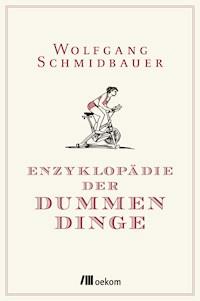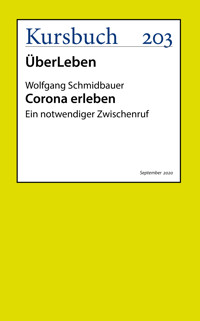9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein unentbehrlicher Leitfaden für alle, die in helfenden Berufen tätig sind. In seinem Buch "Das Helfersyndrom" beleuchtet der renommierte Psychoanalytiker Wolfgang Schmidbauer die besonderen Herausforderungen, denen sich Menschen in helfenden Berufen wie Sozialarbeiter, Therapeuten, Ärzte, Psychologen und Drogenberater gegenübersehen. Ihre Aufgabe ist es nicht nur, zu heilen, zu schützen und zu pflegen, sondern auch dafür zu sorgen, dass diejenigen, die Hilfe benötigen, nicht völlig aus der Gemeinschaft herausfallen. Doch immer mehr Helfer geraten dabei selbst an den Rand ihrer Kräfte. Schmidbauer fasst in diesem Buch die wichtigsten Inhalte seiner drei "Helfer-Bestseller" zusammen und führt zeitgemäß in das Thema ein. Er bietet wertvolle Erkenntnisse aus der Sozialpsychologie und gibt praktische Tipps zur Persönlichkeitsentwicklung und Lebenshilfe für alle, die in einem helfenden Beruf tätig sind. "Das Helfersyndrom" ist ein unverzichtbarer Ratgeber für alle, die anderen helfen und dabei selbst gesund und leistungsfähig bleiben wollen - eine echte Hilfe für die Helfer unserer Gesellschaft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 413
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Wolfgang Schmidbauer
Das Helfersyndrom
Hilfe für Helfer
Über dieses Buch
Ihr Beruf ist es, zu heilen, zu schützen und zu pflegen, aber ihre wahre Aufgabe ist es, mehr zu tun als ihre Arbeit, nämlich darum zu ringen, dass die, die Hilfe benötigen, nicht völlig aus der Gemeinschaft herausfallen. Immer mehr Menschen aus helfenden Berufen geraten dabei selbst an den Rand ihrer Kräfte. Für Sozialarbeiter, Therapeuten, Ärzte, Psychologen, Drogenberater und viele mehr fasst Wolfgang Schmidbauer in diesem Buch die wichtigsten Inhalte seiner drei «Helfer-Bestseller» zusammen und führt zeitgemäß in das Thema ein.
Eine echte Hilfe für Menschen in helfenden Berufen.
Vita
Wolfgang Schmidbauer wurde 1941 geboren. 1966 promovierte er im Fach Psychologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München über «Mythos und Psychologie». Er lebt in München und Dießen am Ammersee, hat drei erwachsene Töchter und arbeitet als Psychoanalytiker in privater Praxis.
Neben Sachbüchern, von denen einige Bestseller wurden, hat er auch eine Reihe von Erzählungen, Romanen und Berichten über Kindheits- und Jugenderlebnisse geschrieben. Er ist Kolumnist und schreibt regelmäßig für Fach- und Publikumszeitschriften.
Außerdem ist er Mitbegründer der Münchner Arbeitsgemeinschaft für Psychoanalyse und der Gesellschaft für analytische Gruppendynamik.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Juni 2023
Copyright © 2007 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Redaktion Hermann Gieselbusch
Covergestaltung Umschlag-Konzept: any.way, Hamburg
Barbara Hanke/Heidi Sorg/Cordula Schmidt
Coverabbildung kieferpix/iStock/Getty Images Plus
ISBN 978-3-644-01123-6
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Einleitung
1 Das Helfersyndrom
2 Beruf, Depression und narzisstische Krise
3 Das abgelehnte Kind
Die Identifizierung mit dem Ich-Ideal (Größenselbst)
Die manische Abwehr
Die Vermeidung von Gegenseitigkeit
Die unersättliche narzisstische (orale) Bedürftigkeit
Die indirekte Aggression
4 Fallgeschichten
Georg
Agnes
Franz
Leonhard
Clemens
Sabine
5 Mehr als helfen wollen
Die Intensität der Abhängigkeit bestimmt das Gewicht einer Abstinenzverletzung
Narzisstische und hedonistische Tätertypen
6 «Das musst du doch verstehen!» Paardynamik und Helfersyndrom
Inszenierte Symbiosen
Der Burnout des Familienvaters
Die narzisstische Bedeutung der Sexualität
Die Störungen in der Aggressionsverarbeitung
Die Geliebte als Sprache
7 Die «neuen» Helfer
Helfen als Droge
Berufsarbeit und Privatleben: Formen der Wechselwirkung
Opfer des Berufs
Spalter
Perfektionist
Pirat
8 «Neue» und «alte» Helfer im Konflikt
Aussteigen und drinbleiben
Die Grenzen des emotionalen Wachstums
Energiekrise im Helfen
Norm und Beziehung
Das Dilemma der Familientherapie
Der Erwachsene als «großes Kind»
Das Kind als kleiner Erwachsener
Das Kind als Objekt der Pädagogik
Das Kind als Erlöser
Anpassungszwang und Sehnsucht nach Liebe
Macht und Ohnmacht der Therapeuten
Zweckrationale Gefühlskontrolle
Die Legitimation des Helfers
9 Helfersyndrom und Mobbinggefahr
Mobbing
Wer gibt, dem wird gegeben
Der kannibalische Narzissmus
Mobbing und manische Abwehr
Im Kindergarten
Die manische, die depressive und die humorvolle Position
10 Burnout
Engel der Helfer
Ausgebrannt?
Anfangsphase
Einbruchsphase
Abbauphase
Kompensierter Burnout
Vom Burnout zur regressiven Entprofessionalisierung
Beispiele
Vor Burnout geschützt?
Literatur
Über den Autor
Einleitung
Das Helfersyndrom ist 2007 dreißig Jahre alt geworden. Peter Jacobs, Pflegedirektor und Fortbilder von Pflegekräften in München, hat mir einmal erzählt, dass er zu fragen pflegt, wer von den Anwesenden den Begriff «Helfersyndrom» kenne. Die meisten melden sich. Fragt er nach dem Buch «Die hilflosen Helfer», melden sich bereits deutlich weniger; den Namen des Autors, der diesen Begriff prägte, weiß kaum einer.
Wie kam ich dazu, das Helfersyndrom zu finden? Ich hatte Psychologie studiert, weil ich mir zu unsicher war, dem Kindertraum zu folgen, «Dichter» zu werden, der sich aus einer langen Zeit alles verschlingenden Lesens ergeben hatte. Aber die unbewusste Tendenz war stärker. Aus einem Studentenjob im Archiv einer medizinischen Zeitschrift wurde seit 1961 eine kleine Karriere als Wissenschaftsjournalist.
Mein Chef, Ildar Idris, der Gründer und Herausgeber von «Selecta», redete mir zu, das Psychologiestudium aufzugeben. Er bot mir eine Stelle als Redakteur an. Aber ich wollte nicht abhängig sein; es widerstrebte mir, etwas Begonnenes abzubrechen. Ich verliebte mich in eine italophile Frau, machte mein Diplom, promovierte und kaufte mit ihr zusammen ein verlassenes Haus in der Toskana. Dort lebte ich zwischen 1966 und 1971 als freier Autor. Die Pressearbeit lieferte Brot und Butter; daneben begann ich, nicht mehr Gedichte, sondern Sachbücher zu schreiben.
1971 beschloss ich, meinen papierwurmartigen Beruf als Science Writer zurückzustellen. Ich wollte doch noch etwas Praktisches mit dem Psychologiestudium anfangen. Mein Eintritt in die Helfer-Welt war recht dramatisch und vermittelte mir Eindrücke, dass es dort recht irrational zugehen kann. Durch meine Artikel und Bücher war Günter Ammon auf mich aufmerksam geworden. Er schmeichelte mir, zog mich in seinen Kreis und belebte den Wunsch, eine analytische Ausbildung zu machen.
Ich fühlte mich in der Welt der Helfer immer ein wenig wie ein Ethnograph. Das mag daran liegen, dass meine frühen Interessen in die Richtung der Kulturanthropologie gingen. Ich hatte im Ausland gelebt, ich hatte über Mythen promoviert und eine Weile meinen eigenen ethnologischen Dilettantismus gegen den der Humanethnologen der Lorenz-Schule gesetzt.[1]
So erschien mir die Welt der Psychotherapeuten, in die ich mit der Absicht geriet, mein theoretisches Wissen durch praktische Kenntnisse in Psychoanalyse und Gruppentherapie aufzubessern, wie ein Dschungel abseits der großen Strömungen der Naturwissenschaft (die ich aus meiner Zeit als Science Writer gut kannte), von einem bunten Gemisch der unterschiedlichsten Stammeskulturen besiedelt. Sie erinnerte an das, was ich über Neuguinea gelesen hatte: Bereits nach einer Tagereise verstehen die Angehörigen des einen Volkes die Sprache des nächsten nicht mehr. Jede Sprachgruppe ist der festen Überzeugung, dass jenseits der Berge mit der eigenen jede Zivilisation endet und ein Reich der Dämonen beginnt.
Nachdem ich in meiner Dissertation[2] Mythologie und Dogmatik der einzelnen psychotherapeutischen Glaubensrichtungen studiert hatte, kam ich nun mit dem konkreten Verhalten der Helfer in Berührung. Ich war Reporter genug geblieben, um zu erkennen, dass die offenkundigen Widersprüche zwischen dem Glaubensbekenntnis und der Lebenspraxis ein interessantes Thema boten. Es wiederholte sich, was mich bereits als Kind, sobald ich anfing, die frommen Katholiken meiner Passauer Heimat genauer zu beobachten, ebenso gefesselt wie dem katholischen Glauben entfremdet hatte: Verhalten und Verhaltensbegründungen passten nicht zusammen.
Da hatte ich den psychosozialen Helfern, die doch wissenschaftlich fundiert und weltlich arbeiteten, etwas anderes zugetraut. Ich dachte, dass Ärzte besonders gesund leben müssten, dass Pädagogen sich gerne anderen Erziehern aussetzen und Therapeuten, die doch die Wohltat des offenen Ausdrucks preisen, bereitwillig über ihre Gefühle sprechen. Jetzt war es aber wieder ähnlich, ja noch krasser, denn die Religion hatte viele Bilder für die menschliche Schwäche angesichts des Erhabenen, die Helfer aber verstummten hilflos, wenn es um die Anwendung ihrer eigenen Aussagen auf sie selbst ging. So kam ich auf das Bild des hilflosen Helfers, und es wurde zu meiner Arbeitshypothese, dass Menschen manchmal deshalb Helfer werden, weil es ihnen so schwer fällt, sich helfen zu lassen. Aus diesem Grund delegieren sie Abhängigkeit nach außen, an ihre Schützlinge.
Es gehörte zur Ausbildung bei Ammon, dass Anfänger sehr schnell und ungeschützt praktizieren sollten. So arbeitete ich schon seit 1973 selbst mit Gruppen und suchte Kontakt zu anderen Therapeuten, deren Gemeinsamkeit vor allem ihre Distanz zu den etablierten Therapieausbildungen war, die wir als zwanghaft, verschult, kurzum als reaktionär ablehnten. Damals lernte ich durch Günter Ammon auch Siegfried Gröninger kennen, einen schillernden Charakter mit großem Organisationstalent.
Es war eine bewegte und bewegende Zeit, in der ich Illusionen über die Möglichkeiten, durch Gruppenanalyse «befreite Gebiete» in einer repressiven Gesellschaft zu schaffen, aufbaute und wieder revidierte. Gröninger motivierte Ammon, in München ein eigenes Institut aufzubauen. Ammon wusste ebenso wenig wie ich, worauf er sich da eingelassen hatte.
Nach etwas über einem Jahr hatte Gröninger eine Gruppe um sich gesammelt und dazu gebracht, sich von Ammon wieder zu trennen, dessen tyrannische Ansprüche nicht nur mir die Nähe zu ihm ebenso verleideten, wie er mich angezogen hatte, solange ich ihn nur aus seinen Schriften kannte.
So wurde ich 1972 Gründungsmitglied und eine Weile auch Vorstand in zwei analytischen Instituten. Als der Autor an Bord erfand ich die Namen («Gesellschaft für analytische Gruppendynamik» und «Münchner Arbeitsgemeinschaft für Psychoanalyse», abgekürzt GaG und MAP). Ich schrieb die ersten Ausbildungsordnungen nach unseren Vorstandsbeschlüssen. Es kennzeichnet die Dynamik von Institutionen, dass meine damaligen Texte drei hektographierte Seiten umfassten, während heute unsere Ausbildungsrichtlinien einen Schnellhefter mit zweihundert Seiten füllen.
Beide Institute haben sich im Lauf der Zeit die Anerkennung der Dachverbände beziehungsweise der Ärzte- und Psychotherapeutenkammern erkämpft. Vom Nutzen der Gruppenarbeit in Therapie und Erwachsenenbildung wurde ich bleibend überzeugt. Nach rund zehn Jahren gab ich meine Ehrenämter in den Vorständen auf und wandte mich wieder verstärkt dem Schreiben zu. Die therapeutische Praxis habe ich behalten und empfinde sie als große Anregung für meine Arbeit als Autor.
Meine psychoanalytische Selbsterfahrung absolvierte ich außerhalb des Ammon-Kreises, bei Edmund Frühmann und Hans Günther Preuss. Das trug dazu bei, dass ich die Trennung von Ammon gelassener hinnahm als er, der mir alle Geschenke zurückschickte und alle Widmungen in seinen Büchern tilgte.
Der Widerspruch zwischen Ammons nach außen deklarierter souveräner Helfer-Fassade und einer kindlichen Kränkbarkeit und Ansprüchlichkeit dahinter hatte mich gerade deshalb irritiert, weil er der erste Analytiker war, den ich persönlich kennenlernte, der mich in der Toskana besuchte und mit mir diskutierte. Ich sah, wie dieser Kritiker des psychoanalytischen Establishments zwar die Scheinheiligkeit anderer aufdeckte, aber in dieser vermeintlichen Entlarvung an eigenen Fassaden bastelte, hinter die auch er nicht blicken lassen wollte. Ich habe noch öfter miterlebt, wie schnell in alternativen Gründungen die Ausgrenzungsmechanismen und Richtungskämpfe einsetzen, die man anfangs den Rivalen angekreidet hatte.
In den siebziger Jahren war die persönlichkeitsorientierte Fortbildung eine große Innovation in den sozialen Berufen. Daher wurde die von Gröninger und mir geleitete Ausbildung von analytischen Gruppenleitern für Selbsterfahrungsarbeit in der GaG ein großer Erfolg. Ich verbrachte viele Wochen dieser Jahre damit, Selbsterfahrungsgruppen zu leiten, in denen Lehrer, Sozialpädagogen, Psychologen und Ärzte «etwas für sich tun» wollten. Dabei schälte sich ein bestimmter Menschentypus, eine spezifische Charakterstruktur heraus, die ich erst das «soziale Syndrom» und später das Helfersyndrom nannte.
Das Buch «Die hilflosen Helfer» erschien 1977. Der Reformoptimismus der Achtundsechziger verebbte. Die Bewegung hatte sich zersplittert, auf dem langen Marsch durch die Institutionen aufgezehrt. Ich war bis 1970 die meiste Zeit in Italien, in einer ländlichen Idylle gewesen und hatte mich nur theoretisch mit der Studentenbewegung (die ein Jahr nach meinem Examen einsetzte) beschäftigt.
Der Erfolg des Buches überraschte mich sehr. Ich hatte bisher zwölf Bücher veröffentlicht, durchaus achtbare Erfolge, einige waren in verschiedene Sprachen übersetzt worden, und dasselbe Schicksal erwartete ich auch von diesem Text. Ich hatte ihn als einen Werkstattbericht verstanden. Es ging um Fragen, die sich aus der Arbeit ergaben, in die ich hineingestolpert war: Was sind die problematischen Anteile an den Beweggründen, anderen zu helfen? Wie hängen sie mit der Gesellschaft und mit den Institutionen zusammen, welche das Schicksal der Samariter von heute prägen?
«Die hilflosen Helfer» hatten die Stärken und Schwächen des Autors, der den Psychoanalytiker und den Schriftsteller in sich trägt und nicht immer vereinen kann. Für ein populäres Sachbuch setzte der Text zu viele psychoanalytische Kenntnisse voraus; für die Rezensenten der wissenschaftlichen Zeitschriften war er zu allgemein und zu wenig empirisch und statistisch abgesichert.
Aber die wichtigste Gruppe für einen Autor sind die Leser, die ein Buch kaufen. Und diese gab es reichlich. 1987 sollte ich als Vorredner Daniel Cohn-Bendit in den Münchner Kammerspielen vorstellen. Er sprach dort in einer Reihe der «Reden über Deutschland», die vom Kulturreferat und der Bertelsmann-Stiftung organisiert waren. Auf der Bühne war eine Couch aufgebaut, und Cohn-Bendit bezog sich darin ironisch auf mich, «den hilflosen Helfer Schmidbauer».
Nachher scherzte er mit mir, «Die hilflosen Helfer» seien für ihn ein Trauma, weil er 1977 in einer Buchhandlung gearbeitet habe und jeder zweite Kunde entweder die «Häutungen» von Verena Stefan oder eben das Helferbuch kaufen wollte.
Ende der siebziger Jahre gab es in Deutschland eine große Gruppe engagierter junger Sozialberufler. Sie waren durch die Studentenbewegung geschult, hatten Marx und Freud gelesen, die psychoanalytische Sozialpsychologie an den Texten von Horst Eberhard Richter, Michael Lukas Moeller und Tilmann Moser kennengelernt. Sie waren bereit, nun nicht mehr nur über die Probleme ihrer Klienten, sondern auch über ihre eigenen nachzulesen. Die Fortführung der Freiheitsrechte nach innen, mit der sich die Studentenbewegung geplagt hatte, führte zu einem lebhaften Interesse an den verborgenen Hintergründen alltäglicher Emotionen, Leidenschaften und Ängste. Es durfte gefragt werden.
So fühlten sich jene Helfer nicht von mir «verstanden», die es unerträglich finden, wenn ihre Aufopferung nicht schlechthin für gut befunden wird. In den Rezensionen des Helfer-Buches ließen sich jene primitiven narzisstischen Reaktionen verfolgen, wonach der Bote für die Botschaft bestraft wird: Was soll, fragten einige, aus den jungen Sozialarbeitern und Krankenschwestern werden, wenn ihnen der Selbstverdacht auf das Helfersyndrom das spontane Engagement verdirbt?
Christa Meves, Herausgeberin des «Rheinischen Merkur», warf mir vor, den Helfern Steine statt Brot zu geben; jedenfalls machte sie so sehr deutlich, wer von uns beiden Gott näher steht. Ein Monsignore und leitender Angestellter der Caritas erhielt heftigen Beifall, als er auf einer Tagung bemerkte, er habe zwar das Buch über die hilflosen Helfer erworben, es aber dann ungelesen in den Schrank gestellt.
Der Verwaltungsdirektor eines großen Krankenhauses sagte auf dem «Tag der Krankenschwester» in Salzburg nach meinem Festvortrag zwischen Mozarts Dissonanzquartett und einem kalten Büfett, er sei erst kürzlich als Patient in seiner eigenen Klinik gelegen und habe keine Spur des Helfersyndroms bei seinem Personal entdeckt. Nachher setzten sich einige Lehrschwestern an meinen Tisch und erklärten mir, warum sie mich eingeladen hatten und warum es besser sei, in der Diskussion zu schweigen. Irgendwo spricht mich ein bärtiger Sozialarbeiter an. Ihm habe sein Beruf immer Spaß gemacht, ob ich das etwa für nicht normal halte? Und immer, immer wieder die drei Fragen: «Habe ich das Helfersyndrom? Woran bemerke ich es? Was kann ich dagegen tun?»
Ich habe manchmal versucht, sie durch eine Metapher zu beantworten: «Habe ich einen Ödipuskomplex? Wenn ja, woran bemerke ich ihn? Und was kann ich dagegen tun?»
Aber auch ein solcher Vergleich wird nur von Menschen verstanden, die etwas über Psychoanalyse wissen und sich damit befreunden können, dass es Grundkonflikte gibt, die sich nicht auflösen lassen. Wenn wir unter Ödipuskomplex die prägenden Verletzungen unserer Kindheit verstehen, dann wird uns vielleicht deutlicher, dass wir beispielsweise das Aufwachsen ohne Vater oder Mutter, die Kränkung, dass uns ein Geschwister vorgezogen wurde, oder die Rolle des Außenseiters in einer sozialen Gemeinschaft nicht in dem Sinn bewältigen können, dass alle damit verknüpften Probleme verschwinden. Aber unsere Einsichten in diese frühen Schicksale helfen uns wahrscheinlich, gelassener mit dem zu leben, das unseren Versuchen widersteht, es aus der Welt zu schaffen.
Aus eben diesem Grund finde ich die sperrige Qualität des Begriffs vom hilflosen Helfer nicht nur von Übel. Das Helfersyndrom zwingt, etwas in Frage zu stellen, das sonst fraglos bleiben kann, und ist damit ein Versteck für eine verleugnende Sichtweise, ein Asyl für (Selbst-)Betrug und ausbeutende Rede («das Wohl der Schüler ist unser oberstes Gebot»). Da so unendlich vieles in unserem Leben und in unserer Kultur verwendet wird, um uns vor Ängsten zu schützen und Kränkungen abzuwehren, wird auch eine solche Komponente im Verhalten von Helfern nachweisbar sein.
Was ich mit dem Ausdruck vom «Helfersyndrom» meinte, war immer nur ein Motiv unter mehreren verschiedenen, freilich auch eines, das aufgrund seiner Verbindung mit Verdrängungen und unbewussten Abwehrmechanismen für emotionale Konflikte und psychohygienische Probleme im helfenden Beruf besonders wichtig werden kann. Aber menschliche Hilfsbereitschaft ist ein viel weiteres Feld; wir beobachten sie bereits bei kleinen Kindern, die gar keine neurotischen Konflikte haben können, welche denen des Erwachsenen vergleichbar sind.
Es ist eine wissenschaftlich unbeantwortbare Frage, ob das menschliche Leben einen Sinn hat; andererseits ist nicht zu leugnen, dass viele Menschen gerade mit dem Helfen starke Erlebnisse von Sinnhaftigkeit verbinden. In den Aussagen über den gewählten helfenden Beruf findet sich sehr oft der Satz: «Ich will etwas Sinnvolles tun!»
Die Problematik des Helfersyndroms, also des Helfens aus einer unbewussten Abwehr heraus, hängt nicht an dieser Sinnhaftigkeit, sondern daran, dass andere Erlebnisformen vermieden und die Welt zwanghaft auf das Helfen eingeengt ist, nicht selten auf Kosten der Einfühlung.
Der hilflose Helfer gleicht einer überbeschützenden Mutter, die ein Kind, das längst essen kann, immer noch füttert. Wenn es sich weigert und selbst den Löffel führen möchte, versorgt sie lieber das arme hungrige Geschöpf mit einer Magensonde, als die eigene übermäßige Fürsorge in Frage zu stellen. Die Sprache hat ein feines Empfinden für diese Gefahr der Entgleisung unserer Hilfsbereitschaft – «ich werde dir schon helfen» ist kein freundliches Angebot, sondern eine Drohung, die Absichten ausdrückt, Macht auszuüben.
Was es sehr erschwert, die innere Struktur helfender Motive bei Erwachsenen zu erkennen, scheint die Durchdringung verschiedener Schichten von Motiven. Abwehr und Spontaneität lassen sich nicht säuberlich trennen, sondern treten gemeinsam auf, ergänzt durch die verschiedensten Einflüsse aus der persönlichen Lebensgeschichte und der sozialen Umwelt.
Helfern und Schützlingen wäre am besten gedient, wenn Helfer grundsätzlich dann nicht mehr arbeiten müssten, wenn ihre emotional getragene, spontane Hilfsbereitschaft versiegt ist. Sie sind dann nicht mehr fähig, leidenden oder unsicheren Personen Sicherheit und Geborgenheit zu vermitteln, weil sie sich nicht einfühlen können und selbst zu viel brauchen, um anderen etwas abzugeben. Jeder von uns hat seine Erfahrungen mit Lehrern, Ärzten oder Pflegenden, welche ihre emotionalen Ressourcen erschöpft haben. Sie fühlen sich unentbehrlich oder sehen sich finanziellem Druck ausgeliefert, haben aber den inneren Bezug und die Einfühlung in ihre Schützlinge verloren.
Wenn wir eine Ursache für solche Missstände suchen, entlastet es die Institutionen und die Presse von gründlichem Nachdenken, wenn wir einen persönlichen Faktor konstruieren. Die betreffenden Lehrer, Ärzte, Pflegerinnen sind nicht für den Beruf geeignet. Wenn jetzt noch jemand das Helfersyndrom als diese Ursache einführt, ist das Missverständnis komplett und der Begriff unbrauchbar geworden. Daher will ich jetzt noch einmal und hoffentlich auch für Nichtpsychologen verständlich ausführen (und wiederholen), was mit diesem Begriff gemeint ist, wo er nützen kann und was er nicht zu leisten vermag. Das Helfersyndrom ist ein dynamischer, ein biographischer Begriff, gewiss keiner, der einfache Unterscheidungen ermöglicht.
Das Bedürfnis nach einfachen Erklärungen wird gegenwärtig mächtiger, weil die modernen Gesellschaften so kompliziert und vielschichtig bestimmt sind, dass uns ihre Undurchschaubarkeit ängstigt. Wer etwa den Spiegel liest, bewundert die Sachkunde und Redegewalt der Reporter. Er fühlt sich präzise und umfassend informiert – genau so lange, bis das Journal ein Thema behandelt, von dem er wirklich etwas versteht. Auf einmal kann er den Verdacht nicht abweisen, dass der Reporter längst nicht so gut informiert ist, wie er uns glauben macht, dass er Triviales als Einsicht handelt und Sprüche klopft.
Daher ist es kein lästiger Zufall, sondern ein ernstes Problem, wenn Begriffe ihre differenzierende Qualität verlieren und zum Schlagwort verkommen. Es wäre schön, gute Helfer ohne und schlechte mit Helfersyndrom durch einen einfachen Test zu unterscheiden, die ersten zu engagieren, die zweiten entweder in die Fortbildung oder in den Ruhestand zu schicken. Aber das ist Unsinn, die Gründe sind vielschichtig, weshalb in manchen Bereichen aus engagierten und einfühlenden Berufsanfängern so viel schneller ausgebrannte Routiniers werden. Die unbewusste Komponente in der Helfermotivation spielt hier nur eine Rolle unter vielen, freilich eine, die für eine persönliche Auseinandersetzung fruchtbar werden kann.
Das Helfersyndrom ist ein Konzept gegen den Strich einer kulturellen Korrektheit, die uns weismachen will, es würde den Menschen gut bekommen, wenn das Gute ganz gut ist und das Schlechte ganz schlecht. Ferner sei es simpel, beides zu unterscheiden, man müsse sich nur den Normen fügen. Dass dem nicht so ist, haben Künstler, Dichter und Erzähler immer genauer gewusst als Priester, Erzieher und Techniker. Es ist das immer noch nicht von der wissenschaftlichen Öffentlichkeit ganz gewürdigte Geschenk Freuds an die Psychologie, dass wir nicht nur erzählen dürfen, sondern es sogar müssen, wenn wir nicht wesentliche Faktoren in unserer Seele ignorieren wollen.
Nach naivem wissenschaftlichem Verständnis wäre ein Trauma schädlich. Aber das Helfersyndrom zeigt, dass aus ihm etwas Gutes entstehen kann, dass aber dieses Gute in Gefahr ist, das Trauma neu zu inszenieren – und dass erst die Beschäftigung mit der Geschichte einer Person, mit ihren Prägungen und den Bedingungen, unter denen sie lebt und arbeitet, uns hilft, hier mehr Klarheit zu gewinnen.
1Das Helfersyndrom
Syndrom im Wortsinn ist das «Zusammenlaufen» verschiedener Merkmale zu einem Bild, einem (krankhaften) Prozess. Wenn zum Beispiel gesagt wird, ein Patient leide an einem Korsakow-Syndrom, dann bedeutet das nicht nur, dass sein Gehirn, meist durch chronischen Alkoholkonsum, geschädigt ist, sondern dass er diese Störung auch in einer bestimmten Weise zu kompensieren sucht: Die Patienten können sich nichts merken, schämen sich dessen und erfinden daher Geschichten, um ihr Versagen zu verschleiern. Erinnerungsunfähigkeit (Amnesie) und Lügenerfindung (Konfabulation) kommen also zusammen und charakterisieren den Zustand des Korsakow-Syndroms, benannt nach dem russischen Psychiater Sergei Korsakow (1854–1900).
Einige Anekdoten, um das Helfersyndrom im Erleben anschaulich zu machen:
«Ich wollte endlich mal wieder mit einer Frau schlafen. Deshalb bin ich nachts in die Straße gefahren, wo die Prostituierten stehen. Als ich dort war und an ihnen vorbeifuhr, war mir übel und mein Herz klopfte. Ich dachte, ich bin impotent, und fuhr vorbei. Da sah ich eine Frau, die eine Panne hatte. Als ich anhielt und ihr meine Hilfe anbot, war ich wieder ruhig und sicher. Es ist schon eine verfluchte Rolle, die ich da spiele.» (Ein 32-jähriger Arzt)
«Wenn ich Menschen kennenlerne, dann setze ich mich sehr für sie ein. Meist haben sie Probleme, ich höre mir das an und arbeite mit ihnen an einer Lösung, unterstütze sie. Und wenn dann das Problem überstanden ist, höre ich nichts mehr von ihnen. Ich bin dann schwer enttäuscht und denke, du schaffst es einfach nicht, eine Beziehung aufzubauen!»
«Sprechen Sie von Ihren Klienten?»
«Nein, natürlich nicht, von privaten Bekannten, von Männern, die ich so kennenlerne. Von den Familien, die ich betreue, würde ich mir ja nie so etwas wie Dank erwarten!» (Eine 40-jährige Sozialarbeiterin)
Schätzenswerte menschliche Eigenschaften verlieren nicht an Wert, wenn wir ihr Zustandekommen untersuchen. Es geht nicht darum zu zeigen, dass auch dem Helfen-Wollen ein «letzten Endes egoistisches Motiv» zugrunde liegt. Die Unterscheidung, welches Verhalten als altruistisch, welches als egoistisch zu bewerten ist, orientiert sich an der Kultur, in der wir leben.
Die beiden Beispiele beleuchten die Abwehrqualität des Helfens: Der Mann schämt sich der erniedrigten Form sexueller Befriedigung und beruhigt sich, sobald er etwas tun kann, was sein Gewissen hoch schätzt. Die Frau hat kein Gefühl dafür, dass private Beziehungen anders sind als professionelle und dass sie in diesen Beziehungen auch etwas anderes wünschen sollte als im Beruf.
Das Helfersyndrom ist die zu einem Teil der Persönlichkeitsstruktur gewordene Unfähigkeit, eigene Gefühle und Bedürfnisse zu äußern, verbunden mit einer scheinbar unangreifbaren Fassade im Bereich sozialer «Dienste» und latenten Allmachtsphantasien.
Unsere Persönlichkeitsstruktur entspricht in der psychoanalytischen Psychologie einer Abwehrorganisation, mit deren Hilfe das Ich versucht, einen realistischen Weg zwischen den Triebwünschen, den Über-Ich-Geboten und der Realität zu finden. Diese Psychologie geht von einem beschreibenden, hermeneutischen Wissenschaftsmodell aus und beruht letztlich auf der Überzeugung, dass eine experimentell und statistisch orientierte Forschung den Menschen nicht erfassen kann, sosehr wir ihre Ergebnisse brauchen, um nicht ins Beliebige zu spekulieren.
Der praktische Nutzen einer Beschäftigung mit dem Helfersyndrom liegt darin, die seelische Hygiene der Helfer zu verbessern und eine stabile Motivation aufzubauen.
«Früher habe ich mich oft schier zerrissen und hatte doch das Gefühl, ich tue nicht genug und erreiche nichts. Wenn um Mitternacht ein Anruf kam, bin ich hingegangen und habe mit den Leuten geredet. Ich dachte einfach, ich darf nicht nein sagen, wenn es jemandem schlecht geht. Aber ich konnte das Gefühl nicht loswerden, dass meine Klienten das ausnützten … Seit ich die Ausbildung gemacht habe, vor allem auch die Einzelanalyse, habe ich das geändert. Ich sage jetzt zu solchen Anrufern, sie sollten sich während der Dienstzeit an mich wenden. Da kann ich dann voll für sie da sein, weil ich ausgeschlafen und nicht insgeheim wütend bin. Solche Gefühle hätte ich mir früher überhaupt nicht eingestanden. Ich dachte, ich muss immer nur für die anderen da sein. Aber daran ist auch die Ausbildung schuld. Man lernt, nichts als die höchsten Ansprüche an sich zu stellen, und kriegt kaum konkrete Mittel in die Hand, um auch etwas zu erreichen.»
Ich erinnere mich noch an die Sozialarbeiterin, deren Aussage ich gern als Beispiel für eine bessere Arbeitshygiene infolge der Auseinandersetzung mit dem Helfersyndrom zitiere. Sie hatte in der GaG eine Ausbildung absolviert und arbeitete mit mir als Koleiterin in einer der Selbsterfahrungsgruppen, die wir damals im Rahmen von Fortbildungen für die Mitarbeiterinnen der bayerischen Jugendfürsorge anboten.
Solche Situationen sind nach wie vor aktuell, obwohl gerade Sozialpädagogen heute sehr viel stärker zur Reflexion über ihre Berufsmotivation angeleitet werden. Eine Dozentengeneration, die sich mehr oder weniger intensiv mit Gruppenselbsterfahrung auseinandersetzte, hat ihre Spuren hinterlassen; Supervisionen in diesem Arbeitsfeld tun ein Übriges, um vor Ort Burnouterscheinungen zu bekämpfen und die Betroffenen dabei zu unterstützen, ihre professionelle Rolle zu finden.
Das Burnoutproblem ist heute sehr viel stärker in der Alten- und Krankenpflege angesiedelt. Hier gibt es noch große Defizite an Distanz von einer naiven Helfermoral, in der Aufopferung und Härte ebenso unreflektiert gedeihen wie unprofessionelle Wehleidigkeit. («Die böse alte Frau hat mich angespuckt! Zu der gehe ich nicht mehr ins Zimmer. Das kann mir niemand zumuten. Ich bin doch nicht Altenpflegerin geworden, um mich anspucken zu lassen!»)
Aber in der Analyse des Helfersyndroms ist Burnout nur eine von vielen Anwendungen. Natürlich brennt schneller aus, wer nicht gelernt hat, zwischen realistischen und perfektionistischen Ansprüchen an die eigene Berufsmotivation zu unterscheiden. Aber die fesselnde Perspektive angesichts des hilflosen Helfers ist dessen Scheitern in der Anwendung seiner Einsichten und seiner Wertvorstellungen auf das Nächstliegende: auf die eigene Person.
In keiner Berufsgruppe werden eigene (psychische) Störungen so vertuscht und bagatellisiert wie in jener, die unmittelbar mit der Behandlung solcher Störungen befasst ist. Schwäche, Hilflosigkeit, das offene Eingestehen emotionaler Probleme werden nur bei anderen begrüßt und unterstützt, während das eigene Selbstbild von solchen «Flecken» frei bleiben soll.
Vor sechzig Jahren hat die amerikanische Arzneimittelfirma Parke-Davis Fragebögen an 10000 Ärzte verschickt, um deren Gesundheitszustand zu erforschen. Es zeigte sich, was nicht untypisch ist für dieses Verfahren: Es ermittelt eine Wunschvorstellung von der Realität. Von den Befragten bestätigten nur 0,5 Prozent, dass sie an seelischen Störungen litten. Das Idealbild des allen Aufgaben gewachsenen Arztes hatte sich als mächtiger erwiesen als die Wirklichkeit. Ärzte werden in Wahrheit erheblich häufiger in psychiatrische Kliniken aufgenommen als die Durchschnittsbevölkerung.
M.F. Brooks und seine Mitarbeiter gingen in England Einweisungen von Ärzten in Nervenkrankenhäuser nach. Es zeigte sich, dass in einer Klinik einer von 82, in einer anderen sogar einer von 46 Patienten Mediziner war – also ein erheblich höherer Prozentsatz als in der Durchschnittsbevölkerung.[3]
In dieselbe Richtung weist eine prospektive Arbeit von G.E. Vaillant und Mitarbeitern.[4] Diese verglichen eine Gruppe von 47 Studenten der Medizin von deren Eintritt in die Universität an mit einer Gruppe zufällig ausgewählter Studenten anderer Fächer. Es zeigte sich, dass von den Ärzten 47 Prozent schlechte Ehen hatten oder sich scheiden ließen, 36 Prozent psychoaktive Medikamente und/oder Alkohol beziehungsweise Rauschdrogen konsumierten, 34 Prozent sich in psychotherapeutische Behandlung begaben und 17 Prozent mindestens einmal in einer Nervenklinik behandelt wurden. Alle diese Zahlen lagen signifikant über denen der Kontrollgruppe. Fazit: Ärzte sind seelisch stärker belastet als der Durchschnitt der Akademiker.
Charakteristisch für die unbewusste Dynamik des Helfersyndroms ist der Traum eines 30-jährigen Arztes:
«Ich war mit einer Gruppe anderer Kandidaten vor dem Haus von Dr. A., unserem Lehranalytiker. Wir sollten eine Glocke an dieses Haus montieren. Ich sehe noch die hohen, aus Kalkstein gemauerten Wände vor mir. Die Sache mit der Glocke klappte aber nicht gut. Wir brauchten noch Material, Seile und so. Deshalb ging ich zu einem Schuppen in der Nähe. Als ich herankam, hörte ich in dem Schuppen ein leises Weinen. Ich öffnete die Tür. Da sah ich etwas ganz Schreckliches: Ein halb verdurstetes, abgemagertes Kind, ganz verdreckt und mit Spinnweben überzogen, steckte eingeklemmt zwischen dem Gerümpel.»
In diesem Traum wird der Gegensatz zwischen erstrebter Geltung (die Glocke für den mächtigen Boss) und den abgespaltenen, unansehnlichen, kindlich gebliebenen und verwahrlosten Bedürfnissen deutlich. Die Fassade sagt: «Ich bin großartig, ich gebe!» Das Kind sagt: «Ich bin ausgehungert und drohe zu verschmachten, ich muss mich verstecken.»
Der Helfer gibt und ist stark; der Schützling ist schwach und auf den Helfer angewiesen. Die Asymmetrie dieser Situation wird für den hilflosen Helfer zur Droge – und wenn er aus ihr nicht genügend Erlebnisse von Erfolg und Bestätigung schöpfen kann, ist der Helfer sehr gefährdet, drogenabhängig zu werden.
Man erklärt manchmal die Häufigkeit von Drogenabhängigkeit in den Helferberufen mit der leichten Erreichbarkeit von Opiaten und Psychopharmaka für Ärzte und Pflegepersonal. Aber diese Erklärung reicht nicht aus, zumal auch Alkoholabhängigkeit häufiger ist als in der Durchschnittsbevölkerung. Es geht wohl eher darum, dass bereits die Berufswahl Abwehrbedürfnisse enthält.
Während in der Bevölkerung auf 600 Nichtärzte ein Arzt kommt, sind es unter den Entlassenen einer Suchtklinik nur 50 Nichtärzte auf einen Arzt. In Vaillants Material benutzten über 30 Prozent der untersuchten Ärzte regelmäßig Psychopharmaka, Alkohol in hohen Dosen oder Drogen. Mindestens ein Prozent der amerikanischen Ärzte ist rauschgiftabhängig, was bei Akademikern sonst sehr selten vorkommt, erläutern H.C. Modlin und A. Montes in einer Untersuchung über Sucht bei Ärzten.[5]
Die Mediziner rechtfertigen ihren Drogenmissbrauch mit Überarbeitung, dauernder Müdigkeit oder körperlichen Erkrankungen. Die Forscher kommen zu anderen Ergebnissen: Sie sprechen von einer «oralen Persönlichkeit», die sich bereits vor Beginn der Sucht bemerkbar mache. Die inneren Widersprüche dieser Persönlichkeit lassen sich mit dem Bild von der Fassade und dem verwahrlosten Baby darstellen: Eigene Bedürfnisse nach Versorgung durch Zuwendung und offenes Geben und Nehmen von Gefühlen werden nicht angemessen befriedigt, weil die Helfer starr auf die Rolle der Autorität festgelegt sind.
Da Abhängigkeit und Bedürftigkeit schambesetzt sind und vom bewussten Erleben wenig zugelassen werden, bleiben die entsprechenden Bedürfnisse auf einer primitiven, wenig entwickelten Stufe. Im Helfersyndrom spitzen sich Entwicklungsmerkmale der individualisierten Gesellschaften zu, in denen die persönliche Leistung zum Gradmesser von sozialer Anerkennung wird. Der hilflose Helfer kompensiert durch seinen beruflichen Übereinsatz Gefühle innerer Leere und Wertlosigkeit, welche durch seine Armut an Ausdrucksmöglichkeiten und emotionalem Austausch mit anderen Menschen entstehen.
Die Dynamik ist die des Teufelskreises, der Verstärkung des «Bösen» durch seine Folgen: Wer sich unantastbar und überlegen gibt, verliert an mitmenschlicher Nähe; wer dann seine Sehnsüchte nach Kontakt mit Drogen betäubt, vereinsamt noch mehr.
Wer in ein armes Land reist, dessen Traditionen noch einigermaßen intakt sind, wundert sich oft, wie fröhlich und auf einander (ebenso wie auf den Fremden) bezogen die Menschen dort sind. Sie verpassen kaum eine Gelegenheit, sich emotional auszutauschen, miteinander zu lachen, eine kleine Spielszene aufzuführen. Wenn der Besucher die Sprachbarriere überwinden kann und einen Indio-Bauern oder einen Jemeniten noch zusätzlich erheitern will, muss er ihm nur erzählen, wogegen er in seinem Land versichert ist.
Diese Beobachtung passt zu dem klinischen Befund, dass in den reichen Ländern Depressionen und Ängste sehr viel häufiger sind. Wer sich am Hunger orientiert, kann sein Leben leichter strukturieren als jemand, der Sicherheit sucht und sich daher an der Angst orientiert, diese zu verlieren.[6]
Alltagsverhalten und Depressionsneigungen hängen mit dem Kindheitsschicksal zusammen: In einem armen Land werden Kinder sehr viel stärker in einen emotionalen Austausch mit Spielkameraden und Erwachsenen einbezogen. Wo es nur wenige Dinge und wenige Möglichkeiten zu langfristiger Planung gibt, öffnen sich Räume für eine sozusagen rollenfreie menschliche Kommunikation.
Wenn ich an einem deutschen Arbeiter vorbeigehe, der in einer Baumkrone Äste absägt, tauscht er mit mir keinen Blick, und wenn er es tut, reagiert er nicht auf meinen Blick. Als wir im Jemen an einem Mann vorbeigingen, der in einer Baumkrone arbeitete, bemerkte er sofort unsere Blicke, lächelte, schwang triumphierend die kleine Axt, mit der er arbeitete.
Diese rollenfreie Kommunikation scheint mir ein wesentliches Antidepressivum. Wer sie beherrscht, fühlt sich von seinen Mitmenschen sozusagen energetisch versorgt; wem sie fehlt, der wird immer missmutiger und sperrt sich immer mehr gegen sie ab.
Der oralen Persönlichkeit sind gewissermaßen die Saugwurzeln verloren gegangen, mit deren Hilfe andere Erwachsene aus ihren mitmenschlichen Beziehungen genügend Befriedigung gewinnen. Die narzisstischen Ansprüche wachsen, weil sie nicht befriedigt werden können. Sie müssen verdrängt werden, weil sie jetzt als übermäßig und unangemessen erlebt werden.
In der «modernen» psychiatrischen Theorie der Depression überwiegt ein primitives genetisches und biochemisches Modell, wonach Personen mit ungünstigen Erbanlagen irgendwann an einem Mangel an Botenstoffen erkranken, der durch Medikamente behoben wird.
Dies ist eine Erklärung von Depressiven für Depressive, von Helfern, die ihre Fassade noch halten können, für andere, die dazu nicht mehr in der Lage sind. Sie lenkt von gesellschaftlichen Problemen und psychologischen Lösungen ab. Nebenbei verkauft sie die Kranken an die pharmazeutische Industrie.[7]
Der hilflose Helfer kann die einfühlende Zuwendung, die anderen Menschen eine Entwicklung ihrer Fähigkeit zum emotionalen Austausch und zur rollenfreien Kommunikation ermöglicht hat, so wenig nachträglich erfahren, wie ein Vierzigjähriger an der Brust seiner Mutter satt werden kann. Daher ist es für ihn mühsam und langwierig, andere Formen der Kommunikation aufzubauen und emotionale Beziehungen zu gestalten, in denen er nicht nur kontrolliert gibt, sondern auch lebendig nimmt.
Wer seine innere Leere durch Suchtmittel «füllt», kann sich kurzfristig über seine Mangelsituation trösten, wird aber langfristig diese noch verschlimmern. Der drogenabhängige Helfer ist sozusagen eine extreme Variante des hilflosen Helfers, der seine berufliche Rolle süchtig lebt und sich dem alkoholkranken Kollegen weit überlegen fühlt, weil für ihn die Arbeit allein reicht, um seine Selbstgefühlsdefizite zu kompensieren. Es liegt nahe, Bert Brechts rhetorische Frage abzuwandeln: Was ist die eigene Drogenabhängigkeit, verglichen mit der Gründung einer Klinik für Suchtkranke.
Die naive Frage «Habe ich ein Helfersyndrom oder nicht?» sollte also erst einmal durch die Frage nach dem Schweregrad und der Ausprägung der entsprechenden Selbstgefühlsprobleme ersetzt werden. In der Analyse einer konkreten Biographie spielen dann noch die Möglichkeiten eine Rolle, die Selbstgefühlsstörungen auszugleichen.
Der biographische Ansatz der Psychoanalyse wirkt zwar angesichts der Bedürftigkeit für schnelle Lösungen umständlich, vertieft aber die Einsicht in Entwicklungen und ermöglicht es immer wieder, sonst Unverständliches zu verstehen. Wenn ein Helfer depressiv wird, wäre es unsinnig, diesen Burnout allein dem Helfersyndrom zuzuschreiben, ebenso unsinnig aber auch, dieses als Risikofaktor zu ignorieren. Im Alltag begegnen uns Mosaike aus Störung und Kompensation. Mit Willenskraft und Disziplin kann sich ein hilfloser Helfer «normal» verhalten; wenn er immer wieder Magenschmerzen, Bandscheibenvorfälle und Allergien hat, schreibt er das seinen schlechten Erbanlagen zu.
Eine liebevolle und aufmerksame Vorgesetzte kompensiert die durch das Helfersyndrom entstandenen Defizite an emotionalem Austausch und menschlicher Nähe. Wird sie versetzt, bricht die Störung aus. Solange der helfende Beruf Gestaltungsspielräume öffnet und hohes Sozialprestige einträgt, spüren Betroffene nicht, wie sehr sie ihr Helfersyndrom einengt. Aber wenn solche Plomben im Selbstgefühl wackeln oder gar ausfallen, wächst die innere Not. Jetzt manifestiert sich die bisher kompensierte narzisstische Störung in Alkohol- oder Drogenabhängigkeit.
2Beruf, Depression und narzisstische Krise
Das Helfersyndrom verbindet eine sehr allgemeine, berufliche Kategorie mit einem klinischen Fachausdruck. Solche Begriffe gehören in eine kritische Tradition. Damit versuche ich, Aufmerksamkeit für ein Problem zu gewinnen, das zwischen den festen Grenzen der akademischen Fachbereiche angesiedelt ist: Berufe untersucht die Soziologie, Berufsmotivationen die Psychologie und Depressionen die Psychiatrie.
Erlebende Menschen jedoch verbinden nicht selten ihre Depression mit ihrer Kindheit und mit ihrer Berufswahl. Solche Personen zu erreichen und ihr Verständnis in die eigene Situation zu vertiefen, ist das Ziel einer Untersuchung über das Helfersyndrom.
Der in seinem Selbstgefühl, dem Narzissmus, einigermaßen stabile Mensch kann Kränkungen verarbeiten, indem er sie realistisch einschätzt: Hier habe ich einen Fehler gemacht, dort nicht, in vielen Bereichen bin ich in Ordnung. Die narzisstische Störung eines zur Depression neigenden Menschen hingegen drückt sich darin aus, dass der einzelne Fehler nicht in seinem realen Umfang wahrgenommen wird, sondern als Symbol für die Mangelhaftigkeit der ganzen Person.
Das hängt mit Störungen der Aggressionsverarbeitung zusammen, mit dem Teufelskreis des Perfektionismus. Wer als Kind so massiv gekränkt wurde, dass er seine eigene Wut als mörderisch erlebte (und dadurch auch seine Bezugspersonen als mordlustig imaginieren musste), sucht später den perfekten Frieden, die perfekte Harmonie. Dann gibt es aber keine kleinen, harmlosen, gut lösbaren Streitigkeiten mehr, sondern nur noch Katastrophen.
Ich arbeitete einmal mit einem Arztehepaar. Die Frau litt darunter, dass sich ihr Mann oft tagelang in ein Schweigen zurückzog, das er ihr nicht erklären konnte. Als er mehr Vertrauen geschöpft hatte und bemerkte, dass ich mich auch für Kleinigkeiten interessierte, gestand er einen – so seine Worte – völlig lächerlichen und ganz bestimmt bedeutungslosen Anlass für einen dieser Rückzüge. Seine Ehefrau hatte ihn beim Frühstück zur Rede gestellt, weil er die Butter im Papier ließ und nicht auf ein Tellerchen legte.
Er korrigierte den Fehler und verstummte, ohne zu erkennen, weshalb, es war schließlich eine Kleinigkeit – aber eben ein Symbol dafür, dass seine Frau ihn nicht «verstand», seine Bemühungen um sie (er deckte jeden Morgen den Tisch, damit sie noch ein wenig länger schlafen konnte) nicht würdigte, ihn nicht liebte, er sie deshalb hasste, sie ihn auch hassen musste …
Das Konzept Helfersyndrom ist nützlich, um zu verstehen, weshalb die Fähigkeit dieses Arztes, einfühlend und sorgfältig mit schwierigen Patienten umzugehen, keineswegs seiner extremen Kränkbarkeit durch seine Partnerin widersprechen muss.
Die Patienten sind von ihm und seinen Leistungen abhängig; er kann im Umgang mit ihnen jene seelischen Bezirke vermeiden, die sich in seiner Intimsphäre bemerkbar machen. Seine Erwartungen an die Einfühlung und Anerkennung vonseiten der Kranken sind durch eine feste Rolle definiert, die ihn schützt und ihm Sicherheit gibt. Als Ehemann fehlt ihm dieser Schutz. Die kleine Aggression gegen die pingelige Partnerin darf nicht laut werden; sie verwandelt sich unterirdisch in vernichtende Wut. Diese kann nur dadurch kontrolliert werden, dass sich der hilflose Helfer sozusagen tot stellt und wartet, bis sich sein Selbstgefühl wieder festigt.
Auch dieser Arzt-Patient war latent suizidal. Die Verbindung von Kränkbarkeit und Perfektionismus sucht Trost im Nicht-Sein, wie es bereits vor vierhundert Jahren William Shakespeares Hamlet im Monolog erwägt:
Ob’s edler im Gemüt, die Pfeil’ und Schleudern
des wütenden Geschicks zu tragen oder
sich wappnend gegen eine See von Plagen
durch Widerstand sie enden?
Sterben, schlafen, nichts weiter …
«Wenn es mir zu viel wird und ich diese Leere spüre und denke: Du bringst es doch nicht, dann ist es mir immer ein großer Trost, wenn ich mir vorstelle: Du kannst dich ja jederzeit umbringen, dann hast du Ruhe» (ein 36-jähriger Arzt).
Depressive Symptome bei hilflosen Helfern werden dadurch verschärft, dass sie sich so schwer tun, Hilfe anzunehmen und eigene Schwächen auszudrücken. Während die Angehörigen der helfenden Berufe danach trachten, ihren Klienten zu versichern, dass es keine Schande ist, Symptome zu haben und Hilfe anzunehmen, scheint es nicht wenigen Helfern schwer zu fallen, dieser Maxime selbst zu folgen.
Fast alle Ärzte, die sich mit seelisch und/oder körperlich erkrankten Kollegen beschäftigt haben, weisen darauf hin, dass Ärzte «schlechte» Patienten sind. Das scheint für Psychiater in besonders ausgeprägtem Maß zu gelten: Sie haben zwar in der Öffentlichkeit inzwischen mehr Erfolge mit der Aufklärung darüber, dass seelische Erkrankungen kein Makel und oft gut behandelbar sind, glauben aber selbst zuallerletzt daran, wenn sie persönlich psychische Probleme haben.
Zwar gehört es zu den Grundsätzen der medizinischen Ausbildung, angehenden Ärzten klarzumachen, dass sie weder sich selbst noch nahe Angehörige behandeln dürfen. Aber diese Maximen werden oft nicht beachtet. Selbstdiagnosen und Selbstbehandlungen sind weit verbreitet, gerade auch da, wo sie am wenigsten gelingen können, bei psychischen Störungen.
E.M. Waring schildert ein Beispiel: Ein Nervenarzt im mittleren Alter verzögerte die Aufnahme einer Behandlung um sechs Monate, obwohl er an eindeutigen Symptomen einer schweren Depression litt: Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, Verstopfung, Tagesschwankungen der Stimmung, Impotenz, geistiger Verlangsamung, trauriger Verstimmung und Selbstmordgedanken.
Der Arzt erklärte, da er nicht an Schlaflosigkeit gelitten habe, sei sein Zustand so ernst nicht gewesen. Während der sechsmonatigen Periode, in der er eine Behandlung vermied, zerbrach seine Ehe, und er verlor eine berufliche Position, die ihn sehr befriedigt hatte. Er behandelte sich selbst mit antidepressiven Medikamenten in einer Dosis, die weit unter dem Therapiestandard lag, und setzte die Medikation sofort ab, wenn er sich etwas besser fühlte, was ebenfalls als Behandlungsfehler gilt. Sein Alkoholkonsum hatte beträchtlich zugenommen.
In einem anderen Fall verschrieb sich ein Arzt hohe Dosen von Schlafmitteln über zwei Jahre hin, ohne sich für süchtig zu halten. Er kam erst in Behandlung, als seine Frau Selbstmord beging. Sie hatte vorher bereits einige Suizidversuche unternommen. Er hatte immer gedacht, seine Frau sei gesund.[8]
Ein Konzept wie das Helfersyndrom wendet sich gegen die inzwischen wieder bei manchen Autoren beliebte Vereinfachung, wonach depressive Störungen eine Folge von genetisch bedingten Besonderheiten des Gehirnstoffwechsels sind. Diese reduktionistische Auffassung hat neben dem Wohlgefallen, das sie bei der Pharmaindustrie auslöst, auch ein nicht zu unterschätzendes psychologisches Plus. Sie schützt die Kranken vor Selbst- und Fremdvorwürfen, welche das psychische Klima eher vergiften als heilsam machen, in dem sich Depressive bewegen.
Ich vermute, dass genau diese Entlastung die antidepressiven Medikamente so beliebt macht, obwohl sie in den Augen kritischer Mediziner kaum wirksamer sind als Placebos. Wenn der Depressive Medikamente nimmt, ist ihm selbst und seiner Umgebung klar, dass er kein moralischer Versager und nicht an seinem Leiden schuld ist. Das entlastet ihn sehr.
Wenn die Medikamente nicht helfen, wird zu künstlichen epileptischen Anfällen gegriffen (Elektrokrampftherapie), für deren Wirkungen es viele fragwürdige biochemische Erklärungen und eine sinnvolle psychologische Hypothese gibt: der Elektroschock ist extrem angsteinflößend und wird als massive Strafe erlebt; so befriedigt er die in allen Depressionen nachweisbare Wendung der Aggression gegen die eigene Person.
Psychopharmaka und Elektroschock überzeugen den Kranken und seine Umwelt, dass er unschuldig ist und sein Stoffwechsel gestört. Das ist ein entlastender Mythos, der nicht als Mythos benannt werden darf, ohne diese entlastende Wirkung zu gefährden.
Für den Psychoanalytiker ist das kein Grund, die Dinge nicht beim Namen zu nennen. Er ist sich seiner Minderheitenposition ohnedies sicher und vertraut darauf, dass in den von ihm verantworteten Behandlungen die Kranken lernen können, sich mit psychischen Mitteln gegen Schuldgefühle, Selbstbestrafungen und Versagensängste zu wehren. Wenn ihnen das gelingt, brauchen sie die Kombination von genetischer Mythologie und chemischer oder physikalischer Quälerei nicht mehr, welche die «biologischen» Psychiater (die man lieber industrielle Psychiater nennen sollte) als einzig richtige Behandlung ausgeben.
Allerdings wird der Psychoanalytiker häufig erst konsultiert, wenn die Erkrankung weit fortgeschritten ist und der Kranke zunächst vor allem Entlastungen benötigt. Die akute schwere Depression macht unfähig, den seelischen Spielraum zu gewinnen, der für eine Auseinandersetzung mit den Fehlentwicklungen nötig ist, welche die Reservoire an emotionalen Ressourcen erschöpft haben. Wer sich extrem elend fühlt, kann nicht verstehen, was er getan hat und was er ändern müsste, um solchen Formen der Erschöpfung seiner inneren Kräfte zu entgehen.
Die von dem Münchner Psychiater Florian Holsboer plakativ vertretene These «Depression ist nichts anderes als gestörter Hirnstoffwechsel»[9] ist ein wissenschaftlicher Rückschritt. Sie bringt uns im Verständnis nicht weiter als etwa die Behauptung, Tuberkulose sei nichts anderes als gestörter Lungenstoffwechsel.
Eine solche These mag sinnvoll sein, wenn sie sich gegen magische Vorstellungen wendet, wonach Tuberkulose auf sexuellen Exzessen oder Unmoral beruhe. Aber sie ersetzt natürlich nicht die genaue Ursachenforschung, welche Robert Koch geleistet hat, indem er den bakteriellen Erreger nachwies und demonstrierte, wie ihn jeder kundige Forscher im Mikroskop sichtbar machen kann.
Demgegenüber haben die mit immensen Finanzmitteln geförderten Forschungsberge hinsichtlich der körperlichen Ursachen der Depression noch kaum eine Maus[10] geboren. Völlig unklar ist nicht nur der Erbgang dieser angeblich genetischen Erkrankung, deren Auftreten extremen kulturellen Unterschieden unterworfen ist[11], sondern auch die Frage, ob die biochemischen Veränderungen im Gehirn Ursache oder Folge jener Veränderungen sind, die am Beispiel des Psychiaters diskutiert wurden, der seine Depression verleugnete, weil er noch schlafen konnte.
Von den Anhängern der genetischen Reduktion wird gern die Übereinstimmung eineiiger Zwillinge in Bezug auf Depressionen angeführt. Wenn einer dieser Zwillinge an einer schweren Depression erkrankt, hat der zweite ein weit überdurchschnittliches Risiko, ebenfalls an diesem Leiden zu erkranken.
Da solche Zwillinge identische Erbanlagen haben, sind sie ein Indikator für die genetische Komponente in der menschlichen Persönlichkeit. Bei zweieiigen Zwillingen ist dieses Risiko längst nicht so hoch. Es bestätigt sich sogar, in freilich geringerem Ausmaß, wenn die Zwillinge getrennt aufgewachsen sind.
Aber Untersuchungen an Zwillingen haben auch ergeben, dass die Erkrankungswahrscheinlichkeit an Tuberkulose eine ebenso hohe Konkordanz (Risiko-Übereinstimmung) aufweist. Wäre also die Ursache dieser Lungenkrankheit unbekannt, würden die Biologisten nicht weniger beredt die These vertreten, es handle sich um eine ererbte Stoffwechselstörung.
Die genetische Forschung führt in eine Sackgasse, weil eine einfache Erbanlage für Depressionen gar nicht existieren kann. Da diese Erkrankung die Fortpflanzungsfähigkeit vermindert, wäre sie bereits ausgemerzt. Genetische Bedingung einer Depression scheint die erhöhte Verwundbarkeit des Gehirns gegenüber emotionalen Verletzungen, die durch Perfektionismus kompensiert werden und schließlich in einen mehr oder weniger ausgeprägten Erschöpfungszustand führen.
Depressive sind unter günstigen Entwicklungsbedingungen besonders feinfühlig und kreativ, können sich aber eben wegen dieser reichen Fähigkeiten auch besonders schaden, sobald sie diese gegen sich selbst richten. Der biochemische Forscher, welcher angesichts eines solchen Endstadiums seinen Befund erhebt und daraus die Depression erklären will, verwechselt eine Folge mit einer Ursache.
Die Analyse des Helfersyndroms kann das Verstehen solcher Vorurteile vertiefen, welche in den helfenden Berufen sehr häufig Wissenschaft zu Pseudowissenschaft entgleisen lassen. Eugen Bleuler, ein nachdenklicher Psychiater, der früher als viele andere Freud ernst nahm und sich dann doch wieder von ihm distanzierte, weil ihm die Psychoanalytiker als Gruppe zu dogmatisch waren, sprach 1919 vom «autistisch-undisziplinierten Denken», das viele Ärzte auszeichne.[12] Der Begriff des Narzissmus fasst es genauer, aber er wurde damals erst entwickelt.
Autismus ist – ebenso wie Narzissmus – ein Wort für auffällige Selbstbezogenheit. Wenn wir die Qualität beider Begriffe unterscheiden wollen, wäre Autismus eine sozusagen hilflose und alternativlose Selbstbezogenheit; der Autist im klinischen Sinn kann andere Menschen nicht als seinesgleichen wahrnehmen, sich nicht in sie einfühlen, sich nicht mit ihnen austauschen und bei ihnen geborgen fühlen.
Einen «Narzissten» gibt es demgegenüber nur in der (entwertenden) Alltagssprache, nach dem ebenfalls moralisierenden Vorbild des griechischen Mythos, wonach der schöne Jüngling dieses Namens, weil er die Liebe der Frauen wie der Männer verschmähte, von Aphrodite mit unerfüllbarer Selbstliebe bestraft wurde und angesichts seines Spiegelbildes verschmachtete: Er konnte den Geliebten, der ihm da aus einem stillen Teich entgegenblickte, nicht erreichen. So verwandelte ihn die schließlich doch gnädige Göttin in die Frühlingsblume, die wir kennen.
Im wissenschaftlichen Sprachgebrauch ist Narzissmus heute nicht wertend gemeint, sondern eine universelle Dimension menschlichen Erlebens. Alle Menschen erwerben eine Einstellung zu sich selbst, zu der auch liebevolle Gefühle gehören. Thomas Mann hat in «Schwere Stunde» beschrieben, wie der Dichter Kraft aus einer namenlosen Zärtlichkeit schöpft, die er beim Anblick seiner eigenen Hand empfindet. Dieser Narzissmus ist gesund. Da er aber den Forderungen an Unterordnung und Disziplin widerspricht, welche in den höher entwickelten Gesellschaften verinnerlicht werden, stellen sich die meisten Menschen darauf ein, dass sie gefährliches Terrain betreten, wenn sie ihre Selbstliebe allzu offen ausleben.
Denn zum Narzissmus eines sozialen Tieres gehört auch der Exhibitionismus. Jedes unverdorbene Kind ist ein großer Selbstdarsteller; die meisten Erwachsenen im nördlichen Europa aber schämen sich, wenn sie öffentlich reden oder auf einer Bühne ihre Gefühle darstellen sollen.
Die narzisstische Bedürftigkeit des hilflosen Helfers ist gebrochen; sie wird nicht als Selbstliebe erlebt, sondern als Zwang, Ideale zu verwirklichen und für das Wohlergehen der Schützlinge zu sorgen. Aus diesem Grund sind auch Helfer-Institutionen, Schulen etwa oder Krankenhäuser und Universitäten, viel schwieriger zu verändern als Wirtschaftsunternehmen. Obwohl auch sie wirtschaftlichen Mechanismen unterworfen sind, werden diese nicht direkt geäußert, sondern transformiert. Sie treten nur als Sorge für das Wohl Dritter (der Schüler, der Patienten) an die Oberfläche. Das verwirrt die Debatten und erschwert die Reformen.
Was Psychiater wie den oben zitierten Fanatiker der Psychopharmakologie von anderen Naturwissenschaftlern unterscheidet, ist die polemische Wendung gegen eine umfassendere Perspektive. Niemand wendet sich dagegen, die genetischen Hintergründe depressiver Symptome zu erforschen und sie mit chemischen Mitteln zu lindern. Aber auf der anderen Seite ist nicht zu leugnen, dass es viele Menschen gibt, welche sich nach einer Psychoanalyse nicht nur besser fühlen, sondern auch glauben, verstanden zu haben, weshalb sie depressiv geworden sind und was sie künftig tun oder lassen sollten, um nicht wieder depressiv zu werden.
Ein Physiker fühlt sich nicht dafür zuständig, die Arbeit der Forscher in benachbarten Gebieten zu entwerten; ein biologischer Psychiater jedoch sehr wohl. Wer diesen Unterschied verstehen will, kommt nicht um eine Auseinandersetzung mit der Dynamik des Helfens als Abwehr herum. Die materielle Natur können wir erforschen, ohne dass dadurch Ängste geweckt werden. (Zumindest heute; zur Zeit Galileis war das noch anders). Wer aber ein Leiden erforscht, das ihn selbst bedroht, sieht es durch die Brille der eigenen Emotionen.
Die Konstruktion einer lückenlosen, von unserem Erleben vollständig unabhängigen Kausalität, die von einem defekten Gen zur defekten Psyche führt, bietet einen wirksamen Schutz vor eigener Betroffenheit, vor eigenen Ängsten, vor gefährlicher Nähe. Je fragwürdiger die so dogmatisch behauptete Kausalität unter naturwissenschaftlichen Gesichtspunkten ist, desto polemischer werden jene bekämpft, welche sich dem Problem aus einer anderen Richtung nähern und die Depression nicht als unverständliches körperliches Ereignis erforschen, sondern als potenziell verstehbare Entwicklung.