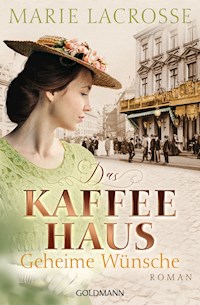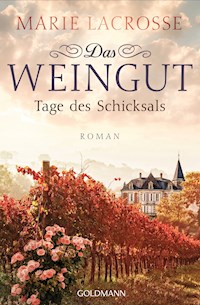9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Kaffeehaus-Saga
- Sprache: Deutsch
Wien in den 1880er-Jahren: Die junge Sophie von Werdenfels flüchtet aus der tristen Atmosphäre ihres Elternhauses so oft wie möglich in die Pracht des Kaffeehauses ihres bürgerlichen Onkels. Dort lernt sie Richard von Löwenstein kennen, einen persönlichen Freund des Kronprinzen Rudolf. Während sich die beiden verlieben, schwärmt Sophies beste Freundin Mary für den verheirateten Kronprinzen. Ungeachtet aller Warnungen Sophies, lässt sich Mary sogar auf eine Affäre mit Rudolf ein. Und niemand ahnt, dass dadurch das Kaiserreich in seinen Grundfesten erschüttert wird …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 947
Veröffentlichungsjahr: 2020
Sammlungen
Ähnliche
Buch
Wien in den 1880er-Jahren: Die junge Sophie von Werdenfels flüchtet aus der tristen Atmosphäre ihres Elternhauses so oft wie möglich in die Pracht des Kaffeehauses ihres bürgerlichen Onkels. Dort lernt sie Richard von Löwenstein kennen, einen persönlichen Freund des Kronprinzen Rudolf. Während sich die beiden verlieben, schwärmt Sophies beste Freundin Mary für den verheirateten Kronprinzen. Ungeachtet aller Warnungen Sophies lässt sich Mary sogar auf eine Affäre mit Rudolf ein. Und niemand ahnt, dass dadurch das Kaiserreich in seinen Grundfesten erschüttert wird …
Autorin
Marie Lacrosse hat in Psychologie promoviert. Viele Jahre arbeitete sie hauptberuflich als selbstständige Beraterin und schrieb unter ihrem wahren Namen Marita Spang erfolgreich historische Romane. Heute konzentriert sie sich fast ausschließlich aufs Schreiben. Ihre Trilogie »Das Weingut« wurde zu einem großen SPIEGEL-Bestseller. Die Autorin lebt mit ihrem Mann in einem beschaulichen Weinort. Weitere Romane von Marie Lacrosse sind bei Goldmann in Vorbereitung.
Mehr Informationen unter www.marielacrosse.de
Marie Lacrosse
Das KaffeehausBewegte Jahre
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstveröffentlichung September 2020
Copyright (c) 2020 by Marie Lacrosse
Copyright der deutschen Erstausgabe (c) 2020 by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Montasser Medienagentur, München.
Gestaltung des Umschlags und der Umschlaginnenseiten: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: © Laurence Winram/ Trevillion Images
Redaktion: Heike Fischer
Karte: © Peter Palm, Berlin
BH · Herstellung: ik
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-25143-7V004
www.goldmann-verlag.deBesuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Meiner verstorbenen Schwiegermutter gewidmet,die Wien über alles geliebt hat.
Wien ist eine Stadt,die um einige Kaffeehäuser herum errichtet ist …
Bertolt Brecht
Wie eine Blume sprosst der Mensch auf und wird gebrochen.
Grabinschrift der Baroness Mary Vetsera, Hiob 14,2
Dramatis Personae
Es werden nur die handlungstragenden Figuren aufgeführt. Historische Persönlichkeiten sind mit einem * gekennzeichnet.
Sophies Familie
Komtess Sophie von Werdenfels,genannt Phiefi, ältere Tochter des Freiherrn Nikolaus von Werdenfels
Freiherr Nikolaus von Werdenfels, Sophies tödlich verunglückter Vater
Henriette von Freiberg, genannt Yetta, geb. Danzer, ehemalige von Werdenfels, Sophies wiederverheiratete Mutter
Arthur, Ritter von Freiberg, ihr zweiter Ehemann und Sophies Stiefvater
Nikolaus, genannt Nikki, Sophies älterer Bruder
Emilia, genannt Milli, Sophies jüngere Schwester
Stephan Danzer, Henriettes älterer Bruder, Sophies Patenonkel, Besitzer des Kaffeehauses Prinzess
Annerl Danzer, seine jung verstorbene Frau
Richards Familie
Richard von Löwenstein, genannt Richie, einziger Sohn einer Nebenlinie des alten Adelsgeschlechtes der Grafen von Löwenstein, Offizier in der k. u. k. Armee und Freund Kronprinz Rudolfs
Eduard von Löwenstein, Richards Vater
Aglae von Löwenstein, seineMutter
Graf Maximilian von Löwenstein, genannt Max, Richards Onkel und Majoratsherr der Familie von Löwenstein
Graf Adalbert von Thurnau, ein Cousin mütterlicherseits von Richards Vater
Komtess Amalie von Thurnau, genannt Ami, seine einzige Tochter
Eleonore, genannt Lori, Amalies Mutter, die bei deren Geburt verstorben ist
Die kaiserliche Familie
Kaiser Franz Joseph I.*, regierender Monarch und Familienoberhaupt der Habsburger
Kaiserin Elisabeth*, genannt Sisi, seine Frau
Kronprinz Rudolf*, ihr einziger Sohn
Kronprinzessin Stephanie*, Rudolfs Frau
Prinzessin Elisabeth*, genannt Erzsi, Rudolfs und Stephanies Tochter
Prinzessin Gisela*, älteste Tochter des Kaiserpaars
Prinzessin Marie Valerie*, jüngste Tochter des Kaiserpaars
Erzherzog Franz Salvator*, Marie Valeries Verlobter und späterer Ehemann
Louise von Sachsen-Coburg*, Schwester der Kronprinzessin Stephanie
Philipp von Sachsen-Coburg*, Louises Gatte und Jagdfreund Rudolfs
Erzherzog Albrecht*, Onkel des Kaisers Franz Joseph und oberster Heerführer der k. u.k Armee; Großonkel und militärischer Vorgesetzter des Kronprinzen Rudolf
Erzherzöge Franz Ferdinand* und Otto*, Söhne des jüngeren Kaiserbruders Karl Ludwig
Gräfin Marie Louise Larisch*, geb. Wallersee, Sisis Nichte
Graf Georg Larisch*, Marie Louises Ehemann
Herzog Max in Bayern*, Kaiserin Sisis Vater
Herzogin Ludovika*, Sisis Mutter
Die Familie Vetsera
Komtess Marie Alexandrine von Vetsera*, genannt Mary, zweitälteste Tochter der Familie und Sophies beste Freundin
Baronin Helene von Vetsera*, Marys Mutter
Baron Albin von Vetsera*, Marys Vater
Ladislaus*, genannt Laszi, Marys älterer Bruder
Johanna*, genannt Hanna, ihre ältere Schwester
Franz Albin*, genannt Feri, ihr jüngerer Bruder
Alexander*, Aristides*, Hector* und Heinrich Baltazzi*, die Brüder von Marys Mutter
Weitere Personen von Bedeutung
Herzog Miguel von Braganza*, aus Portugal vertriebener Thronprätendent, Verehrer von Mary Vetsera und ein Freund Kronprinz Rudolfs
Mizzi Caspar*, Luxusprostituierte und Geliebte Rudolfs seit Sommer 1886
Olga Popova, Balletttänzerin an der Wiener Hofoper und Geliebte Richards von Löwenstein
Gräfin von Wilczek, eine gute Bekannte von Sophie
Komtess Annelie von Wilczek, ihre ledige Tochter
Irene von Sterenberg (ehemals Gerban), Gast im Café Prinzess
Personal
Ida, langjährige Mitarbeiterin in Stephan Danzers Kaffeehaus, später Mamsell im Haushalt der von Werdenfels
Mina, Aufseherin im Café Prinzess
Hedwig, ehemalige Aufseherin im Café Prinzess
Gruber, erster Diener im Haus Werdenfels
Fräulein Mohr*, Gesellschafterin im Haus Vetsera (der Name ist fiktiv, da nicht überliefert, die Person ist jedoch historisch belegt)
der alte Christian*, erster Hausdiener der Vetseras
Agnes Jahoda*, Marys Zofe
Joseph Jahoda*, Agnes Vater, Portier und (fiktiv im Roman) Kutscher der Vetseras
Johann Loschek*, Rudolfs erster Kammerdiener
Carl Nehammer*, Rudolfs zweiter Kammerdiener
Josef Bratfisch*, Rudolfs privater Leibkutscher; in seiner Freizeit ein bekannter Heurigensänger und Kunstpfeifer
Weitere historische Personen von Bedeutung für die Handlung
(in der Reihenfolge ihrer Erwähnung im Roman)
Moritz Szeps*, Freund Rudolfs, Herausgeber des Neuen Wiener Tagblatts
Graf Eduard von Taaffe*, konservativer Ministerpräsident Österreichs ab 1879
Johanna Wolf*, exklusivste Bordellwirtin in Wien
Kaiser Wilhelm I.*, deutscher Kaiser bis März 1888
Kronprinz und späterer Kaiser Friedrich III.*, deutscher Kaiser von März bis Juni 1888
Otto Fürst Bismarck*, deutscher Reichskanzler
Baron Moritz Hirsch*, jüdischer Bankier und Geldgeber Rudolfs
Gustav Graf Kálnoky*, Außenminister Österreich-Ungarns ab 1881
Kronprinz und späterer Kaiser Wilhelm II.*, deutscher Kaiser ab Juni 1888
Graf Carl Albert von Bombelles*, Obersthofmeister des Kronprinzen Rudolf und stadtbekannter Lebemann
Dr. Hermann Widerhofer*, Leibarztderkaiserlichen Kinder, später der gesamten kaiserlichen Familie
Graf Leopold Gondrecourt*, Generalmajor undRudolfs Erzieherin Kindertagen
Graf Arthur Potocky*, Stephanies Liebhaber
Engelbert Pernerstorfer*, Mitglied im Abgeordnetenhaus des österreichischen Reichsrats
Ritter Georg von Schönerer*, Führer der Deutschnationalen und später der Alldeutschen Vereinigung und glühender Antisemit
Graf Josef Hoyos*, Jagdfreund Rudolfs
Henry Chambige*, gescheiterter französischer Selbstmörder
Professor Eduard Sueß*, Rektor der Wiener Universität und ein bekannter liberaler Politiker
Prinz Heinrich Reuß*, deutscher Botschafter in Wien im Jahr 1889
Baron Franz von Krauß*, Polizeipräsident von Wien
Tadeusz Ajdukiewicz*, bekannter Wiener Maler
Dr. Heinrich von Slatin*, Sekretär am Obersthofmarschallamt; mit der Vertuschung der Mayerling-Affäre betraut
Graf Eduard von Paar*, Generaladjutant des Kaisers Franz Joseph
Gräfin Ida Ferenczy*, ungarische Hofdame und Vertraute Sisis
Prolog
Café Prinzess in Wien
April 1879
»Oh, diese Torte ist ja ganz prachtvoll gelungen, Onkel Stephan!«
Sophie klatschte vor Begeisterung in die Hände. Ihre grünen Augen strahlten mit dem gleichfarbigen Turban des Marzipanprinzen um die Wette. Das Figürchen mit seinen roten Pluderhosen, dem gelben weiten Hemd mit schwarzer Weste und der ausladenden Kopfbedeckung schmückte als Aufsatz eine riesige dreistöckige Torte. Vier Miniaturausgaben, ausgestochen aus gefärbtem Marzipan, zierten jeweils die zehn Zentimeter hohen Seiten der drei nach obenhin kleiner werdenden Stockwerke. Die beiden oberen waren zusätzlich von einem Ring aus kandierten Kirschen und Pistazien umgeben.
»Mein Geschenk zur Silberhochzeit unseres hochverehrten Kaiserpaars.« Stephan Danzer strich seiner achtjährigen Lieblingsnichte liebevoll über die blonden Haare, die ihr, zu zwei dicken Zöpfen geflochten, weit über den schmalen Rücken fielen.
Seit dem viel zu frühen Tod seines geliebten Annerls, das ihren gemeinsamen Sohn mit in die Ewigkeit genommen hatte, lebte Stephan Danzer allein und schenkte seine ganze väterliche Liebe den beiden kleinen Töchtern seiner Schwester Henriette. Vor allem die ältere Sophie, deren Pate er war und die ihn so oft wie möglich besuchte, hatte er in sein Herz geschlossen.
Danzer war der Besitzer des Kaffeehauses Prinzess an der Ecke der Dorotheergasse zum Graben, einer der elegantesten Einkaufsstraßen Wiens. Das Haus in der Dorotheergasse hatte Stephan von seinem Vater geerbt, der die heute stadtbekannte Lokalität zwar gegründet, aber nie selbst geleitet hatte. Stephans Familie bewohnte die oberen Etagen des Hauses.
Schon als junger Bub hatte Stephan das Nachbarsmädchen Annerl verehrt, die einzige Tochter des Besitzers des Eckhauses zum Graben, eines ehemaligen Palais. Annerl teilte schon als Kind seine Leidenschaft für das Kaffeehaus und hielt sich so oft dort auf, wie es ihr ihre gestrenge Mutter erlaubte. Die ging natürlich davon aus, dass Annerl Stephans sechs Jahre jüngere Schwester Henriette, die ungefähr im Alter ihrer Tochter war, besuchte und dass sich die Mädchen in der Wohnung der Danzers unter der Aufsicht von Stephans Mutter aufhielten.
Doch die fühlte sich durch die Kinder oft gestört und erlaubte ihnen nur zu gern, die Treppen ins Kaffeehaus hinunterzulaufen. Gemeinsam lungerten Stephan, Henriette und Annerl in der Küche oder einer Nische des Gastraums herum und beobachteten die Herren, die oft über einem einzigen Häferl Melange oder Verlängertem stundenlang die Zeitungen studierten.
Als Annerl zwölf Jahre alt war, starb ihre Mutter an einer Lungenkrankheit. Danach gab ihr Vater seine Tochter zu Stephans großer Betrübnis in ein Pensionat für höhere Töchter. Umso größer war seine Freude, als die kaum Sechzehnjährige endlich wieder nach Hause kam, um ihrem nun ebenfalls gebrechlichen Vater den Haushalt zu führen.
Stephan konnte den Abschluss seiner Zuckerbäckerlehre in der renommierten Konditorei Gerstner in der Kärntnerstraße kaum abwarten, um endlich um Annerls Hand anzuhalten. Zu seiner übergroßen Freude sagte sie Ja und brachte als Mitgift bereits das Haus am Graben, welches ihr der sieche Vater vermacht hatte, mit in die Ehe.
Einige Jahre später verstarb auch Annerls Vater. Nun konnten die beiden ihren Traum verwirklichen, das Kaffeehaus in der Dorotheergasse um ein elegantes Konditor-Café zu erweitern, dessen Eingang zum Graben hin lag. Ein Mauerdurchbruch verband das Café mit den Räumen des ursprünglichen Kaffeehauses.
Das Kaffeehaus hatte sich bis zu diesem Zeitpunkt nicht von vielen anderen Kaffeehäusern Wiens unterschieden. Es bot neben den üblichen Kaffeesorten ein paar einfache Mehlspeisen wie Apfelstrudel oder Buchteln an, außerdem kleine Gerichte wie Schinkensemmeln und Würstel.
Die Besucher waren ausschließlich Männer. Denn anders als im Café durfte dort nach Herzenslust geraucht werden. Natürlich gab es Zeitungen und Zeitschriften aller Art, und natürlich konnte sich jeder Besucher dort so lange aufhalten, wie es ihm genehm war. Auch wenn er lediglich einen Kleinen Schwarzen konsumierte.
Schnell stellte sich heraus, dass das Café eine eigene Backstube brauchte, in der Stephan sein Talent als Zuckerbäcker zur Gänze ausschöpfen konnte. Diese wurde im Souterrain eingerichtet, wo er genug Platz für seine zahlreichen Gerätschaften hatte.
Wer Danzer zum ersten Mal sah, hätte ihn eher für einen Schlachtermeister gehalten als für einen der begnadetsten Zuckerbäcker Wiens. Mit seinen fleischigen Händen formte er aus Teig und allerlei Zuckerwerk die filigransten Kunstwerke.
Annerls und Stephans Glück wäre vollkommen gewesen, hätte der ersehnte Nachwuchs sich endlich eingestellt. Doch erst neun Jahre nach der Hochzeit wurde Annerl zum ersten Mal schwanger.
Ihr Zustand hinderte sie allerdings nicht daran, sich mit der für sie charakteristischen Leidenschaft der kostspieligen Neuausstattung des Cafés zu widmen. Diese sollte dem Haus endgültig einen Rang unter den ersten Zuckerbäcker-Adressen Wiens sichern. Schließlich lag das Etablissement von Ch. Demel’s Söhne, kurz Demel genannt, nur wenige Gehminuten entfernt am Michaelerplatz gegenüber der Hofburg. Dem Café war zudem bereits der k. u. k. Hoflieferantentitel verliehen worden, von dem die Danzers damals noch träumten.
»Gefällt dir mein Werk?«, versicherte sich Danzer nun überflüssigerweise noch einmal der Bewunderung seiner Nichte.
»Oh ja! Die Mokkaprinzentorte ist wunderschön! Aber«, Sophie nutzte die Gunst des Augenblicks, »wann darf ich denn einmal ein Stückerl davon probieren?« Sie hob ihren treuherzig bittenden Blick zur massigen Gestalt ihres Onkels empor.
Die Idee zur »Mokkaprinzentorte«, der herausragenden Spezialität des Cafés Prinzess, verdankte Danzer ebenfalls seiner verstorbenen Gattin. Selbst als Annerls Schwangerschaft immer beschwerlicher wurde, sodass sie das Bett hüten musste, ruhte ihr Geist nicht. »Wir brauchen eine ganz besondere Torte, die jedermann nur mit dem Café Prinzess in Verbindung bringt«, erklärte sie ihrem überraschten Gatten eines Abends, als er neben ihrem Krankenbett saß. »Und ich habe auch schon etwas im Sinn, was so leicht von niemandem übertroffen werden kann.« Dann begann sie, Stephan ihren Plan zu erläutern.
Auf einer Reise nach München hatten die beiden vor einigen Jahren eine Torte gekostet, an die Annerl sich später immer wieder erinnert hatte. Sie bestand aus verschiedenen Biskuitböden und Buttercremeschichten und hatte beiden damals ausgezeichnet gemundet. Von ihrem Krankenbett aus entwickelte sie nun gemeinsam mit Stephan ein an diese Köstlichkeit angelehntes Rezept, das er dann tagsüber immer wieder ausprobierte. Abends brachte er Annerl eine Kostprobe der Torte, die sie unzählige Male verwarf, bis sie beide endlich zufrieden waren.
Entstanden war schließlich eine im Aufbau ähnliche, doch im Geschmack ganz andersartige Torte als die damals in München verkostete. Ihr Aroma erhielt sie vor allem durch die Zutat des berühmten Wiener Kaffees, den es in der ganzen Hauptstadt mittlerweile in unzähligen Variationen gab.
Sechs hauchdünne Biskuitböden wurden mit köstlicher Mokkabuttercreme bestrichen und übereinandergelegt. Der letzte Boden wurde, genauso wie die gesamte Torte, zusätzlich mit einer Marzipanschicht überzogen, die mit Kakaopulver hellbraun gefärbt und geschmacklich verfeinert war. Verziert wurde das Werk zunächst mit Mokkabohnen aus Bitterschokolade, Mandeln und Tupfern aus Schlagobers.
Zwar sprachen die Gäste des Cafés Prinzess der Torte von Anfang an zu. Deren Triumphzug erlebte Annerl zu Stephans großer Trauer allerdings nicht mehr mit. Im achten Monat ihrer Schwangerschaft erlitt sie eine Totgeburt und starb wenige Stunden später an ihren nicht zu stillenden Blutungen.
Mehr denn je hatte sich Stephan nach diesem entsetzlichen Verlust in die Arbeit gestürzt. In kürzester Zeit verhalf er dem Café Prinzess zu einem Bekanntheitsgrad, der durchaus mit dem des Demel und des zweiten k. u.k Hoflieferanten, der Konditorei Gerstner, mithalten konnte. Dabei spielte die Prinzess-Torte, wie Danzer sein Werk zunächst nannte, keine unerhebliche Rolle. Dennoch schien noch etwas zu fehlen.
Die zündende Idee war Stephan Danzer dann im vergangenen Jahr gekommen, als der einzige Sohn Kaiser Franz Josephs, Kronprinz Rudolf, im August 1878 seinen zwanzigsten Geburtstag feierte. Er sandte eine seiner Prinzess-Torten an das allmächtige Obersthofmeisteramt und ließ nachfragen, ob er die Torte zu Ehren des Thronfolgers in Zukunft »Kronprinz-Rudolf-Torte« nennen dürfe.
Diese Bitte wurde zwar letztlich abschlägig beschieden, da sich dies mit der Würde des Kaiserhauses nicht vereinbaren ließe, lautete die Antwort. Aber das Glück war Stephan Danzer trotzdem hold.
Durch ein Missgeschick in der Hofküche hatte es zum festlichen Diner des Kaisers, zu dem auch einige Gäste geladen waren, ausgerechnet an diesem Tag an Nachspeisen gefehlt. Der Obersthofmeister erinnerte sich an Danzers Präsent, das alsbald an der hochherrschaftlichen Abendtafel serviert wurde und sowohl dem Kronprinzen als auch dem Kaiser höchstpersönlich vorzüglich mundete. Als es zu kaiserlichen Nachbestellungen kam, bewarb sich Danzer sofort um den Titel des Hoflieferanten, den ihm das Obersthofmeisteramt nur wenige Wochen später zuerkannte.
Diesen Titel ließ sich der Hof mit einer Taxe von fünfhundert Gulden zwar teuer bezahlen. Er wurde aber gleichwohl nur wenigen ausgewählten Unternehmen verliehen. Daher war der Titel aufgrund der damit automatisch verbundenen illustren Kundschaft aus dem ganzen Hochadel und dem oft neu geadelten Großbürgertum die Garantie für eine glänzende wirtschaftliche Zukunft.
Dennoch wurmte Danzer die Ablehnung seiner Bitte, die Torte nach Kronprinz Rudolf benennen zu dürfen. Eine alternative Namensidee kam ihm, als er in einer bekannten Porzellanhandlung edles Geschirr für sein Café erwerben wollte und dabei die bunt bemalte Figurine eines Mohren aus Meißner Porzellan entdeckte.
»›Mokkaprinzentorte‹! Das wäre doch ein veritabler Name«, murmelte er halb laut vor sich hin, um sich nur wenige Stunden später in seiner Backstube mit der Nachbildung der Figurine, die er sofort erworben hatte, aus seinem feinen und selbstverständlich hausgemachten Marzipan zu befassen. Nach einer durchgearbeiteten Nacht war es so weit: Nun schmückten die farbigen Marzipanprinzen jede seiner berühmten Mokkatorten und verhalfen dem Gebäck damit weit über die Wiener Grenzen hinaus zu Ruhm.
Zumal es der ewig rührigen Konkurrenz bislang nicht gelungen war, den einzigartigen Geschmack der Torte nachzuahmen. Das Rezept, insbesondere die Zusammensetzung der verwendeten Gewürze für die Füllung, hütete Danzer wie seinen Augapfel und rührte die Mokkabuttercreme bis zum heutigen Tage stets eigenhändig an.
Jetzt lächelte er seiner Nichte Sophie liebevoll zu und drohte ihr spielerisch mit dem Zeigefinger. »Du weißt doch, mein Schatzerl, dass zu viel Kaffee in der Torte verarbeitet ist, um sie Kindern anbieten zu können. Wenn du zwölf Jahre alt bist, darfst du so viel davon essen, wie du nur magst. Ich backe dir sogar eine ganze Torte zu deinem Geburtstag.« Trotz dieses großzügigen Angebots verzog Sophie ihre vollen roten Lippen zu einem Schmollmund.
»Schau her!«, versuchte Danzer, die Enttäuschung des Mädchens zu lindern. »Hier in der Vitrine sind so viele köstliche Torten und Mehlspeisen. Du kannst ein Erdbeercreme-Schiffchen haben! Oder wie wäre es mit diesem köstlichen Blaubeerstrudel mit Schlagobers? Es gibt auch frische Marillenknödel mit Butterbröseln in der Küche. Die hast du doch so gerne. Und heiße Schokolade dazu, so viel du magst.«
Doch wenn es eine gänzlich unweibliche Eigenschaft seiner noch kindlichen Nichte gab, dann war es Sophies Dickköpfigkeit. Störrisch schüttelte sie zu jedem seiner Angebote den Kopf, dass die blonden Zöpfe nur so flogen.
»So lassen Sie sie doch in die Backstube gehen und dem Toni über die Schulter schauen! Er macht doch gerade die Mokkaprinzentörtchen für das Silberhochzeitsbuffet. Wenn ihm da eins misslingt, kann Phiefi« – das war Sophies Kosename seit dem Kleinkindalter – »doch zumindest ein Stückerl davon naschen. Dann weiß sie wenigstens, wie die Torte schmeckt!«
Wieder klatschte Sophie vor Freude in die Hände. »Oh ja, liebe Tante Ida. Das wäre so fein!«
Unbemerkt war Ida, die ältliche Frau, die seit über zwanzig Jahren die Kasse bediente, zu den beiden getreten. Sie gehörte quasi zum Hausinventar und hielt Stephan Danzer unverbrüchlich die Treue. Man munkelte, die um einige Jahre ältere, ledige Ida sei seit jeher unsterblich in Danzer verliebt.
Nun erwiderte die gutmütige, pausbäckige Frau Sophies Strahlen. »Also, Herr Danzer!«, mahnte sie den immer noch zögernden Zuckerbäcker. »Nun geben S' Ihrem Herzen einen Stoß. Sie wissen doch, wie gern Phiefi in der Backstube hilft.«
Danzer seufzte. »Nun gut«, gab er schließlich nach. »Aber du musst mir zweierlei versprechen, Sophie!«, mahnte er sie ungewohnt streng unter Verzicht auf ihren Kosenamen. »Du ziehst dir nicht nur die übliche Schürze an, sondern versteckst deine Haare zur Gänze unter einer weißen Haube, wie es auch meine Zuckerbäcker tun. Es ist eine große Ehre für mich, dass ich den Auftrag erhalten habe, das Dessert-Buffet zum Silberhochzeitsmahl mit kleinen Mokkaprinzentörtchen zu bestücken. Undenkbar, wenn da ein Haar in den Teig oder die Creme fallen würde. Und«, er hob die Hand, als Sophie ihm schon ihr Versprechen geben wollte, »du verhältst dich mucksmäuschenstill und störst niemanden. Du schaust einfach nur zu!«
Sophie nickte etwas eingeschüchtert. Selbst jedes Kind in Wien wusste, dass das Kaiserpaar in dieser Woche seine Silberhochzeit feierte. Die ganze Stadt fieberte dem Ereignis entgegen, insbesondere dem großen Festzug, den der bekannte Künstler Hans Makart zu Ehren von Franz Joseph und Sisi gestaltet hatte, wie Kaiserin Elisabeth nicht nur im engen Familienkreis, sondern auch vom Volk genannt wurde.
Ida half Sophie in eine übergroße Kittelschürze und verbarg deren Zöpfe unter der Haube. Dann führte sie das Mädchen die Hintertreppe hinab in die Backstube.
»Servus, Toni«, grüßte sie den Zuckerbäckermeister, der mittlerweile, zu Stephan Danzers großem Leidwesen, den größten Teil seiner ehemaligen Tätigkeiten übernommen hatte. Aber nach dem Tod seiner Frau erlaubte die Führung des Cafés Prinzess seinem Besitzer nur noch in Ausnahmefällen, selbst in der geliebten Backstube zu werkeln. »Hier bringe ich dir die Phiefi. Sicherlich ist sie euch eine große Hilfe!« Sie zwinkerte Toni zu.
»Aber«, wollte Sophie eingedenk des Versprechens an ihren Onkel, möglichst unbemerkt zu bleiben, schon einwenden, als Ida ihr einen Finger auf den Mund legte. »Pscht! Du willst doch nicht nur allen nutzlos im Wege stehen. Was der Onkel nicht weiß, macht ihn nicht heiß.«
»Also«, wandte sie sich noch einmal an den Zuckerbäckermeister, »gib der Phiefi was G'scheites zu tun. Du weißt ja, wie gut sie sich in allem anstellt.« Mit diesen Worten huschte Ida die Treppe wieder hinauf.
»Tjaaa …« Toni musterte Sophie mit gespielt angestrengter Miene. »Was könntest du denn wohl helfen? Ach, jetzt weiß ich’s!« Er schlug sich mit seiner bemehlten Hand an die Stirn, die dort eine weiße Spur hinterließ. »Markus!«, rief er alsdann dem Lehrbuben zu. »Zeig Phiefi doch mal, wie sie die Böden für die Torterln mit ausstechen kann.«
Schon wenig später beugte sich Sophie mit vor Anstrengung gerunzelter Stirn über die rechteckigen Biskuitböden und versenkte das kreisrunde Ausstechförmchen vorsichtig in das duftende, noch lauwarme Backwerk.
»Schau, dass des Formerl ganz dicht an' letzten Ausstich setzt, damit nur a bisserl Teigboden verlor'n geht«, meinte Markus und zeigte ihr, wie es ging. »Die übrig ‘bliebenen Bröseln dürf‘n mir nachher mit Schlagobers essen. Und wenn‘st a ganze Lag‘ ausg‘stochen hast, löst die Torterl-Böden ganz achtsam mit‘m Schieber raus. Schau, so geht’s! Musst aufpassen, dass der Boden ned zerbricht, sonst können mir‘n nimmer verwenden. Dann legst die Torterln da auf‘s g‘fettete Papier. Der Toni und der Willi setzen‘s dann später mit der Mokkacreme z’sammen.«
»Gut machst des, Phiefi! Wärst a gute Zuckerbäckerin! Schad, dass des ned möglich is«, lobte Markus sie zu ihrer Freude nach ihren ersten erfolgreichen Versuchen.
»Warum denn?«, protestierte Sophie umgehend. »Wenn ich erwachsen bin, will ich dieses Handwerk auch erlernen!«
Markus grinste. »Ein adliges Fräulein wie du kann gar keinen Beruf erlernen!«, belehrte er sie. »Schon gar kein ehrbares Handwerk!«
Das werden wir schon noch sehen!, schoss es Sophie durch den Kopf. Am liebsten hätte sie vor Zorn mit dem Fuß aufgestampft. Im letzten Moment erinnerte sie sich jedoch an das Versprechen, das sie ihrem Onkel Stephan gegeben hatte, und beherrschte sich. Trotzig wandte sie sich wieder dem Ausstechen der Böden für die Törtchen zu und erwiderte nichts mehr auf Markus’ letzte Bemerkung.
Der merkte natürlich, dass sie sich über ihn geärgert hatte. »Magst mir später auch dabei helfen, die Marzipanprinzen ausstechen?«, fragte er sie nach zehn Minuten verbissenen Schweigens. »Schau, der Meister rollt die Mass‘ scho aus.«
»Oh ja!«, jubelte Sophie, deren Zorn meist genauso rasch wieder verrauchte, wie er aufkam.
»Musst‘s genauso machen wie mit die Böden«, zeigte ihr Markus schon wenig später, was sie zu tun hatte. »Die Blechformerln zum Ausstechen von die Prinzen sind natürlich a Spezialanfertigung für‘s Café Prinzess. Die gibt’s in a paar Größen. Für die Torterln verwenden wir in diesem Fall die mittelgroßen.« Er hielt eins der Förmchen in die Höhe.
»Aba musst achtgeben, dass die Mass ned an der Ausstechform hängenbleibt und der Turban oder die Schnabelschuh abbrechen. Damit des ned passiert, tauchst des Formerl z’erst immer ins Wasser!«
Tatsächlich brauchte Sophie diesmal ganze fünf Versuche, bis sie den Bogen heraushatte. Zum Trost durfte sie die in den Ausbuchtungen des Förmchens hängen gebliebenen Marzipanstückchen naschen, während die verunstalteten Prinzen zusammengedrückt und wieder in die Schüssel mit dem Marzipanteig wanderten, um erneut geknetet und ausgerollt zu werden.
Schließlich war auch diese Arbeit getan. Fünfzig Prinzen warteten nun auf ihre Bemalung. Zu ihrem Bedauern durfte Sophie dabei nur zusehen.
Staunend verfolgte sie, wie Toni zunächst die Konturen der Mokkaprinzen mit einem dünnen Pinsel und schwarzer Farbe aufzeichnete. »Was verwendet er da?«, konnte sie ihre Neugier nicht bezähmen, obwohl sie versprochen hatte, still zu sein.
»Des is Hollersaft«, flüsterte Markus zurück. »Kirschsaft nehmen mir für die Hosen, Safran für‘s gelbe Hemd, Spinatsaft für‘n Turban.«
»Igitt!«, schreckte Sophie zurück. Sie hasste Spinat.
Markus grinste. »Des is aba alles mit Honig g‘süßt und mit Maismehl an’dickt. Des schmeckst nimmer mehr raus.«
Fasziniert beobachtete Sophie, wie aus dem ausgestochenen Marzipan die typischen Mokkaprinzen entstanden. Toni arbeitete rasch. Nachdem das Kostüm fertig war, erhielt jeder Mohr zuletzt sein braunes Gesicht. »Braun ist leicht«, mutmaßte sie. »Dafür nehmt ihr sicher Kaffee!«
Markus schüttelte den Kopf. »Na, Kakao färbt besser braun als wie Kaffee.«
Zwei vorsichtig in die Masse gedrückte Hagelzuckerstückchen bildeten die Augen, ein Strich mit der Kirschfarbe den breiten roten Mund. Schon war ein Mohr fertig.
»Jetz muss des alles noch a paar Stund‘ trocknen«, erklärte Markus ihr schließlich. »Dann legen mir die Prinzen auf die fertigen Torterln.«
Die unerwartete Enttäuschung verengte Sophies Kehle. Also würde es heute gar keine Pannentörtchen geben, von denen sie kosten konnte.
Toni betrachtete sie aufmerksam. »Was für a Laus is dir denn jetz über die Leber g‘laufen, Phiefi?«, fragte er. »Hat’s dir bei uns ned g‘fallen?«
»Doch sehr!«, beeilte sich Sophie zu versichern. »Ich dachte nur … ich hoffte …« Sie stammelte und suchte nach den richtigen Worten.
Ob Toni ahnte, was sie bewegte, oder ob es einfach dem Zufall geschuldet war, um sie abzulenken, ließ sich später nicht mehr ausmachen. Jedenfalls meinte er gutmütig: »Also, fertig wer’n die Torterln erst morgen. Heut Nacht stehn’s noch in der Kühlkammer. Aba a paar sind beim Z’sammsetzen von die Böden zerbrochen. Magst einmal kosten?«
Sophie nickte begeistert. Mit geschlossenen Augen ließ sie den ersten Bissen auf der Zunge zergehen. Zu ihrer Überraschung schmeckte er leicht bitter.
Toni und Markus grinsten, als sie die Augen wieder öffnete. Offensichtlich waren sie nicht überrascht. »Musst Kaffee mögen, damit’st uns‘re Mokkaprinzentorte genießen kannst«, sagte Toni. »Vielleicht bist dafür noch a bisserl zu jung!«
»Ich bin nicht zu jung«, antwortete Sophie trotzig. »Es schmeckt ganz vorzüglich, und ich bitt recht schön um ein weiteres Stück.«
Achselzuckend kam Markus ihrer Bitte nach. »Wenn‘s ganz mit Marzipan überzogen is, schmeckt ‘s auch süßer.«
»Ich sagte dir doch, es ist ganz vorzüglich«, beharrte Sophie gestelzt. Tatsächlich schmeckte ihr der zweite Bissen besser, ob nun aus Einbildung oder aus Gewöhnung.
In diesem Augenblick begannen die Glocken des Stephansdoms zu läuten. »Ach Gott!« Sophie schlug sich vor Schreck die Hand vor den Mund. »Es ruft schon zur Vesper. Der Papa wird jeden Augenblick da sein, um mich abzuholen.«
Da kam auch schon Ida die Treppe hinunter. »Spute dich, Kind!«, mahnte sie. Noch während Sophie die Schürze abband, fuhr der Einspänner ihres Vaters vor.
»Und, hattest du einen schönen Nachmittag, Phiefi?«, fragte Nikolaus von Werdenfels, als sie gemeinsam in der Kutsche saßen.
Sophie schmiegte sich an ihn und genoss den vertrauten Duft nach Eau de Cologne und Tabak. »Ja, Papa. Es war ganz herrlich! Ich habe in der Backstube geholfen und die Mokkaprinzentorte gekostet. Sie ist bitter, aber ich werde mich schon noch an den Geschmack gewöhnen, wenn ich erst einmal erwachsen bin.«
»Ja, das denke ich auch!« Ihr Vater lächelte und drückte ihr einen Kuss auf den Scheitel.
Es war einer der letzten glücklichen Tage in Sophies Kindheit.
Teil 1 Ouvertüre
Kapitel 1
Prag
Herbst 1879
»Nun komm, mein Schatzerl! Zier dich nicht so!«
Weinselig zerrte Richard von Löwenstein das Prager Schankmädel auf seinen Schoß und versuchte, ihm seine Hand ins Mieder zu schieben. Eine schallende Ohrfeige war die Folge.
Während sich Richard unter dem Gelächter seiner Offizierskameraden die brennende Wange hielt und den Kopf hin und her schüttelte, um das Dröhnen in seinem Ohr loszuwerden, befreite sich die junge Frau und stürzte davon. Wenig später erschien der Wirt des Gasthauses an ihrem Tisch.
»Meine Herren!« Sein verkniffener Gesichtsausdruck strafte seine unterwürfige Verbeugung Lügen. »Ich bitte recht schön darum, meine Schankmädchen nicht zu belästigen. Dies ist ein ehrbares Haus. Wenn Sie andere Dienste als die meinen in Anspruch nehmen möchten, finden Sie das nächste Hurenhaus gleich zwei Straßen weiter.«
Er wollte gerade nach dem leeren Weinkrug und den irdenen Bechern greifen, die das Mädchen hatte abräumen wollen, als sich Richard des Gefäßes bemächtigte. »Ohnehin ist gleich Sperrstunde.« Der vierschrötige Mann verbeugte sich noch einmal. »Ich darf nun abkassieren und danke für Ihren Besuch.«
Mürrisch griffen die drei Offiziere des 36. k. u.k Infanterie-regiments nach ihren Börsen und warfen einige Münzen auf den Tisch.
»So ein Spaßverderber! Mitternacht ist kaum vorüber.«
»Es ist halt a Jud, Schurli!«, besänftigte ihn sein Kamerad mit spöttischer Stimme. »Und du, Richie«, wandte er sich an Richard, »hast wohl eine seiner Töchter erwischt. Du weißt doch, dass das Judenvolk so was nicht leidet.«
Damit spielte er auf die stadtbekannte Geschichte an, dass sich Kronprinz Rudolf, der Kommandant ihres Regiments, höchstpersönlich in ein Judenmädchen verliebt hatte, das seine Gefühle auch erwiderte. Dessen besorgte Eltern hatten es daraufhin allerdings in aller Eile aufs Land geschafft und mit einem alten Krämer ihrer eigenen Glaubensrichtung verheiratet, damit es seine Unschuld nicht an den Kronprinzen verlor. Wie es hieß, hatte das Mädchen das nicht verkraftet und war kurz nach der Hochzeit an einem Nervenfieber gestorben. Im Regiment ging das Gerücht um, dass der Kronprinz untröstlich über den Tod der Geliebten sei.
»Ja, hier nutzt dir auch dein ›Löwenherz‹ nichts«, grinste der Schurli genannte Mann. »Löwenherz« war Richard von Löwensteins Spitzname. Aufgrund seines oft an Tollkühnheit grenzenden Wagemuts trug er ihn bereits seit ihrer gemeinsamen Kadettenzeit in der Theresianischen Akademie, die in Wiener Neustadt lag und als die beste im ganzen Kaiserreich galt.
»Halt ’s Maul, Schurli!« Richard schüttelte auf dem Weg nach draußen wegen des Dröhnens in seinem Ohr noch immer den Kopf hin und her. »Und du auch, Ferdi!«, schnauzte er auf der nächtlichen Straße seinen zweiten Kameraden an, der ihn grinsend musterte.
Ferdi schlug Richard auf die Schulter. »Nun hab dich nicht so, Richie! In unserer ersten Schlacht wirst du Schlimmeres aushalten müssen. Doch der Vorschlag des Juden ist gut. Lass uns noch im Puff von Madame Albertina einkehren!« Er griff sich in den Schritt und rieb sein Gemächt unter der Uniformhose aus blauem Tuch. »Die Huren dort sind vom Feinsten!«
»Und völlig verseucht, wie es heißt!« Schlagartig war Richard nüchtern. »Da hat sich schon so mancher den Tripper oder noch Schlimmeres geholt.«
»Ach was!«, wehrte Ferdi ab. »Wir sehn uns halt vor!«
Richard lag schon die Frage auf der Zunge, wie sie das denn bewerkstelligen wollten, als er an den lüsternen Mienen seiner Kameraden sah, dass sie durch keinen Einwand von ihrem Entschluss abzubringen waren.
»Ich muss schon in ein paar Stunden auf dem Exerzierplatz stehen«, wehrte er daher ab. Dieses Argument war eigentlich unsinnig, denn auch Schurli und Ferdi, beide Leutnants wie er, würden zur selben Uhrzeit um sechs Uhr früh mit ihren Kompanien antreten müssen.
»Ich geh dann mal zurück ins Quartier!«, kam er diesem Einwand zuvor und wandte sich zum Gehen. »Macht’s gut und seid achtsam!«, rief er den beiden noch über die Schulter hinweg zu. Achselzuckend trotteten sie in die andere Richtung davon.
Richard atmete tief durch und schüttelte ein letztes Mal den Kopf wegen seines immer noch rauschenden Ohrs. Abfuhren wie die, die er sich soeben von der jüdischen Wirtstochter geholt hatte, war er an sich nicht gewohnt. Mit seiner schlanken, aufgrund des vielen Exerzierens muskulösen Gestalt, den dunkelbraunen Haaren und Augen galt er als »fesch«, zumal wegen seiner noch hinzukommenden stattlichen Größe von über ein Meter achtzig. Der kleine Schnauzer in Kombination mit der weißlichen Narbe auf der linken Wange, dem Ergebnis einer außer Kontrolle geratenen Fechtübung in der Militärakademie, verlieh seinem Gesicht zudem etwas Verwegenes.
»Du siehst aus wie ein Pirat!«, hatte ihm schon so manche seiner Liebschaften bescheinigt.
Mithilfe seines guten Aussehens machte er so aus der Not eine Tugend. Denn anders als seine Offizierskameraden, die allesamt aus reichen adligen oder großbürgerlichen Elternhäusern stammten, war Richard auf seinen schmalen Leutnantssold angewiesen, der kaum einhundert Gulden pro Monat betrug. Damit konnte man keine großen Sprünge machen, musste er davon doch auch seine Ausrüstung instand halten, seinen Burschen entlohnen und sich ab und an eine anständige Mahlzeit gönnen, um dem Kasernenfraß zu entgehen.
Gar nicht zu reden von den üblichen Saufgelagen, bei denen er nicht zurückstehen wollte, waren ihm doch schon Besuche in den Spielhöllen und Freudenhäusern aufgrund seiner klammen Finanzen versagt.
Insbesondere die Letzteren hatte Richard zum Glück auch nicht nötig. Denn die Herzen der einfachen Kleinbürgermädchen, an die er sich in der Regel hielt, flogen ihm zu. So konnte er seine Bedürfnisse als junger Mann von neunzehn Jahren auch in dieser Hinsicht befriedigen, ohne dass ihn dies mehr kostete als kleine Blumenbuketts und ein paar Schachteln Konfekt.
Zudem blieb er gesund und ersparte sich die langwierigen und schmerzhaften Behandlungen, die venerische Krankheiten nun einmal nach sich zogen. Wobei die »Franzosenkrankheit«, also die Syphilis, nicht einmal mit den Quecksilberkuren, bei denen einem häufig die Haare und Zähne ausfielen, völlig geheilt werden konnte.
Auch bildete sich Richard etwas darauf ein, noch keins der Mädchen geschwängert zu haben. Das lag vor allem daran, dass er sie in der Regel rasch wieder fallen ließ, nachdem er sie verführt hatte. Um die zerstörte Jungfräulichkeit, den beschädigten Ruf und die gebrochenen Herzen seiner Verflossenen scherte er sich wenig. Er war ein Leutnant Seiner Majestät, Kaiser Franz Joseph, noch dazu von uraltem Adel! Keins der jungen Dinger, die sich ihm leichtfertig hingaben, konnte im Ernst damit rechnen, dass er sie zum Traualtar führen würde. Zumal er sich hütete, derartige Versprechungen zu machen, worauf er sogar stolz war.
»Ich kriege die Madl auch ohne so einen verlogenen Schmus herum!«, pflegte er, bei seinen durchaus neidischen Kameraden mit seinen Eroberungen zu prahlen.
Nun schlug Richard den Weg zu seiner Kaserne ein. Der führte ihn zunächst ein Stück weit in Richtung des Hradschins, der Burg der ehemaligen böhmischen Könige, wo auch der Kronprinz mit seinem Gefolge residierte.
Ihn kannte Richard bislang nur flüchtig. Seit er vor sechs Monaten nach Prag versetzt worden war, hatte er ihn lediglich auf einigen Empfängen für die Offiziere seines Regiments, die der leutselige Kronprinz ab und zu abhielt, kurz und nichtssagend gesprochen. Bei dem Manöver im Sommer sah er ihn als Kommandanten nur aus der Ferne. Zu mehr hatte es bislang nicht gereicht. Denn zu den Treffen im kleineren Kreis, zu denen Rudolf einige seiner Offiziere wöchentlich einlud, wurde er nicht gebeten.
Dabei gehörten die von Löwensteins zum uralten und damit hoffähigen Adel der k. u. k. Monarchie. Doch die Familie war seit Generationen verarmt und spielte daher im gesellschaftlichen Leben Wiens nur eine untergeordnete Rolle.
Während Richard kräftig ausschritt, um zumindest noch ein paar Stunden Schlaf vor dem morgigen harten Tag zu finden, hörte er plötzlich einen jammernden Laut. Verblüfft blieb er stehen und lauschte. Tatsächlich klangen die Töne wie ein unterdrücktes Schluchzen. Nun konnte er auch einige Wortfetzen verstehen.
»Arme Rebecca … bringe allen Menschen nur Unglück … bin es nicht wert, geliebt zu werden … schon meine Mutter spürte das … bevorzugt meine Schwester Marie Valerie …«
Verblüfft zog Richard die Luft durch die Zähne. Marie Valerie war die jüngste Tochter des Kaiserpaars. Wenn dort also jemand sein Los unter Verwendung ihres Namens beklagte und die Prinzessin seine Schwester nannte, konnte das denn wirklich …?
Nun wurden die Klagen lauter. Richard lugte vorsichtig um die Ecke der Gasse, aus der das Jammern kam. Dann wich er in eine Hausnische zurück. Trotz seiner Vorahnung glaubte er, seinen Augen und Ohren zunächst nicht zu trauen.
Da kommt wirklich der Kronprinz des Weges daher, realisierte er, als dieser in den Lichtkegel einer Laterne trat. Die Gerüchte, die ich bislang für dummes Geschwätz hielt, scheinen also richtig zu sein. Rudolf zieht nachts allein durch die Straßen Prags, um das Grab des Judenmädchens zu besuchen und ihren Tod zu betrauern. Das ist kaum zu glauben!
Richard zog sich noch weiter in den Schatten des Hauses zurück. Nicht auszudenken, wenn er mich entdeckt und erkennt! Wahrscheinlich erhalte ich dann schon morgen meine Versetzung nach Ruthenien oder in eine andere abgelegene Gegend des Reiches.
Tatsächlich wankte Kronprinz Rudolf, immer noch schluchzend, an ihm vorbei, ohne ihn zu bemerken. Richard wollte sich schon aufatmend in die entgegengesetzte Richtung in Bewegung setzen, auch wenn er damit einen Umweg zu seiner Kaserne in Kauf nehmen musste, als er die beiden Gestalten bemerkte, die dem Kronprinzen folgten. Sie schienen ihm nachzuschleichen. Beide hatten ihre Gesichter bis über die Nase mit schwarzen Tüchern verhüllt.
Schon zückte einer der Männer einen Dolch, der im Mondlicht aufblitzte. Sie wollen ihn ausrauben! Ohne lange nachzudenken, riss Richard seinen Säbel aus der Scheide. Die Männer waren höchstens noch zehn Meter von Rudolf entfernt.
»Obacht, Hoheit!«, brüllte er. Dann stürmte er auf die Straßenräuber zu. Jetzt schnellte auch Rudolf mit gezogener Pistole herum und zielte auf die Angreifer, die mitten im Schritt verharrten. Angesichts ihrer Entdeckung und der Waffen Richards und Rudolfs, die den ihren weit überlegen waren, gaben sie Fersengeld, bevor Richard herangekommen war.
Spontan stellte er sich Rudolf in den Weg, der mit seiner Pistole auf die Rücken der Flüchtenden zielte.
»Lassen Sie es gut sein, Hoheit!«, keuchte er atemlos. »Sie wollen doch sicher kein Aufsehen um diese nächtliche Stunde erregen!«
Beschämt ließ Rudolf die Waffe sinken. Er musterte Richard im diffusen Mondlicht. »Mit wem habe ich die Ehre?« Nun klang seine Stimme nicht mehr weinerlich, sondern ruhig und beherrscht.
Richard schlug die Hacken zusammen und salutierte. »Richard von Löwenstein, Eure Hoheit. Leutnant der 10. Kompanie des 36. Infanterieregiments.«
»Wie es scheint, bin ich Ihnen zu Dank verpflichtet, Leutnant von Löwenstein.« Rudolf wandte sich zum Gehen. »Seien Sie so freundlich, mich zu meinem Quartier zu begleiten. Und morgen um sieben Uhr melden Sie sich bei meinem Adjutanten.«
Prag
November 1881, ungefähr zwei Jahre später
»Mich dünkt, der Ehestand hat nicht allzu viel an deinem Lebenswandel geändert.«
Obwohl Richard wusste, dass diese Bemerkung selbst angesichts seiner Freundschaft zu Rudolf, die bereits am Tag nach der nächtlichen Episode in Prag begonnen hatte, gewagt war, konnte er sie sich diesmal nicht verkneifen. Er wartete jetzt bereits seit über einer Stunde auf den Kronprinzen, die dieser offensichtlich mit einem Schäferstündchen verbracht hatte, anstatt ihre Verabredung einzuhalten.
»Nun sei nicht allzu streng mit mir!« Rudolf hob begütigend eine Hand. Mit der anderen strich er sich über seine immer länger werdenden rotbraunen Koteletten, die er unter dem Kinn zusammenwachsen ließ. Richard konnte dieser gerade in Mode gekommenen Barttracht nichts abgewinnen und trug nach wie vor nur seinen stets kurz gehaltenen dunklen Schnauzer.
Der Kronprinz seufzte tief. »Schließlich bist du nicht mit einem siebzehnjährigen Mauerblümchen verheiratet, das wohl kaum einen Gatten gefunden hätte, wäre es nicht die Tochter des belgischen Königs.«
»Du kannst dir deine Gattin einmal nach deinem eigenen Geschmack wählen«, fügte Rudolf noch hinzu.
»Nun ja«, ein bitterer Zug erschien um Richards Mund, »das steht noch dahin. Vorerst kann ich mir eine Heirat mit meinem Sold nicht einmal leisten.« Auch er hob nun die Hand, allerdings in einer abwehrenden Geste. »Trotz der beiden Beförderungen, die ich dir verdanke, und deinen großzügigen Zuwendungen, die du mir immer wieder zukommen lässt. Denn auf diese könnte ich mich ja schwerlich berufen, wenn ich um ein Mädchen freie.«
»Kommt Zeit, kommt Rat!«, ließ Rudolf Richards Einwand nicht gelten. »Jedenfalls zwingt dich keine Staatsräson dazu, eine Frau zu ehelichen, der kein Mann etwas abgewinnen könnte.«
»Ich dachte, Stephanie von Belgien wäre deine eigene Wahl gewesen«, wandte Richard ein. »Anfangs hast du doch sogar von ihr geschwärmt.«
Rudolf machte eine wegwerfende Handbewegung. »Da hoffte ich auch noch, dass sie mir wenigstens geistig eine ebenbürtige Partnerin wäre, wenn sie schon nicht hübsch ist. Stattdessen ist sie ein rechtes Gänschen.«
Richard biss sich auf die Lippen, während er überlegte, was er darauf antworten sollte. Bislang hatte er das heikle Thema von Rudolfs Brautschau im Frühling 1880, der anschließenden Verlobung in Brüssel und der Hochzeit im Mai dieses Jahres in der Augustinerkirche in Wien eher vermieden. Er wollte Rudolf nicht in Verlegenheit bringen.
Denn durch ihre seit nunmehr über zwei Jahre währende Verbindung und seine Nähe zum Kronprinzen, der ihn bereits wenige Monate nach dem vereitelten Raubüberfall in Prag in seinen Stab berufen hatte, wusste er natürlich mehr vom Liebesleben des Thronfolgers, als ihm lieb war.
Dazu gehörte auch die Tatsache, dass sich Rudolf trotz seines anfänglich tiefen Schmerzes doch relativ rasch über das verstorbene Judenmädchen Rebecca hinweggetröstet hatte. Eine ihrer zahlreichen Nachfolgerinnen hatte der Kronprinz als Liebesgespielin sogar mit nach Brüssel genommen, als er um Stephanies Hand anhielt.
Doch was soll man auch anderes von einem Mann erwarten, der schon als Jüngling in die Hände eines Grafen Bombelles gefallen ist, dachte Richard nun zum wiederholten Mal. Graf Carl von Bombelles, der Rudolfs Hofstaat als Obersthofmeister führte, galt als ein ausgemachter Lebemann und war dem Thronfolger sicher nicht zufällig zugeteilt worden, als dieser alt genug gewesen war, um einen eigenen Haushalt zu beanspruchen.
Böse Zungen behaupteten sogar, dass Kaiser Franz Joseph Bombelles höchstpersönlich ausgesucht hätte, um seinen Sohn, der ihm aufgrund seiner Neigungen zu vergeistigt war, mit amourösen Abenteuern von allem abzulenken, was mit der Leidenschaft Rudolfs für die Vogelkunde oder die politische Zukunft des Habsburgerreichs zu tun hatte. Insbesondere darüber hatte Rudolf seine ganz eigenen, liberal zu nennenden Ansichten, die in krassem Gegensatz zu denen seines erzkonservativen Vaters standen.
Und Bombelles hat wahrlich ganze Arbeit geleistet, sinnierte Richard weiter, noch immer um eine Antwort verlegen.
Schon vor ihrer Hochzeit galt Rudolfs jetzige Gattin Stephanie als ausgesprochen hässlich. Bei der Hochzeitsfeier, die Richard gemäß seines niedrigen Stellenwertes im Hochadel nur aus der Ferne hatte beobachten können, war es ihm noch nicht möglich gewesen, sich ein eigenes Bild von ihr zu machen. Doch selbst aus der Distanz wirkte die Braut eher plump und ungelenk auf ihn.
Rasch munkelte man zudem, sie sei am Wiener Hof nicht sonderlich beliebt. Allen voran konnte Rudolfs Mutter Sisi ihre Schwiegertochter vorgeblich nicht leiden und bezeichnete sie sogar als »repräsentationssüchtiges Trampeltier«.
Rudolf durchbrach schließlich selbst die peinliche Schweigepause und seufzte ein weiteres Mal. »Stephanie war die Einäugige unter den Blinden.« Er fixierte Richard scharf mit seinen jetzt blassbraunen Augen. Es faszinierte Richard immer wieder, wie sich Rudolfs Augenfarbe seiner Befindlichkeit anpasste und von leuchtendem Braun bis ins Grünliche hinein changieren konnte.
»Du weißt doch, wie wenig Alternativen ich hatte. Es musste durchaus eine Königstochter katholischen Glaubens sein. In Madrid und Lissabon war die Auswahl noch grauslicher. Da ich zudem die Louise schon kannte«, dies war die ältere Schwester Stephanies, die mit einem Jagdfreund Rudolfs, dem Prinzen Philipp von Sachsen-Coburg, verheiratet war, »hab ich halt die Stephanie genommen. Was blieb mir denn anderes übrig? Immerhin hatte ich den Vorteil einer langen Verlobungszeit und konnte so noch meine Orientreise machen.«
Von Februar bis April 1881 hatte Rudolf zehn Wochen lang solch exotische Länder wie Ägypten und Palästina bereist.
Richard suchte weiter betreten nach einer taktvollen Erwiderung. Natürlich war auch ihm bekannt, dass die Verlobung am 7. März 1880 zu einem Zeitpunkt stattgefunden hatte, zu dem die in dieser Hinsicht unterentwickelte Braut noch nicht empfängnisfähig gewesen war. Geschlagene vierzehn Monate hatte der Kaiserhof warten müssen, bis es endlich zur Hochzeit gekommen war. Und obwohl Rudolfs Mutter Sisi darauf bestanden hatte, mit der Trauung zu warten, bis Stephanie endlich ihre monatlichen Blutungen bekam, ging das Gerücht, dass es in der Hochzeitsnacht im Mai 1881 durchaus noch nicht so weit gewesen war.
Eher üblich war es dagegen, dass sich die Brautleute bei der Hochzeit kaum kannten. Zumal sich Rudolf wenig Mühe gegeben hatte, den Kontakt zu Stephanie während der Verlobungszeit zu suchen, sondern stattdessen sein ausschweifendes Junggesellenleben fortgesetzt hatte.
Das war ein heikler Punkt in Richards Beziehung zu Rudolf. So gern er diesen auch auf die Jagd begleitete, der der Kronprinz leidenschaftlich frönte, und sosehr er die langen Gespräche bei einem guten Glas Wein und den von Rudolf bevorzugten türkischen Zigaretten genoss, so wenig schätzte er es, ihn bei seinen regelmäßigen Bordellbesuchen zu begleiten. Nach wie vor fürchtete er die Ansteckung mit einer Geschlechtskrankheit, die mittlerweile auch seine alten Leutnantsfreunde Schurli und Ferdi erwartungsgemäß erwischt hatte. Ferdi war sogar zeitweise dienstuntauglich geschrieben worden.
Schließlich hatte Richard aus der Not eine Tugend gemacht. Da Rudolf für alle Unkosten ihrer gemeinsamen Aktivitäten aufkam, also auch für ihre Bordellbesuche, legte er selbst noch ein paar Gulden drauf, um seine Bettgenossinnen zum Schweigen darüber zu verpflichten, dass er ihre Dienste höchstens manuell oder oral, meistens aber gar nicht in Anspruch nahm.
»Also hast du dein Glück noch nicht gefunden«, sagte er nun lahm und merkte selbst, wie dümmlich seine Bemerkung klang.
Rudolf zuckte mit den Achseln. »Könntest du mit Stephanie glücklich werden?«
Wenn Richard ehrlich war, musste er dies verneinen. Über Stephanies Intellekt hatte er sich noch immer keine Meinung bilden können, sehr wohl aber über ihr Aussehen. Offenbar betäubte sie ihren Kummer über die Ablehnung des Wiener Hofs und Rudolfs Gefühlskälte mit ausgiebigem Essen. Damit stand sie ganz im Gegensatz zu ihrer Schwiegermutter Sisi, die zwar ebenfalls aufgrund ihres exzentrischen Lebensstils immer unbeliebter wurde, sich aber fast zu Tode hungerte, wenn man sie kränkte.
Jedenfalls hatte Stephanie seit der Hochzeit erheblich an Gewicht zugelegt. Erst vor wenigen Wochen war Richard ihr zum ersten Mal persönlich im Rahmen einer Abendgesellschaft begegnet, zu der Rudolf auf den Hradschin geladen hatte. Ihre Haare, Augenbrauen und Wimpern waren tatsächlich so dünn und farblos, wie man sie Richard beschrieben hatte, die Augenlider gerötet, die Frisur unvorteilhaft aufgetürmt, was ihr Gesicht noch eiförmiger wirken ließ, als es aufgrund des fliehenden Haaransatzes ohnehin schon war.
Nach dem Souper hatte sie Richard dennoch leidgetan, da sich Rudolf allzu offensichtlich mit einer ihrer Hofdamen befasste und seine Gattin kaum beachtete. Als er jedoch versuchte, die Kronprinzessin in eine Konversation zu ziehen, erfuhr er am eigenen Leib einen hässlichen Wesenszug, den man ihr ebenfalls nachsagte. Seine höflichen Fragen beantwortete Stephanie knapp und nichtssagend in schnippischem Tonfall und nutzte die erste Gelegenheit, diesem offensichtlich aufgrund Richards Bedeutungslosigkeit für sie uninteressanten Gespräch zu entkommen.
So hätte er also Grund genug gehabt, Rudolfs Frage mit einem aufrichtigen Nein zu beantworten, entschloss sich aber zu einer diplomatischeren Variante, um ihr Gespräch fortzusetzen.
»Was hast du denn nun in Wien erlebt?«, lenkte er auf ein unverfänglicheres Thema ab.
Ein Strahlen glitt über Rudolfs Gesicht und ließ es sofort viel attraktiver erscheinen. Nur wenn in Rudolfs nun leuchtend braune Augen jener Glanz trat, den Richard jetzt darin bemerkte, konnte er nachvollziehen, warum der Kronprinz der von jungen Frauen und Mädchen umschwärmteste Mann im ganzen Kaiserreich war. Daran hatte auch seine Hochzeit nichts geändert.
»Ich habe einen ganz faszinierenden Mann kennengelernt, der mir sehr von Nutzen sein kann.« Rudolf stockte geheimnisvoll.
»Wer ist es denn?«, tat ihm Richard den erwarteten Gefallen und hakte nach.
»Der Mann heißt Moritz Szeps.«
»Der jüdische Herausgeber des Neuen Wiener Tagblatts?«, fragte Richard verblüfft.
»Kennst du den Mann?«, fragte Rudolf nun seinerseits erstaunt.
»Nicht persönlich!«, wehrte Richard ab. »Aber seine Gazette machte ja allerhand Furore in den letzten Jahren. Sie gilt als eine der letzten liberalen Tageszeitungen in Wien.«
Rudolf nickte. »So ist es. Ihre Auflage ist mehrere Zehntausend Exemplare hoch.«
»Und du willst darin deine anonymen Artikel veröffentlichen?« Richard kannte Rudolfs Passion fürs Schreiben. Der Kronprinz verfasste neben naturwissenschaftlichen Werken, vor allem über sein Steckenpferd, die Vogelkunde, schon seit etlichen Jahren auch Artikel mit kritischen politischen Inhalten. Nachdem er die ersten veröffentlichten Schriften noch namentlich gekennzeichnet hatte, war es zu scharfer Kritik vonseiten seines Großonkels, des mächtigen Erzherzogs Albrecht, gekommen. Albrecht war als Generalinspekteur des Heeres der mächtigste Mann im Militär und Rudolfs Vorgesetzter. Infolgedessen hatte sich erwartungsgemäß auch Rudolfs Vater, Kaiser Franz Joseph, kritisch über die journalistischen Versuche seines einzigen Sohnes geäußert, die er eines Thronfolgers für nicht würdig erachtete.
Die Differenzen zwischen Vater und Sohn waren gewachsen, seit der konservative Graf Eduard von Taaffe, ein Jugendfreund des Kaisers, vor zwei Jahren seinen liberalen Vorgänger als Ministerpräsident abgelöst hatte. Rudolfs Befürchtungen, dass von Taaffe durch seine auf Föderalismus ausgerichtete Politik der nationalen Einheit des Habsburgerreichs schaden könnte, fanden nicht nur kein Gehör bei seinem Vater, sondern wurden von diesem sogar als eitles Geschwätz abgetan.
Da Rudolf nie einen Hehl daraus gemacht hatte, dass er die politische Linie von Taaffes ablehnte, wurde er seither nicht nur rund um die Uhr von dessen Geheimagenten bespitzelt, sondern auch systematisch von politisch wichtigen Informationen abgeschnitten. »Ich weiß absolut nichts von dem, was vorgeht«, pflegte Rudolf sich auch bei Richard immer wieder zu beklagen.
Jetzt nickte der Kronprinz erneut begeistert. »Moritz Szeps und ich liegen politisch vollkommen auf einer Linie. In seinem Blatt kann ich nicht nur unbehelligt schreiben, was ich denke, sondern erfahre von ihm auch endlich, was im Reich so alles passiert. Szeps hat ganz ausgezeichnete Kontakte, sowohl im Inland als auch im Ausland.«
Richard war weniger begeistert. »Ich gönne dir diese Chance von Herzen«, sagte er zwar, fügte aber gleich danach hinzu: »Doch es klingt so, als sei deines Bleibens in Prag nicht mehr allzu lange.«
Tatsächlich hatte Rudolf dafür gesorgt, dass Richard mittlerweile zu seinen Stabsoffizieren gehörte. In diesem Rahmen hatte er ihm auch bereits zu zwei rasch aufeinanderfolgenden Beförderungen verholfen, zuerst zum Oberleutnant und vor einigen Monaten zum Hauptmann.
»Wenn ich Prag verlasse, gehst du einfach mit mir«, beruhigte Rudolf, der Richards Sorgen spürte, ihn nun.
»Und wenn du durchaus zu den Dragonern willst, verschaffe ich dir eine Stelle im 2. Dragonerregiment in Wiener Neustadt«, deutete er Richards Zögern richtig. »Dann können wir uns trotzdem immer wieder treffen.«
Tatsächlich hatte ihm Richard gleich zu Beginn ihrer Freundschaft eingestanden, wie enttäuscht er darüber war, aufgrund seiner eingeschränkten Mittel nicht wie all seine Vorfahren bei der Kavallerie dienen zu dürfen.
Richard lächelte. »Ich denke darüber nach, Rudolf, und bedanke mich vorerst recht schön. Zum Glück muss ich heute noch nichts entscheiden. Es bleibt ja noch Zeit.«
Kapitel 2
Palais Werdenfels in Wien
8. Dezember 1881, gegen 18.45 Uhr
»Und hast du deinen Besuch im Palais Vetsera heute genossen, liebe Mama?«
Henriette von Freiberg, ehemals Baronin von Werdenfels, öffnete schon den Mund, um ihrer Tochter Sophie zu antworten, als sie ihr Gatte Arthur von Freiberg mit einer rüden Handbewegung daran hinderte.
Er fixierte seine Stieftochter streng mit seinen dunklen, fast schwarzen Augen. »Wer hat dir die Erlaubnis zum Sprechen erteilt, Sophia?«
Sophie senkte den Blick auf ihren Suppenteller. Sie saß mit ihrer Familie beim gemeinsamen Abendessen. Nur Nikolaus, ihr älterer Bruder, fehlte. Er durfte heute Abend eine Opernvorstellung im Wiener Ringtheater besuchen.
»Entschuldigen Sie bitte …«, flüsterte sie und fügte nach einer winzigen Pause noch »Vater« hinzu.
Trotzdem war dies Arthur von Freiberg nicht entgangen. Mit finsterem Blick wandte er sich an Sophies Mutter Henriette. »Da sehen Sie es wieder einmal, werte Gattin. Sie haben es vollständig versäumt, Ihrer Tochter gute Manieren beizubringen.«
»Aber Phiefi wollte doch nur …« Angesichts des jetzt geradezu stechenden Blicks ihres Gatten verstummte Henriette. Denn sie hatte bereits den nächsten Fauxpas begangen. Ihr zart geschnittenes Gesicht rötete sich.
»Und ich hatte außerdem schon viele Male darum gebeten, in meinem Hause diese lächerlichen Spitznamen nicht mehr zu verwenden. Können Sie sich das merken?«
Henriette nickte eingeschüchtert, während Sophie in hilflosem Zorn, den sie jedoch nicht zu zeigen wagte, in ihrer Suppe rührte. Eigentlich war die kräftige Rinderbrühe mit Frittateneinlage, so hießen die in Streifen geschnittenen dünnen Pfannkuchen, eine ihrer Lieblingssuppen. Doch nun war ihr der Appetit schlagartig vergangen.
Instinktiv schaute sie zum jetzt leeren Stuhl ihres Bruders Nikolaus, Nikki genannt. Sie vermisste sein verschwörerisches Zwinkern, mit dem er schon so manches Mal die unerträgliche Atmosphäre bei den gemeinsamen Mahlzeiten ins Lächerliche gezogen hatte.
Ach, wäre unser Vater doch nur noch am Leben, seufzte sie innerlich, wie so oft, seit sich das häusliche Zusammenleben nach der zweiten Eheschließung ihrer Mutter als zunehmend spannungsgeladen erwies.
Zu Lebzeiten ihres Vaters Nikolaus von Werdenfels war ihre Mutter eine fröhliche, lebenslustige Frau gewesen. Nikolaus, der jüngere Sohn eines böhmischen Industriellen, den sie auf einem der vielen Wiener Faschingsbälle kennengelernt hatte, war ihre große Liebe gewesen. Dessen Familie war erst vor drei Generationen durch die Glaswarenfabrik, die sie betrieb, zu großem Wohlstand gelangt und von Kaiser Franz Joseph geadelt worden. Er hatte Nikolaus’ Vater Matthias den erblichen Freiherrntitel verliehen.
Da die Familie einst aus Oberbayern nach Böhmen eingewandert war, ergab es sich rein zufällig, aber sehr passend, dass der Familienname »Werdenfels« daraufhin zum Adelstitel »von Werdenfels« wurde. Damit trug man den Namen einer verfallenen Burg aus der alten Heimat, die in der Nähe des Marktfleckens Garmisch lag, aus der Sophies Vorfahren väterlicherseits stammten.
Der Freiherrntitel war, gemeinsam mit seinem großen Vermögen, nach Matthias’ Tod vor zehn Jahren auf seine beiden Söhne übergegangen. Zwar hatte Nikolaus’ älterer Bruder Matthias junior den größeren Teil des Erbes erhalten. Aber Sophies Großvater wollte seinen jüngeren Sohn nicht vom Wohlwollen seines älteren Bruders abhängig machen, wie es beim Hochadel gang und gäbe war. Dort erbte oft nur der älteste Sohn als sogenannter Majoratsherr das gesamte Eigentum der Familie und konnte uneingeschränkt darüber verfügen.
Diese gute Absicht hatte nach dem frühen Tod von Sophies Vater Nikolaus jedoch eine fatale Wirkung gezeitigt. Der erst Fünfunddreißigjährige war ums Leben gekommen, als er vergeblich versuchte, das durchgegangene Gespann einer Kutsche aufzuhalten. Dabei war er ins Stolpern geraten und buchstäblich unter die Räder gekommen. Bis dahin hatte er die Wiener Filiale der böhmischen Glaswarenfabrik geleitet und sich im besten Einvernehmen mit seinem Bruder befunden.
Nie würde Sophie den furchtbaren Tag vergessen, an dem man den zerschmetterten Körper ihres Vaters ins Werdenfelser Palais in der Wiener Marokkanergasse im 3. Bezirk gebracht hatte. Wie durch ein Wunder war sein männlich schönes Gesicht unversehrt geblieben, sodass ihn Frau und Kinder zum Abschied zumindest noch einmal auf die kalten Lippen küssen konnten. Nun ruhte er in einer marmornen Gruft auf dem Wiener Zentralfriedhof.
Obwohl Nikolaus von Werdenfels ein lebensbejahender, immer zu Späßen aufgelegter Mann gewesen war, den man leicht für oberflächlich halten konnte, stellte sich bei der Eröffnung seines Testaments heraus, dass er, anders als viele weitaus ältere seiner Standesgenossen, Vorsorge für seine Familie getroffen hatte. Frau und Kinder erbten sein ganzes Vermögen. Henriette erhielt das Palais mit allem Interieur sowie das Barvermögen, das nach Abzug einer sehr stattlichen Mitgift für seine Töchter Sophie und Emilia und einer standesgemäßen Ausstattung seines ältesten Sohnes Nikki, der schon als Kind eine militärische Laufbahn anstrebte, noch übrig war.
Als Treuhänder hatte Sophies Vater zwar seinen älteren Bruder Matthias eingesetzt, aber nur bis zu einer potenziellen Wiederverheiratung Henriettes. Mit der er wahrscheinlich ebenso wenig gerechnet hatte wie mit seinem frühen Ableben.
Genau in diese Kerbe schlug Arthur von Freiberg. Vor Nikolaus’ Tod war er nur flüchtig mit den von Werdenfels bekannt gewesen, und zwar durch den Ehemann von Henriettes guter Freundin, der Baronin Helene Vetsera. Diese wohnte ganz in der Nähe, in der Salesianergasse, und war Henriette eine wahre Stütze nach dem furchtbaren Schicksalsschlag gewesen.
Wie ihr Mann Albin Vetsera, den der Kaiser ebenfalls in den Freiherrnstand erhoben hatte, war auch Arthur von Freiberg Mitglied im diplomatischen Dienst des Auswärtigen Amts. In dieser Funktion war er einige Male Mitarbeiter des um zehn Jahre älteren Barons Vetsera in dessen diversen ausländischen Dienststellen gewesen.
Nach Nikolaus’ Tod hatte er der untröstlichen Witwe einige Male in Begleitung von Helene Vetsera seine Aufwartung gemacht. Und so kam es dann, wie es kommen musste: Nach Ablauf des Trauerjahrs war Henriette dem Charme des gut aussehenden Mannes erlegen und hatte, gegen den Wunsch ihrer älteren Kinder Nikki und Sophie, seine Werbung um ihre Hand angenommen.
Auch Nikolaus’ Bruder Matthias war entsetzt gewesen. Ob dies eher dem Umstand geschuldet war, dass sich Henriette so rasch nach dem Tod ihres Gatten mit einer neuen Ehe tröstete, oder der Tatsache, dass nun ein großer Teil des böhmischen Vermögens in fremde Hände überging, sei dahingestellt.
Jedenfalls konnte Matthias die Heirat seiner Schwägerin, die nach dem Tod ihres Mannes nahezu allen Lebensmut verloren hatte und sich in der Person Arthurs von Freiberg eher Trost und Halt als eine neue Liebe erhoffte, nicht verhindern. Infolgedessen hatte er mit der ganzen Familie seines verstorbenen Bruders gebrochen und nicht an der Hochzeitsfeier im Spätsommer des vergangenen Jahres teilgenommen.
Und Onkel Matthias hat recht behalten, dachte Sophie nun ingrimmig, während sie weiter in ihrer erkaltenden Suppe rührte, ohne ihren Löffel ein einziges Mal zum Munde zu führen. Dieser Mann macht Mama und uns alle nur unglücklich.
»Wenn du keinen Appetit hast, kannst du dich gleich auf dein Zimmer begeben«, unterbrach Arthur von Freibergs Stimme einmal mehr Sophies finstere Gedanken.
Sie schreckte auf und begegnete dem missbilligenden Blick ihres Stiefvaters und dem flehenden ihrer Mutter. Milli, ihre erst sechsjährige Schwester, durfte noch nicht an den Mahlzeiten teilnehmen. Da Nikki im Theater war, würde Henriette mit von Freiberg allein speisen müssen, wenn sich Sophie jetzt zurückzog. Obwohl sie keinen Hunger mehr verspürte, gab das den Ausschlag für sie, sich zusammenzunehmen.
»Nein, nein, Vater«, murmelte sie. »Entschuldigen Sie! Mir ist heute nur nicht so nach der Frittatensuppe.«
»Sehr merkwürdig!« Von Freiberg griff nach der Klingel. »Sonst konntest du doch nie genug davon bekommen.«
»Serviere den nächsten Gang«, beschied er dem Diener, der eilfertig die Tür des Speisezimmers öffnete, vor der er gewartet hatte.
Der Mann machte eine tiefe Verbeugung. »Sehr wohl, gnädiger Herr.«
Ringtheater in Wien
8. Dezember 1881, gegen 18.45 Uhr, zur gleichen Zeit
»Wie schön, dass du auch noch mitkommen konntest, Laszi!«, strahlte Nikolaus von Werdenfels seinen Sitznachbarn Ladislaus von Vetsera an.
Der lächelte herzlich zurück. »Ja, Nikki!«, bestätigte er. »Es war mir zunächst ganz arg, nur der Sechste bei der Zwischenprüfung gewesen zu sein und diese Gelegenheit damit verpasst zu haben.«
In diesem Augenblick fing Nikolaus einen missbilligenden Blick von Laszis rechtem Sitznachbarn auf. »Ihr solltet euch was schämen, euch am Pech unseres armen Kameraden auch noch zu freuen!«
»Ist ja schon gut, Hannes«, begütigte Nikki. »Niemand hat dem Wastl gewünscht, heute vom Pferd zu fallen und sich den Arm zu brechen. Aber so konnte er nun mal nicht mit in die Oper kommen. Und ich gönn’s dem Laszi eben. Er lag doch nur um einen halben Punkt zurück!«
»Pscht!«, zischte ihr Begleiter Rudolf Frieß, der Sohn des Betreibers der Major-Frieß’schen-Militärschule, in der sowohl Nikki von Werdenfels als auch Laszi von Vetsera ihre vormilitärische Ausbildung absolvierten. Er begleitete die fünf Zöglinge seines Instituts als Aufsichtsperson.
Als Preis für die fünf besten Absolventen der Zwischenprüfung hatte Major Frieß Karten für die heutige Oper Hoffmanns Erzählungen von Jacques Offenbach ausgesetzt. Erst gestern hatte die hoch gelobte Uraufführung dieses Werks stattgefunden.
Nikki wandte den Kopf. Das Theater schien bis auf den letzten Platz besetzt zu sein. Die Vorstellung war bereits seit Wochen ausverkauft. Doch nun, da man wusste, dass Offenbachs Werk auch die Anerkennung des kritischen Wiener Publikums gefunden hatte, waren der Preis und ihre heutige Anwesenheit noch einmal so viel wert. Und vor allem, dass Laszi, sein musikbegeisterter bester Freund wider Erwarten mit dabei sein konnte, freute Nikki besonders. Kurz hatte er sogar mit dem Gedanken gespielt, Laszi seine eigene Karte, die er als Drittbester des Jahrgangs erhalten hatte, zu überlassen, bis der Unfall ihres Klassenkameraden Wastl für eine andere Lösung gesorgt hatte.
Und ihre Plätze waren wahrlich sehr gut. Diesbezüglich hatte sich Major Frieß nicht lumpen lassen und sie gleich in der dritten Reihe gebucht. Natürlich waren es keine Logenplätze, diese waren dem Adel und reichen Großbürgern vorbehalten. Aber Nikki und seine Kameraden hatten einen ausgezeichneten Blick auf die Bühne und konnten sogar in den Orchestergraben hineinsehen, wenn sie die Hälse reckten.
»Gleich geht es los«, flüsterte Laszi aufgeregt. »Es fehlen nur noch die Streicher.«
In diesem Augenblick ertönte hinter dem noch geschlossenen Vorhang ein lauter Knall.
Palais Werdenfels in Wien
8. Dezember 1881, gegen 19.00 Uhr
»Reichst du mir das Salz, liebe Phiefi?«
Kaum waren die Worte heraus, schlug sich Henriette von Werdenfels leicht auf die Lippen. Natürlich zu spät. Ihr Gatte sah sie strafend an.
»Habe ich Ihnen nicht gesagt, werte Henriette …«
Zu seinem Erstaunen fiel ihm seine sonst sanftmütige, schüchterne Gattin jedoch ins Wort. »Ja, ja. Es ist ja schon gut! Jedermann hat einen Spitznamen, wie du sehr gut weißt. Meiner ist übrigens Yetta. Wir haben Sophie Phiefi gerufen, seit sie zwei Jahre alt war. Sie selbst hat sich so genannt, während sie das Sprechen erlernte.«
Eine steile Falte bildete sich auf der hohen Stirn ihres Gatten. Seine dunklen Augen begannen, gefährlich zu funkeln, und verliehen seinen regelmäßigen Gesichtszügen etwas Diabolisches.
»Ich darf doch sehr bitten, werte Henriette.« Seine Stimme blieb ruhig, hatte aber dennoch einen drohenden Unterton. »Sie vergessen sich. In meinem Hause«, er betonte die Worte, »möchte ich die Form gewahrt wissen, insbesondere bei den Mahlzeiten. Also halten Sie sich daran!«
Der kurze Moment des Aufbegehrens ihrer Mutter war so rasch vorbei, wie er aufgeblitzt war. »Entschuldigen Sie meine Entgleisung, Arthur«, erwiderte sie in demütigem Ton. »Es wird nicht mehr vorkommen.« Mit ihren Worten erlosch der winzige Hoffnungsfunke, der kurz zuvor in Sophie aufgeglommen war.
»Das will ich doch stark hoffen, meine Liebe.«