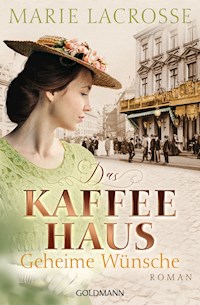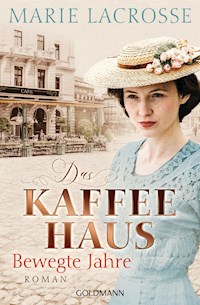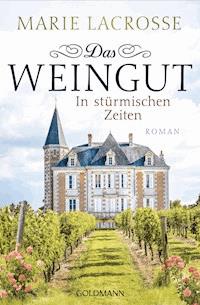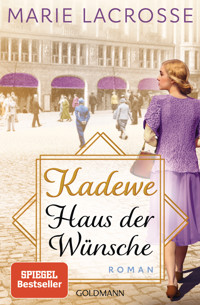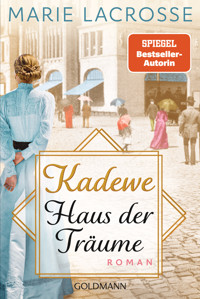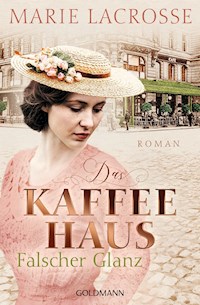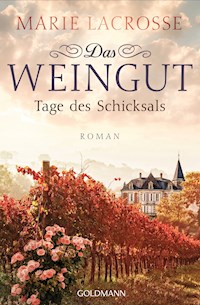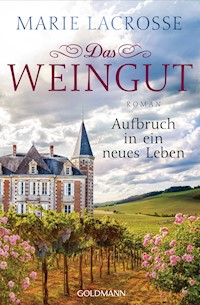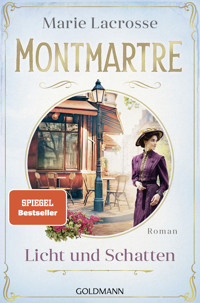
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Montmartre
- Sprache: Deutsch
Paris im Sommer 1866: Elise Lambert und Valérie Dumas werden am selben Tag geboren. Sonst haben die beiden Mädchen nicht viel gemeinsam. Elise, Tochter einer einfachen Wäscherin, wächst in Armut auf dem Hügel von Montmartre auf. Valérie hingegen ist die Tochter eines wohlhabenden Kunsthändlers vom Boulevard de Clichy. In einer Zeit, in der Frauen kaum Möglichkeiten haben, hegen die beiden große Träume. Valérie ist eine begnadete Malerin, die es an die Kunstakademie schaffen möchte, wo auch Toulouse-Lautrec und van Gogh studieren. Elise dagegen möchte als Tänzerin in den schillernden Varietés von Montmartre berühmt werden. Schicksalsschläge und die Liebe stellen beide vor ungeahnte Herausforderungen, doch die jungen Frauen kämpfen für ihr Glück …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 709
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Buch
Paris im Sommer 1866: Elise Lambert und Valérie Dumas werden am selben Tag geboren. Sonst haben die beiden Mädchen nicht viel gemeinsam. Elise, Tochter einer einfachen Wäscherin, wächst in Armut auf dem Hügel von Montmartre auf. Valérie hingegen ist die Tochter eines wohlhabenden Kunsthändlers vom Boulevard de Clichy. In einer Zeit, in der Frauen kaum Möglichkeiten haben, hegen die beiden große Träume. Valérie ist eine begnadete Malerin, die es an die Kunstakademie schaffen möchte, wo auch Toulouse-Lautrec und van Gogh studieren. Elise dagegen möchte als Tänzerin in den schillernden Varietés von Montmartre zum Star werden. Schicksalsschläge und die Liebe stellen beide vor ungeahnte Herausforderungen, doch die jungen Frauen kämpfen für ihr Glück …
Weitere Informationen zu Marie Lacrosse sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin finden Sie am Ende des Buches.
Marie Lacrosse
MONTMARTRE
Licht und Schatten
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Originalausgabe April 2025
Copyright © 2025 by Marie Lacrosse
Copyright Deutsche Erstausgabe © 2025 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 Mü[email protected]
(Vorstehende Angaben sind zugleich
Pflichtinformationen nach GPSR)
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Montasser Medienagentur, München
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign
Umschlagmotive: © Richard Jenkins – rjenkins.co.uk; © angkhan, Inga Av, francodelgrando, seesulaijular/stock.adobe.com; © Digimanselector/shutterstock.com
Redaktion: Marion Voigt
Karte: © Peter Palm
BH · Herstellung: ik
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-30643-4V002
www.goldmann-verlag.de
Für meine Familiezum Dank für ihre fortdauernde Unterstützung
Betrachtet man Fotos des Montmartre vom Ende des 19. Jahrhunderts, so glaubt man, ein Dorf irgendwo weit vom Pariser Zentrum vorzufinden und keinesfalls einen Stadtteil in Sichtweite von Seine und Eiffelturm.
ESPRIT MONTMARTRE
Montmartre – kein anderer Ort wies um 1900 eine solche Dichte an hochkarätigen Künstlerpersönlichkeiten auf wie dieses besondere Pariser Viertel.
ESPRIT MONTMARTRE
»Er hat noch kein Bild gegen Geld verkauft, sondern tauscht seine Arbeit gegen andere Bilder.«
»Es ist schade, dass ihm sein Charakter dermaßen im Wege steht.«
THEO VAN GOGH ÜBER SEINEN BRUDER VINCENT WÄHREND SEINES AUFENTHALTS IN MONTMARTRE 1886–1888, KATALOG DES KRÖLLER-MÜLLER MUSEUMS
In Toulouse-Lautrec hat der Montmartre seinen eigentlichen Maler gefunden.
PARIS MONTMARTRE
»Sie hat ein Vertrauen in sich, das niemand sonst besitzt, mal lächelnd, mal schüchtern, kühn oder katzenhaft, geschmeidig wie ein Handschuh.«
HENRI TOULOUSE-LAUTREC ÜBER LA GOULUE, THE MOULIN ROUGE
Dramatis Personae
Es werden nur die für die Handlung bedeutsamen Figuren aufgeführt. Historische Persönlichkeiten sind mit einem * gekennzeichnet.
ELISE LAMBERTS FAMILIE
Elise Lambert, älteste Tochter
André Renard, ihr Verlobter
Jeanne Lambert, ihre Mutter
Jacques Morin, ihr Vater
Simone Lambert, ihre jüngere Schwester
Marianne, Jeannes Ziehmutter
VALÉRIE DUMAS’ FAMILIE UND HAUSPERSONAL
Valérie Dumas, einzige Tochter
Alphonse Dumas, ihr Vater, Inhaber einer Kunstgalerie
Amélie Dumas, ihre Mutter
Victoria und Gérôme Dumas, Valéries Großeltern väterlicherseits
Cecile und Bernard Valbert, Valéries Großeltern mütterlicherseits
Simon, Hausdiener
Marie, Hausmädchen
(HISTORISCHE) PERSÖNLICHKEITEN AUS DER CANCAN-SZENE
Louise Weber*, genannt La Goulue, Tänzerin
Valentin*, genannt der Knochenlose, Tanzpartner von La Goulue
Charles Tazzini*, Geliebter von La Goulue
Marquis de Biron*, Geliebter von La Goulue
Lucienne Beuze*, genannt Grille d’Égout, Tänzerin
Joseph Oller*, Besitzer des Moulin Rouge
Marcel Hebert, Direktor des Élysée Montmartre
Bernard Miller, Direktor des Élysée Montmartre, sein Nachfolger
Charles Desteuque*, Journalist
(HISTORISCHE) PERSÖNLICHKEITEN AUS DER KUNSTMALERSZENE
Pascal Didier, Kunstmaler und Valéries Geliebter (Figur in Anlehnung an den Maler Émile Bernard*)
Baptiste Germain, Kunstmaler
(Figur in Anlehnung an den Maler Jean-Léon Gérome)
Henri de Toulouse-Lautrec*, Kunstmaler, Mitglied des Hochadels
Vincent van Gogh*, niederländischer Kunstmaler
Suzanne Valadon*, Aktmodell und spätere Kunstmalerin
Henri Gervex*, Kunstmaler
Pierre-Auguste Renoir*, Kunstmaler
Edgar Degas*, Kunstmaler
Paul Gauguin*, Kunstmaler
Camille Pissarro*, Kunstmaler
Theo van Gogh*, Kunsthändler und Vincents jüngerer Bruder
Père Tanguy*, Farbenhändler, Förderer avantgardistischer Malerei
Paul Durand-Ruel*, Kunsthändler
Fernand Cormon*, Kunstmaler und Leiter der gleichnamigen Kunstakademie
Agostina Segatori*, ehemaliges Malermodell und Inhaberin des Café Tambourin
Carmen Gaudin*, genannt Red Rosa, Modell von Henri de Toulouse-Lautrec
WEITERE HISTORISCHE PERSÖNLICHKEITEN MIT BEDEUTUNG FÜR DEN ROMAN
(in alphabetischer Reihenfolge)
Aristide Bruant*, Chansonnier und Inhaber des Cabarets Le Mirliton
Robert Coutelas*, Sittenwächter
Gustave Eiffel*, Erbauer des Eiffelturms
Ferdinand de Lesseps*, Erbauer des Suez- und des Panamakanals
Louise Michel*, Pariser Kommunardin und Anarchistin
Maxime Lisbonne*, Besitzer der Taverne du Bagne und Anarchist
Rodolphe Salis*, Inhaber des Cabarets Chat Noir
Madeleine Weber*, La Goulues Mutter
WEITERE FIKTIVE PERSONEN MIT BEDEUTUNG FÜR DEN ROMAN
Père Zacharie, Amélie Dumas’ Beichtvater und Priester in Sacré-Coeur
Pierre Lombard, sein Neffe
Luc Colbert, Zuhälter
IM ROMAN GENANNTE HISTORISCHE PERSÖNLICHKEITEN OHNE AKTIVE ROLLE
(in alphabetischer Reihenfolge)
Georges Ernest Jean Marie Boulanger*, französischer General und Aufrührer
Alexandre Cabanel*, Kunstmaler
Georges Clemenceau*, Politiker und Staatsmann, späterer Ministerpräsident
Camille Corot*, Kunstmaler
Georges-Eugène Haussmann*, bis 1870 Präfekt des Departements Seine; Stadtplaner und Umgestalter von Paris
Édouard Manet*, Kunstmaler
Eric Satie*, Pianist und Komponist
Paul Signac*, Kunstmaler
Charles Frederick Worth*, Modedesigner, Begründer der Haute Couture
Émile Zola*, Romancier
Prolog
AUF DEM MAQUIS VON MONTMARTRE
20. JUNI 1866
Jeanne spürte das erste Ziehen im Unterleib, als sie den schweren Wassereimer aus dem Brunnen zog. Erstaunt setzte sie das Gefäß ab und befühlte ihren hochschwangeren Bauch. Die Hebamme Marianne hatte ihr doch vor wenigen Tagen gesagt, es sei frühestens in zwei Wochen so weit. Hatte sich die erfahrene Alte etwa geirrt?
Ach was, beruhigte sich Jeanne, das Kleine hat mich wahrscheinlich inwendig getreten. Sie hängte die schweren Eimer zu beiden Seiten an das Tragegestell und bückte sich, um es sich auf die Schultern zu heben. Als sie sich aufrichtete, zog es erneut. Diesmal deutlich heftiger als zuvor.
Mit sorgenvoll gekrauster Stirn schleppte Jeanne ihre Last die steile unbefestigte Gasse empor, die zu ihrer Hütte mitten im Maquis von Montmartre führte. Der Maquis hoch oben auf der Butte, wie man die höchste Erhebung von Montmartre nannte, war eine von Trampelpfaden durchzogene Freifläche. Zum Teil war sie unbebautes, mit Unkraut überwuchertes Ödland, zum Teil standen einfache Bretterbuden in unregelmäßigen Abständen nebeneinander.
In diesen Elendsquartieren hausten Bewohner aus der ärmsten Bevölkerungsschicht von Paris. Sie waren im Sommer der Hitze, im Winter der Eiseskälte in den zugigen Hütten schutzlos ausgeliefert. Es gab keine Abtritte, man verrichtete seine Notdurft hinter den Büschen in der Nähe der Hütten. Der nächste Brunnen war meist mehrere Hundert Meter entfernt.
Jacques Morin, mit dem die achtzehnjährige Jeanne Lambert seit einem Jahr zusammenlebte und von dem sie ihr erstes Kind erwartete, hatte ihre Behausung, die nur aus einem einzigen Raum bestand, selbst gezimmert. Je näher Jeanne ihrem ärmlichen Obdach kam, desto stärker machte sich der Gestank der benachbarten Abdeckerei bemerkbar. Dort wurden jeden Tag mindestens ein Dutzend Pferdekadaver gehäutet, und in den dadurch entstehenden Blutseen züchtete der Besitzer Würmer, die er als Köder an Angler verkaufte.
Wie üblich summten dichte Fliegenschwärme über dem Gelände.
Als Jeanne sich ihrer Hütte näherte, entdeckte sie zu ihrem Ärger, dass der verschlissene Vorhang, der im Sommer tagsüber den Eingang verschloss, ein Stück zur Seite gezogen war. Sie seufzte vernehmlich. Wahrscheinlich hatte Jacques in ihrer Abwesenheit die Hütte aufgesucht und den Vorhang nicht ordentlich zugezogen. Einen Teil der Fliegen würde sie nun auch in der Hütte vorfinden, wo sie sich an Jeannes wenigen Essensvorräten gütlich taten.
Jeanne setzte die schweren Wassereimer ab und betrat die Hütte. Tatsächlich erhob sich eine schwarze Wolke der Insekten von der Brotdose und dem Kochtopf. Beide Gefäße standen offen. Der Kochtopf auf dem winzigen Öfchen, das gleichzeitig als Herd und im Winter als Heizung diente, war leer, ohne Jeannes Mittagessen. Jacques hatte offenbar den Rest Erbsensuppe verzehrt, anstatt seiner Arbeit als Zimmermann nachzugehen.
In den letzten Monaten schwänzte Jacques seine Arbeitsstelle immer wieder und trieb sich stattdessen in den Kneipen herum, die es in reichlicher Anzahl auf dem Hügel von Montmartre gab. Erst als Jeanne sich nach ihren Waschgeräten bückte, fiel ihr das Stroh auf, das vor ihrer Lagerstatt auf dem hart gestampften Lehmboden verstreut war. Ein eisiger Schrecken durchfuhr sie. Schwerfällig drehte sie sich zu dem Strohsack hin, der als Matratze diente. In seinem Innern bewahrte Jeanne den geringen Lohn auf, den sie mit ihrer Arbeit als Wäscherin verdiente.
Als sie den Strohsack wendete, bestätigten sich ihre schlimmsten Befürchtungen. Der Schlitz in dem harten Leinen, den sie sorgfältig mit Nadeln zugesteckt hatte, war aufgerissen. Im Stoff klaffte ein breites Loch. Als sie mit der Hand hineinfuhr und panisch herumtastete, fand sie den Beutel mit den wenigen Münzen nicht mehr. Es waren kaum fünf Francs gewesen, die sie dort vor Jacques versteckt hatte, um sie nach der Geburt zur Verfügung zu haben. Vom Munde abgespart, damit sie die Hebamme bezahlen und beim Trödler etwas zum Anziehen für das Kind kaufen konnte.
Denn die Hemdchen, Mützchen und Schühchen, die sie abends nach einem harten Tag am Waschfass beim schlechten Licht einer einzigen Kerze gestrickt, gehäkelt und genäht hatte, waren schon vor Wochen Jacques’ Trunksucht zum Opfer gefallen. Er hatte sie ins Pfandhaus getragen und die wenigen Sous, die er dafür erhielt, noch am gleichen Abend versoffen.
»Dieser Mistkerl!«, schrie Jeanne nun in ihrer hilflosen Wut laut auf. Im selben Augenblick durchzuckte sie ein stechender Schmerz. Eine warme Flüssigkeit rieselte ihre Schenkel hinab. Sie konnte sich gerade noch auf den beschädigten Strohsack schleppen, bevor die nächste Wehe sie übermannte.
Zwei Stunden später drängte sich das schwarz behaarte Köpfchen ihres Töchterchens aus ihrem Leib.
»Was für ein Glück, dass ich zufällig vorbeikam, um dir etwas Ziegenmilch zu bringen.«
Die alte Hebamme Marianne, bei der Jeanne auf der Butte gewohnt hatte, bevor sie mit Jacques in die eigene Bretterbude gezogen war, tätschelte ihr die schweißbedeckte Stirn.
Zuvor hatte sie Jeanne tatkräftig bei der Entbindung geholfen, die Nabelschnur durchtrennt und das kleine Mädchen in ein sauberes Tuch gewickelt. Dann legte sie es Jeanne an die Brust.
»Wie soll sie denn heißen?«, fragte sie nun.
»Ich will sie Elise nennen, nach meiner verstorbenen Mutter.«
Marianne nickte beifällig. »Ein schöner Name.«
»Aber diesen Schuft solltest du noch heute rauswerfen«, fügte sie mit grimmigem Gesichtsausdruck hinzu. »Er hat dir nichts als Unglück gebracht. Wie ich es dir von Anfang an …« Marianne stockte und biss sich auf die Lippen.
»Sprich es nur aus!«, entgegnete Jeanne resigniert. »Es ist wahr, du hast mich vor dem Taugenichts von Anfang an gewarnt.«
»Er neigte schon als Junge zur Trunksucht«, bestätigte Marianne. »Wie seine beiden Eltern, die mehr Branntwein als Wasser tranken, wann immer sie es sich leisten konnten.«
Jeanne wich dem Blick der Hebamme aus.
»Doch heute ist es die Grüne Fee«, sagte die alte Frau erbittert. »Nicht nur teurer, sondern auch viel teuflischer als Schnaps.«
Grüne Fee nannte man im Volksmund den Absinth, ein alkoholisches Getränk, das seinen typischen Geschmack den darin enthaltenen Gewürzen Wermut, Anis und Fenchel verdankte. Die grüne Farbe stammte von zugesetzten Kräutern wie Minze oder Melisse. Man verdünnte es in den Schenken zwar mit Wasser, Absinth war aber trotzdem ungleich stärker als Bier oder Wein und sogar viele Sorten Schnaps.
»Leider ist der Kerl mit seinen schwarzen Locken und blauen Augen anscheinend unwiderstehlich für die Weiber«, fuhr die Alte in ihrer Tirade fort, als Jeanne noch immer schwieg.
Seufzend stand die Hebamme auf. »Wenigstens das hat er der Kleinen vererbt. Die wird mal eine richtige Schönheit, wirst sehen.«
Als Jeanne ebenfalls Anstalten machte, sich zu erheben, drückte Marianne sie sanft, aber bestimmt auf das Lager zurück. »Untersteh dich!« Sie hob warnend den Zeigefinger. »Du bleibst jetzt den ganzen Tag liegen und ruhst dich aus. Heute Abend seh ich noch mal nach dir.«
»Aber … die Wäsche«, protestierte Jeanne schwach. »Ich hab’s Madame George versprochen, sie heute zu schrubben.«
»Da wusste ja noch niemand, dass das Kleine es so eilig hat, auf die Welt zu kommen. Mach dir keine Sorgen! Ich geh bei der George vorbei und sag ihr Bescheid.«
»Aber … Jacques hat doch meinen ganzen Lohn gestohlen«, protestierte Jeanne noch einmal. »Ich muss doch was verdienen, um das Kind zu ernähren. Und dich will ich auch bezahlen.«
Marianne schürzte die Lippen. »Um mich mach dir mal keine Sorgen, Jeanine!« Sie wies auf Jeannes volle Brust, aus der ein Tropfen Milch sickerte. »Das Kleine ist auch gut versorgt. Und du hast die Ziegenmilch, die ich dir mitgebracht habe. Ein wenig Brot hat der Schuft dir auch noch gelassen. Das sollte erst mal reichen. Nach der Geburt soll man ohnehin nicht gleich zu viel essen. Heute Abend bring ich dir eine kräftige Brühe mit«, versprach sie, bevor sie sich unter die niedrige Türöffnung bückte und Jeanne zum Abschied zuwinkte.
Die blieb noch eine halbe Stunde liegen. Dann stand sie mühsam auf und legte ihr Töchterchen auf dem Strohsack ab. Hinter dem Vorhang verborgen, lugte sie rechts und links den Trampelpfad entlang, konnte Marianne jedoch nirgends entdecken. Erst dann schlüpfte sie hinaus, klaubte einen Arm voll Reisig zusammen, der auf einem Haufen neben der Bretterbude lag, und entzündete damit hinter der Hütte ein Feuer. Darüber hängte sie einen großen Topf an einen Dreifuß und erwärmte nach und nach das Wasser, das sie morgens vom Brunnen geholt hatte. Topf für Topf füllte sie ins Waschfass in einer Ecke der Hütte.
Als das Fass voll war, griff sie nach einem Laken, das sie schon am frühen Morgen in einer Bütte eingeweicht hatte, und begann, es mit Kernseife einzureiben und über dem Waschbrett zu schrubben.
Schließlich muss das Leben ja weitergehen, dachte sie, während sie wegen ihrer Schmerzen im Unterleib die Zähne zusammenbiss. Auch wenn es die alte Marianne noch so gut mit mir meint.
EINE VORNEHME WOHNUNG AM BOULEVARD DE CLICHY
20. JUNI 1866, AM GLEICHEN TAG
Alphonse Dumas zuckte zusammen, als ein weiterer schriller Schrei der Gebärenden aus dem Schlafzimmer drang. Seit vielen Stunden ging das schon so. Am liebsten hätte er sich die Ohren zugehalten. Er scheute nur davor zurück, weil ständig Dienstboten wie aufgescheuchte Hühner mit Tüchern, Wasserschüsseln und nutzlosen Stärkungsmitteln ins Zimmer eilten und wieder herauskamen. Sie hätten ihn durch die offene Tür des großen Salons, in dem er auf die Geburt seines ersten Sohnes wartete, sehen können.
Schließlich hielt er es nicht mehr aus, ging mit großen Schritten in den Flur und packte eines der Dienstmädchen, das gerade aus dem Gebärzimmer kam, am Arm. »Hol mir Doktor Vernon heraus!«, befahl er barsch. Das Mädchen nickte schüchtern und lief ohne ein Wort zurück. Nur wenig später erschien der Arzt. Er hatte seinen Gehrock abgelegt und die Krawatte gelockert. Die Manschetten seines weißen Oberhemds waren mit feinen Blutströpfchen gesprenkelt.
»Warum geht es nicht endlich vorwärts?«, fragte Dumas ohne jegliche Höflichkeitsfloskel. »Sie hatten mir doch versprochen, dass es keine Komplikationen geben würde. Doch nun liegt Amélie bereits seit« – er warf einen Blick auf die große Standuhr –, »seit sage und schreibe sechsundzwanzig Stunden in den Wehen.«
Doktor Vernon hob die Achseln. Flüchtig streifte sein Blick den Servierwagen, auf dem eine große Karaffe Cognac stand. Es war zwar erst zwei Uhr nachmittags, aber Dumas deutete die Geste richtig. Wortlos stand er auf und goss sich und dem Arzt ein großes Glas ein.
Dann wies er auf den Fauteuil gegenüber seinem eigenen Platz. Gewaltsam bezwang er sich. »Also, mit welchen Schwierigkeiten haben wir es zu tun?« Alphonse bemühte sich, seine Stimme ruhig zu halten.
Vernon trank erst einen großen Schluck, bevor er antwortete. »Das Becken Ihrer verehrten Frau Gemahlin ist schmaler, als es zunächst den Anschein hatte«, erklärte er dann. »Das Kind hat sich im Mutterleib leider nicht ausreichend gedreht. Das Köpfchen liegt immer noch nicht in Richtung des Geburtskanals.«
»Aber Sie hatten mir doch versprochen, dass sich alles zur rechten Zeit fügen wird!« Jetzt schwang mühsam unterdrückter Zorn in Dumas’ Stimme mit. »Die Hebamme, die ich auf Ihren Rat hin schon vor vier Wochen entlassen habe, hat genau das prophezeit. Sie jedoch haben behauptet, die Frau sei ein ungebildetes Weib aus dem Volk. Der Säugling werde sich schon noch richtig lagern.« Auch er nahm einen Schluck aus seinem Glas. »Doch wie es nun aussieht, haben Sie sich geirrt.«
Wieder hob Doktor Vernon die Schultern. »Gottes Wege sind unergründ…«, begann er bereits mit salbungsvollem Ton, als Alphonse ihm rüde das Wort abschnitt.
»Die alte Marianne hat gesagt, man müsse das Kind notfalls selbst im Mutterleib drehen. Warum tun Sie das nicht?«
Jetzt schürzte der Arzt empört die Lippen. »Aber ich bitte Sie, sehr verehrter Monsieur Dumas. Das natürliche Schamgefühl Ihrer jungen Frau« – er geriet ins Stottern – »berührt an so intimer Stelle von einem Mann, das …«
»Wollen Sie Amélie und meinen Sohn eher sterben lassen?«, schnitt Alphonse dem Mediziner erneut das Wort ab. Dann fasste er einen Entschluss und sprang auf. Er zog heftig an der Klingelschnur, bis der Hausdiener herbeistürzte.
»Simon! Eilen Sie sofort auf die Butte und holen Sie die alte Marianne herbei!«
»Was für ein denkwürdiger Tag«, murmelte Marianne vor sich hin, während sie hinter dem Mädchen die Dienstbotentreppe in dem vornehmen Haus am Boulevard de Clichy bis ins zweite Stockwerk hinaufeilte. »Zwei Geburten so kurz hintereinander.«
Das Haus war eines der prächtigen Gebäude, wie sie in der nun schon über ein Jahrzehnt währenden Ära des Barons Haussmann, der das Zentrum von Paris modernisierte, auch am Fuß des Montmartre-Hügels entstanden waren. Es wies reiche Stuckverzierungen an der cremefarbenen Außenfassade auf. Bis auf einige Einzelheiten der Dekoration glich es seinen Nachbarn wie ein Ei dem anderen. Baron Haussmann legte allergrößten Wert darauf, dass alle Neubauten einer Straßenzeile bis hin zu den Fensterläden und den kunstvoll gedrechselten Balkongittern einander ähnelten.
Die komfortabelste Wohnung lag jeweils im zweiten Stockwerk dieser Gebäude. Sie bestand wie diejenige des wohlhabenden Kunsthändlers Alphonse Dumas aus zwölf Zimmern zu beiden Seiten eines lang gestreckten Flurs. Das großzügige, mit weißem Marmor verkleidete Badezimmer war bei den rückwärtigen Räumen eingerichtet, die als Schlaf- und Gästezimmer dienten.
Als die Hebamme die Zimmerflucht vom Dienstboteneingang her betrat, der sich in einem kurzen Flur vor der geräumigen Küche befand, verglich sie die Pracht dieser Behausung unwillkürlich mit der elenden Hütte, in der sie vor wenigen Stunden der kleinen Elise auf die Welt geholfen hatte. Selbst die Dienstbotenkammern gleich unter dem Dach des Neubaus waren bequemer als die Bretterbuden des Maquis. Obwohl auch sie den jahreszeitlichen Temperaturen ungeschützt ausgesetzt waren, wie Marianne wusste. Aber es stank wenigstens nicht so infernalisch darin wie droben auf der Butte, und das Ungeziefer beschränkte sich auf ein paar Bettwanzen und Stechmücken im Sommer.
Aus der Küche drang ein verführerischer Duft. Mariannes Magen begann zu knurren. Ihre Morgenmahlzeit war schon etliche Stunden her. Aber mit dem Geld, das sie hoffentlich heute verdienen konnte, würde auch sie sich ein Stück fettes Schweinefleisch leisten können und Jeanne am Abend etwas davon vorbeibringen.
Doch nun galt es, sich auf die Aufgabe zu konzentrieren, die vor ihr lag. Es war äußerst ungewöhnlich, dass eine einfache Hebamme vom Hügel des Montmartre überhaupt mit einer so vornehmen Schwangeren wie Amélie Dumas in Kontakt kam. Vor einigen Monaten war sie Amélie zufällig auf dem Boulevard de Clichy begegnet, als diese von heftiger Übelkeit geplagt wurde. Da die feine Dame ohnmächtig zu werden drohte und das sie begleitende Dienstmädchen völlig überfordert schien, hatte Marianne sich ein Herz gefasst, die Schwangere angesprochen und sie nach Hause begleitet. Noch am gleichen Tag hatte sie Amélie die bewährte Kräutertinktur vorbeigebracht, mit der sie solche Leiden seit Jahren erfolgreich behandelte. Das Mittel hatte auch bei Amélie Dumas angeschlagen.
Während der nächsten Monate hatte Marianne dann regelmäßig in der Wohnung des Kunsthändlers vorgesprochen. Amélie hatte darauf bestanden, weiter von ihr betreut zu werden. Bis Marianne vor ungefähr vier Wochen gemerkt hatte, dass sich der Säugling im Mutterleib nicht so drehte, wie es vor einer Geburt normalerweise der Fall war. Ihre behutsamen Untersuchungen, vor denen die Schwangere schon längst nicht mehr zurückschreckte, hatten ergeben, dass das Kind verkehrt herum mit dem Steiß nach vorn in der Gebärmutter lag.
Doch sobald Amélie dies ihrem Mann mitgeteilt hatte, hatte der sich an jenen Kurpfuscher gewandt, der Marianne nun mit einem Glas Cognac in der Hand verächtlich musterte, als sie vorbeieilte. Dumas hatte sie selbst damals auf Anraten des Mediziners mit Dank für ihre bisherigen Dienste entlassen, ungeachtet des heftigen Protests der werdenden Mutter.
Schon auf der Treppe hatte Marianne die lauten Schreie vernommen, die aus dem Schlafzimmer drangen, in das sie nun eintrat. Mit einem Blick erfasste sie die kritische Situation. Das Gesicht der Gebärenden war rot gefleckt und von Schweiß bedeckt, die Wangen eingefallen, die Hände zu Fäusten geballt. Das Bettlaken, auf dem Amélie aufgrund der sommerlichen Hitze ohne Decke lag, war mit Blut getränkt.
»Wie lange geht das schon so?«, raunte Marianne einem der Dienstmädchen zu, die hilflos um das Bett standen.
»Die Gnädige liegt seit dem vorigen Morgen in den Wehen«, antwortete das Mädchen zu Mariannes Entsetzen im gleichen Flüsterton.
Einen Moment fühlte sie sich völlig mutlos. Man würde es ihr anlasten, wenn die Gebärende im Kindbett stürbe. Nicht diesem Scharlatan, der bislang offenbar nicht das Geringste ausgerichtet hatte, um der jungen Frau des Kunsthändlers zu helfen. Dann riss Marianne sich zusammen und straffte den Rücken.
»Ich brauche frisches heißes Wasser und gute Seife!«, herrschte sie eines der Dienstmädchen an, das sofort hinauseilte. Sobald es mit den gewünschten Dingen zurückgekehrt war, wusch Marianne sich gründlich die Hände und näherte sich der halb ohnmächtigen Amélie.
»Erkennen Sie mich noch, gnädige Frau?«
Amélie öffnete mühsam die verquollenen Augen und nickte. Dabei huschte für einen Moment ein Lächeln um ihre Lippen, ehe sich ihr Mund wieder vor Schmerz verzog. »Bitte, bitte, Marianne«, flehte sie tonlos. »Hilf du mir! Ich halte es nicht mehr aus.«
Marianne nestelte ein Fläschchen aus ihrer Tragetasche. Es enthielt eine schmerzstillende Mischung aus Zwiebelextrakt und Pfefferminzöl, der Marianne Laudanum beigemischt hatte. Sie füllte zwei Teelöffel in ein Glas und goss es mit Wasser aus der Karaffe neben dem Bett auf.
»Trinken Sie das!« Sie führte Amélie das Glas sanft an die Lippen und hob mit der anderen ihren Kopf an. Dabei entrang sich der Geplagten ein lautes Stöhnen.
Als das Mittel nach einigen Minuten zu wirken begann und sich Amélies Augen schläfrig schlossen, tastete Marianne vorsichtig ihren Körper ab.
»Jetzt musst du sehr tapfer sein, meine Liebe«, murmelte sie vor sich hin, bevor sie ihre Hand mit reinem Gänsefett einrieb und sanft in den Unterleib einführte. Mit der anderen Hand drückte sie vorsichtig Amélies Bauch. Zum Glück gelang ihr rasch, was der hochgelehrte Arzt erst gar nicht versucht hatte. Mit geübten Griffen drehte sie den Säugling im Leib der nun vor Schmerz Wimmernden in die richtige Lage.
Doch danach waren die Wehen zu schwach, um das Kind endgültig auszutreiben. Seufzend griff Marianne nach einem weiteren Mittel und flößte es Amélie ein. Mit markerschütternden Schreien brachte diese eine halbe Stunde später endlich ein kleines Mädchen zur Welt.
»Wie? Es ist überhaupt kein Sohn?«
Fassungslos starrte Alphonse Dumas die Hebamme an. Die schüttelte den Kopf.
»Nein, Ihre werte Frau Gattin hat ein entzückendes Töchterchen zur Welt gebracht.«
»Doch nun ist es Zeit für dich zu gehen«, mischte sich Doktor Vernon ein. »Es bedarf eines erfahrenen Wundarztes, um der Kindsmutter eine angemessene Nachbehandlung angedeihen zu lassen.«
Wie betäubt fügte sich der Kunsthändler der energischen Anweisung des Arztes. Er nestelte zwei Fünf-Francs-Stücke aus seiner Westentasche und reichte sie Marianne. Noch bevor sie ihren Dank aussprechen konnte, trat er ans Fenster und drehte ihr den Rücken zu. Die Hebamme knickste kurz und verabschiedete sich.
»Ein Mädchen!« Der Kunsthändler konnte es immer noch nicht fassen. »Nach zwei männlichen Fehlgeburten jetzt nur ein Mädchen.«
»Es tut mir sehr leid für Sie«, täuschte Doktor Vernon Mitgefühl vor. Dann begab er sich wieder selbst ins Krankenzimmer.
»Ihre Frau hat einen guten Schutzengel gehabt, dass sie diese Geburt überlebt hat«, konstatierte er selbstzufrieden, als er nach einiger Zeit in den Salon zurückkehrte. Dann holte er hörbar Luft.
»Doch lassen Sie mich Ihnen einen guten Rat geben, mein lieber Dumas«, fuhr er salbungsvoll fort. »Sie sollten Ihrer jungen Frau keine weitere Schwangerschaft zumuten. Es ist nicht davon auszugehen, dass sie noch einmal ein lebendes Kind zur Welt bringen kann. Stattdessen wird sie das nächste Mal mit hoher Wahrscheinlichkeit im Kindbett sterben.«
Wie von der Natter gebissen, fuhr Dumas herum. »Aber … Aber … Wie soll ich das denn verhindern?«
Erst als der Arzt ihn abschätzig musterte, wurde Alphonse klar, was er gemeint hatte.
»Monsieur, ich bin ein Mann in den besten Jahren«, protestierte er heftig. »Gerade einmal vierunddreißig Jahre alt. Und Amélie wird erst dreiundzwanzig! Sie können doch nicht von mir erwarten, dass ich bis zu meinem Lebensende auf jeden ehelichen Verkehr verzichte!«
»Na, na.« Vernon klopfte Dumas mit einer Mischung aus Geringschätzung und Wohlwollen auf die Schulter. »In Paris wimmelt es nur so von hübschen Frauen jeden Alters, jeder Figur und jeder Haarfarbe. Man nennt Paris nicht umsonst die Stadt der Liebe. Da sollte es einem Herrn wie Ihnen, strotzend vor Manneskraft, begütert dazu und mit den allerbesten Manieren, doch nicht schwerfallen, ausreichend Ersatz zu finden.«
TEIL 1Späte Kindheit
Kapitel 1
IN EINER WÄSCHEREI IN MONTMARTRE
12. JULI 1878
»Maman«, maulte Louise Weber zum wiederholten Mal. »Wie lange muss ich denn diese blöde Arbeit noch machen? Heut ist doch mein Geburtstag.«
Ihre Mutter Madeleine blickte kurz von dem Plätteisen hoch, mit dem sie gerade ein Herrenhemd bügelte.
»Ich hab dir schon mal gesagt, dass ich das nicht entscheiden kann«, antwortete sie. »Die Vorarbeiterin teilt uns ein. Geh und frag Jeanne, wenn du was von ihr willst.«
»Warum fragst du sie denn nicht?«, unternahm Louise einen weiteren Versuch. »Auf dich hört sie doch viel eher!«
»Weil du selbst schuld bist, wenn du heute die Plätteisen schrubben musst«, entgegnete ihre Mutter kurz angebunden. »Schließlich bist du fast eine halbe Stunde zu spät aus der Schule gekommen.«
»Aber dafür kann ich doch nix!«, begehrte Louise auf. »Das war doch die doofe Nonne, die mir diese Strafarbeit aufgebrummt hat.«
»Du wirst schon wissen, warum du die verdient hast. Und jetzt will ich kein Wort mehr darüber hören!«, beendete Madeleine Weber die Diskussion.
Mürrisch griff Louise wieder zu der Bürste und fuhr fort, die braun eingebrannten Stärkeflecke auf der Unterseite des Bügeleisens zu scheuern. Dies war in der Tat eine der unbeliebtesten Arbeiten für die Lehrmädchen in der Büglerei. Immer wieder passierte es, dass die auf dem Ofen erhitzten Plätteisen noch zu heiß waren, wenn gestärkte Wäschestücke damit bearbeitet wurden. Dann brannte sich die Stärke ins Eisen ein, das damit zunächst unbrauchbar wurde. Denn verwendete man es weiter, übertrugen sich die Flecke unweigerlich auf die Wäschestücke und ließen sich kaum mehr entfernen.
Elise, die die ganze Szene von ihrem eigenen Arbeitsplatz aus beobachtet hatte, stand plötzlich auf. Sie hatte wie die fast gleichaltrige Louise Weber vor einigen Wochen Geburtstag gehabt und an diesem Tag sogar von ihrer Mutter Jeanne den halben Nachmittag frei bekommen.
Einerseits wusste sie gut, warum Louise dieser Vorzug trotz ihres heutigen zwölften Geburtstags verwehrt wurde. Denn Louise kam häufig zu spät, auch wenn sie nicht in der Klosterschule nachsitzen musste, die die Mädchen am Vormittag besuchten. Sie trieb sich an anderen Tagen nach der Schule noch in den Gassen von Montmartre herum, stibitzte hier einen Apfel von einem Marktkarren und schwatzte da, frühreif, wie sie war, mit einem der jungen Burschen, die überall herumlungerten.
Bei der Arbeit in der Büglerei trödelte sie meistens herum und war sogar langsamer als Simone, Elises ungefähr ein Jahr jüngere Schwester. Vor unangenehmen Arbeiten, wie dem Reinigen der Bügeleisen, aber auch dem Vorsortieren der schmutzigen Wäsche, die meistens erbärmlich stank, pflegte Louise sich zu drücken, sooft sie konnte.
Trotzdem tat Louise Elise heute leid. In der Wäscherei hatte bislang niemand Notiz von ihrem Geburtstag genommen, geschweige denn ihr dazu gratuliert. Ihre Mutter Madeleine hatte daheim auch keinen Kuchen für sie gebacken, wie Jeanne vor einigen Wochen für Elise. Das hatte ihr Louise in der Schule erzählt.
Meistens bewunderte Elise ihre Freundin, die sich viel mehr traute als sie selbst. An manchen Tagen musste Louise ihr vorlautes Wesen und ihre Streiche aber auch büßen. Doch ausgerechnet am Geburtstag, neben Weihnachten und Ostern der wichtigste Feiertag im Jahr, sollte man es gut haben, fand Elise.
Jetzt streckte sie die Hand nach dem Plätteisen aus. »Komm, ich tausche mit dir«, bot sie an. »Du kannst derweil die Taschentücher bügeln, die Simone dann zusammenlegt. Nimm es als mein Geburtstagsgeschenk!«
Das ließ sich Louise nicht zweimal sagen. Denn diese Arbeit machte jedes der Mädchen gern.
Elise ignorierte die gerunzelte Stirn ihrer Mutter, die gerade aus dem hinteren Raum der Wäscherei kam, wo die schmutzige Wäsche gelagert wurde. Jeanne Lambert hatte sich im Lauf der Jahre systematisch hochgearbeitet. Den trunksüchtigen und zunehmend gewalttätigen Jacques Morin hatte sie schon kurz nach der Geburt ihrer zweiten Tochter Simone verlassen. Mithilfe der alten Hebamme Marianne, die tagsüber auf die Mädchen aufpasste, hatte sie zunächst in dieser Wäscherei als einfache Waschfrau angefangen.
Die Tätigkeit am eigenen Waschfass hatte sie nur zu gern gegen die harte Arbeit im städtischen Lavoir eingetauscht. Denn im Waschhaus gab es immerhin fließendes Wasser, sowohl heiß als auch kalt, das nicht mühsam vom Brunnen in die eigene Hütte geschleppt werden musste. Ihr Lohn betrug zwar nur zwei Francs pro Tag und damit weniger als an einem guten Tag am eigenen Fass. Dafür wurde er jeden Abend ausgezahlt.
Schnell war Jeanne aufgrund ihres Fleißes zur Waschmeisterin aufgestiegen, wie man die Vorarbeiterin der Wäscherinnen nannte. Dann bot ihr Madame Claude, die Besitzerin der Wäscherei, die anspruchsvollere Arbeit als Büglerin an. Sie war zwar ebenfalls anstrengend, aber nicht ganz so hart. Schließlich war Jeanne auch hier zur Vorarbeiterin aufgestiegen. Sie nahm die schmutzige Wäsche der Kundinnen an, verteilte sie an die Waschfrauen, sorgte dafür, dass sie rechtzeitig getrocknet wurde, und gab die Wäschestücke schließlich den vier Plätterinnen, je nachdem wie kunstfertig sie beim Bügeln waren.
Die schwierigsten Arbeiten übernahm Jeanne immer noch selbst. Dazu gehörten die oft mit Rüschen und Spitzen besetzten Hauben, die, perfekt gebügelt, immerhin sechs Sous pro Stück als Bezahlung einbrachten.
Jeanne selbst verdiente inzwischen mit vier Francs pro Tag das Doppelte ihres ursprünglichen Lohns. Doch auch in Montmartre wurde das Leben immer teurer. Mariannes schäbiges Holzhaus im Maquis, wohin sie sich mit ihren Töchtern zunächst geflüchtet hatte, hatten alle schon vor Jahren verlassen und waren in eine kleine Mansarde in der Rue Tourlaque gezogen.
Inzwischen lebten die vier sogar im Erdgeschoss des Hauses in einer geräumigen Wohnung mit drei Zimmern und dem Abtritt auf dem Flur. Ein Luxus, der Jeanne jedoch eine erkleckliche Miete kostete. Den Franc, den ihre beiden Töchter zusätzlich mit ihrer Mithilfe in der Plätterei am Nachmittag verdienten, konnte sie daher gut gebrauchen.
Wenn Elise in einem Jahr die Klosterschule beendet hätte, würde auch sie in der Plätterei weiterarbeiten dürfen, ohne sich zuvor als Waschfrau halb tot schuften zu müssen. Das hatte Jeanne mit Madame Claude schon vor einiger Zeit vereinbart.
Zwei Stunden später näherte sich der Arbeitstag seinem Ende. Zu diesem Zeitpunkt wurde die gebügelte Wäsche an die Kundinnen ausgeliefert, die sie nicht selbst abholen wollten. Dafür waren in erster Linie die vier Büglerinnen zuständig, die sich die schweren Weidenkörbe mit der Wäsche an einen Ellenbogen hängten, bevor sie damit losstapften. Gab es viel auszuliefern, halfen die Waschfrauen mit.
Der Anblick dieser Frauen mit ihrer schweren Last war für Montmartre mittlerweile genauso typisch wie die vielen Maler, die jede Ecke des Stadtteils im Freien auf ihre Leinwand bannten. Es blieb nicht aus, dass fast alle Künstler irgendwann auch einmal ein Bild einer solchen Wäscheausträgerin zeichneten oder malten.
Heute Abend hatte Jeanne mit der Auslieferung der Wäsche allerdings ein Problem. Corinne, eine der Büglerinnen, hatte sich die rechte Hand an einem Plätteisen verbrannt. Die Stelle war mittlerweile rot angeschwollen und mit Brandblasen übersät. Jeanne konnte froh sein, wenn Corinne morgen überhaupt zur Arbeit erschien. Auf keinen Fall wollte sie ihr zumuten, heute Abend noch Wäsche auszutragen. Die Waschfrauen, die ihren Arbeitstag früher als die Büglerinnen begannen, waren längst zu Hause.
Die Mädchen hatten den Unfall und die nachfolgenden Maßnahmen und Diskussionen natürlich mitbekommen. »Ich laufe dann eben zweimal«, bot Madeleine Weber an. Doch Jeanne schüttelte resigniert den Kopf.
»Ausgerechnet heute liegen die Wohnorte der Kundinnen, die auf die fertige Wäsche warten, sehr weit auseinander. Wir haben eine Lieferung an die Place du Tertre, gleich neben der neuen Basilika, die sie da bauen. Eine andere ist für die Wirtin der Moulin de la Galette, der Weg dorthin ist ebenfalls steil. Die beiden letzten müssen in den Boulevard de Clichy und den Boulevard de Rochechouart. Aber wieder an den entgegengesetzten Enden der Straßen.«
Sie seufzte. »Es wird mir nichts anderes übrig bleiben, als selbst zu gehen. Dabei habe ich gleich ein Treffen mit Madame Claude vereinbart. Ich wollte sie davon überzeugen, einen neuen Plättofen zu kaufen. Den brauchen wir dringend, der alte ist mittlerweile viel zu klein. Aber ihr wisst ja, dass sie jeden Centime dreimal umdreht, bevor sie ihn ausgibt.«
Auf dem Plättofen wurden auf eigens dazu eingerichteten Flächen die Bügeleisen erhitzt. Der Ofen sorgte außerdem für die zum Trocknen der Wäsche nötige Hitze.
»Außerdem ist dann niemand hier, um die Kasse zu machen. Das wird Madame Claude nicht gefallen.«
Die Besitzerin der Wäscherei bestand darauf, dass die Austrägerinnen den eingenommenen Lohn noch am gleichen Abend ablieferten. So konnten auch etwaige Reklamationen der Kundinnen über fehlende oder beschädigte Wäschestücke sofort registriert werden. Das kam zwar nur noch selten vor, seit Jeanne Vorarbeiterin war. Aber auszuschließen war es nicht.
Schließlich fasste Jeanne einen Entschluss. »Corinne, bleib bitte hier und sag Madame Claude Bescheid, dass ich mich verspäten werde. Vielleicht wartet sie ja auf mich. Und ihr anderen liefert euren Lohn bei Corinne ab, wenn Madame Claude doch schon fort ist.«
Sie griff nach einem der Wäschekörbe, als Louise plötzlich die Hand hob. »Ich hab ’ne Idee, Madame Lambert.« Die Lehrmädchen mussten die Vorarbeiterin siezen. »Wenn Elise und ich den Korb an zwei Seiten tragen, bringen wir ihn wenigstens den Berg hinab. Das schaffen wir doch, oder?« Sie zwinkerte Elise zu.
Die war zwar überrascht, hatte aber keine Einwände. Nach kurzer Überlegung stimmte auch Jeanne dem Plan zu. »Ich gebe euch die Wäsche für Madame Lefèbre mit. Ihre Wohnung liegt unten am Boulevard de Clichy, am nächsten von hier aus. Kassieren müsst ihr den Waschlohn nicht. Madame Lefèbre ist eine unserer ältesten Kundinnen und wird die Rechnung beim nächsten Mal mit bezahlen.«
Gesagt, getan. Wenige Minuten später schleppten die beiden Mädchen den schweren Korb zwischen sich die Rue Lepic hinab, die auf den Boulevard de Clichy mündete. Plötzlich bog Louise ab und zog Elise samt dem Korb in einen engen Hof, der von der Straße aus nicht einsehbar war. Elise glaubte, dass Louises Blase voll war und sie sich erleichtern wollte. Doch zu ihrem Entsetzen begann die Freundin, die Wäsche im Korb zu durchsuchen, nachdem sie ihn abgestellt hatte. Ihre Augen blitzten, ihre Zungenspitze schob sich zwischen die Lippen.
Schließlich zog sie ein blau-gelb gestreiftes Kleid aus glänzendem Stoff hervor, das an Ärmeln und Saum mit Rüschen garniert war, und hielt es sich vor den Leib. Es schien ungefähr ihre Größe zu sein.
»Das Kleid hat mir schon so gut gefallen, als Corinne es heute gebügelt hat«, erklärte sie der ratlosen und verwirrten Elise. »Vor allem wegen dem weiten Rock.«
Elise kam plötzlich ein furchtbarer Verdacht. »Willst du es etwa stehlen?« Sie schnappte nach Luft. »Schlag dir das aus dem Kopf! Du weißt doch, dass meine Maman jedes Wäschestück aufschreibt, das abgegeben wird. Wenn was fehlt, erst recht so ein schönes Kleid, merkt sie es doch sofort. Du wirst dir höchstens eine mächtige Tracht Prügel einhandeln.«
»Ach was!«, wiegelte Louise mit einem verschmitzten Grinsen ab. »Man muss nur wissen, wie man so was richtig anstellt.« Vor den Augen der weiterhin fassungslosen Elise faltete sie das Kleid und steckte es in eine Tragetasche aus Baumwollstoff, die sie unter ihrem Rock hervorgezogen hatte. Dann hängte sie sich die Tasche über die Schulter, nicht ohne sie vorher sorgfältig zuzubinden.
Elises Verdacht verstärkte sich. »Du hast das schon vorher geplant!«, wurde ihr klar. »Du wusstest, dass dieses Kleid hier in unserem Wäschekorb ist.«
Louises Grinsen vertiefte sich. »Nicht genau, aber ich hab’s gehofft.«
Angesichts von Elises Gesichtsausdruck fügte sie rasch hinzu: »Nun hab dich nicht so! Ich will es mir doch nur ausleihen, nicht stehlen. Madame Lefèbre sagen wir einfach, es ist in der Wäscherei vergessen worden, und bringen es morgen vorbei.«
»Wofür willst du dir das Kleid denn ausleihen?«
»Was glaubst du wohl? Heute Abend gibt’s ’nen Ball in der Moulin de la Galette. Wenn ich schon sonst keine Geburtstagsfeier hab, will ich wenigstens da hingehen.«
»Und deine Mutter erlaubt dir das?«
Louise schürzte verächtlich die Lippen. »Natürlich nicht. Die glaubt, dass ich längst schlafe, wenn ich mich aus dem Fenster davonschleiche. Der Ball geht bis Mitternacht. Ein wenig davon krieg ich auf jeden Fall noch mit. Und du weißt doch, ich tanz so gern.« Einen Augenblick lang verdunkelten sich ihre graublauen Augen. »Mein Papa hat mir schon den Chahut beigebracht, als ich erst vier war.«
Elise nickte. Louise erzählte manchmal von ihrem bei einem Unfall früh verstorbenen Vater. Er war Dachdecker von Beruf gewesen und eines Tages infolge eines Sturzes in die Tiefe gestorben.
Der Chahut wiederum war ein Tanz, der viele Jahre lang sogar als unanständig verboten gewesen war, weil die Tänzerinnen dabei ihre Beine unter den Röcken in die Luft warfen.
»Heute tanzt man allerdings den Cancan«, erklärte Louise. »Da hebt man die Röcke sogar richtig hoch, damit man die Beine auch sehn kann.«
»Du willst also mit diesem gestohlenen Kleid heut Nacht den Cancan in der Moulin de la Galette tanzen?« Elise konnte es noch immer nicht fassen. »Das Kleid wird dabei doch ganz zerknittert. Vielleicht muss es sogar noch mal gewaschen werden.«
»Ich pass schon gut drauf auf!«, versicherte Louise. »Und wenn trotzdem was passiert, lass ich mir irgendwas einfallen. Aber du merk dir eins: Wer nix wagt, der gewinnt auch nix.«
Kapitel 2
KUNSTGALERIE VON ALPHONSE DUMAS
JULI 1878
Valérie wischte sich unwillkürlich eine Strähne ihres rötlich braunen Haars aus der Stirn, die sich aus ihrer Zopffrisur gelöst hatte. Dabei merkte sie nicht, dass sich Spuren von Farbe von ihrer Hand auf die Haut übertrugen.
Obwohl die Kunstgalerie ihres Vaters in einem schattigen Teil der Rue Laffitte lag, hatte sich die drückende Hitze der vergangenen Tage inzwischen auch in den weitläufigen Räumen ausgebreitet. Es nutzte nichts, die mit einem kunstvollen schmiedeeisernen Gitter gesicherte Glastür zu öffnen, da draußen kein Lüftchen wehte.
Valérie lehnte sich auf ihrem hölzernen Hocker ein wenig zurück und betrachtete ihr Gemälde. Es war ein Stillleben mit einer Vase, in der ein bunter Blumenstrauß aus verschiedenfarbigen Dahlien steckte. Valérie kaufte täglich eine dieser Blumen von ihrem Taschengeld an einem Stand auf dem Boulevard de Clichy und nahm die Blüten als Modell, um sie naturgetreu nachzumalen.
Das Bild sollte ein Geburtstagsgeschenk für ihre Mutter Amélie sein. Sie würde in wenigen Wochen fünfunddreißig Jahre alt werden. Nach den Begriffen ihrer Zeit war sie damit eine Frau in mittleren Jahren, die die Blüte ihrer Jugend längst hinter sich hatte. Dahlien gehörten zu ihren Lieblingsblumen.
Valérie setzte noch einige Farbtupfen auf eine weiße und eine rosafarbene Blüte. Zuletzt malte sie die vorgezeichneten Blätter grün aus und überprüfte nochmals ihr Werk.
Mit leisem Bedauern konstatierte sie, dass der Blumenstrauß nach einigen Nachmittagen Arbeit daran jetzt fertig war. Sie hatte die Blüten so regelmäßig angeordnet, wie es Amélie tat, wenn sie einen Strauß arrangierte.
»Irgendwie … sieht es langweilig aus«, murmelte sie vor sich hin.
»Warum malst du dann nicht eine Blüte, die ein wenig über den Vasenrand hinaushängt?«, ertönte plötzlich eine sonore Stimme in ihrem Rücken.
Valérie fuhr erschrocken herum. Der Herr, der unbemerkt hinter sie getreten war, war noch jung und ihr flüchtig vom Sehen bekannt. Es war einer der Maler, die ihre Werke über die Galerie ihres Vaters verkauften.
Der Mann bemerkte Valéries Unsicherheit, legte die rechte Hand auf die Brust und verneigte sich leicht. »Entschuldige bitte, wenn ich dich erschreckt habe. Mein Name ist Henri Gervex. Und wer bist du?«
Ehe Valérie antworten konnte, schlug er sich mit zwei Fingern an die Stirn und fuhr fort: »Du bist Valérie Dumas! Hab ich recht? Die Tochter von Alphonse.«
Valérie nickte und errötete dabei leicht. Wieder sprach Gervex schon weiter, bevor sie antworten konnte. »Ich muss deinem Vater wirklich zustimmen. Du hast ein außerordentliches Talent zum Malen.«
Nun spürte Valérie ihr Gesicht glühend heiß werden. Zwar lobte auch ihr Vater sie immer wieder für ihre Zeichen- und Malkünste. Aber solch ein Kompliment hatte er ihr noch nie gemacht.
»Danke, danke, Monsieur«, stammelte sie.
Gervex neigte den Kopf und lächelte. »Dein Vater kann wahrlich stolz auf dich sein.«
»Das bin ich auch, Henri. Aber setzen Sie dem Kind doch nicht solche Flausen in den Kopf!« Jetzt hatte auch Valéries Vater den Nebenraum der Galerie betreten, in dem sie malte.
Gervex drehte sich zu ihm um. »Ich meine das völlig ernst, Alphonse. Sie sollten diese Begabung Ihrer Tochter fördern.«
»Das tue ich bereits nach Kräften«, versicherte Dumas. »Soweit es sich für ein so junges Mädchen schickt. Doch nun folgen Sie …«
Valérie fasste sich ein Herz und merkte dabei gar nicht, dass sie ihren Vater unterbrach. »Monsieur Gervex, meinen Sie wirklich, ich soll noch eine oder zwei Blüten hinzufügen, die ein wenig aus der Vase heraushängen?«
Der Maler nickte nachdrücklich. »Wenn du nicht nur ein schönes, aber gewöhnliches, sondern ein außergewöhnlich schönes Stillleben malen willst, würde ich dir dazu raten.«
»Henri!«, mahnte ihr Vater. »Nun kommen Sie doch endlich! Valérie wird schon wissen, was zu tun ist. Ich habe außergewöhnlich günstige Neuigkeiten für Sie.«
An der Tür drehte Alphonse sich noch einmal um. »Und wisch dir die Farbe von der Stirn, Valérie!«
Gervex folgte ihrem Vater aus dem Nebenraum in die Kunstgalerie. Valérie reinigte ihre Stirn mithilfe eines Taschenspiegels und einiger Tropfen Parfüm aus dem Flakon in ihrer Handtasche.
Maman würde das Bild besser gefallen, wie es jetzt ist, überlegte sie dabei. Aber mir nicht!, entschied sie dann. Außerdem bliebe mir heute nichts anderes mehr zu malen als die Vase und der Hintergrund. Dazu hab ich viel weniger Lust als zu den Blüten.
Sie begann, eine solch überhängende Blüte mit einem feinen Kohlestift an jeder Seite der Vase vorzuzeichnen. Dabei entschied sie, beide Blumen in Rot zu malen. Auch das würde das Bild interessanter machen. Bislang gab es zwischen all den weißen und rosa Dahlien nur eine einzige rote Blüte im Zentrum des Straußes.
Die Vase male ich dann in Blau, beschloss sie plötzlich. Nicht in Silbergrau! Blau macht einen viel besseren Kontrast.
Sie ignorierte dabei das leise Ziehen in der Magengrube, dass ihrer Mutter auch die ursprünglich vorgesehene Farbe der Vase wahrscheinlich besser gefallen würde. Überhaupt war Amélie von Valéries Zeichenbegabung keineswegs so angetan wie ihr Vater Alphonse.
Seit sie denken konnte, hatte Valérie ihre Mutter nur als kränklich erlebt. Außer zur Messe, die sie täglich besuchte, ging Maman kaum aus dem Haus. Sie empfing auch nur selten Besuch. Wenn Valérie in ihrer stürmischen Art, die sie von ihrem Vater geerbt hatte, ins Zimmer der Mutter stürzte, fand sie sie häufig auf ihrem Betschemel kniend vor, mit einem Rosenkranz zwischen den schmalen Fingern.
Jedes Mal handelte sie sich dann einen Tadel ein. »Valérie! Ein wohlerzogenes junges Mädchen bewegt sich gesittet. Es rennt nicht einfach durch eine Tür, bevor man es hineingebeten hat. Wie oft muss ich dir das noch sagen?«
Dann senkte Valérie den Kopf. »Entschuldige bitte, Maman! Es kommt nicht wieder vor.« Doch ihre guten Vorsätze reichten kaum bis zum nächsten Tag.
»Das Kind hat einfach zu viel Temperament!«, hatte sich Amélie einmal bei Alphonse beklagt, als sie glaubte, Valérie sei nicht in Hörweite. »Man könnte meinen, sie sei ein Junge. Ich weiß gar nicht, warum wir das teure Pensionat für Höhere Töchter bezahlen, wenn Madame Claire ihr dort nicht einmal Manieren beibringen kann.«
»Aber, aber, meine Teuerste«, hatte ihr Vater ihre Mutter beschwichtigt. »Madame Claire ist von Valérie begeistert. Sie ist eine der besten Schülerinnen, besonders in den Naturwissenschaften und der Mathematik.«
»Da siehst du es«, entgegnete ihre Mutter. »Genau das sind die Begabungen eines Knaben, nicht die eines jungen Mädchens. Im Religionsunterricht tut sie sich jedenfalls nicht besonders hervor«, hatte sie spitz ergänzt.
Madame Claires Pensionat lag nur eine kurze Wegstrecke von der Wohnung der Dumas entfernt in einem feudalen Gebäude am Boulevard Haussmann, sodass Valérie dort nicht übernachtete und auch die Wochenenden zu Hause verbrachte. Obwohl ihre Mitschülerinnen sie deswegen beneideten, wünschte sich Valérie oft, sie könnte auch im Pensionat wohnen.
Trotzdem bemühte sie sich, ihrer Mutter die Tochter zu sein, die sie sich wünschte. Valérie begleitete sie in den Ferien morgens zur Messe und verbrachte viele Nachmittage am Stickrahmen, obwohl sie viel lieber gezeichnet hätte. Sie übte eifrig auf dem verhassten Klavier, da ihre Mutter der Ansicht war, Musik sei die Kunst, die einer jungen Dame wohl anstünde.
Zum Glück sah ihr Vater Alphonse das anders. Als Kunsthändler war ihm Valéries Talent schon aufgefallen, als sie ein kleines Mädchen war. Jetzt stand er auf dem Zenit seines Erfolgs. Viele der bekannten Salonmaler, zu denen auch Henri Gervex gehörte, verkauften ihre Gemälde über seine Galerie.
Im jährlich stattfindenden Pariser Salon auszustellen, galt als Grundvoraussetzung für den Erfolg als Kunstmaler. Wenn man dann noch zu den von einer Jury ausgewählten Preisträgern gehörte, war man in der Regel ein gemachter Mann.
Ein gemachter Mann. Valérie hatte in der Tat noch nie von einer Frau gehört, der die Ehre zuteilgeworden wäre, im Salon auszustellen. Die bekannteste Kunstakademie in Paris, die École des Beaux-Arts, nahm Frauen erst gar nicht als Schülerinnen auf.
Mädchen mit malerischer Begabung wurden im besten Fall zu Hause von einem Privatlehrer unterrichtet. Zwar galt auch Zeichnen durchaus als weibliche Beschäftigung, aber nur im Stillen und nicht im Lichte der Öffentlichkeit.
Trotzdem war Valérie nicht entgangen, dass ihr Vater ihre Begabung wertschätzte. Von ihm stammte auch der Vorschlag, Valérie solle ihre Mutter zum diesjährigen Geburtstag mit einem gemalten anstatt einem echten Blumenstrauß überraschen. Natürlich im Stil des »Akademischen Realismus«, das heißt, so naturgetreu, als ob man die echten Blumen vor sich sähe.
Die sonst für Valérie überaus zähe Zeit in den großen Sommerferien war daher bisher wie im Fluge vergangen und voll kurzweiliger Erlebnisse gewesen. Um ihre Mutter überraschen zu können, durfte sie nicht zu Hause malen. Deshalb begleitete sie ihren Vater seit nunmehr vierzehn Tagen nachmittags in die Galerie und beobachtete neugierig das Kommen und Gehen von Künstlern und Kunden.
Ein besonderes Erlebnis war gleich, nachdem sie die Skizze der Vase und des Blumenstraußes vollendet hatte, der gemeinsame Einkauf von Farben bei einem Händler namens Père Tanguy gewesen. Dort durfte sie sich einige Ölfarben aussuchen.
Sehr interessant fand sie auch die Bilder, die Père Tanguy in seinem Laden ausgestellt hatte. Sie glichen zwar überhaupt nicht den Gemälden, die ihr Vater in der Kunstgalerie verkaufte, übten aber dennoch einen gewissen Reiz auf Valérie aus.
Die Farben waren nicht klar und kräftig, sondern pastell, und sie wirkten verwaschen. Trotzdem erkannte Valérie, was die Bilder darstellen sollten. Es gab Ansichten verschiedener Gärten und Landschaften. Der Künstler hieß Pissarro, entzifferte sie die Signatur, während ihr Vater noch mit dem Händler schwatzte.
Doch als sie ihren Vater auf dem Rückweg zur Galerie nach den Gemälden fragte, äußerte der sich verächtlich. »Das sind Schmierereien von einer Gruppe, die sich Impressionisten nennt. Kein einziges dieser Bilder wird jemals einen Käufer finden. Mir kommt so ein Schund jedenfalls nicht in die Galerie.«
Valérie lag es schon auf der Zunge zu widersprechen. Dann unterließ sie es wegen des angewiderten Gesichtsausdrucks ihres Vaters. Seither betrachtete sie die vielen Gemälde im großen Verkaufsraum, die in drei Reihen über- und dicht nebeneinander an den Wänden aufgehängt waren, intensiver als zuvor.
Da gab es eine grausame Szene aus einem römischen Amphitheater, auf der ein behelmter Gladiator gerade vom Publikum mit nach unten gesenkten Daumen den Befehl empfing, seinen unterlegenen Gegner zu töten. Da gab es Gemälde, die Schlachten zeigten, und solche mit Themen aus dem Alten Testament. Und vor allem unzählige Gemälde mit nackten Körpern, insbesondere von Frauen.
Eigentlich war es einer Dame sogar verboten, ihren Fußknöchel in der Öffentlichkeit sehen zu lassen. Valérie war einmal streng von ihrer Mutter zurechtgewiesen worden, als sie sich während eines Spaziergangs in einem Park die Schnürsenkel binden wollte.
Bislang hatte Valérie diese Art von Kunstwerken nicht infrage gestellt. Doch seit dem Besuch bei Père Tanguy grübelte sie darüber nach, warum nicht nur die griechische Liebesgöttin Venus immer wieder nackt dargestellt wurde. Aktuell bot ihr Vater gleich zwei Gemälde an, wo die Göttin, angeblich bei ihrer Geburt, aus den Wellen stieg. Allerdings als erwachsene, mit allen weiblichen Formen ausgestattete Frau.
Aber auch Tugenden wie die Hoffnung, die Wahrheit oder die Treue wurden als nackte Frauen abgebildet. Selbst die Frau des griechischen Heerführers Agamemnon war nackt, als ihr Sohn Orestes sie aus Rache für den Mord an seinem Vater tötete. Sie wirkte zudem ungefähr gleichaltrig wie ihr Sohn.
Instinktiv vermied es Valérie, ihren Vater nach den Gründen für diese Art der Darstellung zu fragen. Sie bekam allerdings rasch mit, dass sich solche Gemälde besonders gut verkauften und hohe Preise damit erzielt werden konnten. Deshalb vermutete sie, ihr Vater würde ärgerlich werden, wenn sie ihn darauf ansprach, und ihr womöglich sogar die Besuche in der Galerie verbieten.
Ein weiterer Aspekt störte sie zunehmend. Wenn sie zufällig ein Verkaufsgespräch mithörte, pries ihr Vater diese Figuren oft als der Natur getreu nachgestellt. Verglich Valérie die gemalten Personen jedoch mit Menschen aus ihrer Umgebung, kam sie jedes Mal zu dem Schluss, die Malereien würden die Natur eher verklären, als sie realistisch abzubilden.
Heute dachte sie jedoch nicht über diese Widersprüche nach. Sie war noch ganz hingerissen über das große Lob dieses bekannten und berühmten Pariser Malers. Nach ungefähr einer Stunde und einigen Korrekturen hatte sie die überhängenden Blüten skizziert und stand auf, um nachzusehen, ob sich Henri Gervex noch in der Galerie aufhielt. Zu gern hätte sie ihm ihren Entwurf gezeigt.
»Nun, ich muss tatsächlich gestehen, dass der Ratschlag, den Ihnen dieser Edgar Degas gegeben hat, nicht von schlechten Eltern war. Das hätte ich diesem Menschen gar nicht zugetraut. Seine Ballettmädchen, die er gewöhnlich malt, wirken längst nicht so erotisch. Wenn man sie überhaupt deutlich erkennen kann.«
»Tja, ganz kurz dachte ich sogar, Degas hätte mich absichtlich in eine Falle gelockt. Schließlich hat die Jury des diesjährigen Pariser Salons dieses Bild wegen Anstößigkeit abgelehnt.«
Valérie, die gerade an die Tür zu dem kleinen Raum klopfen wollte, in dem ihr Vater ganz besondere Werke verwahrte, hielt mitten in der Bewegung inne.
Rolla hieß Gervex’ Bild, das ihr Vater gestern zu einem exorbitant hohen Preis an einen belgischen Sammler verkauft hatte. Angesichts der Freude ihres Vaters neugierig geworden, war Valérie in einem unbewachten Moment in den bis dahin verschlossenen Raum geschlüpft und hatte es sich angesehen. Doch ihr Vater scheuchte sie rasch hinaus, als er es bemerkte.
Was ist denn anstößig an diesem Bild?, überlegte sie nun. Die nackte Frau, die dort auf dem Bett liegt, sieht nicht anders aus als viele andere nackte Frauen auf den Gemälden.
Gervex selbst gab ihr die Antwort auf diese Frage. »Die prüde Jury nahm Anstoß daran, dass diese Frau ihre Kleider in einem Haufen neben das Bett geworfen hat, bevor sie sich ihrem Geliebten hingab. Weil dadurch eben deutlich wird, dass man nackt miteinander schläft und zuvor bekleidet war.«
Ganz verstand Valérie den Sinn dieser Ausführungen nicht. Hatte die Jury Anstoß daran genommen, dass die Frau ohne Nachtgewand schlief? Dass man sich vor dem Zubettgehen auszog, war doch ganz normal.
Oder hatte die Jury kritisiert, dass der Mann bekleidet war, während die Frau keinen Faden am Leib trug? Nein, das kann auch nicht sein, verwarf sie diesen Gedanken. Sie erinnerte sich nämlich an einige Bilder, wo splitternackte Frauen vor einer ganzen Gruppe von bekleideten Männern standen.
»Jedenfalls ist Rolla zu beneiden«, hörte Valérie jetzt ihren Vater sagen. »Sich nach einer Nacht mit einer solchen Frau die Kugel zu geben, weil man zuvor sein ganzes Vermögen für Vergnügungen durchgebracht hat, ist ein schöner Tod nach einem schönen Leben.«
Valérie hörte aufmerksam zu. Rolla war offenbar der Name des Mannes neben dem Bett. Sie nahm sich vor, bei Gelegenheit herauszufinden, um wen es sich dabei handelte. Vielleicht verstand sie dann besser, was an dem Gemälde so unanständig sein sollte.
Als sich die Schritte der beiden Männer der halb offenen Tür näherten, schlüpfte sie rasch in ihr kleines Gemach zurück. Von dort aus belauschte sie das Gespräch weiter, wenn auch mit einem Anflug von schlechtem Gewissen.
»Jedenfalls hat sich dieser Monsieur aus Brüssel das Skandalbild einhunderttausend Francs kosten lassen. Wer hätte das gedacht?«, sagte ihr Vater.
Gervex lachte. »Ich sehe den Leiter der Jury des diesjährigen Salons regelrecht blass vor Neid werden, wenn er das erfährt. Meines Wissens hat er für keines seiner Bilder je mehr als zehntausend Francs erhalten.«
Valérie wusste, dass alle Mitglieder der mächtigen Jury, die die Gemälde für die renommierte Ausstellung auswählten, ebenfalls Kunstmaler sein mussten.
»Ein Drittel der Summe, die Sie jetzt als Provision verdient haben, mein lieber Alphonse«, fügte Henri mit leicht spöttischem Unterton hinzu.
»Mein Preis für das Risiko, das ich auf mich genommen habe«, hörte Valérie ihren Vater erwidern. »Die Sache hätte auch ins Auge gehen und mich sogar seriöse Käufer kosten können. Denken Sie doch nur ans Frühstück im Grünen von Édouard Manet. Der blieb damals auf seinem Skandalgemälde sitzen. Dabei hat er die Kleider der nackten Gespielin viel dezenter gemalt als Sie!«
Gervex prustete. »Heutzutage sind wir weiter als vor fünfzehn Jahren. Deshalb hielt ich Ihr Risiko von vornherein für gering. Und habe recht behalten, wie man jetzt sieht.« Damit verabschiedete sich Henri Gervex und verließ die Galerie.
Valérie blieb mit einer Mischung aus Ratlosigkeit und Neugier und einer ganzen Reihe offener Fragen zurück.
Kapitel 3
MOULIN DE LA GALETTE
EIN SONNTAGNACHMITTAG IM AUGUST 1879, EIN JAHR SPÄTER
Je weiter Elise die steile Rue Lepic an der Seite von Louise Weber emporstieg, desto schneller klopfte ihr Herz. Das hatte nicht nur mit dem anstrengenden Weg zum Eingang der Mühle zu tun, sondern auch mit der Mischung aus Vorfreude und Angst. Beide Gefühle lagen beständig im Widerstreit miteinander.
Heute würde Elise, natürlich ohne Wissen ihrer Mutter Jeanne, an ihrem ersten Ball teilnehmen. Er fand wie jeden Sonntagnachmittag auf der großen, im Freien gelegenen Tanzfläche der Moulin de la Galette statt. Die Mühle thronte hoch oben auf dem Hügel von Montmartre und war seit vielen Jahren ein beliebtes Ausflugsziel der Pariser, hatte Louise ihr erzählt.
»Da ist der Wein viel billiger als in Paris. Weil Montmartre ja noch nicht lang dazugehört.«
Der Stadtteil war erst im Jahr 1860 als 18. Arrondissement von Paris eingemeindet worden, wusste Elise. Der Zusammenhang mit billigem Wein war ihr trotzdem nicht klar gewesen. »Was hat das eine denn mit dem andern zu tun?«
Louise hatte die Achseln gezuckt. »Irgendwas mit Zoll oder so. Corinne aus der Wäscherei hat mal gesagt, in Montmartre konnte sich früher jeder für kleines Geld besaufen. Auch jetzt wär es bei uns noch viel billiger wie in der Stadt. Genau verstanden hab ich’s nicht. Aber es ist mir auch wurscht.«
Ihre Augen blitzten, als sie Elise verschwörerisch zulächelte. »Wir bezahlen sowieso nix, wirst sehn. Die Kerle reißen sich drum, uns einzuladen.«
Das hoffe ich sehr, erinnerte sich Elise jetzt an Louises Worte, als sie keuchend hinter ihr herstapfte. Je höher sie kamen, desto steiler wurde die Rue Lepic. Elise hatte keinen Centime bei sich, mit dem sie sich selbst etwas zu trinken kaufen konnte. Und verspürte bereits jetzt an diesem warmen, sonnigen Augustnachmittag heftigen Durst.
Endlich kam das große ovale Tor in Sicht, hinter dem eine Treppe zum Garten der Mühle hinaufführte. Doch zu Elises Enttäuschung ging Louise daran vorbei.
»He«, rief Elise ihr nach und blieb stehen, da sie jetzt auch noch Seitenstechen vom schnellen Gehen bekam. »Wo willst du denn hin?«
Louise fuhr herum und legte sich mit wütendem Gesichtsausdruck den Zeigefinger auf den Mund. Dann wartete sie, bis Elise herangekommen war.
»Du dämliche Trine!«, zischte sie. »Willst du alle auf uns aufmerksam machen?«
»Was wär denn dabei?« Elise verstand ihre Freundin nicht.
»Na, der Torwächter da lässt uns sicher nicht rein«, erklärte Louise. »Der fragt uns, wo unsere Mütter sind. Und dann war’s das mit dem Tanz.«
»Außerdem kostet es Eintritt«, fügte sie hinzu. »Fünfundzwanzig Centime. Hast du etwa so viel dabei?«
Elise sank der Mut. »Davon hast du mir gar nichts gesagt. Wie willst du denn sonst reinkommen?«
»Ach, das ist nicht schwer.« Louises Zorn verrauchte so schnell, wie er gekommen war. Jetzt grinste sie wieder. »Wir kommen einfach vom Maquis aus zur Mühle und schlagen uns dann durchs Gebüsch. Da gibt’s ’ne Lücke im Zaun, gleich hinter der Blaskapelle. Wir schlüpfen durch, und schon sind wir drin.«
Elise stockte der Atem. »Und … das Kleid?«, stammelte sie. »Das kriegt doch sicher Flecke dabei! Oder sogar einen Riss!«
Jetzt bedauerte sie heftig, dass sie sich von Louise hatte überreden lassen, sich aus der Wäsche, die sie gestern Abend am Boulevard de Clichy ausliefern sollten, zum ersten Mal ebenfalls ein Kleid »auszuleihen«. Ein kostbares noch dazu. Aus weißer Seide mit rosa Rüschen.
Louise hatte ihr vorher erklärt, dass sie so etwas schon ein paarmal gemacht hätte, ohne je erwischt worden zu sein.
»Komm schon«, hatte Louise sie überredet. »Du willst bei den Burschen doch Eindruck schinden! Wer soll denn mit dir tanzen, wenn du in so ’nem Baumwollfetzen daherkommst wie dem, den du jetzt anhast.«
Eigentlich war Elise bis dahin auf ihr neues Kleid mit dem Blümchendruck stolz gewesen. Ihre Mutter Jeanne hatte es ihr in ihrer spärlichen Freizeit genäht. Doch auf ihr Zögern hin setzte Louise noch eins drauf. »Bild dir ja nicht ein, dass ich dich damit mitnehm! Da blamier ich mich ja bis auf die Knochen mit dir.«
Und so überwand sich Elise, das weiße Kleid zu nehmen. Denn die Freundin schwärmte ihr schon den ganzen Sommer lang von den wunderbaren Tanzveranstaltungen in der Moulin de la Galette vor. Seit Wochen schlich sie sich ohne Wissen ihrer Mutter dorthin. Zu gerne wollte Elise auch einmal dabei sein.
Louise hatte sich aus einer anderen Wäschelieferung ebenfalls ein teures Kleid ausgesucht. Es war hellblau und betonte die Farbe ihrer graublauen Augen. Dazu hatte sie gleich einen mit Volants besetzten Unterrock einbehalten. Als sich herausstellte, dass er für ihr Kleid viel zu lang war, schlug Louise den Bund an der Taille um und steckte ihn mit Stecknadeln fest. Jetzt bauschte sich der Rock des Kleides. Entzückt drehte sich Louise um die eigene Achse. »Das richtige Kleid für einen Cancan«, schwärmte sie.
Das war vor zwei Stunden geschehen, nachdem sich die Mädchen zu Hause jeweils mit der Ausrede verabschiedet hatten, sich nachmittags bei der Freundin treffen zu wollen. Stattdessen schlichen sie sich in einen Garten, in dem sich eine kleine Hütte befand. Diesen Schlupfwinkel hatte Louise schon vor einiger Zeit entdeckt, hier pflegte sie sich für den Tanz herzurichten und umzuziehen.
»Die Besitzerin ist unsre Nachbarin. Die liegt schon seit Wochen im Spital. Da stört uns niemand«, hatte sie Elise mitgeteilt, als die beiden gestern Abend ihre ausgeliehenen Kleider dort versteckt hatten.
Louise hatte ihrer Mutter auch das Salatöl stibitzt, das sie verwendete, um sich künstliche Locken in ihre rotblonden glatten Haare zu drehen. Darauf konnte Elise mit ihren schwarzen Locken verzichten, zudem fürchtete sie, Fettflecke auf dem Kleid zu hinterlassen. Und nun sollte sie damit sogar durch Gebüsch und einen Zaun kriechen. Ihr schwante Böses. Doch für eine Umkehr war es zu spät.
Eine halbe Stunde später hatten sich ihre Bedenken aufgelöst. Tatsächlich war sie, ohne das Kleid zu beschädigen, auf die Gartenterrasse der Mühle gelangt und stand nun am Rand, um das Geschehen erst einmal zu beobachten.