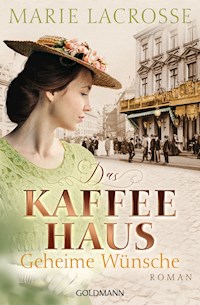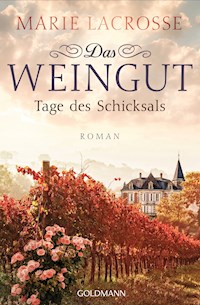9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Das Weingut
- Sprache: Deutsch
In den dunklen Gassen Prags fordert ein skrupelloser Killer seine Gegner zu einem teuflischen Spiel heraus ...
Weißenburg im Elsass im Jahr 1870: Die junge Waise Irene kommt als Dienstmädchen in das Herrenhaus des reichen Weinhändlers Wilhelm Gerban. Dessen Sohn Franz glaubt an die Ideale der französischen Revolution, wofür sein Vater wenig Verständnis hat. Als Irene auf Franz trifft, verlieben die beiden sich leidenschaftlich ineinander. Doch nicht nur Standesschranken und familiäre Intrigen stehen ihrer Beziehung im Wege. Auch am europäischen Horizont ziehen dunkle Wolken auf: Ein furchtbarer Krieg bricht aus. Gegen alle Widerstände kämpfen die beiden jungen Leute um ihr Glück. Bis das Schicksal unbarmherzig zuschlägt ...
Vor der Kulisse des Kriegs von 1870/71 zeichnet Marie Lacrosse ein beeindruckendes Bild der bürgerlichen Verhältnisse der Zeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 858
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Buch
Weißenburg im Elsass im Jahr 1870: Die junge Waise Irene kommt als Dienstmädchen in das Herrenhaus des reichen Weinhändlers Wilhelm Gerban. Dessen Sohn Franz glaubt an die Ideale der Französischen Revolution, wofür sein Vater wenig Verständnis hat. Als Irene auf Franz trifft, verlieben die beiden sich leidenschaftlich ineinander. Doch nicht nur Standesschranken und familiäre Intrigen stehen ihrer Beziehung im Wege. Auch am europäischen Horizont ziehen dunkle Wolken auf: ein furchtbarer Krieg bricht aus. Gegen alle Widerstände kämpfen die beiden jungen Leute um ihr Glück. Bis das Schicksal unbarmherzig zuschlägt …
Autorin
Marie Lacrosse hat in Psychologie promoviert und arbeitet heute als selbstständige Beraterin überwiegend in der freien Wirtschaft. Unter einem anderen Namen schreibt sie erfolgreich historische Romane. Die Autorin lebt mit ihrem Mann in einem beschaulichen Weinort. »Das Weingut. In stürmischen Zeiten« ist der erste Band der großen Saga um die Weinhändler-Familie Gerban.
Mehr über das Buch finden sie unter:www.marielacrosse.de
Marie Lacrosse
Das Weingut.In stürmischen Zeiten
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2018 by Marie Lacrosse
Copyright der deutschen Erstausgabe © 2018 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Montasser Medienagentur, München.
Gestaltung des Umschlags und der Umschlaginnenseiten: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: gettyimages/ © Max shen und FinePic®, München
Karten: © Peter Palm, Berlin
Redaktion: Heike Fischer
BH · Herstellung: kw
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-22641-1V005
www.goldmann-verlag.deBesuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Meinem Mann Jürgen für seine unverbrüchliche Treue
Man mag es beklagen, aber es bleibt richtig, dass die Humanität im Kriege dem Kriege nachstehen muss und dass die energische Kriegführung zugleich die humanste ist.
Helmuth von Moltke der Ältere, preußischer Generalfeldmarschall
Man muss doch durch so ergreifende Beispiele wie diejenigen, welche Sie erzählen, erkannt haben, was der Ruhm auf den Schlachtfeldern an Martern und Tränen kostet. Man lässt sich nur zu oft verleiten, die glänzenden Seiten eines Krieges zu sehen und die Augen vor den traurigen Folgen desselben zu verschließen.
Der Schweizer General Dufour an Henry Dunant, den Begründer des Roten Kreuzes
Dramatis Personae
Es werden nur die handlungstragenden Figuren aufgeführt. Historische Persönlichkeiten werden mit einem * gekennzeichnet.
Irenes Familie
Irene Weber, unehelich geboren in einer Gebäranstalt, aufgewachsen in Waisenhäusern; »Weber« ist nicht ihr echter Familienname
Klara, Deckname von Irenes anonym bleibender Mutter
Tante Erna, Klaras Begleiterin in die Gebäranstalt
Franz Gerbans Familie
Wilhelm Gerban, deutscher Weinhändler mit Firmensitz im elsässischen Weißenburg
Pauline Gerban, seine französische Ehefrau
Franz Gerban, Wilhelms und Paulines ältester Sohn
Mathilde Gerban, ihre jüngere Tochter
Gregor Gerban, Wilhelms Bruder, Leiter des familieneigenen Weinguts im pfälzischen Schweighofen
Ottilie Gerban, Ehefrau von Gregor und Wilhelms Schwägerin
Fritz Gerban, Gregor und Ottilies Sohn
Sophia, diejüngere Schwester von Ottilie
Hauspersonal der Gerbans in Altenstadt
Niemann, erster Hausdiener
Frau Burger, Hausdame
Frau Kramm, Köchin
Gerda, erstes Hausmädchen
Minna, zweites Hausmädchen
Riemer, Kutscher
Weitere Personen von Bedeutung
(Es werden nur die wichtigsten Personen in der Reihenfolge ihres Erscheinens im Roman aufgeführt.)
Schwester Agnes, Hebamme in der Gebäranstalt, später Leiterin des Waisenhauses in Heidelberg
Schwester Gertrude, Leiterin des Mädchentrakts im Waisenhaus in Speyer
Mutter Ignatia, Oberin des Waisenhauses in Speyer
Dr. Frey, Hausarzt der Gerbans
Karl Krüger, Arbeiter auf dem Weingut der Gerbans
Major von Kaisenberg*, Bataillonskommandant von Fritz Gerban
Edgar Hepp*, Unterpräfekt von Weißenburg
General Abel Douay*, französischer Befehlshaber der Schlacht von Weißenburg
Pfarrer Klein*, evangelischer Pastor in Fröschweiler
Albert Valon, französischer Deserteur
Louis Rousser, Sanitätsfeldwebel in der französischen Armee
Gérome, französischer Kriegsversehrter
Jacques, französischerSanitätsgefreiter
Claire Rocher, Bewohnerin von Bazeilles
Dr. Etienne, Arzt für Frauenheilkunde in Weißenburg
Dr. Berger, Lazarettarzt in Saint-Quentin
Marianne Serge, eine begüterte Dame in Saint-Quentin
Paul, ihr bei Sedan gefallener Sohn
Gilbert, kriegsversehrter französischer Soldat
Otto, Minnas Ehemann
Magda Färber, Zimmerwirtin in Landau
Emma, Textilarbeiterin in Lambrecht
Im Roman erwähnte historische Persönlichkeiten ohne aktive Rolle
König Wilhelm von Preußen*, späterer deutscher Kaiser
Otto Graf Bismarck*, sein Reichskanzler
Kronprinz Friedrich Wilhelm von Preußen*, deutscher Oberbefehlshaber der Schlachten von Weißenburg und Fröschweiler-Wörth
Napoleon III.*, französischer Kaiser
General Mac-Mahon*, Marschall von Frankreich, Oberbefehlshaber der französischen Truppen in der Schlacht bei Sedan, wo er auf sein Pendant auf gegnerischer Seite, General Helmuth von Moltke den Älteren, trifft
Prolog
Heidelberg, Februar 1851
Das Krähen des Säuglings riss sie aus dem Erschöpfungsschlaf, in den sie nach der schweren Geburt für einige Minuten gesunken war. Mühsam richtete sie sich auf den Ellenbogen auf und blickte umher. Kein Lichtstrahl fiel durch das trübe Milchglas des kleinen Fensters zu ihrer Rechten, draußen herrschte mittlerweile finstere Nacht.
Als sie sich vorbeugte, um den Vorhang zurückzuziehen, der ihr Bett rechter Hand auf Kopfhöhe umgab, schoss ein rasender Schmerz durch ihren Unterleib. Mit einem leisen Schrei sank sie zurück in die Kissen.
Wenig später wurde der Vorhang zur Seite gezogen. Ohne ein Lächeln tauchte das Gesicht ihrer Tante Erna vor ihr auf. Es zeigte den Ausdruck Fleisch gewordener Missbilligung.
»Was gibt es, Klara?« Auch die Stimme ihrer Tante klang hart. »Du sollst ruhen, damit wir diese unwürdige Örtlichkeit so schnell als möglich verlassen können.«
»Bitte!« Die junge Frau leckte sich über die spröden, aufgesprungenen Lippen. »Bitte, ich will das Kind doch nur einmal sehen. Ist es ein Junge oder ein Mädchen?«
Ihre Tante schüttelte den Kopf. »Es ist ein Bastard«, antwortete sie brutal. »Das weißt du genauso gut wie ich, und mehr musst du nicht wissen!«
»Bitte, um Christi willen, ich bitte dich! Ich will es nur einmal halten! Ich habe es neun Monate in meinem Leib getragen! Es ist mein Kind!«
»Ich habe Nein gesagt! Das gehört nicht zu den Gepflogenheiten dieses Hauses! Wir müssen schon genug dafür bezahlen, dass deine Schande unentdeckt bleibt, Klara!«, betonte die Tante den Namen in verächtlichem Tonfall. Es war nicht der richtige Vorname der Wöchnerin. Wie jeder Tochter aus gutem Hause, die die Dienste dieser Anstalt in Anspruch nahm, hatte man ihr am Tag der Aufnahme einen Decknamen zugewiesen.
»Bitte!« Klaras Stimme wurde lauter. »Bitte! Ich schreie das ganze Haus zusammen, wenn ich das Kind nicht sehen darf!«
Der Ausdruck im Gesicht ihrer Tante wandelte sich von Missbilligung zu unverhohlener Verachtung und kaltem Zorn. »Hättest du geschrien, bevor dieser Bastard gezeugt wurde, hättest du wohlgetan! Aber damals hast du es vorgezogen, dich in sündiger Lust zu wälzen! Nun füge dich in dein Schicksal. Ich werde dir einen Schlaftrunk bringen lassen. Wir reisen so bald wie möglich ab!«
Mit diesen Worten trat sie vom Bettrand zurück und riss den Vorhang mit einer herrischen Bewegung wieder zu.
Tränen der Empörung und Demütigung rannen der jungen Frau über die Wangen. Noch einmal versuchte sie, sich aufzurichten, noch einmal warf sie der Schmerz zurück auf ihr schweißdurchtränktes Lager. Nicht einmal die Laken hatte man nach der stundenlangen Tortur der Geburt gewechselt. Nur das blutige Ledertuch, das man ihr untergeschoben hatte, war entfernt worden.
Verzweifelt lauschte sie auf die Geräusche um sich herum. Sie hörte den Säugling leise im Nebenraum weinen, der von ihrer Kammer abging, und erkannte nun auch die Stimmen der Hebamme und der Schwester, die sie während der Geburt betreut hatten. Wasser plätscherte. Wahrscheinlich wurde das Kind gerade gebadet. Doch niemand reagierte auf ihr leises Rufen, obwohl die Tür zwischen ihrer Kammer zum Nebenraum offen stand. Klara fühlte sich völlig hilflos. Einmal mehr verfluchte sie die Abgeschiedenheit ihres Zimmers.
Da niemand ihre wahre Identität kennen sollte, hatte sie in diesem »Haus für gefallene Mädchen«, wie ihre Tante es nannte, den kleinen Raum für sich allein. Ihre Leidensgenossinnen, die aus ärmeren Verhältnissen stammten, lagen dagegen in einem großen Schlafsaal. Von deren Schicksal hatte ihr Schwester Agnes erzählt. Die mütterlich wirkende Frau war die einzige Person, die in den zwei Monaten ihres Aufenthaltes ein freundliches Wort an sie gerichtet hatte.
Wie oft hatte sich Klara in diesen endlosen Wochen nach der Gesellschaft der Frauen und Mädchen gesehnt, die vom gleichen Unglück heimgesucht worden waren! Wie gerne hätte sie ihr weiches Federbett in der kleinen Kammer mit einem der harten Strohlager im großen Saal getauscht, den sie tief verschleiert jeden Sonntagmorgen durchquert hatte, wenn man sie zur heiligen Messe führte. Auch in der kleinen zugigen Kapelle musste sie abseits in dem unbequemen geschnitzten Chorgestühl sitzen, während sie den Worten des Priesters lauschte, der seiner ausschließlich weiblichen Gemeinde in jeder Predigt ihren sündigen Lebenswandel vorhielt.
Allerdings hätte Schwester Agnes ihr sagen können, dass das Geschwätz und Geplauder, nach dem sich Klara so sehnte, auch im großen Schlafsaal streng unterbunden wurde. Dass die Frauen und Mädchen dort, solange sie dazu fähig waren, tagsüber harte Arbeit verrichten mussten. Sie webten oder spannen zwölf Stunden lang, die Geschickteren klöppelten Spitze oder bemalten Holzspielzeug. Klara konnte nicht wissen, dass keine dieser Unglücklichen dafür Verständnis aufgebracht hätte, dass sich das Fräulein in der Kammer langweilte, weil man ihr außer der Bibel nicht einmal Bücher zugestanden hatte. Dass sie für das nahrhafte Essen, das man ihr dreimal am Tag servierte, beneidet worden wäre: Weizenbrot mit Marmelade zum Frühstück, Hühnchen und frisches Gemüse zu Mittag, Käse und Wurst zum Abendessen, so viel sie begehrte. Während sich die armen Bewohnerinnen der Anstalt mit einem faden Haferbrei am Morgen, einer dünnen Gemüsesuppe am Mittag und hartem Brot mit Quark oder Schmalz am Abend begnügen mussten.
»Schließlich sind diese Frauen nicht einmal zahlende Gäste, sondern liegen der Wohlfahrt auf der Tasche.« In diesem oder ähnlichem Tenor hätte Tante Erna über ihre Leidensgenossinnen gesprochen, wenn Klara je das Gespräch mit ihr darüber gesucht hätte. Die Häme und Verachtung, mit der diese sich im Bewusstsein ihrer eigenen altjüngferlichen Tugend über »die in Schande Geratenen« äußerte, wäre dabei wahrscheinlich noch deutlicher als sonst zum Ausdruck gekommen.
Jetzt krähte der Säugling wieder heftiger. »Sch, sch, alles ist gut«, hörte Klara die beruhigende Stimme der Hebamme, der unmittelbar Tante Ernas schnarrende folgte.
»Sind wir hier drin jetzt endlich fertig? Ich sehne mich nach einer anständigen Mahlzeit und dem Frieden meines Zimmers.«
»Sofort, meine Gnädigste. Sie müssen mich nur noch zur Mutter Oberin begleiten und die Übergabe des Kindes an unsere Anstalt bescheinigen.«
Nein, sie sollen es noch nicht wegbringen! Mit letzter Kraft zog Klara an ihrem Bettvorhang, doch niemand im Raum schien es zu bemerken oder zu beachten. Dann hörte sie, wie die Tür ihrer Kammer geöffnet und geschlossen wurde und sich die Schritte mehrerer Personen den Gang hinunter entfernten. Sie war allein. Verzweifelt begann sie zu schluchzen.
Das ganze Elend der letzten furchtbaren Monate brach wie eine Lawine über sie herein. Die Tante hatte von sündiger Lust gesprochen, in der sie sich gewälzt habe. Stattdessen hatte sie nur Entsetzen und Scham empfunden, als der Mann, dem sie vorbehaltlos vertraut hatte, völlig unvermutet über sie hergefallen war. Er hatte ihre Schreie mit einem Kissen erstickt, während er ihre Röcke hochschob, ihren Schlüpfer zerriss und brutal in sie eindrang. Der hilflos Weinenden drohte er hinterher, sie in Schimpf und Schande aus dem Haus zu werfen, sollte sie auch nur ein Sterbenswörtchen von dem verraten, was in dieser Nacht geschehen war. Klara glaubte ihm das aufs Wort.
Wie gerne hätte sie geschwiegen und alles verdrängt und vergessen! Doch dann begann diese merkwürdige Übelkeit, die sie jeden Morgen heimsuchte. Um die Taille herum wurde sie fülliger, sodass sie nicht mehr so eng geschnürt werden konnte und all ihre Kleider weiter gemacht werden mussten. Ihre Brüste schwollen an.
In ihrer Unschuld konnte sie sich diese Veränderungen ihres mädchenhaften Körpers anfangs gar nicht erklären. Bis ihre Schwester, alarmiert durch die Zofe, die Klara täglich aufwartete, ihr eines Morgens auf den Kopf zusagte, dass sie schwanger sei. Und dabei den Vater des Kindes gleich mit benannte. In ihrer grenzenlosen Verwirrung hatte Klara den Verdacht ihrer Schwester bestätigt.
Unmittelbar danach setzte hinter der gutbürgerlichen Fassade ihres Heims hektisches Treiben ein. Nachdem der langjährige Hausarzt der Familie unter dem Siegel strengster Verschwiegenheit die Schwangerschaft bestätigt hatte, tagte der Familienrat. Klara war davon ausgeschlossen, ihr wurde nur das Ergebnis mitgeteilt.
»Du wirst in Begleitung von Tante Erna zunächst aufgrund deiner schwachen Konstitution einen Kuraufenthalt in Baden-Baden antreten. Dort kennt euch niemand. Sobald dein Zustand sich nicht länger verbergen lässt, wird Tante Erna dich in eine Gebäranstalt nach Heidelberg bringen. Dort wird das Kind zur Welt kommen, ohne dass dein richtiger Name jemals genannt werden wird. Nach der Geburt verbleibt es im der Anstalt angeschlossenen Waisenhaus. Du selbst verbringst zwei weitere Monate in Baden-Baden und kehrst dann als genesen nach Hause zurück.«
Ein Blick in die unerbittlichen Gesichter rings um den polierten Nussbaumtisch zeigte Klara sofort, dass jeder Widerspruch zwecklos war. Man hatte über ihr Schicksal und das des Ungeborenen unwiderruflich entschieden.
Während der folgenden Monate in Baden-Baden durfte Klara mit niemandem in Kontakt treten. »Möchtest du dich und die Familie endgültig in Verruf bringen?«, hielt ihr die gestrenge Tante vor, als sie Klara beim Plaudern mit einem jungen Offizier erwischte. Er hatte sie im Speisesaal des vornehmen Kurhotels angesprochen, während sich Tante Erna im Büro der Hausdame über die Frechheit eines Zimmermädchens beschwerte, das ihr am Morgen Widerworte gegeben hatte. Von da an ließ sie Klara keinen Moment mehr aus den Augen.
Waren ihr die Monate in Baden-Baden ohne jede gesellschaftliche Zerstreuung bereits öde und trostlos vorgekommen, so empfand sie ihre Lage in der Gebäranstalt in Heidelberg bereits nach wenigen Tagen als schier unerträglich. Sie durfte ihre Kammer tagsüber nicht verlassen, erst im Schutze der Dunkelheit unternahm sie in Begleitung einer Pflegerin einen kurzen Spaziergang im Hof. Am Sonntag nahm sie an der heiligen Messe teil, am Nachmittag kam Tante Erna zu Besuch. Bei beiden Gelegenheiten mangelte es nicht an Ermahnungen und Vorhaltungen über ihren Fehltritt. Trotz ihrer flehentlichen Bitten verweigerte man ihr jede Literatur, verbot ihr, Briefe zu schreiben, und gestand ihr selbst einen Stickrahmen und einen Malkasten erst zu, nachdem sie zwei Tage hintereinander apathisch im Bett gelegen und jede Nahrung zurückgewiesen hatte.
Am schlimmsten waren die medizinischen Visiten. Klara hatte bereits die Untersuchung durch den Hausarzt, der sie seit frühester Kindheit kannte, als überaus peinlich empfunden. Doch was sie in Heidelberg erwartete, stellte dies noch bei Weitem in den Schatten. An jedem zweiten Tag musste sie, nur mit einem losen Hemd bekleidet, mit weit gespreizten Beinen erdulden, dass ihre geheimsten Stellen den Blicken zweier Medizinstudenten dargeboten wurden, während der Professor, der die Gebäranstalt zu Studienzwecken nutzte, sie innen und außen, oben und unten abtastete.
Schwester Agnes teilte Klara mit, dass im Gegenzug für die täglichen »Lehrveranstaltungen« kein Honorar für die medizinischen Dienstleistungen in der Anstalt berechnet wurde. Was ihr Agnes verschwieg, war die Tatsache, dass rund um die Betten der mittellosen Frauen ganze Heerscharen von männlichen Studenten standen, die die Unglücklichen oft mehrmals hintereinander unter der Aufsicht eines Assistenten des Professors untersuchten und dabei nicht mit zotigen Bemerkungen sparten.
Deshalb wusste Klara auch nicht, dass sie trotz ihres Elends als einzige Insassin der Anstalt Privilegien genoss, die nur den reichen und damit zahlungskräftigen Kundinnen gewährt wurden. Dennoch hatte auch sie für ihre Sünde hier zu büßen. Die Nonnen, die die Anstalt führten, behandelten Klara ohne jede Wärme und ließen sie unter der steifen Höflichkeit, mit der sie ihr begegneten, deutlich ihre Verachtung spüren.
»Lassen Sie sich dadurch nicht aus der Fassung bringen, liebes Fräulein. Die Schwestern glauben nun einmal, das müsse so sein, weil sie es nicht besser wissen«, tröstete Agnes, Laienschwester und ebenfalls Hebamme in diesem Konvent, sie eines Tages, als sie Klara nach einer Visite der Mutter Oberin hilflos weinend auf ihrem Lager fand. »Denken Sie an Ihr Kindchen, so viel Kummer könnte ihm schaden.«
Das Kind … Anfangs hatte Klara es aus tiefstem Herzen gehasst. Doch als sie die ersten zarten Bewegungen des Wesens spürte, das da in ihr heranwuchs, verwandelte sich ihre Abneigung mit jedem Tag mehr in Liebe und Zärtlichkeit. Daran änderte sich auch nichts, als sie erfuhr, dass ihr eine schwere Geburt bevorstand.
»Man fürchtet, das Kind und sogar Sie selbst könnten dabei sterben«, gestand ihr Agnes auf ihre drängenden Fragen hin, nachdem sie wieder einmal den Austausch zunehmend bedenklicher Blicke und Tuscheleien des Professors mit seinen Studenten beobachtet hatte. Doch anstatt erschrocken zu sein, fühlte Klara sich erleichtert. »Dann müsste ich das Kleine wenigstens nicht hergeben, sondern wäre auf immer mit ihm vereint.«
»Reden Sie nicht so, ich bitte Sie, gnädiges Fräulein«, entgegnete die entsetzte Agnes. »Sie haben Ihr ganzes Leben noch vor sich und sind zum Sterben noch viel zu jung. Hätte ich Ihnen doch nur nichts gesagt!«
Doch das Kind wollte sich bis zuletzt nicht drehen, um mit dem Kopf voran das Licht der Welt zu erblicken. Obwohl es den Gepflogenheiten des Hauses widersprach, die Schmerzen der Geburt durch die Vergabe von Betäubungsmittel zu lindern, verabreichte ihr der Professor nach Stunden fruchtloser Wehen schließlich ein wenig Morphium, um das Kind mithilfe einer Zange mit dem Steiß voran aus dem Geburtskanal herausziehen zu können. Hinterher musste er noch den tiefen Dammriss vernähen, eine überaus schmerzhafte Prozedur, die Klara wieder bei vollem Bewusstsein erdulden musste.
Doch das Kind hatte aus Leibeskräften gebrüllt, nachdem es endlich zur Welt gebracht worden war. Hinter ihrem Bettvorhang hörte Klara trotz der getuschelten Unterhaltung, dass es anscheinend gesund und kräftig war.
Warum lässt man es mich nicht wenigstens ein einziges Mal sehen? Wieder übermannte Klara die Verzweiflung. Deshalb bemerkte sie auch nicht, dass jemand auf leisen Sohlen ihre Kammer betrat, bis der Bettvorhang an ihrer rechten Seite behutsam zurückgezogen wurde. Erleichtert blickte Klara in das rotwangige Gesicht von Schwester Agnes, die zu ihrer Enttäuschung nicht bei der Geburt dabei gewesen war.
»Ich bringe Ihnen einen Schlaftrunk, liebes Fräulein«, lächelte sie. »Sie waren sehr tapfer und müssen jetzt ruhen.«
»Ist das Kleine wohlauf?«
Agnes’ Lächeln vertiefte sich. »Oh ja, es ist ein kräftiges Kind.«
»Ist es ein Junge oder ein Mädchen?«
Agnes’ Miene verdüsterte sich. »Das darf ich Ihnen nicht sagen, gnädiges Fräulein. Darauf stehen die strengsten Strafen.«
Alles in Klara lehnte sich dagegen auf. »Bitte, ich muss es wissen! Ich flehe Sie an und werde Sie reich belohnen!«
Agnes verzog unwillig den Mund. »Dafür nehme ich kein Geld, mein Fräulein. Es wäre gegen die Christenpflicht, Ihre Notlage derartig auszunutzen.«
Klara griff nach dem Strohhalm. »So sagen Sie es mir ohne Entgelt, liebe Agnes. Sehen Sie denn nicht, wie ich leide?«
Gespannt beobachtete sie den inneren Kampf auf dem Gesicht der Hebamme. Schließlich seufzte Agnes tief auf. »Es ist ein Mädchen, gnädiges Fräulein. Doch wenn herauskommt, dass ich Ihnen das gesagt habe, werde ich noch in derselben Stunde davongejagt.«
Klara war so erleichtert, dass sie den letzten Satz gar nicht mehr hörte. »Ein Mädchen! Ich wusste es.« Spontan griff sie nach Agnes’ Hand. »Sagen Sie mir, Schwester Agnes, ist es normal, dass eine Mutter das Geschlecht ihres Kindes ahnt?«
Die Hebamme nickte, nun wieder lächelnd. »Viele Mütter wissen es vor der Geburt«, bestätigte sie.
»Darf ich es sehen? Können Sie es mir heimlich bringen? Bitte, nur ein einziges Mal!«
Erschrocken wich die Schwester zurück und hob abwehrend beide Hände. »Das kann ich nun wirklich nicht für Sie tun, gnädiges Fräulein. Das Kind ist bereits in der Obhut des Waisenhauses.«
Klaras Freude erlosch. Sie fühlte sich unendlich kraftlos.
Agnes hielt ihr den mitgebrachten Becher hin. »Nun trinken Sie das! Sie müssen endlich zur Ruhe kommen.«
Folgsam schluckte Klara das bittere Gebräu. Plötzlich kam ihr ein neuer Gedanke. Sie griff nach Agnes’ Hand.
»Der Name! Wie wird sie heißen?«
Wieder schüttelte Agnes den Kopf. »Auch das darf ich Ihnen nicht sagen.«
Klara überging diesen Einwand, indem sie einfach weitersprach. »Als ich hier tagelang einsam in meiner Kammer saß, habe ich mir Namen für das Kind überlegt. Einen Jungen wollte ich Maximilian, ein Mädchen Irene nennen.«
»Irene? Das ist ein seltener Name!«
Klara nickte. »Doch mit einer wunderbaren Bedeutung: Die Friedliche. Das ist von der griechischen Friedensgöttin Eirene abgeleitet.«
»Ein heidnischer Name?«
Trotz ihrer Erschöpfung und Traurigkeit musste Klara lächeln. »Schon lange verwendet man ihn auch in der Christenheit. Es gibt sogar mehrere heiliggesprochene Frauen, die Irene hießen.«
Agnes zögerte. Kurz nach der Geburt hatte die Schwester Oberin ihr befohlen, Klaras Tante danach zu fragen, ob sie dem Kind einen Namen zu geben wünschte. Diese hatte es unwirsch abgelehnt. Doch wer außer ihr und Klaras Tante wusste das schon? Bei ihrer Unterhaltung war sonst niemand zugegen gewesen.
»Bitte, erfüllen Sie mir wenigstens diesen Wunsch.« Klaras Stimme klang verwaschen und schwach. Das Schlafmittel begann bereits zu wirken. »Es ist das Einzige, was ich meinem Kind, das ich niemals kennenlernen werde, mitgeben kann.« Sie schluchzte auf. Tränen rannen über ihr bleiches Gesicht.
Agnes fühlte tiefes Mitleid mit dieser Unglücklichen. Warum ist die Welt nur so hart? Selbst zu denen, die doch vom Glück begünstigt zu sein scheinen.
Sie gab sich einen Ruck. Es war riskant, doch es konnte gelingen. Klaras Tante hatte ausdrücklich betont, dass sie weder das Kind sehen noch in die Anstalt zurückkommen wolle, bis Klara reisefähig sei. Bis zu diesem Zeitpunkt wäre die Kleine schon längst getauft.
Liebevoll beugte sie sich über das Bett und streichelte Klara über die Wange. »Ich will sehen, was ich tun kann, liebes Fräulein. Doch nun schlafen Sie endlich ein.«
Teil 1 Scheinfrieden
Kapitel 1
Waisenhaus in Speyer, April 1866
Erst als sie in der Dunkelheit des Karzers allein war, ließ Irene ihren Gefühlen freien Lauf. Sie kauerte sich in die ihr bereits wohlvertraute Ecke, zog die Knie an, legte ihren Kopf darauf und begann zu weinen, erst leise und zögerlich, dann immer heftiger, bis sie vor lauter Schluchzen kaum noch Luft bekam.
Warum ging es nur so ungerecht in der Welt zu? Warum wurde immer nur sie zur Zielscheibe des Spotts der anderen Mädchen? Diese teilten als Waisen doch das gleiche elende Schicksal wie sie selbst! Und warum bestraften die strenge Leiterin der Mädchenabteilung oder gar die Mutter Oberin des Waisenhauses meistens nur sie, wenn sie sich zur Wehr setzte? Diejenigen, die ihren Zorn durch Hänseleien und Gemeinheiten provoziert hatten, kamen in der Regel ungeschoren davon.
So war es auch heute gewesen. Bärbel, bekannt für ihre Ungeschicklichkeit, hatte beim Abräumen des Geschirrs nach der dünnen Mittagssuppe einen der irdenen Suppenteller fallen gelassen. Da das Mädchen wusste, dass es dafür bestraft werden würde, wandte es sich plötzlich gegen Irene, die mit ihm Tischdienst hatte und ihm gerade den Rücken zukehrte.
»Pass doch auf, du dumme Trine!«, rief Bärbel durch den ganzen Speisesaal, kaum dass der Teller auf den Steinfliesen zerschellt war. Sofort wurden die Zöglinge, die sich unter den wachsamen Augen der Aufseherinnen vor dem Ausgang stauten, um ihre Arbeit in der Küche, der Nähstube, dem Waschkeller oder dem Garten wieder aufzunehmen, aufmerksam. Neugierig drehten sie sich um und folgten der Leiterin des Mädchentrakts, Schwester Gertrude, die nun zu den beiden Mädchen zurückging. Auf deren Wink hin blieben die anderen Aufseherinnen vorerst an der Tür stehen.
»Was ist denn los, Bärbel?«, fragte Gertrude.
»Die Irre da«, Bärbel zeigte mit dem Finger auf Irene, »die Irre hat einen Teller zerbrochen.«
Zorn durchflutete Irene angesichts der Ungerechtigkeit der Beschuldigung. Aber noch mehr kränkte sie der Spottname, den ihr die anderen Mädchen schon wenige Tage nach ihrer Ankunft gegeben hatten. Er war eine Verballhornung ihres Vornamens Irene, den die wenigsten kannten. Indem sie die zwei letzten Buchstaben einfach wegließen, verliehen sie dem Namen eine völlig andere Bedeutung. Noch kränkender war es allerdings, dass Schwester Gertrude ihnen die Beschimpfung ungestraft durchgehen ließ. Irene hatte die säuerliche Mittvierzigerin noch nie leiden können.
»Du lügst«, zischte Irene Bärbel an. »Du warst es selbst und willst nun mir die Schuld in die Schuhe schieben.«
»Warum sollte ich lügen?«, entgegnete Bärbel frech. Ihr Blick glitt zu Hanna, zu deren engstem Kreis sie dazugehörte. Hanna war die ungekrönte Herrscherin im Schlafsaal der Waisenmädchen. Siebzehn Jahre alt, korpulent und überaus stark, hatte sie sich diese Position gleichermaßen durch Bauernschläue wie durch Gewaltanwendung erworben. Wen sie in ihr Gefolge aufnahm, durfte sich mit Fug und Recht in der Gemeinschaft der Waisenkinder am untersten Rand der Gesellschaft als etwas Besonderes fühlen. Und Bärbel, die es verstanden hatte, sich durch kleine Gefälligkeiten und Schmeicheleien bei Hanna beliebt zu machen, gehörte zu ihren augenblicklichen Favoritinnen.
»Also, warum streitest du es ab, Miststück?«, herrschte Hanna Irene an. »Bist wohl wieder zu feige, um für deine Missetaten einzustehen?«
Wieder blieb Schwester Gertrude passiv. Sie trat sogar einen Schritt zurück und überließ es den Mädchen selbst, den Streit zwischen sich auszutragen.
Irene bemerkte es wohl. Ihr Zorn wurde noch größer und drängte nach Entladung. »Ich? Zu feige?«, zischte sie. »Feige sind deine Speichelleckerinnen, die dich hofieren und dir schöntun, obwohl du sie den ganzen Tag herumkommandierst.«
Hannas grobes Gesicht verfinsterte sich. »Hüte deine Zunge, Irre! Sonst wird es dir leidtun!«
Irene ballte die Hände zu Fäusten. »Was willst du denn tun, fette Henne, äh, Hanna?«, zahlte sie es der Älteren mit gleicher Münze heim. »Stolziere doch gleich zur Mutter Oberin und gackere deine Gemeinheiten heraus! Das passt zu dir. Du und deinesgleichen scharren ohnehin den ganzen Tag im Mist.«
Mit einem Wutschrei hatte sich Hanna daraufhin auf sie gestürzt. Bevor Schwester Gertrude und weitere hinzueilende Aufseherinnen eingreifen konnten, rissen sich die beiden wie Furien an den Haaren, stießen gegen Tische und Stühle, kratzten und bissen einander, bis sie sich schließlich sogar auf dem Boden wälzten. Bei dem Gerangel gingen drei weitere Teller und sogar eine irdene Suppenschüssel zu Bruch.
Der Zorn verlieh Irene Riesenkräfte. Obwohl Schwester Gertrude und einige Mädchen aus Hannas Clique dieser zu Hilfe eilten, mit Fäusten auf Irenes Rücken eintrommelten und sie ihrerseits an den langen braunen Zöpfen rissen, gelang es ihr, Hanna am Boden festzunageln. Mit beiden Beinen auf Hannas Armen ohrfeigte sie die verhasste Gegnerin mit den teigigen Gesichtszügen wieder und wieder.
Selbst als sie starke Arme schließlich nach hinten rissen, strampelte und wehrte sie sich und versuchte weiterhin, Hanna zu treten, bis sie von der schieren Übermacht der Gegnerinnen überwältigt wurde.
Als ihre blinde Wut langsam abklang, erschrak Irene zutiefst. Nicht nur Schwester Gertrude, nein, auch die gestrenge Mutter Oberin hatte höchstpersönlich eingegriffen. Offensichtlich hatte einer von Irenes ungezielten Schlägen sie getroffen, denn sie rieb sich die gerötete Wange.
Demonstrativ langsam nahm Mutter Ignatia auf einem der Stühle des Speisesaals Platz. »Was geht hier vor?« Ihre braunen Augen mit gelblichen Einsprengseln funkelten unheilverkündend.
Mit auf den Rücken gedrehten Armen wurde Irene vor sie hingestoßen, wo sie wie in einem Schraubstock von Schwester Gertrude und der Köchin festgehalten wurde, die der Lärm ebenfalls auf den Plan gerufen hatte.
»Bärbel hat einen Teller zerbrochen und will nun mir die Schuld dafür geben.« Obwohl Irene die Aussichtslosigkeit ihrer Lage bereits klar war, weigerte sie sich, klein beizugeben.
»Das ist nicht wahr!«, schrie Bärbel mit überzeugend gespielter Empörung. »Sie lügt, die Irre lügt!«, fielen nun auch andere Mädchen aus Hannas Gefolge ein.
Mittlerweile hatte sich auch Hanna wieder erhoben. Sie blutete aus der Nase, ein Auge begann bereits zuzuschwellen. »Und dann hat sie mich angegriffen, grundlos, denn ich habe ihr nichts getan«, schrie sie mit schriller Stimme. »Schauen Sie, ehrwürdige Mutter, ich blute sogar.«
»Auch das ist nicht wahr, Hanna hat zuerst mit der Prügelei angefangen!« Verzweifelt blickte Irene in die Runde. Schwester Gertrude blieb stumm und sah an ihr vorbei. Andere Mädchen schauten zu Boden oder grinsten ihr frech ins Gesicht. Schließlich griff Irene ein junges schmächtiges Mädchen am Arm. »Sag du ihnen, wie es war, Katharina!«, flehte sie. Der Dreizehnjährigen hatte sie erst gestern geholfen, ihr Tagespensum in der Nähstube zu schaffen. Doch das Mädchen senkte ebenfalls den Kopf und wich Irenes Blick aus.
»Also, wie war es, Katharina?« Mit schneidender Stimme nahm Mutter Ignatia den Faden wieder auf. »Was hast du gesehen? Tritt näher!«
Katharina knickste erschrocken. »Nichts, gar nichts habe ich gesehen, ehrwürdige Mutter. Ich war schon an der Tür, als das Getöse losging.«
Natürlich hatte sich auch sonst niemand bereitgefunden, für Irene zu sprechen. Und so kam es, wie es immer kam. Zwar wurde auch Hanna für die Prügelei mit dem Verzicht auf das Abendbrot bestraft, doch darüber hinaus traf Mutter Ignatias ganzer Zorn eindeutig Irene.
»Zehn Hiebe auf jede Hand und eine Woche Karzer bei Wasser und Brot.«
In der Dunkelheit der Zelle versuchte Irene nun, ihre immer noch wie Feuer brennenden Handflächen an der Wand zu kühlen. Es half nur wenig.
Ach, hätte ich doch in Heidelberg bleiben können, dachte sie sehnsüchtig.
Der Konvent der Schwestern von der »Unbefleckten Empfängnis Mariens« unterhielt Waisenhäuser in der ganzen Region. Bis zu ihrem zwölften Lebensjahr hatte Irene in Heidelberg gelebt, in einem Waisenhaus, dem auch eine Gebäranstalt für ledige Mütter angeschlossen war. So war sie schon früh mit dem Gedanken vertraut gemacht worden, ein Bastard zu sein, den seine Mutter nach der Geburt einfach zurückgelassen hatte. Dieser Gedanke schmerzte sie fast noch mehr als die Schläge mit der Rute, die sie heute erhalten hatte, und die Prellungen aus dem Kampf mit Hanna, die sich jetzt ebenfalls bemerkbar machten.
Immerhin war die Leiterin des Mädchenschlafsaals in Heidelberg eine freundliche Frau gewesen, die sich nach Kräften bemüht hatte, ihren Zöglingen zumindest ein wenig mütterliche Fürsorge angedeihen zu lassen.
Als Schwester Agnes eines Tages hinzugekommen war, wie Irene wegen ihres ungewöhnlichen Namens gehänselt wurde – auch in Heidelberg pflegten die Bösartigen unter den Mädchen sie »Irre« zu schimpfen –, ergriff sie nicht nur Irenes Partei und belegte die Spötterinnen mit einer für ihre sanfte Wesensart ungewohnt harten Strafe. Nein, sie nahm Irene sogar mit in ihre Schreibstube, um sie dort zu trösten.
»Du darfst dich wegen deines Vornamens nicht grämen. Es ist ein schöner Name, viel schöner als Anna, Emma und Liesel, wie hier eine Menge Mädchen heißen.«
»Aber ich wünschte, ich würde Anna oder Liesel oder Emma heißen«, begehrte Irene auf. »Warum musste ausgerechnet ich ›Irene‹ getauft werden?«
Ein merkwürdiger Ausdruck huschte über Schwester Agnes’ gütiges Gesicht. Sie seufzte tief und kämpfte offensichtlich mit sich. »Es war der Wunsch deiner Mutter«, sagte sie schließlich leise.
Anfangs glaubte Irene, sie habe sich verhört. »Der Wunsch meiner Mutter? Ja, kannten Sie meine Mutter denn?«
Diesmal ließ Schwester Agnes’ Antwort noch länger auf sich warten. Schließlich nickte sie ergeben. »Ich hätte dir das gar nicht sagen dürfen, Mädchen. Doch nun, wo du es weißt, will ich dir Auskunft geben. Ja, ich kannte deine Mutter. Sie war eine liebe, gefühlvolle Frau.«
»Die mich hier einfach zurückgelassen hat!« Wieder begehrte Irene auf, noch heftiger als zuvor wegen ihres Namens.
Schwester Agnes schwieg.
»Warum, warum nur hat sie das getan? Warum, wenn sie liebevoll und gefühlvoll war!«
Diesmal sprach das reine Mitleid aus Agnes’ Augen. »Ich glaube, weil sie keine andere Wahl hatte.«
»Weil sie dachte, sie könnte mich nicht ernähren und ich würde am Ende hungers sterben? Wie erbärmlich von ihr! Sie hätte sich doch als Magd verdingen können oder als Wäscherin, so wie Luises Mutter, die ihre Tochter zumindest jeden zweiten Sonntag hier besucht!«
Schwester Agnes schüttelte den Kopf. »Das verstehst du noch nicht, mein Kind.«
Trotz Irenes Drängen war keine weitere Antwort mehr von ihr zu bekommen gewesen. Doch von diesem Tag an hielt Agnes ihre Hand über sie und schützte sie vor den Schikanen ihrer Leidensgenossinnen, wann immer sie konnte.
Mit Irenes zwölftem Geburtstag war dann die Zeit des Abschieds gekommen. Jugendliche Waisen mussten bis zu ihrer Volljährigkeit mit einundzwanzig Jahren in das Haus nach Speyer umsiedeln, sofern es nicht gelang, sie schon vorher als Magd oder Dienstmädchen in Stellung zu bringen.
»Ich wünsche dir von Herzen alles Glück dieser Erde! Möge die Gnade unserer Heiligen Jungfrau beständig mit dir sein!« Agnes schlug das Kreuzzeichen über Irene und nahm dann ihre beiden Hände. »Ich möchte dir etwas zum Abschied geben.«
Aus der Lade ihres Schreibtischs zog Agnes ein zerknittertes Stück Papier, das sie Irene reichte. »Dies hier stammt von deiner Mutter. Ich habe es als Erinnerung an sie aufbewahrt. Nun sollst du es bekommen.«
Verblüfft starrte Irene auf das Papier. Es war ein verblasstes Bild, mit zarten verwaschenen Farben gemalt. »Das stammt von meiner Mutter? War sie eine Künstlerin?«
Agnes verneinte. »Es ist ein Aquarell. Man malt es mit Wasserfarben.«
Irene betrachtete das seltsame Bild. Es stellte eine Landschaft im Gewitter dar. Düstere Wolken verdunkelten den Himmel, grelle Blitze zuckten aus ihnen heraus, die Äste der Laubbäume bogen sich im Sturm. »Es ist kein fröhliches Gemälde.«
»Ich sagte es dir schon einmal: Deine Mutter war sehr unglücklich, als sie bei uns war. Möchtest du das Bild trotzdem haben?«
Irene zögerte. »Ich habe einmal gehört, dass reiche Damen zu ihrer Zerstreuung malen. Bitte, was wissen Sie sonst noch über meine Mutter?«, drängte sie.
Agnes’ Gesicht nahm einen verschlossenen Ausdruck an. »Nichts weiter, mein Kind.«
Irene spürte, dass das nicht die Wahrheit war. Doch mehr konnte sie nicht in Erfahrung bringen. Schließlich nahm sie das Bild und verstaute es in ihrem schmalen Bündel zusammen mit den wenigen Habseligkeiten, die sie besaß.
Seit ihrer Ankunft in Speyer hatte sie die Zeichnung nun schon mehrmals in der Hand gehabt, um sie in winzige Fetzen zu zerreißen, insbesondere, wenn sie wieder einmal wegen ihres schrecklichen Namens gehänselt worden war. Doch immer hatte sie etwas in letzter Minute davon abgehalten.
Wird mich das Bild irgendwann einmal zu meiner Mutter führen? Werde ich jemals erfahren, wer ich bin? Habe ich da draußen überhaupt eine Familie, vielleicht Brüder und Schwestern, die nichts von mir wissen? Auch jetzt grübelte Irene wieder über diese Fragen.
Plötzlich wurde sie aus ihren Gedanken gerissen. Auf dem Gang näherten sich Schritte. Was hatte das zu bedeuten? Sie befand sich doch noch kaum mehr als zwei Stunden in ihrer Haft. Zudem war sie für den Rest des Tages zum Fasten verurteilt. Auch den Blecheimer für ihre Notdurft würde sie nicht vor dem Morgen entleeren dürfen. Sie lauschte angespannt.
Tatsächlich, die Schritte verharrten vor ihrer Tür. Wenig später drehte sich der Schlüssel knarzend im Schloss. Irene blinzelte in den Lichtschein einer Petroleumlampe. Vor ihr stand Schwester Gertrude, die Leiterin des Mädchensaals, mit verkniffener Miene.
»Steh auf und folge mir, Irene. Du musst dich waschen und dein Sonntagskleid anziehen. Jemand besteht darauf, dich zu sehen.«
Waisenhaus in SpeyerApril 1866, eine halbe Stunde zuvor
»Aber gnädiger Herr, ich bitte Sie! Dieses Mädchen ist keinesfalls dazu geeignet, in einem solch vornehmen Hause wie dem Ihren in Dienst zu gehen! Ich kann Ihnen ein Dutzend unserer Zöglinge empfehlen, die ich für weitaus angemessener erachte.«
»Ehrwürdige Mutter, erlauben Sie, dass ich mir darüber selbst ein Urteil bilde. Irene wurde mir von Schwester Agnes aus Heidelberg ausdrücklich empfohlen!«
Wilhelm Gerban, ein wohlhabender Weinhändler aus dem elsässischen Weißenburg, bemühte sich nur mit Worten, aber nicht dem Ton nach zu verbergen, dass er Widerspruch gegen seine Wünsche nicht gewohnt war. Doch Mutter Ignatia ließ sich so schnell nicht einschüchtern.
»Ich weiß nicht, warum Schwester Agnes sich so für Irene ins Zeug gelegt hat. Vielleicht war sie in Heidelberg ja noch folgsamer und sanfter als hier bei uns in Speyer. Das Mädchen gibt beständig Widerworte, ist altklug und kann sich nicht in die Gemeinschaft der anderen Zöglinge einfügen. Gerade büßt Irene eine Strafe ab, da sie heute schon wieder eine Rauferei angezettelt hat.«
»Wie gut hat sie die Hauswirtschaft in Ihrer Anstalt erlernt?« Gerban ging gar nicht auf Mutter Ignatias Worte ein. »Ihr Haus ist doch angeblich dafür bekannt, Mädchen zu guten Dienstboten auszubilden.«
Als die Oberin mit zusammengepressten Lippen schwieg, fügte er hinzu: »Oder gab man mir diesbezüglich eine falsche Auskunft?«
Mutter Ignatia sog hörbar die Luft ein. »Keineswegs, mein Herr. Mädchen aus unserer Anstalt sind landauf, landab als Dienstmädchen oder Mägde sehr begehrt.«
»So kann also auch Irene kochen und putzen, waschen und nähen?«
Die Oberin nickte widerwillig. »Das kann sie.«
»Beherrscht sie auch das Lesen, Schreiben und Rechnen? Schwester Agnes erzählte mir, sie habe in Heidelberg zu den besten Schülerinnen gehört.«
Auf den Wangen der Oberin erschienen nun hässliche rote Flecken. »Irene hat auch hier sehr gute Zeugnisse.«
»Also kann man sie auch auf den Markt zu Besorgungen schicken.« Gerban lächelte zufrieden.
»Das kann man wohl, sofern man ihr vertraut.« Mutter Ignatia konnte ihren Zorn immer schlechter verbergen.
Wilhelm Gerban runzelte seine eisgrauen buschigen Augenbrauen und betrachtete Ignatia mit forschendem Blick. Er stand schon hoch in den Fünfzigern und war mit seiner stattlichen Figur und seinem teuren Gehrock aus feinem Tuch eine imposante Erscheinung.
»So hat das Mädchen schon einmal gestohlen oder eine andere unehrliche Tat begangen?« Seine Stimme hatte nun einen schneidenden Unterton. »Das müsste dann ja in ihrer Akte verzeichnet sein.« Er streckte gebieterisch die Hand aus. »Darf ich die Akte einmal sehen?«
Die roten Flecken auf Ignatias Wangen verstärkten sich. Noch ehe sie antworten konnte, mischte sich Schwester Gertrude ein. »Gestohlen hat Irene noch nichts, aber sie lügt alleweil.«
Mit einer für sein Alter und seine Statur erstaunlichen Behändigkeit fuhr Gerban zu ihr herum. »Ich erinnere mich nicht, Sie um Ihre Meinung gebeten zu haben, Schwester …?« Die Frauen konnten nicht erkennen, ob er Gertrudes Namen tatsächlich bereits vergessen hatte oder nur so tat.
Gertrudes Gesicht färbte sich blutrot. Gerban fuhr unerbittlich fort: »So haben Sie also Beweise dafür, dass Irene lügt? Was für Beweise sind das?«
»Die … die Aussagen der anderen Mädchen«, stotterte Gertrude. »Und woher wissen Sie, dass diese Mädchen die Wahrheit sagen und Irene nicht einfach nur anschwärzen? Viele Mädchen in diesem Alter neigen dazu!«
»Es ist … es ist ihr … ihr Charakter«, stammelte Gertrude weiter. »Sie trägt die Nase hoch und bildet sich etwas auf ihre Nähkunst und ihre guten Noten ein. Das erzürnt die anderen Insassinnen.«
»Sodass sie also umso mehr Grund haben, das arme Ding anzuschwärzen«, konstatierte Gerban trocken. Er wandte den Blick ab und ignorierte Gertrudes empörtes Schnaufen.
Mittlerweile hatte sich Mutter Ignatia wieder gefasst. Sie wechselte die Taktik. »Da ich Ihnen, verehrter Herr Gerban, denn nun durchaus keines der Mädchen, das ich für geeigneter halte, vorstellen darf, möchte ich Sie zumindest fragen, was Sie dazu veranlasst hat, nur und ausschließlich nach Irene zu verlangen. Woher kennen Sie sie überhaupt?«
Wäre Mutter Ignatia geschulter in der Beobachtung von Männern gewesen, wäre ihr der Moment der Unsicherheit, der einen Wimpernschlag lang über Gerbans markante Gesichtszüge huschte, nicht entgangen. So aber bemerkte sie nichts.
Gerban räusperte sich. »Nun, ich sehe wohl ein, dass Sie ein Recht darauf haben, dass ich Ihre Frage beantworte«, begann er umständlich. »Es ist eine traurige Geschichte, die ich nur sehr oberflächlich kenne.«
Er räusperte sich wieder. »Meine liebe Frau, die seit vielen Jahren aufgrund ihrer zarten Konstitution kränkelt, hatte eine Freundin, die an der Schwindsucht litt. Auf dem Sterbebett nahm diese Freundin meiner Frau das Versprechen ab, nach einem Waisenmädchen zu forschen, das in der Heidelberger Anstalt leben sollte. Das Mädchen habe einen ungewöhnlichen Namen, es hieße Irene.«
»Welche Verbindung hatte die Freundin Ihrer verehrten Gattin zu diesem Kind?«
»Das konnte meine Frau leider nicht mehr in Erfahrung bringen. Noch in derselben Nacht, in der sie ihrer Freundin das Versprechen gab, nach dem Kind zu forschen, erlitt diese einen Blutsturz und fiel danach in tiefe Bewusstlosigkeit, aus der sie nicht mehr erwachte. So blieb das Geheimnis ungelüftet.«
»Wie schade«, entfuhr es Schwester Gertrude. Ignatia warf ihr einen missbilligenden Blick zu.
»Bei allem Respekt, verehrter Herr Gerban, ist es denn nicht überaus leichtsinnig, sich das Mädchen nur aufgrund dieser unzureichenden Empfehlung ins Haus zu holen? Schließlich haben Dienstmädchen eine besondere Vertrauensstellung inne.«
Zur Überraschung der Frauen seufzte Gerban. »Seien Sie versichert, Mutter Oberin, dass ich diesen Einwand ebenfalls viele Male mit meiner Gattin erörtert habe. Doch sie ließ nicht locker und kam immer wieder auf ihre Bitte zurück. Der Tod ihrer Freundin ist bereits mehr als ein Jahr her. Daran können Sie erkennen, dass ich nicht leicht zu überzeugen war.«
»Und was hat Ihre Meinung dann schließlich geändert?«
Gerban seufzte noch einmal. »Wie ich bereits erwähnte, ist die Gesundheit meiner geliebten Gattin sehr zart. Sie grämte sich ununterbrochen über das nicht eingehaltene Versprechen, und ich fürchtete, das könne ihr auf die Dauer schaden. Deshalb erklärte ich mich am Ende unter der Bedingung, dass das Mädchen ehrlich, fleißig und klug ist, dazu bereit, nach ihm zu forschen und eine Aufnahme in unseren Haushalt in Erwägung zu ziehen. Und siehe da, Schwester Agnes lobte Irene genau in diesem Sinne über alle Maßen.«
Ignatia schürzte die Lippen, aber Gerban ließ sie nicht zu Wort kommen. »Daher habe ich meine Reise noch einmal verlängert und bin heute nach Speyer gekommen, um mir selbst ein Bild von dem jungen Ding zu machen.« Diesmal wehrte er einen Einwand Ignatias mit einer Geste ab. »Und ich versichere Ihnen, Mutter Oberin, ist mir das Mädchen nicht angenehm, lasse ich es nur zu gerne in Ihrer Obhut. Eine andere Dienstmagd aus Ihrer Anstalt benötige ich in diesem Fall allerdings nicht.«
»Doch wenn mir Irene gefällt«, schloss Gerban seine Rede, »zahle ich Ihnen den doppelten Abstand, den Sie sonst erhalten.«
Dieses Argument gab den Ausschlag. Mutter Ignatia wandte sich an Schwester Gertrude. »So bringen Sie das Mädchen in Gottes Namen herbei. Doch sorgen Sie dafür, dass es anständig ausstaffiert ist.«
Als Irene das Kontor der Mutter Oberin betrat, in dem auch Besucher empfangen wurden, musterte Gerban sie intensiv mit seinen stahlgrauen Augen, die jetzt im fortgeschrittenen Alter besser zu seinen bereits ergrauten Haaren passten als zum blassen Blond seiner Jugend. Was er sah, gefiel ihm.
Das Mädchen war mittelgroß und schlank und in seinem einfachen grauen Leinenkleid mit der blütenweißen Schürze reinlich gekleidet. Die schweren braunen Zöpfe waren zu einem Kranz um den Kopf herum gewunden, auf dem ein schlichtes weißes Leinenhäubchen saß.
Am markantesten war zweifellos Irenes Gesicht. Die dunkelblauen Augen bildeten einen reizvollen Kontrast zu den braunen Haaren. Eine seltene Kombination, schoss es Gerban durch den Kopf. Mit den breiten Augenbrauen, der kleinen spitzen Nase und dem schmallippigen Mund war Irenes Gesicht nicht eigentlich hübsch zu nennen, dennoch wirkte es anziehend.
Er winkte Irene heran. Obwohl sie schon beim Eintreten geknickst hatte, wiederholte sie die Geste ohne Aufforderung noch einmal.
»Hat man dir gesagt, warum man dich kommen ließ, Mädchen?«
Irene senkte den Kopf. »Nein, verehrter Herr.«
»Nun, dann möchte ich dich noch eine Weile darüber im Unklaren lassen und dir erst ein paar Fragen stellen.« Obwohl er es bereits wusste, fragte er sie: »Wie lautet dein Name?«
»Irene, mein Herr. Ich heiße Irene.« Ihre Stimme war so leise, dass er sie kaum verstand.
»Sprich lauter, Irene. Wie ist dein Nachname?«
Nun schwang ein leichtes Zittern in ihrem Tonfall mit. »Man nennt mich Weber, mein Herr. Doch das ist nicht mein richtiger Name. Man gab ihn mir in der Anstalt in Heidelberg, da er gerade im Alphabet an der Reihe war. Wie mein wirklicher Name lautet, weiß ich nicht. Ich kenne weder meinen Vater noch meine Mutter.«
»Irene Weber«, murmelte Gerban. Auch eine ungewöhnliche Kombination. Laut fuhr er fort: »Irene ist ein seltener Name. Magst du ihn leiden?«
Nun zeigte sich so etwas wie Unwillen im Gesicht des Mädchens. Es hob den Kopf und sah ihm in die Augen. »Meistens mag ich ihn nicht, mein Herr. Ich werde deswegen oft verspottet. Aber manchmal weiß ich ihn auch zu schätzen. In Heidelberg habe ich erfahren, dass meine unbekannte Mutter ihn auswählte.«
Mutter Ignatia und Schwester Gertrude sogen scharf den Atem ein. »Wer behauptet das?«, mischte sich Ignatia ein, und an Gerban gewandt, erläuterte sie: »Das widerspricht den Gepflogenheiten unseres Hauses.«
Der Weinhändler winkte unwillig ab. »Mir scheint, das spielt hier keine Rolle, ehrwürdige Mutter. Erlauben Sie, dass ich mit meinen Fragen fortfahre.« Er wartete ihre Antwort nicht ab.
»Man hat mir berichtet, du seist oft frech, gäbest Widerworte und wärst sogar in Raufereien verwickelt.«
Irene errötete. Fasziniert beobachtete Gerban, wie Trotz und Traurigkeit in ihrem Gesicht miteinander kämpften. Sie holte tief Luft. »Ich wehre mich, mein Herr, wenn man mir etwas vorwirft, das ich nicht getan habe. Und ich stelle richtig, wenn etwas Falsches gesagt wird.«
»Nenn mir für beide Situationen ein Beispiel.« Irene begann mit der Begebenheit des zerbrochenen Tellers, die ihr den Arrest eingebracht hatte. Gerban lauschte gebannt.
Das Mädchen versteht sich weit über seinen Stand hinaus auszudrücken. Es scheint mir ungewöhnlich begabt.
»Und ein Beispiel für etwas, das du richtiggestellt hast?«
Irene zögerte und warf Schwester Gertrude einen verstohlenen Blick zu. Die erwiderte ihn finster. Gerban machte eine ermutigende Handbewegung. Seine Neugier wuchs.
»Im Unterricht schrieb Schwester Gertrude ein Wort falsch an die Tafel.«
Irene stockte. Wieder färbte sich das Gesicht der Leiterin der Mädchenabteilung blutrot.
»Was war das für ein Wort?«
»Sie schrieb die sieben Untugenden junger Mädchen auf. Das Wort: ›Trägheit‹ buchstabierte sie mit einem ›k‹ anstatt mit einem ›g‹.«
Gerban grinste belustigt. »Und das hast du vor den Ohren aller Mitschülerinnen korrigiert?«
»Natürlich habe ich das«, entgegnete Irene einfach. »Schließlich hätten sich die anderen das Wort doch sonst falsch gemerkt.«
Gerban warf einen Blick auf die beiden Ordensschwestern. Gertrude starrte tief gedemütigt zu Boden, Mutter Ignatia fixierte Irene mit wütend zusammengezogenen Augenbrauen.
Der Weinhändler deutete eine Verbeugung an. »Ich sehe, die ehrwürdigen Schwestern haben das Mädchen richtig beschrieben. Es sagt unbedingt die Wahrheit und könnte dabei auch vorlaut und altklug wirken.«
In Irenes dunkelblauen Augen begann es, verdächtig zu schimmern. Sie schwieg und senkte den Blick wieder zu Boden. Doch Gerban ließ nicht locker.
»Sag an, Irene, kannst du auch rechnen?«
Das Mädchen nickte.
»Wie viel ist zwölf mal zwölf?«
»Einhundertvierundvierzig.« Die Antwort kam wie aus der Pistole geschossen.
»Und dreizehn mal sechsundzwanzig?«
»Dreihundertachtunddreißig.« Diesmal dauerte die Antwort einen Augenblick länger. Doch sie war richtig wie auch die folgenden Aufgaben, die ihr Gerban stellte. Der Weinhändler nickte zufrieden.
»Und hast du in diesem Hause auch noch etwas anderes als Schreiben und Rechnen gelernt?«
Etwas wie Hoffnung blitzte in Irenes Augen auf. »Oh ja, mein Herr. Ich kann einen ganzen Haushalt besorgen. Man lehrte mich Kochen, Putzen, Waschen, Flicken, Nähen und alle anderen Arbeiten.«
Gerban war amüsiert. »So ahnst du jetzt, warum ich dich befrage?«
Irene nickte. »Sie suchen wahrscheinlich eine Dienstmagd für Ihren Haushalt.«
Gerban lächelte. »Ein zusätzliches Dienst- oder Küchenmädchen, um genau zu sein. Du wärst eine von vielen Dienstboten in unserem großen Haus in Altenstadt bei Weißenburg. Doch warum sollte ich dich nehmen? Du hast selbst zugegeben, dass du immer wieder in Händel mit anderen Waisenmädchen verstrickt warst. Könntest du dich denn in meinen Haushalt einfügen?«
Fast tat sie Gerban leid, als er beobachtete, wie der Glanz aus Irenes Augen wich und einer stumpfen Resignation Platz machte.
»Ich würde es nach besten Kräften versuchen, mein Herr«, antwortete sie mit erstickter Stimme.
»Und wenn man dir dort ebenfalls einmal Unrecht tut?«
Von dieser Antwort hängt ab, ob ich sie mitnehme, erkannte der Weinhändler plötzlich zu seiner eigenen Überraschung.
Irene schwieg und kämpfte sichtbar mit sich. »Gib Antwort und lass den Herrn nicht warten«, fuhr Ignatia sie schließlich grob an.
Irene seufzte. »Ich würde mich auch in Ihrem Hause dagegen zur Wehr setzen, mein Herr.« Sie war kaum zu verstehen. Dann knickste sie wieder. »Doch nun lassen Sie mich gehen, da Sie mich ja doch nicht mitnehmen werden.«
Wider Willen war Gerban beinahe gerührt. »Wer sagt denn, dass ich dich nicht mitnehmen möchte?«
Jetzt mischte sich die Oberin ein. »Herr Gerban, lassen Sie uns dieser Sache nun ein Ende bereiten. Sie sehen, dass wir mit all dem Recht haben, was wir Ihnen über den Charakter des Mädchens sagten. Sie ist nicht geeignet, in Ihrem Hause … «
Gerban fiel der Oberin mitten ins Wort. Ohne die Nonne auch nur anzusehen, sprach er wieder zu Irene.
»Du würdest in Altenstadt leben. Das ist im französischen Elsass.«
Irene nickte. »Das weiß ich, mein Herr. Doch es macht mir nichts aus.«
»Im ersten Jahr erhältst du keinen Lohn. Du arbeitest nur für deine Unterkunft, dein Essen und deine Kleidung.«
Irene nickte wieder. »Auch das macht mir nichts aus. Wenn ich nur recht rasch von hier wegkomme.«
Wieder schnauften die Schwestern empört. Gerban drehte sich zu ihnen um und lächelte spöttisch. »Ich sehe, dieses reizende Kind ist ein Rohdiamant. Augenscheinlich haben Sie es nicht verstanden, ihn zu schleifen. Daher möchte ich nun mein Glück versuchen.«
Mutter Ignatia nickte steif. »Wie Sie wünschen, mein Herr. Also geh nun, Irene und packe deine Sachen. Schwester Gertrude wird dich begleiten.«
Nachdem sich die Tür hinter den beiden geschlossen hatte, erhob sich Ignatia und entnahm einem verkratzten Kontorschrank eine Akte und ein großes, in Leder gebundenes Buch. Dann setzte sie sich wieder hinter ihren Schreibtisch und zückte eine Feder.
»So lassen Sie uns nun zu den Formalitäten kommen, Herr Gerban. Sie wissen, dass Sie sich selbst um das Gesindedienstbuch Irenes kümmern müssen, da sie noch nicht volljährig ist. Ich übergebe Ihnen hiermit eine Abschrift ihrer Geburtsurkunde sowie ihre Schulzeugnisse.«
Ein rascher Blick zeigte dem Weinhändler, dass Irene tatsächlich in allen Fächern die besten Noten vorzuweisen hatte. Die einzige Ausnahme bildeten die Beurteilungen für ihr »Betragen«. Diese schwankten zwischen »ausreichend« und »nicht genügend«.
»Und hier bitte ich um Ihre Unterschrift und Ihr Siegel, Herr Gerban.« Der Weinhändler unterzeichnete und drückte seinen Ring in das Wachs, das Mutter Ignatia auf das Papier tröpfelte.
»Nun wäre nur noch der Abstand zu entrichten. Üblicherweise beträgt er zehn Gulden …«
»Ja, ja«, winkte Gerban ungeduldig ab. »Ich gebe Ihnen dreißig Gulden.«
Einen Moment war Ignatia sprachlos. Dann streckte sie fordernd die Hand aus.
»So sei es denn, Herr Gerban. Was auch immer Ihre Beweggründe sein mögen, Irene in Ihr Haus zu holen, Sie werden sehen, dass Ihnen das Mädchen nichts als Scherereien und Ungemach bereiten wird. Glauben Sie mir, ich kenne unsere Zöglinge durch und durch.«
Papperlapapp. Fast wäre Gerban das respektlose Wort herausgerutscht. Stattdessen verbeugte er sich mit ironisch übertriebener Höflichkeit.
»Ich bedanke mich für Ihren wohlgemeinten Rat, ehrwürdige Oberin. Doch wie ich bereits sagte, wir werden sie uns zurechtschleifen.«
Das leichte Gefühl von Unbehagen in seiner Magengrube drängte er energisch beiseite.
Kapitel 2
Altenstadt, April 1866, am nächsten Tag
Als der Zweispänner, der sie vom Weißenburger Bahnhof abgeholt hatte, sich dem imposanten Wohnsitz der Familie Gerban näherte, lugte Irene gespannt aus dem Fenster. Vor Staunen entfuhr ihr ein überraschter Laut, so sehr war sie von dem Anblick, der sich ihr bot, überwältigt.
Durch eine mit Kies bestreute Allee, die zu beiden Seiten von mächtigen Eichen, Platanen und Buchen im zarten Laub des Frühjahrs gebildet wurde, näherte sich die Kutsche einem weiß gestrichenen Herrenhaus mit dunkelblauen Fensterläden. Der Eingangsbereich wurde von zwei mächtigen Säulen gerahmt, die am Fuße der breiten überdachten Treppe standen und mit ihren Kapitellen einen halbrunden Balkon mit fein ziseliertem Geländer trugen. Zu beiden Seiten der makellos geharkten Auffahrt blühten Tulpen, Narzissen und Kaiserkronen in den gepflegten Rabatten.
Die Kutsche kam im Kies knirschend zum Stehen. Ein Mann im schwarzen Anzug mit blütenweißem Hemd öffnete den Schlag und verneigte sich, als Wilhelm Gerban ausstieg. »Willkommen zu Hause! Hatte der gnädige Herr eine angenehme Reise?«
Gerban nickte leutselig. »So angenehm, wie man mit der Bahn eben reisen kann, Niemann. Aber sicherlich weit angenehmer als mit der schlecht gefederten Postkutsche auf den holprigen rheinbayerischen Straßen.«
Niemann verneigte sich noch einmal. »Es ist eine Schande, wie unsere schöne Pfalz unter der bayerischen Herrschaft verkommt.«
»Na, na, Niemann.« Gerban schnalzte missbilligend mit der Zunge. »So schlimm ist es nun auch wieder nicht, dass Sie sich dem Verdacht mangelnder Königstreue aussetzen sollten.«
Irene beobachtete, wie das Gesicht des ersten Dieners, für den sie Niemann zu Recht hielt, rot anlief. »Ich möchte dem gnädigen Herrn versichern, dass ich der Überzeugung bin, unser hochverehrter König Ludwig II. weiß nichts von den Schlampereien seiner Verwaltungsbeamten.«
»Nun ja, wie dem auch immer sei, Niemann«, beendete Gerban das heikle Thema. »Ich habe ein neues Dienstmädchen als Ersatz für Herta mitgebracht. Sie heißt Irene.« Niemann zog erstaunt die Augenbrauen hoch. Gerban übersah es geflissentlich. »Helfen Sie ihr aus dem Wagen! Frau Burger soll sie in ihre zukünftigen Pflichten und die Gepflogenheiten des Hauses einweisen, ihr ihre Kammer zeigen und sie angemessen einkleiden. Morgen nach dem Frühstück soll sie meiner Gattin vorgestellt werden.« Damit strebte er auf den Eingang des Hauses zu, der zu beiden Seiten von weiteren Dienstboten gesäumt war, ohne sich noch einmal umzudrehen.
Da Niemann keine Anstalten machte, der noch immer in der Kutschentür stehenden Irene die Hand zu reichen, raffte sie schließlich ihre Röcke und stieg ohne seine Hilfe aus. Der Diener betrachtete sie mit einem unergründlichen Gesichtsausdruck, der auf Irene weder freundlich noch unfreundlich wirkte. Immerhin erwiderte er ihren Gruß mit einem kurzen Kopfnicken, als sie vor ihm knickste.
Während sie ihm über die Auffahrt zur Gruppe der übrigen Dienstboten folgte, sah sie sich erneut dem Wechselspiel aus Freude und Enttäuschung ausgesetzt, welches sie schon kurz nach dem Verlassen des Waisenhauses ergriffen hatte.
Da Schwester Gertrude aufgrund der erlittenen Demütigungen immer noch außer sich gewesen war, erfuhr Irene mehr über die Hintergründe ihrer Einstellung, als es der Leiterin der Mädchenabteilung im Nachhinein lieb sein konnte. Während sie ihr kleines Bündel packte, entnahm Irene Gertrudes hämischen Bemerkungen, dass der reiche Weinhändler aus Weißenburg sie und nur sie als Dienstmädchen für seinen Haushalt gewünscht hatte. Vorgeblich aufgrund einer Marotte seiner Frau Gemahlin.
Irenes Hoffnung, von Herrn Gerban mehr über die seltsamen Hintergründe ihrer Dienstverpflichtung zu erfahren, schwand jedoch rasch dahin. Schon auf der Fahrt in den gehobenen Gasthof, in dem sie übernachteten, bevor sie am nächsten Morgen die Reise nach Weißenburg antreten würden, sprach er nur noch das Nötigste mit ihr. Den herzlichen, tief empfundenen Dank über ihre Einstellung quittierte er nur mit einem knappen Nicken, begleitet von einem undefinierbaren kehligen Laut. Auch auf ihre höflichen Versuche, mehr über ihr neues Heim und seine Bewohner zu erfahren, antwortete er nur einsilbig.
»Du wirst einen ganzen Stab von Dienstboten vorfinden, die dir alles erläutern werden, was du wissen musst.«
»Darf ich fragen, gnädiger Herr, was genau meine Aufgabe sein wird?«
Gerban zuckte mit den Achseln. »Das entscheidet in letzter Instanz meine Gattin oder Frau Burger, die Hausdame. Ich vermute, du wirst als Haus- oder Küchenmädchen arbeiten.« Damit griff der Weinhändler nach einer Zeitung, in die er sich demonstrativ vertiefte. Irene wagte ihn nicht mehr zu fragen, warum seine Frau Gemahlin auf ihrer Anwerbung bestanden hatte.
Eine weitere Gelegenheit zu einem Gespräch hatte sich danach nicht mehr ergeben. Die Nacht im Gasthof verbrachte Irene in einer schlicht möblierten Kammer. Die Mahlzeiten nahm sie in einem gesonderten Raum ein, der offensichtlich weniger begüterten Gästen vorbehalten war. Dennoch genoss sie den ungewohnten Luxus in vollen Zügen. Noch nie hatte sie eine Schlafkammer ganz für sich allein gehabt, und auch die einfache, aber reichliche Hausmannskost schmeckte ihr nach der spärlichen Verpflegung im Waisenhaus vorzüglich. Außerdem war sie noch nie mit der Eisenbahn gefahren und freute sich auf die lange gemeinsame Zugfahrt am nächsten Tag. Sie hoffte, ihrem wortkargen Dienstherrn dabei doch noch die eine oder andere Einzelheit über ihr Schicksal entlocken zu können.
Doch erneut wurde sie enttäuscht. Während der Weinhändler im Salon erster Klasse reiste, wurde Irene auf der harten Holzbank eines Wagens dritter Klasse durchgeschüttelt. Erst kurz vor Weißenburg ließ Gerban sie dort von einem Schaffner abholen.
Dass sie wahrhaftig in ein sehr reiches Haus kommen würde, zeigte Irene schon der in eine tadellose Livree gekleidete Kutscher, der Gerban und sie am Bahnhof erwartete. Und nun schritt sie ehrfürchtig auf das palastartige Anwesen zu, das ihr neues Heim werden sollte.
Alles wäre besser gewesen als das Waisenhaus, versuchte sie tapfer, sich selbst zu beschwichtigen. Ich wäre lieber Magd auf jedem noch so ärmlichen Bauernhof geworden, als dort noch einen Tag länger zu bleiben. Und nun solch ein vornehmes Haus! Auch wenn ich nicht weiß, welchen Umständen ich dieses Glück verdanke, will ich mich nach Kräften bemühen, um mich dankbar zu zeigen. Mit Fleiß und Ausdauer wird es mir schon gelingen. Und wer weiß, wie weit ich es damit noch bringen kann. Vielleicht zum ersten Hausmädchen oder gar eines Tages zur Hausdame!
Sie holte tief Luft. Und womöglich erfahre ich schon morgen früh mehr, wenn ich der Hausherrin vorgestellt werde.
Mit neuer Hoffnung folgte sie Niemann, der schließlich vor einer ältlichen Frau mit mürrischer Miene stehen blieb. Sie war in ein hochgeschlossenes schwarzes Kleid gekleidet und erinnerte Irene auf Anhieb an Mutter Ignatia. Erneut verließ sie der Mut.
»Das ist Frau Burger, die Hausdame. Sie ist für all deine Belange zuständig und wird dich einweisen.« Irene knickste tief.
Niemann wandte sich an die ältliche Frau. »Hier bringe ich Ihnen Irene, das neue Dienstmädchen, das Herr Gerban mitgebracht hat.«
Frau Burger fixierte Irene scharf. Dann seufzte sie vernehmlich. »Nur der gnädige Herr allein weiß, warum er selbst ein neues Dienstmädchen ausgesucht hat. Hoffentlich stellt sie sich nicht allzu ungeschickt an.«
»Ich werde mir größte Mühe geben, Frau Burger«, antwortete Irene, während Niemann gleichzeitig verlauten ließ: »Sie wird die Gelegenheit schon zu schätzen wissen.«
Frau Burger musterte die erschrockene Irene kühl. »Nun, sie scheint vorlaut zu sein. Ich hoffe, sie kann nicht nur tüchtig arbeiten, sondern lernt auch noch, sich zu benehmen.«
Damit winkte sie Irene, ihr zum Dienstboteneingang an der Rückseite des Hauses zu folgen.
Anwesen der Gerbans bei AltenstadtApril 1866, wenig später im kleinen Salon
»Nun, meine Liebe, wie geht es dir heute?« Wilhelm Gerban nippte an seinem Tee, den Niemann gerade serviert hatte.
»Ich persönlich bin wohlauf, danke der Nachfrage.« Am zögerlichen Ton seiner Gattin merkte Gerban sofort, dass etwas ganz und gar nicht in Ordnung war.
Während er seine Tasse absetzte und demonstrativ nach einem Stück Kuchen griff, wartete er zunächst auf das, was sie ihm gleich erzählen würde, kaute und schwieg.
Pauline Gerban spielte nervös mit ihren Händen. Obwohl er an der Größe ihrer Pupillen erkannte, dass sie auch heute wieder Laudanum, ihr probates Mittel gegen jede Unbill des Lebens, eingenommen hatte, schien sich dessen beruhigende Wirkung diesmal nicht in vollem Ausmaß eingestellt zu haben.
Pauline räusperte sich mehrmals vernehmlich, kam aber immer noch nicht zur Sache. Langsam wurde Gerban unruhig. Was kann denn nun wieder geschehen sein?
Er musterte seine Frau mit zusammengezogenen Augenbrauen. Obwohl sie schon lange ihren sexuellen Reiz für ihn verloren hatte, war Pauline noch immer von jener zarten Schönheit, die ihn vor mehr als fünfundzwanzig Jahren so angezogen hatte, dass er sich tatsächlich in die gebürtige Straßburgerin verliebte.
Er hatte Pauline im Haus ihres Vaters kennengelernt, eines schwerreichen französischen Weinhändlers, der seiner einzigen Tochter nicht nur eine großzügige Mitgift ausgesetzt hatte, sondern sie auch zur Erbin seines gesamten Vermögens bestimmen wollte. Als Wilhelm dies im Rahmen seiner Geschäfte mit Paulines Vater erfuhr, war das Grund genug für ihn gewesen, nach Straßburg zu kommen, um dort um ihre Hand anzuhalten.
Doch als er der damals Neunzehnjährigen zum ersten Mal begegnete, war er aufrichtig überrascht gewesen, dass sie nicht nur reich, sondern zudem noch anmutig und gebildet war. Obwohl er schließlich unter vielen Bewerbern das Rennen um ihre Hand machte, verlief ihre Ehe nicht glücklich.
Über zehn Jahre musste ich auf die Geburt meines Sohnes und Erben warten. Noch heute dachte Gerban mit Ingrimm daran. Was hätte ihm sein riesiges Vermögen, das er hauptsächlich mit Paulines Geld erwirtschaftet hatte, genutzt, wenn es nach seinem Tode dem Sohn seines jüngeren Bruders zugefallen wäre! Denn die Kinderlosigkeit ihrer Ehe lag nicht an ihm! Das wusste er aufgrund seiner zahlreichen Affären, die er vor und auch nach der Heirat unterhalten hatte, nur zu genau!
Dass Pauline an seiner Seite verkümmerte wie eine Blume ohne Wasser, wäre ihm damals wie heute nicht in den Sinn gekommen. Schließlich hatte er seinen Teil der Verpflichtungen mehr als erfüllt. Mit Paulines Geld war das heruntergewirtschaftete Weingut im pfälzischen Schweighofen, das nach dem Tode des Vaters nunmehr sein Bruder leitete, aufgeblüht und brachte einen Spitzenjahrgang nach dem anderen hervor. Ihm selbst hatte seine Ehe mit einer französischen Frau ermöglicht, seine Weinhandlung jenseits der deutschen Grenze ins benachbarte elsässische Weißenburg zu verlegen. So sparte er die hohen Steuern und Ausfuhrzölle, die die bayerische Regierung, zu deren Gebiet die Pfalz seit dem Wiener Kongress 1816 gehörte, den dortigen Weinhändlern auferlegte. Deshalb konnte er seine Produkte konkurrenzlos preiswert anbieten.