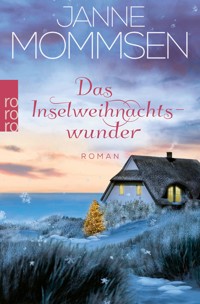9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die kleine Friesencafé-Reihe
- Sprache: Deutsch
Seeluft, Strand und Friesentorte - der Auftakt zur neuen Friesencafé-Reihe von Bestsellerautor Janne Mommsen. Julia braucht eine Auszeit vom Leben. Auf Rat ihrer Oma reist sie nach Föhr, um den Spuren ihrer früh verstorbenen Mutter zu folgen, die einst eine glückliche Zeit auf der Insel verbrachte. Bei einem Spaziergang stößt Julia auf ein leerstehendes Kapitänshaus: der perfekte Ort, um ihrer Leidenschaft, der Malerei, nachzugehen. Spontan beginnt sie, Porträts von Touristen und Insulanern anzufertigen. Als sich immer mehr Leute dort malen lassen, schenkt sie bald Kaffee aus, backt Friesentorte und bewirtet die Gäste. Es fühlt sich an wie ein eigenes kleines Café. Julia scheint ihrem Traum vom Glück ganz nahe, da stellen sich ihr zwei Männer in den Weg: Der kauzige Nachbar, Kapitän Hark Paulsen, und der irritierend gutaussehende Bürgermeister Finn-Ole. Wer hilft? Natürlich Oma Anita. Die träumte als junge Frau nämlich selbst von einem eigenen Café, allerdings in Paris.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Janne Mommsen
Das kleine Friesencafé
Ein Inselroman
Roman
Über dieses Buch
Ein kleines Inselcafé und der große Traum vom Glück
Julia braucht eine Auszeit vom Leben. Auf Rat ihrer Oma reist sie nach Föhr, um den Spuren ihrer früh verstorbenen Mutter zu folgen, die einst eine glückliche Zeit auf der Insel verbrachte.
Bei einem Spaziergang stößt Julia auf ein leerstehendes Kapitänshaus: der perfekte Ort, um ihrer Leidenschaft, der Malerei, nachzugehen. Spontan beginnt sie, Porträts von Touristen und Insulanern anzufertigen. Als sich immer mehr Leute dort malen lassen, schenkt sie bald Kaffee aus, backt Friesentorte und bewirtet die Gäste. Es fühlt sich an wie ein eigenes kleines Café.
Julia scheint ihrem Traum vom Glück ganz nahe, da stellen sich ihr zwei Männer in den Weg: Der kauzige Nachbar, Kapitän Hark Paulsen, und der irritierend gutaussehende Bürgermeister Finn-Ole. Wer hilft? Natürlich Oma Anita. Die träumte als junge Frau nämlich selbst von einem eigenen Café, allerdings in Paris.
Seeluft, Strand und Friesentorte - der Auftakt zur neuen Friesencafé-Reihe von Bestsellerautor Janne Mommsen.
Vita
Janne Mommsen hat in seinem früheren Leben als Krankenpfleger, Werftarbeiter und Traumschiffpianist gearbeitet. Inzwischen schreibt er überwiegend Romane und Theaterstücke. Mommsen hat in Nordfriesland gewohnt und kehrt immer wieder dorthin zurück, um sich der Urkraft der Gezeiten auszusetzen.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, März 2021
Copyright © 2021 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Die auf den Seiten 85 und 227 zitierten Liedzeilen sind aus:
Carmina Burana
Text: anonym
Komposition: Carl Orff
La Mer
Text: Charles Trenet
Komposition: Charles Trenet & Leó Chauliac
Covergestaltung Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich
ISBN 978-3-644-00745-1
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
1
Der altersschwache Diesel des Triebwagens heulte laut auf, dann rollte die Kleinbahn aus dem Bahnhof Niebüll heraus. Hark Paulsen saß im Großraumwagen alleine an seinem Lieblingsplatz am Tisch, in Fahrtrichtung links, mit viel Raum für die Beine. Vor seinem Fenster zog die weite Landschaft vorbei, die Sonne stand hoch am knallblauen Himmel und brachte die sattgrünen Wiesen und Weiden zum Leuchten. Der mächtige Seedeich in ein paar Kilometern Entfernung war die einzige Erhebung weit und breit, auf der Krone graste eine Schafherde, es wehte ein kräftiger Ostwind.
Alles sah aus wie ein perfekter Hochsommernachmittag. Aber nicht für ihn: Dieses Wetter passte ihm ganz und gar nicht. Für heute hätte er sich einen Orkan mit Graupelschauern gewünscht, der die See mit schaumigen, haushohen Brechern aufpeitschte.
Oben im Gepäckfach lag sein kleiner Rollkoffer mit den neuen Anziehsachen, darüber hatte er seine sorgsam gefaltete Dienstkleidung gelegt. Hark kaufte nicht gerne ein, aber heute war es mal wieder fällig gewesen. Er hatte in Husum zwei Paar Schuhe, vier Hosen und fünf neue Hemden besorgt, damit war die Klamottenfrage erst mal wieder für ein paar Jahre geklärt. Geschmeichelt hatte er von der Verkäuferin vernommen, dass sich seine Konfektionsgröße nicht verändert hatte. Okay, er war nicht gerade dünn, aber sie hatte ihn «immer noch schlank» genannt. Und das mit siebenundsechzig, ohne dass er viel dafür tat, damit konnte er zufrieden sein.
Nach zwanzig Minuten passierte der Zug die schmale Durchfahrt im Seedeich und hielt auf der Mole von Dagebüll. Hark schnappte sich seinen Koffer und trat auf den Bahnsteig. Sofort schlug ihm der salzige Seewind ins Gesicht. Er blinzelte in die Sonne und atmete tief ein. Eigentlich sollte die Flut längst da sein, aber der Meeresboden war lediglich mit einer hauchdünnen Wasserschicht bedeckt. Darin spiegelte sich der blaue Himmel mit seinen Schäfchenwolken. Ein paar Seemeilen entfernt lag die Insel Föhr, die erste Hausreihe der Wyker Promenade war zu erkennen. Davor leuchtete der helle Strand, während sich links davon der kilometerlange Deich erstreckte.
Als er die Norderaue auf den Hafen zukommen sah, schnürte es ihm den Hals zu. Die weiße Autofähre mit dem dicken schwarzen Streifen war noch ungefähr eine Viertelseemeile entfernt. Behutsam arbeitete sie sich im flachen Wasser durch die ausgebaggerte Fahrrinne zum Anleger vor. Mit jedem Meter, den sie näher kam, wurde sein Brustkorb schwerer. Irgendwann ist es für jeden so weit, Hark Paulsen!, ermahnte er sich. Wieso solltest du da eine Ausnahme sein? Also reiß dich zusammen! Ein Sturm wäre für ihn leichter zu nehmen gewesen, damit kannte er sich aus. Eins war klar: Wenn er die Überfahrt nach Föhr hinter sich hatte, würde er sich erst mal eine Woche in seinem Haus einsperren, um einen klaren Kopf zu bekommen, das war beschlossene Sache.
Er passierte die Absperrung zum Seiteneinstieg und nickte der Kassiererin zu. «Moin, Karin», grüßte er.
«Moin, Käpt’n Paulsen.»
Nachdem die Norderaue angelegt hatte, kamen ihm die Passagiere von der Fähre entgegen. Ein paar Insulaner kannte er, man nickte sich zu, manchmal kam ein knappes «Moin». Hark kämpfte sich gegen den Menschenstrom hoch an Bord. Er hoffte, dass ihm niemand ansah, wie elend er sich fühlte. «Die letzte Fahrt»: Wie das schon klang! So etwas schrieb man in Traueranzeigen, wenn ein Seemann verstorben war: «Er hat seine letzte Fahrt angetreten …»
Hark verstand nicht, warum er in Pension gehen sollte. Er war gesund, kompetent und erfahren, hatte an Bord alles im Griff, und der Job brachte ihm Spaß. Aber die Reederei bestand darauf. Eigentlich sollte er schon letzte Woche aufgehört haben, aber ein Kollege hatte ihn gebeten, heute noch mal für ihn einzuspringen.
Hark ging hoch zur Brücke. Wehe, jemand hält sich nicht an meine Ansage!, schwor er sich grimmig. Den werfe ich eigenhändig über Bord! Dass dies seine allerletzte Fahrt war, sollte auf keinen Fall Thema werden. Der Besatzung der Norderaue hatte er seine Anweisung zugemailt, die im Wesentlichen aus jenem Satz bestand, den jeder Norddeutsche kannte und respektierte: «Macht kein Brimborium!»
Hark betrat die Brücke, wo der vollbärtige, rundbäuchige Steuermann Roloff auf ihn wartete. Der diensthabende Kapitän Hannes Schmidt kam ebenfalls hinein, er hatte seine Uniform bereits gegen Jeans und T-Shirt getauscht.
«Moin, all tosoom», brummte Hark und gab beiden die Hand.
«Moin, Sharky», sagte Hannes. Den Spitznamen hatte Hark schon in frühester Kindheit verpasst bekommen, alle nannten ihn so.
«Irgendwas Besonderes?», fragte er seinen Kollegen, der die Fähre von Amrum rübergebracht hatte und hier von Bord ging. Hark sollte die Norderaue gleich nach Wyk schippern: 7,7 Seemeilen, dann war Schluss, für immer. Er blieb misstrauisch, kam doch noch irgendein Spruch? – Nein, auf seine Jungs konnte er sich verlassen.
«Der Wind dreht auf sieben bis acht aus Ost, wir haben extremes Niedrigwasser, und die Flut kommt nicht zurück. Es langt wohl gerade noch.»
«Alles klar.»
Wenn ein starker Ostwind die See bei Ebbe wegdrückte, hatten sie manchmal nicht genug Wasser unter dem Kiel. Hark kontrollierte die Instrumente auf der Brücke und rief den Maschinisten an: «Bei dir alles okay, Jan?»
«Maschine läuft rund», kam es zackig zurück.
So hatte er es gerne. Er ging mit seinem Koffer in die Kapitänskabine ein Deck tiefer, um sich umzuziehen. Als er in seiner makellosen weißen Uniform zurück auf die Brücke kam, telefonierte sein Steuermann gerade. «Ihr organisiert den Shantychor für den Alten», bellte Roloff in den Hörer und legte hastig auf, als er ihn bemerkte. Hark zog die Stirn in Falten. Mit dem «Alten» war er gemeint, aber es bezog sich nicht auf seine Lebensjahre. So nannte man nach alter Seemannstradition den Kapitän an Bord. Dagegen hatte er nichts.
Gegen den Shantychor schon. Die blöde Abschiedsfeier der Reederei in ein paar Wochen hasste er jetzt schon, aber das war wohl nicht zu umgehen. Roloff brachte ihm einen großen Pott Kaffee, wie er ihn am liebsten mochte, stark und schwarz. Das heiße Getränk munterte ihn auf. Er schaute aufs Watt, das sich bis zum Horizont hinzog. Nicht weit entfernt aalten sich ein paar dunkle Seehunde auf einer Sandbank in der Sonne. Unter ihren struppigen Schnurrbarthaaren schienen sie ständig zu lächeln, schon deswegen zählten sie zu Harks Lieblingstieren.
Föhr lag in Sichtweite. Hark war auf der Insel aufgewachsen und hatte von hier aus alle Weltmeere befahren. Auf offener See hatte er sich immer wohl gefühlt, auch und gerade in brenzligen Situationen. Kämpfte er sich mit einem riesigen Containerfrachter im Sturm vor Kap Horn einen Wellenberg hinauf, um dann auf der anderen Seite wieder herunterzugleiten, tauchte der Bug oft bis zum Deck in die See. Er war immer ruhig geblieben, obwohl er wusste, dass gerade hier schon viele Schiffe untergegangen waren. Und er war froh, dass er seine Mannschaften immer heil nach Hause gebracht hatte. Trotz moderner Schiffstechnik hatte Hark den Respekt vor dem Meer nie verloren, auf See waren Menschen nur Gäste, das war ihm stets bewusst.
Hark betätigte den Knopf für das Schiffshorn und beugte sich zum Mikro. «Wir legen jetzt ab Richtung Föhr», teilte er unaufgeregt mit. Er gab den Befehl zum Leinenlösen. Behutsam bugsierte er die Norderaue mit dem Joystick aus dem Dagebüller Hafen heraus. Obwohl ihm die Gewässer im Wattenmeer seit frühester Jugend bekannt waren, blieb er aufmerksam. Mit einem Auge schielte er immer aufs Echolot, das die Wassertiefe anzeigte. Der ausgebaggerte Kurs war durch Birkenbäume markiert, die man ins Watt gesteckt hatte, aber wegen der Gezeiten konnte sich die Fahrrinne jederzeit verschieben.
Dann passierte es, sie liefen auf Schlick. Die Natur hatte sich nicht an die Prognose gehalten, das Wasser war nicht gestiegen, zusätzlich drückte eine heftige Windbö die Fähre zur Seite. Hark versuchte noch, mit dem Joystick das Schiff herumzureißen, aber es war zu spät.
«Tja», murmelte er.
Auch Steuermann Roloff zuckte nur mit den Achseln. «Laut Vorhersage haben wir in zehn Minuten wieder genug Wasser unterm Kiel.»
«Na denn», brummte Hark und ließ die Maschinen herunterfahren. Im Grunde freute er sich, dass seine letzte Fahrt nicht so ereignislos verlief wie erwartet. Er beugte sich zum Mikro, um eine Durchsage an die Passagiere zu machen.
«Hier spricht Kapitän Paulsen. Wir sitzen wegen extremer Ebbe fest. Sobald wieder Wasser da ist, fahren wir weiter.» Er fügte hinzu: «Wer es eilig hat, kann gerne zu Fuß vorgehen.»
An seinem letzten Tag war so ein Spruch drin, fand er. Er verließ die Brücke und schaute sich auf dem Oberdeck um. Dort war alles in Ordnung, viele Passagiere schienen die Verzögerung zu genießen: Sie waren auf hoher See, die Sonne schien, die Temperatur war angenehm, wer wollte da meckern? Klar, Nörgler und Klugscheißer gab es natürlich auch, zum Beispiel der Typ, der sich jetzt vor ihm aufbaute. Mitte vierzig, schmale Lippen, Stoppelhaarschnitt. «Wie lange dauert das denn noch?», sagte er gereizt.
Hark kratzte sich am Kinn. «Das kann sich hinziehen.»
«Wenn Sie mehr Gas geben, geht es mit Sicherheit schneller», greinte der Mann. «Aber die Reederei will Treibstoff sparen, stimmt’s? Euch geht es doch nur ums Geld, und wir Passagiere müssen das ausbaden.»
Hark legte die Stirn in Falten. «Das mit dem Gas kann ich probieren, aber vorher muss ich ein anderes Problem lösen.»
«Was denn?»
«Wir sind zu schwer», raunte Hark ihm zu.
«Und dagegen kann man nichts tun?»
«Doch. Wir müssen einen Passagier über Bord werfen.»
Der Typ sah ihn entsetzt an.
«Ich suche gerade Freiwillige», fügte Hark hinzu und blickte ihm fest in die Augen. Seinem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, hatte der Mann keinen Sinn für friesischen Humor.
2
Als Hark die Norderaue eine Stunde später in den Wyker Hafen manövrierte, tauchte die Abendsonne die Inselhauptstadt in ein goldenes Licht. Das Meerwasser glitzerte tiefblau, die Marsch zur Rechten leuchtete grün wie ein Smaragd.
Harks letzte Fahrt war eine der schönsten seines Lebens gewesen. Und gleichzeitig die schlimmste, eben weil sie so schön war. Er überwachte das Anlegemanöver, das wie immer hervorragend klappte, seine Mannschaft war perfekt aufeinander eingespielt. Passagiere und Autos verließen die Fähre, Steuermann Jan Roloff brachte Hark das Logbuch zum Abzeichnen. Die Norderaue blieb im Hafen, sie würde erst morgen wieder auslaufen.
Hark schnappte sich seinen Koffer. «Schön’n Feierabend», brummte er.
«Selber auch», antwortete Jan.
Das war es dann gewesen. Mit diesen beiden Worten endeten für ihn fünfundvierzig Jahre Seefahrt.
Hark tippte sich an die Mütze und ging von Bord – zugegeben: mit weichen Knien. Den ersten Schritt in sein neues Leben hatte er geschafft, aber das Schlimmste lag noch vor ihm. Was auf der Insel auf ihn zukam, würde heftiger werden als sämtliche Stürme vor Kap Horn zusammen.
Hark stieg in seinen alten, klapprigen Mercedes aus dem Jahr 1966, der hinten zwei seitliche Heckflossen hatte. Die passten gut zu einem Kapitän, fand er. Er fuhr über die Umgehungsstraße aus der Hauptstadt Wyk heraus. Der Koffer lag neben ihm auf dem Sitz. Als er hinter Alkersum die offene Marsch erreichte, huschte ein Lächeln über sein Gesicht. Der weite Himmel über dem flachen Land munterte ihn auf. Hier war er aufgewachsen. Deshalb wusste er auch, dass ihm sein Heimatdorf Oldsum das garantierte, wonach er sich gerade am meisten sehnte: Ruhe. Natürlich kannte in dem Fünfhundert-Seelen-Dorf jeder jeden, und man quatschte auch miteinander, wenn man sich traf. Aber wenn jemand das gerade nicht wollte, wurde das ohne Wenn und Aber akzeptiert. Hark fand, dass dies eine der nobelsten Eigenschaften der Inselfriesen war.
Schon von weitem wies ihm die alte Mühle am Dorfrand mit ihren mächtigen Flügeln den Weg. Kurz davor bog er auf einen Schleichweg ab und fuhr langsam nach Oldsum rein. Links und rechts der schmalen Straße dösten die vertrauten Reetdachhäuser mit ihren roten Backsteinmauern in der Abendsonne. Harks Haus stand in einer Lindenallee, die einen Hauch aristokratischer Noblesse verströmte. Es war eines der ältesten Gebäude im Ort, hier war schon sein Urgroßvater aufgewachsen. Es gehörte zu einem Geviert von Reetdachhäusern, die sich um einen Innenhof mit einem üppig wuchernden Garten gruppierten. Vor kurzem hatte Hark das Haus nebenan dazugekauft; das gegenüber gehörte Festländern, die selten da waren.
Er stellte den Wagen vor der Haustür ab, schnappte sich seinen Koffer und ging hinein. Seine Inneneinrichtung überraschte die meisten Besucher, wenn sie das erste Mal hierherkamen. Die Wände in der Küche waren vollständig mit traditionellen friesisch blauen Kacheln verkleidet. Sie stammten aus dem 18. Jahrhundert und zeigten Motive von der Insel: Mühlen, alte Segelboote und Fische. In der Mitte des Raumes stand ein grober Bauerntisch, drum herum vier Stühle mit hohen Lehnen. Der Rest der Wohnung war komplett asiatisch eingerichtet. Das Kopfende des Bettes hatte die Form eines chinesischen Schriftzeichens, die Couch war aus Bambus gefertigt. Die Schränke und Kommoden besaßen ganz andere Proportionen als in Europa, vor allem wirkten sie nicht so wuchtig. In die Schranktüren waren feine Intarsien aus verschiedenen Holzarten eingearbeitet, was Hark liebte. Diese Möbel hatte er auf seinen Seereisen in China und Japan gekauft. In den verwinkelten Gassen Shanghais kannte er sich gut aus – als es sie noch gab und sie nicht durch gläserne Wolkenkratzer ersetzt worden waren. Den exotischen Geruch der Möbelläden hatte er noch immer in der Nase. In seiner Wohnung lebte die Erinnerung an diese längst vergangene Zeit weiter.
Ächzend ließ er sich auf den Ohrensessel fallen, der als einziges Möbelstück im Wohnzimmer nicht aus Asien stammte. Fürs Erste wollte Hark sein Haus nicht mehr verlassen. Dafür hatte er vorgesorgt: In der Speisekammer und im Kühlschrank lagerten Lebensmittel für mindestens eine Woche. Doch dann fiel ihm auf, dass er etwas Wichtiges vergessen hatte, zu blöde! Es half nichts, er musste noch einmal los.
Den Weg zu «Frischemarkt Rickmers» hätte er mit verbundenen Augen gefunden, inklusive der Abkürzung über den Pfad hinter Hansens Gartenzaun. Den nahm er seit Jahrzehnten. Hark stellte sich manchmal vor, dass die Wege und Straßen hier in Oldsum ein Gedächtnis besaßen und von früh an alles von ihm mitbekommen hatten: seine Geburt, die ersten Laufschritte, ungelenke Fahrversuche auf dem Kinderrad, Ballspiele, Raufereien, die erste scheue Annäherung an ein Mädchen. Die Straßen im Ort kannten ebenso seine Eltern, Großeltern und Urgroßeltern, als sie noch Kinder waren. Sie hatten irgendwann mit ansehen müssen, wie seine Vorfahren im Sarg aus dem Haus getragen wurden. Zum Glück waren alle Paulsens sehr alt geworden, darauf setzte er.
Frischemarkt Rickmers befand sich in einem rot verklinkerten Gebäude, das ein paar Meter zurückgesetzt im Waaster Bobdikem lag, der Hauptstraße, die durchs Dorf führte. Der einzige Supermarkt im Ort diente auch als Treffpunkt und Nachrichtenzentrale.
Am Eingang stieß Hark auf Birte Feddersen, die er seit frühster Kindheit kannte. Schon damals in der ersten Klasse war sie eine Kesse gewesen, die sich nicht die Butter vom Brot nehmen ließ. Daraus hatte sich eine schlanke Endsechzigerin mit blondgefärbten kurzen Haaren entwickelt, die immer noch herrlich vorlaut war. Birte hatte viele Jahre als Assistentin in der Fering-Stiftung gearbeitet, die sich die Förderung der friesischen Sprache und Kultur zum Ziel gesetzt hatte. Sie hatte das Büro mit großer Leidenschaft und Organisationstalent geschmissen, das konnte man nicht anders sagen. Nach ihrer Verrentung war sie Vorsitzende des Trachtenvereins geworden. Zu hohen Festen wie Hochzeit, Konfirmation, runden Geburtstagen und Dorffeiern trugen die Föhrer Frauen immer noch die alten Trachten, die über mehrere Generationen vererbt wurden. Auch die jungen Föhrerinnen setzten diese Tradition stolz fort.
«Moin, Sharky, hü gongt et?», grüßte Birte.
«Gud, un di?»
«Auch.»
«Wann ist es bei dir so weit?», erkundigte sie sich. Als ob er schwanger war und kurz vor der Niederkunft stand.
Er winkte ab. «Och, das dauert noch.»
Was nicht stimmte, Birte wusste das natürlich.
«Macht die Reederei nicht bald die große Verabschiedung für dich?», bohrte sie nach.
«Ich weiß von nichts.»
Das war glatt gelogen, er dachte an kaum etwas anderes. Vor allem suchte er fieberhaft nach einer Ausrede, mit der er diese Feier umgehen konnte. Am liebsten hätte er Birte jetzt zugerufen: «Meine Pensionierung ist der Anfang vom Ende! Danach wird nichts mehr kommen, außer dem Lebensabschnitt, in dem ich sterben werde. Und das ist keine Kleinigkeit. Ich weiß, dass es allen so geht, aber ich finde es trotzdem schrecklich!» Aber er hielt sich zurück.
«Sag mal, wo wir gerade am Schnacken sind: Wir suchen noch Leute», sagte Birte.
«Wofür?»
«Französisch.»
«Nee.»
«Nich?»
Auf der Insel Föhr sprach man Hochdeutsch, Plattdeutsch und Fering und ein bisschen Dänisch. Das beherrschte Hark alles. Davon abgesehen sprach er fünf weitere Sprachen fließend, Französisch war eine davon. Er war zehn Jahre für eine Reederei in Marseille gefahren, außerdem konnte er Englisch, Schwedisch, Spanisch und Portugiesisch. Was kaum einer auf der Insel wusste.
«Und was ist mit Canasta? Wir treffen uns jeden Mittwochnachmittag in ‹Grethjens Gasthof›.»
«Wer ist ‹wir›?»
«Na, Rentner wie du und ich.»
Hark schluckte. Rentner wie du und ich? Meinte sie etwa ihn damit? So weit war er noch lange nicht! Bis zu seiner Abschiedsfeier war er immer noch offiziell bei der Reederei als Kapitän zur See angestellt. Er murmelte ein «Mal sehen», gab Birte einen freundschaftlichen Klaps auf die Schulter und kaufte eine Flasche Aquavit. Dann trottete er nach Hause.
Im Dorf war kein Mensch zu sehen, das Abendlicht floss goldglänzend durch die leeren Straßen, als seien sie Kanäle. Für Hark war Oldsum schöner als Venedig, keine Frage.
Zu Hause nahm er ein großes Glas aus dem Küchenschrank und ging mit der Aquavit-Flasche in seinen Blumen- und Gewürzgarten hinterm Haus. Hier war es immer windstill und viel wärmer als auf dem Rest der Insel. Entspannt setzte er sich in seinen Strandkorb unter dem knorrigen Birnbaum, was sein absoluter Lieblingsplatz war. Es roch nach frisch gemähtem Gras, Kräutern und Meer. Sein Garten sah aus wie ein Dschungel, alles wuchs wild durcheinander, Blumen und Stauden, daneben gab es einen Abschnitt mit Gemüse, großen Kohlsorten, Zucchini, Gurken, Kartoffeln, Lauch, Sellerie und Kürbis. Außerdem hatte er Gräser, Farne und Kräuter gepflanzt.
Der Himmel färbte sich gerade rötlich. Es war, als ob sich alle Vögel der Gegend für ein Konzert zusammengefunden hatten, er lauschte genau und hörte einige Sperlinge und Austernfischer heraus.
Hark hatte das Gefühl, dass das Glück im Leben meist auf seiner Seite gewesen war. Allein, dass er Miranda kennengelernt hatte! Sie war zufällig aus Spanien zu Besuch in Hamburg gewesen, als er dort mit seinem Schiff in der Werft lag. In einem Café am Jungfernstieg waren sie ins Gespräch gekommen, und er hatte sich auf der Stelle in die dunkelhaarige Schönheit mit den lebhaften braunen Augen verliebt. Miranda war charmant und blitzgescheit. Sein unglaubliches Glück war gewesen, dass er ähnlich stark auf sie gewirkt haben musste wie sie auf ihn. Und dass sie bereit war, zu ihm auf die windumtoste, abgelegene Insel Föhr zu ziehen, obwohl er die meiste Zeit des Jahres auf hoher See sein würde.
Wie schwierig es am Anfang für Miranda gewesen sein musste, auf der Insel zurechtzukommen, konnte er gar nicht ermessen. Allein das Wetter war so anders als in Spanien! Fering zu lernen, war für sie eine weitere Herausforderung: Ohne die Inselsprache würde sie in Oldsum nie richtig angenommen werden, das war klar. Also setzte sie sich täglich mit Insulanern zusammen und lernte in erstaunlich kurzer Zeit deren Sprache. Mit ihrer offenen, fröhlichen Art hatte sie sich bald auf der Insel eingelebt, gab Spanischkurse an der Volkshochschule und arbeitete erst in der Gemeindebücherei, dann in einem Wyker Buchladen. Ihr zuliebe musterte er bald von den großen Pötten ab und wechselte auf die Fähre. Was sich für einen Seemann ungefähr so anfühlte wie für einen Formel-1-Fahrer, auf einen Gokart umzusteigen.
Er hatte es keinen Tag bereut.
Ein Jahr nach ihrem Kennenlernen machte er ihr einen romantischen Heiratsantrag, wieder im Café am Jungfernstieg, den sie mit Tränen in den Augen annahm. Miranda und er hatten eine phantastische Zeit zusammen, bei ihnen passte einfach alles. Er hörte nicht auf, sie zu lieben.
Doch dann brach das Unglück über sie herein. Während Mirandas Krankheit hatte er sich ein Jahr freigenommen, um sie zu pflegen. Selbst da hatten sie noch eine intensive Zeit. Er musste ihr versprechen, dass er nach ihrem Tod alles dafür tun werde, um ein gutes Leben zu führen. Das hatte er unter Tränen geschworen – halten konnte er es nicht. Miranda fehlte ihm einfach zu sehr. Für ein paar Jahre ging er wieder auf große Fahrt. Auf dem Meer fühlte er sich ihr näher als an jedem anderen Ort. Der Ozean strahlte jene Ewigkeit aus, in der sich Miranda nun befand. Später war er zur Fähre zwischen Wyk und Dagebüll zurückgekehrt. Dort war er auch geblieben – bis vorhin. Dass damit nun endgültig Schluss war, hatte er noch immer nicht richtig begriffen. Insgeheim hoffte er, dass doch noch irgendetwas passierte und man ihn wieder brauchte.
Natürlich hatte er einen Plan für die Zeit danach, seine Pensionierung war ja kein unerwarteter Schicksalsschlag, sondern stand seit langem fest. Um keine Lücke in seinem Leben entstehen zu lassen, hatte er vor einem halben Jahr das renovierungsbedürftige Nachbarhaus gekauft. Dreißig Jahre lang war die umgebaute Scheune ein plüschiges Oma-Café mit schlichten Möbeln und blau-weißem friesischem Geschirr gewesen. Jan und Susanne, die ursprünglich aus Hattstedt auf dem nordfriesischen Festland kamen, hatten es geführt. Anfangs hatte kaum jemand bemerkt, dass sie mit der Zeit selbst ihre besten Kunden am Tresen geworden waren. Irgendwann gab es nichts mehr zu beschönigen, da lallten sie schon morgens. Wenn etwas kaputtging, wurde es nicht mehr repariert. Hark und ein paar andere hatten versucht, ihnen unter die Arme zu greifen, aber sie wiesen jede Hilfe zurück. Die Gäste blieben aus, und nachdem die beiden Ärger mit der Lebensmittelaufsicht bekommen hatten, verkauften sie ihm schließlich das Haus und zogen zurück aufs Festland.
Erst einmal hatte er alles renoviert, die Wohnräume und die ehemalige Scheune, in der das Café gewesen war. Er hatte den Holzfußboden erneuert und jeden einzelnen roten Mauerstein sorgfältig mit einer Stahlbürste abgebürstet. Dabei hatte er richtig losgelegt – und sich total verrechnet: Das Haus war viel schneller fertig geworden als gedacht. Die Heizung funktionierte jetzt überall, ansonsten waren nur noch Kleinigkeiten zu erledigen. Hark hatte noch keine Idee, ob er das Haus weiterverkaufen oder vermieten sollte. Wichtig war ihm nur, dass er seine Ruhe haben würde, und das bedeutete: keine Gastronomie und kein Geschäft mit Laufkundschaft!
Ansonsten hatte er keinen blassen Schimmer, wie es mit ihm weitergehen konnte, alles erschien ihm als sinnloser Zeitvertreib. Ohne Zweifel war er auf Schiet gelaufen und saß fest. Die Aquavit-Flasche stellte er ungeöffnet zur Seite. Wenn es einem schlecht ging, sollte man auf keinen Fall trinken, das war seine eiserne Regel, und damit war er immer gut gefahren. Er wollte lieber einen klaren Kopf bewahren.
Aber mit dem Verzicht auf Alkohol war noch nichts gelöst. Würde er ab jetzt nur noch hier im Strandkorb sitzen und darauf warten, dass Freund Hein ihn abholte?
3
Bevor Julia Feierabend machte, ging sie noch einmal durch das riesige Gewächshaus und schaute, ob ihre Blumen gut versorgt waren. Ihr Arbeitsplatz war ein Paradies – wer sonst konnte das sagen? Egal, welche Jahreszeit gerade war, bewegte sie sich stets in angenehmer Wärme. Um sie herum blühten Blumen in fröhlichem Gelb, tiefem Polarblau, melancholischem Violett, knalligem Rot. Es gab zarte, durchscheinende Gewächse, die unauffällig in einer Ecke dösten, vor grauem Himmel aber eine ungeahnte Leuchtkraft entfalteten. Allein ihre Namen klangen wie Poesie: Zauberglöckchen und Mittagsblume kamen an sonnige Plätze, Männertreu, Elfenspiegel und Fleißige Lieschen an schattige. Die Pflanzen im Gewächshaus hatte sie nicht in strengen Reihen angeordnet, sondern nach Charaktereigenschaft und Erdteil sortiert. Dass das Gewächshaus mitten in Gelsenkirchen-Buer lag, unweit der ehemaligen Zeche Hugo, spielte keine Rolle: Beim Zusammenstellen ihrer Sträuße und Arrangements wanderte sie täglich von Südafrika nach Mittelamerika, weiter nach Asien und zurück nach Europa.
Auch heute verabschiedete sie sich mit einem guten Gefühl von den vielfarbigen Schönheiten und schloss die gläserne Tür hinter sich zu.
Julia war hier, in Gelsenkirchen-Buer, bei ihrer Oma Anita aufgewachsen, die das alteingesessene Blumengeschäft führte. Solange Julia zurückdenken konnte, hatte sie inmitten dieses Blütenmeeres gespielt. So war sie wie von selbst in eine Welt der Farben hineingewachsen. Sie hatte eine Ausbildung als Floristin gemacht und später die Meisterin draufgesattelt.
Auch nach Feierabend ließen die Blumen sie nicht los: Dann malte sie sie, und das mit großer Leidenschaft. Es hatte vor vielen Jahren in einem Südfrankreich-Urlaub mit Oma begonnen. In den Altstädten der Provence gab es überall Zeichner, die Porträts von Touristen anfertigten. Denen hatte sie stundenlang fasziniert über die Schulter geschaut. Zurück in Gelsenkirchen schenkte ihre Oma ihr zum Geburtstag eine Staffelei und einen Zeichenkurs an der Volkshochschule, später war es mit Tempera- und Ölfarben weitergegangen. Die Malerei war ein fester Bestandteil von Julias Leben geworden, sie konnte vollkommen darin versinken. Wenn sie vor ihrer Staffelei stand, gab es nur noch Farben, Linien und Flächen, denen sie stundenlang folgte und die sie beständig ausbaute. Deswegen die Malerei zum Beruf zu machen, hätte sie sich allerdings nicht zugetraut. Es war so genau richtig für sie, ein entspannender Ausgleich zur Arbeit.
Heute Abend aber hatte sie etwas anderes vor: Sie wollte mit ihren Freunden zum «Tetraeder» nach Bottrop fahren, einer begehbaren mehrstöckigen Stahlskulptur auf einem Hügel. Von hier aus hatte man einen unvergleichlichen Blick auf das gesamte Ruhrgebiet. Jeder sollte etwas zu essen oder zu trinken mitbringen, Julia war zuständig für den Sekt, der bereits im Kühlschrank stand.
Während sie vom Gewächshaus zum Wohnhaus ging, schaute sie auf ihr Handy. Anscheinend hatte sie einen Anruf verpasst. Als sie nun sah, von wem, schnellte ihr Blutdruck nach oben.
Raffael.
Mit dir rede ich nicht mehr, dachte sie. Sie hätte ihm nicht mal eine Zehntelsekunde ihrer Lebenszeit geopfert. Dass sie sich getrennt hatte, war eine der besten Entscheidungen überhaupt gewesen. Alternativlos sozusagen. Trotzdem zog allein sein Name auf dem Display ihre gute Laune in den Keller.
In dieser Stimmung zweifelte sie plötzlich alles in ihrem Leben an, was sie bis eben noch gut gefunden hatte: Würde ihre Clique auch noch durch Clubs und Kneipen ziehen, wenn sie alle sechzig waren? Würde sie dann immer noch im Gewächshaus arbeiten? Zurzeit war alles gut, aber konnte es ewig so weitergehen? War es nicht Zeit, noch mal etwas Neues anzufangen? Schnell wischte sie die Fragen, auf die ihr keine Antworten einfielen, beiseite.
Sie betrat das zweistöckige Wohnhaus, das ihr Großvater in den fünfziger Jahren zusammen mit ein paar Kumpels eigenhändig gebaut hatte. Im Erdgeschoss befand sich der Blumenladen, in dem Anita bediente, dahinter lag die Wohnung ihrer Oma. Sie selbst hauste ganz oben in der gemütlichen Dachgeschosswohnung, die sie sehr liebte.
Im Treppenhaus trat ihr Anita in den Weg. «Hallo, Julia, mein Kind, hast du einen Moment?»
Oma hatte ein Handtuch auf dem Kopf zu einer Art Turban geschlungen, was ihren langen Hals betonte. Dazu trug sie einen schwarzen Seiden-Morgenmantel. Sie hatte noch nie Probleme mit ihrer Figur gehabt, obwohl sie nicht gerade asketisch lebte und einen Eierlikör mit Freunden nie verschmäht hätte. Beneidenswert.
«Nach was riecht es hier?», fragte Julia.
«Na, rate mal.»
Julia zog die Luft tief ein und überlegte einen Moment. «Bananenkuchen?»
«So ist es!» Ihre Oma strahlte.
Anita war die Königin des Backens, an ihr war wirklich eine Spitzenkonditorin verlorengegangen. Oft waren es eine Messerspitze Vanille oder ein Hauch Ingwer, die den Unterschied machten. Gott sei Dank hatte Oma ihr in den letzten Jahren all ihre Rezepte mit den kleinen Tipps und Kniffen beigebracht, Julia kannte sie inzwischen auswendig. Neben dem Malen war Backen ihre zweite Leidenschaft geworden.
Nun führte Oma sie im Wohnzimmer auf die dunkelgrüne Plüschcouch, die hier seit Jahrzehnten stand. Bis auf dieses Möbelstück war alles mit weißen Ikea-Möbeln eingerichtet, Oma hatte einen Fimmel für das schwedische Möbelhaus.
Anita legte den Arm um ihre Enkeltochter. Was Oma wohl wollte? Irgendwie war sie anders als sonst, das hier würde kein beiläufiges Feierabendgerede werden.
«Ich muss dir etwas zeigen», sagte Oma und zog ein kleines pastellgelbes Heft aus ihrem Morgenmantel. «Schau mal, das habe ich vorhin beim Aufräumen gefunden.»
Julia nahm die gelbe Kladde in die Hand. Sie schien ziemlich alt zu sein. Auf der ersten Seite stand ein Name in tintenblauer Schreibschrift. Als Julia ihn las, riss es ihr den Boden unter den Füßen weg.
Diese Kladde hatte ihrer Mutter gehört!
«Von wann stammt das?», flüsterte sie.
«Linda hat damals eine Mutter-Kind-Kur mit dir auf der Insel Föhr gemacht. Du warst gerade mal ein Jahr alt. Das Reizklima an der Nordsee tat Lindas Lunge gut. Dieses Heft war anscheinend eine Art Tagebuch von dieser Kur.»
Wie schade, dass sie sich nicht daran erinnern konnte!
«Sie ist so glücklich mit dir von Föhr zurückgekehrt», erinnerte sich Oma.
Linda war gestorben, als Julia anderthalb war, sie hatte ihre Mutter also nie bewusst kennengelernt. Julia war es immer ein bisschen unangenehm, wenn Menschen sie nach ihrer Mutter fragten und sie sagen musste, dass sie schon lange tot sei. Viele entschuldigten sich dann für die Frage, dabei hatte sie nie ein Problem damit gehabt. Man konnte schwer um jemanden trauern, den man nie richtig gekannt hatte.
Aber warum standen ihr jetzt Tränen in den Augen?
Bei aller Abgeklärtheit gab es natürlich immer diese starke Sehnsucht, die nie erfüllt werden konnte. Um die Lücke in ihrem Leben zu füllen, hatte Julia alles über Linda wissen wollen. Aber leider gab es keine Ton- oder Filmaufnahmen von ihr, nur Fotos.
Ihre Mutter war schlank gewesen und hatte schwarze Locken gehabt. Sie wirkte auf den Bildern lebensfroh, meist lachte sie in die Kamera, dabei blitzten ihre großen dunklen Augen. Wie es damals Mode war, trug sie T-Shirts in allen Farben, dazu Kleider mit Spaghettiträgern, im Sommer hatte sie Espadrilles an Füßen. Dass sie über Jahre an einer Lungenkrankheit gelitten hatte, war ihr nicht anzusehen.
Ihre Mutter hatte Julia früh bekommen, mit neunzehn. Nach ihrem Tod nahm Anita, die Mutter ihres Vaters, Julia zu sich und zog sie groß. Bei ihrer liebevollen Oma entbehrte Julia nichts, sie war immer für sie da. Ihr Vater war geschäftlich viel unterwegs, Julia bekam ihn selten zu Gesicht. Das war für sie als Kind schwer verständlich gewesen. Oma hatte versucht, es ihr zu erklären: Nach Lindas Tod erlitt er einen Zusammenbruch, danach hatte er das Gefühl, sein Leben nicht mehr richtig in den Griff zu bekommen. Er fühlte sich überfordert als Witwer mit Kind, er hatte Angst. Inzwischen lebte er mit seiner neuen Frau auf Gran Canaria und betrieb dort eine Wäscherei.
Julia blätterte weiter in dem Heft, in dem nur sechs Seiten gefüllt waren. Es waren ungelenke Kugelschreiberzeichnungen von Linda, versehen mit Kommentaren in Schreibschrift.
Die erste Seite trug die Überschrift «Ankunft zum Abschied, der Fährmann bringt dich rüber». Zu sehen war ein Mastenwald von Segelbooten, dahinter eine Fähre. Julia traf das mitten ins Herz: War das eine Vorahnung gewesen, dass sie bald sterben musste?
Das nächste Bild hatte Linda «Hoffnung» genannt, darauf waren Surfer zu sehen. «Tanz der Surfer auf dem Meer vor Nieblum», hieß die Unterzeile. Ins Wasser hatte ihre Mutter das Wort «Heilung» geschrieben.
Es folgte der Blick zwischen zwei Inseln auf die hohe See: «Melancholischer Seeblick, jeden Tag».
Julia blätterte weiter zur nächsten Seite.