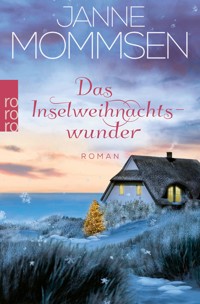9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die kleine Friesencafé-Reihe
- Sprache: Deutsch
Romantik auf Friesisch: Der Spiegel-Bestseller und dritte Teil der fulminant gestarteten Friesencafé-Reihe. Während Julia die Hochzeit von Oma Anita mit Kapitän Hark im kleinen Friesencafé vorbereitet, geht auf Long Island ein Mann am Strand spazieren und lernt Fering. Harks Großcousin Henry soll Trauzeuge sein und aus Amerika anreisen. Kurz vor dem Fest mischt der charismatische Leuchtturmwächter die Hochzeitsgesellschaft ordentlich auf. Denn hier treffen Ruhrpottschnauzen und friesische Gelassenheit aufeinander, unterschiedlicher kann es nicht sein. Hat Henry die Kraft, die Gegensätze zu vereinen? Und ist er überhaupt der, für den man ihn hält? Neben der Arbeit hält die Fernbeziehung mit Finn-Ole Julia auf Trab. Die Verbindung steht vor einer echten Zerreißprobe. Außerdem gibt es da schon länger den Plan, das kleine Friesencafé in eine Pension umzurüsten ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 242
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Janne Mommsen
Inselhochzeit im kleinen Friesencafé
Roman
Über dieses Buch
Romantik auf Friesisch
Während Julia die Hochzeit von Oma Anita mit Kapitän Hark im kleinen Friesencafé vorbereitet, geht auf Long Island ein Mann am Strand spazieren und lernt Fering. Harks Neffe Henry soll Trauzeuge sein und aus Amerika anreisen.
Kurz vor dem Fest mischt der charismatische Leuchtturmwärter die Hochzeitsgesellschaft ordentlich auf. Hier treffen Ruhrpottschnauzen und friesische Gelassenheit aufeinander, unterschiedlicher kann es nicht sein. Hat Henry die Kraft, die Gegensätze zu vereinen?
Neben der Arbeit hält die Fernbeziehung mit Finn-Ole Julia auf Trab. Die Verbindung steht vor einer echten Zerreißprobe. Dabei liegt zwischen ihnen nichts als das Wattenmeer. Und das lässt sich bekanntlich überwinden – zumindest, wenn das Wetter stimmt …
«Erfolgsautor zwischen den Meeren.» Hamburger Abendblatt
«Er schreibt wunderschöne Liebesgeschichten, und alle sind Bestseller.» Bild
Vita
Janne Mommsen hat in seinem früheren Leben als Krankenpfleger, Werftarbeiter und Traumschiffpianist gearbeitet. Inzwischen schreibt er überwiegend Romane und Theaterstücke. Mommsen hat in Nordfriesland gewohnt und kehrt immer wieder dorthin zurück, um sich der Urkraft der Gezeiten auszusetzen.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, März 2023
Copyright © 2023 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Das Zitat auf S. 104 stammt aus: Eduard Mörike, Gedichte
Das Zitat auf S. 146/147 stammt aus: Joachim Ringelnatz, Gedichte
Covergestaltung Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich
Coverabbildung Shutterstock
ISBN 978-3-644-01398-8
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
En gräen maaren, en lachten dai
Ein grauer Morgen, ein heller Tag
1
Ich lehne mich an die Kante des großen Konferenztisches und blicke durch die bodentiefe Glasfront vom 38. Stock auf die Upper Bay südlich von Manhattan. Über dem Wasser schwebt ein weißer Schleier, den die Vormittagssonne zum Leuchten bringt, darüber spannt sich ein wolkenloser tintenblauer Himmel. Ein kleines Ausflugsschiff zieht seinen Kurs schnurgerade Richtung Freiheitsstatue, dahinter breitet sich der Atlantik aus.
Mr. Chang und Mr. Fernandez haben sich mit ihren Leuten zur Beratung in getrennte Nebenräume zurückgezogen. Die Verhandlungen sind wie erwartet schnell zu Ende gegangen. Im Grunde war die Sache ziemlich einfach: Mr. Fernandez, Inhaber einer weltweiten Logistikfirma, steckte in finanziellen Schwierigkeiten. Mr. Chang wollte Anteile seines Unternehmens kaufen, um die Transportkosten für seine Firma zu senken, beide profitieren also von dem Geschäft. Da ihr Englisch nicht verhandlungssicher ist, wurde ich als Dolmetscher hinzugezogen. Mein Ruf ist es, nicht nur präzise zu übersetzen, sondern kulturelle Mentalitäten einzubeziehen, dafür zahlt man mich besonders gut. Im Lauf der vier Jahrzehnte, die ich diesen Job mache, habe ich zur Genüge die Missverständnisse kennengelernt, die trotz korrekter Übersetzung auftreten können. So habe ich mir vorhin erlaubt, Mr. Changs Mandarin ins Spanische zu übersetzen, was für den aus Argentinien stammenden Señor Fernandez vertrauter klang als amerikanisches Englisch.
Mr. Fernandez kommt wieder herein. Sein Maßanzug sitzt perfekt, das Gel in seiner Kurzhaarfrisur lässt kein Härchen abstehen. «Muchas gracias», sagt er lächelnd. «Ihr Español ist einfach perfekt.»
Das Geschäft ist anscheinend zu seiner Zufriedenheit gelaufen.
Ich lächele zurück. «Dafür bin ich da.»
«Mr. Chang lässt sich entschuldigen, er ist schon wieder auf dem Weg zum Flughafen.»
Die Masters of the Universe sind immer in Eile.
«Bitte senden Sie die Rechnung an meine Firmenadresse in Buenos Aires.»
«Vielen Dank, ich möchte kein Honorar», widerspreche ich sanft.
Señor Fernandez kneift seine großen braunen Augen zusammen. «Gibt es ein Problem?»
«Fährt zufällig in nächster Zeit einer Ihrer Frachter von New York nach Nordeuropa?», erkundige ich mich statt einer Antwort.
«Einige – wieso?»
«Könnten Sie anstelle eines Honorars meinen Wagen mitnehmen?»
Señor Fernandez sieht nun neugierig aus. «Sie wollen ihn in Europa verkaufen?»
«Nein, ich mache dort Urlaub.»
«Sie vertrauen den Mietwagenfirmen da drüben nicht?»
«Doch, schon. Aber ich fahre ein ganz besonderes Auto, von dem ich mich nur ungern trenne.»
«Verstehe, was ist es für einer? Ein Jaguar E-Type aus den Sechzigern oder ein Camaro?»
«Etwas kleiner, aber das Jahrzehnt stimmt.»
Er gibt mir zum Abschied seine Handynummer. Der Deal ist besiegelt.
In der Tiefgarage ist es drückend warm. Mit dem Autoschlüssel in der Hand wandere ich an den gängigen Modellen der oberen Mittelklasse vorbei, hin und wieder steht hier ein teurer Sportwagen. Ganz hinten auf dem Besucherparkplatz wartet auf mich das schönste Auto der Welt: mein altweißer 63er VW Käfer mit dem dunkelroten Faltdach. Die kreisrunden Scheinwerfer sehen aus wie Kinderaugen. Alles an dem Wagen ist abgerundet, die Motorhaube, die Heckscheibe, allein der aufgesetzte Blinker auf dem geschwungenen Kotflügel ist ein Kunstwerk, dazu kommt das Trittbrett mit der Gummibeschichtung.
Als ich die Tür öffne, empfängt mich der typische Käfergeruch, der auch nach Jahrzehnten nicht verflogen ist. Am Armaturenbrett ist eine kleine Blumenvase befestigt, in die ich zwei Vergissmeinnicht gesteckt habe. Ich drehe den Zündschlüssel um, der Boxermotor springt sofort an. Er klingt immer ein wenig angestrengt, funktioniert aber absolut zuverlässig. Den Wagen habe ich vor einem halben Jahr in New Mexico gekauft. Im Wüstenklima hatte Rost keine Chance. Klar, der Lack von vor sechs Jahrzehnten ist von der Sonne verblichen, aber diese Patina hat für mich was.
Ich tuckere aus der Tiefgarage in die Fulton Street, die im Schatten der umliegenden Hochhäuser liegt. Vor mir fährt ein Truck mit der lila Aufschrift «FedEx». Normalerweise würde ich jetzt über den Teddy-Roosevelt-Drive nach Hause fahren. Ich lebe in Williamsburg in einer geräumigen Dreizimmerwohnung, die Rose und ich gekauft haben, lange bevor in diesem Teil von Brooklyn alles unbezahlbar wurde.
Dort will ich jetzt nicht hin.
In meiner Wohnung halte ich mich eigentlich nur zum Schlafen auf, und das auch nur unter der Woche. Meist arbeite ich in meinem kleinen Büro in der Lower East Side bis in den späten Abend hinein. Freie Wochenenden, wie das, welches mir gerade bevorsteht, sind für mich eine Bedrohung. 52-mal im Jahr befinde ich mich im freien Fall, Samstag und Sonntag erscheint mir mein Leben sinnlos und leer, unabhängig davon, ob draußen ein Blizzard tobt oder die New Yorker Sommerhitze alles lahmlegt. Das Wochenende auch noch mit Arbeit vollzuschaufeln, ist auch keine Lösung, das habe ich längst probiert – bis ich vom Stress krank wurde.
Immerhin bin ich 67.
Mir fehlt Rose immer noch, seit ihrem Tod vor über zwanzig Jahren fehlt sie mir. Es hört einfach nicht auf. Immer waren wir füreinander da, konnten uns aufeinander verlassen. So eine Nähe kannst du durch nichts ersetzen. Rose und ich waren ein Dream-Team, wir hatten den gleichen Humor, waren beide sehr unordentlich, haben leidenschaftlich gerne gekocht. Am Herd haben wir immer Neues ausprobiert, israelische Küche, georgische, französische, deutsche, was uns einfiel.
Als ich auf die Brooklyn Bridge abbiege, befinde ich mich plötzlich im prallen Sonnenlicht. Neben mir funkelt das Wasser des East River. Ich schiebe das Faltdach mit dem verchromten Hebel zurück. Sofort knattert der Fahrtwind hinein und verwirbelt meine Haare. «Convertible for poor», hatte es der Verkäufer genannt, «Cabrio für Arme.» Die Hochhäuser des Financial Districts werden im Rückspiegel immer kleiner. Neben mir überholt ein Pick-up, der afroamerikanische Fahrer deutet auf meinen lärmenden Käfer und hebt lächelnd den Daumen. Ich winke zurück.
In meiner Familie war der Käfer kein Auto, sondern ein Familienmitglied, das am liebsten in der Garage ruhte. Mein Vater war ein notorischer Angeber, er besaß in den Sechzigern einen chromglänzenden Chevrolet, der mir wie ein rollender Ozeanriese vorkam. Den kleinen frechen Käfer fand ich viel cooler.
Ich nehme den Interstate Highway, der ans andere Ende von Long Island führt. Rechts geht es nach Coney Island, dem berühmten Strand mit dem Vergnügungspark. Ich habe meine frühe Kindheit zwischen Achterbahnen und Riesenrädern verbracht. Unser Viertel wurde «Little Odessa» genannt, wegen der vielen Immigranten, die hier wohnten. Von ihnen habe ich akzentfrei Russisch gelernt, ansonsten kann ich über das Viertel wenig Positives sagen. Die Kriminalität war hoch, die Straßen wurden beherrscht von Drogenbanden, gegen die die Polizei machtlos war. Wir Kinder mussten immer aufpassen, nicht zwischen die Fronten zu geraten.
Dort zieht mich nichts mehr hin.
Souverän schnurrt mein Auto Meile für Meile den Asphalt runter. Der Vorbesitzer hat netterweise ein Radio mit Kassettenrekorder in den Wagen eingebaut (den es 1963 noch nicht gab, aber so streng bin ich da nicht, mein Auto ist kein Museum). Bei einem Antiquitätenhändler in der Lower East Side habe ich einen Stapel Musik-Kassetten gekauft, die man sonst kaum noch bekommt. Ich lege die Beachboys mit «Surfin’ USA» ein, später einige Soul-Hits aus meiner Teeniezeit. Dann komme ich zu der Kassette, die jemand Wichtiges für mich eingesprochen hat. Ich will unbedingt jene Sprache reaktivieren, die ich vor Jahrzehnten oft gehört, aber selbst kaum gesprochen habe. Um rauszufinden, was die männliche Stimme sagt, muss ich genau hinhören:
«Hü gongt et? – How are you? – Wie geht es?»
Okay, das kannte ich noch. Der Sprecher übersetzt alles auch auf Deutsch, denn das haben wir häufiger als Englisch miteinander gesprochen.
«Min eilunn feer mei ik liis. – I love my Feer Island. – Ich liebe meine Insel Föhr.»
Ich versuche es laut zu wiederholen, bin aber nicht sicher, ob die Aussprache richtig war. Also spule ich zurück. Noch mal. Plötzlich wird die Sprecherstimme rasend schnell und hoch, wie in alten Mickymaus-Filmen. Es ist nichts mehr zu verstehen. Bandsalat!
Ich drücke schnell die Stopptaste und fahre auf einen Parkplatz. Dort fische ich einen Kugelschreiber aus dem Handschuhfach und fädle das Kassettenband wieder ein. Gott sei Dank, es funktioniert wieder.
«God dat wi a woss ha. – Nice to have Springtime. – Schön, dass wir Frühling haben.»
Dad stammte von einer kleinen deutschen Insel namens Föhr, dort wurde diese seltene Sprache gesprochen. Wir hatten damals viel Besuch von Exil-Föhrern, von denen und von Dad habe ich mir einiges abgehört. Auch wenn nicht viel hängen geblieben ist, der Klang ist mir sofort wieder vertraut.
«Man dring, wat beest du brat wurdn», war der immer gleiche Spruch von Dads Freunden. «Mann, Junge, was bist du groß geworden!» Dabei bin ich seit meinem 15. Lebensjahr bei 1,80 Meter stehen geblieben. Das ist nun schon über fünfzig Jahre her, seitdem habe ich nicht mehr Fering gesprochen. Aber nun bin ich wild entschlossen, es aufzufrischen. Allein das harte «r» ist eine Herausforderung. Ich rolle es wie im Spanischen, ob das richtig ist?
Später lege ich noch mal die Beach Boys ein und singe jeden Titel laut mit. Die Außentemperatur steigt, und natürlich hat der Oldtimer keine Klimaanlage. Zusätzlich zum offenen Faltdach klappe ich die Ausstellfenster an der Fahrer- und Beifahrerseite auf, sodass ich mehr vom Fahrtwind abbekomme. Die Luft riecht nach Atlantik.
Bis zur äußersten Spitze von Long Island sind es gute 120 Meilen. Nach einer Weile durchfahre ich die «Hamptons». Hierhin verziehen sich die reichen New Yorker am Wochenende. In Southampton, East Hampton, Westhampton, Bridgehampton und Hampton Bays sieht es komplett anders aus als in New York. Die riesigen Villen sind makellos weiß, die Grundstücke um die Häuser riesengroß, die Straßen blitzsauber, Rasenflächen gestutzt, sämtliche Hecken perfekt geschnitten.
Kurz vor Montauk passiere ich die Pferderanch, die meinem Vater mal gehört hat. Wir hatten zwölf Pferde, die von uns liebevoll gepflegt und geritten wurden. Als es Anfang der Siebziger von Coney Island hierherging, war ich alles andere als begeistert. Montauk kam mir vor wie ein Kaff in der tiefsten Prärie, es lag viel zu weit von New York entfernt. Allein dass die Rolling Stones damals zufällig ihren Urlaub dort verbrachten, tröstete mich etwas.
Der eigentliche Ort Montauk mit seinen Ferienhäusern und den kleinen Geschäften beginnt ein, zwei Meilen hinter der Farm. Ich bin ewig nicht mehr hier gewesen, es hat sich einiges verändert. Der Name stammt von den Montaukett – Ureinwohnern, die eine faszinierende Kultur hatten. Mit einem Nachfahren jener Ureinwohner bin ich zur Highschool gegangen. Die Montauketts waren bekannt für die Herstellung von Perlenketten, die Frauen waren weise Ackerbäuerinnen, sie bauten Mais, Bohnen und Kürbis an.
Montauk ist damals wie heute ein Touristenort mit fantastischen Stränden. Hauptattraktion ist der Leuchtturm, der Tag und Nacht alle fünf Sekunden blinkt und dessen Licht 19 Seemeilen weit zu sehen ist. Als sein Vorgänger im 19. Jahrhundert erhöht werden sollte, waren die Anwohner strikt dagegen: Wenn vor Long Island keine Schiffe mehr verunglückten, konnten sie sie nicht ausrauben – wovon sollten sie dann leben? Er wurde trotzdem erhöht.
Sein Blinken war das Erste, was Einwanderer aus Europa von der Neuen Welt sahen, wenn sie nach der langen Schiffsreise über den Atlantik kamen. Insofern war das Montauk Lighthouse die Erfüllung eines Versprechens.
Heute regt sich kein Lüftchen, der Atlantik liegt still und unbeweglich da wie ein riesiger Spiegel. Ich parke meinen Käfer in der Nähe des East End Surf Clubs am Ditch Plains Beach. Auf dem Parkplatz ziehe ich meine Schuhe aus, schnalle meinen kleinen Rucksack über und schnappe mir meine geliebte Gitarre vom Rücksitz. Auf dem zerkratzten Korpus klebt ein halb abgerissener Aufkleber mit einem Peace-Zeichen. Für die echten Hippies waren wir zu jung, wir spielten am Strand aber gerne ihre Songs.
Barfuß wandere ich unterhalb der Steilküste auf den Leuchtturm zu. Diesen Weg sind wir wer weiß wie oft als Highschool-Clique gegangen, der Strand war unser zweites Zuhause. Hier habe ich das erste Mal ein Mädchen geküsst, Betsy Silberstein, die eine Zahnspange hatte. Nach dem College habe ich im Montauk Lighthouse als Angestellter der Coast Guard gearbeitet. Für mich war es der schönste Arbeitsplatz der Welt: Den ganzen Tag aufs offene Meer blicken, im Winter wie im Sommer, hatte etwas. Heute ist der Leuchtturm längst automatisiert.
Ich lege mich neben meine Gitarre auf den sonnenwarmen Sand und schließe die Augen. Winzige Wellen schwappen träge an die Strandkante, schmatzen kurz auf und laufen dann aus. Nach einer Pause schleicht sich die nächste Welle heran. Es ist der perfekte Ort, um zu entspannen. Bei mir klappt das leider nicht. Nach drei Stunden Fahrt erwischt mich hier dieselbe niederschmetternde Einsamkeit wie in meiner Wohnung. Dem Alleinsein kann ich nicht entfliehen, es findet mich überall. In Montauk kommen Erinnerungen an bessere Zeiten hoch, hier hatte ich einen guten Start ins Leben – was ist bloß im Lauf der Jahre passiert? Andererseits darf ich mich nicht beschweren, ich bin 67 Jahre alt, habe einen Job, der mir Spaß macht, und bin gesund. Es gibt wahrlich schlimmere Schicksale auf dieser Welt. Also Ärmel hoch, und weiter geht’s!
Ich stimme die Gitarre und singe ein Lied von Simon & Garfunkel, «The Sound of Silence». Warum ausgerechnet dieser Song, weiß ich nicht.
Irgendwann ziehe ich einen Zettel aus meinem Rucksack, darauf steht der Text eines Föhrer Liedes, quasi die Nationalhymne der Insel. Leider weiß ich nicht, wie die Melodie geht. Also singe ich das Fering einfach zu «The Sound of Silence».
Alhuar ik henkem üüb a eerd,
alhü uk het det lun:
at jaft dach man an ian eilun Feer,
det leit mi boowen uun.
An kaam ’k uk hen uun ’t lokelkst steed,
huar surgen goor ej wiar,
toocht ik dach äeder an uk leed
am di, min eilun Feer.
Wherever I go on this Earth,
whatever name a land may have
there’s only one Isle of Föhr,
that in my mind is best.
If I came upon the happiest place,
where worries don’t exist,
all the day from dawn till dusk I’d think
of you, my Isle of Föhr.
Beim Singen blicke ich auf den glitzernden Atlantik vor mir, den vertrauten Anblick aus meiner Jugendzeit – im Sommer genauso wie bei eisigen Winterstürmen. Aber egal, wie es kam, ich war immer draußen am Strand.
Der Himmel bezieht sich, es wird diesig. Auf der anderen Seite des Ozeans liegt dieses Feer Island, wo ich noch nie war. «Fööör» wird es auf Deutsch ausgesprochen. Ich muss das «Ö» noch oft üben, bis ich es einigermaßen akzentfrei hinbekomme. Eins steht jetzt schon fest: Die Reise zur Insel mit dem «Ö» wird das größte Abenteuer meines Lebens werden.
2
Der Wecker meldete sich mit nervtötendem Piepsen und riss Julia aus den tiefsten Träumen. Sie lag Haut an Haut mit ihrem Liebsten unter einer warmen Decke. Draußen rauschte der Meereswind, hinter der Gardine leuchtete die Morgensonne. Wenn sie aufstand, würde sich nichts an diesem Tag besser anfühlen als diese Nähe zu Finn-Ole – warum sollte sie sie aufgeben? Doch der Wecker blieb unbestechlich. Widerwillig beugte sie sich nach unten, sechs Uhr morgens war zu früh für alles auf der Welt. Leider stand das klingelnde Ding auf dem Holzfußboden, zu weit weg, um es mit ausgestrecktem Arm zu erreichen. Finn-Ole schlief derweil weiter, ohne sich einen Millimeter zu rühren. Beneidenswert. Einen Moment später passierte jedoch etwas Unerwartetes: Ohne Vorwarnung sprang er aus dem warmen Bett.
«Was ist?», murmelte sie.
«Wir müssen!»
«Aber nicht gleich!»
«Doch», antwortete er und legte sich noch einmal zu ihr unter die Decke. Seine dichten braunen Haare waren durcheinandergeraten, was sie sehr mochte.
Sie küsste ihn auf den Mund. «Komm, wir lassen heute alles ausfallen.»
«Deine Gästebetten werden um neun ins kleine Friesencafé geliefert, dann musst du da sein.»
Wie vernünftig.
«Du hast ja recht.»
Sie schaute sich im Raum um, irgendetwas war heute anders. Erst, als sie zum Fenster blickte, war es sogar hinter der Gardine zu erkennen: Das Morgenlicht draußen sah seltsam aus.
«Was ist das?», fragte sie. Sie konnte den Anblick nicht einordnen, er machte ihr Angst.
Auch Finn-Ole sah irritiert aus.
Sie standen auf und zogen vorsichtig die Vorhänge beiseite. Der Himmel leuchtete ockergelb, als sei das gewohnte Blau mit einem gelben Malerquast übertüncht worden. Sie zuckte zusammen, wie war das möglich? Es wirkte wie in einem Science-Fiction-Film.
«Gespenstisch», flüsterte Finn-Ole.
Julia kam es so vor, als ob die vertraute alte Erde untergegangen und durch eine neue ersetzt worden war.
Dann fiel es ihr wieder ein: «Saharastaub.»
«Stimmt», sagte er erleichtert. Gestern war im Wetterbericht angekündigt worden, dass Staubmassen aus der Saharawüste in einem riesigen Strom nach Norden geweht würden. Nun waren sie angekommen.
Die Zeit reichte gerade für eine Katzenwäsche und einen Kaffee, den Finn-Ole in der Einbauküche seines Ein-Zimmer-Feriendomizils aufsetzte. Er wohnte hier nur vorübergehend, weil er eine Vertretung auf dem Amrumer Amt übernommen hatte. Die dauerte nun allerdings schon ein halbes Jahr.
Dass Julia und er zurzeit auf verschiedenen Inseln wohnten, hatte ihrer Beziehung keinen Abbruch getan, es war sogar besonders reizvoll, wenn man sich dann endlich wiedersah. Trotzdem sehnten sie sich danach, endlich zusammen in Oldsum auf Föhr leben zu können. Zum Glück kam Finn-Ole jedes Wochenende herüber, immerhin war er Bürgermeister von Oldsum und musste sich um seine Gemeinde kümmern. Während seiner Abwesenheit schaute sie nach seinen Schafen, die am Deich grasten.
«Leg dich ruhig wieder hin», schlug sie vor, als sie bereits am Küchentisch saßen. «Ich kann alleine rüberwandern.»
«Auf keinen Fall.»
«Das habe ich aber schon mal gemacht.»
«Was riskant war.»
«Ach was.»
Er küsste sie auf die Wange. «Heute gehen wir zusammen nach Föhr, das habe ich versprochen, und das halte ich auch.»
Sie huschte ins kleine Bad und machte dort den Fehler, in den Spiegel zu schauen. Ihre Frisur sah aus wie ein Dschungel, die Augenringe waren nicht zu übersehen. Um sechs Uhr morgens konnte sie das nicht mit Gesten und Gerede überspielen, dafür war es einfach zu früh.
«Du hast total kleine Augen», stellte sie lächelnd fest, als sie zurück war.
«Ich möchte nicht uncharmant sein, aber das eint uns gerade.»
In Finn-Oles elektrischem Dienstgolf fuhren sie bis zur Wattkante im Norden der Insel. Reetdachhäuser und Wälder sahen in dem gelben Licht fremd aus. Auf der Straße war kein Auto zu sehen. Während der Fahrt fühlten sich ihre Augenlider an wie mit Blei beschwert.
An der Wattkante wurde Julia wach. Eine steife Brise aus Nordwest wehte dunkelgraue Wolken heran, ein starker Kontrast zum saharagelben Morgenhimmel. Die riesige Fläche vor ihr strahlte eine ungeheure Kraft aus. Menschen waren hier nur als flüchtige Gäste zwischen den Gezeiten geduldet. Das musste sie respektieren. Gegenüber lag ihre Heimatinsel Föhr, die Dünen von Utersum und Nieblum nahmen die Farbe des Himmels auf und leuchteten ihr ockerfarben entgegen.
«Kaum zu fassen, dass die Sahara jetzt schon bis zur Nordsee reicht», sagte Julia. «Wir sollten Kameltouren durchs Watt anbieten.»
Finn-Ole grinste. «Auf den landestypischen Friesenkamelen?»
«Mit denen veranstalten wir dann Rennen im Schlick.»
«Du, so bekloppt klingt das gar nicht.»
«Findest du?»
«Doch, es ist total abwegig.»
«Genau deswegen sollten wir darüber nachdenken!»
Julia checkte auf dem Handy die Wettervorhersage, der Wind würde eventuell bis auf sieben Stärken aufdrehen, Regen war nicht zu erwarten. Aber das war an der Nordsee nie sicher.
Sie zogen Schuhe und Strümpfe aus und verstauten sie in ihren Rucksäcken. Die Oberflächen der unzähligen Pfützen auf dem Meeresboden zitterten bei jeder Windböe, als würde gleich Glas zerspringen. Julia war im vergangenen Winter oft im Watt gewesen. Im Sommer wollte sie mit Feriengästen hinüber nach Amrum wandern – falls sie die Prüfung zur Wattführerin bestünde. Klaas, ihr Ausbilder, war Stammgast im kleinen Friesencafé und hielt Julia für genau die Richtige, um die Schönheit dieser einzigartigen Landschaft zu vermitteln. Julia selbst wollte einfach nur einen Ausgleich zur Routine im kleinen Friesencafé.
Genau genommen hatte ihre früh verstorbene Mutter den Grundstein für ihre Liebe zu der Insel gelegt, als sie auf Föhr zur Kur war. Da war Julia noch ein Kleinkind gewesen. Als Julia Jahrzehnte später die Föhrer Lieblingsorte ihrer Mutter anhand von deren Tagebuch aufsuchte, hatte sie Finn-Ole kennengelernt. Anfangs hatte sie ihn für einen Nerd gehalten, was vor allem wohl an seinem Siebzigerjahre-Trainingsanzug lag, den er häufig trug. Doch schon bald sah sie ein, dass sie sich getäuscht hatte. Finn-Ole war charmant und attraktiv.
«Alles dabei?», erkundigte er sich.
Sie zählte auf: «Kompass, Rettungsseil, Rettungsdecke, Erste-Hilfe-Ausrüstung, Uhr, Pfeife, Fernglas, Leuchtpistole und natürlich mein wasserdichtes Handy.»
Führungszeugnis, Erste-Hilfe-Schein, Schwimmer-Nachweis und Gesundheitspass hatte sie beim Amt vorgelegt, den Theorieteil für die Prüfung zur Wattführerin hatte sie bereits erfolgreich absolviert. Im Praxisteil sollte sie unter Aufsicht eines erfahrenen Wattführers eine ganze Gruppe begleiten. Das wollte sie vorweg zusammen mit Finn-Ole üben – ohne Publikum. Er war ebenfalls ausgebildeter Wattführer und konnte ihr Tipps für die Prüfung geben, die nächste Woche stattfinden würde.
Sie küssten sich kurz und betraten dann den feuchten, weichen Meeresboden, der sich am frühen Morgen kühl anfühlte. Unter dem gigantischen ockerfarbenen Himmel waren sie winzig kleine, zweibeinige Insekten auf einer riesigen leeren Fläche.
Finn-Ole nahm ihre Hand. Das Watt versetzte sie in eine Art Urzustand, ihre Gedanken verknüpften sich mit der Weite des Meeres und des Himmels. Wenn Alltagsärger hier nicht verflog, wurde er doch unbedeutend. Wie sagten die Insulaner? «Die Flut bringt’s, die Ebbe nimmt’s.» Diesen Rhythmus hätte sie sich für ihr sonstiges Leben gewünscht: Alle paar Stunden verschwand jedes Problem und wurde mit frischen Gedanken und Stimmungen überspült!
Kurz hinter Amrum mussten sie einen Priel durchqueren. Die Strömung war reißend, das Wasser ging aber nur bis zum Knie. Allerdings war es dermaßen eisig, dass es an den Beinen wehtat. Vor Prielen hatte Julia allergrößten Respekt, sie liefen oft bereits voll, wenn der restliche Meeresboden noch unbedeckt vom Wasser war. Im schlimmsten Fall schnitten sie einem den Weg zum sicheren Festland ab, was lebensgefährlich werden konnte.
Heute stimmten Wetter und Gezeiten. Trotzdem musste sie immer aufpassen. Das Watt war nicht der natürliche Lebensraum des Menschen. Mit Klaas hatte sie den genauen Weg abgesteckt, den er geprüft und für gut befunden hatte. Wich sie davon ab, konnte sie in gefährliche Schlammlöcher geraten. Darin versank man tief und kam ohne Hilfe nicht mehr heraus, das wurde von vielen unterschätzt.
«Du musst nächste Woche vor allem darauf achten, dass deine Gruppe zusammenbleibt», meinte Finn-Ole. «So eine Horde geht schneller auseinander, als du gucken kannst. Dann bekommen sie deine Anweisungen nicht mehr mit.»
Föhr lag als schmaler Streifen vor ihnen, Schritt für Schritt kamen sie der Insel näher. Sie sprachen beim Gehen wenig miteinander, tauchten zusammen ein in die prachtvolle Kulisse um sie herum. Die Wolken türmten sich vor ihnen auf, ein starker Nordwestwind blies ihnen entgegen und machte ihnen den Kopf frei. Leider waren sie viel zu schnell drüben, fand Julia.
«Wattführerprüfung bestanden», sagte Finn-Ole, «jedenfalls von mir aus.»
«Aber ich bin eine Frau», flüsterte sie.
«Habe ich das bezweifelt?»
«Anscheinend.» Sie sah ihn abwartend an.
Dann kam er von selbst drauf. «Ah, sorry, Wattführerinnenprüfung.»
Sie lachte. «So viel Zeit muss sein. Sonst erwarten die Leute einen Kerl wie Klaas, und das bin ich nun wirklich nicht.»
«Ja, kann man so sagen.»
Wattführerinnen waren immer noch selten auf der Insel, warum auch immer.
«Und was steht heute bei dir an – außer Betten für das Hochzeitsfest in Empfang nehmen?», fragte er.
«Das leere Haus gegenüber vom Friesencafé für die Gäste einrichten», antwortete sie. «Bis zu Anitas und Harks großem Tag muss alles fertig sein.» Sie freute sich, dass ihre Oma sie mit den Hochzeitsvorbereitungen betraut hatte.
«Frühstück gibt es dann im Garten des kleinen Friesencafés?»
«So stelle ich mir das vor.»
«Klingt gut.»
Julia schaute auf ihre Uhr. «Wenn du zurück nach Amrum willst, musst du los.»
Er grinste. «Willst du mich loswerden, oder was?»
«Im Gegenteil, ich bin nur besorgt wegen der Tide.»
Sie küssten sich innig.
«Es war wunderschön mit dir», flüsterte sie.
«Dito», antwortete er. «Außerdem warst du mir eine gute Wattführerin.»
«Der Priel vor Amrum läuft jede Sekunde weiter voll. Willst du nicht doch die Fähre nehmen?»
Finn-Ole dachte kurz nach. «Nee, das haut gerade noch hin.»
«Dann los – und im Notfall rufst du mich an, ja?»
«Nicht nur im Notfall.»
«Dann ist ja gut.»
Sie küssten sich noch einmal, dann drehte er sich um und wanderte mit großen Schritten zurück nach Amrum. Sie schaute ihm einen Moment lang nach. Dann machte sie sich auf den Weg.
Eine gute Dreiviertelstunde später ging Julia am Ortsschild von Oldsum vorbei. Unter dem Saharahimmel sah das kleine Inseldorf aus wie ein Gemälde. Früher war Oldsum ein Bauerndorf gewesen, bei vielen Häusern waren noch die ehemaligen Scheunen zu erkennen. Über dem Ort lag die gewohnte tiefe Ruhe, Julia hörte nur den Wind. Inzwischen arbeitete und lebte sie seit über einem halben Jahr hier, die Insel fühlte sich so vertraut an, als hätte sie nie woanders gelebt. Sie ging durch die Gassen und Straßen in Richtung ihres kleinen Friesencafés.
Der Himmel bezog sich, es fing an zu regnen. Als Allererstes würde sie sich auf der besten aller Kaffeemaschinen, ihrer italienischen Scala, einen Caffè Crema zubereiten. Julia liebte die ehemalige Scheune, in der das Friesencafé seinen Sitz hatte, mit den alten Dachbalken, den Bodendielen und den unverputzten Wänden, an denen selbstgemalte Bilder von ihr hingen. Sie zeigten die Föhrer Lieblingsorte ihrer verstorbenen Mutter: das Meer bei Sonnenschein und Regen, Lichtstimmungen in der Marsch, den Tanz eines kleinen Mädchens in der Wyker Kurmuschel, Kitesurfer, die hoch in den Himmel flogen. Die alten Tische und Caféstühle hatte Julias Oma Anita als junge Frau in Paris ersteigert und sie zur Eröffnung höchstpersönlich hierhergebracht. Ein Hauch französisches Flair stand der friesischen Insel gut, fand sie. «Auf diesen Stühlen haben schon Romy Schneider und Alain Delon miteinander geflirtet», behauptete sie immer – wer wollte das bezweifeln?
Als sie ankam, rief Julia als Erstes Finn-Ole an.
«Alles klar bei dir?»
«Ja, ich bin fast drüben.»
Das wertete Julia noch nicht als Entwarnung.
«Wie weit ist ‹fast›?»
«Der Priel liegt hinter mir.»
Das klang gut!
«Und der Regen?»
Selbst ein kleiner Schauer konnte einem im Wattenmeer bei starkem Wind heftig zusetzen, weil es nirgends Schutz gab.
«Hier regnet es nicht.»
«Hey, Glück gehabt, pass weiter auf dich auf.»
«Sowieso.»
Erleichtert legte sie auf.
Für sie stand gleich erst einmal Geschleppe an. Vom Festland sollten Matratzen geliefert werden, die ins leer stehende Nachbarhaus getragen werden mussten. Darauf sollten die Hochzeitsgäste von Anita und Hark nächtigen.
Inzwischen hatte Julia in ihrem kleinen Friesencafé einige Feste ausgerichtet, aber die Hochzeit ihrer «Omma» Anita mit Kapitän Hark sollte die schönste Feier aller Zeiten werden. Die beiden hatten sich letztes Jahr im zarten Alter von 67 kennengelernt und waren schwer verliebt. Vielleicht konnte Julia ihrer Oma ein bisschen etwas von dem wiedergeben, was sie für sie getan hatte. Nach dem frühen Tod von Julias Mutter hatte Anita ihre Enkelin bei sich aufgenommen und großgezogen. Ohne sie wäre Julia nicht der Mensch, der sie heute war!
Sie schaute durchs Fenster auf die Allee vor dem Café. Dort sah es erstaunlicherweise aus wie immer. Der erwartete Lastwagen vom Festland fehlte, dabei hätte die Lieferung über die Morgenfähre längst da sein sollen. Sie schnappte sich ihr Handy und rief den Möbelhändler an.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: