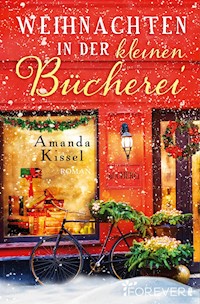4,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Eine lang vermisste Schwester und eine zauberhafte Liebesgeschichte: »Das kleine Schloss am Weinberg« von Amanda Kissel als eBook bei dotbooks. Die Redakteurin Patricia Marold steht vor den Scherben ihrer Karriere, da muss sie erfahren, dass ihre Mutter einen Unfall hatte. Voller Sorge kehrt sie heim in das malerische kleine Schlösschen am Weinberg. Der Lebensgefährte ihrer Mutter und Schlossherr Henri von Wagenfeld empfängt sie mit offenen Armen. Doch auch er weiß keinen Rat, wie sie ihrer Mutter den langgehegten Wunsch erfüllen soll, die vor Jahren verschollene Beatrice wiederzusehen, Patricias Schwester. Dafür hat der charmante Leander, der im Café seines Vaters aushilft, gleich die erste zündende Idee. Mit seiner Hilfe – und vielleicht ein bisschen verräterischem Herzklopfen – macht sie sich auf eine emotionale Suche ... Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der Familiengeheimnisroman »Das kleine Schloss am Weinberg« von Bestsellerautorin Amanda Kissel ist ein Wohlfühlbuch, das Fans von Manuela Inusa und Julie Caplin begeistern wird. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 418
Ähnliche
Über dieses Buch:
Die Redakteurin Patricia Marold steht vor den Scherben ihrer Karriere, da muss sie erfahren, dass ihre Mutter einen Unfall hatte. Voller Sorge kehrt sie heim in das malerische kleine Schlösschen am Weinberg. Der Lebensgefährte ihrer Mutter und Schlossherr Henri von Wagenfeld empfängt sie mit offenen Armen. Doch auch er weiß keinen Rat, wie sie ihrer Mutter den langgehegten Wunsch erfüllen soll, die vor Jahren verschollene Beatrice wiederzusehen, Patricias Schwester. Dafür hat der charmante Leander, der im Café seines Vaters aushilft, gleich die erste zündende Idee. Mit seiner Hilfe – und vielleicht ein bisschen verräterischem Herzklopfen – macht sie sich auf eine emotionale Suche ...
Über die Autorin:
Amanda Kissel wurde in Neustadt an der Weinstraße geboren und arbeitet als Schulleiterin. Mit ihrem Mann und drei Kindern lebt sie mitten im Pfälzerwald.
Amanda Kissel veröffentlichte bei dotbooks bereits »Das kleine Haus am Wald«, »Sommer im kleinen Haus am Wald«, »Kaktusblütenzeit« und »Das kleine Schloss am Weinberg«.
Die Weihnachtsgeschichte »Weihnachten im kleinen Haus am Wald – oder: Der Wunschzettel«, die nach »Sommer im kleinen Haus am Wald« spielt, ist in der Anthologie »Kerzenschein und Schneegestöber« erschienen.
»Das kleine Haus am Wald« erscheint auch im gemischten Sammelband »Das kleine Haus in der Heide & Das Cottage in Seagrove Bay & Das kleine Haus am Wald«.
***
Originalausgabe Oktober 2024
Copyright © der Originalausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Redaktion: Ralf Reiter
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ae)
ISBN 978-3-98952-421-7
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Amanda Kissel
Das kleine Schloss am Weinberg
Roman
dotbooks.
Kapitel 1
Mildes Morgenlicht fiel durch die staubigen Fenster des Lagerraums und ließ die Spinnweben in den Ecken glitzern. Eben noch hatte Patricia, die sich auf der nackten Matratze unter der Wolldecke zusammengerollt hatte wie eine Katze, wild geträumt, nun wurde sie durch ein sachtes Klopfen gegen die Tür aus dem Schlaf gerissen.
»Bonjour, Madame, hier kommt Ihr Kaffee.« Elian, der seine übliche Kluft aus abgetragenen Jeans und stylishem Hemd trug – heute aus minzgrünem, mit rosa Flamingos bedrucktem Stoff –, trat mit einer riesigen Tasse herein, der Dampfwolken entstiegen. Vorsichtig bahnte er sich seinen Weg an den hüfthohen Stapeln noch in Folie eingeschweißter Bücher und ungeöffneten Kartons vorbei, bevor er sich neben sie auf die Matratze plumpsen ließ.
»Du bist ein Engel.« Patricia strich sich das zimtbraune, kinnlange Haar aus dem Gesicht und griff nach der Tasse. »Ohne den Koffeinschub, den du mir jeden Morgen bringst, wäre ich zu nichts nütze. Na ja, bin ich ja sowieso nicht.« Sie pustete über den Milchschaum und ließ den Blick missmutig durch den unordentlichen Lagerraum schweifen.
»Sei nicht albern, Chérie.« Elian legte ihr den Arm um die Schultern. »Es ist nicht deine Schuld, dass dich Mademoiselle Papillon entlassen hat. Im Grunde hat sie das gar nicht, dein Vertrag lief einfach aus, denn eine Schwangerschaftsvertretung ist nun einmal zeitlich begrenzt, das liegt in der Natur der Dinge.«
Patricia seufzte und blätterte durch einen französischen ChickLit-Roman, der neben ihrer Matratze lag. »Vielleicht fanden sie mich in der Redaktion auch einfach zu bieder und altbacken für eine Pariser Modejournalistin. Wahrscheinlich sieht man mir auf hundert Meter Entfernung an, dass ich ein Landei aus einer kleinen deutschen Kurstadt bin.«
»Unsinn.« Elian schnalzte ungeduldig mit der Zunge. »Du könntest glatt auf dem Titel der Mademoiselle Papillon als Model posieren mit deinem makellosen Teint, den seidigen braunen Haaren und den grasgrünen Augen.«
»Na ja, als Model fühle ich mich nicht gerade.« Sie sah an ihrem grauen T-Shirt mit der Aufschrift Yippie Yaygay – Elian hatte es ihr großzügig überlassen – und der abgewetzten Jogginghose herab.
»Du darfst dich nicht gehen lassen«, sagte Elian streng und musterte sie. An ihm selbst saß jedes Härchen der hochgegelten blonden Frisur. »Vielleicht möchtest du dich mal wieder waschen, Chérie? Und etwas Lippenstift würde dir auch gut zu Gesicht stehen …«
Patricia stieß ihm gespielt gekränkt den Ellenbogen in die Rippen. »Ja, ich habe verstanden. Keine Angst, ich muss mich heute sowieso aufbrezeln. Ich möchte mich nachher bei der Redaktion von Chic et Charme vorstellen.«
»Du hast ein Vorstellungsgespräch ergattert?« Elian drückte sie so begeistert an sich, dass sie einen Moment kaum Luft bekam.
»Das nun nicht gerade.« Patricia machte sich von ihm frei und brachte die Kaffeetasse in Sicherheit. »Ich gehe auf gut Glück vorbei. Vielleicht suchen sie tatsächlich jemanden. Ich würde jeden Job annehmen, ich würde auch einfache Hilfsdienste akzeptieren oder den Redakteurinnen Kaffee kochen oder hinter den Models herputzen … Alles, um in Paris bleiben zu können.«
Elian seufzte theatralisch. »Ich könnte mir ein Leben ohne dich als heimliche Bewohnerin unseres Lagers nicht mehr vorstellen. Das ist so romanesk.«
Patricia stand mühsam auf und rieb sich die Gliedmaßen, die von der Nacht auf der steinharten Matratze ganz steif waren, dann schlängelte sie sich an den riesigen, ungeöffneten Paketen mit Büchernachschub durch und griff nach ihrem dunkelblauen Hosenanzug, der auf einem Bügel an einem einfachen Regal hing, auf dem sich Ladenhüter stapelten.
Auch Elian erhob sich und griff nach der leeren Tasse. »Ich wünsche dir viel Glück! Und kannst du die Buchhandlung durch den Hinterausgang verlassen? Papa ist heute hier und … ähm, du weißt ja, unser kleines Wohnarrangement würde ihm mit Sicherheit nicht gefallen, wenn er davon wüsste …«
Patricia, die eine Staubfluse von ihrem Hosenanzug wischte, die wie eine angegraute Schneeflocke darauf haftete, fiel in sich zusammen. »Ich bin dir so dankbar, dass du mich in eurem Buchladen wohnen lässt … Wenn ich doch nur die Miete für mein Apartment noch ein bisschen länger hätte bezahlen können! Ich möchte nicht, dass dein Vater sauer auf dich ist, wenn er herausfindet, dass ich hier kampiere.«
»Darüber mach dir keine Sorgen, er wird es schon nicht bemerken, er ist ja meistens in der Filiale in der Rue de la Bécherie. Ach, und heute Abend habe ich ein Rendezvous mit Jean-Pierre. Dem Ernährungsberater, von dem ich dir erzählt habe, erinnerst du dich? Willst du dich uns anschließen und etwas essen gehen?«
Patricia lächelte wehmütig. »Nein, ich würde nur stören bei eurem romantischen Abend.« Die Vorstellung, einen weiteren Abend allein in dem dunklen Laden zu verbringen, behagte ihr nicht. Aber wohin sollte sie sonst? Zumindest hatte sie hier genügend Lesestoff. In den zwei Wochen, die sie seit Auslaufen ihres Zeitvertrags in der Buchhandlung logierte, hatte sie so viele Bücher gelesen – querbeet, von Familiensagas über Psychothriller bis hin zu Liebesromanen –, dass sie den Eindruck hatte, ihr ohnehin einwandfreies Französisch habe sich noch einmal ordentlich verbessert.
»Wir sehen uns später, Chérie.« Elian sah sie mit seinen braunen Augen treuherzig an und küsste sie wie ein großer Bruder auf beide Wangen. »Und hübsch dich auf für dein Gespräch bei Chic et Charme! Im Mitarbeiterbad müsste noch lila Eyeliner von mir rumliegen, den darfst du großzügig benutzen.«
»Der ist mir ein bisschen zu bunt.« Sie lächelte schief, verabschiedete sich von Elian, der den Verkaufsraum ansteuerte, entledigte sich ihrer Schlafsachen – sie mussten dringend mal wieder gewaschen werden, aber sie wollte Elian nicht auch noch mit ihrer Schmutzwäsche behelligen – und schlüpfte in ihren Hosenanzug, den sie meistens zur Arbeit bei Mademoiselle Papillon getragen hatte. Das T-Shirt und die Jogginghose stopfte sie in eine Tüte, vielleicht konnte sie nach der Vorstellungsrunde bei dem Magazin einen Waschsalon aufsuchen.
In dem winzigen Bad mit der trüben Deckenbeleuchtung kämmte sie sich die Haare und tupfte ein bisschen von Elians himbeerrotem Lipgloss auf die Lippen; zum Glück hortete der Freund hier genug Bürsten, Puderquasten und andere Beauty-Utensilien, dass sie die Spuren der unbequemen Nacht ausradieren konnte und sich nicht mehr wie eine müde alte Frau fühlte, sondern halbwegs wie die Neunundzwanzigjährige, die sie war.
»Ich muss einfach einen neuen Job bekommen«, flüsterte sie ihrem Spiegelbild auf Deutsch zu und starrte sich im Halbdunkeln in die grünen Augen. Sie hatte so hart dafür gekämpft, den temporären Job bei Mademoiselle Papillon zu bekommen, in Deutschland ihre Wohnung und die Stelle bei einer kleinen Frauenzeitschrift aufgegeben, dass es ihr ein Loch ins Herz reißen würde, wenn sie ihre Traumstadt Paris wieder verlassen müsste. Sie käme sich wie eine Versagerin vor, jemand, der es nicht geschafft hatte, sich in der Metropole an der Seine ein kleines Fleckchen zu erobern, an dem sie bleiben konnte. Ein Vogel, der kein Nest besaß.
In der Métro, die wie immer überfüllt war, hielt sie sich mit der einen Hand am Haltegriff fest, mit der anderen umklammerte sie ihre edle kirschrote Longchamps-Tasche, die vor einiger Zeit bei einem Modeshooting in der Redaktion übrig geblieben war und die sie hatte behalten dürfen. Es war oberflächlich, sich in solcherlei Luxusgegenstände zu verlieben, auf der anderen Seite war die Tasche praktisch genug, um ihre Mappe mit den Bewerbungsunterlagen darin zu verstauen. Elegante Stadthäuser mit schmalen Fassaden, uralte, groß gewachsene Bäume, durch deren Blätterdächer die Maisonne blinzelte, Banken und Geschäfte in noblen Gebäuden flogen kurz an den Fenstern vorüber, dann tauchte die Bahn wieder wie ein Wurm in die Finsternis des Untergrunds ein. An der Station Richelieu-Drouot stieg sie aus und kämpfte sich im Gewimmel schick gekleideter Pariser und lässiger Touristen, die ihre Handykameras in alle Richtungen hielten, die Treppen hoch und den Boulevard Haussmann entlang, bis sie vor dem Gebäude stand, in dem das Modemagazin Chic et Charme untergebracht war. Ehrfürchtig sah sie an dem stattlichen, neoklassischen Haus hoch, das sieben Etagen beherbergte. Das zweite und fünfte Stockwerk wurde von einem durchgehenden Balkon umgeben, begrenzt von zierlichen Metallgeländern.
Neben der hohen Flügeltür am Eingang waren die Namen der ansässigen Firmen und Gesellschaften in goldene Plaketten eingraviert.
Alles wirkte so vornehm und erhaben, dass ihr der Mut sank. Was sollte sie hier? Die Chancen, hereinzuschneien und einen Job angeboten zu bekommen, standen bei null. Außerdem war sie keines dieser Pariser Geschöpfe, die aus jeder Pore Nonchalance verströmten; sie hatte sich die letzten Monate sehr bemüht, ihre deutsche Kleinstadt-Aura abzustreifen wie eine alte Haut und großstädtisch unterkühlt zu wirken. Vielleicht hätte sie sich bei Starbucks einen Soja Latte kaufen und vor sich hertragen sollen, um ganz unbeschwert daherzukommen, allerdings tat sie gut daran, unnötige Ausgaben zu vermeiden.
Nachdem sie durch die Tür getreten war, entdeckte sie einen Concierge in einem dämmrigen Verschlag. Seine schwarze Uniform mit der Schiebermütze wirkte so altmodisch, dass es schon kultig war.
»Chic et Charme? Im fünften Stock«, erklärte er, nachdem sie ihm mehrmals laut zu verstehen gegeben hatte, was sie herführte. An ihrem Französisch konnte es nicht liegen, dass er auf dem Schlauch stand. Bestimmt war er schwerhörig.
In dem ruckelnden Aufzug fuhr sie nach oben und wurde mitten in der Moderedaktion ausgespuckt. Es herrschte ein so buntes Treiben, dass sie erst einmal an die Wand gedrückt stehen blieb und sich eingeschüchtert umsah. Mitarbeiterinnen mit sehr dunkelrotem Lippenstift, ausnahmslos alle in Schwarz gekleidet, eilten durch die Gänge, riefen ihren Assistentinnen Anweisungen zu oder scheuchten Models vor sich her. Eine Mischung aus exklusiven Parfums schwebte wie eine Regenwolke durch die Etage. Patricia stockte der Atem, als sie einen Blick aus einem Fenster erhaschte und auf die in der Sonne glänzenden Dächer des Viertels sah, die wie mit flüssigem Gold überzogen wirkten. Hier zu arbeiten wäre ein Traum.
»Bonjour, entschuldigen Sie …« Kurz entschlossen ging sie ein paar Schritte den Gang entlang, ihre Tasche an sich gepresst. Doch niemand schien sie zu hören, alle waren vollkommen mit ihren eigenen Angelegenheiten beschäftigt.
»Ich suche die Chefredakteurin …«, sprach sie mit fast verzweifeltem Mut ein junges Mädchen mit tiefschwarz gefärbtem Bob an, das einen Kleiderständer auf Rollen vor sich herschob. Er war mit Abendkleidern aus Seide und Satin behängt, Pailletten und winzige Schmucksteine funkelten, dass es Patricia blendete.
»Mhm?« Ehe sie sichs versah, war ihr das Mädchen mit den Rollen des Ständers über die Schuhe gefahren.
»Autsch!« Patricia zuckte zusammen vor Schmerz, verlor das Gleichgewicht und versuchte, sich an dem Ständer abzustützen, der daraufhin ein Stück wegrollte. Noch immer die behängte Kleiderstange umklammernd, stürzte sie nach vorne und fiel geradewegs in die teuren Abendkleider hinein.
»Madame!« Entrüstet jagte die junge Angestellte dem Kleiderständer hinterher und klaubte die Roben zusammen, die Patricia von den Bügeln gerissen hatte. Mit brennendem Gesicht tauchte diese zwischen den Stoffen auf und versuchte zu retten, was zu retten war. Mit zitternden Händen hob sie die Kleider auf, aber das Mädchen riss sie ihr aus den Fingern.
»Mon Dieu!« Fassungslose Rufe erschollen von ringsum, mehrere Frauen gesellten sich nun um sie und betrachteten das Spektakel, das sie unfreiwillig abgab, mit unverhohlener Abscheu. »Wer sind Sie und was tun Sie hier?«
Patricia hängte sich ihre Longchamps-Tasche über die Schulter, die ihr im Eifer des Gefechts heruntergefallen war, und strich atemlos den Hosenanzug sowie die in Unordnung geratenen Haare glatt. Selten hatte sie sich so geschämt wie gerade jetzt und sich noch dazu so fehl am Platz gefühlt. Es war eine Schnapsidee gewesen, sich initiativ bei der Zeitschrift vorzustellen, völlig lächerlich. »Ich würde gerne kurz die Chefredakteurin sprechen«, stammelte sie und wünschte, ihre hummerroten Wangen würden allmählich wieder ihre normale Farbe annehmen.
»Das wäre dann ich«, ließ sich eine Stimme von der anderen Seite des Kleiderständers, jenseits der Abendkleider, vernehmen. »Marie-France de Chantillon. Was wünschen Sie? Einen bemerkenswerten Auftritt haben Sie da hingelegt, das muss ich Ihnen lassen.«
»Verzeihung, das war keine Absicht«, murmelte Patricia und umrundete den Kleiderständer, um die Chefredakteurin nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen. Doch diese kam ihr ebenfalls entgegen, und wenn sie nicht abrupt gestoppt hätte, wären sie ineinander gerannt.
»Das wäre ja noch schöner«, sagte Marie-France de Chantillon, eine überaus grazile Dame jenseits der fünfzig, die ein kleines Schwarzes und eine dezente Perlenkette trug. Sie roch betörend nach einem exotisch zitronigen Duft. Ihre heisere Stimme klang zugleich belustigt und kühl. »An die Arbeit, Mädchen, die Show ist zu Ende.«
Die Angestellten zerstreuten sich, und Patricia blieb mit Madame de Chantillon allein zurück. »Was führt Sie her, meine Liebe?«
Ermutigt von der unerwartet freundlichen Anrede, sprudelten die Sätze, die sie sich zurechtgelegt hatte, aus ihr hervor. »Mein Name ist Patricia Marold. Ich habe Mode und Journalistik studiert – ich habe in Deutschland viele Jahre lang für eine Zeitung gearbeitet, danach hatte ich in Paris einen Zeitvertrag bei Magdalène. Zuletzt war ich als Schwangerschaftsvertretung bei Madame Papillon tätig. Ich suche eine neue Beschäftigung und möchte nachfragen, ob es bei Ihnen offene Stellen gibt.«
Als was auch immer, fügte sie in Gedanken hinzu. Wenn jemand vonnöten ist, der noch mehr Kleiderständer durch die Flure schiebt, dann bin ich euer Mann, beziehungsweise eure Frau.
Die Chefredakteurin legte bedauernd den Kopf schief. »Leider nicht, meine Gute. Alle Stellen sind besetzt, Sie haben sich umsonst herbemüht.«
»Brauchen Sie auch keine Assistentin oder Hilfskraft oder …« Fieberhaft überlegte Patricia, was sie noch anbieten konnte. Sie gab bestimmt ein erbärmliches Bild ab, aber sie brauchte so dringend Arbeit! Was sollte sonst aus ihr werden? Sie konnte nicht für alle Ewigkeit im Hinterraum der Buchhandlung wohnen, sich in der Mitarbeitertoilette notdürftig waschen und sich in Acht nehmen, nicht von Elians Vater erwischt zu werden, der sie sicherlich hochkant rausschmeißen würde. »Ich könnte die Kleider der Models bügeln oder die Requisiten aufräumen, die für Fotoshootings gebraucht werden …«
Bügeln? Aufräumen? Erneut lief sie rot an. Konnte sie noch tiefer sinken?
Marie-France de Chantillon lächelte unergründlich. »Nun ja, engagiert wirken Sie zumindest mal. Bedaure, wir brauchen wirklich niemanden. Aber begleiten Sie mich kurz zu meiner Sekretärin, sie kann sich mal Ihren Namen und Ihre Telefonnummer notieren.«
Niedergeschlagen trat sie hinaus auf die Straße; das geschäftige Treiben des Pariser Vormittags und das Summen des Verkehrslärms rauschten ihr in den Ohren. Wohin sollte sie nun? Sie musste noch viele Stunden totschlagen, bis sie sich wieder in den Lagerraum des Buchladens schleichen konnte, ohne von Elians Vater oder einem Mitarbeiter entdeckt zu werden. Plötzlich überkam sie eine solch heftige Sehnsucht nach ihrem Ein-Zimmer-Apartment in Montmartre, das sie für die Zeit der Schwangerschaftsvertretung gemietet hatte, dass sich ihr Magen schmerzhaft verknotete. Elian hatte es zwar geringschätzig Bruchbude genannt, aber sie hatte sich dort so zu Hause gefühlt wie eine Raupe in ihrem Kokon. Die Farbe war von den Wänden geblättert, die Armaturen waren verrostet, und es war so winzig, dass kaum mehr als ein Bett, ein kleiner Tisch und ein Herd hineingepasst hatten, aber das Fenster aus morschem Holz hatte den Blick auf die dreitausend Quadratmeter des Weinbergs Montmartre freigegeben, eine malerische Aussicht wie auf einem impressionistischen Gemälde mit Grüntupfern in allen Schattierungen. Wenn die Reben abends mit der Dämmerung verschwammen, erinnerte sie dies stets an ihre deutsche Heimat, denn sie stammte aus einem großen Weinbaugebiet.
Genug, ermahnte sie sich, es nützte nichts, Trübsal zu blasen, sie musste nach vorne schauen. Aus ihrer Handtasche ertönte der Signalton ihres Smartphones, und sie blieb rasch unter dem Art-déco-Kandelaber der U-Bahn-Station Richelieu-Drouot stehen, um zu sehen, wer sich bei ihr meldete. Seit sie ihre Arbeit verloren hatte, gingen kaum noch Nachrichten auf ihrem Handy ein.
Wie geht es dir? Du hast lange nichts mehr von dir hören lassen. Melde dich doch mal wieder. Mama. Seufzend steckte Patricia das Smartphone zurück in die Tasche und trat rasch zur Seite, um nicht von einem Schwung der Métro entgegeneilender Menschen umgerissen zu werden. Sie hatte es noch nicht über sich gebracht, ihrer Mutter Petra zu berichten, dass sie noch keine neue Stelle gefunden hatte. Petra hatte sie bei ihren Berufswünschen zwar stets unterstützt, aber bestimmt würde sie sie schnurstracks nach Hause ins Blumental beordern, wenn sie erfuhr, dass sie praktisch auf der Straße stand. Vielleicht wäre das ohnehin das Schlaueste. Sie würde ihrer Mutter heute Abend zurückschreiben, wenn sie die nötige Ruhe fand.
Patricia gab sich einen Ruck und lief im Strom der Menschen die Treppen zur Métro hinunter. Nein, noch würde sie sich nicht geschlagen geben. Wie die ganze letzte Woche würde sie zum Quai François Mauriac fahren, um sich dort in der Bibliothèque Nationale de France in einem stillen Eckchen an einen Computer zu setzen und nach freien Stellen zu recherchieren. Froh, einen Plan zu haben, machte sie sich auf den Weg.
Am Abend verließ sie ihren zeitweiligen Unterschlupf, kaufte sich eine Crêpe mit Apfelmus – sie musste wirklich mit ihrem Geld haushalten – und kehrte müde und sich verschwitzt fühlend in die Buchhandlung zurück. Was gäbe sie für ein schönes, heißes Schaumbad! Doch sie musste sich auch heute wieder mit dem Waschbecken in Elians Mitarbeitertoilette begnügen. Elians Vater schien nicht zugegen, und auch Louise, Elians Kollegin, war nirgends mehr zu sehen, so konnte sie unbemerkt in den Lagerraum huschen.
Nur Minuten später kam Elian zu ihr, die Neugier stand ihm wie immer ins Gesicht geschrieben. »Na, wie war es? Haben sie dich gleich als stellvertretende Chefredakteurin eingestellt?«
Patricia hängte ihren Hosenanzug auf den Kleiderbügel, um in eine Leggings und ein T-Shirt zu schlüpfen. Die Jogginghose und Elians Yippieh Yaygay-Shirt lagen noch immer in der Tüte auf der Matratze, sie hatte vergessen, beim Waschsalon vorbeizugehen. »Spar dir die Witze. Du weißt doch, dass die Chancen, einen Job bei Chic et Charme zu bekommen, sehr begrenzt waren, um nicht zu sagen, nicht existent.«
»Ach, du Armes.« Elian hielt ihr einen hohen Becher mit einem dickflüssigen bonbonrosa Getränk hin. »Trink das, Chérie, das wird dir guttun.«
»Ein Smoothie?« Dankbar nahm Patricia den Becher entgegen und sog am Strohhalm. Plötzlich merkte sie, dass sie nach der Crêpe und der Banane noch immer ein Loch im Magen zu haben schien – kein Wunder, war dies doch das Einzige, was sie heute gegessen hatte. »Du verwöhnst mich.«
»Ich wette, du hast heute entweder gar nichts oder nur leere Kalorien zu dir genommen, so wie immer«, sagte Elian streng und setzte sich auf eine Bücherkiste. »Jemand muss auf dich und deine Ernährung achten.«
»Ich habe immerhin eine Banane gegessen. Seit du mit Jean-Pierre angebandelt hast, entwickelst du dich zum Gesundheitsapostel.« Patricia schmunzelte, sog noch einmal gierig an dem Smoothie und ließ sich dann auf die Matratze nieder, froh, ihre Füße, die von den vielen Stunden in den engen Pumps wehtaten, massieren zu können. »Aber ich beschwere mich nicht, ich profitiere ja auch davon.«
»Also konnten sie dir bei der Zeitschrift nicht weiterhelfen?«
Patricia schüttelte traurig den Kopf. »Nein. Ich durfte meine Kontaktdaten hinterlegen, aber das wohl nur, weil die Chefredakteurin Mitleid mit mir hatte. Nach meinem Besuch in der Redaktion bin ich in die Bibliothèque Nationale und habe nach Stellenangeboten gegoogelt. In meiner Branche gibt es natürlich rein gar nichts, deshalb überlege ich, ob ich nicht kellnern soll oder dergleichen.«
»Kellnern?« Elian schaute sie so entsetzt an, als habe sie vorgeschlagen, die verdreckten Wände der Métro-Stationen mit der Zahnbürste zu schrubben. »Das liegt dir doch gar nicht, Chérie. Anders als in einem hübschen Etuikleid hinter einem Schreibtisch kann ich mir dich nicht vorstellen.«
»Ach was, ich habe früher immer von einem eigenen Café geträumt. Das würde schon passen. In meiner Heimatstadt hatte ich ein Stammcafé, die Zuckerschnute. Es sah aus wie ein gemütliches Wohnzimmer, lauter durchgesessene Sofas und Ohrensessel wie aus Großmutters Zeiten und Regalbretter mit Spielen und zerfledderten Büchern. Wie gesagt, war es ein Traum von mir, auch einmal ein solches Lokal zu besitzen. In einem Café zu bedienen, kommt dem doch ein bisschen nahe.«
Elian schüttelte den Kopf, als sei sie geistig nicht ganz auf der Höhe. »Du hast aber viele Träume – Karriere bei einer Modezeitschrift machen, ein Café betreiben …«
Geräuschvoll sog Patricia den letzten Tropfen aus ihrem Smoothie-Becher. »Du willst doch auch nicht nur den Buchladen betreiben, du wünschst dir doch nichts sehnlicher, als einen großen Gesellschaftsroman zu schreiben …«
»Und das werde ich eines Tages schaffen.« Elian lächelte verschmitzt. »Verlass dich drauf. Ist das dein Handy, das piept? Welch schrecklicher Signalton, wie ein Frosch, der quakt.«
»Oh.« Patricia zog ihre Longchamps-Tasche zu sich heran und angelte nach dem Smartphone. Sie hatte vollkommen vergessen, sich bei ihrer Mutter zu melden, wahrscheinlich machte die sich inzwischen Sorgen. Aber als sie auf das Display des Handys starrte, sah sie, dass es Henri von Wagenfeld war, der mittlerweile achtmal angerufen und Nachrichten geschickt hatte. Warum hatte sie nicht daran gedacht, das Handy nach Verlassen der Bibliothek wieder auf laut zu stellen? Ein ungutes Gefühl machte sich in ihr breit. Es musste etwas geschehen sein, sonst würde Henri sich nicht so oft hintereinander melden.
»Henri hat versucht, mich zu erreichen«, erklärte sie Elian knapp und wählte mit zitternden Fingern die deutsche Nummer.
»Graf Henri von Wagenfeld, der Freund deiner Mutter?« Elian ließ sich den Namen genüsslich auf der Zunge zergehen, er liebte alles, was mit Adel, Prunk und Protz zu tun hatte. Wobei er da bei Henri natürlich schief gewickelt war, fehlte bei ihm das Geld doch an allen Ecken und Enden.
»Patricia?«, erklang nach Sekunden Henris unnatürlich angespannte Stimme aus dem Gerät. »Ich versuche seit Stunden, dich zu erreichen. Petra hatte einen schrecklichen Unfall, du musst sofort nach Hause kommen.«
Kapitel 2
Der TGV schoss wie ein weiß-blauer Blitz durch die Landschaft, an Städten, beschaulichen Dörfern und Feldern vorbei, die allmählich in der einbrechenden Dämmerung des Maiabends versanken. Patricia starrte aus dem Fenster, ohne wirklich etwas wahrzunehmen; immer und immer wieder wiederholte sie in Gedanken das kurze Gespräch am Telefon, das sie vor wenigen Stunden mit dem Lebensgefährten ihrer Mutter geführt hatte. Petra hatte einen schweren Autounfall gehabt, ein Lastwagen hatte ihr die Vorfahrt genommen, sie war fast ungebremst in ihn hineingefahren. Kurz nach ihrer Ankunft im Krankenhaus, wohin sie mit Blaulicht und Sirenen transportiert worden war, war sie ins Koma gefallen. Die Nachricht schockierte sie derart, dass Patricia sich innerlich wie betäubt fühlte, so als schwebe ihr Geist außerhalb des Körpers und beobachte alles aus der Distanz. Unablässig ging ihr der Gedanke durch den Kopf, ob es etwas geändert hätte, wenn sie am Nachmittag die WhatsApp ihrer Mutter beantwortet hätte. Wahrscheinlich nicht, auch Elian hatte ihr dies immer wieder eingetrichtert, doch die Frage ließ sich nicht so einfach abschütteln.
Der Freund hatte sich in der ersten Stunde nach Erhalt der Nachricht als Fels in der Brandung erwiesen, hatte ihr eine Jeans und eine dunkelblaue Bluse für die Fahrt herausgelegt und ihre übrigen Sachen ordentlich in ihren Koffer gepackt, der verloren zwischen den Bücherpaketen stand, hatte ihr eine Flasche Wasser in die Handtasche gesteckt und ihr in der Boulangerie gegenüber des Buchladens ein mit Schafskäse und Tomaten belegtes Baguette als Reiseproviant besorgt.
»Mach dir nicht allzu viele Sorgen«, hatte er ihr geraten, ruhig und unerschütterlich, während sie wie ein aufgeregter Vogel umhergeflattert war und die letzten Kleinigkeiten zusammengesucht hatte, um sie noch in den Koffer zu werfen, ihr Ladekabel, ihre Kosmetiktasche, das Buch, das sie gerade las – als ob sie auf der Zugfahrt den Nerv hätte zu schmökern. »Deine Mutter ist bestimmt bald wieder wohlauf, und dann kommst du zurück nach Paris. Keine Sorge, deine Ritz-artige Unterkunft in unserem Lager halte ich dir frei, auch wenn mir die Leute die Bude einrennen.«
Unter Tränen hatte Patricia geschmunzelt und den Freund fest umarmt. »Drück meiner Mutter die Daumen, dass sie diese Tragödie übersteht!«
»Natürlich.« Elian küsste sie auf beide Wangen, und sie atmete den tröstlichen Geruch seines Moschus-Vanille-Parfums ein. »Und halt mich auf dem Laufenden, wie es ihr geht, bombardiere mich mit Nachrichten, die Ungewissheit ist auch für mich unerträglich.«
»Du bist ein guter Freund.« Patricia wischte sich über die feuchten Augen. »Der beste. Es war ein Glücksfall, dass ich an meinem ersten Tag in Paris in deine Buchhandlung geschneit bin und wir ins Gespräch gekommen sind.«
Der Schaffner, der langsam vorbeischritt und die Fahrkarten zugestiegener Passagiere kontrollierte, riss sie aus ihren Gedanken. Zum wiederholten Mal checkte sie ihr Smartphone, aber es war keine neue Nachricht von Henri eingetroffen. Das bedeutete wohl, dass Petras Zustand unverändert war; ob dies gut oder schlecht war, vermochte sie nicht zu sagen. Die Angst, ihre Mutter könne nicht mehr am Leben sein, wenn sie im Krankenhaus einträfe, fraß sie auf. Sie riss ein Stück von Elians Baguette ab und stopfte es sich in den Mund, einfach um sich zu beschäftigen, aber es schmeckte wie Pappe. Sie verspürte keinen Appetit, überhaupt füllte der Geschmack der salzigen Tränen, die in ihrer Kehle saßen, ihren Mund aus. Was sollte aus ihr werden, wenn Petra starb? Dann wäre sie ganz allein auf der Welt. Außer ihrer Mutter hatte sie niemanden mehr, nicht nachdem ihr Vater und ihre Schwester so früh aus ihrem Leben verschwunden waren. Rasch verdrängte sie die aufsteigenden Erinnerungen an die beiden, doch sie waren mit den Jahren, in denen sie sie nicht gesehen hatte, verblasst wie alte Fotografien.
Wo bist du?, schrieb Elian, gefolgt von fünf Emojis mit ratlosen Gesichtern.
Schon in Deutschland, antwortete sie mit fliegenden Fingern. Ich muss gleich in Kaiserslautern aussteigen, dann in die S-Bahn umsteigen, dann mit der Bummelbahn weiter in Richtung Blumental. Ich werde erst kurz vor elf ankommen.
Inzwischen lag die Landschaft in Dunkelheit getaucht, sie schien gegen die Zugfenster zu drücken. Patricia fühlte sich beklommen, wenn sie ihr zusammengekauertes Spiegelbild in den Scheiben sah. Die Angst um ihre Mutter trommelte ihr mit jedem Herzschlag durch den Körper.
Das zweimalige Umsteigen, das Entlanghasten an den Bahnsteigen, um ihren Anschluss zu erreichen, zog wie verschwommene Szenen eines Films, dem man nur flüchtig folgte, an ihr vorüber. Endlich kam sie in ihrer kleinen Heimatstadt an und atmete die klare, frische Nachtluft ein. Alles hier war anders als in Paris, selbst der Geruch. Ein Taxi, das einsam vor dem Bahnhof stand, brachte sie zum Krankenhaus, das nur wenige Minuten entfernt lag. Ob man sie zu so später Stunde noch zu ihrer Mutter lassen würde? Aber sie musste sie einfach sehen, sie würde sich nicht abweisen lassen.
Henri hatte ihr geschrieben, auf welchem Stockwerk ihre Mutter lag, deshalb war es unnötig, am Empfang nach ihr zu fragen. Sie versuchte, mit ihrem Koffer, dessen Rollen quietschten, möglichst wenig Aufsehen zu erregen, als sie die Gänge entlangeilte. Sie fühlte sich zu Tode erschöpft und klebrig. War es wirklich erst zwölf Stunden her, dass sie sich bei Chic et Charme vorgestellt hatte? Es schien wie aus einem anderen Leben.
»Wohin wollen Sie?« Wie ein Phantom stellte sich ihr plötzlich eine Krankenschwester in den Weg und bedachte sie mit einem bohrenden Blick. Sie bot mit ihren zerzausten Haaren, der zerknitterten Bluse und dem Koffer ja auch einen verstörenden Anblick, erst recht zu dieser Uhrzeit.
»Ich … meine Mutter … Petra Marold«, stammelte sie und stützte sich auf ihren Koffer. »Der Lebensgefährte meiner Mutter hat mich benachrichtigt, und ich bin gleich aus Paris gekommen und …«
Ihre aufgeregt hervorsprudelnden Worte schienen die Krankenschwester zu besänftigen. »Nun atmen Sie erst mal durch, Frau Marold. Sie müssen ja fix und fertig sein. Wollen Sie ein Glas Wasser?« Die Frau – ihr Namensschild wies sie als Schwester Lara aus – wirkte besorgt, vielleicht befürchtete sie, Patricia würde gleich einen Zusammenbruch erleiden.
»Nein, danke.« Patricia schluckte. »Ich möchte nur meine Mutter sehen. Wie geht es ihr?«
Ihre Stimme bebte. Mit aller Kraft, die sie noch aufbrachte, versuchte sie, sich darauf einzustellen, dass Schwester Lara ihr gleich schonend beizubringen versuchte, dass ihre Mutter zwischenzeitlich verstorben war. Ein Felsbrocken rutschte ihr von der Brust, als sie stattdessen sagte: »Nach wie vor unverändert. Bei ihrer Ankunft im Krankenhaus war sie noch kurz bei Bewusstsein, aber seitdem liegt sie im Koma. Sie hat bei dem Aufprall ein Schädel-Hirn-Trauma davongetragen.«
Eiskalte Klauen schienen Patricias Herz abzuklemmen; tausend Ängste nahmen ihr die Luft zum Atmen. »Wird sie wieder aufwachen? Wird sie wieder gesund werden?«
»Es ist zu früh, das zu sagen.« Schwester Lara sprach leise, so als wolle sie die schlafende Station nicht wecken. »Morgen können Sie mit einem Arzt sprechen.«
»Okay, danke, das werde ich tun«, murmelte sie unglücklich. »Kann ich meine Mutter kurz sehen?«
Die Krankenschwester schien unschlüssig. »Zu dieser Zeit normalerweise nicht. Aber da Sie den weiten Weg aus Paris gekommen sind, lasse ich Sie kurz zu ihr. Erschrecken Sie nicht, sie ist an furchtbar viele Maschinen angeschlossen.«
Patricia nickte und wappnete sich innerlich gegen den Schock, den Petras Anblick ihr sicherlich versetzen würde. Lara führte sie durch eine Glastür zu einem Zimmer am Ende des Ganges und wollte sich offensichtlich bereits von ihr verabschieden, als ihr noch etwas einfiel. »Ach, übrigens. Ihre Mutter hat, kurz nachdem sie eingeliefert worden und bewusstlos geworden ist, noch etwas gesagt.«
Patricias Kopf flog zu der Krankenschwester herum. »Was?«
»Ich kann natürlich nicht beurteilen, ob es wichtig war«, fügte die Schwester entschuldigend hinzu. »Sie sagte: Ich möchte Beatrice sehen. Bringt Beatrice zu mir.«
Das Blut dröhnte plötzlich in Patricias Ohren, übertönte jegliche Geräusche der stillen Station, das Quietschen der Kofferrollen auf dem Boden, das Piepsen der Maschinen, das Summen der Neonröhren, das ferne Schlagen einer Tür.
»Beatrice?« Es war unnötig, den Namen zu wiederholen, denn sie wusste nur zu genau, wer damit gemeint war.
»Ihre Mutter sagte nicht, wer das sein soll.« Schwester Lara hob bedauernd die Schultern. »Vielleicht war sie auch nicht richtig bei sich.«
»Danke, dass Sie es mir ausgerichtet haben.« Patricias Stimme war nur mehr ein Flüstern, zu heiser, um in normaler Lautstärke zu sprechen. Ihr Kopf fühlte sich an, als stecke er in einem dichten Nebel.
Es brach Patricia das Herz, ihre Mutter an all die Schläuche und Apparate angeschlossen zu sehen. Statt der üblichen sportlich-eleganten Kleidung, die sie wie ihre Tochter liebte, trug sie einen weißen, dunkelblau gepunkteten Krankenhauskittel, die Haut bleich wie Wachs, die zu einem Bob geschnittenen Haare stumpf auf dem Kissen ausgebreitet. Ihre Mutter war erst Mitte fünfzig, viel zu jung zum Sterben. Patricia rieb sich die Tränen weg und zwang sich, ein paar Worte mit Petra zu sprechen, denn sie hatte gelesen, dass Komapatienten die Stimmen ihrer Angehörigen wahrnahmen. Doch ihr war dabei, als trüge sie das Gewicht schwerer Backsteine im Magen.
»Du musst wieder aufwachen, hörst du, Mama? Du musst gesund werden!«, flüsterte sie eindringlich, das Wort musst betonend, als lege sie all ihre Hoffnungen hinein. »Ich habe nur noch dich.«
Ihr blieben nur wenige Minuten im Krankenzimmer vergönnt, denn bald kam Schwester Lara herein und führte sie hinaus. »Kommen Sie morgen wieder, Frau Marold, Ihre Mutter braucht Ruhe. Und Sie auch, so wie Sie aussehen. Haben Sie jemanden, der sich um Sie kümmert?«
»Ja.« Patricia nickte und griff nach ihrem Koffer, um ihn über den Flur zu ziehen. Das kalte Neonlicht flackerte über ihnen. »Der Lebensgefährte meiner Mutter.« Vom Zug aus hatte sie Henri von Wagenfeld eine Nachricht geschrieben und ihm die ungefähre Zeit mitgeteilt.
»Ach, der Graf, der in diesem malerischen Schlösschen etwas außerhalb im Blumental wohnt.« Schwester Lara klang sehr angetan, und trotz ihres Kummers und ihrer Müdigkeit musste Patricia schmunzeln. Die Leute fanden es immer sehr romantisch, dass ihre Mutter mit einem Grafen zusammen war und in einem Schloss mitten in den Weinbergen wohnte. Die wahren Umstände waren allerdings weniger paradiesisch. »Graf von Wagenfeld verbrachte heute einige Stunden am Bett Ihrer Mutter. Er liest ihr vor oder spielt ihr Musik vor, er kümmert sich rührend.«
»Ja, so ist Henri.« Die Aussicht, Henri gleich zu begegnen und von ihm ins Schloss gebracht zu werden, taute die Eisschicht des Schmerzes, die sich um ihr Herz gelegt hatte, ein wenig auf. Es würde so guttun, von Henris Armen umschlungen zu werden und die Last mit ihm zu teilen.
Sie verabschiedete sich von der Krankenschwester und verließ die Klinik. Gerade als sie aus der Eingangstür trat, den schweren Koffer hinter sich herschleifend, sah sie Henri auf sich zueilen.
»Patricia!« Mit wenigen langen Schritten war er bei ihr und umarmte sie fest. Sie lehnte ihren Kopf gegen seine Brust und ließ den Tränen freien Lauf. Minutenlang standen sie so, ohne sich zu rühren, dann rückte Henri ein Stück von ihr ab und reichte ihr eines seiner makellos gebügelten Stofftaschentücher mit eingesticktem Monogramm. »Hier, nimm, meine Liebe. Ich bin froh, dass du da bist. Zu zweit lässt sich diese schlimme Zeit besser bewältigen.«
»Danke, Henri.« Sie schniefte in das Taschentuch. Henri lächelte ihr aufmunternd zu, griff sich den Koffer und führte sie zu seinem Auto, einem uralten, schilfgrünen Mercedes, der so klapprig war, dass sie jedes Mal befürchtete, er würde auseinanderfallen, wenn sie mitfuhr. Von hinten beobachtete sie den Grafen verstohlen. Er hatte sich nicht verändert, seit sie ihn zum letzten Mal gesehen hatte, das weiße Haar stand ihm noch immer in Büscheln vom Kopf, so wie Schafswolle, und er war in seinem üblichen Stil gekleidet: noble Anzugweste über einem Hemd, trotz des milden Maiabends eine Cordhose und dazu abgenutzte Sneaker.
Galant hielt er ihr die Tür offen, und sie stieg ein. Wie üblich benötigte Henri drei Anläufe, um den Mercedes zu starten, doch dann fuhren sie los über die menschenleeren Straßen. In der Ferne sah Patricia den Grenadierbau mit den Salinen, das Mauerwerk mit den hoch aufragenden Holzstreben hell erleuchtet; fast mystisch funkelte der Komplex in der Dunkelheit. In Gedanken verglich sie ihre beschauliche Heimatstadt mit dem mondänen Paris, kam aber zu dem Schluss, dass man die beiden Orte kaum vergleichen konnte.
»Wie ist es passiert?«, flüsterte sie dumpf, während sie aus dem Fenster starrte. Zu ihrer Linken erhob sich nun der senfgrüne Bau der Kreisverwaltung, von den Einheimischen liebevoll Senffabrik genannt.
»Wie ich dir bereits am Telefon gesagt habe – ein Lastwagen nahm ihr die Vorfahrt, und sie prallte in ihn hinein«, berichtete Henri bedrückt. »Der Lastwagenfahrer kam mit nur leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Sie war gerade auf dem Weg zum Einkaufen. Zum Glück war der Krankenwagen schnell zur Stelle.«
Patricia nickte, obwohl Henri das im Finstern nicht sehen konnte. Sie verließen das Stadtgebiet durch einen Kreisel und folgten der Landstraße. Zu beiden Seiten erhoben sich Weinberge, an deren Rändern Rosen und Malven blühten, in schweigender Pracht. Die Gegend trug den Namen Blumental, was in ihren Ohren immer wie Musik geklungen hatte. Dies alles hatte ihr in Paris gefehlt, das musste sie zugeben. Vielleicht hatte sie deshalb ihre winzige Wohnung in Montmartre mit Blick auf die Rebstöcke so geliebt.
»Ich habe dir dein übliches Zimmer zurechtgemacht.«
»Im ehemaligen Empfangssaal?« Patricia lächelte.
»Eher Sälchen. Groß ist der Raum ja nicht. Meine Vorfahren haben anscheinend wenig Wert darauf gelegt, ihre Gäste in einem großartigen Besuchersaal zu empfangen. Du bleibst doch eine Weile?«, fügte Henri mit einem forschenden Seitenblick auf sie hinzu. »Ich hoffe doch, dass deine Mutter bald aufwacht, und dann wird sie jede Unterstützung brauchen, die sie bekommen kann.«
»Ich kann so lange bleiben, wie ich will. Ich habe meinen Job verloren, und das Geld wird allmählich knapp. Mama weiß noch gar nichts davon.« Sie verschwieg Henri, dass ihre Vermieterin sie mit Ablauf ihres Arbeitsverhältnisses vor die Tür gesetzt hatte und sie seitdem im Hinterraum einer Buchhandlung hauste. Das Geständnis wäre ihr zu peinlich gewesen. »Ich niste mich also bei dir ein wie die Made im Speck.«
Henri grinste. »Sehr gern. Ich freue mich, wenn ich andere Gesellschaft habe außer die üblichen Schlossgespenster.« Wieder ernst, fuhr er fort: »Aber du kannst dir durchaus im Schloss ein paar Kröten verdienen, wenn du möchtest. Du kannst den Job deiner Mutter übernehmen.«
»Nichts lieber als das. Danke, Henri.« Es erleichterte sie, einer Aufgabe nachgehen zu können, denn die Vorstellung, ihre Tage Däumchen drehend zu verbringen, in banger Anspannung, wie sich Petras Zustand entwickeln möge, ängstigte sie. Petras Job zu übernehmen, war keine schlechte Idee. Ihre Mutter arbeitete im Schlossmuseum, das sich im Erdgeschoss des alten Gemäuers befand und Gemälde beherbergte, die ein Vorfahre Henris, Hubertus von Wagenfeld, im neunzehnten Jahrhundert gemalt hatte. Allzu groß war die Sammlung nicht, trotzdem kamen pro Tag einige wenige Besucher. Auch Patricia liebte die Bilder mit ihren Jagd- und Schlossszenen. Da das Museum nur ein paar Stunden pro Tag geöffnet war, arbeitete Petra zusätzlich als Mädchen für alles. Undichte Stellen im Dach, kaputte Wasserleitungen, Risse in den Wänden – Petra hatte alles im Blick und kümmerte sich um die Handwerker, die die Reparaturen ausführten. Patricia wusste natürlich, dass das alles finanziell sehr schwierig war. Henri verfügte kaum über Rücklagen geschweige denn über genügend Einnahmen, um das Schloss instand zu halten.
»Hattest du in letzter Zeit viele Fernsehauftritte?«
Henri grunzte, während er von der Landstraße abbog und die Abzweigung zu einer schlecht befestigten kleinen Straße nahm, an deren Ende das Schloss lag. Die Weinreben drängten sich so dicht heran, dass sie fast das Auto berührten. »Nur zwei. Einmal im Frühstücksfernsehen, einmal in dieser unsäglichen Klatschsendung, die sonntagnachmittags gesendet wird. Das eine Mal musste ich ein Statement zu Königin Laetitias Sommermode abgeben, das andere Mal über Prinzessin Amalias Liebesleben schwadronieren. Als ob ich davon eine Ahnung hätte.«
Patricia musste lachen, dann verstummte sie plötzlich und fragte sich, wieso sie so heiter sein konnte, wo ihre Mutter doch im Koma lag. Vielleicht war sie einfach nur müde und musste dringend ins Bett. »Als Adeliger hält dich halt jeder für den geborenen Experten, was die Königshäuser dieser Welt anbelangt.«
»Als ob«, brummte Henri. Er hasste es, als Graf immer wieder zu Fernsehsendungen eingeladen zu werden, um Einschätzungen über Könige und Prinzessinnen abzugeben, aber diese Auftritte brachten bitter benötigtes Geld ein. »Wir sind da.«
Der Mercedes hielt auf dem knirschenden Kies, und sie stiegen aus. Während Henri sich um ihr Gepäck kümmerte, sah Patricia zu dem Schloss hoch, das sich keksbraun auf einer kleinen Anhöhe erhob. Die Weinberge schmiegten sich an es wie heranbrandende Wogen an eine Festung mitten auf einer Meeresinsel. Der Anblick schnürte ihr die Kehle ab. Das war das Zuhause ihrer Mutter. Der Nachthimmel wölbte sich wie eine samtene Kuppel über das Dach des Schlosses, und der Mond hing so schief, als sei er beschwipst.
»Folge mir unauffällig.« Henri ging ihr voran und schloss die schwere, mit Intarsien verzierte Eingangstür auf, die zum Wohnbereich führte. Durch eine separate Tür am linken Flügel konnte man zum Museum gelangen.
Kühle empfing Patricia, als sie in der mit Marmorplatten ausgelegten Eingangshalle stand, und wie immer dieser leicht abgestandene, staubige Geruch, der von den vergangenen vier Jahrhunderten zeugte, in denen die von Wagenfelds das Schloss bewohnt hatten. Henri verzichtete darauf, den riesigen Kronleuchter mit seinen tausend Kristallen anzuschalten, der wie ein Adler mit großen Schwingen an der Decke schwebte. Er musste Strom sparen und knipste deshalb lediglich ein kleines Lämpchen an. Im trüben Licht folgte Patricia ihm durch den Prunksaal, in dem einst rauschende Feste und Bälle gefeiert worden waren. Nun war er durch provisorische Trennwände in kleinere Nischen unterteilt, die Henri und Petra als Wohnung dienten. Patricia musste stets belustigt lächeln, wenn Gesprächspartner ganz erstaunt fragten, ob ihre Mutter und deren Freund denn nicht das ganze Schloss bewohnten. Die Betriebskosten wären unvorstellbar.
Sie durchquerten den Prunksaal, und Henri öffnete eine Tür am hinteren Ende.
»Willkommen in deinem Reich.« Mit einer Handbewegung bedeutete er ihr, in den angrenzenden Raum einzutreten. »Ich lasse dich in Ruhe auspacken. Willst du danach gleich schlafen gehen oder mir ein wenig Gesellschaft leisten? Ich möchte mir noch die Aufzeichnung der Frühstückssendung ansehen, in der ich meinen Senf zur spanischen Königin dazugegeben habe.«
»Ich schaue nachher mal bei dir herein«, versprach Patricia.
Sie blieb allein in dem kleinen Saal zurück, in dem sie immer unterkam, wenn sie ihre Mutter besuchte. Früher hatten die Urahnen Henris hier ihre Besucher empfangen, doch er war zu einem – zugegebenermaßen sehr noblen – Schlafzimmer umfunktioniert worden. Henri hatte aus verschiedenen Gemächern Möbel hierhertransportiert, und nun war der Raum ein Sammelsurium edelster Teppiche und erlesenster Stühle mit samtbezogenen Polstern. Azurblaue Tapisserien schmückten nebst Porträts der adeligen Familie – natürlich vor Urzeiten von Hubertus von Wagenfeld selbst gemalt – die Wände. Im Zentrum des kleinen Saales stand ein Himmelbett mit pastellblauen, bauschigen Vorhängen, und die Decke war mit pausbäckigen Engeln mit Fanfaren bemalt. In der Ecke stand ein alter, wurmstichiger Sekretär, auf den sie ihren Laptop stellte, und vor dem Kamin befanden sich zwei geschwungene Ohrensessel, deren Stoff bereits so verblichen war, dass man die einst rosenrote Farbe nur mehr erahnen konnte.
Welch ein Kontrastprogramm zu Elians Lagerräumchen! Sie konnte es kaum erwarten, in dem angrenzenden Bad in die Wanne auf Klauenfüßen zu steigen und sich danach in das Bett zu legen, das so weich war, dass sie stets darin versank. Es war wie der Himmel auf Erden.
Doch zuerst legte sie ihre Kleider und anderen Habseligkeiten in den alten Schrank, dessen Türen sich knarrend öffneten, und ging dann nach nebenan in den Prunksaal, wie sie Henri versprochen hatte. Dieser saß auf einer alten Récamiere vor einem kleinen Flachbildschirm, der in dem ehemaligen Prunksaal mit seinen aus Kirschholz geschnitzten Möbeln, Kronleuchtern und Kerzenhaltern, den Spiegeln an den Wänden und der gewölbten, ebenfalls reich bemalten Decke recht fehl am Platz wirkte, wie ein Gegenstand, den man in einer Zeitmaschine in eine andere Epoche befördert und dort vergessen hatte.
»Setz dich zu mir.« Henri, der nun eine dicke Strickjacke trug, denn es war recht frisch in dem alten Gemäuer, klopfte auf die Sitzfläche der Récamiere. »Man kann es über den Bildschirm nicht sehen, aber glaub mir, diese Moderatorin roch drei Meilen gegen den Wind nach Knoblauch.«
Patricia kicherte und lauschte dem Gespräch, das Henri im Frühstücksfernsehen geführt hatte. Er gab wirklich eine gute Figur ab; mit seiner steifen Körperhaltung und dem alten Frack, den er für Fernsehauftritte im Schrank hängen hatte, wirkte er tatsächlich sehr aristokratisch.
»Königin Laetitia ist die Verkörperung der Eleganz, gepaart mit Nonchalance und Heiterkeit. Ihre beiden bezaubernden Töchter kommen ganz nach ihr, betrachten Sie nur die Bilder aus Sevilla, die uns letztes Wochenende erreichten …«, salbaderte Henri auf dem Bildschirm.
»Hier spricht der wahre Fachmann«, zog Patricia ihn auf.
Henri verzog das Gesicht, als habe er Zahnschmerzen. »Hör mir auf. Wenigstens hat mir das Geschwafel fünfhundert Euro eingebracht, die ich gut in den Gärtner investieren kann. Du musst dir den Schlossgarten morgen mal bei Tageslicht ansehen. Ein Dschungel ist nichts dagegen. Ein paar Salzstangen?« Er reichte ihr eine Tüte, und sie zog eine Handvoll Salzstangen heraus, die sie nachdenklich knabberte. Die Bilder der spanischen Königsfamilie zogen an ihr vorüber, ohne dass sie sie noch wirklich wahrnahm. Die Sätze der Krankenschwester flackerten wieder wie Irrlichter in ihrem Kopf auf. Wie hatte sie sie nur vergessen können?
»Schwester Lara hat mir gesagt, Mama wolle Beatrice sehen.«
Da waren sie heraus, die bedeutungsschweren Worte, die plötzlich wieder wie Kanonenschüsse durch ihre Gedanken donnerten. »Mama sagte, wir sollen Beatrice zu ihr bringen.«
Henri schaltete den Fernseher aus, und einen Moment lang war nur das leise Knacken einer Salzstange zu hören, von der er abbiss. »Ja«, brachte er dann mühsam hervor. »Das hat die Krankenschwester mir auch erzählt.«
Patricia war, als würde ihr sämtliche Luft aus den Lungen gepumpt. Sie lehnte den Kopf zurück und starrte gegen die bonbonrosa gestrichene Decke, als läge dort die Lösung, was sie tun sollte.
Kapitel 3
Am nächsten Morgen frühstückte sie mit Henri, bevor dieser zu seiner Arbeit aufbrach – er war als Sekretär bei einer Wohltätigkeitsstiftung beschäftigt, womit er neben seiner Rolle als Adels-Insider sein Geld verdiente –, dann rief sie gleich Elian an. So wie sie ihn kannte, brannte er vor Ungeduld zu hören, wie es ihr inzwischen ergangen war.
»Endlich meldest du dich, du treulose Tomate«, maulte er. Im Hintergrund hörte sie französisches Stimmengewirr, der Buchladen schien bereits gut gefüllt zu sein. »Ich lag die ganze Nacht wach und habe über dein Schicksal nachgedacht.«
»Spar dir die Theatralik für deinen Roman«, antwortete sie lachend und schlüpfte noch einmal unter die zartblaue Decke ihres Himmelbettes. Draußen brannte zwar eine frühsommerliche Sonne herab, aber in den alten Sälen des Schlosses war es frisch wie in einem Kühlschrank. »Du weißt doch, wie spät ich gestern Abend im Blumental angekommen bin. Ich bin sofort ins Krankenhaus gefahren, um meine Mutter zu sehen. Es war fast Mitternacht, als ich im Schloss eingetroffen bin, da wollte ich dich nicht mehr stören, ich weiß doch, dass du deinen Schönheitsschlaf brauchst.«
»Da hast du auch wieder recht«, seufzte Elian. »Nun erzähl. Wie geht es deiner Mutter?«
Patricia berichtete niedergeschlagen, was sie über Petras Zustand wusste. Am späten Nachmittag, nach ihrem Dienst im Museum, würde sie wieder in die Klinik fahren, aber Henri hatte ihr wenig Hoffnung gemacht, dass sich dort etwas geändert habe. No news are good news, hatte er düster gesagt.
»Das tut mir so leid, Chérie«, murmelte Elian mitfühlend. »Wenn du mich brauchst, genügt ein Wort, dann setze ich mich in den nächsten TGV und düse zu dir.«
»Das ist nett von dir.« Patricia trank einen Schluck des Lavendeltees, den Henri ihr gekocht hatte, um, wie er es ausgedrückt hatte, ihre aufgewühlten Nerven zu beruhigen. »Eins muss ich dir noch erzählen. Meine Mutter hat etwas Seltsames gesagt, kurz bevor sie bewusstlos wurde.« Sie gab Elian die letzten beiden Sätze Petras wieder.
»Huch!«, stieß dieser hervor. »Das ist ja äußerst seltsam. Deine Mutter fragt nach deiner Schwester, die seit vielen Jahren verschollen ist?«
»Na ja, so seltsam ist das auch wieder nicht.« Patricia stellte die Tasse auf dem antiken Nachttisch aus Kirschholz ab. »Meinst du, meine Mutter hat all die Jahre nicht oft an Beatrice gedacht? Welche Mutter schließt einfach damit ab, dass ihr Kind sang- und klanglos aus ihrem Leben verschwindet?«
»Du hast recht. Das würde ich Maman niemals zumuten. Was täte sie ohne mich?«
»Ich weiß, du bist ihr kleiner Prinz«, zog sie Elian auf, wurde aber sogleich wieder ernst. »Die Frage, wo Beatrice ist, muss meine Mutter so beschäftigt haben, dass das nach ihrem schrecklichen Unfall ihr erster Gedanke war. So als ob alles andere plötzlich an Bedeutung verloren habe.«
»Und? Gehst du der Sache nach?«
»Was meinst du?« Zerstreut spielte Patricia mit den Troddeln der samtweichen Decke.
»Na, ob du Beatrice suchst. Das liegt doch nahe, oder?« Elian schien sich zunehmend für das Thema zu erwärmen. Kein Wunder, liebte er doch gefühlvolle Geschichten, in denen es um vermisste Söhne und Töchter und Väter ging, die urplötzlich wieder aus der Versenkung auftauchten. »Wenn es Petras Wunsch ist, solltest du ihr den unbedingt erfüllen. Wer weiß, ob …«
Patricia spürte, wie ihr schwallartig die Tränen in die Augen schossen. »Du meinst, wer weiß, ob meine Mutter noch lange lebt.«
»So meinte ich das nicht«, wehrte Elian erschrocken ab. »Ich bin sicher, sie wird wieder gesund. Trotzdem würde ich mich an deiner Stelle schnurstracks auf die Suche nach Beatrice begeben.«
Da die Schlange vor Elians Kasse immer länger zu werden schien, beendete er das Gespräch bald, versprach aber, sich am Abend wieder bei ihr zu melden.
Patricia schlüpfte aus dem Himmelbett, nahm endlich das ersehnte Bad im nach Wiesenblumen duftenden Schaum und durchsuchte anschließend ihren Schrank nach Kleidern. Als sie noch bei Mademoiselle Papillon gearbeitet hatte, hatte sie ihre Outfits jeden Morgen sorgfältig zusammengestellt, doch heute fühlte sie sich zu deprimiert dazu. Es war völlig egal, was sie trug. Aber vielleicht sollte sie sich doch ein wenig nett zurechtmachen, schließlich musste sie gleich hinüber ins Museum, um sich um etwaige Besucher zu kümmern. Sie entschied sich für eine aprikosenfarbene Leinenhose und ein weißes Satinshirt.
Als sie Henris Prunksaal durchquerte, kam ihr eine Idee. Wo bewahrte Mutter noch einmal ihre persönlichen Habseligkeiten auf? In den schweren, mit Ölfarben bemalten Truhen unter den riesigen Fenstern, vor denen sich bodenlange, dunkle Brokatvorhänge bauschten? Tatsächlich wurde sie rasch fündig und zog ein altes Fotoalbum aus einer der Truhen. Das hatte sie gesucht. Falls im Museum wenig zu tun wäre, würde sie sich die alten Bilder vornehmen.