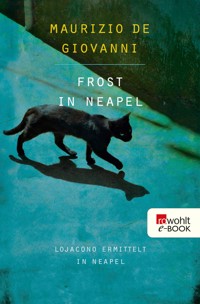9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Serie: Lojacono ermittelt in Neapel
- Sprache: Deutsch
Sie nennen ihn das Krokodil. Er ist die perfekte Mordmaschine. Aber warum weint er, wenn er tötet? Ein junger Mensch wird tot aufgefunden, kaltgemacht durch einen Schuss aus nächster Nähe. Den Täter nennt die Presse nur «das Krokodil». Weil er am Tatort ein Taschentuch mit Tränenflüssigkeit hinterlässt. Weint er Krokodilstränen um sein Opfer? Und weil er, wie das gleichnamige Raubtier, eine perfekte Mordmaschine ist. Inspektor Lojacono wurde von Sizilien nach Neapel strafversetzt. Jetzt sitzt er in einem tristen Polizeibüro und dreht Däumchen. Bis die schöne Staatsanwältin Laura Piras sein Talent erkennt und ihn mit dem Fall betraut. Und so treffen sie in einem morbiden Neapel aufeinander: Der Inspektor und der Killer. Ein neues Kapitel des ewigen Kampfes zwischen Gut und Böse hat begonnen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 341
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Maurizio de Giovanni
Das Krokodil
Kriminalroman
Aus dem Italienischen von Susanne Van Volxem
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Sie nennen ihn das Krokodil. Er ist die perfekte Mordmaschine. Aber warum weint er, wenn er tötet?
Drei junge Menschen werden tot aufgefunden, kaltgemacht durch ein und dieselbe Waffe. Den Täter nennt die Presse nur «das Krokodil». Weil er am Tatort ein Taschentuch mit Tränenflüssigkeit hinterlässt. Weint er Krokodilstränen um seine Opfer? Und weil er, wie das gleichnamige Raubtier, eine perfekte Mordmaschine ist.
Inspektor Lojacono wurde von Sizilien nach Neapel strafversetzt. Jetzt sitzt er in einem tristen Polizeibüro und dreht Däumchen. Bis die schöne Staatsanwältin Laura Piras sein Talent erkennt und ihn mit dem Fall betraut.
Und so treffen sie in einem morbiden Neapel aufeinander: der Inspektor und der Killer. Ein neues Kapitel des ewigen Kampfes zwischen Gut und Böse hat begonnen.
Über Maurizio de Giovanni
Maurizio de Giovanni wurde 1958 in Neapel geboren, wo er auch heute noch lebt. Er studierte Literatur, arbeitet aber hauptberuflich als Banker. «Das Krokodil» ist der erste Fall in der Serie um Inspektor Lojacono. Es wurde in zahlreiche Länder verkauft, unter anderem in die USA, nach England und Frankreich, und gewann 2012 den Premio Scerbanenco, den wichtigsten Preis für italienische Kriminalromane. Maurizio de Giovanni gilt neben Andrea Camilleri und Massimo Carlotto als der renommierteste und erfolgreichste Krimiautor seines Landes.
Inhaltsübersicht
Für Luigi Alfredo Ricciardiund für die Seelen im Dunkel
Eiapopeia, was funkelt da so?
Das sind die lieben Sternlein,
die leuchten so froh.
Ich schenke dir den hellsten,
mein kleines Kindelein,
doch erst mal musst du schlafen,
gar hübsch und gar fein.
Eiapopeia, was glänzet da so?
Das ist der liebe Mond,
der bewacht deine Ruh’.
1
Der Tod kommt um acht Uhr vierzehn auf Gleis drei an, mit sieben Minuten Verspätung.
Er bahnt sich seinen Weg durch Koffer, Aktentaschen und Rucksäcke, mischt sich unter Pendler, die seinen kalten Atem nicht spüren.
Der Tod geht mit unsicheren Schritten, versucht, sich von der Hast der Reisenden nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Nun ist er in der großen Bahnhofshalle angelangt, das Gegröle der Jugendlichen im Ohr, den Duft aufgebackener panini in der Nase. Er blickt sich um, wischt sich rasch eine Träne unter dem linken Auge weg. Und schon verschwindet das Taschentuch wieder in der Jackentasche.
Der Ausgang ist nicht auszumachen; ihm bleibt nichts anderes übrig, als der Laufrichtung der Menschen zu folgen und sich am Straßenlärm zu orientieren. Überall neue Geschäfte, dieser Ort ist nicht wiederzuerkennen. Wie sehr sich alles verändert hat mit den Jahren! Er hat sich genau vorbereitet, alles bis ins kleinste Detail geplant. Die Suche nach dem Ausgang wird der einzige unsichere Moment sein.
Niemand bemerkt ihn. Der Blick eines jungen Mannes, der rauchend an einem Pfeiler lehnt, gleitet über ihn hinweg, als wäre er unsichtbar. Ein klinischer Blick. Nichts zu holen, besagt er, die abgetragenen Schuhe und die altmodische Kleidung sind genauso von gestern wie die selbsttönenden Brillengläser und die dunkle Krawatte. Der Blick wandert weiter und hält inne bei der offen stehenden Handtasche einer Frau, die wild gestikulierend in ihr Handy spricht. Niemand sonst sieht den Tod, der mit zögerlichen Schritten die Bahnhofshalle durchquert.
Nun ist er draußen. Feuchte Luft und Benzingeruch schlagen ihm entgegen. Es hat gerade erst aufgehört zu regnen, der Bürgersteig ist glitschig vom aufgeweichten Dreck. Plötzlich durchbricht ein Sonnenstrahl die Wolkendecke. Der Tod blinzelt in das grelle Licht und wischt sich erneut eine Träne aus dem Augenwinkel. Er blickt sich um und sieht den Taxistand. Ein Bein leicht hinter sich herziehend, geht er los.
Er steigt in einen Wagen, der schon bessere Tage gesehen hat. Es stinkt nach kaltem Rauch, der Sitz ist durchgesessen. Beinahe flüsternd nennt er die Adresse, die der Taxifahrer wie zur Bestätigung noch einmal laut wiederholt, während er ruckartig anfährt und sich, ohne die Vorfahrt zu beachten, in den Verkehr einfädelt. Niemand protestiert.
Der Tod ist in der Stadt angekommen.
2
Polizeimeister Luciano Giuffrè schob seine Brille in die Stirn und rieb sich mit beiden Händen die Augen.
«Signora, so kommen wir nicht weiter. Sie können hier nicht einfach reinspazieren und uns von der Arbeit abhalten – wir haben auch noch andere Dinge zu erledigen. Also, erzählen Sie bitte noch mal kurz und bündig: Was ist passiert?»
Die Frau kniff die Lippen zusammen und warf einen schrägen Blick zu dem anderen Schreibtisch im Zimmer.
«Commissario, nicht so laut. Sonst hört der da noch alles mit …»
Giuffrè breitete die Arme aus.
«Ich habe es Ihnen doch eben schon gesagt: Ich bin kein Kommissar. Ich bin ein einfacher Polizeimeister, der zu seinem Leidwesen hier aufs Revier versetzt worden ist, um Strafanzeigen aufzunehmen. Und ‹der da› ist sowieso mit seinen Gedanken ganz woanders. Das ist Ispettore Lojacono, er macht den gleichen Job wie ich, nur dass er um einiges besser dran ist: Zu ihm geht nämlich nie einer.»
Der Mann an dem anderen Schreibtisch schien von der Tirade seines Kollegen nichts mitzubekommen. Er starrte unentwegt auf seinen Bildschirm, die Hand an der Maus.
Die Frau mittleren Alters warf Giuffrè einen betont gleichmütigen Blick zu, während sie an ihrer Handtasche nestelte.
«Na ja, der Kunde geht halt lieber zum Verkäufer seines Vertrauens.»
«Verkäufer? Ich muss doch sehr bitten. Wir sind hier nicht beim Metzger. Und nun sagen Sie mir doch, was passiert ist, sonst muss ich zum nächsten Fall übergehen.»
Die Frau senkte den Blick.
«Verzeihen Sie, Commissario, ich bin heute einfach etwas nervös. Es ist so: Die aus der Etage unter mir, wissen Sie, die hat sich schon wieder neue Katzen ins Haus geholt. Jetzt sind’s schon drei.»
«Und? Was haben wir damit zu tun?»
«Na, die Katzen miauen!»
«Was sollen sie denn sonst tun?»
«Ich habe das Gefühl, Sie wollen mich nicht verstehen, Commissario. Diese Katzen miauen nicht nur, sie stinken auch noch, habe ich festgestellt. Und da wurde es mir zu bunt: Ich habe mich über den Balkon gebeugt und der Nachbarin zugerufen, dass sie sofort mit ihren Viechern verschwinden soll.»
Giuffrè schüttelte den Kopf.
«Und, wie hat sie reagiert?»
Die Frau richtete sich kerzengerade in ihrem Stuhl auf.
«Sie hat gesagt, ich soll sie am Arsch lecken.»
Giuffrè nickte, im Geiste mit der Katzenbesitzerin einig.
«Und?»
Die Frau riss ihre Schweinsäuglein auf.
«Und jetzt will ich sie anzeigen, Commissario. Ich will, dass sie eine Strafe kriegt – wegen Aufforderung zum Arschlecken.»
Giuffrè wusste nicht, ob er lachen oder weinen sollte.
«Signora, ich bin kein Kommissar. Und jemanden aufzufordern, ihn am Arsch zu lecken, ist, soweit ich weiß, kein Straftatbestand. Lassen Sie mich Ihnen einen guten Rat geben: Gehen Sie jetzt nach Hause und versuchen Sie, das Ganze mit etwas mehr Gelassenheit zu betrachten. Ein paar Katzen mehr oder weniger tun niemandem weh, im Gegenteil, sie vertreiben sogar noch die Ratten. Und jetzt muss ich Sie leider bitten zu gehen.»
Die Frau stand auf, sie zitterte vor Empörung.
«Und für so was muss unsereins Steuern zahlen!», schnaubte sie und rauschte zur Tür hinaus.
Giuffrè nahm seine Brille mit den dicken Gläsern ab und knallte sie auf den Schreibtisch.
«Langsam frage ich mich wirklich, wen ich in meinem früheren Leben so schlecht behandelt habe, dass ich diesen Job hier machen muss. Es ist nicht zu glauben: In einer Stadt, wo an jeder zweiten Straßenecke eine Leiche gefunden wird, kommt so eine wie die da anmarschiert, um Anzeige zu erstatten, nur weil ihr jemand gesagt hat, sie kann ihn mal am Arsch lecken. Findest du das in Ordnung?»
Der Mann am anderen Schreibtisch hob den Blick vom Monitor. Sein Gesicht mit den mandelförmigen schwarzen Augen, den hohen Wangenknochen und den feingezeichneten vollen Lippen hatte fast orientalische Züge. Eine widerspenstige Haarsträhne fiel ihm in die Stirn. Obwohl er die vierzig gerade erst überschritten hatte, zeugten bereits tiefe Falten neben Mund und Augen von vergangenen Sorgen und Nöten.
«Komm schon, Giuffrè. Das ist Kinderkram. Irgendwas musst du doch tun, um den Tag rumzukriegen.»
Mit einer hastigen Bewegung setzte der Polizeimeister die Brille wieder auf die Nase und spielte den Überraschten. Er liebte es, seine Worte mit ausdrucksstarken Gesten zu untermalen.
«Ah, der werte Herr ist aus dem Tiefschlaf erwacht. Was kann ich für dich tun, Ispettore? Dir vielleicht einen Kaffee und eine Brioche bringen? Oder lieber die Zeitung, damit du nachlesen kannst, was in diesem Land so passiert, während du deine Siesta hältst?»
Lojacono schenkte ihm ein schiefes Lächeln.
«Was kann ich dafür, wenn die Leute mich nur einmal schräg ansehen und sich dann vor deinen Schreibtisch setzen? Du hast doch gehört, was die Nervensäge gesagt hat: Der Kunde geht lieber zum Verkäufer seines Vertrauens.»
Giuffrè richtete sich zu seinen ganzen ein Meter fünfundsechzig auf.
«Hör mal, du sitzt genauso auf diesem sinkenden Schiff wie ich, das ist dir doch hoffentlich klar. Oder denkst du etwa, du bist hier nur zu Besuch? Weißt du, wie die anderen unsere Abteilung nennen? ‹Cottolengo› nennen sie sie. Nach dem Krankenhaus in Turin, wo die Schwachsinnigen hingeschickt werden. Und was meinst du wohl – dass sie nur mich damit meinen?»
Lojacono zuckte mit den Schultern.
«Was interessiert mich das? Sollen sie diesen Saftladen doch nennen, wie sie wollen. Mich nervt das hier noch viel mehr als euch alle zusammen.»
Er wandte sich wieder seinem Monitor zu. Unter dem Pokerspiel, das er den ganzen Tag lang gegen seinen Computer spielte, waren die Uhrzeit und das Datum angezeigt: 10. April 2012. Zehn Monate und ein paar Zerquetschte. Seit über einem Dreivierteljahr war er jetzt hier. In der Hölle.
3
Durch den Kopfhörer des Mädchens an der Rezeption dröhnte Beyoncé in voller Lautstärke. Bei den lächerlichen vierhundert Euro, die sie monatlich verdiente, noch dazu an der Steuer vorbei, konnte man nichts anderes von ihr verlangen. Andererseits, in Zeiten wie diesen war der Job als Empfangsdame in einem Zehn-Zimmer-Hotel in Posillipo vielleicht gar nicht so übel, immerhin konnte sie nebenbei für ihre Prüfungen lernen. Aber öde war es trotzdem.
Als sie kurz von ihrem Buch aufsah, zuckte sie zusammen. Hinter dem Tresen stand ein Mann, der sie beobachtete.
«Entschuldigen Sie, ich habe Sie nicht kommen hören. Wie kann ich Ihnen helfen?»
Sie nahm die Kopfhörer von ihren Ohren, ohne jedoch die Musik abzustellen.
Auf den ersten Blick wirkte der Mann wie ein Greis. Wenn sie genauer hingeschaut und sich nicht von der unscheinbaren Kleidung, der dunklen Krawatte, den selbsttönenden Brillengläsern (bei wem hatte sie zuletzt so eine Brille gesehen? Vielleicht bei ihrem Großvater?) hätte ablenken lassen, dann hätte sie ihn vermutlich ein paar Jahre jünger geschätzt. Aber mit der BWL-Prüfung im Nacken und Beyoncé, die aus den Kopfhörern grölte, würde sie dem fremden, gesichtslosen Gast, der da vor ihr stand, kaum mehr Aufmerksamkeit widmen als nötig.
«Ich habe ein Zimmer reserviert, ich glaube, die Nummer sieben. Schauen Sie doch bitte mal nach.»
Auch seine Stimme war ausdruckslos, kaum mehr als ein heiseres Flüstern. Der Mann zog ein Taschentuch aus der Tasche und wischte sich rasch über das linke Auge. Vielleicht hat er Heuschnupfen, dachte das Mädchen.
«Ja, hier haben wir die Reservierung. Ich sehe gerade, die Nummer neun ist auch eben frei geworden, das wäre ein Zimmer mit Blick aufs Meer. Die Sieben geht nach hinten raus. Wenn Sie möchten, können wir…»
Der Alte unterbrach sie freundlich.
«Nein danke. Ich würde gern bei der Sieben bleiben, da ist es bestimmt weniger laut. Ich bin hier, um mich zu erholen. Sagen Sie, haben Sie auch einen Hausschlüssel für mich? Falls ich abends mal spät zurückkomme. Ich habe im Internet gelesen, dass das möglich ist, weil Sie hier keinen Nachtportier haben.»
Ist hier, um sich erholen, und fragt dann nach dem Hausschlüssel, weil er abends spät zurückkommt, dachte das Mädchen. Alles klar …
«Aber natürlich, bitte schön – der ist für den Hintereingang und der fürs Zimmer. Wissen Sie schon ungefähr, wie lange Sie bleiben?»
Eine ganz normale Frage, reine Formalität. Doch der Alte schien sich für die Antwort mächtig anstrengen zu müssen. Sein Blick hinter den Brillengläsern verlor sich ins Leere, eine Falte grub sich in die Stirn unter dem schütteren weißen Haar.
«Ich weiß es noch nicht. Einen Monat, vielleicht auch weniger.»
«Kein Problem, lassen Sie sich Zeit. Angenehmen Aufenthalt!»
Und schon dröhnte Beyoncé wieder in ihren Ohren.
Das Zimmer Nummer sieben. Mit Bedacht ausgewählt auf dem Zimmerplan des Hotels, den er im Internet tausendmal studiert hatte. Das Einzelbett parallel zur Wand, das Bad mit Duschkabine, aber ohne Bidet, der Kleiderschrank mit den knarrenden Türen. Ein Sekretär, ein Stuhl, ein Nachttisch. Perfekt. Alles war perfekt.
Der Alte legte den Koffer aufs Bett, öffnete den Reißverschluss, überprüfte rasch den Inhalt, zog seine Jacke aus und hängte sie ordentlich in den Schrank. Dann schob er den Sekretär vors Fenster und zog das Rollo halb nach oben, ohne den Vorhang zu öffnen. Er schaute hinüber auf die andere Seite des schmalen Privatwegs und nickte zufrieden. Dann lockerte er seine Krawatte und nahm Platz. Er betrachtete den Stift in seiner Hand und den Schreibblock mit dem protzigen Hotel-Logo, warf einen weiteren Blick nach draußen und begann zu schreiben.
Der Koffer war halb leer, bis auf ein paar Kleidungsstücke. Und eine Pistole.
4
Lojacono sah auf die Uhr, zum hundertsten Mal. Elf Uhr achtundfünfzig. Er beschloss, nicht länger zu warten, auch weil Giuffrè endlich den Raum verlassen hatte. Er griff zum Hörer und wählte die Nummer.
«Hallo?»
Sofort versuchte er die Bilder zu vertreiben, die der Klang von Sonias tiefer Stimme in seinem Kopf heraufbeschwor. Ihr Lachen, ihre weichen Brüste, der Geschmack ihrer Lippen. Vorvergangenheit.
«Hallo, ich bin’s.»
«Was willst du?»
Lojacono lächelte bitter.
«Ich freue mich auch, dich zu hören.»
Ihre Stimme wurde laut.
«Mach dich ruhig lustig über mich – nach allem, was du deiner Tochter und mir angetan hast. Weißt du eigentlich, dass wir uns ein Jahr lang nicht vor die Haustür getraut haben? Du sollst uns nicht mehr anrufen, hat der Anwalt gesagt. Du sollst uns nur noch unser Geld schicken.»
Der Inspektor legte sich die Hand über die Augen. Plötzlich fühlte er sich kraftlos.
«Bitte, Sonia. Du weißt, dass ich dir immer pünktlich dein Geld schicke. Ihr kriegt fast alles von dem Hungerlohn, den sie mir hier zahlen. Mein Leben in dieser Stadt ist dermaßen beschissen, das kannst du dir nicht vorstellen. Es ist wirklich nicht nötig, dass du mir auch noch die Hölle heißmachst.»
Das Lachen der Frau hatte nichts Fröhliches an sich.
«Ist dir klar, was du aus unserem Leben gemacht hast? Wenn du wenigstens ein richtiger Mafioso gewesen wärst, dann hätten sie immerhin Respekt vor uns gehabt, vor Marinella und mir. Aber jetzt kann uns nicht mal mehr die Verwandtschaft in die Augen gucken, und hier, wo uns sowieso fast niemand kennt, müssen wir uns verstecken, als wären wir Diebinnen. Zum Teufel!»
Zum Teufel. Wie wenig doch dazu gehörte, in der Hölle zu schmoren.
«Wie auch immer. Ich wollte wissen, wie es euch geht. Und ich wollte mit Marinella sprechen.»
«Vergiss es! Vergiss es, hast du verstanden? Sie will nicht mit dir sprechen. Sie hat alle ihre Freunde verloren nach dieser Geschichte. Was kann einer Fünfzehnjährigen Schlimmeres passieren? Du brauchst gar nicht erst zu versuchen, sie direkt zu erreichen, sie hat eine neue Handynummer.»
Lojacono schlug mit der flachen Hand auf den Schreibtisch, dass die Büroklammern und Stifte bebten.
«Himmelherrgott, sie ist meine Tochter! Seit zehn Monaten habe ich ihre Stimme nicht mehr gehört! Kein Richter dieser Welt kann einem Vater vorschreiben, sich seiner Tochter gegenüber tot zu stellen.»
Sonias Stimme wurde schneidend wie eine Messerklinge.
«Das hättest du dir früher überlegen müssen. Bevor du der Mafia vertrauliche Informationen weitergegeben hast. Noch nicht mal Geld hast du dafür kassiert. Du hast einfach nur versagt. Und wenn ein Mädchen einen Versager zum Vater hat, dann muss man wenigstens dafür sorgen, dass sie für den Rest ihres Lebens keinen Schaden mehr davon nimmt. Schick das Geld und lass uns in Ruhe!»
Sie legte auf.
Erst als er den sichtlich unangenehm berührten Giuffrè an seinen Platz zurückschleichen sah, wurde Lojacono bewusst, dass er schon eine ganze Weile zusammenhanglose Sätze in den Hörer gestammelt hatte. Rasch erhob er sich und verließ den Raum.
Er kannte ihn, diesen Alfonso Di Fede. Und wie er ihn kannte. Sie waren sogar zusammen in eine Klasse gegangen, in der Grundschule, bevor der andere wie alle aus seiner Familie Schafhirte geworden war. Er erinnerte sich noch gut an den wortkargen dicken Jungen mit dem stolzen Blick, der nie ein Buch aufgeschlagen hatte. Offenbar hatte er gewusst, was auf ihn zukommen würde.
Natürlich hatte er Alfonsos Laufbahn verfolgt, die so war wie die von vielen anderen auch. Der Härteste und Loyalste kam nach oben, Stufe um Stufe – letztlich nicht anders als bei der Polizei. Ein paar Mal eingebuchtet und wieder entlassen, bis er irgendwo auf dem Land zwischen Gela und Canicattì untergetaucht war. Noch einer, der die Ärmel hochkrempeln konnte. Der geheime Botschaften und, wenn nötig, auch den Tod überbrachte, wann immer man es von ihm verlangte.
Sie waren sich nie mehr über den Weg gelaufen. Di Fede war nicht unter den wenigen gewesen, die sie in den heißen sizilianischen Nächten hatten aufspüren können, in irgendwelchen abgelegenen Baracken mit kargen Zimmern voller Weinflaschen und Pornoheften – Orte, an denen über die Schicksale unschuldiger Menschen verfügt wurde.
Am Ende hatte ihn doch einer geschnappt, irgendwo weit weg, in Deutschland. Und während der stundenlangen Verhöre, die zu seiner Kronzeugenschaft geführt hatten, war plötzlich sein Name aufgetaucht: Inspektor Giuseppe Lojacono vom Mobilen Einsatzkommando Agrigento, ein hochangesehener Kader weit oben auf der Karriereleiter. Weit oben, aber ohne jede Rückendeckung.
«Ja», hatte der Kronzeuge Alfonso Di Fede gesagt, «ja, natürlich: Lojacono hat uns immer mit Informationen versorgt. Über ihn haben wir von den Plänen des Einsatzkommandos erfahren und wussten, wo wir hinkonnten und wo nicht. Kann ich bitte noch einen Kaffee haben?»
Wer konnte schon sagen, woher sein Name so plötzlich aufgetaucht war? Aus irgendeinem hinteren Winkel von Di Fedes Gedächtnis oder aus der Notwendigkeit heraus, jemand anderen zu decken? In den Nächten nach der sofort erfolgten Suspendierung hatte Lojacono Stunden damit verbracht, an die Decke zu starren und sich diese Frage zu stellen.
Die Auswirkungen auf sein Leben und das von Sonia und Marinella waren verheerend gewesen. Niemand hatte mehr das Wort an ihn gerichtet: entweder aus Angst, die Unterstellung könne wahr sein, oder aus dem gegenteiligen Grund. In ihrer Verunsicherung hatten sie sich alle von ihnen abgewendet und sie allein vor dem Aus stehen lassen.
Der Zweifel in den Blicken seiner Frau und Tochter war ihm sofort aufgefallen. Mit bedingungsloser Unterstützung hatte er nicht gerechnet, allzu oft hatte er als Polizist ähnliche Geschichten mit angesehen. Er wusste genau, wie selten es außerhalb von Büchern und Filmen geschah, dass Angehörige gleichermaßen das Unglück mittrugen, wie sie das gemeinsame Glück genossen hatten. Aber er hatte gehofft, wenigstens die Chance zu haben, sich erklären und verteidigen zu können.
Besser wäre es gewesen, man hätte ihn tatsächlich vor den Kadi gestellt. Dann hätte er die ganze Absurdität der Angelegenheit aufzeigen und sie auf das zurückführen können, was sie war: ein Fall von übler Nachrede. Aber eben weil es so wenige Indizien gab, war es auch nicht zum Prozess gekommen, hatte sich Justitia nicht in die Schlacht begeben.
«Zweckmäßigkeit», so hatte das Schlüsselwort geheißen. Keine Disziplinierungsmaßnahme, sondern bloß eine Frage der Zweckmäßigkeit. Gewiss, man hatte eine Akte angelegt; in irgendeinem dunklen Hinterzimmer befand sich ein Ordner, auf dem sein Name stand und der randvoll gefüllt war mit Kopien von Verhören, Protokollen und Einsatzberichten. Fragmente, Ausschnitte aus dem Leben eines Polizisten, der in einer Gegend wohnte und arbeitete, die in Sachen Verbrechensbekämpfung weltweit zu den schwierigsten zählte. Alles war in sich zusammengefallen wie ein Kartenhaus – aus reiner Zweckmäßigkeit.
«Sie müssen mich verstehen, Lojacono», hatte der Polizeipräsident gesagt. «Ich handele nicht nur zum Wohl Ihrer Familie, sondern auch zu dem der Einsatztruppe. Die Kollegen müssen sich sicher fühlen können. Es ist für niemanden gut, wenn Sie hierbleiben. Sie wären einfach zu exponiert. So ist es am zweckmäßigsten.»
Reine Zweckmäßigkeit also, dass Sonia und Marinella nach Palermo hatten umziehen müssen – lieber keinen Erpressungsversuch oder gar Schlimmeres riskieren. Es gab genügend Familien, die wegen Di Fede und seines Clans Tote zu beklagen hatten, und schließlich konnte niemand vorhersehen, was für Aktionen diese Hitzköpfe planten.
Marinella hatte die Schule wechseln müssen, ihre besten Freundinnen verloren, den Jungen, für den sie geschwärmt hatte. Schreckliche Dinge in diesem Alter. Zuletzt hatte er nur noch blanken Hass aus ihrer Stimme herausgehört.
Auch seine Versetzung nach Neapel war aus reiner Zweckmäßigkeit erfolgt, natürlich. Man hatte ihn weit genug weggeschickt, um ihn los zu sein, und nahe genug, um es nicht nach Strafversetzung aussehen zu lassen. Wegen einer Schuld, die man ihm nicht nachweisen konnte. Polizeikommissariat San Gaetano, im Bauch einer Stadt, die sich in ständiger Auflösung befand. Etwas Schlimmeres, das sofort zur Verfügung gestanden hätte, war nicht zu finden gewesen. Das einzig Gute hier war der Kaffee. Wenigstens das.
Der leitende Kommissar hatte ihn in seinem Büro empfangen.
«Sie verstehen sicher, Lojacono, dass es unter den gegebenen Umständen wenig zweckmäßig ist, wenn Sie hier bei Ermittlungen tätig werden.»
Zweckmäßig oder nicht zweckmäßig, hatte er gedacht.
«Tun Sie mir also den Gefallen und halten Sie sich aus allem raus, was irgendwie nach Ermittlung aussieht.»
«Und was soll ich sonst tun?», hatte er gefragt.
«Machen Sie sich keine Gedanken, es wird nichts von Ihnen erwartet. Gehen Sie einfach aufs Revier und tun Sie, wozu Sie Lust haben. Lesen Sie oder schreiben Sie Ihre Memoiren. Seien Sie einfach da und machen Sie sich keinen Kopf. Es wird nicht lange dauern, das versichere ich Ihnen.»
Zehn Monate und ein paar Zerquetschte. Zum Verrücktwerden. Anrufe ins Leere hinein, verzweifelte Versuche, mit der Tochter zu reden. Aus der Heimat, von den alten Kollegen: nichts als Schweigen. Ein einziger Schwebezustand, ohne Gefühl für Raum und Zeit, hinter einem leergefegten Schreibtisch, mit dem Computer als Poker-Gegner. Und an seiner Seite dieser Giuffrè, noch so ein Paria, Exchauffeur eines hohen Beamten, dem man eine neue Aufgabe zugeteilt hatte – eine, wo er keinen Schaden anrichten konnte. Er musste lediglich Strafanzeigen von verrückten Weibern aufnehmen.
Ich darf nicht schlecht von Giuffrè denken, sagte er sich. Er ist der Einzige, der überhaupt mit mir redet.
5
Liebling, mein Liebling,
endlich bin ich hier! Endlich atme ich die Luft ein, die Du auch eingeatmet hast – vielleicht ist ja noch ein wenig von dem übrig geblieben, was durch Deine Lungen gegangen ist, vielleicht atme ich es ja genau jetzt ein, in diesem Moment.
Die letzten Monate waren schier endlos für mich. Sie hat so lange gebraucht, um zu sterben. Zum Schluss war jeder Atemzug nicht mehr als ein verzweifeltes Röcheln. Nachts saß ich an ihrem Bett, wünschte mir, dieses Geräusch würde endlich aufhören, ich möge endlich frei sein. Mein Gott, was hat sie lange gebraucht!
Sie ist zu meinem Gefängnis geworden. Langsam, unmerklich siechte sie in ihrem Bett dahin. Niemand kam uns mehr besuchen, ihr Anblick war einfach zu grauenhaft. Ein kümmerlicher Rest Leben.
Ich hingegen, ich habe mich nicht kleinkriegen lassen. Ich hatte ja Dich, mein Liebling!
Der Gedanke an Dich hat mich jeden dieser Momente ertragen lassen. Die Vorstellung, Dich wiederzusehen, Dich noch einmal an mich zu drücken, hat mich beflügelt, hinweggetragen, vor der Verzweiflung gerettet. Ja, gerettet, mein Liebling! Dein Lächeln, Deine Schönheit, Dein blondes Haar. Die Wärme Deiner Hände auf meinem Gesicht. In der Nacht, im Halbschlaf, geplagt von diesem nicht enden wollenden Röcheln, wie von einem unaufhörlich tickenden Metronom, konnte ich Dich hören. Ich sah Dich mit den Augen meiner Sehnsucht, wie einen Leuchtturm in der Nacht, wie einen sicheren Hafen im Sturm.
Liebling, mein Liebling!
Der Klang Deines in die Stille hinein gemurmelten Namens hat mir die Kraft gegeben, bis zum Schluss bei ihr zu bleiben. Denn ich wusste, irgendwann würde ich Dich noch einmal an mein Herz drücken können.
Ich habe keine einzige Sekunde vergeudet, weißt Du? Ich habe alles perfekt geplant.
Ich habe gelernt, im Internet zu surfen. Es heißt, für jemanden in meinem Alter ist das enorm schwierig – aber nicht für mich! Du lächelst, oder, mein Liebling? Du denkst, dass nichts so schwierig sein könnte wie diese Jahre ohne Dich. Genau so ist es, Du hast es erfasst. Nichts ist mehr schwierig.
Es ist kaum zu glauben, wie leicht alles zu planen und zu organisieren war. Man muss nur die Zeit dazu haben – und Zeit hatte ich wahrlich genug. Durch Deine Briefe, ja, durch sie habe ich alles erfahren, was ich wissen musste. Wie oft habe ich sie gelesen, wieder und wieder! Wie kostbare alte Dokumente habe ich sie entschlüsselt, immer darauf bedacht, sie nicht zu beschmutzen oder zu beschädigen. Nur Deine Hände haben sie berührt und meine. Nur sie.
Deinen Briefen habe ich entnommen, was ich brauchte: Namen und Daten. Der Computer hat den Rest erledigt. Während sie vor sich hin röchelte und auf den Tod wartete, habe ich nach Adressen, Orten, Abfahrtszeiten gesucht. Es ist alles im Netz zu finden. Alles! Man muss nur Geduld haben, darf nicht zu schnell aufgeben. Und Du weißt ja, wie viel Geduld ich aufbringen kann.
Nun fehlt nicht mehr viel. Der Moment ist gekommen, das zu tun, was nötig ist, um Dich noch einmal in die Arme zu nehmen, um bei Dir zu sein. Und dieses Mal für immer, ohne dass sich noch irgendetwas zwischen uns stellen könnte.
Ich habe es nicht mehr geschafft, ihr davon zu erzählen, musst Du wissen. Und vielleicht hätte ich es ihr auch nicht erzählt, wenn ich gekonnt hätte. Warum sie beunruhigen oder ihr gar Leid zufügen? Du weißt, wie leicht sie sich aufgeregt hat.
Endlich bin ich so weit. Der Moment ist gekommen. Und wie drängt es mich, mit der Arbeit anzufangen!
Heute Nacht soll die Jagd beginnen.
6
Mirko steht rauchend vor dem Spiegel. Er überprüft seine Frisur, der Schnitt ist noch relativ frisch, er gefällt ihm. Nur ein leichter Irokese, nichts Auffälliges. Er mag es nicht, wenn die Leute ihn zu lange in Erinnerung behalten. An diese Möglichkeit denkt er sofort, dumm ist er nicht. Schließlich ist er kein Kind mehr. Er ist schon sechzehn.
Er spürt ihn noch, diesen Schauer, der ihm über den Rücken gelaufen ist, als Antonio ihn vor einem Monat zum ersten Mal angesprochen hat. Der Antonio, der für alle Jungs aus dem Viertel ein Held ist. Der Antonio, der mit den schönsten Mädchen geht. Der noch vor zwei Jahren genau so ein Milchbubi war wie er, der nachts zum Kicken in die Galleria ging und jetzt eine schwere Maschine mit verchromtem Auspuff fährt, sodass die Schaufensterscheiben der Läden vibrieren, wenn er vorbeirast. Ja, und der Antonio, der auf ihn zugekommen ist, als er mit seinen Kumpels auf der Mauer saß und sie Weibergeschichten austauschten, und der zu ihm gesagt hat: «He, komm mal her, ich muss mit dir reden!» Mirko kann sich noch genau an die Gesichter der anderen erinnern: Überraschung, Neid, sogar leichte Beunruhigung hat sich auf ihnen abgezeichnet. Und er hat noch sein eigenes Herzklopfen im Ohr, als er sich von der Gruppe gelöst hat, um seinem Schicksal entgegenzugehen.
Antonio hat ihm den Arm um die Schulter gelegt. Als wäre er ein guter Freund, einer wie er. «Du scheinst mir mehr draufzuhaben als die anderen», hat er gesagt, «bist cleverer als sie, mehr auf Zack.» Er wäre ihm positiv aufgefallen, als er ihn auf dem Moped hat rumfahren sehen. «Du bist keiner, der irgendeinen Scheiß baut», hat er gemeint. «Du bist ein cooler Typ, hast dich im Griff. Das gefällt mir. Meine Leute müssen so sein.»
«Deine Leute?», hat er nachgefragt, seine Stimme kaum mehr als ein Flüstern.
Er hat ihn auf die Probe gestellt. Ein Anruf auf dem Handy, und er hat Gewehr bei Fuß gestanden. Hat ein paar Briefumschläge in der Stadt verteilt. Einmal hat er auch einen Typen, den er nicht kannte, auf dem Moped mitgenommen, von einem Viertel zum nächsten hat er ihn kutschiert, außerhalb der eigentlichen Zone. Schließlich hat Antonio ihm ein paar von den schwarzen Straßenhändlern anvertraut, die CDs und Sonnenbrillen verkaufen, damit sie ja nicht anfingen, ihn zu bescheißen, nach dem Motto, sie wären beklaut worden.
Seit ein paar Tagen ist die Sache ernst. Nun ist es sein Job, zu den Gymnasien in den besseren Vierteln raufzufahren, sich dort etwas im Abseits auf sein Moped zu setzen und zu warten. Wenn die Schüler aus dem Gebäude strömen, mischt er sich unter sie, bis einer mit einem zusammengefalteten Geldschein auf ihn zukommt. Ein Handschlag, und er übergibt ihm ein Tütchen. Er ist ein Jugendlicher unter anderen Jugendlichen, die gleichen Klamotten, das gleiche Moped. Nichts leichter als das.
Von Antonio hat Mirko zwei Geldscheine erhalten, zwei Banknoten à fünfzig Euro. «Aber sei vorsichtig!», hat er zu ihm gesagt.
Mirko wirft einen letzten Blick in den Spiegel, er ist ein wenig nervös. Was, wenn der Iro doch zu auffällig ist? Nachher erkennen sie ihn wieder, vielleicht einer von diesen stielaugigen Lehrern, die sich immer in Dinge einmischen, die sie nichts angehen.
Aber dann denkt er noch mal an die Situation vor der Schule zurück und erinnert sich, dass ein paar von diesen Bekloppten, die so scharf darauf sind, ihm ihr Geld zu geben, genau so eine Frisur haben wie er, und er wird ruhiger.
Unwillkürlich wandern seine Gedanken zu dem blonden Mädchen. Sie ist ihm sofort aufgefallen, inmitten all der Hühner, am Schulausgang. Mamma mia, wie schön sie ist. Wie ein Engel ist sie ihm vorgekommen, als sie ihren Blick auf ihn gerichtet hat, und er hat sich noch kleiner gefühlt als in dem Moment, in dem Antonio ihn zu sich rief. Und sie hat ihm zugelächelt, ja, ihm! Sie wird ihn mit jemandem verwechselt haben, aber egal, sie hat ihm zugelächelt.
Mirko schaut sich um. Klar, wenn die Blonde gesehen hätte, in was für einem Loch er wohnt, sie hätte sich totgelacht, keine Frage. Aber muss sie es denn überhaupt erfahren?
Er klopft sich auf die Hosentasche, in der die hundert Euro stecken. Er möchte das Geld nur ungern antasten, aber er braucht Benzin für sein Moped. Vielleicht muss er doch noch mal an Mamas Handtasche.
Er lächelt seinem Spiegelbild zu, die Zigarette im Mundwinkel, ein Auge zugekniffen. Mama … Immer hat sie zu ihm gesagt, sie beide wären ganz allein auf der Welt, nur er und sie. Immer hat sie ihm alles gegeben, was sie hatte, solange er sich erinnern kann. Hat immer nur gearbeitet, nie einen Mann gehabt. Geht nie ins Kino oder ins Restaurant. Aber hält diese Bude hier sauber, alles nur für ihn, ihr einziges Kind.
Ich bin kein Kind mehr, Mama! Lass mich nur machen, ab heute sorge ich für dich. Ich bringe jetzt das Geld nach Hause. Und ich führe dich zum Essen aus und ins Kino, jeden Abend.
Ob die Blonde wohl auf Jungs mit Iro steht?, fragt er sich und betrachtet sich im Spiegel. Egal, was kümmert es ihn?
7
Letizias Trattoria war zu einem angesagten Ort geworden. Die Gäste kamen vom Vomero, aus Posillipo und vom Bezirk Chiaia, parkten ihre Wagen auf den bewachten Parkplätzen am Rand des Viertels, jenseits der gierigen Blicke der Autoknacker.
Mit der hymnischen Besprechung eines Gastrokritikers in einer der Tageszeitungen hatte alles begonnen. Letizia fragte sich immer wieder, wann der Mann, ein Namenloser wie so viele, in ihr Lokal gekommen war und sich an einen der Tische mit den rot karierten Decken gesetzt hatte, um die «köstliche Soße aus roten Zwiebeln» und das «phantastische Tintenfischragout, eine Wohltat für die Sinne» zu kosten. Andererseits war sie stolz darauf, es nicht gewusst und folglich den Journalisten nicht anders als alle anderen behandelt zu haben.
Weil der Mann eine Koryphäe auf seinem Gebiet war, berüchtigt für seine gnadenlosen Verrisse von vermeintlichen Erste-Klasse-Restaurants, war der rasante Aufstieg der winzigen Trattoria nach Erscheinen des Artikels unaufhaltsam gewesen. Das Telefon klingelte unablässig, und es hagelte Reservierungen. Letizia hätte die Preise deutlich anheben können, den Speiseraum auf Kosten der Küche oder des Kellers vergrößern, extra Tische für die vornehme Kundschaft bereitstellen und ein paar Kellner anstellen können. Doch es wäre nicht mehr ihre Trattoria gewesen.
Ihr gefiel es, die Bestellungen selbst entgegenzunehmen, durch das Lokal zu streifen und mit ihren Gästen ein Schwätzchen zu halten. Solche Gespräche – ohne dass es zu vertraulich wurde – halfen ihr, geschmackliche Vorlieben besser zu erkennen und die richtigen Empfehlungen zu geben. Man geht ins Restaurant, um miteinander zu reden – wenn ihr das nicht wollt, dann kauft euch unterwegs irgendwo ein Sandwich. Das war ihre Philosophie.
Einer der Gründe, warum der Weg in die dunkle, feuchte Gasse unbedingt lohne, schrieb der Kritiker, sei Letizia selbst, «eine hübsche Brünette, freundlich und warmherzig, stets mit einem flotten Spruch auf den Lippen und einem ansteckenden Lachen». Was der Mann nicht ahnte: Hinter dem ansteckenden Lachen verbarg sich ein eiserner Wille, den sie sich nach einem schweren Schicksalsschlag zugelegt hatte.
Sie sprach nie über ihren Mann, der schon vor Jahren ums Leben gekommen war; die einen sagten, bei einem Unfall, die anderen, nach kurzer schwerer Krankheit. Sie hatte keine Kinder, und niemand wusste von irgendwelchen Beziehungen, die sie danach eingegangen wäre, obwohl nicht wenige sich von ihrem charmanten Lächeln und dem großen Busen angezogen fühlten. Aber da war die Trattoria, die geführt werden musste, und mit ihren vierzig Jahren hatte sie keine Lust mehr auf irgendwelche Abenteuer.
Kurz bevor der Artikel erschienen und mit ihm der Reservierungswahn ausgebrochen war, hatte sich ihr Augenmerk auf einen ihrer Stammgäste gerichtet. Er setzte sich immer an den Ecktisch, den man von den anderen Plätzen aus kaum wahrnahm und den nie jemand haben wollte, weil er sich genau unter dem Fernseher und gegenüber der Eingangstür befand. Der Mann zog nie seinen Mantel aus, las nicht, kam stets ohne Begleitung. Er bestellte das Menü des Tages, aß schnell; aber dann blieb er sitzen, um Wein zu trinken, ein Glas nach dem anderen, mit Methode und ohne Genuss, als wäre es eine Medizin.
Letizia betrachtete ihn neugierig und auch ein wenig mitleidig. Er hatte ein merkwürdiges Gesicht, es schien wie aus Holz geschnitzt, mit hohen Wangenknochen und schwarzen Mandelaugen. Insgeheim nannte sie ihn «der Chinese». Sie hätte gerne mit ihm geredet. Ihre kommunikative Ader drängte sie förmlich dazu, jenes Schweigen zu brechen, das ihn wie ein durchsichtiger Schleier vom Rest der Welt abzuschotten schien, aber sie spürte, wie dünn das Eis war und dass er vielleicht nach ein paar einsilbigen Wortwechseln nicht mehr zum Essen zu ihr gekommen wäre.
Intuitiv hatte sie begonnen, ihm seinen Stammplatz frei zu halten. Auch wenn sich draußen auf dem Bürgersteig eine Warteschlange bildete, die Gäste im strömenden Regen dicht gedrängt unter ihren Schirmen ausharrten, so blieb doch immer der Ecktisch frei in Erwartung seines stummen Gefährten. Und er kam, auf die Minute genau, die Haare zerzaust, der Trench zerknittert, und setzte sich unter den Fernseher. Für Letizia war es wie eine lang ersehnte Verabredung, so ersehnt, dass sie ihre Preise für ihn sogar noch ein weiteres Mal senkte.
Eines Abends war «der Chinese», mit dem Rücken gegen die Wand und dem Weinglas in der Hand, eingenickt. Seine Miene war schmerzverzerrt, er schien verloren in irgendeinem grausamen Traum. Zwei Pärchen, die am Nachbartisch saßen, begannen sich gegenseitig mit den Ellbogen anzustoßen und Witze über ihn zu reißen. Eines der Mädchen ließ sogar extra eine Gabel zu Boden fallen, um ihn aufzuschrecken. Doch er verharrte in seinem verzweifelten Schlaf. Letizia fühlte, wie ihr Herz sich zusammenzog, und sie trat näher, um sich an seinen Tisch zu setzen und seine Ruhe zu schützen. Ohne die Augen zu öffnen, murmelte er:
«Verzeihen Sie, aber ich habe fürchterliche Kopfschmerzen. Geben Sie mir noch eine Minute, dann stehe ich auf und mache den Tisch frei.»
«Machen Sie sich keine Sorgen, Sie können so lange hierbleiben, wie Sie wollen. Ich bringe Ihnen ein Aspirin – dann geht es Ihnen bestimmt gleich besser.»
Immer noch mit geschlossenen Augen, aber mit einem schiefen Lächeln auf den Lippen, hatte er gesagt:
«Meine Kopfschmerzen lassen sich nicht von Aspirin vertreiben. Aber danke, danke trotzdem. Vielleicht können Sie mir noch ein Glas Wein bringen. Und die Rechnung.»
Seit jenem Abend hatte es sich Letizia, wenn in der Trattoria nur wenig Betrieb war, zur Gewohnheit gemacht, an dem kleinen Ecktisch Platz zu nehmen und ihr Abendessen dort, statt in der Küche, zu sich zu nehmen.
Ein Wort gab das andere, Abend für Abend, aus «dem Chinesen» war Inspektor Giuseppe Lojacono geworden, genannt Peppuccio, wie die ferne Familie ihn gerufen hatte und die Freunde aus Montallegro in der Provinz Agrigento – Freunde, die keine mehr waren. Allmählich hatte sich aus den Bildern, die er auf dem Grund seines Rotweinglases fand, eine traurige Geschichte herauskristallisiert, die kaputte Ehe und die Tochter inklusive, deren Stimme er zu vergessen begann.
Abend für Abend war Letizia für Lojacono eine Art Fenster zur Stadt geworden. Eine Stadt, die so ganz anders war, als er es sich vorgestellt hatte: misstrauisch, klamm und dunkel, viel verschlossener und undurchdringlicher, als es zunächst den Anschein hatte. Eine Stadt, in der jeder darauf bedacht war, nicht in Schwierigkeiten zu geraten, in der man nur mit seinem eigenen Kram beschäftigt war, stets auf dem Sprung. Eine Stadt, die einem zwischen den Fingern zerrann, die sich urplötzlich verflüssigte oder in Luft auflöste.
Lojacono, der selbst aus einer Gegend stammte, die keineswegs mit dem bloßen Verstand zu begreifen war, fragte sich, worauf das fragile Gleichgewicht zwischen der Stadt und ihren Bewachern, den Carabinieri und Polizeibeamten, wohl beruhte. Er sah seine Kollegen kommen und gehen, komplexe Vorgänge abschließen und sich neuen widmen, Tag für Tag, während um sie herum wie in einem riesigen Kochtopf irgendwelche Kleindelikte hochkochten. Kopfschüttelnd sagte er zu Letizia, das Ganze komme ihm vor wie ein Netz ohne Boden, ein System ohne Halt. Er begreife nicht, wieso es nicht schon längst zusammengebrochen sei.
Die Frau lächelte und straffte die Schultern.
«Vielleicht ist es so», sagte sie, «dass hier jeder Einzelne mühsam versucht, auf eigenen Beinen zu stehen, und dass die Stadt am Ende genau dadurch zusammengehalten wird.»
Und er gab ihr zur Antwort sein seltsam schiefes Lächeln, das ihr so gut gefiel, und hob sein Glas, um auf die düstere Stadt und auf ihr, Letizias, helles Lachen anzustoßen.
8
Der Alte schleicht um die Häuser.
In seinen ausgetretenen Schuhen schlurft er über das holprige feuchte Pflaster, ein Bein leicht hinter sich herziehend. Er ist vorsichtig, richtet den Blick nach unten, um nicht auszurutschen. Hin und wieder kramt er in seiner Tasche nach einem Taschentuch und wischt sich über das linke Auge.
Der Alte bewegt sich nur langsam vorwärts. Wenn er an eine Kreuzung kommt, bleibt er stehen, schaut von einer Straßenseite zur anderen und wartet ab, bis die zahlreichen Mopeds und Vespas – manchmal mit zwei, drei Beifahrern hintendrauf – an ihm vorbeigerast sind.
Der Alte schleicht um die Häuser, und niemand bemerkt ihn. Er ist wie eine Windböe, wie eine Ratte im Dunkeln. Wem sollte er schon auffallen, er, der er aussieht wie all die anderen Gespenster, die diese düstere Stadt bevölkern.
Hin und wieder begegnet der Alte jemandem: einer von der Last der Jahre niedergedrückten Frau, einem Schwarzen mit einer Sporttasche über der Schulter, einem Mann, dessen Gesicht von Schicksalsschlägen gezeichnet ist. Er wendet den Blick ab, und genau so tun es die anderen, denn der Tod ist kein schöner Anblick, ebenso wenig wie seine Vorboten.
Der Alte schleicht um die Häuser, und niemand bemerkt ihn. Er läuft an den Fenstern der Kellerwohnungen vorbei, aber er guckt nicht hinein. Er schaut sich das Elend nicht an. Und das Elend schaut ihn nicht an.