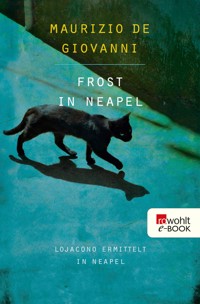
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Serie: Lojacono ermittelt in Neapel
- Sprache: Deutsch
Es herrscht bittere Kälte in Neapel, als ein grausamer Doppelmord gemeldet wird: Ein junger Biochemiker und seine bildhübsche Schwester wurden tot in ihrer gemeinsamen Wohnung aufgefunden. Wer kann diese Tat von beispielloser Skrupellosigkeit verübt haben? Der Vater, der gerade erst sechzehn Jahre Gefängnis wegen Totschlags hinter sich hat? Der Verlobte der Frau, ein Provinz-Rockstar, der ihre angehende Karriere als Topmodel und ihr gutes Verhältnis zu ihrem Bruder mit Eifersucht beäugte und zu Wutausbrüchen neigte? Wo bleibt das Motiv? Die Ermittler tappen im Dunkeln, aber sie stehen unter Druck. Wenn der Fall nicht schnell aufgeklärt wird, droht dem Kommissariat von Pizzofalcone die Schließung. Erst als Lojacono und seiner Truppe aufgeht, dass es der Mörder nicht zwangsläufig auf beide Geschwister abgesehen haben muss, gerät die Sache in Bewegung…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 436
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Maurizio de Giovanni
Frost in Neapel
Lojacono ermittelt
Kriminalroman
Über dieses Buch
Es herrscht bittere Kälte in Neapel, als ein grausamer Doppelmord gemeldet wird: Ein junger Biochemiker und seine bildhübsche Schwester wurden tot in ihrer gemeinsamen Wohnung aufgefunden. Wer kann diese Tat von beispielloser Skrupellosigkeit verübt haben?
Der Vater, der gerade erst sechzehn Jahre Gefängnis wegen Totschlags hinter sich hat? Der Verlobte der Frau, ein Provinz-Rockstar, der ihre angehende Karriere als Topmodel und ihr gutes Verhältnis zu ihrem Bruder mit Eifersucht beäugte und zu Wutausbrüchen neigte? Wo bleibt das Motiv?
Die Ermittler tappen im Dunkeln, aber sie stehen unter Druck. Wenn der Fall nicht schnell aufgeklärt wird, droht dem Kommissariat von Pizzofalcone die Schließung. Erst als Lojacono und seiner Truppe aufgeht, dass es der Mörder nicht zwangsläufig auf beide Geschwister abgesehen haben muss, gerät die Sache in Bewegung …
Vita
Maurizio de Giovanni wurde 1958 in Neapel geboren, wo er auch heute noch lebt. Er studierte Literatur und hat lange Zeit als Banker gearbeitet. «Das Krokodil», der erste Fall in der Serie um Inspektor Lojacono, wurde 2012 mit dem wichtigsten Preis für italienische Kriminalromane, dem Premio Scerbanenco, ausgezeichnet. «Frost in Neapel» ist der vierte Fall um Lojacono und seine Kollegen von Pizzofalcone. Maurizio de Giovanni ist einer der erfolgreichsten lebenden Krimiautoren Italiens. Seine Bücher werden in zahlreiche Länder verkauft, unter anderem nach Frankreich, England und in die USA.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel «Gelo» bei Giulio Einaudi editore s.p.a., Turin.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Dezember 2017
Copyright © 2017 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«Gelo» Copyright © 2014 & 2016 by Giulio Einaudi editore s.p.a., Turin
Redaktion Petra Müller
Umschlaggestaltung any.way, Barbara Hanke/Cordula Schmidt
Umschlagabbildung Neuebildanstalt/Freudenthal
ISBN 978-3-644-31611-9
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Caterina, Emiliano,
Delia, Ludovica.
Allen die wunderbare Zukunft,
die in ihren Augen und Herzen leuchtet.
1
Auf einmal spürst du die Kälte.
Sie trifft dich wie ein Peitschenhieb, wie ein plötzliches Erkennen.
Du spürst sie, während du dich über sie beugst, dein Gesicht nur wenige Zentimeter von ihrem entfernt, du schaust in ihre erloschenen Augen. Die Kälte. Dieses stechende Gefühl auf der bloßen Haut, heftig, gnadenlos, als gäbe es nichts anderes als die Kälte, als hätte es nie etwas anderes gegeben.
Du nimmst sie mit allen deinen Sinnen wahr, du siehst sie in den Schwaden, die aus deinem Mund aufsteigen, hörst sie in deinem keuchenden Atem, inhalierst sie durch die Nase, schmeckst sie sogar auf deiner ausgedörrten Zunge. Und du spürst sie auf der Haut.
Du springst auf, als hättest du erst jetzt begriffen, wo du bist und was du getan hast. Du schaust dich um, orientierungslos. Allmählich lässt die Wut nach und macht Platz für die Vernunft. Wie eine Stimme von weit her, die an die Oberfläche zu dringen versucht, möchte sie sich Gehör verschaffen. Schnell, schnell.
Du beeilst dich, auch wenn es vielleicht nicht nötig ist. Von draußen dringt kein Geräusch herein: Wenn es so kalt ist, igeln sich die Leute in ihrem warmen Zuhause ein, lassen sich berieseln vom Fernseher, hängen vor der Playstation und haben nur noch ein Gesprächsthema: «Was für eine Kälte! So eine verfluchte Kälte! Menschenskinder, habt ihr schon mitgekriegt, wie saukalt es draußen ist? Und die Temperatur soll sogar noch fallen – da kann man sich ja nur noch ins Bett legen und auf den Sommer warten.»
Dummköpfe, alles Dummköpfe. Sie denken, die anderen sind genauso dumm. Aber du nicht. Du bist nicht dumm.
Du schaust dich ein letztes Mal um. In ihrem Zimmer. Überall sind ihre Sachen verteilt. Plüschtiere, Wäsche. Ein einziges Chaos. Nichts von dir, kein verräterisches Detail. Sehr gut. Langsam gehst du hinaus, da ist die Tür zur Küche, die Eingangstür. Zu deiner Rechten das große Zimmer.
Vom Flur aus ist er nicht zu sehen. Du reckst dich vor, nur ein paar Zentimeter, hältst den Atem an, die Schwaden aus deinem Mund versiegen. Im ersten Moment denkst du, er sei aufgestanden, warte auf dich hinter der Tür, womöglich mit einem langen Messer in der Hand, wie in einem dieser schlechten amerikanischen Filme, bei denen die Handlung so vorhersehbar ist.
Doch, da ist er. Du siehst seine Hände, einen Block, das Display seines Handys. Er hält einen Stift in der Hand.
Du bleibst stehen. Denkst, er nimmt seine Notizen wieder auf oder macht sich anderswie bemerkbar, mit einem Hüsteln, einem Lachen. Das schwache Licht der Deckenlampe, das rote Leuchten vom Heizstrahler, dessen Kabel er mit Isolierband verstärkt hat, weil er immer darüber stolperte, zerstreut, wie er ist.
Wie er war …
Wieder diese innere Stimme: «Nun mach schon, beeil dich! Jede Sekunde zu viel kann dein Verhängnis sein. Du musst dich beeilen.»
Du atmest tief durch und betrittst das Zimmer. Du schaffst es nicht, zu ihm hinzuschauen, zu dem auf die Tischplatte gesunkenen Kopf, dem herabhängenden Arm, der Hand mit dem Stift.
Jetzt wäre eine Stärkung gut, denkst du und schluckst. Etwas Kräftiges, ein Glas Wein oder besser einen Schnaps. Etwas, das in der Kehle brennt, das Wärme im Bauch und Leichtigkeit im Kopf erzeugt. Vielleicht haben sie hier ja was zu trinken. Quatsch, denkst du, was sollen sie denn schon haben, diese armen Schlucker. Diese Phantasten, die sich verzweifelt an die Vorstellung geklammert haben, ihren Weg zu machen, in einer Stadt, die sie nicht wollte.
Verhungert sind sie.
Tot sind sie. Mausetot.
Hier drinnen ist es kälter als draußen, denkst du. Wie in einem Eisloch. Oder wie im Leichenschauhaus. Mit zitternder Hand fasst du dir an die Stirn. Vielleicht hast du Fieber? Vielleicht ist alles nur ein Traum, einer von diesen verfluchten Albträumen, aus denen man endlich aufwachen möchte? Vielleicht schlägst du ja jeden Moment die Augen auf und findest dich unter deiner warmen Bettdecke wieder. Und denkst mit einem Lächeln: Gott sei Dank, es ist vorbei.
Es ist alles vorbei …
Die Stimme, diese Stimme in deinem Kopf: «Beeil dich. Schau genau hin: Gibt es etwas, das dich verraten könnte? Das deine Anwesenheit hier bezeugt?»
Du musst auf jeden Fall noch mal zu ihm zurück, ob du willst oder nicht. Jede Geste, jede Bewegung musst du von ihm aus rekonstruieren. Von ihm und seinem Kopf aus.
Sein verdammter Kopf, mit dieser absurden Vertiefung am unteren Ende, dort, wo die Wirbelsäule beginnt. Die Stelle ist jetzt feucht und dunkel, als hätte ihm jemand Farbe übergeschüttet, über Nacken und Schultern. «Schau mal, wie lustig!» Sein Hemdkragen ist ganz schwarz von Blut.
Das rote Leuchten des Heizstrahlers erscheint wie das Licht der Hölle.
Dein Blick wandert über den Boden. Endlich sehen deine Augen, was sie sehen müssen: die Bronzeplastik. Du beugst dich hinunter und greifst nach ihr.
Du bist überrascht. Sie war so leicht vorhin. Vorhin, als die Wut deinen Arm geführt hat, als der Furor durch deine Adern strömte. Jetzt wirkt sie zentnerschwer, das in Metall gegossene Abbild einer Frau mit Schärpe, die Trophäe von irgendeinem geistlosen Sommerabend mit Musik aus den Sechzigern und jungen Männern auf der Suche nach flüchtigen Bekanntschaften. Du betrachtest sie, als würdest du sie zum ersten Mal sehen.
Symbole. Sein Kopf, ihr Gesicht.
Sein Kopf, den du gerade erst zertrümmert hast, ein Kopf voller Geist, Ehrgeiz und Wissensdurst. Ein Kopf, auf den du eingehauen hast: zwei, drei, fünf Mal, obwohl schon der erste Schlag genügt hätte. Ein dumpfes, feuchtes Knacken, wie wenn man eine Nuss zertritt.
Ihr Gesicht, ihr schönes Gesicht, die perfekte Nase, die verlockenden roten Lippen: geschwollen, von dir verunstaltet, nicht mehr wiederzuerkennen, aufgeplatzt, zerstört wie ihr Leben.
Symbole.
Genau, denkst du, während du die Bronzeplastik in deiner Jacke verstaust: zerschlagen und zerstört wie eure Hoffnung, das Elend zu verlassen, in dem ihr aufgewachsen seid und wo ihr besser geblieben wärt. Sein Kopf, ihr Gesicht. Du hast es nicht mit Vorsatz getan, aber wenn du hättest wählen können, hättest du nicht anders gehandelt. Es war ihre einzige Hoffnung, ihre Eintrittskarte in ein besseres Leben.
Oder in die Hölle.
Panik überkommt dich. Du musst hier weg!
Du gehst zurück in den Flur. Du bist jetzt hellwach, dein Verstand ist klar wie ein Morgen, an dem der Nordwind bläst, kalt wie die Temperaturen, die da draußen herrschen. Du machst die Tür hinter dir nicht zu, du lehnst sie nur an. Womöglich würde jemand das Schloss einschnappen hören, und alles wäre verloren.
Besser, du nimmst die Treppe als den Aufzug, so weiß niemand, aus welchem Stockwerk du kommst. Du könntest dicht an die Wand gepresst die Stufen hinuntergehen, im Halbdunkel, aber wer sollte dich schon sehen? Es ist spät am Abend, und bei dieser Kälte geht sowieso niemand raus, wenn es nicht unbedingt erforderlich ist.
Während du dich im Treppenhaus nach unten schleichst, kannst du das Plärren der Fernseher aus den Wohnungen hören.
Da, die Haustür! Und schon stehst du auf der Straße.
Der eisige Wind schlägt dir entgegen und nimmt dir den Atem. Du verbirgst dein Gesicht hinter dem Mantelkragen, auch wenn die Gasse menschenleer ist. Du musst etwas trinken, du sehnst dich nach Wärme. Jeder Schritt führt dich weiter fort von diesem Leichenschauhaus, von diesen Zimmern, in denen der Tod sich breitgemacht hat. Du zitterst am ganzen Körper, deine Hände ebenso wie deine Beine. Dein Rücken schmerzt vor Anspannung. Das Gewicht der Bronzeplastik in deiner Jacke sagt dir, dass alles wahr ist.
Du siehst die Leuchtreklame von einer Bar. Das Schöne an dieser verdammten Stadt ist, dass sich zu jeder Tages- und Nachtzeit irgendjemand findet, der dir was zu essen, zu trinken oder zu rauchen gibt, weil er scharf auf dein Geld ist.
Du trittst ein. In einer Ecke stehen ein paar Typen vor einem Spielautomaten. Drei Männer und eine Frau sitzen an einem Tisch. Es riecht nach Schweiß und altem Fett, aber wenigstens ist es warm.
Du setzt dich hin, befreist dich von deiner Jacke und dem Totengewicht der Bronzeplastik. Du legst deine Hände auf den Tisch und wartest darauf, dass sie aufhören zu zittern.
Du bestellst was zu trinken und auch zu essen, um nicht aufzufallen.
Lauter unnötige Vorsichtsmaßnahmen, denkst du, denn die übernächtigte Bohnenstange, die dich bedient, schaut dir nicht mal ins Gesicht.
Ein neapolitanischer Schlager dröhnt aus den Lautsprechern. Die Videopokerspieler sind auf ihre Automaten fixiert. Die vier jungen Leute an einem der Tische amüsieren sich und lachen laut.
Endlich im Alltag angekommen. Unsichtbar. Alles ist gut jetzt. Alles ist gut.
Du trinkst. Und trinkst. Und nimmst noch einen Schluck.
Doch die Kälte will nicht weichen.
2
Mit einem eleganten Hüpfer, der einer Ballerina würdig gewesen wäre, betrat Polizeioberwachtmeister Marco Aragona den Raum.
«Guten Morgen, die Herrschaften. Ist das nicht ein wunderschöner Tag heute?»
Seine Begrüßung stieß auf düsteres Schweigen. Inspektor Lojacono schaute von seinem Aktenordner auf und warf dem jungen Kollegen einen entnervten Blick zu. Der Stellvertretende Kommissar Giorgio Pisanelli seufzte und schüttelte den Kopf.
Aragona ließ nicht locker. In beleidigtem Unterton sagte er:
«Also hört mal … Was ist denn das für eine Frontenbildung? Darf man vielleicht erfahren, welche Laus euch über die Leber gelaufen ist, dass ihr nicht mal mehr guten Tag sagt?»
Ottavia Calabrese schaute hinter ihrem großen Bildschirm hervor.
«Du hast ja recht, Marco. Guten Morgen! Auch wenn ich ehrlich gesagt nicht finde, dass heute ein schöner Tag ist. Nachts war es unter null, und am Morgen, als ich mit unserem Hund Gassi gegangen bin, waren die Bürgersteige komplett vereist.»
Lächelnd rieb Aragona sich die Hände.
«Aber was ist denn so schlimm an einem schönen, kalten Wintertag? In dem Dorf meiner Eltern schneit es jedes Jahr, und alle freuen sich und sind guter Dinge.»
Der Mann mit dem Stiernacken und den breiten Schultern, der an einem Schreibtisch etwas abseits saß und Zeitung las, brummelte:
«Was man an Eis und Schnee so toll finden kann, würde ich wirklich gerne mal wissen. Die alten Leute rutschen auf der Straße aus und brechen sich die Knochen, die Autofahrer produzieren massenhaft Auffahrunfälle, und draußen hält man es vor Kälte nicht aus.»
Aragona breitete resigniert die Arme in Richtung seines Kollegen Francesco Romano aus.
«Du hat doch immer was zu meckern, Hulk. Ich kann mich nicht erinnern, dich in den letzten Monaten mal lächeln gesehen zu haben, von herzhaft lachen ganz zu schweigen. Versuch doch wenigstens ein Mal, die Dinge positiv zu sehen! Die Kälte versorgt einen mit Energie, macht Lust, sich zu bewegen. Vielleicht sogar, sich mal so richtig zu verausgaben, was in diesen Breitengraden ja eher untypisch ist.»
Alessandra Di Nardo, deren Schreibtisch sich ganz am Ende des Großraumbüros befand, unterbrach das Reinigen ihrer Dienstwaffe und blaffte:
«Darf ich dich darauf hinweisen, dass du wie üblich der Letzte bist, ganz egal ob warm oder kalt? Von ‹verausgaben› kann bei dir also kaum die Rede sein. Und außerdem, wie siehst du eigentlich aus? Was ist das für ein Pullover?»
Gekränkt fuhr Aragona mit der Hand über den hummerfarbenen Rollkragenpullover, den er unter seinem Jackett trug.
«Schon seltsam, dass ausgerechnet die Jüngste hier in diesem Altersheim keinen Sinn für die Schönheit einer Farbe hat, die immerhin etwas Licht in diese dunkle Jahreszeit bringt. Abgesehen davon hat der Pullover so viel gekostet wie …»
Lojacono und Ottavia beendeten seinen Satz im Chor:
«… sämtliche Klamotten von uns allen hier zusammen.»
«Genau. Weil ihr nämlich Polizisten vom alten Schlag seid. Solche Typen wie euch sieht man nicht mal mehr in den Fernsehserien aus den Siebzigern. Dieser Job geht mit der Zeit, er entwickelt sich, und ihr versteht das einfach nicht. Das ist auch der Grund, warum …»
Diesmal vervollständigten Alex und Romano seinen Satz:
«… ich der Erste sein werde, der hier Karriere machen und diesem …»
Aragona, die Hände wie ein Dirigent beim Einsatz erhoben, setzte zum Schlussakkord an:
«… verschissenen Kommissariat von Pizzofalcone den Rücken kehren wird.»
Hinter ihm ging die Tür auf, und Kommissar Luigi Palma stand im Raum. Alle Anwesenden wandten den Blick ab und ihre Aufmerksamkeit wieder dem zu, womit sie ursprünglich beschäftigt gewesen waren. Außer Aragona, der davon nichts mitbekommen hatte und einen Kratzfuß machte, bei dem er seinem Vorgesetzten den Hintern entgegenstreckte.
Betont langsam klatschte Palma in die Hände.
«Bravo, Aragona, bravo! Mein Kompliment für deinen kleinen morgendlichen Slapstick. Aber jetzt würde ich gerne klären, wie wir den Vormittag hier in diesem Altersheim gestalten, wenn du nichts dagegen hast.»
Der Polizeioberwachtmeister sprang zur Seite, wobei er gerade noch seine blau verspiegelte Sonnenbrille auffangen konnte, die ihm von der Stirn gerutscht war. Er richtete seine Elvis-Tolle, die dem doppelten Zweck diente, seine beginnende Glatze zu verdecken und ein paar Zentimeter Körpergröße hinzuzuschummeln, und setzte sich an seinen Schreibtisch.
Palma schaute auf die Papiere, die er in der Hand hielt, als suchte er Zuspruch in ihnen. Schon am frühen Morgen sah er wie üblich verknittert und erschöpft aus, was durch seinen Dreitagebart, den verrutschten Krawattenknoten und die hochgekrempelten Hemdsärmel noch unterstrichen wurde. Seine widerspenstigen Haare verstärkten den Eindruck von Chaos und Überarbeitung.
«Also», sagte er, «ich habe eine Dienstanweisung für euch. Pisanelli wird euch ins Bild setzen. Wir werden Unerledigtes aufarbeiten, sprich: uns die ungelösten Fälle vornehmen. Es geht darum, festzustellen, wo man noch was machen kann. Alles andere archivieren wir mit einer kurzen Aktennotiz.»
Romano schlug seine Zeitung zusammen und murmelte:
«Schreibkram, immer nur Schreibkram. Wenn ich das vorher gewusst hätte, wäre ich zum Katasteramt gegangen.»
Besorgt wandte sich Ottavia an den Kommissar.
«Ist das eine Anordnung, die vom Präsidium kommt, Commissario? Hat das was zu bedeuten?»
Lojacono musterte seinen Vorgesetzten mit unergründlicher Miene.
«Soll das etwa heißen, dass sie immer noch überlegen, den Laden hier dichtzumachen?»
Pisanelli platzte dazwischen:
«Immer noch diese alte Geschichte? Haben wir nicht längst gezeigt, was in uns steckt? Sollen wir auf ewig mit dem Makel der Erbsünde herumlaufen?»
Das mit dem Makel spielte auf die berühmt-berüchtigte Geschichte von den «Gaunern von Pizzofalcone» an, als die sie jeder einzelne Polizist der Region kannte. Die früheren Kollegen hatten sich des schlimmsten Verstoßes gegen die ehernen Regeln ihres Standes schuldig gemacht und beschlagnahmte Drogen weiterverkauft. Es hatte einen riesigen Skandal gegeben, und das kleine Kommissariat stand kurz vor der Schließung. Am Ende entschieden die übrigen Kommissariatsleiter der Stadt, das Polizeirevier für eine Übergangszeit auf Probe bestehen zu lassen.
Giorgio Pisanelli war neben Olivia Calabrese der einzige Überlebende der nachfolgenden Welle von Verhaftungen und Frühverrentungen und deshalb diesbezüglich besonders empfindlich. Sollte das Kommissariat doch noch geschlossen werden, würde er sich für immer verantwortlich fühlen, obwohl er genauso wenig wie die Kollegin in den Coup involviert gewesen war.
Aragona unterbrach das Gespräch, um wieder einmal seinen unverbesserlichen Optimismus zur Schau zu stellen.
«Vielleicht wollen sie ja nur ein bisschen Altpapier loswerden. Die werden sich hüten, uns rauszuschmeißen: Worüber sollen sich die Kollegen aus den anderen Polizeirevieren denn das Maul zerreißen, wenn es uns, die neuen Gauner von Pizzofalcone, nicht mehr gibt?»
Mit einer heftigen Bewegung drehte Pisanelli sich zu ihm um. Normalerweise war er die Ruhe in Person, doch allein bei der Erwähnung dieses Spitznamens schwoll ihm der Kamm.
«Aragona, ich habe es dir schon tausendmal gesagt, aber du begreifst es einfach nicht! Die Schuldigen haben für ihre Sünden bezahlt oder werden noch dafür bezahlen. Aber die Leute aus dem Viertel hier, das ohne uns eine vollkommen rechtsfreie Zone wäre, sie tragen keinerlei Schuld. Wir müssen weiterhin für sie ansprechbar sein. Und an unserem Image arbeiten. Wir schaffen das, und dann …»
Mit einem bitteren Unterton fiel Romano dem Stellvertretenden Kommissar ins Wort.
«Tolle Imagekampagne! Die benutzen uns, damit wir den Kehraus machen. Und dann Schluss mit lustig. Wir haben alle Dreck am Stecken, wie du weißt. Und wer einmal Mist gebaut hat, der wird es wieder tun. Das kannst du vergessen, glaub mir.»
Palma nahm die Zügel erneut in die Hand.
«Ihr regt euch nur unnötig auf. Wirklich, ohne Grund. Alles, was wir tun müssen, ist ein bisschen aufräumen, mehr nicht. Sobald ein neuer Fall reinkommt, hören wir natürlich sofort damit auf. Also, Giorgio, du gehst mit Aragona und Romano die alten Ordner holen und …»
Das Läuten des Telefons unterbrach ihn. Wie immer ging Ottavia an den Apparat. Nach einem kurzen Smalltalk legte sie den Hörer auf und sagte:
«Das war die Telefonzentrale vom Präsidium. Bei ihnen ist ein Anruf eingegangen, offenbar ein Notfall, im Vico Secondo Egiziaca 32, nur ein paar Schritte von hier.»
Lojacono war bereits aufgestanden und hatte nach seinem Mantel gegriffen.
«Ich übernehme das.»
Palma nickte.
«Einverstanden. Di Nardo, du gehst mit ihm. Dann kommt deine Pistole wenigstens mal an die frische Luft.»
3
Kaum waren Lojacono und Alex zur Tür hinaus und Palma in sein Büro zurückgekehrt, haute Romano mit der Faust auf den Tisch.
«Verdammte Scheiße! Die dürfen raus auf die Straße, und wir sitzen hier und machen Buchhaltung.»
Aufgeschreckt von Romanos Gepolter, sagte Ottavia:
«Komm schon, Francesco. Palma hat ganz sicher niemanden bevorzugen wollen und überhaupt …»
Aragona unterbrach sie.
«Immer musst du Partei für unseren Chef ergreifen. Hulk hat völlig recht: Wenn’s was Wichtiges ist, schickt Palma den Chinesen los. Und Calamity Jane hat genauso einen Stein bei ihm im Brett. Ich möchte wirklich mal wissen, wie man hier Karriere machen soll, wenn man sich mit diesen uralten Fällen befassen muss, die nur noch nicht abgeschlossen sind, weil eure Kollegen vor lauter Dealerei keine Zeit hatten.»
Pisanelli warf ihm einen finsteren Blick zu.
«Aragona, da ich diesen Job hier zu koordinieren habe, neige ich dazu, dir einen hübschen staubigen Aktenordner aufs Auge zu drücken, der seit zehn Jahren darauf wartet, endlich durchgeackert zu werden. Was hältst du davon?»
Ottavia versuchte, die beiden zu besänftigen.
«Ich kann’s nur noch mal sagen: Der Kommissar hat ganz bestimmt nicht vor, irgendjemanden zu bevorzugen. Lojacono hat einfach die meiste Erfahrung. Er hat schließlich in San Gaetano den Fall mit dem Krokodil gelöst und hier die Sache mit der Notarsgattin, bei der du im Übrigen Teil der Ermittlung warst, Marco, also …»
Romano hatte kein Einsehen.
«Auf diese Weise sammelt Lojacono immer mehr Erfahrung, und wir kommen hier nie raus. Ich werde mit Palma reden und ihm sagen, wenn er …»
Ein Hüsteln, das vom Eingang kam, unterbrach ihre Diskussion. Sämtliche Köpfe wendeten sich zur Tür. Auf der Schwelle stand eine gepflegte Frau mittleren Alters, die darauf wartete, dass ihr jemand Aufmerksamkeit schenkte.
«Bitte, Signora, was können wir für Sie tun?»
Auf Ottavias Aufforderung hin trat die Frau einen Schritt vor. Sie schien sich sichtlich unwohl zu fühlen. Aus den Tintenflecken auf ihren Händen, mit denen sie die Henkel ihrer Tasche knetete, schloss Pisanelli, dass es sich um eine Lehrerin handeln musste. Er registrierte auch die rundlichen Formen und die geringe Körpergröße, die von den niedrigen Absätzen kaum kompensiert wurde.
«Ich … Ich möchte Anzeige erstatten. Oder besser: Ich möchte eine … eine Meldung machen, genau. Eine Meldung.»
Romano stand auf. Er wollte sich nicht die zweite Gelegenheit des Tages entgehen lassen, mit dem wahren Leben in Berührung zu kommen statt mit abgelegten Fällen.
«Wir sind ganz Ohr, Signora. Ich bin übrigens Hauptwachtmeister Francesco Romano.»
Die Frau schenkte ihm ein angespanntes Lächeln, das sie gleich viel jünger wirken ließ.
«Guten Morgen. Mein Name ist Emilia Macchiaroli, ich bin Lehrerin und unterrichte an der Sergio-Corazzini-Schule, nur wenige Schritte von hier entfernt. Kann ich … Können wir offen reden?»
«Natürlich, Signora. Wir sind unter uns, das sind alles Kollegen.»
Die Frau schaute sich um und fuhr sich mit der Zunge über die Lippen. Noch immer schien sie sich unbehaglich zu fühlen.
«Nun … Ich bin mir nicht sicher, ob ich richtig handele. Ich hatte einfach das Gefühl, ich müsste das melden … Also, nicht melden im Sinne von … Ich habe versucht, die Mutter zu überreden, dass sie … Aber aus irgendeinem Grund will sie nicht. Nicht, dass das ungewöhnlich wäre, für eine Mutter ist so etwas ziemlich unvorstellbar, und dann ist das Mädchen ein Einzelkind, was es nicht besser macht, wie Sie sich vorstellen können. Auf der anderen Seite habe ich mich gefragt: Was, wenn es stimmt? Natürlich wird zu diesem Thema auch viel herbeiphantasiert, bei dem ganzen Schmutz, der so im Fernsehen gezeigt wird, aber jeder einhundertste Fall ist wahr. Und Sie kennen ja die Geschichte vom Hirtenjungen, der immer aus Spaß ‹Ein Wolf, ein Wolf!› ruft, und als dann wirklich ein Wolf kommt, glaubt ihm keiner mehr … Ich bin wirklich niemand, der überall Gefahr wittert, aber man kann doch auch nicht alles unter den Teppich kehren, oder?»
Aragona starrte sie mit offenem Mund an. Pisanelli versteckte sich hinter einem Aktenordner. Ottavia versuchte, ihre ganze Konzentration auf ihren Bildschirm zu lenken. Romano fragte sich, ob die Frau wirklich eine Antwort erwartete. Aber da das offensichtlich der Fall war, probierte er es auf die unverbindliche Tour.
«Äh, ja, gewiss doch. Und was den Tatbestand betrifft, Signora, worum geht es genau?»
«Na ja, um sexuellen Missbrauch natürlich. Wissen Sie, ich unterrichte Literatur. Heute heißt das Fach anders, aber wir Lehrer vom alten Schlag halten es mit der Tradition. Das ist eine Frage der Prägung: Wenn ich mich als junger Mensch an eine bestimmte Bezeichnung gewöhne, dann …»
Aragona konnte nicht mehr an sich halten.
«Bitte, Signora, kommen Sie zur Sache. Sonst versteht weder der Kollege, um was es geht, noch wir anderen. Und wenn wir Sie nicht verstehen, können wir Ihnen auch nicht helfen.»
Signora Macchiaroli zwinkerte irritiert, als könnte sie es nicht fassen, dass jemand gewagt hatte, sie zu unterbrechen.
«Ich erkläre es Ihnen doch gerade, oder etwa nicht? Wie gesagt, ich unterrichte Literatur, das heißt, ich bin die zuständige Fachbereichsleiterin. Die Kinder schreiben Kurzessays und Erörterungen, machen Recherchen, und ich lese ihre Texte. Natürlich sollen diese in erster Linie widerspiegeln, was sie im Unterricht gelernt haben: Kenntnis über Autor und Werk, das historische Umfeld, in Teilen auch …»
Aragona sprang auf.
«Signora, wenn Sie Ihren Unterricht genauso zäh gestalten wie Ihren Bericht hier, wundert mich gar nicht, dass der Wissensstand in diesem Land immer mehr sinkt. Ich bitte Sie, sagen Sie endlich, warum Sie gekommen sind!»
Romano bedachte Aragona mit einem vernichtenden Blick und bemühte sich um Schadensbegrenzung:
«Signora, wir versuchen lediglich zu verstehen, wozu Sie Anzeige erstatten möchten.»
«Nein, Herr Wachtmeister, keine Anzeige. Ich glaube, eine Anzeige setzt voraus, dass man Gewissheit über ein Verbrechen hat. Diese Gewissheit habe ich jedoch nicht, und ich kann sie auch gar nicht haben. Aber ich habe den begründeten Verdacht, dass eine meiner Schülerinnen sexuell belästigt wird. Und da ich mit meinem Gewissen im Reinen sein möchte, fühle ich die Verpflichtung, das zu melden.»
Ein unbehagliches Schweigen machte sich im Großraumbüro breit. Palma, der von seinem Zimmer aus die Unterhaltung mitgehört hatte, tauchte im Türrahmen auf. Interessiert fragte er:
«Wie alt ist denn Ihre Schülerin? Und wer belästigt sie Ihrer Meinung nach?»
Die Frau drehte sich zu dem Kommissar um und musterte ihn ruhig aus ihren klaren blauen Augen.
«Zwölf Jahre. Sie heißt Martina Parise und geht in die 7b. Und derjenige, der sie sexuell belästigt, ist ihr Vater.»
4
Der Vico Secondo Egiziaca befand sich tatsächlich nur zwei Schritte vom Kommissariat entfernt. Lojacono und Alex Di Nardo brauchten weniger als drei Minuten. Den Mantelkragen hochgeschlagen, die Augen wegen des eisigen Winds zusammengekniffen, drückten sie sich eng gegen die Hauswände, um der Kälte zu trotzen. Bei jedem Atemzug bildeten sich kleine Wölkchen vor ihren Mündern.
Alex atmete genüsslich ein und aus.
«Du kannst sagen, was du willst, Lojacono, aber ich mag diese Kälte. Man muss sich nur bewegen, schon wird einem warm. Bei Hitze kannst du nicht viel machen. Selbst wenn du halb nackt bist, ist es weiterhin heiß. Die einzige Zuflucht bieten Räume mit Klimaanlage, was aber ungesund ist, wie wir alle wissen.»
«Mir ist wirklich schleierhaft, was an einem Wind, der einem die Ohren abreißt, schön sein soll, Di Nardo. Du willst mich wohl auf den Arm nehmen? Was bei mir zu Hause kalt ist, empfindet ihr hier als Hitze. Heute Morgen habe ich gedacht, ich bin in Lappland gelandet. Das Aufstehen war die reinste Tortur. Hier, wir sind da.»
Sie hatten gar nicht erst nach der Hausnummer Ausschau halten müssen. Vor der Eingangstür parkte ein Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht. Ein junger Polizist hüpfte von einem Bein aufs andere, um nicht festzufrieren.
Lojacono trat auf ihn zu.
«Wir kommen vom Kommissariat Pizzofalcone.»
Der Uniformierte machte mit dem Kopf eine Bewegung in Richtung Treppenhaus und hauchte weiter in seine zu einem Trichter gewölbten Hände.
«Endlich! Ihr habt ganz schön lange auf euch warten lassen. Ich bin Ciccoletti, vom Präsidium. Zweiter Stock. Ein junger Mann und ein Mädchen. Es gibt keinen Pförtner, falls ihr einen suchen solltet. Mein Kollege erwartet euch oben. Die Spurensicherung müsste auch jeden Moment hier sein.»
Lojacono hatte sich noch immer nicht an das saloppe Verhalten der Kollegen gewöhnt. Einer der Gauner von Pizzofalcone zu sein, war offenbar ein unauslöschlicher Makel.
Er durchbohrte den Streifenpolizisten mit einem düsteren Blick und zischte:
«Ciccoletti, du hast es hier mit einem Inspektor zu tun. Also nimm gefälligst die Hände vom Mund und stell dich anständig hin. Sonst verpass ich dir ein paar Backpfeifen, damit dir warm wird. Verstanden?»
«Jawohl, Herr Inspektor. Es ist nur so verdammt kalt heute Morgen, und dann dieser Wind. Wir waren so schnell vor Ort und warten hier schon …»
Wortlos drehte Lojacono sich um und betrat das Wohnhaus. Mit einem halb mitleidigen, halb vorwurfsvollen letzten Blick auf den Uniformierten ging Alex ihm nach.
Das Gebäude hatte wie die meisten im Viertel schon bessere Tage gesehen. Doch trotz seiner ramponierten Fassade machte der verwinkelte Altbau einen soliden Eindruck, von den missglückten Modernisierungsversuchen im Treppenhaus einmal abgesehen. Auf dem Weg nach oben registrierte Lojacono die abgeblätterte Tapete, die andersfarbigen Ersatzkacheln und die roh verputzten Risse in der Wand, die nicht noch mal überstrichen worden waren. Jede der hölzernen Wohnungstüren sah anders aus. Ein paar kleinere Aluminiumtüren mit mehreren Klingelschildern davor ließen darauf schließen, dass die ehemals großen Etagenwohnungen in Apartments unterteilt worden waren. Das war auch bei der Wohnung im zweiten Stock der Fall, denn hinter der ersten Tür befand sich ein kleiner Flur mit zwei weiteren Türen, die beide offen standen.
Ein uniformierter Polizist erwartete sie auf dem Treppenabsatz. Er war älter als sein Kollege auf der Straße, was vielleicht der Grund für sein formelles Verhalten war. Er tippte sich an die Mütze.
«Guten Morgen, mein Name ist Stanzione. Sie sind die Kollegen aus Pizzofalcone? Man hat Sie per Funk angekündigt.»
Alex nickte.
«Ja, das sind wir. Ich bin Polizeioberwachtmeisterin Di Nardo, und das ist Inspektor Lojacono. Was können Sie uns sagen?»
Der Mann wandte sich direkt an Lojacono. Wegen des Dienstgrads. Aber auch weil er ein Mann war, dachte Alex mit leichtem Groll.
«Die Tat ist unmittelbar hier passiert, in der rechten Wohnung vom Eingang aus. Zwei junge Leute, Studenten, ein Mann und eine Frau: Sie liegt auf dem Bett, und er sitzt am Schreibtisch im Nebenraum.»
Alex schaltete sich in barschem Ton ein:
«Wer hat sie gefunden?»
Zögernd wandte sich Stanzione erneut an Lojacono, als wäre dieser ein Bauchredner und Alex seine Handpuppe.
«Ein Kollege des Jungen. Er steht ziemlich unter Schock. Er hält sich im Moment bei den Nachbarn auf, zwei … zwei Männer, die ihm erst mal einen starken Kaffee gemacht haben, dem armen Teufel.»
Ohne die Hände aus den Manteltaschen zu nehmen, begutachtete Lojacono erst die Haupteingangstür und dann die zu der rechten Wohnung, auf die der Uniformierte gezeigt hatte: Beide wiesen keinerlei Einbruchsspuren auf. Er trat einen Schritt vor. Das Apartment wurde durch eine nackte Glühbirne und das Licht vom Fenster erhellt.
Immer noch kurz angebunden, kam Alex dem Inspektor zuvor.
«Hast du das Licht angemacht, Stanzione?»
«Um Himmels willen, nein. Ich habe nichts angefasst. Ich bin rein, habe mich umgesehen und sofort wieder raus. Bin ja schließlich kein Anfänger.»
Lojacono, dem Alex’ durchaus berechtigte Feindseligkeit nicht entgangen war, unterdrückte ein Lächeln.
«Als du gekommen bist, Stanzione, waren die Türen da offen, geschlossen oder angelehnt?»
«Offen, Ispettore, alle beide. Und auch die von der anderen Wohnung.»
Alex hatte das vordere Zimmer betreten, aus dem der Lichtschein der Glühbirne kam. Lojacono folgte ihr.
Die Polizistin blieb am Fußende des Bettes stehen, das fast den ganzen Raum ausfüllte.
Vor ihr lag ein junges Mädchen, auf dem Rücken, die nackten Beine leicht gespreizt. Ihre Jacke war offen, und die Fetzen ihres zerrissenen Hemdes bedeckten ihren Oberkörper nur notdürftig. Sie hatte keinen BH an. Ein winziger Slip war bis zu ihrem linken Knie hinuntergerollt. Auf dem Boden ein Paar Jeans.
Selbst in diesem derangierten Zustand mit den blauen Flecken bot ihr Körper einen wunderschönen Anblick.
Lojacono kniete sich hin, um besser sehen zu können: Das Gesicht des Mädchens wies eine Schwellung an Mund und Nase auf, am Hals befanden sich rote Striemen.
Als er den Blick hob, sah er, dass seine Kollegin auf ein großformatiges Foto an der Wand starrte. Es zeigte das Opfer: strahlend im Sonnenschein, nur mit einem Bikini bekleidet, hinter sich das glitzernde blaue Meer. Der Kontrast hätte nicht größer und verstörender sein können: ein Stück Papier voller Leben und daneben ein Körper aus Fleisch und Blut, dem man das Leben genommen hatte.
Der Inspektor verließ den Raum, Alex blieb wie versteinert zurück.
Ein schmaler Flur führte zu dem zweiten Zimmer, das etwas größer war. In der Mitte des Raumes standen ein Schreibtisch und ein Stuhl, auf dem ein Mann saß: den Oberkörper vornübergebeugt, einer seiner Arme baumelte herab, der Kopf und die andere Hand, die noch einen Stift umklammert hielt, lagen auf der Schreibtischplatte.
Achtsam, wo er seine Füße hinsetzte, trat Lojacono näher. Der Leichnam drehte ihm den Rücken zu. Der Hemdkragen war im Nacken dunkel von Blut, unten am Schädel klaffte eine Wunde. Die Kleidung musste das ganze Blut aufgesogen haben, denn nirgendwo auf dem Boden waren rote Flecken zu sehen.
Der Polizist umrundete den Schreibtisch, sodass er das Gesicht des Opfers sehen konnte. Der junge Mann war kaum älter als zwanzig, höchstens fünfundzwanzig. Der Tod hatte in seinem Gesicht einen seltsamen Ausdruck hinterlassen, ein verzerrtes Lächeln, das die obere Zahnreihe freilegte. Die Augen waren halb geöffnet und starrten ins Leere. Es gab keinerlei Anzeichen von einem Kampf, der oder die Mörder schienen ihn überrascht zu haben.
Im Flur stieß Lojacono auf Alex, die auf dem Boden kniete. Den Blick auf einen Gegenstand gerichtet, der unter einer kleinen Kommode lag, fragte sie:
«Was würdest du sagen, was das ist?»
Auch Lojacono kniete sich hin.
«Sieht aus wie ein Handy mit Kopfhörern. Kann man von hier aus schlecht sagen.»
Alex streckte die Hand aus, doch Lojacono hielt sie zurück.
«Lass alles so, wie es ist. Die Kollegen vom Kriminaltechnischen Institut sind unterwegs, sie werden das Teil rausholen und untersuchen. Und wir hören uns jetzt mal an, was derjenige zu sagen hat, der die beiden gefunden hat.»
5
Signora Macchiaroli hatte eine erstaunliche Wandlung vollzogen. Palma vermutete, dass das an der zunehmenden Gewissheit lag, mit dem Gang zur Polizei das Richtige getan zu haben. Er hatte die Lehrerin mit dem Versprechen entlassen, dass sie ihrem Verdacht nachgehen würden, selbstverständlich mit der gebotenen Diskretion. Sie hatte die ganze Zeit die Henkel ihrer Handtasche geknetet und ihm mit äußerster Kühle geantwortet:
«Keine Sorge, Commissario. Ich bin mir meiner Verantwortung voll bewusst und habe ganz bestimmt keine Angst davor, dass jemand mitbekommt, wie ich mich um eine Schülerin in Not kümmere. Lassen Sie nur dort Diskretion walten, wo Sie anders nicht an Informationen herankommen: Häufig verschließen sich Jugendliche ja im Kontakt mit Fremden, und dann muss man ihnen jedes Wort aus der Nase ziehen. Sollten Sie meine Unterstützung benötigen, finden Sie mich in der Schule.»
Die Kollegen im Großraumbüro schätzten den Sachverhalt unterschiedlich ein. Aragona war überzeugt, dass seine Theorie am stichhaltigsten war.
«Wenn ihr mich fragt, hat das Mädel irgendeinen Schwachsinn im Fernsehen gesehen und in einem Schulaufsatz verarbeitet. Und die Alte hatte nichts Besseres zu tun, als gleich zur Polizei zu rennen.»
Romano nickte.
«Nicht unwahrscheinlich. Der Grat zwischen Realität und Fiktion ist an dieser Stelle oft schmal. Ein Vater ist zärtlich zu seiner Tochter und wird gleich zum Kinderschänder gemacht.»
Pisanelli blätterte in dem Ordner vor ihm auf dem Tisch.
«Ich weiß nicht … Diese Lehrerin scheint mir ziemlich viel Erfahrung zu haben, das ist nicht ihr erster Job. Für mein Gefühl ist sie niemand, der sich von Emotionen leiten lässt oder überreagiert. Was meinst du, wie viele Schülerinnen sie in ihrem Lehrerinnenleben schon gesehen hat? Dass sie sich jetzt bei uns meldet, wird seinen Grund haben.»
Aragona ätzte zurück:
«Wie schön, diese Solidarität im Alter: Der in Ehren ergraute Polizist vertraut blind der in Ehren ergrauten Lehrerin! Ich sage dir eins, Presidente: So wie du dir deine komischen Selbstmorde einbildest, bildet sie sich ihre Vergewaltiger-Väter ein. Vielleicht ist es ja sogar eine Art Übertragung: Die Signora möchte gern vergewaltigt werden, du würdest dich gern umbringen. Also fabuliert ihr alle beide davon, dass dieses Schicksal anderen widerfährt.»
Die plötzliche Anspielung auf das, was die anderen für einen harmlosen Spleen ihres dienstältesten Kollegen hielten, löste ein peinliches Schweigen im Raum aus. Pisanelli war überzeugt, dass die Serie von Selbstmorden, die in den letzten Jahren im Viertel stattgefunden hatten, in Wirklichkeit echte Morde waren, und ging hartnäckig dieser Theorie nach, indem er alle möglichen Fakten, Zeugenaussagen und Fotos sammelte. Er tat dies außerhalb der Dienstzeit und zum Schaden von niemandem, daher tolerierte das Team seine fixe Idee, ohne große Worte darüber zu verlieren, und machte sich höchstens in seiner Abwesenheit darüber lustig.
Ottavia half dem Kollegen aus der Verlegenheit.
«Aragona, manchmal bist du wirklich ein Ekel, das man am liebsten zum Mond schießen würde. Du hast kein Recht, dich so über Giorgio zu erheben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du in seinem Alter nicht halb so weise sein wirst.»
Auch Romano, der die Lehrerin ebenso wenig ernst nehmen wollte, reagierte heftig.
«Du bist echt ein Idiot, Aragona! Ein Vollidiot. Ausgerechnet du, der du keine Ahnung von nichts hast, machst hier einen auf Superpsychologe.»
Aragona zuckte mit den Achseln.
«Also wirklich, was habe ich denn schon gesagt? Das war ja nun echt keine Beleidigung, oder, Presidente? Habe ich dich etwa gekränkt? Ich habe nur einen kleinen Scherz gemacht.»
Pisanelli versuchte ein Lächeln.
«Lass gut sein, Marco. Und mach dir keine Sorgen, ich bringe mich schon nicht um. Im Gegenteil, irgendwann werdet ihr alle noch einsehen müssen, dass ich recht habe mit meiner Theorie. Ich weiß, ihr denkt, ich spinne und vergeude meine Zeit. Aber solange meine Arbeit davon unberührt bleibt … Außerdem habe ich meine Gründe, warum ich diesen Fällen weiter nachgehe. Und was diese Lehrerin betrifft: Ich habe nur gesagt, man sollte gewisse Dinge nicht unterschätzen, mehr nicht. Manchmal denkt man sich nichts weiter dabei, und dann ist …»
Romano ließ ihn nicht ausreden.
«Klar, die einen ermitteln in einem doppelten Mordfall, und die anderen müssen sich den Phantasien einer alten Jungfer widmen. Soll der Kommissar doch Lojacono in diese Schule schicken!»
«Wie schon gesagt, Francesco, hier wird niemand bevorzugt», sagte Ottavia beschwichtigend. «Aber davon unabhängig denke ich auch, wir sollten der Sache nachgehen. Solange hier nur der geringste Verdacht von sexuellem Missbrauch besteht …»
Palma erschien auf der Türschwelle zu seinem Büro.
«Wenn nichts Dringenderes anfällt, möchte ich, dass ihr das mit dem Mädchen überprüft, Kollegen. Einen Blick sollten wir riskieren, sicher ist sicher. Romano und Aragona, ihr übernehmt das.»
Aragona versuchte, Widerspruch anzumelden.
«Chef, die Alte sieht Gespenster. Sollen wir nicht wenigstens warten, bis sie Anzeige erstattet, bevor wir aktiv werden? Es gibt mit Sicherheit Wichtigeres zu tun.»
«Zweifellos, Aragona. Wir hatten ja vorhin schon von den ungelösten Fällen gesprochen. Vielleicht sollte ich dir die Protokolle anvertrauen, die noch abgeschrieben werden müssen. Diese Aufgabe würde dich bestimmt ein halbes Jahr lang an deinen Schreibtisch fesseln. Was meinst du?»
Aragona hatte seinen Mantel schon in der Hand. Mit einem Brummeln erhob sich Romano, um ihm zu folgen.
Palmas Stimme nahm einen ernsten Tonfall an.
«Also, Jungs, Schluss mit den Befindlichkeiten, ja? Ein Polizist ist ein Polizist, der jeden Fall mit der gleichen Professionalität angehen muss. Ich will nicht, dass man sich im Präsidium über uns beschwert. Wenn sie den Laden hier schon dichtmachen, dann wenigstens nicht, weil wir Mist gebaut haben. Sind wir uns da einig?»
Aragona schlug die Hacken zusammen und legte zwei Finger an die Stirn, als wäre er bei der Marine.
«Jawohl, Herr Kapitän. Seien Sie unbesorgt. Wir werden uns von unserer besten Seite zeigen und nur Einser aus der Schule mitbringen.»
«Du bist wirklich ein Idiot, Aragona.»
6
Kaum hatte Lojacono die Nachbarwohnung betreten, wurde ihm klar, warum der Kollege Stanzione vorhin ins Stottern geraten war.
Sie ähnelte nicht im Entferntesten der Wohnung der Opfer. Man kam sofort in ein großes helles Zimmer, dessen eine Wand aus einer Fensterfront mit Balkon bestand. Die Einrichtung war eher schwülstig und wurde dominiert von viel Rosa, Spitzenstoffen, Plüschtieren und ausladenden Lampenschirmen auf vergleichsweise dünnen Beinchen.
An einem verchromten Glastisch saß ein schlaksiger junger Mann mit Brille, der sich unaufhörlich seine immer wieder zurückfallenden Haare aus der Stirn strich. Seine Lippen zitterten, und zwei rote Flecken auf seinen Wangen verrieten, wie aufgeregt er war.
Neben ihm stand ein weiterer junger Mann, der eine bunt gemusterte knöchellange Tunika trug. Mit seinem Pferdeschwanz, den nackten Füßen und den geschminkten Augen bot er einen ungewöhnlichen Anblick.
Etwas abseits, als wollte er sich von den beiden anderen distanzieren, befand sich ein dritter junger Mann, der komplett in Schwarz gekleidet war. Sein Körper war untersetzt, und seine Nase und Ohren zierten mehrere auffällige Silberringe.
Stanzione, der Lojacono und Alex Di Nardo begleitet hatte, sagte:
«Ispettore, das ist der junge Mann, der die Toten gefunden und die 112 angerufen hat.»
Lojacono wartete darauf, dass der Polizist auf einen der drei Anwesenden zeigte, doch nichts geschah. Er wandte sich an Alex.
«Di Nardo, erklärst du ihm, dass er sich ein bisschen präziser ausdrücken möchte? Oder soll ich ihm mit Hilfe einer kleinen Skizze verdeutlichen, dass sich in diesem Raum drei junge Männer befinden?»
Der Brillenträger hob zitternd die Hand, wie ein Schüler, der die Antwort auf eine Frage des Lehrers kennt, aber sich nicht traut, sie laut auszusprechen.
«Ich bin … Ich bin derjenige, der … Ich habe die Polizei, also euch gerufen.»
Er stand sichtlich unter Schock. Seine Stimme, die ohnehin nicht sehr tief war, drohte ins Falsett zu kippen, was er mit einem vorgetäuschten Hustenanfall zu überspielen versuchte.
Lojacono musterte ihn schweigend. Schließlich fragte er:
«Wie heißen Sie?»
Der Tunikaträger ergriff das Wort, mit kräftiger Stimme und eindeutig apulischem Dialekt.
«Renato, sag jetzt nichts! Ruf deinen Anwalt an, die verarschen dich sonst. Hast du nicht gemerkt: Der Bulle hat sich uns noch nicht mal vorgestellt.»
Stanziones Stimme triefte vor Verachtung, als er sich in das Gespräch einmischte.
«Nun mach mal halblang, du Vogelscheuche! Leute, die so rumlaufen wie du, gehören eh eingesperrt. Ein bisschen mehr Respekt, klar?»
«Sie können sagen, was Sie wollen, mir machen Sie damit keine Angst! Sie befinden sich ohne jede Befugnis in unserer Wohnung und sollten dankbar sein, dass wir Sie überhaupt reingelassen haben. Stattdessen benehmen Sie sich hier wie die Axt im Wald – ohne auch nur ansatzweise darauf Rücksicht zu nehmen, dass wir alle unter Schock stehen.»
Das war zu viel für Stanzione. Mit rot angelaufenem Gesicht trat er vor und brüllte:
«Du verdammte Tunte, gleich setzt’s was in deine geschminkte Visage!»
Mit einer Kraft, die den Polizisten sichtlich überraschte, packte Alex ihn am Handgelenk.
«Halt den Mund, du Idiot. Dir ist wohl gar nicht klar, dass der Typ dich anzeigen kann, und zwar aus gutem Grund?»
Mit einer entschuldigenden Geste hob Lojacono beide Hände und schob sich zwischen Stanzione und den jungen Mann in der Tunika.
«Entschuldigung, das tut mir leid. Situationen wie diese sind für niemanden leicht. Man gewöhnt sich einfach nicht daran. Mein Name ist Inspektor Giuseppe Lojacono, ich komme vom Kommissariat Pizzofalcone. Das ist meine Kollegin, Polizeioberwachtmeisterin Alex Di Nardo. Den Kollegen brauche ich Ihnen nicht vorzustellen, weil er sowieso gleich geht. Er wird sich zu seinem Kumpel unten am Eingang gesellen und zusammen mit ihm auf die Kriminaltechniker warten – nicht wahr, Stanzione?»
Dem Polizisten schien klar, dass er besser daran tat, sich zu fügen. Mit einem letzten finsteren Blick auf seinen Kontrahenten verließ er die Wohnung. Zumindest für einen Moment schien es, als würde die Spannung im Raum etwas nachlassen.
Der Tunikaträger blies sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht und stellte sich vor.
«Angenehm. Ich bin Vinnie Amoruso und wohne hier zusammen mit meinem Freund Paco Mandurino.»
Er zeigte auf den Schwarzgekleideten, der ein Nicken andeutete.
Lojacono wandte sich an den dritten jungen Mann, der die Toten gefunden hatte.
«Und Sie? Wer sind Sie, und warum sind Sie in die gegenüberliegende Wohnung gegangen?»
Der Angesprochene machte den Mund auf, schloss ihn wieder, stieß einen tiefen Seufzer aus und sagte:
«Ich heiße Renato Forgione. Ich bin ein Freund … ein Kollege und Freund von Biagio. Gestern ist er nicht zur Uni gekommen, ich habe den ganzen Nachmittag auf ihn gewartet. Er ist auch nicht an sein Handy gegangen oder hatte es ausgeschaltet, jedenfalls bin ich heute Morgen … O Gott, mir wird schon wieder ganz schlecht …»
Als wollte er Erlösung erflehen, hatte er bei seinen letzten Worten den Blick auf Vinnie gerichtet, der ihm sanft über die Schulter strich. Er fuhr sich mit der Hand übers Gesicht, wandte den Kopf zu Lojacono und fuhr fort:
«Wir sind ständig in Kontakt, wir arbeiten zusammen, kümmern uns um dieselben Projekte im Fachbereich. Ich habe mir Sorgen gemacht. Er bleibt doch nicht einfach so weg, so ist er nicht … war er nicht, das war absolut ungewöhnlich. Also bin ich hergekommen. Die Tür war nur angelehnt, ich bin rein und habe sie … habe sie … Entschuldigen Sie mich …»
Er sprang auf und rannte ins Bad.
Lojacono wandte sich an Amoruso.
«Kannten Sie die Opfer?»
Der junge Mann hatte seinen Pferdeschwanz gelöst und spielte mit dem Haargummi.
«Wir können es immer noch nicht glauben, Ispettore. Wer tut so was? Wer hat das getan? Jedenfalls hießen die beiden Biagio und Grazia Varricchio, sie waren Bruder und Schwester. Sie kamen aus Kalabrien, aus einem Dorf in der Nähe von Crotone. Er war älter als sie, ein kluger Kopf, ein Kollege von Renato, ich glaube, Biochemiker oder Biologe, irgendwas in der Art, ich kenne mich da nicht aus. Er hat schon eine ganze Weile hier gewohnt, länger als wir. Und wir sind hier seit wann? Seit zwei Jahren vielleicht?»
Der Schwarzgekleidete, der bisher nicht ein Wort gesagt hatte, erwiderte:
«Seit zwei Jahren und zehn Monaten, Vinnie.»
In gespielter Überraschung schlug Amoruso sich die Hand vor den Mund.
«Mein Gott, so lange schon? Wir beide studieren Jura. Zugegeben, wir sind keine sehr eifrigen Studenten, aber wir haben immerhin genug mitgekriegt, um unsere Rechte zu kennen.»
Lojacono brachte das Gespräch zurück aufs Thema.
«Sie haben gesagt, dass er schon eine ganze Weile hier gewohnt hätte – seine Schwester auch?»
Entschieden schüttelte Vinnie den Kopf.
«Das Mädchen ist erst seit ein paar Monaten hier.»
Paco präzisierte seine Aussage erneut.
«Seit sieben Monaten.»
Vinnie bedachte ihn mit einem harten, bösen Blick. Dann wandte er sich an den Inspektor.
«Wenn Paco sich so genau erinnert, werden es in der Tat sieben Monate gewesen sein.»
Forgione kehrte zurück, bleich wie ein Bettlaken und ähnlich zerknittert. Alex nutzte die Gelegenheit, sich in die Diskussion einzumischen und Lojacono zuvorzukommen.
«Sie haben gesagt, die Tür sei nur angelehnt gewesen. Meinten Sie die zum Treppenhaus oder die zur Wohnung?»
«Die zu Biagios Wohnung. Die Tür zum Treppenhaus hat Vinnie mir aufgemacht.»
Alex musterte den Tunikaträger nachdenklich und stellte die unvermeidliche Frage:
«Und Sie haben bis dahin nicht mitgekriegt, dass die Tür nur angelehnt war? Haben Sie nichts gehört, keinen Krach, Schreie, nichts dergleichen?»
Ohne zu zögern, entgegnete Vinnie:
«Doch, Signorina, aber nicht gestern Abend, sondern gestern Nachmittag. Es gab einen Streit. Die eine Stimme gehörte Biagio, die andere einem Mann, den ich nicht kenne. Sie haben starken Dialekt gesprochen. Dann ist jemand gegangen, und Paco ist kurz raus auf den Flur, um nachzusehen. Aber die Tür war zu.»
Lojacono schaute den Schwarzgekleideten an.
«Sind Sie sicher?»
Paco nickte.
«Absolut.»
«Und Sie haben denjenigen, der gegangen ist, nicht gesehen?»
«Nein, er war schon weg.»
Bei der Erwähnung des Streits hatte Renato die Augen aufgerissen, und seine Lippen hatten erneut zu zittern begonnen. Alex tauschte mit Lojacono einen vielsagenden Blick und wandte sich dann an den jungen Mann:
«Wissen Sie, wer der zweite Mann gewesen sein könnte? Hat Biagio Ihnen was erzählt?»
Renato reagierte nicht.
Lojacono versuchte, die Frage noch einmal anders zu stellen.
«Signor Forgione, wussten Sie, dass Varricchio Besuch erwartet hat?»
Der Angesprochene schien ihn noch nicht mal gehört zu haben, sein Blick klebte an Vinnie.
Der Inspektor gab auf und wandte sich erneut an den Tunikamann.
«Die beiden haben also Dialekt gesprochen? Das heißt, Sie haben sie auf Kalabresisch streiten hören?»
Vinnie nickte.
«Ich habe kein einziges Wort verstanden. Nicht, dass ich sie hätte belauschen wollen, aber sie haben total gebrüllt. Grazia war allerdings nicht da, glaube ich, oder sie wollte sich nicht einmischen.»
Langsam drehte Forgione den Kopf zu den beiden Polizisten.
«Ja, Biagio hat Besuch erwartet. Er hat mir vor ein paar Tagen davon erzählt. Und er hatte wirklich Angst vor dem Besuch.»
Lojacono ließ nicht locker.
«Und wen hat er erwartet?»
«Seinen Vater. Er wollte aus seinem Dorf hierherkommen.»
Alex meldete sich zu Wort.
«Aber Sie sagten doch, er hatte Angst vor dem Besuch. Warum das?»
Renato schwieg für einen Moment. Verzweifelt fuhr er mit der Hand über die gläserne Tischplatte. Als er den Blick hob, um zu antworten, lag in seinen Augen eine unendliche Traurigkeit.
«Biagio hat seinen Vater seit fast siebzehn Jahren nicht gesehen. Er hat versucht, diesen Teil seines Lebens zu vergessen. Und vor keiner Sache hatte er mehr Angst als vor dieser Begegnung.»
Nach diesen Worten wurde es still im Raum. Paco und Vinnie schienen verzweifelt einen Weg zu suchen, den Freund zu trösten. Lojacono war derjenige, der schließlich das Schweigen brach.
«Warum hat er ihn so lange nicht gesehen? Hat es Streit gegeben? Eine Trennung? Eine Geldgeschichte?»
«Nein. Biagios Vater war im Gefängnis, sechzehn Jahre lang. Er ist vor gut einem Jahr entlassen worden.»
«Wissen Sie zufällig, warum er im Gefängnis war?», wollte Alex wissen.
Renato drehte sich zu ihr um. Seine Stimme war kaum mehr als ein Flüstern, als er sagte:
«Wegen Mord.»
7
Die Mittelschule Sergio Corazzini befand sich in einer Art Niemandsland. Um genau zu sein, dachte Romano, während er sich mit Aragona auf den Weg dorthin machte, war das ganze Viertel ein Niemandsland: ein langer, an den Rändern ausgefranster Grenzstreifen, der zwei völlig verschiedene und in ständiger Alarmbereitschaft befindliche soziale Schichten nur um wenige Meter voneinander trennte.
Er musterte die Marktstände, die die Bürgersteige blockierten und die Fußgänger zwangen, auf der Fahrbahn zu gehen und sich dem Risiko auszusetzen, von einem der gegen die Einbahnstraße rasenden Motorroller über den Haufen gefahren zu werden. Die Eiseskälte hatte dem alltäglichen Leben nichts anhaben können. Schließlich musste man sich auch ernähren, wenn draußen Frost herrschte, aber die Marktverkäufer hatten sich in den Schutz der Toreinfahrten zurückgezogen, von denen aus sie eingemummelt in Wintermäntel und Wollmützen das Geschehen im Auge behalten und beim geringsten Anzeichen von Kaufinteresse zur Stelle sein konnten.
Niemandsland zwischen zwei Welten.
Die Taschendiebe sind blitzschnell, ob zu Fuß oder zu zweit auf ihren frisierten Rollern, sie haben die Alten, Schwachen und Zerstreuten genau im Blick, schnappen sich, was sie kriegen können, und verschwinden im Labyrinth der Gassen, das sie wie ihre Westentasche kennen und wo sie sich innerhalb von Sekunden in ihre Schlupflöcher zurückziehen können.
Niemandsland.
Die Angestellten aus den Bankfilialen im Anzug oder Kostüm, die mit ernstem Gesicht und konzentriertem Blick selbst auf der Straße noch Millionendeals und Devisengeschäfte abwickeln. Das Headset am Ohr oder das Handy zwischen Wange und Schulter geklemmt, gestikulieren sie im Laufen, während sie ihre falsch geparkten Autos suchen: halb auf dem Bürgersteig und dann noch auf dem Behindertenparkplatz – ist ja nur für eine Minute.
Niemandsland.
Schwarzhändler. Dutzende, Hunderte von Schwarzhändlern. Die Asiaten mit ihren Ständen voller Radios, Ladegeräten, Barometern und Kamerastativen. Die Afrikaner mit ihren auf der Straße ausgebreiteten Tüchern, auf denen sich gefälschte Designerhandtaschen und geschnitzte Holztiere stapeln. Die Osteuropäer mit ihren Flohmarktklamotten, die sie aus der Heimat mitgebracht oder nachts aus der Altkleidersammlung geklaut und notdürftig geflickt haben. Und die Italiener mit ihren Blumen, Nylonstrümpfen, Besen, Schuhen, bedruckten T-Shirts, Fußballfahnen und Azzurri-Schals. Alle lauern sie den Vorbeigehenden auf, packen sie manchmal sogar am Arm, laut und aufdringlich, lästig wie Fliegen, und später gehen sie ihre Stütze kassieren und demonstrieren wutgeladen unter den Fenstern der Regierungspaläste, «Wir wollen Arbeit! Wir wollen Arbeit!», als verdienten sie nicht genug mit ihrem Schwarzhandel, mit ihren Schreiner-, Klempner- oder Elektrikerjobs ohne Rechnung, ohne Beleg: «Seien Sie doch froh, Dottore, so sparen Sie Geld.»
Niemandsland.
Die hundert, tausend, zehntausend Anwälte und Anwältinnen mit ihren wehenden Mänteln oder Zwölf-Zentimeter-Absätzen, die ledernen Aktentaschen vollgestopft mit komplizierten Fallakten, treppauf, treppab hasten sie durch die Gerichtsgebäude in dem Versuch, eine Urteilsverkündung zu beschleunigen, die auf sich warten lässt und an der sie sich noch die Zähne ausbeißen werden. So viele Jahre an der Universität, unzählige Praktika, Kongresse, sinnlose Veröffentlichungen, Spezialisierungen und Zusatzdiplome für einen Fall mit Rechtsschutzversicherung und Hungerlohn: «Ich bin der Cousin von einem Ihrer Freunde, lieber Anwalt, können Sie mir mit Ihrem Honorar nicht entgegenkommen?»
Niemandsland.





























