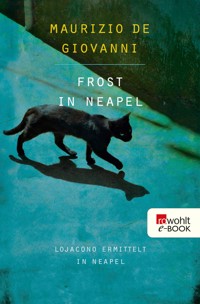9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Serie: Lojacono ermittelt in Neapel
- Sprache: Deutsch
Maurizio de Giovanni, Shootingstar der italienischen Krimiszene, legt den zweiten Band der neapolitanischen Serie um Inspektor Lojacono vor. Im besten Viertel Neapels wird eine Notarsgattin tot aufgefunden. Die Dame sammelte leidenschaftlich Schneekugeln, und ausgerechnet eins ihrer Sammlerstücke musste als Tatwaffe herhalten. Nichts deutet auf ein gewaltsames Eindringen ins Haus. War der Mörder ein Bekannter der Frau? Inspektor Lojacono wurde gerade mit ein paar anderen Polizisten in ein neues Kommissariat, Pizzofalcone, versetzt: Sie müssen den Großteil der alten Besetzung ablösen, die in ein skandalöses Drogendelikt verwickelt war. Mit diesem schlechten Ruf schlagen sich die neuen Beamten nun herum, weshalb sie spaßeshalber nur «die Gauner von Pizzofalcone» genannt werden. Doch während der Regen durch Neapels Straßen peitscht, will bei Inspektor Lojacono so gar keine heitere Stimmung aufkommen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 479
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Maurizio de Giovanni
Die Gauner von Pizzofalcone
Lojacono ermittelt in Neapel
Aus dem Italienischen von Susanne Van Volxem
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Maurizio de Giovanni, Shootingstar der italienischen Krimiszene, legt den zweiten Band der neapolitanischen Serie um Inspektor Lojacono vor.
Im besten Viertel Neapels wird eine Notarsgattin tot aufgefunden. Die Dame sammelte leidenschaftlich Schneekugeln, und ausgerechnet eins ihrer Sammlerstücke musste als Tatwaffe herhalten. Nichts deutet auf ein gewaltsames Eindringen ins Haus. War der Mörder ein Bekannter der Frau?
Inspektor Lojacono wurde gerade mit ein paar anderen Polizisten in ein neues Kommissariat, Pizzofalcone, versetzt: Sie müssen den Großteil der alten Besetzung ablösen, die in ein skandalöses Drogendelikt verwickelt war. Mit diesem schlechten Ruf schlagen sich die neuen Beamten nun herum, weshalb sie spaßeshalber nur «die Gauner von Pizzofalcone» genannt werden. Doch während der Regen durch Neapels Straßen peitscht, will bei Inspektor Lojacono so gar keine heitere Stimmung aufkommen …
Über Maurizio de Giovanni
Maurizio de Giovanni wurde 1958 in Neapel geboren, wo er auch heute noch lebt. Er studierte Literatur, arbeitet aber hauptberuflich als Banker. «Das Krokodil», der erste Fall in der Serie um Inspektor Lojacono, wurde 2012 mit dem wichtigsten Preis für italienische Kriminalromane, dem «Premio Scerbanenco», ausgezeichnet. «Die Gauner von Pizzofalcone» ist der zweite Fall in der Serie. Maurizio de Giovanni ist einer der erfolgreichsten lebenden Krimiautoren Italiens. Seine Bücher werden in zahlreiche Länder verkauft, unter anderem nach Frankreich, England und in die USA.
Inhaltsübersicht
Für Severino Cesari,
Seelenbruder in jeder Hinsicht
1
Das Meer ist überall.
Das Meer ist in der Luft. Das Meer ist auf der Straße.
Das Meer ist am Himmel, hochgestiegen bis zu den verrammelten Fensterläden in den oberen Etagen.
Das Meer ist in den Ohren, wo es selbst das Heulen des Windes übertönt.
Das Meer ist auf den Felsen, wo es zerbirst und raue Schreie ausstößt.
Das Meer fliegt. Das Meer ist in der Luft zerstoben, lauter winzige Wassertropfen.
Es ist wie dein verdammter Schnee, weißt du? Der fällt und fällt, alles ins Chaos stürzt, für einen Moment sogar den Horizont verdeckt und dann auf den Boden sinkt.
Genau genommen fällt er nicht immer auf den Boden. Manchmal lässt er sich auch seitlich nieder. Diesmal. Ich habe ihm zugeschaut, wie er sich seitlich niedergelassen hat, ganz langsam. Auf der gegenüberliegenden Seite.
Nur ein einziger Mensch hat sich auf die Straße getraut. Ich. Wer sonst würde sich um diese Uhrzeit, bei diesem Wetter nach draußen begeben? Auf die Gefahr hin, vom Wind weggefegt zu werden, vielleicht bis auf eine ferne Insel.
Wer weiß.
Ich kann nicht glauben, dass ich es getan habe. Und doch habe ich es getan. Ich wollte es nicht, es war nicht geplant. Ich dachte, wir würden miteinander reden, und am Ende hätte ich dich überzeugt. Ich dachte, du würdest sagen: «Okay, jetzt habe ich es begriffen.» Ich dachte, du würdest sagen: «Ja, du hast recht, du hast mich überzeugt. Ich werde reinen Tisch machen. Und gehen.»
Ich dachte, dir genügt ein kurzer Moment, um das Ganze mit den Augen der Vernunft betrachten zu können. Doch stattdessen? Stattdessen Fehlanzeige. Was für ein Dickkopf du doch bist!
Gewesen bist.
Mein Gott, wie viel Meer da ist in der Luft! Und was für ein Krach! Er betäubt mich. Verwirrt mich.
Ich musste es tun, das verstehst du doch, oder? Ich hatte keine andere Wahl.
Weil die Liebe so ist, wie sie ist. Du kannst sie eine Weile geheim halten, sie verstecken hinter alltäglichen Gesten und Blicken. Du kannst den Mantel des Schweigens über ihr ausbreiten, sie wie eine Pflanze hegen und pflegen. Aber ab dem Moment, da du sie rausgelassen hast, ans Tageslicht, ab dem Moment hast du sie nicht mehr im Griff. Dann hat sie dich im Griff, die Liebe. Sie entscheidet für dich, öffnet sich wie eine wundersame Blüte, will den ganzen Raum einnehmen.
Du hingegen – Fehlanzeige. Du hast der Liebe keinen Raum gegeben. Du hast diesen Schritt nicht gehen wollen. Das hast du nun davon.
Du hättest in meinen Blicken lesen sollen. Hättest es erkennen müssen. Du hattest Zeit genug zu begreifen, dass ich kein Nein akzeptieren, dass ich den Kopf verlieren würde. Man konnte es in meinen Blicken lesen.
Dieser Schnee. Dein verdammter Kunstschnee. Er ist wie das Meer, das mich von Kopf bis Fuß durchnässt wie ein Regenschauer. Das meinen Kopf vor lauter Wind und Wasser bald zum Bersten bringt.
Ich kann sie nicht sehen, deine Fenster, die du verrammelt hast. Zu viel Wind, zu viel Meer ist in der Luft.
Wie dein Schnee, den du so gerne angeschaut hast, wenn er in dem Glas aufstob und die Landschaft unter sich begrub. Hättest du gedacht, dass ausgerechnet dieser Schnee dein letzter sein würde?
Er ist tatsächlich aufgewirbelt. Ein allerletztes Mal, bis er dann langsam niedergesunken ist. Auf der einen Seite das Blut, auf der anderen der Schnee.
Als er sich endlich gelegt hatte, warst du nur noch eine Erinnerung.
2
Giuseppe Lojacono saß auf dem Beifahrersitz des Streifenwagens, den Rücken durchgedrückt, die Hände reglos auf den Oberschenkeln. Mit seinen hohen Wangenknochen, den schräg stehenden Augen, die zu zwei schmalen Schlitzen wurden, wenn er sich konzentrierte, dem ungebändigten schwarzen Haar, dem stets unter Spannung stehenden Körper, als müsse er jeden Moment losstürzen, sah er tatsächlich aus wie ein Chinese. Den Spitznamen hatten ihm die Kollegen gegeben, natürlich ohne dass er davon wusste, denn er war niemand, den man rasch ins Vertrauen zog. Die tiefen Falten neben den Mundwinkeln ließen erahnen, dass er die vierzig bereits überschritten hatte, wenn auch noch nicht lange.
Lojacono hing seinen Gedanken nach. Er dachte, wie schnell er doch all das verloren hatte, was er sich mit Mühe aufgebaut hatte. Und dass bei ihm zu Hause um diese Jahreszeit, Ende März, die Mandelbäume bereits in voller Blüte standen und die Sonne so warm war, dass man an den Strand gehen, aufs Meer schauen und die Seele baumeln lassen konnte. Hier hingegen schien der Winter alles noch in seiner Gewalt zu haben: Sturmböen, die sich mit Regenschauern abwechselten, Passanten, die hinter ihren vom Wind zerrupften Regenschirmen herjagten, zum Stillstand verdonnerte Autofahrer, die ihren Unmut durch permanentes Hupen zum Ausdruck brachten.
Aber sein Zuhause war weit weg, Lichtjahre entfernt, in Raum und Zeit. Vielleicht inzwischen sogar unerreichbar. Abgesehen davon, dass er dort ohnehin unerwünscht sein würde. Er war einfach zu unbequem. Als Freund, als Familienmitglied, als Kollege.
Er dachte an seine Unterredung mit Kommissar Di Vincenzo, seinem Vorgesetzten. Nicht, dass sie jemals gute Freunde gewesen wären, aber seit der Geschichte mit dem Krokodil war die Situation erst recht belastend.
Das Krokodil: Der verzweifelte Alte, der vier Kinder umgebracht hatte. Den er, ohne offiziellen Auftrag, dingfest gemacht hatte. Dessen Motiv und Identität er aufgedeckt hatte. Während sämtliche Polizisten der Stadt in den üblichen Schubladen gewühlt hatten – Camorra, organisiertes Verbrechen, Drogenhandel –, ohne den geringsten Erfolg zu landen.
Die Sache hatte ihn halbwegs rehabilitiert, aber bei den Kollegen erst recht unbeliebt gemacht. Einer, der weder Ortskenntnis noch Kontakte in die Szene besaß und einen so komplizierten Fall, eine Handvoll Serienmorde, allein durch logisches Denken gelöst hatte. Der für das Polizeipräsidium, das von Presse und Öffentlichkeit mit dem Rücken zur Wand gestellt worden war, die Kastanien aus dem Feuer geholt hatte.
An dem Punkt musste etwas mit ihm geschehen. Sie konnten ihn unmöglich in der Abteilung für Strafanzeigen sitzen lassen, in einem Kommissariat, das sich in dem Viertel mit der höchsten Kriminalitätsrate befand. Ihm stand zweifelsohne ein adäquater Job zu, sonst würde noch irgendein Boulevardblatt aus Mangel an zugkräftigen Schlagzeilen lautstark nachfragen, was denn aus dem Mann geworden sei, der das Krokodil geschnappt hatte.
Di Vincenzo hatte sich zunächst dagegen gesträubt, um am Ende doch klein beizugeben und ihm ein paar «kalte Fälle» aufs Auge zu drücken, die seit Jahren ohne neue Erkenntnisse vor sich hin gammelten. Niemand konnte dem Kommissar schließlich vorschreiben, welche Aufgaben er wie an seine Leute verteilte.
Vor ein paar Tagen dann hatte er ihn zu sich rufen lassen. Und ihm von Pizzofalcone erzählt.
Seine Versetzung in dieses Kommissariat, dachte Lojacono, war vermutlich die beste Lösung für alle – etwas, was man immer denkt, wenn man vom Regen in die Traufe kommt.
Der junge Polizist, der am Steuer saß, hatte schon zweimal versucht, ein Gespräch anzufangen, aber jedes Mal waren seine Smalltalk-Sätze ins Leere gelaufen. In den letzten Minuten hatte er den Wagen daher schweigend durch den dichten Verkehr gesteuert und nur immer wieder flüchtige Seitenblicke auf seinen Beifahrer geworfen.
Dieser Sizilianer mit dem finsteren Profil war ihm unheimlich. Auch er hatte schon alle möglichen Geschichten über den Inspektor gehört, den sie beim Mobilen Einsatzkommando von Agrigent rausgeworfen hatten, weil ein Kronzeuge behauptet hatte, er versorge die Mafia mit internen Informationen. Soweit der Polizist wusste, hatte sich der Verdacht als nicht haltbar erwiesen, aber wie immer in solchen Fällen hatte man den Beschuldigten sicherheitshalber seines Amtes enthoben.
Er war ihm schon ein paarmal im Foyer des Kommissariats begegnet, und natürlich kannte er die Geschichte mit dem Krokodil. Die ganze Stadt hatte darüber geredet. Selbst nachdem der Fall abgeschlossen war, beherrschte er die Schlagzeilen weiter, berichteten die Medien Tag für Tag darüber, bis ein weiteres Verbrechen ihm den Rang ablief – frisches Blut, neue Morde. Wie die Sache tatsächlich abgelaufen war, konnte er nicht beurteilen. Aber so oder so fühlte er sich an der Seite dieses wortkargen Mannes ziemlich unbehaglich.
Schließlich fasste er sich ein Herz und fragte:
«Soll ich das Blaulicht einschalten, Ispettore? Wir kommen sonst keinen Schritt voran – sobald in dieser Stadt zwei Regentropfen vom Himmel fallen, springen sie alle in ihre Autos.»
Ohne den Blick von der Schlange vor ihnen zu lösen, sagte Lojacono:
«Nein, nicht nötig. Wir haben’s nicht eilig.»
Ein sichtbares Zucken durchlief den Verkehrsstrom, der kurz darauf erneut erstarrte: vielleicht eine Ampel, die ein paar Kilometer weiter vorne auf Rot umgesprungen war.
Der Wind sprühte brackiges Regenwasser auf die Windschutzscheibe, direkt vom Meer. Scirocco.
Ohne den Blick von seinem Schreibtisch zu heben, wies Di Vincenzo Lojacono einen Stuhl zu.
«Bitte, bitte, nehmen Sie Platz.»
Er wühlte zwischen den Papieren, die vor ihm lagen. Dann nahm er seine Brille ab und lehnte sich in seinem Stuhl zurück.
«Und, Lojacono, man kämpft sich so durch seine Akten, was? Wer weiß, dank Ihres legendären Instinkts kriegen wir ja vielleicht sogar was bewegt. Olle Kamellen, ist mir schon klar. Aber einer, der gut ist, richtig gut, sieht auch Dinge, die andere übersehen haben.»
Der Inspektor schwieg, ohne die Miene zu verziehen.
Di Vincenzo trommelte mit den Fingern auf die Schreibtischplatte. Schließlich nahm er den Faden wieder auf.
«So einfach ist das alles nicht. Draußen denken sie, unsere Arbeit würde so ablaufen wie in amerikanischen Fernsehserien – dass wir von Brücken auf fahrende Motorräder springen, uns mit Gangstern mitten auf der Straße Schießereien liefern und so weiter. Aber in Wahrheit: Akten, nichts als Akten! Abgesehen von ein paar Glückstreffern, versteht sich. So was kann immer passieren.»
Der Tumbe sieht den Erfolg des anderen allein im Glück begründet, dachte Lojacono. Er wünschte sich ein Geldstück für jedes Mal, da er diese Situation erlebte.
«Commissario, was kann ich für Sie tun? Ich stehe zu Ihren Diensten.»
Di Vincenzo nickte, ohne den Groll zu verbergen, der in ihm hochgestiegen war.
«Nun mal ehrlich, Lojacono: Dieser Coup, den Sie da gelandet haben, mit dem Krokodil, das war doch eine Mischung aus Show und reinem Glück. Flankiert von Ihrem seltsamen Verhältnis zu Dottoressa Piras, über das ich mir lieber kein Urteil anmaßen werde.»
Die Anspielung auf die Stellvertretende Staatsanwältin Laura Piras, die Lojacono in die Ermittlungen zur «Mordsache Krokodil» mit einbezogen hatte, sollte wohl ein Schlag unter die Gürtellinie sein, doch der Inspektor ließ sich davon nicht beeindrucken. Er konnte sich vorstellen, was man sich über ihn und Laura Piras erzählte, die schöne Unnahbare, die aus ihren Sympathien für ihn kein Geheimnis machte.
«Commissario, Sie können mich nicht leiden, und ich kann Sie nicht leiden. Beschränken wir unsere Begegnungen also auf das Notwendigste, in beiderseitigem Interesse. Deswegen frage ich Sie noch einmal: Was kann ich für Sie tun?»
Di Vincenzos Kiefermuskeln zuckten, und sein düsterer Blick sprach Bände. Doch es gelang ihm, sich zu beherrschen.
«Sie haben recht, Lojacono, ich kann Sie nicht leiden. Und genau aus dem Grund bin ich sehr froh, Ihnen das mitteilen zu können, was ich Ihnen jetzt mitteilen werde: Man hat mich gebeten, für eine unbefristete Zeit auf einen meiner Mitarbeiter zu verzichten, um ihn einem anderen Kommissariat zu überlassen. Der Einzige meiner Leute, der derzeit nachweislich nicht mit einem konkreten Fall befasst ist, sind Sie.»
Lojacono straffte die Schultern. Er wollte es seinem Gegenüber nicht unnötig einfach machen.
«Ich nehme an, es handelt sich um eine freiwillige Versetzung. Und mein Einverständnis wird vorausgesetzt. Mein schriftliches Einverständnis. Will sagen, wenn Sie mich loswerden wollen, müssen Sie mich erst von der Sache überzeugen. Stimmt’s, Commissario?»
Di Vincenzo machte Anstalten, sich zu erheben, ließ sich dann aber wieder auf seinen Stuhl fallen, die Lippen zu einem schmalen Strich verzogen.
«Dass Sie die Richtlinien parat haben, wundert mich gar nicht. So was ist typisch für Leute, die sich vor ehrlicher Arbeit drücken wollen. Mit diesem Gewerkschaftskram kennen die sich am besten aus … Ja, es stimmt. Aber genauso stimmt es, dass ich Sie mit irgendwelchem Pipifax betrauen kann, sollten Sie sich der Versetzung verweigern. Der Ruhm, den Ihnen das Krokodil eingebracht hat, ist nicht von ewiger Dauer.»
Lojacono wartete einen Moment, dann sagte er:
«Dann erzählen Sie mir mal von dieser neuen Herausforderung, Commissario. Vielleicht nehme ich sie ja an, wer weiß.»
Die Aussicht, den undurchsichtigen Sizilianer bald loszuwerden, mit dem er sich wegen der Piras besser nicht anlegte, erfreute den Kommissar nicht wenig. Außerdem würde er sich im Falle von Lojaconos Weigerung von einem seiner engsten Vertrauten trennen müssen, und das bedeutete wegen des geringen Personalstands Probleme im Alltagsgeschäft. Er musste ihn einfach überzeugen. Also versuchte er, so zuvorkommend wie möglich zu sein.
«Nun, es handelt sich in der Tat um eine Herausforderung, wenn man so will. Haben Sie schon mal was vom Kommissariat von Pizzofalcone gehört?»
Lojacono starrte den Kommissar unverwandt an. Dieser beschloss, sich davon nicht irritieren zu lassen.
«Es handelt sich um einen nicht sehr großen, aber dicht besiedelten Bezirk, der von den Quartieri Spagnoli bis runter zum Meer reicht. Vier Welten in einer, könnte man sagen: einfaches Volk, kleine Angestellte, neureiche Geschäftsleute und alter Adel. Das volle Programm, nur die Industrie fehlt. Und das auf einer Fläche von rund drei Quadratkilometern. Eines der ältesten Kommissariate der Stadt, klein, aber von strategischer Bedeutung.»
Di Vincenzo runzelte die Stirn und veränderte seinen Tonfall. Etwas Unangenehmes schien ihm in den Sinn gekommen zu sein.
«Vor etwa einem Jahr ist dort eine Riesenmenge ungeschnittenes Kokain beschlagnahmt worden, frisch in den Quartieri eingetroffen. Richtig viel Stoff, verdammt viel. Aber deklariert haben sie gerade mal die Hälfte.»
«Wer ‹sie›?», fragte Lojacono leise.
«Das hat man erst später rausgefunden. Die Kollegen waren zu viert. Alles Ermittler. Ein genialer Coup: Insidertipp, Hinterhalt, Angriff bei Übergabe. Keine Sekunde zu früh, um auch wirklich was zu finden, und keine zu spät, um die Jungs in die Falle laufen zu lassen. Absolut sauber, schnell und unblutig. Und natürlich war es im Interesse aller Beteiligten, den Fund deutlich runterzuspielen: für die Camorra, um das Strafmaß zu verringern, und leider eben auch für die Kollegen, die mit dem Zeug selbst angefangen haben zu dealen.»
Der Inspektor sagte nichts. Ausnahmsweise einmal konnte er mit dem Kommissar mitfühlen. Eine üble Geschichte. So richtig übel. Für jeden Polizisten, der auch nur einen Funken Ehre im Leib besaß.
Di Vincenzo fuhr fort.
«Einer von ihnen hatte einen kranken Sohn, Krebs. Ein anderer lebte in Scheidung, die Frau hat ihn vor die Tür gesetzt. Beim Dritten war gerade der Vater mit seinem Laden pleitegegangen, und der Vierte hat gezockt. Sie haben sich angeschaut, nur ganz kurz. Zwei von ihnen kenne ich, ich hätte meine Hand für sie ins Feuer gelegt. Tja, so kann man sich irren … Jedenfalls, wenn in der Drogenszene, vor allem bei einer solchen Menge, die Machtverhältnisse dermaßen umgekrempelt werden, dann muss das mit den Clanchefs abgeklärt werden. Denn über kurz oder lang kriegt auch die Gegenseite mit, was da läuft. Und die Kollegen von der DIGOS haben’s mitgekriegt. Beschattung über Monate, Fotos, Filme. Und am Ende haben sie sie geschnappt. Alle vier.»
Eine Windböe schlug gegen das Fenster.
Lojacono sagte:
«Verstehe. Eine üble Geschichte.»
Di Vincenzo seufzte.
«Auch den Kommissar hat’s getroffen, Ruoppolo, ein älterer Kollege, kurz vor der Pensionierung. Ein wirklich integerer Mann, ich kannte ihn gut. Absolut anständig, dass Sie mich da richtig verstehen. Aber bei ein paar Kontrollen sind sie ihm zuvorgekommen. Sodass er am Ende frühzeitig in den Ruhestand gehen musste. Ein paar Monate lang war der Polizeipräsident kurz davor, das Kommissariat von Pizzofalcone dichtzumachen und die Tätigkeitsbereiche auf die benachbarten Dienststellen zu verteilen. Dann hat er es sich anders überlegt.»
«Und hier kommen wir ins Spiel.»
«Genau. Es sollen vier neue Ermittler eingestellt werden, und sie haben bei den vier größten Kommissariaten der Stadt nach geeigneten Kandidaten angefragt. Der neue Kommissar ist Palma, ein aufstrebender junger Kollege. Er kommt vom Vomero – vielleicht erinnern Sie sich an ihn, er war damals bei dieser Besprechung wegen der Geschichte mit dem Krokodil dabei. Wenn ich er wäre, hätte ich nie im Leben zugesagt. Er kann nur verlieren.»
Lojacono verzog das Gesicht.
«Und Sie haben mich als Mitarbeiter angeboten.»
Di Vincenzo zog eine Augenbraue hoch.
«Ich hätte es getan, wenn ich die Chance dazu gehabt hätte. In solchen Fällen nutzt doch jeder die Möglichkeit, seine faulen Äpfel in den Kompost zu geben. Aber Sie sind von Palma höchstpersönlich angefordert worden. Es scheint, Sie haben ihn bei jener Besprechung schwer beeindruckt. Er ist ein Dummkopf, das habe ich schon immer geahnt. Natürlich habe ich sofort meine Zustimmung gegeben. Also, was meinen Sie?»
Der Inspektor schwieg einen langen Moment. Schließlich fragte er:
«Und welches Risiko gehe ich ein, wenn ich annehme? Mit welchen Konsequenzen muss ich rechnen?»
Di Vincenzo gab ein empörtes Schnauben von sich und schlug mit der flachen Hand auf die Tischplatte. Seine Brille, ein paar Stifte und die Papiere vor ihm stoben auseinander.
«Dass der Versuch, den Verein aufrechtzuerhalten, in die Hose geht! Dass er dichtgemacht wird und ihr, im schlimmsten Falle, alle miteinander wieder dorthin zurückgeschickt werdet, wo ihr hergekommen seid! Oder vielleicht noch ganz woandershin, was ich mir nur wünschen kann – weil nämlich ich und die anderen Vorgesetzten dieser Traumkandidaten, die niemand haben will, in der Zwischenzeit alles daransetzen werden, Ersatz für euch zu kriegen. Ein einziger Haufen Lügner, Gauner und Versager!»
Lojacono ließ sich nicht beeindrucken.
«Commissario, ich wäre auch nach Patagonien gegangen, um von hier wegzukommen. Aber ich wollte Sie noch ein bisschen schmoren lassen. Also, wann kann ich meinen neuen Job antreten?»
3
Die Frau stürmt herein und wirft die Tür hinter sich zu.
Bevor sie endgültig ins Schloss fällt, hat der Mann noch Gelegenheit, einen Blick auf die Gesichter der Angestellten zu erhaschen, festgehalten wie in einem hyperrealistischen Gemälde, das Erstaunen, Verlegenheit, Angst in einem einzigen Gesichtsausdruck festhalten will. Einer hat sich sogar halb von seinem Stuhl erhoben, als wollte er sich der Hereinstürmenden in den Weg stellen. Als wäre es möglich, sich ihr in den Weg zu stellen.
Der Mann atmet tief aus, zieht den Kopf zwischen die Schultern, wie um den Aufprall der Tür gegen den Rahmen zu dämpfen.
«Was wirst du jetzt tun, verdammt noch mal? Hast du dich entschieden? Darf man wissen, wie es weitergeht?»
Sie hat die Hände in die Seiten gestemmt, breitbeinig steht sie da. Ihre Kiefer mahlen. Die roten Haare glänzen, als stünden sie in Flammen, ebenso die Augen. Wunderschön, denkt er. Wunderschön, sogar wenn sie vor Wut kocht.
Was in letzter Zeit ziemlich häufig geschieht, um ehrlich zu sein.
«Brüll hier nicht so rum! Bist du wahnsinnig geworden? Willst du, dass die halbe Welt mitkriegt, was mit uns ist?»
Sie senkt die Stimme, allerdings nur geringfügig.
«Ich muss wissen, was du zu tun gedenkst. Es reicht jetzt. Die Rolle vom naiven Dummchen, das sich vom tollen Karrierehengst an der Nase herumführen lässt, passt nicht zu mir. Ich lasse mir so etwas nicht gefallen, ich kann dich fertigmachen, das weißt du ganz genau. Ich kann’s kaum glauben, dass ich so lange stillgehalten habe.»
Ihm ist klar, dass sie sich nur noch mehr aufregen wird, wenn er an ihr Mitgefühl appelliert. Die Gedanken rotieren in seinem Kopf.
«Ich wollte dich nicht an der Nase herumführen. Die Sache ist kompliziert. Ein ganzes langes Leben … Da geht’s um viel Geld. Um Besitz. Das meiste ist auf sie überschrieben, aus steuerlichen Gründen. Und dann ist es auch eine Frage des Stils: Man kann nicht jemanden … jemanden wie sie von heute auf morgen mit einem Tritt in den Hintern verabschieden. Und dann, die Freunde, die gemeinsamen Bekannten, auch geschäftliche Kontakte … Das ist alles nicht so einfach.»
«Freunde? Geschäftliche Kontakte? Deine Kontakte sind mir so was von egal, verstehst du? Ich mache dich fertig, vor aller Augen! Keine Ahnung – denkst du etwa, der Herrgott verzeiht dir alles? Was glaubst du wohl, was Seine Eminenz dazu sagen würde, wenn er wüsste … wenn er von mir wüsste, von meinem Zustand? Er würde dich zur Hölle jagen, zur Hölle würde er dich jagen.»
Er lehnt sich in seinem Schreibtischsessel zurück, faltet die Hände unter dem Kinn, versucht sich zu konzentrieren. Er darf den Kopf nicht verlieren.
«Großartige Idee. Auf die Weise haben wir am Ende gar nichts mehr. Ist es das, was du willst? Was du für dich willst, für … Für uns? Wäre es nicht klüger, den richtigen Moment abzuwarten? Vielleicht müssen ja gar nicht wir die Entscheidung fällen. Ich rede mit ihr, das habe ich dir versprochen. Ich werde es tun. Ich muss es tun. Sie ist ein vernünftiger Mensch, verstehst du? Sie ist nicht dumm, ganz und gar nicht.»
Sie starrt ihn an, ohne mit der Wimper zu zucken. Aus ihren großen grünen Augen. Ihre Brüste heben und senken sich unter ihrem schweren Atem. Er kann nicht anders, als fasziniert hinzuschauen.
«Das würde ich dir auch raten. Sonst tue ich es nämlich und sage es ihr ins Gesicht. Vielleicht verstehen wir uns von Frau zu Frau ja sogar besser und müssen nicht lange um den heißen Brei herumreden. Ich bringe ihr ein kleines Geschenk mit und sage ihr, dass man nur verlieren kann, wenn man sich mit einer wie mir anlegt.»
Er weiß, dass sie dazu durchaus in der Lage wäre. Dass sie jemand ist, der vor einer solchen Konfrontation nicht zurückschreckt.
«Wenn du nicht endlich aufhörst, hier so rumzubrüllen, musst du dich gar nicht mehr zu ihr aufmachen. Weißt du, wie viele Spitzel sie hat, hier drinnen? Auf jeden Fall würde es eh nichts bringen. Dir wird sie niemals ihre Zustimmung geben. Sie wird glauben, dass es einen Kampf auszutragen gilt. Vielleicht würde sie sich sogar einreden, dass ich nicht den Mut habe, sie zu verlassen, weil ich es ihr nicht selbst gesagt habe, und es also etwas zurückzuerobern gibt. Gott bewahre! Wir würden uns in einen jahrelangen Rechtsstreit verwickeln – immerhin ist sie die Tochter eines noch immer einflussreichen ehemaligen Richters. Nein, ich muss selbst mit ihr reden.»
Die Frau macht einen Schritt auf den Schreibtisch zu, wie eine Löwin, die sich gleich auf ihre Beute stürzen wird. Sie legt die Hände auf die Tischplatte, ihre rot lackierten Fingernägel zeigen in seine Richtung.
Ihre Worte sind nicht mehr als ein Zischen.
«Dann tu es endlich! Rede mit ihr, und zwar schnell! Ich schwöre dir, sonst rede ich mit ihr, und das war’s dann. Auf welche Weise auch immer.»
4
Das Kommissariat von Pizzofalcone war über den Innenhof eines älteren Gebäudes zu erreichen. Die Farbe blätterte von der bereits mehrfach übertünchten Fassade ab. Lojacono hatte den Eindruck von Schlamperei und Verfall, was in den Altstadtvierteln der Stadt jedoch keine Seltenheit war.
Nach einem kurzen Wortwechsel mit dem Fahrer des Streifenwagens, der mit quietschenden Reifen und eingeschaltetem Martinshorn davonbrauste, stieg er die wenigen Treppenstufen zum Foyer hinauf. Neonlicht erhellte den Raum, hierhin kam die Sonne nicht einmal zur Mittagszeit.
Hinter dem Empfangstresen fläzte sich ein Polizist auf einem Drehstuhl und las eine Sportzeitung. Es roch nach dem Kaffee aus dem Getränkeautomaten, vor dem zwei Wachleute standen und lachend diskutierten. Der Mann am Tresen schaute nicht einmal auf. Lojacono trat schweigend näher und wartete, ohne den Blick von dem Uniformierten zu lösen.
Nach einer Weile sah der Polizist von seiner Zeitung auf und sagte:
«Sie wünschen?»
«Ich bin Inspektor Lojacono. Der Kommissar erwartet mich.»
Der Mann nahm weder die Zeitung herunter, noch veränderte er seine Haltung.
«Erster Stock, letzter Raum.»
Lojacono rührte sich nicht.
«Aufstehen», murmelte er.
«Was?», entgegnete der Polizist.
«Aufstehen, du Schwachkopf. Name, Vorname, Dienstgrad. Und zwar dalli, sonst kippe ich dir diesen Tisch hier vor die Füße und verpasse dir einen in den Allerwertesten.»
Der Inspektor hatte weder Tonlage noch Gesichtsausdruck verändert, doch die Wirkung war, als hätte er gebrüllt. Die beiden Kaffeetrinker wechselten einen raschen Blick und eilten wortlos aus dem Foyer.
Der Polizist erhob sich ungelenk. Die Uniformjacke über dem dicken Bauch klaffte auf. Ebenso wie sein Gürtel waren die obersten Knöpfe seines Hemdes geöffnet und die Krawatte nur lose umgebunden. Er nahm Haltung an, den Blick ins Leere gerichtet.
«Polizeiwachtmeister Giovanni Guida vom Kommissariat Pizzofalcone.»
Lojacono sah ihn unverwandt an.
«Hör mir mal gut zu, Giovanni Guida vom Kommissariat Pizzofalcone: Du bist das erste menschliche Wesen, das die Leute zu Gesicht kriegen, wenn sie hier reinkommen, und folglich können sie gar nicht anders, als zu denken, der ganze Laden hier besteht aus verlotterten Typen. So verlotterten Typen, wie du einer bist. Und ich lasse mich nicht gerne von fremden Leuten für einen verlotterten Typen halten.»
Der Mann blieb stumm, seine Miene ausdruckslos. Einer der beiden Wachmänner, die am Kaffeeautomaten gestanden hatten, tauchte auf, um direkt wieder um die nächste Ecke zu verschwinden.
«Wenn ich dich noch einmal so hier erwische, wie ich dich eben erwischt habe, dann zerre ich dich nach draußen in den Innenhof und prügele dich so lange windelweich, bis du anständig Rapport erstatten kannst.»
Der Polizeiwachtmeister erwiderte zerknirscht:
«Tut mir leid, Ispettore. Wird nicht wieder vorkommen. Das liegt daran, dass hier kaum mehr einer vorbeikommt. Die Leute gehen lieber … sie gehen zu den Carabinieri, wenn sie Anzeige erstatten wollen. Das machen sie schon, seit das mit … schon seit einer ganzen Weile.»
Lojacono erwiderte:
«Das ist mir vollkommen egal. Auch wenn sie ein Schweigekloster hier draus machen, hast du dich so zu benehmen, wie es sich gehört.»
Während sich Guida leise fluchend und mit hochrotem Kopf das Hemd in die Hose stopfte, trat Lojacono durch die innere Eingangstür auf den kurzen Flur, der auf eine Treppe zuführte. Überall bemerkte er dieselben Anzeichen von Schlamperei und Verfall. Er fühlte ein leichtes Unbehagen in sich aufsteigen und fragte sich, ob er wohl jemals seine alte Leidenschaft für den Beruf des Polizisten wiedererlangen würde.
Das Büro des Kommissars befand sich direkt neben der Treppe. Palma saß hinter seinem Schreibtisch und heftete Papiere in einen Aktenordner ab. Bei seinem Anblick erinnerte sich Lojacono sofort an ihre erste Begegnung. Der Mann war um die vierzig und schien mit seinen hochgekrempelten Ärmeln und dem Dreitagebart nicht gerade viel Wert auf ein untadeliges Äußeres zu legen. Vor allem aber wirkte er wie jemand, der ständig unter Strom steht.
Als der Kommissar Lojacono bemerkte, erhellte ein Lächeln sein Gesicht.
«Ah, Lojacono, endlich! Ich hatte gehofft, dich schon heute hier begrüßen zu können. Ich hätte auch selbst angerufen, aber der guten Ordnung halber musste ich warten, bis Di Vincenzo, der alte Griesgram, mit dir gesprochen hat. Bitte, setz dich.»
Der Inspektor trat vor. Das Fenster war geschlossen, doch durch die von Regenschlieren überzogene Scheibe konnte man das aufgewühlte Meer sehen, das zum millionsten Mal die mächtige Tuffsteinfestung auf der schmalen Landzunge zu überrollen versuchte. Diese Stadt schaffte es immer wieder, einen mit ihrer trügerischen Schönheit zu überraschen, dachte er.
«Phantastisch, oder? Der Ausblick hier ist wirklich phänomenal, aber wir dürfen uns trotzdem nicht von der Arbeit abhalten lassen: Es gibt genug zu tun. Setz dich doch. Möchtest du einen Espresso?»
«Nein danke. Wie geht es Ihnen, Commissario?»
Palma breitete die Arme aus.
«Nicht so, Lojacono! Wir sollten uns duzen, schließlich sind wir alle arme Schweine und müssen zusammenhalten. Außerdem sind die meisten von uns hier neu; ich selbst bin seit Montag da, die anderen sind in den letzten drei Tagen gekommen, und du bist das Schlusslicht. Ach, übrigens – jetzt, wo du hier bist, könnten wir eigentlich gleich unsere erste Konferenz abhalten, was meinst du? Oder möchtest du dich lieber erst mal umsehen?»
Der Inspektor war ganz überwältigt vom Enthusiasmus des Kommissars.
«Nein, kein Problem, wenn Sie möchten … Äh, ich meine, wenn du möchtest … Also gerne sofort.»
«Sehr schön, dann lass uns keine Zeit verlieren, ich habe nur auf dich gewartet. – Ottavia? Ottavia!»
Eine Seitentür öffnete sich, und eine Frau im Kostüm steckte den Kopf ins Zimmer hinein.
«Was kann ich für Sie tun, Commissario?»
«Was heißt hier ‹Sie›? Wir haben doch gesagt, wir duzen uns. Komm rein, komm schon. Das ist Inspektor Giuseppe Lojacono, der letzte Neuzugang des Kommissariats. Lojacono, darf ich vorstellen: Polizeimeisterin Ottavia Calabrese, sie hat bereits früher hier gearbeitet und ist uns eine wertvolle Stütze bei der Eingewöhnung.»
Die Frau trat auf Lojacono zu, der aufgestanden war, um ihr die Hand zu schütteln. Sie war eine attraktive, wenn auch nicht sehr auffällige Erscheinung, knapp über vierzig, mit straff nach hinten gebundenen Haaren und etwas müde wirkenden Gesichtszügen.
«Herzlich willkommen, Ispettore. Wenn Sie Hilfe brauchen: Ich stehe immer zu Ihrer Verfügung.»
Ihre leise Stimme klang zugleich warm und selbstbewusst. Lojacono bildete sich gern auf den ersten Blick ein Urteil über seine Mitmenschen, auch wenn er durchaus bereit war, es später zu revidieren. Die Polizeimeisterin machte jedenfalls erst einmal einen positiven Eindruck auf ihn.
Palma lachte.
«Na, so leicht geht dir das Du aber auch nicht über die Lippen, was, Ottavia? Lojacono, die Kollegin Calabrese ist ein echtes Computergenie. Was auch immer du im Internet suchen solltest, sie findet es für dich. Ottavia, könntest du den anderen Bescheid sagen, dass wir uns im Besprechungszimmer treffen? Lass uns ein paar Espressi und eine Flasche Wasser bestellen, um unser neues Team zu feiern. Komm, Lojacono, wir gehen schon mal vor und warten drinnen auf die anderen.»
5
Dieses Zimmer. Diese Wände.
Es sind sechseinhalb Schritte von Wand zu Wand, längs gemessen. Nein, falsch, noch einmal: Es sind achtdreiviertel. Und quer sind es acht Schritte. Ich weiß noch, wir haben es in der Schule durchgenommen: Um die Fläche eines Rechtecks zu berechnen, muss man die lange mit der kurzen Seite multiplizieren. Ich bin gerne zur Schule gegangen. Aber dann, nach der achten Klasse, war natürlich Schluss.
Beim Ausmessen der Querseite muss der Wandschrank mit einkalkuliert werden, weil man seinetwegen etwas ausweichen muss, was die Strecke um fast einen Viertelschritt verlängert. Und an der Längsseite hat eine der Kacheln eine kleine Macke, genau an der Stelle, wo man den Fuß nach dem dritten Schritt hinsetzen muss.
Man lernt viel, wenn man sich den ganzen Tag hier aufhält. Vom Balkonfenster aus kann man zum Beispiel in die fünf Wohnungen im Nachbarhaus gucken. Würde ich auf den Balkon gehen, könnte ich wahrscheinlich noch mehr sehen, aber lieber nicht. Neulich hat er ein Stück Papier vor die Balkontür gelegt und am nächsten Tag kontrolliert, ob es noch da war. Es war noch da, weil ich gar nicht auf die Idee gekommen bin, die Tür zu öffnen – aber wenn es nicht mehr da gewesen wäre, was hätte ich ihm gesagt? Gut, dass ich sie nicht aufgemacht habe.
Nun sind es schon zwei Wochen. Gestern war er da. Wer weiß, wann er wiederkommt. Er hat gesagt: «Hoffentlich bald.» Ja, hoffen wir mal.
Achtdreiviertel Schritte sind nach meiner Berechnung sieben Meter. Ein riesiges Zimmer. Nur für mich alleine. Und dann noch Schlafzimmer, Küche und Bad. Zu Hause, in unserem Kellerloch, haben wir zu fünft in einem Raum gewohnt, der nur halb so groß ist wie dieser. Und wir hatten trotzdem das Gefühl, uns geht’s gut.
Ich kann mich wirklich glücklich schätzen.
Den Rollladen, den darf ich hochziehen. Nicht ganz – er hat gesagt, besser nicht, trotz der Vorhänge –, aber ein Stück, das hat er mir erlaubt. Ich schaue gerne zum Fenster raus, ich vertreibe mir die Zeit damit, die Leute zu beobachten. Zum Beispiel da drüben im dritten Stock: Da wohnt eine Alte, die genauso gerne wie ich aus dem Fenster guckt. Einmal hatte ich sogar das Gefühl, sie hat mich entdeckt.
Sieben Meter lang, sechs Meter breit. Über vierzig Quadratmeter, ein einziges Zimmer. Ich kann mich wirklich glücklich schätzen.
Und er hat mir ganz viel zu essen dagelassen. Der Kühlschrank platzt beinah aus allen Nähten. Hat man schon mal so viele Leckereien auf einem Haufen gesehen? Kaum zu glauben, dieser Luxus.
Manchmal fehlt mir allerdings die frische Luft. Er hat eine Klimaanlage einbauen lassen und mir die Fernbedienung in die Hand gedrückt. Was haben wir uns totgelacht, als ich einfach nicht begreifen wollte, wie das Ding funktioniert!
Ich habe auch eine Waschmaschine hier, die sogar die Sachen trocknet, die sie wäscht – wirklich unglaublich, ein echtes Wunder! Ich habe ihm gesagt, ich brauche so was nicht; die drei Teile, die ich hier trage, kann ich auch über der Badewanne aufhängen. Aber er wollte davon nichts wissen, hat gesagt, ich soll alles bekommen, was man so brauchen kann. Wie eine Königin. Genauso hat er es gesagt: «wie eine Königin». Wer hätte das gedacht, dass zu mir mal einer sagt, ich wäre eine Königin.
Ich halte alles pieksauber hier drinnen, auch wenn es nicht wirklich schmutzig wird. Wenn er kommt, soll er nicht denken, ich würde nicht auf Sauberkeit achten. Sobald ich fertig mit Putzen bin, setze ich mich vor die Glotze. Mit dieser Fernbedienung kann ich umgehen. Aber ich habe auf ganz leise gestellt, denn er hat mir eingeschärft, dass man mich auf keinen Fall hören darf, auch wenn die Stimme, die man hört, aus dem Fernseher kommt und nicht meine eigene ist.
Ich warte auf ihn, warte die ganze Zeit auf ihn. Manchmal ruft er an, die Telefonnummer von hier kennt nur er. Letztes Mal hat er mich kurz mit Mama sprechen lassen – wie schön das war, ihre Stimme zu hören. Und wie glücklich sie war! Sie hat mir erzählt, dass er ihr ganz viele Sachen gekauft hat, dass er Papa und zweien meiner Brüder einen Job verschafft hat und dass es ihnen allen gutgeht. Sie hat gesagt: «Danke, meine Schöne. Danke.» Und ich war total stolz.
Jetzt muss ich dringend etwas essen. Er hat gesagt, ich darf mich nicht gehenlassen. Ich wäre so schön, findet er, ich dürfte auf keinen Fall mein Aussehen vernachlässigen. Sonst müsste er mich wegschicken. Er hat es mit einem Lächeln gesagt, aber trotzdem habe ich Angst bekommen. Ich bin jetzt achtzehn, und er sagt, in meinem Alter kann man schnell hässlich werden, wenn man zu viel oder zu wenig isst. Deshalb hat er mir Sachen mitgebracht, die ich essen soll. Für jeden Tag hat er aufgeschrieben, was ich kochen soll. Und die Uhrzeit dazu.
Ich habe den Zettel mit einem Marienkäfer-Magneten am Kühlschrank festgemacht und lese ihn jedes Mal beim Kochen durch. Ich achte darauf, dass ich immer regelmäßig esse.
Vorhin habe ich mich ans Fenster gestellt, und da war die Alte, die genau in meine Richtung geguckt hat.
Sie macht mir Angst, die Alte.
Wer weiß, was sie von mir will.
6
«Da wären wir also», sagte Palma. «Ich habe mit der Besprechung so lange gewartet, bis auch Inspektor Lojacono, unser letzter Neuzugang, eingetroffen ist. Jetzt ist das Team komplett, und wir können mit der Vorstellungsrunde beginnen.»
Lojacono wünschte sich von Herzen, dass die joviale, gut gelaunte Art des Kommissars auch auf die anderen Anwesenden abfärben und sich nicht als reiner Zweckoptimismus erweisen würde. Die Truppe war ziemlich zusammengewürfelt und bestand, wie Di Vincenzo mit einem ironischen Unterton bemerkt hatte, aus den «Ausgestoßenen» der diversen Kommissariate der Stadt. Und diese Ausgestoßenen kamen nun zusammen, um die von ihren korrupten Kollegen hinterlassene Leerstelle zu füllen, jenen in Ungnade gefallenen Polizisten, die im ganzen Land nur als «Schande für ihren Berufsstand» bezeichnet wurden.
Andererseits, dachte Lojacono, gehörte auch er zu diesen Ausgestoßenen, auch von ihm hieß es, er sei korrupt und kriminell.
Palma fuhr fort:
«Ich will euch nicht verhehlen, dass unsere Aufgabe nicht leicht sein wird. Mir haben sie alle davon abgeraten, den Job hier anzunehmen, und selbst der Polizeipräsident war sich bis zum letzten Moment unsicher, ob er dieses Kommissariat nicht lieber dichtmachen soll. Aber mich haben Herausforderungen schon immer gereizt, und deswegen habe ich den Job akzeptiert. Wenn es gut läuft, dann läuft es für uns alle gut. Wenn nicht, dann werde vor allem ich dumm dastehen, weil ihr anderen, schätze ich, aus den verschiedensten Gründen kein Interesse daran haben werdet, dorthin zurückzukehren, wo ihr hergekommen seid.»
Während des nachfolgenden Schweigens musterte Lojacono unauffällig die Runde um den ovalen Tisch, dessen helles Holz Brandflecken von Zigaretten aufwies. Mit ihm zusammen waren sie zu siebt und bunt gemischt von Alter, Geschlecht und Typ her. Unwillkürlich fragte er sich, was die Kollegen wohl hierherverschlagen hatte, welche Geschichten sich hinter ihren Gesichtern verbargen.
Als hätte er seine Gedanken erraten, sagte der Kommissar:
«Ich möchte, dass ihr euch alle kurz vorstellt, damit wir uns besser kennenlernen. Ich bin Gigi Palma, Leitender Kommissar von Pizzofalcone. Ich stehe jederzeit zu eurer Verfügung, die Tür zu meinem Büro wird immer offen stehen. Ich bin fest davon überzeugt, dass unsere Arbeit hier, ehrliche Arbeit, früher oder später Früchte tragen wird. Und zwar reife Früchte. Ich werde versuchen, möglichst unvoreingenommen zu sein: Was in euren Personalakten steht, interessiert mich nicht. Von heute an seid ihr alle rehabilitiert. Ich wünsche euch viel Erfolg. So, und jetzt schlage ich vor, die Kollegen, die schon vorher hier waren, fangen an mit der Vorstellungsrunde, vielleicht könnt ihr uns anderen ja das eine oder andere über diesen Ort erzählen …»
Er zeigte auf die Kollegin, die er Lojacono bereits vorgestellt hatte. Die Frau nickte und sagte mit ihrer leisen, melodischen Stimme:
«Ottavia Calabrese, Polizeimeisterin. Ich bin zuständig für die Recherche im Internet und fürs Sekretariat sowie die Pressearbeit. Was in letzter Zeit so ziemlich die Hölle war, auch wenn sich um die ganz heiklen Fragen der Sprecher des Polizeipräsidenten persönlich gekümmert hat. Wie ihr euch denken könnt, ist das Kommissariat von einer internen Untersuchungskommission von oben bis unten durchgecheckt worden. Wir dachten eigentlich, dass es dichtgemacht wird. Dieser Versuch hier ist eine positive Überraschung. Hoffen wir also das Beste.»
Ihr Stoßseufzer wurde vom nervösen Gelächter der ganzen Runde quittiert.
Ein glatzköpfiger, bereits in die Jahre gekommener Kollege ergriff das Wort.
«Giorgio Pisanelli, Stellvertretender Kommissar. Bevor ihr fragt, wie alt ich bin, sage ich es euch lieber gleich: Die sechzig habe ich schon seit einem Jahr hinter mir.»
Wieder lachte die ganze Runde, was der Mann mit stoischer Gelassenheit aufnahm. Mit seiner rauen Stimme fuhr er fort:
«Ich arbeite seit fünfzehn Jahren hier. Vielleicht hätte ich mehr Ehrgeiz an den Tag legen sollen, aber weil meine Frau … Nun, es gab ein paar Probleme in meiner Familie, weshalb ich mich lieber auf andere Dinge konzentriert habe. Wenn man so will, bin ich das Gedächtnis von dem Laden hier, ich wohne seit Urzeiten in dem Viertel und kenne Tod und Teufel. Die Kollegen von der internen Untersuchungskommission haben jedes Papier, das ich in der Hand hatte, genauestens überprüft, um sicherzugehen, dass ich mit den Leuten, die vor euch hier waren, nicht unter einer Decke stecke. Ich kann also mit Fug und Recht behaupten, ein anständiger Mensch zu sein, wie mir bei dieser Gelegenheit bestätigt wurde.»
Mit einem sichtlich zufriedenen Gesichtsausdruck nahm er das allgemeine Gejohle entgegen, Palmas mit eingeschlossen. Ein ziemlich cleverer Schachzug, dachte Lojacono, dieser Versuch, die Atmosphäre aufzulockern.
Palma zeigte auf die einzige weitere Frau im Raum, die mit ihrer zierlichen Figur und der schlichten Kleidung fast wie ein junges Mädchen wirkte.
«Mein Name ist Di Nardo, Alessandra Di Nardo. Ich bin angehende Polizeioberwachtmeisterin. Vorher war ich beim Kommissariat Decumano maggiore.»
Sie hatte während des Sprechens niemanden in der Runde angeschaut, und auch ihr Tonfall hatte keinerlei Emotionen verraten.
Palma deutete auf Lojacono.
«Das ist Inspektor Giuseppe Lojacono vom Kommissariat San Gaetano.»
Dann zeigte er auf den jungen Mann, der neben ihm saß und nun wie ferngesteuert aufsprang. Er war ziemlich klein und trug lange Koteletten und eine Art Elvis-Tolle, die wohl seine beginnende Glatze verdecken sollte. Das weit geöffnete Hemd gab den Blick frei auf seine rasierte Brust. Sein Teint tendierte in Richtung Orange, was auf regelmäßige Besuche im Sonnenstudio schließen ließ. Als wollte er der Lächerlichkeit die Krone aufsetzen, nahm er nun mit einstudierter Langsamkeit seine blau getönte Sonnenbrille ab und sagte:
«Hi, ich bin Marco. Polizeioberwachtmeister Marco Aragona. Ich komme direkt vom Präsidium.»
Die Lage war schlimmer als befürchtet, stellte Lojacono fest. Er fragte sich, wie man dieses Kommissariat jemals auf ein halbwegs vernünftiges Niveau bringen sollte. Palma seufzte, und zum ersten Mal hatte der Inspektor das Gefühl, dass auch er nicht wirklich von den Erfolgsaussichten seines Teams überzeugt war.
«Ah, verstehe», sagte er vage. «Und du da hinten am Ende des Tisches?», beeilte er sich nach kurzem Zögern hinzuzufügen. «Du scheinst mir der Letzte in unserer Runde zu sein.»
Der stämmige Mann mit der finsteren Miene hatte sich die ganze Zeit nicht an dem allgemeinen Gelächter und Gefrotzel beteiligt. Mit den Fingern der linken Hand trommelte er auf die Tischplatte, die rechte hielt er unter dem Tisch verborgen. Der Bürstenhaarschnitt, der kurze Hals und das kantige Kinn unterstrichen den düsteren Ausdruck seiner Augen.
Widerwillig ergriff er das Wort.
«Francesco Romano, Polizeihauptwachtmeister. Ich komme vom Kommissariat Posillipo.»
Palma nickte, als er nichts weiter hinzufügte.
«Okay, die Vorstellungsrunde ist beendet. Im Vergleich zu anderen Polizeieinheiten haben wir insofern das Nachsehen, als wir fast alle neu hier sind; von Teamgeist kann also noch keine Rede sein. Dass jeder jeden kennt, den Vorteil haben wir einfach noch nicht.»
Der Solariumgebräunte lachte auf.
«Dafür haben es die vier Kollegen mit ihrer Drogennummer in Sachen Teamgeist wohl etwas übertrieben.»
Palma warf ihm einen bösen Blick zu. Lojacono konnte sich vorstellen, wie er als Kommissar auftrat, sobald die Gutmenschenmaske gefallen war.
«Kollege Aragona, noch so eine Bemerkung, und du gehst dahin zurück, wo sie dich mit einem Tritt in den Hintern weggejagt haben. Und glaub mir, ich kann gut treten.»
Aragona machte sich ganz klein auf seinem Stuhl, als wolle er unsichtbar werden.
Palma nahm den Faden wieder auf.
«Also, oberstes Gebot: Wir müssen uns so schnell wie möglich alle kennenlernen. Dafür werden sämtliche Ermittlungen ab sofort in Zweierteams geführt, pro Fall ein Team. Fürs Erste und um die Dinge besser managen zu können, werden Pisanelli und Calabrese, die beide das Kommissariat schon kennen, Innendienst schieben. Ihr anderen geht raus auf die Straße und lasst euch von den beiden Internen unterstützen. Alles klar?»
Die allgemeine Zustimmung nahm er mit einem zufriedenen Nicken entgegen.
«Gut. Ich habe sechs Schreibtische in einen der größeren Räume bringen lassen. So dicht aufeinander werdet ihr Gelegenheit genug haben, euch besser kennenzulernen. Viel Glück!»
Wenige Minuten später befand sich Kommissar Luigi Palma, genannt Gigi, allein in seinem Büro und studierte zum x-ten Mal die Liste, die ihm die Personalabteilung mit dem Vermerk «persönlich – vertraulich» hatte zukommen lassen.
Über Pisanelli und die Calabrese, die beide schon vorher in Pizzofalcone gearbeitet hatten, gab es kaum Informationen. Wie der Stellvertretende Kommissar gesagt hatte, waren ihre Curricula streng durchleuchtet worden, ohne dass irgendwelche Auffälligkeiten entdeckt worden waren, was besagte, dass es tatsächlich keine gab. Doch auf der anderen Seite waren sie beide reine Schreibtischmenschen, besaßen also wenig praktische Erfahrung.
Die Di Nardo war noch sehr jung, gerade einmal achtundzwanzig Jahre alt, mit einem eindeutigen Faible für Schusswaffen, was ihr bei Schießübungen regelmäßig die höchste Punktzahl einbrachte. Doch genau diese Leidenschaft war ihr in ihrer alten Dienststelle zum Verhängnis geworden, als sich unter nicht näher bekannten Umständen eine Kugel aus ihrer Dienstpistole gelöst hatte.
Romano hingegen war ein echter Hitzkopf: Er hatte einen Verdächtigen in den Schwitzkasten genommen und seinem Kollegen, der ihn davon abhalten wollte, eine Riesendummheit zu begehen, ein blaues Auge geschlagen.
Palma stieß einen tiefen Seufzer aus und kratzte sich am Kopf. Aragona, der Solariumgebräunte mit der Angebermasche, war als Neffe eines höheren Verwaltungsbeamten aus der Basilikata ins Amt gelobt worden. Weil er Auto fuhr wie ein Verrückter, hatte er seinen Job als Begleitschutz zweier Staatsanwälte verloren. Während seiner Zeit im Präsidium hatte er offenbar kaum dazugelernt.
Und Lojacono? Ihm hing noch immer der Ruf als sizilianischer Mafia-Kollaborateur an. Doch Palma hatte erlebt, wie er die Sache mit dem Krokodil angegangen war, was großen Eindruck auf ihn gemacht hatte. Mehr noch als der Kollege Di Vincenzo den Inspektor hatte loswerden, hatte er, Palma, ihn haben wollen. Sein Instinkt verriet ihm, dass der Mann ein echtes Talent für seinen Beruf besaß. Und eine ehrliche Haut war er noch dazu.
Er konnte nur hoffen, dass sein Instinkt ihn nicht trog. Er, Kommissar Luigi Palma, den sie Gigi nannten, wünschte es sich von ganzem Herzen.
7
Donna Amalia saß auf ihrem Thron und hatte den Blick fest auf das Fenster im vierten Stock des Hauses gegenüber gerichtet. Auf den Balkon, um genau zu sein. Und Donna Amalia war immer genau. Äußerst genau.
Sie hatte sofort gemerkt, dass da drüben etwas nicht mit rechten Dingen zuging. Siebzehn Tage war das jetzt her. Sie hatte die Renovierungsarbeiten in der Wohnung beobachtet. Soweit sie das von ihrem Standort aus beurteilen konnte, war die Sanierung ebenso zügig wie sorgfältig erfolgt. Das Ganze musste ziemlich viel gekostet haben. Donna Amalia hatte sogar eine entsprechende Bemerkung zu Irina gemacht, und dieses Miststück hatte wie immer «Jaja» gesagt, aber in Wirklichkeit an etwas ganz anderes gedacht, wahrscheinlich an irgendeinen reichen Knacker, dem sie eine kleine Gefälligkeit erweisen konnte, wenn sie runter zum Einkaufen ging. Immer wollte sie sich etwas dazuverdienen, nie konnte sie genug Geld scheffeln, das Miststück. Entweder gab sie es für irgendeinen Tinnef in der Stadt aus oder schickte es in ihr Heimatdorf, wo auch immer sich dieses hässliche Kaff befand. Sie hatte ihr ein paar Fotos gezeigt, und selbst auf den Bildern sah es abscheulich aus, wie mochte es da erst in Wirklichkeit sein.
Donna Amalias Problem war, dass sie sich nicht vom Fleck rühren konnte, sie war vollkommen steif. Ihre Arthrose war von einer besonders fortgeschrittenen Form, wie sie nicht ohne Stolz verkündete; die Schmerzen waren unerträglich, sie konnte kaum alleine zur Toilette gehen. Aber bevor sie sich von dem Miststück auf den Topf setzen ließ, wäre sie eher auf allen vieren zum Klo gekrochen. Und so saß sie ab morgens nach dem Aufstehen, wenn das Miststück ihr beim Anziehen geholfen hatte, in ihrem Sessel, zu dem sie sich mit ihrer Gehhilfe geschleppt hatte. Den ganzen Tag saß sie dort bei laufendem Fernseher und schaute zum Fenster hinaus.
Ihr Sohn wohnte in Mailand und erfand immer neue Ausreden, warum er nicht mal mehr an den Feiertagen kam. Er lebte mit einer zusammen, die bestimmt genau so ein Miststück wie ihre Irina war und ihn davon abhielt, seine alte Mutter zu besuchen, die doch so viele Opfer für ihn gebracht hatte. Dieser Idiot dachte wohl tatsächlich, sein schlechtes Gewissen damit beruhigen zu können, dass er ihr Geld schickte. Als könnte man mit Geld alles kaufen.
Donna Amalias Beine funktionierten vielleicht nicht mehr richtig, aber ihr Geist durchaus. Im Kopf war sie hellwach, wie ein aufgewecktes junges Mädchen. Alle Zahnräder griffen perfekt ineinander, sie bekam genau mit, was auf der Welt vor sich ging, jede kleinste Veränderung nahm sie wahr. Wie oft hatte sie dem Miststück erklärt, das von nichts einen blassen Schimmer hatte, dass Veränderungen etwas über den Lauf der Welt verrieten. Jede Abweichung, egal, ob gewaltig oder geringfügig, hatte ihre Bedeutung im großen Ganzen.
Die Tante mit der Männerstimme im Canale >5 machte eine Talkshow extra für Alte? Ein Zeichen! Der neue Papst ein Argentinier? Ein Zeichen! Ein Soldat brachte die eigene Frau um, weil er mit einer Soldatin zusammen sein wollte? Ein Zeichen! Die Kunst, mein liebes ukrainisches Miststück, ist, die Zeichen miteinander zu kombinieren. Die Deutung war der Schlüssel. Das System der Zeichen, sprich der Veränderungen, zu verstehen, darum ging es.
Die Wohnung im Haus gegenüber war so ein Zeichen. Ein wichtiges Zeichen. Äußerst wichtig.
Vorher hatte dort eine ganz normale Familie gewohnt. Schrecklich, aber normal. Ein Vater, der nie da war. Eine Mutter, die den Tag am Telefon verbrachte; sie hatte die blöde Kuh vor dem Fenster auf und ab gehen sehen, den Hörer zwischen Kinn und Schulter geklemmt und immer am Gestikulieren. Wie sie es anstellte, vor lauter Telefonitis nicht taub zu werden, konnte Donna Amalia sich nicht erklären. Und dann noch die beiden halbwüchsigen Kinder, das Mädchen, das sich mit irgendwelchen Halbstarken in seinem Zimmer einschloss, und der Junge, der, statt zu pauken, Gitarre spielte und heimlich auf dem Balkon rauchte.
Dann waren sie plötzlich weg gewesen. Sie mussten ein attraktives Angebot bekommen haben, denn Donna Amalia hatte nicht das geringste Anzeichen für ihren bevorstehenden Auszug bemerkt. Eines Morgens hatte ein Umzugswagen vor der Tür gestanden, und nach zwei Tagen waren sie mit Sack und Pack verschwunden, wohin auch immer. Donna Amalia verspürte nicht ansatzweise Bedauern darüber; es hatte einfach nichts Neues mehr zu entdecken gegeben, sie kannte sie inzwischen viel zu gut.
Die anschließende Renovierung war ruck, zuck vonstattengegangen; soweit sie das erkennen konnte, hatte sich ein Dutzend Handwerker viele Stunden am Tag in der Wohnung aufgehalten. Von ihrem Beobachterposten aus hatte sie in fast jedes Zimmer Einblick, und die Männer arbeiteten bei weit geöffneten Fenstern und Türen. Sie hatten sogar in jedem Raum ein Klimagerät eingebaut. Ein echter Luxus. Seit Monaten schon lag sie ihrem Sohn in den Ohren, dass sie auch eine Klimaanlage brauchte, aber dieser Nichtsnutz hatte nur im Wohnzimmer ein Gerät installieren lassen, mit der Begründung, die kalte Luft schade ihren Knochen. Als ob ihren Knochen noch etwas schaden könnte.
Dann war sie gekommen. Eine einzelne Person, eine junge Frau.
Sie musste über Nacht eingezogen sein, denn Donna Amalia hatte den ganzen Tag auf der Lauer gelegen, von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang, ohne Erfolg. Erst hatten sie die Möbel gebracht, alle nagelneu, und dann ein paar Kisten mit Kleidern. Donna Amalia hatte den Schriftzug eines namhaften Geschäfts aus der Innenstadt erkannt. Und plötzlich waren ein paar Lichter angegangen, und das bläuliche Flimmern eines Fernsehers war zu sehen.
Einmal war ein Fenster geöffnet worden, vermutlich im Schlafzimmer, und ein dunkelhaariger Mann hatte an dem Griff hantiert. Dann war es wieder geschlossen worden, und seit dem Moment hatten sich die Gardinen nicht mehr bewegt. Die Gardinen in der ganzen Wohnung. Unmöglich, so was.
Der Typ am Fenster hatte sich auch nicht mehr gezeigt. Nur eine junge Frau konnte man hinter den Gardinen auf und ab gehen sehen. Ihre Silhouette war deutlich zu erkennen. Einmal hatte sie ihr Gesicht ganz nah an die Glasscheibe der Balkontür im Wohnzimmer gebracht, und Donna Amalia hatte die Luft angehalten, so schön war sie. Wunderschön. Sogar sie, die sonst bei jedem Menschen einen Makel entdeckte, musste zugeben, dass das Gesicht des Mädchens einfach perfekt war. Aber sie war sofort wieder verschwunden, ohne sich erneut zu zeigen.
Über das Miststück Irina hatte Donna Amalia vorsichtig Erkundigungen in den Geschäften der Nachbarschaft einholen lassen. Niemand, wirklich niemand konnte sagen, wer in die Wohnung eingezogen war. Niemand belieferte sie, niemand brachte ihr Lebensmittel, niemand hatte das schöne Mädchen als neue Kundin gewonnen. Absolut niemand.
Als Zeichen, dachte Donna Amalia, war das schwierig zu deuten. Äußerst schwierig. Also musste sich dahinter etwas anderes verbergen, etwas Großes. Denn wenn die Zeichen sich nicht in ein System fügten, dann musste da etwas sein, das sich der Betrachtung entzog.
Donna Amalia wartete. Und wartete. Im Viertel liefen die Dinge wie sonst auch, aber die Wohnung von gegenüber ließ sich noch immer in kein System einordnen. Sie versuchte, mit ihrem Sohn am Telefon darüber zu sprechen, leider rief er sie ja nur einmal pro Woche an, aber er sagte wie das Miststück Irina bloß «Jaja». Und unter einem Vorwand beendete er das Gespräch.
Donna Anna kam das alles so merkwürdig vor, dass sie am Ende Irina losschickte, um im Haus gegenüber zu klingeln. Sie hatte ihr genau erklärt, was sie in die Gegensprechanlage sagen sollte: dass sie zu Signora Esposito aus dem ersten Stock wolle, und wenn ihr jemand antworten würde, sollte sie sagen: «Oh, Entschuldigung, ich habe mich in der Etage vertan», ganz unschuldig und lammfromm. Und dann sollte sie auf schnellstem Wege zurück zu ihr, Donna Amalia, kommen und berichten, wie die Stimme aus der Gegensprechanlage geklungen habe. Aber da hatte keine Stimme geantwortet, obwohl das Miststück behauptete, zweimal geklingelt zu haben. Und doch war das Mädchen zu Hause, denn Donna Amalia hatte sie hinter den Gardinen vorbeihuschen sehen. Sie ging nicht an die Gegensprechanlage, warum bloß? Vielleicht war das Ding kaputt, das wäre ja nicht weiter ungewöhnlich. Verdammte Technik – vor ein paar Jahren hätte es noch gereicht, sich an den Pförtner zu wenden, aber inzwischen war alles so teuer geworden, dass sich kein Mensch mehr einen Pförtner leisten konnte.
Hinter ihrem Wohnzimmerfenster, während der Regen auf die Häuser niederprasselte und der Wind durch die Straßen pfiff, sodass die Passanten in die Toreinfahrten flüchteten, kniff Donna Amalia listig die Augen zusammen: Wenn ein Zeichen nicht zu deuten war, dann fügte es sich nicht ins System ein. Und das musste gemeldet werden.
Sie rief das Miststück Irina zu sich und befahl ihr, das Telefon zu holen.
8
Gerade als Lojacono sich zum Abendessen in sein Stammlokal aufmachen wollte, klingelte das Telefon: Marinella.
Inzwischen telefonierte er jeden Tag mit seiner Tochter, nach Monaten schmerzhafter Funkstille hatten sie sich wieder angenähert. Es war noch zu früh für ein Treffen, aber die Fortschritte waren nicht zu übersehen: Vom totalen Schweigen über ein paar einsilbige Worte und karge Mitteilungen zu ihrem Alltag hatte sich das Mädchen ihm ganz allmählich wieder geöffnet, ein langwieriger, mühsamer Prozess.
Lojacono liebte seine Tochter sehr, die Trennung von ihr hatte ihn beinah verrückt werden lassen. Doch als das Verfahren und seine Versetzung anstanden, war seine Frau schnell auf Distanz gegangen – weniger, weil sie an die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen glaubte, als wegen der sozialen Ächtung, die damit verbunden war. Sich als Ausgestoßene zu fühlen, der die Türen vor der Nase zugeschlagen wurden und Freunde aus dem Weg gingen – für diese Schmach war kein Gerichtsurteil nötig.
Und schlimmer noch: Sonia und Marinella hatten nach Palermo umziehen müssen, angeblich um sie vor möglichen Vergeltungsschlägen in Sicherheit zu bringen. Lojacono konnte sich nicht vorstellen, mit welcher Begründung man sich an seiner Familie für etwas rächen wollte, das er nicht getan hatte. Doch es half nichts, sie mussten sich alle miteinander dem Gerichtsbeschluss unterwerfen.
Marinella war fünfzehn Jahre alt, und zu den üblichen Problemen von Jugendlichen ihres Alters kam noch hinzu, dass sie ein eher introvertierter Typ war, der allem Neuen, mögliche Bekanntschaften eingeschlossen, zurückhaltend begegnete. Dass man sie aus ihrem persönlichen Umfeld herausgerissen hatte, einer Kleinstadt wie Agrigent, in der seit Generationen alle alles übereinander wussten, war ein schwerer Schock für sie gewesen. Und dass die Mutter kein gutes Haar am Vater ließ und ihm die banalsten Dinge zur Last legte, tat sein Übriges: Lojacono hatte jeden Kontakt zu dem Mädchen verloren.
Die Abwesenheit Marinellas in seinem Leben war ihm erst recht unerträglich geworden, als er mit den unschuldigen Opfern des Krokodils zu tun bekam; der Trennungsvereinbarung und aller Vernunft zuwider hatte er sie angerufen, in der traurigen Erwartung, dass sie seinen Anruf ignorieren würde.
Doch zu seinem großen Erstaunen hatte Marinella nicht nur seinen Anruf entgegengenommen, sondern das Gespräch mit ihm in regelmäßigen Abständen fortgeführt. Peu à peu hatte sie ihm von ihren Schwierigkeiten erzählt, sich in der neuen Umgebung einzuleben, und von den komplizierten Beziehungen zu ihren Klassenkameraden und Lehrern. Aus der Ferne hatte Lojacono schließlich miterlebt, wie sich aus oberflächlichen Bekanntschaften echte Freundschaften entwickelten – ein Nachbarmädchen, das in dieselbe Schule ging, eine weitere Kameradin, die sich ihnen anschloss. Inzwischen hatte Marinella eine Clique von Freunden, mit denen sie regelmäßig ins Kino oder Pizza essen ging.
Um sie nicht in Gewissensnöte ihrer Mutter gegenüber zu bringen, die möglichst jeden Kontakt zwischen ihnen zu unterbinden suchte, rief er sie selbst nicht an, sondern wartete darauf, dass Marinella sich bei ihm meldete. Er hatte Angst, den dünnen Faden zwischen ihnen zu zerreißen, den zu spannen er sich so bemüht hatte, wusste er doch selbst am besten um seinen wenig kommunikativen Charakter. Aber auch einfach nur zu schweigen war schön, wenn am anderen Ende der Leitung jemand war, den man liebte.
Manchmal war das Mädchen regelrecht aufgekratzt.
«Ciao, Papi. Was machst du? Isst du gerade?»