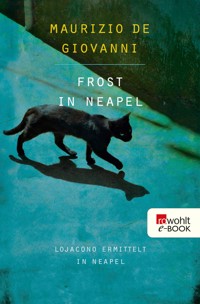9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Serie: Lojacono ermittelt in Neapel
- Sprache: Deutsch
In der trügerischen Maiwärme Neapels geschieht ein perfides Verbrechen. Der zehnjährige Dodo, Enkel eines reichen Unternehmers, wird bei einem Schulausflug entführt. Kurz darauf erfolgt der Erpresseranruf. Die reiche Familie von Dodos Mutter soll ein Lösegeld bezahlen. Inspektor Lojacono und sein Team haben eine harte Nuss zu knacken. Wer ist die blonde Frau, mit der Dodo zuletzt gesehen wurde? Die Familie des Kindes ist zerrüttet: Mutter und Vater leben getrennt, und auch das Verhältnis der Eltern zu dem reichen Großvater ist schlecht. Welche Rolle spielt der neue Lebensgefährte der Mutter, ein brotloser Künstler mit Spielschulden? Oder die Hausangestellte des Großvaters, voller Rachegelüste gegenüber dem undankbaren Mann, dem sie ihr Leben lang diente? Während Lojacono und seine Leute im Trüben stochern, harrt Dodo selbst mit seiner Batman-Figur im Arm in einem dunklen Zimmer aus. Er glaubt fest an Superhelden und seine Rettung …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 429
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Maurizio de Giovanni
Der dunkle Ritter
Lojacono ermittelt in Neapel
Kriminalroman
Aus dem Italienischen von Susanne Van Volxem
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
In der trügerischen Maiwärme Neapels geschieht ein perfides Verbrechen. Der zehnjährige Dodo, Enkel eines reichen Unternehmers, wird bei einem Schulausflug entführt. Kurz darauf erfolgt der Erpresseranruf. Die reiche Familie von Dodos Mutter soll ein Lösegeld bezahlen.
Inspektor Lojacono und sein Team haben eine harte Nuss zu knacken. Wer ist die blonde Frau, mit der Dodo zuletzt gesehen wurde? Die Familie des Kindes ist zerrüttet: Mutter und Vater leben getrennt, und auch das Verhältnis der Eltern zu dem reichen Großvater ist schlecht. Welche Rolle spielt der neue Lebensgefährte der Mutter, ein brotloser Künstler mit Spielschulden? Oder die Hausangestellte des Großvaters, voller Rachegelüste gegenüber dem undankbaren Mann, dem sie ihr Leben lang diente?
Während Lojacono und seine Leute im Trüben stochern, harrt Dodo selbst mit seiner Batman-Figur im Arm in einem dunklen Zimmer aus. Er glaubt fest an Superhelden und seine Rettung …
Über Maurizio de Giovanni
Maurizio de Giovanni wurde 1958 in Neapel geboren, wo er auch heute noch lebt. Er studierte Literatur, arbeitet aber hauptberuflich als Banker. «Das Krokodil», der erste Fall in der Serie um Inspektor Lojacono, wurde 2012 mit dem wichtigsten Preis für italienische Kriminalromane, dem Premio Scerbanenco, ausgezeichnet. «Der dunkle Ritter» ist der dritte Fall um Lojacono und seine Kollegen von Pizzofalcone. Maurizio de Giovanni ist einer der erfolgreichsten lebenden Krimiautoren Italiens. Seine Bücher werden in zahlreiche Länder verkauft, unter anderem nach Frankreich, England und in die USA.
Paola.
Alles Licht, das ich habe
1
Batman.
Baaatmaaan.
Ein Flüstern in der Dunkelheit, es riecht nach Moder und Staub.
Batman.
Ein Rascheln des Umhangs, der die Luft vor Dodos Gesicht zerschneidet.
Batman.
Dodo sieht ihn nicht, weil es dunkel ist. Dunkler als die Nacht, dunkler als das Kämmerchen in seinem Zimmer, mit der Tür, die nicht richtig schließt und manchmal mit einem Knarren von alleine aufgeht.
Sein Zimmer. Sein schönes warmes Zimmer, mit dem Avengers-Poster an der Wand, den Stickeralben und den Action-Figuren. Geordnet nach Größe und Geschichte stehen sie auf seinem Regal, und jedes Mal, wenn die Putzfrau da war, muss er sie neu sortieren. Bei dem Gedanken an sein Zimmer, an die Avengers und die Action-Figuren schießen ihm Tränen in die Augen. Er schluckt sie hinunter.
Wie dunkel es hier ist. Die Dunkelheit ist voller Geräusche, die Dunkelheit ist nie still.
In seinem Zimmer zu Hause wartet Dodo jeden Abend darauf, dass Mamas Tür endlich zugeht und er das Nachtlämpchen hervorholen kann. Seit er drei ist, besitzt er es. Niemand weiß von dem Lämpchen, eines von der Art, die man direkt in die Steckdose stecken kann und die kaum mehr als ein Schummerlicht machen. Eigentlich ist es gar keine richtige Lampe.
Wie gerne wäre ich jetzt in meinem Zimmer. Selbst wenn die Tür zum Kämmerchen manchmal von alleine aufgeht.
Dodo unterdrückt seine Tränen. Er hört ein Rascheln irgendwo im Raum und zuckt zusammen. Er hat kein Gefühl dafür, wie groß der Raum ist. Doch ganz sicher wird er nicht losgehen und ihn erkunden.
Batman, denkt er und umklammert die Action-Figur mit seiner verschwitzten Hand. Was für ein Glück, dass ich dich heute Morgen mit in die Schule genommen habe. Auch wenn es verboten ist und auch wenn sie sagen, man darf kein Spielzeug mit in die Schule nehmen, schließlich bin ich schon groß, beinah zehn. Aber du und ich, wir beide wissen, dass du kein Spielzeug bist. Du bist ein Held.
Papa und ich haben das immer gesagt, weißt du noch? Dass du der größte aller Superhelden bist. Der beste von allen, der stärkste. Er hat es mir mal erklärt, da war ich noch ganz klein, und er hat noch bei uns gewohnt. Er hat mich auf die Schultern genommen und gesagt: «Du bist mein kleiner König, und ich bin dein Riese, ich bringe dich überallhin. Wohin du willst.»
Papa hat mir erklärt, warum du der größte aller Superhelden bist: Weil du keine Superkräfte besitzt.
Es ist keine Kunst, die Bösen zu besiegen, wenn man ultrastark ist oder fliegen kann und mit den Augen grüne Blitze schleudert. Das ist einfach.
Aber du, Batman, du bist ein ganz normaler Mensch. Du hast Mut, und du bist klug. Die anderen können fliegen? Du hast deinen Dark-Knight-Gürtel mit den Batarangs, du wirfst ein Seil aufs Dach und hangelst dich nach oben. Die anderen können megaschnell rennen? Du hast dein Batmobil, das noch viel schneller ist. Du bist der größte Superheld von allen, Batman. Weil deine Macht jeder anderen Macht überlegen ist: Du hast Mut. Du bist wie mein Papa.
Ich habe Papa nicht erzählt, dass ich abends immer das Lämpchen aus der Schublade hole. Ich will nicht, dass er denkt, ich hätte Angst. Das Problem ist, dass ich eigentlich noch klein bin, aber alle sagen, ich sehe aus wie mein Papa, und der ist stark.
Weißt du, Batman, auch wenn du ein Held bist und eigentlich vor nichts Angst hast: Ich weiß, ein bisschen Angst hast du doch in diesem dunklen Raum, in den sie uns eingesperrt haben. Ich auch, ein bisschen, ein ganz kleines bisschen. Aber wir brauchen uns keine Sorgen zu machen – mein Papa kommt und holt uns hier raus.
Flieg, Batman, flieg! Du bist der Dunkle Ritter, der Herrscher der Nacht. Du hast keine Angst im Dunklen, und ich halte mich an dir fest und fliege mit dir fort. Flieg, Batman, flieg!
Ein Schlag gegen die Wellblechtür, ein ohrenbetäubendes Bollern, dass ihm das Blut in den Adern gefriert. Die Action-Figur fällt zu Boden, das Plastik ist rutschig geworden in der verschwitzten Hand und findet keinen Halt mehr.
Dodo schreit auf vor Angst, fährt hoch, kauert sich wieder hin; verzweifelt tasten seine Hände über den Boden: Dreck, spitze Steine, Schotter, Papier. Sie finden die Action-Figur, greifen danach, er hält sie an sein Gesicht, an die tränenfeuchte Wange. Draußen brüllt eine Stimme einen Befehl in einer Sprache, die er nicht versteht.
Er verkriecht sich in eine Ecke, sein Rücken unter dem Hemd ist zerkratzt von der rauen Mauer, sein Herz klopft bis zum Hals, als wollte es seinem Körper entfliehen.
Batman, Batman, hab keine Angst. Mein Papa kommt und holt uns hier raus.
Denn mein Papa ist ein Riese, und ich bin sein kleiner König.
2
Polizeihauptwachtmeister Marco Aragona verzog das Gesicht, kaum war er zur Tür des Gemeinschaftsbüros getreten.
«Wusste ich es doch! Es ist 8 Uhr 29, und alle sind schon da. Habt ihr denn gar kein Zuhause? Ihr habt doch eine Wohnung, eine Familie, wenigstens manche von euch! Wie kann das sein, dass man hier egal zu welcher Uhrzeit immer schon einen von euch antrifft?»
Es war fast ein Running Gag: Jeden Morgen erschien Aragona in letzter Minute und zeigte sich untröstlich, weil alle anderen Mitarbeiter des Kommissariats von Pizzofalcone bereits an ihrem Arbeitsplatz waren.
Der Stellvertretende Kommissar Giorgio Pisanelli unterbrach die Lektüre eines Vernehmungsprotokolls und warf dem Kollegen über den Rand seiner Gleitsichtbrille einen amüsierten Blick zu.
«Noch eine Minute, und du wärst zu spät gewesen, Aragona. Das hätten wir melden müssen.»
Der Polizist setzte sich an seinen Schreibtisch und nahm mit einer einstudierten Geste die Sonnenbrille mit den blauverspiegelten Gläsern ab.
«Hör mal, Presidente, wenn ich nichts gesagt hätte, dann hättest du gar nicht mitgekriegt, dass ich gekommen bin. Das Alter ist ein hässliches Tier …»
Der älteste und der jüngste Mitarbeiter des Kommissariats von Pizzofalcone nahmen sich gern gegenseitig auf den Arm: der eine im Tonfall eines Lehrers, der zu einem renitenten Schüler spricht, der andere, indem er den Kollegen behandelte, als wäre er bereits vergreist.
«Was sitzt ihr eigentlich hier rum, wo draußen allerschönstes Wetter ist? Das müsst ihr mir wirklich mal erklären.»
Ottavia Calabrese schaute hinter ihrem Bildschirm hervor.
«Auch wenn es morgens um acht noch keine Leichen gibt, lieber Aragona, heißt das nicht, dass wir machen können, was wir wollen. Und hör auf, den armen Pisanelli ‹Presidente› zu nennen, nachher bildet er sich noch was drauf ein.»
«Weißt du was, Ottavia? Aus dir spricht der pure Neid. Am liebsten würdest du doch ‹Präsidentin› gerufen werden. Aber das kannst du knicken, du wirst für immer unsere ‹Mama› bleiben. Hast du dir den Kollegen Pisanelli mal genauer angeschaut? Ist dir nicht die Ähnlichkeit aufgefallen? Und dann heißt er auch noch Giorgio und ist fast genauso alt.»
Mit dem Kinn deutete Aragona auf ein gerahmtes Foto an der hellgrün gestrichenen Wand, den einzigen Deko-Gegenstand in dem kargen Ambiente, in dem sie fast ihr ganzes Leben verbrachten. Er kratzte sich die glattrasierte, solariumgebräunte Brust unter dem nur halb zugeknöpften Hawaiihemd und drehte sich zu Pisanelli um.
«Gib’s zu, Presidente, um deinem Land noch besser zu dienen, hast du dich heimlich bei den Gaunern von Pizzofalcone eingeschlichen.»
Ottavia verzichtete auf eine Erwiderung und verschwand wieder hinter ihrem Bildschirm.
Mit der Bezeichnung «Gauner» hatte Aragona auf ihre schwierigen Anfänge als versprengtes Häuflein gefallener Gesetzeshüter angespielt, aus dem sich ein inzwischen gut funktionierendes Team entwickelt hatte. Spitznamen inklusive. Dass ihnen der gesamte Polizeiapparat der Stadt mit Häme begegnete, hatte jedoch einen Grund. Vier Mitarbeiter des Kommissariats waren beim Kokaindealen erwischt worden, und Ottavia und Pisanelli hatten ihre seltsamen Geschäfte bezeugen müssen. Beide wurden als Einzige nicht vom Dienst suspendiert, eine interne Untersuchungskommission hatte sie komplett durchleuchtet. Es war verdammt schwer gewesen, diese von der Leine gelassenen Spürhunde davon zu überzeugen, dass sie mit den korrupten Kollegen nicht unter einer Decke steckten. Eine Zeitlang hatte sogar die Drohung im Raum gestanden, das Kommissariat ganz zu schließen. Die vier Idioten, die bei allen nur noch «die Gauner von Pizzofalcone» hießen, waren durch andere Kollegen ersetzt worden. Der schlechte Ruf jedoch war haften geblieben. Genauso wie die Bezeichnung «Gauner», trotz neuer Führung und neuer Mitarbeiter, worüber Ottavia sich noch immer aufregte.
Doch vor die Wahl gestellt, die Kränkung stoisch zu ertragen oder in die Offensive zu gehen, hatte die neue Truppe, eine wilde Mischung Ausgestoßener aus allen Ecken der Stadt, beschlossen, eine Art Kampfnamen daraus zu machen. Die kollektive Schmähbezeichnung hatten sie noch dazu mit persönlichen Spitznamen angereichert. «Promis haben immer einen Spitznamen», hatte Aragona eines Tages voller Inbrunst behauptet. Ottavia hatte fast einen Lachanfall bekommen. Ja, so etwas gefiel ihr. Sie hatte nichts dagegen, die «Chefin der Kompanie» genannt zu werden. Oder gar die «Mama», selbst wenn das ganz schön frech war. Kurz hatte sie erwogen, dagegen zu protestieren, aber dann gestand sie sich ein, dass sie ja tatsächlich so etwas wie eine Mutter für die anderen war. Ihr entging nichts, auch wenn sie sich gern hinter ihrem Bildschirm verschanzte. Und wann immer jemand von den anderen etwas brauchte, kam er zuerst zu ihr gelaufen, wie zu seiner Mama. Und eine Mutter war sie nun mal auch im wahren Leben; sie war die einzige Frau in der Truppe mit Kind.
«Und der Chinese, wo steckt der? Wenigstens einer, der noch später dran ist als ich.»
Dieses Mal hatte Marco Aragona Inspektor Giuseppe Lojacono auf dem Kieker, den Kollegen, der das legendäre Krokodil überführt hatte und seiner asiatischen Gesichtszüge wegen «der Chinese» genannt wurde.
Ottavia konterte genüsslich:
«Er war bereits da und ist schon wieder weg. Um zehn nach sieben kam ein Anruf: ein Wohnungseinbruch, da ist er hin.»
Aragona riss die Augen auf.
«Um zehn nach sieben? Was soll das denn heißen – schläft der etwa im Büro?»
«Wenn überhaupt, dann schlafen die im Büro. Alex war auch schon da, sie sind zusammen los.»
Alex Di Nardo, die andere Frau im Team, sah zwar aus wie ein zartes junges Mädchen, doch in Wirklichkeit war sie eine Profi-Scharfschützin, die eine Fliege aus 30 Meter Entfernung erledigte. Sie ging zweimal pro Woche zum Schießtraining – wie anders als «Calamity Jane» hätte ihr Spitzname lauten können? «So wissen wenigstens alle, dass sie sich vor ihr in Acht nehmen müssen», war es Aragona eines Morgens rausgerutscht, als er mit Hilfe eines Taschenspiegels hingebungsvoll seine Frisur richtete. Seine Elvistolle sollte vermutlich ein paar Zentimeter mehr Körpergröße hinzuschummeln und zugleich seine beginnende Stirnglatze verdecken.
«Und der Boss, Ottavia? Sag bloß, der ist auch schon da?!»
Aragona warf einen Blick auf die halboffene Tür, die in den Nachbarraum führte: das Büro von Kommissar Luigi Palma. Mit spitzbübischer Miene drehte er sich dann zu Francesco Romano um, dem einzigen weiteren Anwesenden im Gemeinschaftsbüro, der sich schweigend hinter dem Bildschirm verbarrikadiert hatte. Romano war ein massiger Typ, mit breiten Schultern und Stiernacken, und sein finsterer Gesichtsausdruck verriet, dass man sich besser nicht mit ihm anlegte. Doch Marco Aragona war an diesem Morgen einfach nicht zu bremsen.
«He, Hulk! So haben sie dich schon in deinem alten Kommissariat genannt, oder? Gleich packt ihn die Wut, wird er giftgrün im Gesicht und reißt sich das Hemd vom Leib …»
Romano brummte:
«Reiß dir lieber mal dein eigenes Hemd vom Leib. Das übrigens ausgesprochen scheußlich ist.»
«Na hör mal, das Hemd hat so viel gekostet wie all eure Lumpen zusammen! Du bist doch derjenige mit dem grottigen Geschmack, ohne jede Ahnung von Mode. Eben weil ich mich lässig kleide, kommt keiner auf die Idee, ich sei Polizist. Euch sieht man dagegen auf drei Meilen gegen den Wind an, dass ihr Bullen seid. Übrigens, was die Spitznamen angeht: Wenn ihr mir auch einen verpassen wollt, dann nennt mich ‹Serpico›. Ich bin nämlich genau wie er, wie Al Pacino.»
Romano prustete los.
«‹Al Cretino› müsste man dich eher nennen, den Schwachkopf. An deiner Stelle würde ich unbedingt die Regel beherzigen, dass Reden Silber ist und Schweigen Gold. Da kommt nämlich nicht so viel Unsinn bei raus. Stimmt schon, du hast wirklich mehr von einem Komödianten als von einem Bullen an dir. Aber einem Schmierenkomödianten.»
Beleidigt blaffte Aragona zurück:
«Mein Gott, bist du retro! Du scheinst keinen blassen Schimmer davon zu haben, dass unser Beruf im Wandel begriffen ist. Typen wie du sind bald nur noch Dinosaurier, vom Aussterben bedroht. Fossilien, wenn du mich fragst. Weißt du wenigstens …»
In dem Moment klingelte das Telefon.
3
Kommissar Luigi Palma hob den Blick von den Papieren auf seinem Schreibtisch und versuchte, dem Stimmengewirr im Nebenraum etwas halbwegs Verständliches zu entnehmen.
Er hatte es sich zur Regel gemacht, die Tür zu seinem Büro nie ganz zu schließen, um seinen Mitarbeitern das Gefühl zu geben, jederzeit ansprechbar zu sein. Doch hier in Pizzofalcone führte eine der beiden Türen direkt in das Gemeinschaftsbüro, zu dem er die ehemalige Kantine hatte umbauen lassen. Jetzt, fürchtete er, sie könnten glauben, er wollte sie permanent im Auge behalten. Womit seine eigentliche Absicht ins Gegenteil verkehrt worden wäre: Statt ein Primus inter Pares zu sein, eine Art großer Bruder, der koordiniert statt kommandiert, erschiene er ihnen wie ein argwöhnischer Galeerenaufseher, der ihre Gespräche belauscht.
Was auch immer er tat, es konnte so oder so ausgelegt werden. Er hatte gewusst, dass es kein einfacher Job werden würde; sogar der Polizeipräsident hatte ihm bei ihrer letzten Unterredung, als er ihm die Stelle anbot, im selben Atemzug davon abgeraten. Er habe eine vielversprechende Karriere vor sich, früher oder später würde sich bestimmt ein Posten mit mehr Prestige und weniger Unannehmlichkeiten finden, bei dem er seine Fähigkeiten unter Beweis stellen könne.
Doch Palma war nie den bequemsten Weg gegangen, er liebte Herausforderungen, und de facto hatte er kaum etwas zu verlieren. Das konnte der Polizeipräsident freilich nicht ahnen.
Seine Karriere interessierte Palma weit weniger, als sein hohes Arbeitspensum vermuten ließ. Die Wahrheit war einfach: Es gab in seinem Leben nichts anderes.
Seine Eltern waren vor ein paar Jahren verstorben, kurz hintereinander. Palma bezeichnete sich stets als «Kind von späten Eltern»; sein Vater hatte bei seiner Geburt die 50 bereits überschritten, und auch seine Mutter war über 40 gewesen. Sein älterer Bruder hatte das Down-Syndrom gehabt und war mit 20 gestorben – ein plötzliches Loch in ihrer Mitte, ein stiller Schmerz, der sie für immer begleiten sollte. Palma hätte selbst gerne Kinder gehabt, doch seine Exfrau, eine Ärztin, ging so auf in ihrem Beruf, dass für Kinder kein Platz war. Ohne dass sie es wollten, hatten sie sich immer mehr voneinander entfernt, und so hatte der Entschluss, sich zu trennen und später sogar scheiden zu lassen, für beide eine Erleichterung bedeutet.
An dem Punkt hatte Palma begonnen, sich nach anderen Frauen umzusehen. Er war ein gefühlvoller Mann, warmherzig und kommunikativ, der keine Eltern mehr hatte und es auch nicht zu einer eigenen Familie gebracht hatte. Wohin das Schicksal uns eben führt …
Da er eine Führungspersönlichkeit war und gut Teams anleiten konnte, war sein Beruf an die Stelle einer Familie getreten. Natürlich war dies nicht unbemerkt geblieben, und am Ende hatten sie ihm einen Posten als Stellvertretender Kommissar in einem ruhigen Wohnbezirk angeboten. Weil sein Vorgesetzter schwer erkrankte und ständig ausfiel, war er innerhalb kürzester Zeit zum jüngsten Leiter einer Polizeidienststelle in der ganzen Stadt avanciert.
Als der Leitende Kommissar sich, um sein allerletztes Gefecht auszutragen, in den frühzeitigen Ruhestand versetzen ließ, war Palma davon ausgegangen, auch offiziell in seine Fußstapfen zu treten. Das wäre ebenso im Sinne seiner Mitarbeiter gewesen, darunter viele ältere Kollegen, die seine ehrliche, bescheidene Art zu schätzen wussten. Doch da auf dieser Welt nun mal weder die Logik noch die Gerechtigkeit regiert, hatte eine Kollegin aus einer anderen Stadt, die mehr Meriten gesammelt hatte und größeres Wohlwollen in Rom genoss, das Rennen gemacht.
Nicht Wut oder Neid hatten ihn dazu bewogen, seine Stelle aufzugeben. Er wusste einfach, dass es nicht möglich sein würde, die Effizienz des Kommissariats aufrechtzuerhalten. Es war unabdingbar, dass er ging. Wäre er geblieben, hätten die Kollegen die neue Chefin niemals als Autorität anerkannt; sie hätten sich weiterhin bei jeder Frage an denjenigen gewandt, der die Umgebung, die Mitarbeiter und die Strukturen im Kommissariat am besten kannte.
Just um diese Zeit geschah die Sache mit den Gaunern von Pizzofalcone, ein enormer Imageschaden für die örtliche Polizei. Wie die meisten Kollegen, die von morgens bis abends unter größten Mühen die Stadt vor ihrer Zerstörung durch die eigenen Bewohner zu schützen versuchten, hatte auch er innerlich aufbegehrt und eine große Wut in sich verspürt. Als er erfuhr, dass der Polizeipräsident das Kommissariat schließen wollte, was dem Eingeständnis einer Niederlage gleichgekommen wäre, hatte er Einspruch eingelegt.
Und die Leitung des Kommissariats gefordert.
Es war eine Reaktion aus dem Bauch heraus gewesen. Ein Risiko, keine Frage. Aber auch eine Möglichkeit, sich aus diesem trüben Tümpel zu retten, in den seine Karriere und in gewisser Hinsicht sein ganzes Leben sich verwandelt hatte. Ein neuer Job, eine neue Perspektive. Und ein neues Team. Eine neue Ersatzfamilie.
Die Mitarbeiter, die man ihm zuwies, verhießen zumindest nach Lage der Akten nichts Gutes. Die vier Gauner, die in der Drogenaffäre die Hauptrollen gespielt hatten und rausgeflogen waren, wurden durch andere «Gauner» ersetzt, heimatlose Seelen, die kein anderes Kommissariat beschäftigen wollte: der Vitamin-B-gepamperte Aragona, der genauso laut und ungehobelt wie übergriffig und schlampig war; die rätselhafte Di Nardo, die in ihrer eigenen Dienststelle mit der Waffe herumgeballert hatte; der wortkarge Romano, der in seiner cholerischen Art sowohl Gangstern wie Kollegen mit seinen kräftigen Händen schon mal an die Gurgel ging. Und Lojacono? Der Sizilianer, den sie wegen seiner auffälligen mandelförmigen Augen den «Chinesen» nannten?
Bei ihm lag der Fall anders, ihn hatte er haben wollen. Lojaconos ehemaliger Vorgesetzter Di Vincenzo war froh gewesen, ihn loszuwerden, da der Chinese mit einem echten Makel behaftet war: Ein Kronzeuge hatte behauptet, Lojacono habe mit der Mafia kooperiert, woraufhin man ihn in einen anderen Landesteil strafversetzt hatte. Wenngleich es keinerlei Beweise für ein solches Fehlverhalten gab, war der Ruf des Inspektors von dem Moment an ruiniert gewesen. Aber Palma hatte Lojacono bei der Arbeit erlebt, als sie gemeinsam Jagd auf das «Krokodil» machten, einen Serienmörder, der Monate zuvor die Stadt in Angst und Schrecken versetzt hatte. Und er hatte sein Talent erkannt, seine Wut und sein emotionales Engagement: genau das, was er bei seinen Leuten suchte und was für ihn einen guten Polizisten ausmachte.
Auch die beiden Kollegen, die die Säuberungsaktion im Kommissariat von Pizzofalcone durch die interne Untersuchungskommission überstanden hatten, waren alles andere als eine Last.
Der ehemalige Stellvertretende Kommissar Pisanelli kannte das Viertel, in dem er zur Welt gekommen war und sein ganzes Leben verbracht hatte, wie seine Westentasche. Er war ein höflicher, empfindsamer Mann, eine bestens unterrichtete, nie versiegende Informationsquelle, wodurch das Manko kompensiert wurde, dass der Rest des Teams vergleichsweise neu im Stadtteil war. Wäre Pisanelli nicht so fixiert auf einige verdächtige Selbstmorde gewesen, hätte er in ihm die wertvollste Unterstützung gehabt, die man sich wünschen konnte.
Was Ottavia betraf, so hatte er sich anfangs gefragt, ob er sie nicht lieber ins Feld schicken sollte, doch dann war ihm klar geworden, wie wichtig ihre Funktion als Assistentin im Büro war. Sie bewegte sich so geschickt im Internet, dass ihre Recherchen mindestens genauso hilfreich waren wie die Erkundungen, die ihre Kollegen auf der Straße einholten, wenn nicht mehr; sie ersparte ihnen Stunden mühevoller Kleinarbeit, indem sie mit ein, zwei Klicks jede Menge Erkenntnisse zutage förderte, nach denen sie sonst ewig geforscht hätten.
Zugegeben, es erwärmte ihm das Herz, sie im Nebenraum zu wissen und ihr helles Lachen zu hören, wenn Aragona seine schlechten Witze machte.
Er hatte genug Lebenserfahrung, um sich der Gefahr bewusst zu sein. Es war nie gut, wenn die unschuldige Freude an der Begegnung im Job in etwas anderes umschlug. Seine Aufgabe war, dieses Team zu leiten und das Kommissariat möglichst effizient arbeiten zu lassen, damit es nicht aufgelöst wurde. Und Ottavias Aufgabe lag in der wertvollen Recherchearbeit, die sie leistete. Sie beide konnten es sich nicht erlauben, die professionelle Natur ihrer Beziehung zu gefährden. Abgesehen davon, dass sie verheiratet war und einen Sohn hatte, der noch dazu unter Autismus litt.
Vielleicht irrte er sich auch. Vielleicht gaukelte er sich bloß vor, dass sie ihn häufiger anlächelte als die anderen, besonders aufmerksam ihm gegenüber war und die Stimme senkte, wenn sie mit ihm sprach. Gut möglich, dass er das sah und hörte, was er sehen und hören wollte. Weil er sich danach sehnte. Zu viele Nächte hatte er auf der schmalen Couch in seinem Büro verbracht, weil er keine Lust verspürte, in seine chaotische kleine Wohnung zurückzukehren, die er nicht als sein Zuhause empfand. Zu viele Sonntage hatte er biertrinkend vor dem Fernseher verbracht, ohne überhaupt hinzuschauen. Zu viele fast verblasste Erinnerungen geisterten durch seinen Kopf, dass er fast fürchtete, sie sich nur einzubilden, um die Leere in seinem Inneren zu füllen.
Es war nicht der Sex, der ihm fehlte; er war immer schon der Ansicht gewesen, dass Sex ohne Liebe etwas vollkommen Überflüssiges war. Wenn er seine wenigen Freunde traf, ehemalige Klassenkameraden, die daran festhielten, sich alle paar Monate zu verabreden, ertrug er stoisch ihre Scherze; in ihren Augen ähnelte er einem vertrockneten Religionslehrer, der verzweifelt versuchte, ein paar pickligen dauererregten Jünglingen die Freuden des meditativen Lebens nahezubringen. Doch Palma wollte keine flüchtigen Liebschaften. Er wollte seiner Einsamkeit etwas entgegensetzen, keine Frage, aber ganz sicher war dafür nicht die Frau eines anderen geeignet, die ihre eigene Familie hatte, ihr eigenes Leben, ihre eigenen Probleme.
Doch egal, wie vernünftig die Argumentation war, die er sich zurechtlegte: Sie löste sich schlagartig auf, sobald er morgens Ottavias Gesicht sah, die stets als Erste ins Büro kam. Dann war er hoffnungslos verloren, und sein ganzes Gedankenkonstrukt zerfiel in Tausende winzige Glückssplitter. Was ist daran schlimm, raunte sein Unterbewusstsein ihm zu, wenn letztlich gar nichts passiert? Wenn du dich ihr nicht erklärst, wenn du es nicht darauf anlegst, wenn du sie nicht merken lässt, dass dein Interesse an ihr über das rein Berufliche weit hinausgeht? Er wusste, dass er sich etwas vormachte, aber er hatte keine Lust, hohe Schutzwälle um sich herum zu errichten, zumal er keine Ahnung hatte, wie er das anstellen sollte.
Er hörte, wie sie im Nebenraum einen Anruf entgegennahm, und freute sich an dem warmen Klang ihrer Stimme, den er nicht missen mochte.
Doch dann verging ihm das Lächeln.
4
Am Morgen ist die Polizei in der Regel auf Einbrecherjagd, dachte Lojacono, während er sich die steile Gasse hinaufkämpfte, vorbei an Marktverkäufern, die lärmend ihre Waren auf der Straße aufbauten, vorbei an Motorrollern, die sich rücksichtslos ihren Weg bahnten, vorbei an verschlafenen Jugendlichen mit Rucksack über der Schulter. Ein Wohnungseinbruch wird im Morgengrauen entdeckt, wenn die Nacht ihn ans Ufer des erwachenden Bewusstseins spült und der Bestohlene sich als Bestohlener erkennt und in einem Albtraum erwacht.
Ein Einbruch in eine Wohnung ist eine üble Angelegenheit. Ein gewaltsames Eindringen in die Privatsphäre, sinnierte der Inspektor, die brutale Erkenntnis, dass es nicht ausreicht, die Tür vor dem Mob da draußen zu verschließen, um diese aus den Fugen geratene Welt voller Angst und Elend fernzuhalten. Plötzlich findest du dich selbst in der Rubrik «Vermischtes» wieder, ausgerechnet du, der du gar nichts Böses getan hast, der du dachtest, mit diesen Scheußlichkeiten nichts zu schaffen zu haben und immun gegen das Verbrechen zu sein. Deine Ruhe findet ein jähes Ende, die Ordnung, die du mühsam um dich herum errichtet hast, gerät ins Wanken, dein vermeintlich unzerstörbares Idyll existiert nicht länger.
Als Polizist in eine Wohnung zu kommen, in der zuvor ein Einbruch stattgefunden hat, ist nicht unheikel. Man fühlt sich verantwortlich, fast so, als hätte man in seiner Beschützerrolle versagt. Ein unausgesprochener Vorwurf liegt in den Augen des Opfers. «Ich zahle regelmäßig meine Steuern», scheint dieser Blick zu sagen, «mein Leben mit all seinen Problemen ist schon anstrengend genug, und ein Teil meines sauer verdienten Geldes landet in deiner Tasche. Und dann das: eine total verwüstete Wohnung, Kriminelle, die in meinen Sachen herumwühlen und mir neben den Wertgegenständen auch noch meinen inneren Frieden stehlen. Gib zu, Polizist, dass du mit Schuld daran trägst. Wo warst du, als diese Verbrecher mir meine Ruhe und meine Sicherheit raubten? Wahrscheinlich hast du wohlig in deinem Bett gelegen und dein von mir bezahltes Abendessen verdaut.»
Lojacono schaute auf den Zettel, auf dem er die Anschrift notiert hatte. Als der Anruf einging, war außer ihm und Ottavia Calabrese nur Alex Di Nardo im Büro, die gerade zur Tür hereingekommen war. Alles Frühaufsteher, die Kollegen vom Kommissariat Pizzofalcone, ein gutes Zeichen, wenngleich er den Verdacht nicht loswurde, dass weniger die Arbeit als andere, existenziellere Gründe sie so früh aus den Federn trieben. Der Anrufer hatte ein paar unzusammenhängende Sätze im tiefsten neapolitanischen Dialekt von sich gegeben, die er kaum verstand, weshalb er den Hörer an Alex weiterreichen musste.
Er drehte sich zu der Kollegin um und deutete auf die Toreinfahrt. Alex nickte. Sie hatte das Grüppchen Schaulustiger ebenfalls bemerkt, das sich stets wenige Sekunden nach Eintreten eines besonderen Ereignisses bildet und auch jetzt zur Stelle war. Ein paar Meter weiter stand ein Streifenwagen, an dessen Tür mit verschränkten Armen ein uniformierter Polizist lehnte und zu ihnen herübergrüßte.
Eine merkwürdige Frau, diese Di Nardo, dachte Lojacono. Nicht dass die anderen nicht auch merkwürdig waren, und wahrscheinlich war er selbst der Merkwürdigste von allen. Aber Alex war ihm ein echtes Rätsel. Mit ihren feinen Gesichtszügen, der grazilen Figur und schweigsamen Art strahlte sie eine zurückgehaltene, geballte Kraft aus, die jeden Moment explodieren und sich in etwas anderes verwandeln konnte. Lojacono hatte Aragonas Getratsche noch im Ohr, wonach in Alex’ Kommissariat eine Kugel losgegangen sein musste, ein Streifschuss, der einen Kollegen getroffen hatte. Doch er hatte der Sache nicht weiter auf den Grund gehen wollen. Denn hatten sie nicht alle, die sie in Pizzofalcone gestrandet waren, irgendwie Dreck am Stecken?
Unwillkürlich wanderten seine Gedanken nach Süden, in seine sizilianische Heimat, und ein Panorama von Licht und Schatten zeigte sich vor seinem inneren Auge, ein blühender Mandelzweig, das Meer, dessen Geruch der Wind ihm in die Nase trieb. Die Erinnerung an Di Fede wurde in ihm wach, den Mafioso, der mit ihm zur Schule gegangen war und mit seiner Zeugenaussage sein Leben verändert hatte.
Nicht alles hat sich zum Schlechten gewendet, dachte er, als sie sich einen Weg durch die Schaulustigen bahnten, um in den Innenhof zu gelangen, an dessen Ende eine breite Treppe aufstieg. So war zum Beispiel Sonias wahrer Charakter zum Vorschein gekommen, seine Ehefrau, die ihn verlassen hatte und keine Gelegenheit ausließ, ihn bei ihren seltenen Telefonaten mit Gift und Galle zu überschütten. Er hatte Menschen kennengelernt, die er unter anderen Umständen nie getroffen hätte, wie seine neuen Kollegen. Und auch sein Verhältnis zu Marinella, seiner Tochter, hatte sich verändert. Zum Glück.
Über Monate hinweg hatte er nicht mal mit ihr telefonieren können, weil Sonia dies verhindert hatte. Die Sehnsucht nach seiner Tochter, die keine 14 Jahre alt gewesen war, dieser geradezu körperliche Schmerz war mit das Schlimmste, was er je erlebt hatte. Dann, ganz allmählich, hatten sie telefonisch wieder Kontakt aufgenommen, und schließlich, an einem verregneten Abend vor zwei Monaten, hatte sie vor seiner Haustür gestanden. Sie war vor dem ewigen Streit mit ihrer Mutter geflohen, auf der Suche nach einem ruhigen Pol in ihrem Leben, den sie für immer verloren geglaubt hatte.
Einfacher waren die Dinge trotzdem nicht geworden, hatte Lojacono festgestellt. Er hatte ein liebevolles und fröhliches kleines Mädchen in Erinnerung, das mit seinen Freundinnen «feine Dame» spielte und kichernd vor dem Spiegel die Kleider seiner Mutter anprobierte. Doch dieses kleine Mädchen hatte sich in einen wortkargen, nachdenklichen Teenager verwandelt, der nur noch schwarz gekleidet herumlief und ihn aus dunklen Mandelaugen, die den seinen so ähnlich waren, grüblerisch anschaute. Er wusste nicht, ob sich ihr Besuch länger hinziehen würde, und hatte Angst, sie zu fragen. Er wollte nicht, dass Marinella auch nur ansatzweise dachte, sie wäre unerwünscht. Seiner Exfrau hatte er mitgeteilt, dass sich das Mädchen bei ihm befand und dass sie sich keine Sorgen machen sollte, was ihm wüste Beschimpfungen eingetragen hatte. Doch in Wirklichkeit war Lojacono sich gar nicht so sicher, welches die beste Lösung für seine Tochter war: sich in einer neuen Umgebung einzuleben und bei einem Vater zu bleiben, der wegen seines Berufs kaum Zeit für sie hatte, oder an einen Ort zurückzukehren, an dem sie sich offensichtlich nicht wohl fühlte.
Die leise Stimme von Alex Di Nardo riss ihn aus seinen Gedanken.
«Hier geht’s rein.»
In der Beletage befand sich nur eine Wohnung, mit einer einfachen Eingangstür aus Holz, die angelehnt war. Das Haus war wie viele in der Gegend ursprünglich ein Prachtbau gewesen, der mit der Zeit dem Verfall preisgegeben worden war, während das Viertel sozial immer mehr abrutschte. In den letzten zehn Jahren hatten die Immobilienkrise und der steigende Wohnungsbedarf in zentraler Lage die Entwicklung umgekehrt, sodass der Stadtteil wieder an Prestige gewann. Die Graffiti an den Mauern waren entfernt und die Fassaden neu gestrichen worden, und die Rosen und Hortensien in den neu begrünten Innenhöfen schienen sich in der milden Mailuft in ihrem eigenen Glanz zu sonnen.
Die Wohnung, in der der Einbruch stattgefunden hatte, war anders als üblich nicht in mehrere Apartments unterteilt worden, um den Verkauf oder die Vermietung zu erleichtern. Das hieß, sie musste sehr groß sein. Oberhalb des Türrahmens war eine Überwachungskamera angebracht. Alex Di Nardo löste den Blick von dem aufdringlichen Objektiv und wies Lojacono auf die Eingangstür hin, die keinerlei Einbruchspuren aufwies. Durch ein großes Fenster, das perfekt in den Marmorsturz eingepasst war, fiel Licht ins Treppenhaus. Lojacono wickelte sich ein Taschentuch um die Hand, um das Fenster zu öffnen, das auf einen Innenhof hinausging. «S. Parascandolo» war in verschnörkelten Buchstaben in das Messingschild über dem Türklopfer eingraviert.
Ein uniformierter Polizist, der den Eingang der Wohnung bewachte, legte zum Gruß die Hand an die Mütze.
«Guten Morgen, ich bin Polizeiwachtmeister Rispo. Wir sind seit etwa 20 Minuten hier. Der Anruf der Einsatzzentrale ist bei uns eingegangen.»
Der große Vorraum verengte sich zu einem Korridor, von dem rechts eine Art Salon abging. Kleidungsstücke, Taschen und Nippes lagen verteilt auf dem Fußboden. Neben der Eingangstür standen ein Lederkoffer und ein Trolley.
Rispo sagte:
«Das Gepäck gehört den Besitzern der Wohnung. Sie sind heute früh aus Ischia zurückgekommen und haben das Chaos hier vorgefunden. Sie erwarten Sie im Salon.»
Alex wies Lojacono auf die unauffällig angebrachten Überwachungskameras hin, die wie die über der Eingangstür aussahen und auf ein Alarmsystem hindeuteten. Man konnte nicht behaupten, dass dieser S. Parascandolo, wer auch immer das sein mochte, nicht auf Sicherheit bedacht war. Was ihm jedoch augenscheinlich nichts genutzt hatte.
Aus dem Salon war ein gleichmäßiges rhythmisches Geräusch zu hören, das wie ein Schluchzen klang. Kein Zweifel, da weinte jemand.
Gefolgt von Alex betrat Lojacono den Raum.
5
Nicht alle Anrufe, die in einem Kommissariat eingehen, sind gleich.
Das Telefon klingelt ständig, aber immer nimmt jemand den Hörer ab und versucht sich trotz des erhöhten Lärmpegels, in dem alle Kollegen gleichzeitig reden, verständlich zu machen. In einem Kommissariat prallen Gefühle, Leidenschaften, starke Emotionen aufeinander, also muss man etwas lauter reden, die Atmosphäre ist aufgeheizt, erregt. In einem Kommissariat brüllen die Leute, als stünden sie auf dem Sportplatz.
Als Ottavia Calabrese beim zweiten Klingeln ans Telefon ging, herrschte das übliche Durcheinander. Aragona trompetete in den Hörer, um bei Guida, dem Wachmann im Foyer, einen Kaffee zu bestellen; Romano erkundigte sich bei Pisanelli, ob er von einem leerstehenden Apartment in der Nähe des Kommissariats wisse, woraufhin dieser ihm die Adresse eines befreundeten Immobilienmaklers nannte; Palma hatte den Kopf aus seiner Bürotür gesteckt, um ein «Guten Morgen» in die Runde zu werfen.
Aber kaum hatte Ottavia, die mit der Hand den Hörer vor dem Lärm abschirmte, «Was? Ein Kind ist entführt worden?» ausgerufen, herrschte schlagartig Stille im Raum. Die Calabrese griff nach einem Stift, um sich Notizen zu machen. Ihr Gesichtsausdruck zeigte Konzentration, ihre Stimme klang kühl und sachlich. Nur ihre Augen verrieten, wie aufgewühlt sie war.
Palma trat beunruhigt vor ihren Schreibtisch. Ein Kind. Ein entführtes Kind.
Ottavia legte auf. Alle starrten sie an.
«Ein Kind ist bei einem Schulausflug in die Gemäldesammlung der Villa Rosenberg verschwunden, gleich hier um die Ecke. Sie waren gerade erst angekommen, als der Junge plötzlich nicht mehr da war. Eine der Lehrerinnen hat angerufen, eine Schwester von der katholischen Privatschule in der Via Petrarca.»
Ihr Ton war leise und aufgewühlt, aber ungebrochen professionell. Sie hatte ihren Blick auf Palma gerichtet, auch wenn ihre Worte allen galten. Ein Kind.
Palma fragte:
«Woher wissen sie, dass der Junge entführt wurde? Vielleicht ist er ja auch nur weggelaufen, hat sich versteckt oder …»
«Ein Klassenkamerad war bei ihm. Er meint, der Junge sei mit einer Frau weggegangen, einer blonden Frau.»
Schweigen. Anspannung, Angst. Palma seufzte.
«Okay, lasst uns keine Zeit verlieren. Romano, Aragona, ihr macht euch sofort auf den Weg – nehmt das Auto! Pisanelli, besorg dir den Namen des Kindes, sieh zu, dass du etwas über die Familie in Erfahrung bringen kannst, und informiere sie gegebenenfalls. Ottavia, du rufst in der Villa Rosenberg an und sagst denen, sie sollen sich nicht vom Fleck rühren und niemanden rein- oder rauslassen. Ich informiere die Einsatzzentrale und lasse vom Präsidium ein paar Streifenwagen hinschicken. Los, an die Arbeit!»
Aragona raste im üblichen Kamikazestil durch die Stadt, war aber anders als gewöhnlich in ein unbehagliches Schweigen verfallen. Irgendetwas an seinem Beifahrer Francesco Romano, genannt Hulk, gefiel ihm nicht, ja, machte ihm Angst. Vielleicht war es dieser leidende, oft ins Leere gerichtete Blick. Romanos raspelkurze Haare, der Stiernacken und die ausgeprägte Kieferpartie verstärkten den Eindruck einer unterdrückten Kraft, die jeden Moment explodieren konnte. Was ihm ein befreundeter Streifenpolizist sonst noch über den Kollegen erzählt hatte, klang auch nicht gerade beruhigend: Hulk war einem Verdächtigen, der ihn provoziert hatte, an die Gurgel gegangen, sodass dieser ins Krankenhaus musste. «Glaub mir, Aragona, ich war dabei», hatte sein Freund gesagt, «es waren drei Leute nötig, um ihn von dem Typen loszureißen. Fünf Sekunden länger, und er hätte ihn umgebracht.»
Ohne sein Tempo zu drosseln, steuerte Aragona unter wildem Hupen auf eine Gruppe japanischer Touristen zu, die wie aufgescheuchte Hühner auseinanderstoben. Er glaubte seinem Freund jedes Wort: Romano strahlte wirklich etwas Brutales aus. Noch dazu hatte er einen äußerst merkwürdigen Humor, der ihn jedes Mal, wenn er, Aragona, eine witzige Bemerkung machte, wie einen Deppen dastehen ließ. Er warf einen verstohlenen Blick auf seinen Beifahrer, der sich mit der einen Hand am Sitz und mit der anderen am Türgriff festklammerte; sein Kiefermuskel zuckte bedrohlich.
Mit einer Vollbremsung kamen sie vor dem Museum zum Stehen. Romano blaffte los, als wäre Aragona gar nicht anwesend:
«Alleine dieser Fahrstil zeigt, dass der Mann ein Vollidiot ist!»
Zwei Streifenwagen kamen aus unterschiedlichen Richtungen angerast, als sie aus dem Auto stiegen. Auch im Eingangsbereich des klassizistischen Gebäudes, in dem die Gemäldegalerie untergebracht war, herrschte hektische Betriebsamkeit: Ein Grüppchen Touristen mit starkem deutschem Akzent beschwerte sich radebrechend an der Kasse, weil man ihnen den Einlass verwehrte. Ein Wachmann fuchtelte wild mit den Armen und forderte lautstark Ruhe ein. Eine Nonne schluchzte und wurde von ihrer älteren Kollegin zusammengestaucht; ein paar Zehnjährige drückten sich mit verängstigten Gesichtern in eine Ecke des Vorraums.
Kaum hatten sie sie entdeckt, eilten die beiden Schwestern auf sie zu.
«Sind Sie von der Polizei?»
«Polizeihauptwachtmeister Francesco Romano. Das ist mein Kollege Marco Aragona. Erzählen Sie uns, was passiert ist, Schwester.»
Die etwa 60-jährige Frau mit dem runden Gesicht unter dem schwarzen Schleier funkelte ihn aus ihren blauen Augen an.
«Ich bin Schwester Angela vom Orden der Santa Maria della Carità. Das» – sie zeigte mit dem Finger auf die jüngere Nonne, die noch immer schniefte – «ist Schwester Beatrice. Was passiert ist, haben wir bereits am Telefon gesagt: Ein Kind wurde entführt, hier aus diesem Museum, vor einer halben Stunde.»
Mit einem Hüsteln nahm Aragona seine Sonnenbrille ab.
«Wie lautet der Name des Kindes? Und wie hat sich die Entführung genau zugetragen?»
Schwester Angela warf ihm einen abschätzigen Blick zu.
«Sind Sie nicht ein bisschen zu jung, um sich mit so einem schwerwiegenden Fall zu befassen?»
Bevor Aragona etwas erwidern konnte, sagte Romano barsch:
«Das Alter meines Kollegen tut hier nichts zur Sache, Schwester. Davon abgesehen können Sie sicher sein, dass wir beide unseren Job sehr wohl verstehen. Ist es richtig, dass ein Kind, das unter Ihrer Obhut und der Ihrer Kollegin stand, spurlos verschwunden ist? Würden Sie also bitte die Frage beantworten!»
Die Frau flatterte mit den Lidern. Sie wirkte nicht so, als wäre sie Widerspruch gewohnt.
«Ich bin die Oberin des Klosters, zu dem die Schule gehört. Ich war nicht dabei, als es passiert ist. Die Kinder haben zusammen mit Schwester Beatrice einen Ausflug unternommen. Sie hat mich sofort angerufen, als Dodo … der Junge, Edoardo Cerchia, verschwunden ist. Ich bin direkt hierhergeeilt, und dann haben wir Sie benachrichtigt.»
Durch den unerwarteten Beistand von Romano mit neuem Selbstvertrauen erfüllt, sagte Aragona:
«Sie waren also nicht dabei. Und Sie haben uns auch nicht sofort benachrichtigt, sondern sich erst untereinander verständigt und dabei wertvolle Zeit verschwendet. Herzlichen Glückwunsch, Frau Äbtissin!»
Mit einem Gesichtsausdruck, der nichts Gutes verhieß, drehte Romano sich zu ihm um. Schwester Angela war das Blut in die Wangen gestiegen.
«Ich … ich … Schwester Beatrice ist noch sehr jung, und ganz gewiss hat sie nicht damit gerechnet, jemals in eine solche Situation zu geraten. In all den Jahren ist so etwas noch nie vorgekommen …»
Romano wandte sich an die jüngere Nonne.
«Schwester, bitte erzählen Sie uns, was sich zugetragen hat. Und lassen Sie nichts aus, auch keine Details. Aragona, vielleicht machst du dir ein paar Notizen.»
Schwester Angela versuchte, Terrain zurückzuerobern.
«Also, heute Morgen in der Schule …»
Romano unterbrach sie mit einer brüsken Geste.
«Mutter Oberin, ich glaube, es ist besser, wenn Sie mal nach den Kindern schauen. Lassen Sie uns alleine mit Schwester Beatrice, danke.»
Die ältere Nonne wich ruckartig zurück, als hätte Romano sie wegstoßen wollen. Wieder flatterten ihre Lider, doch dann wandte sie sich mit der Haltung einer gekränkten Königin den Kindern zu.
Allein mit den beiden Polizisten schien Schwester Beatrice den letzten Rest von Contenance zu verlieren. Schluchzend brachte sie hervor:
«Ich … ich weiß nicht … Dodo war bei mir und den anderen, in dem Saal mit den Aquarellen, dann … Wir waren alle zusammen, die Kinder und ich … Ich … ich habe nicht gesehen, dass …»
Aragona, den Stift schon zwischen den Fingern, unterbrach sie mit einem Handwedeln.
«Beruhigen Sie sich, Schwester, beruhigen Sie sich. Holen Sie tief Luft und fangen Sie noch mal von vorne an, aber bitte langsamer, sonst verstehe ich kein Wort. Und wie soll ich mir dann Notizen machen?»
Die Schwester tat einen tiefen Seufzer, zog die Nase hoch und trocknete sich die Augen.
«Sie haben ja recht, Herr Wachtmeister. Entschuldigen Sie bitte. Ich bin nur so erschrocken, verstehen Sie? Mit allem habe ich gerechnet, nur mit so etwas nicht. Aber Gott in seiner großen Barmherzigkeit wird mir beistehen. Vielleicht fragen Sie mich lieber eins nach dem anderen, dann vergesse ich auch nichts.»
Romano nickte, sichtlich erleichtert über den Vorschlag.
«Sehr gut. Fangen wir mit dem Jungen an. Edoardo Cerchia heißt er, haben Sie gesagt?»
«Ja, aber wir rufen ihn bei seinem Spitznamen – Dodo. Meine Klasse ist eine fünfte, die Kinder gehören zu den Ältesten, nächstes Jahr kommen sie auf die höhere Schule. Dodo ist schon seit der ersten Klasse bei mir, wie fast alle Kinder, die Sie hier sehen, sie sind seine Klassenkameraden. Dodo ist ein ganz lieber Junge, sehr ruhig, sehr aufgeweckt, sein Benehmen ist tadellos. Vielleicht ein wenig kindlich für sein Alter … Er hängt sehr an seinem Spielzeug, ich habe ihn schon öfter ermahnen müssen, es nicht mit in die Schule zu bringen. Aber er fügt sich gut in die Gemeinschaft ein, ist wohlerzogen, vielleicht ein bisschen introvertiert.»
«Okay, Schwester, so viel zu seinen Kopfnoten. Aber jetzt bitte zum Eigentlichen: Was genau ist heute Morgen passiert?»
Schwester Beatrice senkte die Lieder und versuchte sich zu sammeln, während Romano seinem unhöflichen Kollegen einen finsteren Blick zuwarf.
«Wir hatten diesen Ausflug schon seit Monaten geplant. Das Museum ist morgens extra für Schulklassen geöffnet. Natürlich interessieren sich Kinder in dem Alter nicht wirklich für Kunst, sie würden lieber in einen Themenpark gehen, wo sie spielen und toben können, vor allem jetzt im Frühling, wenn die Tage wärmer werden, aber die Mutter Oberin … Schwester Angela möchte, dass die älteren Kinder auch in den Genuss einer Kunst-Erziehung kommen, deswegen gehen wir jedes Jahr mit der fünften Klasse hierhin.»
Aragona sah sich mit großen Augen um.
«Die Armen, was für ein Schwachsinn. Okay, Schwester, weiter im Text!»
Die Nonne schien seine Grobheit nicht zu bemerken.
«Wir lassen sie etwas früher als sonst in die Schule kommen, um Viertel vor acht, und fahren dann mit dem Schulbus, der sie jeden Tag von zu Hause abholt und wieder zurückbringt, hierher. Sobald die Kinder im Bus sitzen, zählen wir sie durch, und wenn dann alle da sind, geht’s los.»
Romano fragte:
«Ist das der einzige Moment, in dem Sie die Kinder durchzählen?»
«Nein, nein! Eigentlich tue ich die ganze Zeit nichts anderes. Die Kunst wird ihnen von dem Museumspädagogen erklärt, ich selbst schaue nur nach den Kindern.»
«Also haben Sie sofort bemerkt, dass der kleine Cerchia nicht mehr da war? Uns wurde gesagt, ein Klassenkamerad hätte ihn mit einer blonden Frau weggehen sehen – stimmt das? Wie heißt der Klassenkamerad? Und wie kann es sein, dass der Junge einfach verschwindet, wo Sie doch so aufgepasst haben?»
Die Frau brach erneut in Tränen aus.
«Ein Klassenkamerad, ja … Christian Datola. Er war bei ihm, als … als sie Dodo entführt haben, und ich …»
Schwester Angela schien es nicht ertragen zu können, ihre Mitarbeiterin so unter Druck zu sehen. Erneut trat sie auf die Polizisten zu. Mit steinernem Gesicht sagte sie:
«Also, wenn Sie uns etwas anhängen wollen, dann sagen Sie das bitte gleich, in dem Fall nehmen wir uns einen Anwalt. Wir sind die Geschädigten – nicht die Schuldigen. Wir tun alles für unsere Kinder und ihre Familien, unsere Schule ist bekannt dafür, wie aufmerksam und umsichtig wir uns um die Kinder kümmern. Deren Familien, falls Sie das noch nicht wissen sollten, zählen zu den namhaftesten und wohlhabendsten der Stadt …»
Mit dem Bügel seiner Sonnenbrille deutete Aragona anklagend auf die Frau.
«Wollen Sie damit sagen, dass Sie und Ihre Barmherzigen Schwestern nur deshalb so gut auf die Kinder aufpassen, weil sie aus reichen Familien kommen? Und dass, wenn sie aus ärmeren Familien kämen, sie sich ruhig gegenseitig abmurksen könnten? Das nenne ich ‹Barmherzigkeit›!»
Schwester Angela baute sich vor ihm auf. Mit dem Zeigefinger fuchtelte sie direkt vor seiner Nase herum.
«Jetzt hören Sie mir mal gut zu, junger Mann: Ich lasse mich nur sehr ungern beleidigen! Sie nennen mir jetzt sofort Ihre Dienststelle, Ihre Dienstnummer und Ihren vollständigen Namen, und dann werde ich Sie …»
Schwester Beatrice unterbrach ihre Tirade, indem sie an ihrem Ärmel zupfte und mit schreckgeweiteten Augen zum Museumseingang zeigte. Eine Frau eilte herbei, dicht gefolgt von einem Mann.
«Mutter Oberin, da ist Signora Cerchia. Dodos Mama.»
6
Auch der Salon bot einen wüsten Anblick.
Das Zimmer sah aus, als wäre ein Umzug im Gange, ohne dass auch nur irgendetwas in eine Kiste gepackt worden wäre. Sämtliche Schränke, Regale und sonstige Abstellmöglichkeiten waren leer, aber auf dem Fußboden befand sich eine Ansammlung von Gegenständen, die einem Luxusgeschäft alle Ehre gemacht hätte: Nippes, Bücher, Bilder, Teller, Gläser, Silber.
Lojacono spürte gleich, dass an diesem Stillleben etwas nicht stimmte, allerdings hätte er nicht sagen können, was genau ihn an dem Durcheinander aus Farben, Materialien und Formen störte. Aber dann fiel es ihm wie Schuppen von den Augen: Das Chaos hatte Prinzip, alle Gegenstände waren mit großer Sorgfalt auf dem Boden abgestellt worden, nichts war zu Bruch gegangen, obwohl sich einige Teile aus feinstem Kristall und Porzellan darunter befanden. Es schien, als hätten die Einbrecher alles penibel vorbereitet und wären unterbrochen worden, kurz bevor sie ihr Diebesgut hatten wegbringen können.
Mitten in dem Tohuwabohu saß ein Ehepaar auf der Sofakante, hinter sich zwei hochkant gestellte Gemälde und ein Tablett, auf dem die Kaffeetassen nach Größe geordnet waren wie für eine Ausstellung.
Die Frau sah auf den ersten Blick gut aus, obwohl Alex nicht hätte sagen können, wie alt sie war. Die Haut an ihrem Hals und den nackten Oberarmen verriet, dass sie älter als 50 sein musste, aber die unübersehbaren Eingriffe eines Schönheitschirurgen hatten ihrem Gesicht und Körper, der in ein zu enges, knallbuntes Kleid gezwängt war, für alle Zeiten eine künstliche Jugend verliehen. Sie schluchzte heftig und tupfte sich die geröteten Augen unter den gestrafften Lidern mit einem vollkommen durchweichten Taschentuch, während sie gleichzeitig theatralisch den Kopf von rechts nach links warf, als würde sie einem Tennismatch folgen.
Ihr Gatte, mit Dreifachkinn, stattlichem Bauch und dem mürrischen Gesichtsausdruck einer Bulldogge, wirkte hingegen keinen Tag jünger als seine 70 plus. Er schien mit den Nerven völlig am Ende, seine Lippen zitterten, und seine einander unaufhörlich knetenden Hände sahen aus, als führten sie ein Eigenleben. Die Szene verlor eindeutig an Dramatik durch das Hawaiihemd, das er trug.
Lojacono ergriff das Wort.
«Ich bin Inspektor Lojacono vom Kommissariat Pizzofalcone. Und das ist meine Kollegin Polizeioberwachtmeisterin Di Nardo. Sind Sie die Eigentümer dieser Wohnung?»
Mit einer Fistelstimme, die überhaupt nicht zu seiner Statur passte und eher an einen Knaben vor dem Stimmbruch erinnerte, sagte der Mann:
«Sagen wir lieber: der Eigentümer von dem, was von dieser Wohnung übrig geblieben ist. Ich bin Salvatore Parascandolo.»
Er machte weder Anstalten, sich vom Sofa zu erheben, noch seine neben ihm sitzende Frau vorzustellen.
Alex musterte ihn mit einem ausdruckslosen Blick und wandte sich direkt an seine Sitznachbarin.
«Und Sie sind Signora Parascandolo?»
Mit sichtlicher Anstrengung unterbrach die Frau ihr Schluchzen und ihr imaginäres Tennismatch.
«Ja, ich bin Susy Parascandolo. Was für ein Elend, Signori, was für eine Tragödie …»
Lojacono machte eine ausholende Armbewegung, die das Chaos um sie herum einschloss.
«Wann genau haben Sie bemerkt, was passiert ist?»
Parascandolo starrte ins Leere. Schließlich erwiderte er:
«Heute Morgen um acht, als wir von Ischia zurückkamen. Da fährt man übers Wochenende weg, denkt, man hat seine Ruhe und kann etwas Meeresluft tanken, und dann kommt man nach Hause zurück, an den vermeintlich sichersten Ort der Welt, und findet … findet so etwas vor.»
Das zarte Stimmchen hätte im Kontrast zu dem finsteren Gesicht lächerlich geklungen, wenn nicht ein tiefer Schmerz in den Worten des Mannes gelegen hätte.
Alex hob den Blick zu der Überwachungskamera in der Ecke des Salons.
«Was ist mit der Alarmanlage? Sieht aus, als wäre das LED-Lämpchen ausgeschaltet. Haben die Täter sie deaktiviert?»
Die Frage löste eine merkwürdige Reaktion bei den Eheleuten aus. Langsam und bedeutungsvoll drehte der Mann sich zu seiner Frau um, als wäre sie für den Einbruch persönlich verantwortlich.
«Nein, viel einfacher: Die gute Dame hier hat vergessen, die Alarmanlage einzuschalten – das ist des Rätsels Lösung. Ist ja auch egal, was mit unseren Wertsachen passiert, schließlich hat sie sie nicht bezahlt, sondern ich mit meinem mühsam verdienten Geld. Warum also sollte sie die Alarmanlage einschalten, wenn sie das Haus verlässt? Sie hätte einfach nur den Zahlencode eingeben müssen – vier lächerliche Ziffern! Aber nein, Madame hat’s wohl nicht nötig.»
Die Frau schluchzte jetzt heftiger.
«Ich kann schließlich nicht an alles denken! Die Anlage ist neu, noch nicht mal ein Jahr alt, ich habe einfach nicht daran gedacht. Außerdem war ich spät dran, ich hatte noch jede Menge zu erledigen, Koffer packen, während du am Hafen schon auf mich gewartet hast und das Taxi unten auf der Straße hupte wie verrückt, weil man da nicht parken kann. Ich habe es schlicht und einfach vergessen – das ist der Grund.»
Man musste wirklich kein Experte für Gesichtskunde sein, dachte Lojacono, um festzustellen, dass die Parascandolos einander abgrundtief hassten. Er fragte:
«Haben Sie herausgefunden, wie die Einbrecher ins Haus gelangt sind?»
Der Mann erwiderte unwirsch:
«Wäre das nicht eher Ihr Job, uns zu sagen, wie sie hier reingekommen sind? Ich war am Hafen, habe dort auf meine Frau gewartet. Keine Ahnung – vielleicht hat sie in ihrer grenzenlosen Dummheit die Haustür aufgelassen? Die Fenster sind jedenfalls unversehrt, die Gitter davor hatte ich selbst noch zugemacht. Und da die Haustür keine Einbruchspuren aufweist, kann das nur heißen, die Diebe besaßen einen Schlüssel.»
Susy verzog ihre Lippen, die an eine Delfinschnauze erinnerten, zu einem schmalen Spalt und zischte:
«Jetzt spielst du auch noch den Ermittler! Erst Richter, dann Bulle, was?»
Alex versuchte, das Gesprächsthema wieder auf den Diebstahl zu lenken.
«Haben Sie sich schon einen Eindruck verschaffen können, was weggekommen ist? Oder ob überhaupt etwas fehlt?»
Der Mann stand auf. Er war höchstens 1 Meter 60 groß.
«Kommen Sie mit.»
Alex und Lojacono folgten ihm durch den langen Flur. Sie versuchten, nicht auf die überall verstreuten Dinge zu treten. Auch im Schlafzimmer herrschte die gleiche geordnete Unordnung wie im Salon: aufgerissene Schubladen und Schranktüren und jede Menge ordentliche Stapel mit Kleidern und sonstigen Gegenständen auf dem Fußboden. Auf einer Kommode gegenüber der Fensterfront lag eine Brieftasche aus rotem Nappa, deren aus Kredit- und Visitenkarten bestehendes Innenleben aufgefächert war wie in der Auslage eines Lederwarengeschäfts.
An der rechten Wand befand sich ein etwa anderthalb Meter hoher Tresor. Auch er stand offen und war leer. Zu seinen Füßen lehnte ein Landschaftsgemälde. Lojacono trat näher. Das Schloss des Tresors, eine Kombination aus Schlüssel- und Zahlenschloss, war schwarz angelaufen und an mehreren Stellen beschädigt. Aha, dachte er, ein Schneidbrenner.
Er drehte sich zu Parascandolo um.
«Was befand sich in dem Tresor?»
Der Mann zögerte.
«Nicht viel: eine Uhr, Dokumente, aber nichts von Belang. Und Bargeld, ein paar Tausend Euro vielleicht. Nichts Besonderes also.»
Alex und Lojacono wechselten einen Blick. Der Mann log, und noch dazu schlecht. Aber warum?
Die junge Frau fragte:
«Und im Rest des Hauses? Fehlt da etwas?»
Die Ehefrau, die, noch immer schluchzend, zu ihnen aufgeschlossen war, antwortete:
«Nein, zum Glück sieht es nicht danach aus. Na ja, bei dem Durcheinander kann man das nicht so genau sagen, aber mir scheint, es ist nichts weggekommen. Nicht einmal das Silber haben sie mitgenommen.»
Parascandolo fuhr ihr in die Parade.
«Halt den Mund, du dumme Kuh! Woher willst du wissen, dass sie nichts mitgenommen haben? So oft, wie du zu Hause bist, hätten sie alles Mögliche klauen können, ohne dass du es überhaupt bemerken würdest.»
Unvermittelt fragte Alex:
«Sind Sie diebstahlversichert, Signor Parascandolo?»