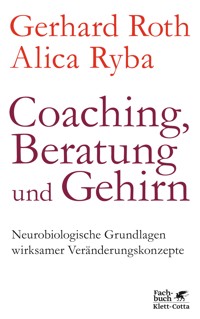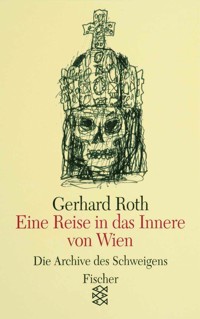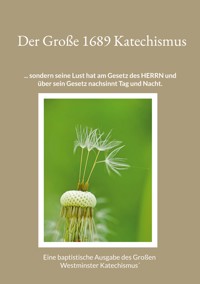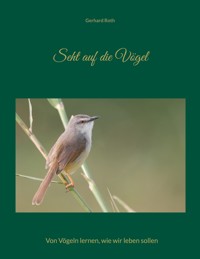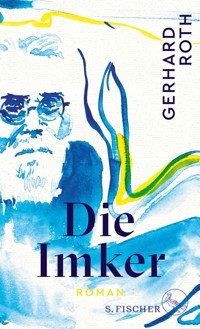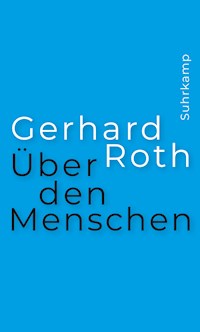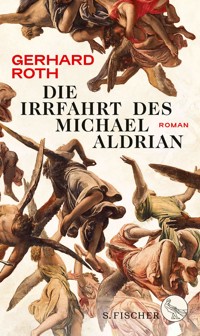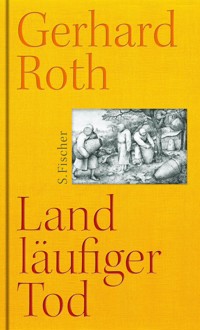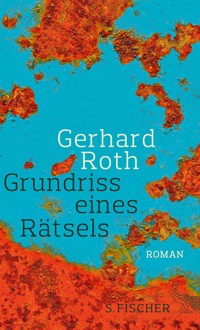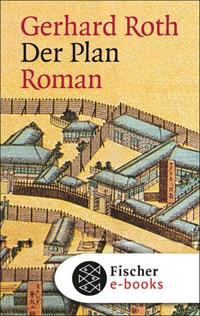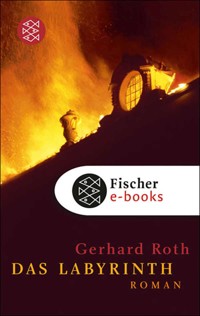
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Wiener Hofburg, die riesige Residenz der Habsburger, brennt, und der Psychiater Heinrich Pollanzy hat einen Verdacht: Könnte sein pyromanischer Patient Philipp Stourzh der Täter sein? Während Stourzh auf den Spuren des letzten österreichischen Kaisers Karl nach Madeira und Madrid reist, führt auch Dr. Pollanzys Weg von Wien nach Spanien. Oder war alles ganz anders?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 535
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Gerhard Roth
Das Labyrinth
Roman
Über dieses Buch
Die Wiener Hofburg, die riesige Residenz der Habsburger, brennt, und der Psychiater Heinrich Pollanzy hat einen Verdacht: Könnte sein pyromanischer Patient Philipp Stourzh der Täter sein? Während Stourzh auf den Spuren des letzten österreichischen Kaisers Karl nach Madeira und Madrid reist, führt auch Dr. Pollanzys Weg von Wien nach Spanien. Dort kommt es zu einer dramatischen Begegnung mit seinem Patienten. Oder war alles ganz anders?
Gerhard Roths Roman ist eine faszinierende Reise in die Grenz- und Krisengebiete von Wahn und Wirklichkeit. Sie führt uns durch halb Europa und quer durch die Zeiten, vor die Gemälde eines Velásquez, Goya und Arcimboldo, durch die literarischen Schatz- und Dunkelkammern eines Kafka, Pessoa und Cervantes, durch spanische Stierkampfarenen, Wiener Kaffeehäuser und Museumsdepots.
Roths Roman durchbricht mit Kühnheit und Wucht alle Grenzen des Genres. Er ist ein großartiges Kompendium vergessenen Wissens und ein gelehrter Reiseführer durch die verborgenen Zusammenhänge von Kunst, Politik, Religion und Geschichte – eine raffinierte Spurensuche voller unerwarteter Wendungen, ein mitreißendes Abenteuer des Lebens wie des Lesens.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Covergestaltung: hißmann, heilmann, hamburg
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2011
© 2005 by Gerhard Roth
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-401318-3
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Doktor Andrej Jefimytsch, von [...]
Erstes Buch Das Feuer
Teil 1 Stourzh
Prolog Krankenbericht
Kapitel 1 In Gugging
Kapitel 2 Rückfälle
Kapitel 3 Der Brand
Kapitel 4 Die Begegnung
Kapitel 5 Kafka
Kapitel 6 Überlegungen
Kapitel 7 Die Schaulust
Kapitel 8 Die Vision
Kapitel 9 Die Restaurationswerkstatt
Kapitel 10 Die Schachpartie
Kapitel 11 Die Brandstätte
Teil 2 Selbstbildnis im Konvexspiegel
Kapitel 1 Krisis
Kapitel 2 Lindner und Jenner
Kapitel 3 »Der Wahn«
Kapitel 4 Das »Haus der Künstler«
Kapitel 5 Im Palmenhauscafé
Kapitel 6 Ein Vorgeschmack auf den Tod
Epilog
Zweites Buch Der Diebstahl
Die Uhr
Kapitel 1 Der König und der Psychiater
Kapitel 2 Hotel »Kaiserin Elisabeth«
Kapitel 3 Ein biographischer Versuch
Kapitel 4 Der Kaiser
Kapitel 5 Die Niederschrift
Kapitel 6 Der Wortlaut
Kapitel 7 Die Nacht
Editorisches Nachwort
Drittes Buch Bericht über den Staub
Reisetagebuch
Kapitel 1 Der Abflug
Kapitel 2 Die Umarmung
Kapitel 3 Ein Spion
Kapitel 4 Sichtbares und Unsichtbares
Kapitel 5 Erwachen
Kapitel 6 Die Insel
Kapitel 7 Der Brief
Kapitel 8 Gedanken
Kapitel 9 Die Fotografie
Nachwort
Viertes Buch Der Wahnsinn
Kapitel 1 Der Schriftsteller
Kapitel 2 Cervantes und Don Quijote
Kapitel 3 Fernando Pessoa und die Heteronyme
Kapitel 4 Auf den Spuren I
Kapitel 5 Auf den Spuren II
Kapitel 6 Eine Welt der Muster
Nachwort
Fünftes Buch Das Verbrechen
Kapitel 1 Die endoskopische Untersuchung (Koloskopie)
Kapitel 2 Die Verwandlung
Kapitel 3 Ein Jahr später
Kapitel 4 Die Zeitinsel
Kapitel 5 Der letzte Eindruck
Epilog
Sechstes Buch Die Suche
Kapitel 1 Die Taschenuhr
Kapitel 2 El Greco
Kapitel 3 Das Ende
Kapitel 4 Das Schweigen
Kapitel 5 Das verschwundene Grab
Kapitel 6 Die Umarmung
Kapitel 7 Das Irrenhaus
Kapitel 8 Im Retiro-Park
Kapitel 9 Asmodea
Kapitel 10 Die Arena
Kapitel 11 Die Corrida
Kapitel 12 Das Buch
Kapitel 13 Der Anruf
Kapitel 14 Der Bericht des Schriftstellers
Epilog
Bibliographie
Doktor Andrej Jefimytsch, von dem noch die Rede sein wird, verschrieb ihm kalte Kompressen für den Kopf und Kirschlorbeertropfen, schüttelte traurig den Kopf und ging weiter; der Wirtin sagte er, daß er jetzt nicht mehr kommen würde, weil man Menschen nicht daran hindern dürfe, den Verstand zu verlieren.
Anton Tschechow, Krankensaal Nr. 6
Der Prozeß der Geschichte ist ein Verbrennen.
Novalis
Erstes BuchDas Feuer
Teil 1Stourzh
PrologKrankenbericht
Mein Name ist Heinrich Pollanzy. Als Psychiater und Leiter der Anstalt Gugging bin ich es gewohnt, seltsame Lebensläufe und Ansichten zu hören. Meinen ehemaligen Patienten und heutigen Pflegegehilfen Philipp Stourzh kenne ich seit mehr als fünfzehn Jahren. Er wurde mit einem epileptischen Anfall in meine Abteilung eingeliefert, der auf den Schuß aus einem Flobertgewehr zurückzuführen war. Das Projektil war in den Hinterkopf des Patienten eingedrungen und, ohne das Gehirn zu verletzen, in einem Bogen unter der knöchernen Schädeldecke bis zur Nasenwurzel gelangt.
Auf der Röntgenaufnahme ist das steckengebliebene Geschoß deutlich zu erkennen. Hunderte Ärzte haben es auf Kongressen gesehen. Die Neurologen sind sich jedoch darüber einig, daß eine Operation ausgeschlossen ist, da die Gefährlichkeit eines Eingriffes in keinem Verhältnis zum Resultat steht. Zudem ist der Status quo für den Patienten nicht bedrohlich. Jedenfalls konnten keine Anzeichen festgestellt werden, daß das Projektil wandert, und auch der epileptische Anfall blieb ein einmaliges Ereignis.
Die Erinnerung an den Unfall ist vollständig aus dem Gedächtnis des Patienten gelöscht.
Philipp Stourzh hatte seinen Vater, einen Sportschützen, in das Überschwemmungsgebiet an der Donau begleitet und auf der Zielscheibe, wie er es immer tat, gerade die Treffer abgelesen, als sich aus dem Flobertgewehr der verhängnisvolle Schuß löste.
Der unglückliche Vater hatte bis vor kurzem das größte Briefmarkengeschäft von Wien besessen, in dem Philipp sechs Jahre nach dem Ereignis einen Brand legte, der aber keinen großen Schaden verursachte und daher von den Eltern vertuscht wurde. Sie bestanden jedoch auf einer therapeutischen Behandlung ihres Sohnes, aus der sich ein gewisses Nahverhältnis zwischen Philipp und mir entwickelte. Ich fand heraus, daß er schon seit seiner Pubertät ein heftiges pyromanisches Verlangen verspürte.
Wann immer sich die Gelegenheit ergab, »zündelte« er an der Alten Donau. Dabei trug er eine Flugtasche der Austrian Airlines aus rotem Kunststoff mit sich, in die er alte Zeitungen, Kartonstücke und eine Flasche Petroleum gestopft hatte. Am Ufer eines versteckten Nebenarmes legte er dann Feuer. Der pyromanische Drang steht also nicht in Zusammenhang mit dem Kopfschuß. Ich halte Philipps Besessenheit vielmehr für das Ergebnis von unterdrücktem Haß auf die eigene Familie. Er warf seinen Eltern vor, daß ihr Briefmarkengeschäft vom Großvater Johann Stourzh nach dem Einmarsch Hitlers in Österreich dem jüdischen Eigentümer geraubt worden sei. Johann war ein sogenannter »Illegaler« gewesen, das heißt Mitglied der NSDAP, als sie in Österreich verboten war. Nach der Verschleppung des jüdischen Besitzers, der später in Dachau ermordet wurde, hatte er das Geschäft mit seltenen und kostbaren Postwertzeichen wie der British Guiana 1C aus dem Jahr 1856, der Bayerischen Schwarzen Einser mit Mühlradstempel »317« und der schwarzen One Penny mit Malteserstempel zugesprochen erhalten. Sein Großvater log später, daß es sich bei den Raritäten um Fälschungen gehandelt hätte, die er nach der »Übernahme« des Geschäftes in den Ofen geworfen habe. Ich führe Philipps versuchte Brandstiftung auf diesen Vorfall zurück und auch seine pyromanische Leidenschaft, die etwas mit Rache zu tun hat, denn sein Vater hat ihm stets eine Antwort auf die Frage, woher der Reichtum der Familie komme, verweigert. Außerdem war Johann Stourzh in die »beschlagnahmte« Wohnung des jüdischen Besitzers eingezogen und hatte dessen Bücher, Ölbilder, Silbergeschirr und Teppiche geraubt, die er seinem einzigen Sohn Adolf weitervererbt hatte.
Ich vermittelte Philipp als Therapie gegen seine pyromanische Leidenschaft in den Sommerferien an eine Feuerversicherung (ein riskantes Experiment, wie ich zugebe), wo er in der Schadensabteilung aushalf. Dort lernte er Wolfgang Unger kennen. Unger ist von Beruf Restaurator im Kunsthistorischen Museum und arbeitet nur nebenbei als Fotograf für Brandschäden. Er zeigte Philipp das Archiv mit über 700 Ordnern, von dem Stourzh so fasziniert war, daß er stundenlang Akten und Fotografien studierte. Noch immer fuhr er an die Alte Donau, um alles mögliche anzuzünden und Zigaretten zu rauchen. Unger zeigte auch mir die ungewöhnliche Sammlung von Aufnahmen ausgebrannter Wohnungen und verkohlter Leichen, Ruinen von Gebäuden und verrußter Autowracks. Auf die Frage, warum die vom Feuer beschädigten und zerstörten Gegenstände auch einzeln fotografiert würden, Kleidungsstücke, Möbel, Uhren, Haushaltsgeräte, Bücher, Bilder, Füllhalter oder Brillen, erklärte er, dies sei notwendig, um die Höhe des Schadensersatzes zu bestimmen.
Ich machte damals Notizen über Philipp für einen Artikel in einer psychiatrischen Fachzeitschrift. Dabei verwendete ich einen Taschenkalender, den ich vom Vertreter einer Medikamentenfirma als Geschenk erhalten hatte.
Bevor ich mit den Ereignissen fortfahre, muß ich eine Einzelheit erwähnen, die von Bedeutung ist: Stourzh trug damals fast immer eine Postkarte mit sich, die er bei einem Besuch des Kunsthistorischen Museums gekauft hatte und als sein »Lieblingsbild« bezeichnete. Sie zeigte Guiseppe Arcimboldos »Ignis«[*] aus dem Jahr 1566, eine brennende Büste, die aus verschiedenen Gegenständen zusammengesetzt ist. Philipp beschrieb das Bild so: »Brennende Holzscheite bilden das Haar, der Kopf besteht aus einem Wachsstock, Kerzen, einem Docht, einer Öllampe, einem Feuereisen und Feuersteinen, der Oberkörper aus einer Pistole, einer Kanone und einem Mörser. Die Gestalt trägt eine prächtige Kette um den Hals, die mit dem Orden des Goldenen Vlieses – einem toten Widderkopf – geschmückt ist.[**] Außerdem ziert der Doppeladler der Habsburger die Brust aus Waffen, ein Symbol der kriegerischen Macht Maximilians II. im Kampf gegen die Türken.«
In einer der Sitzungen ging es um Arcimboldos »Ignis«-Figur und um Philipps Drang, Feuer zu legen. Ich mußte jedoch das Gespräch unterbrechen, da ich zu einer Notaufnahme in die Ambulanz gerufen wurde, die längere Zeit beanspruchte. Bei meiner Rückkehr war Philipp verschwunden. Gleich darauf stellte ich fest, daß auch mein Taschenkalender mit den Eintragungen über Stourzh nicht mehr vorhanden war. Ich war mir sicher, ihn auf dem Schreibtisch liegengelassen zu haben. Beim nächsten Mal stellte ich Philipp zur Rede, er bestritt den Diebstahl jedoch. Damals überlegte ich ernsthaft, die Therapie abzubrechen. Schließlich fand die Putzfrau das kleine Buch unter dem Teppich. Wäre es mir bei jener Sitzung mit Philipp heruntergefallen, hätte sie es schon früher finden müssen, also hatte Stourzh es bei seiner letzten Therapiestunde (vielleicht als ich telefonierte) dorthin geschoben.
Philipp war versessen auf Taschenkalender, sie füllten die Schubladen seines Schreibtisches, den er sorgfältig versperrte. Er liebte besonders solche mit bunten Landkarten, Maßeinheiten, Telefon-Vorwahl-Codes, Währungstabellen und Angaben über Zeitunterschiede auf den fünf Kontinenten. Häufig verwendete er bei seinen Eintragungen eine Geheimschrift.
Ich habe, als er stationär in Gugging behandelt wurde, seine Aufzeichnungen ohne sein Wissen fotokopiert. Zuvor hatte er versucht, die Gardinen im Schlafzimmer seiner Eltern in Brand zu stecken, und war dabei überrascht worden. Daraufhin sei er mit krampfartigen Zuckungen zusammengebrochen, gab der Vater an. Wir wiesen jedoch nach, daß sein Anfall nur vorgetäuscht war. Ich war wegen des Brandattentates beunruhigt, weshalb ich, während er zu einer Untersuchung in ein anderes Gebäude gebracht wurde, sein Zimmer durchsuchte, wo ich in der roten Flugtasche fündig wurde. Trotz größter Bemühungen konnte ich jedoch die Zeichen in seinem Taschenkalender nicht deuten. Ich wandte mich zuletzt an einen Kryptoanalysten, den ich noch von meiner Militärzeit her kannte. Er rief mich bald darauf an und teilte mir mit, daß auch er nicht in der Lage sei, das Geschriebene zu entschlüsseln, da mein Patient den Code bei jeder Eintragung ändere und wahrscheinlich selbst nach einiger Zeit nicht mehr lesen könne, was er notiert habe.
Vielleicht, überlegte ich mir, ging es Stourzh nur darum, Geständnisse abzulegen? (Daß er alles schriftlich niederlegte, befreite ihn vielleicht von Schuldgefühlen.) Die Geheimschrift wechselte mit gut lesbaren tagebuchartigen Eintragungen ab – ein verwirrendes Selbstporträt mit vielen Leerstellen. Schließlich gelang es mir, das System hinter den Aufzeichnungen zu verstehen: In Normalschrift abgefaßt war alles, was Philipp anderen mitteilen wollte. Es waren übrigens auch Zeichnungen darunter, groteske Porträts der Personen, mit denen er zu tun hatte. Mich selbst stellte er riesig groß dar, einen winzigen Patienten in der Faust, den ich gerade verspeiste. Selbstverständlich vergaß er meine schwarze Augenbinde nicht. An anderer Stelle kam ich als Sammler von Nachtfaltern vor, die ich mit Chloroform betäubte, auf Nadeln spießte und in eine Vitrine steckte. Die Nachtfalter hatten winzige Menschenköpfe. Hin und wieder las er mir sogar eine seiner Eintragungen vor. Ich fragte ihn, ob er auch das Feuerlegen an der Alten Donau schriftlich festhielte, und er antwortete, ja, aber er habe die betreffenden Seiten inzwischen herausgerissen und verbrannt, da er nicht wolle, daß jemand etwas darüber erfahre.
Plötzlich, von einem Tag auf den anderen, hörte Philipp mit dem »Zündeln« auf, er habe sich wieder der Philatelie zugewandt, behauptete er. Mit Hilfe der Briefmarken hatte er bereits als Kind ein erstaunliches Wissen erworben. Die gesamte österreichische Geschichte der letzten 150 Jahre sei auf den Postwertzeichen ersichtlich, erklärte er mir einmal in einer Therapiestunde und redete sich dabei in Begeisterung. Er wußte über jede Einzelheit Bescheid, egal, ob es sich um Kaisermarken oder Postwertzeichen des Ersten Weltkrieges mit Soldaten in Schützengräben, Ulanen auf galoppierenden Pferden und Artilleristen mit Mörsern handelte. Besonders der junge Kaiser Karl hatte es ihm angetan. Nach Karls Abdankung im Jahr 1918 seien die alten Briefmarken eine Zeitlang weiterverwendet worden, überstempelt mit Deutschösterreich, so als habe man sich erst daran gewöhnen müssen, daß die Monarchie aufgehört hatte zu existieren.
Immer wieder ereiferte er sich, daß Österreich 1938 gänzlich von der Landkarte verschwunden war, weswegen es für sieben Jahre auch keine postalische Erinnerung daran gebe. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 waren dann verschiedenfarbige Hitlermarken mit »Österreich«-Aufdruck ausgegeben worden, was er als die Rache der Post an der Vergeßlichkeit seiner Landsleute bezeichnete.
Nach der Matura begann Philipp Geschichte und Kunstgeschichte zu studieren.
Ich hatte keinen Grund daran zu zweifeln, daß er auf dem Weg zu einem ruhigeren Leben war.
Eine Zeitlang verlor ich ihn aus den Augen. Das einzige Zusammentreffen war eine zufällige Begegnung, bei der er mir gestand, seine Sammlung von Taschenkalendern – mehr als hundert – an der Alten Donau verbrannt zu haben. Er sah mich nach dem Geständnis schweigend an, auf eine Weise, daß ich ahnte, er führte irgend etwas im Schilde. Es waren nur Sekundenbruchteile eines Blickes, aber sie offenbarten mir, daß alles in ihm noch weiterlebte, was er an Gedanken und Absichten im Kopf gehabt hatte, als ich mit der Therapie begann.
Kapitel 1In Gugging
Eines Tages, vier Jahre nach dem Ende der Therapie, erschien Philipp unangemeldet in der Anstalt, verlangte mich zu sprechen und fragte mich, ob ich etwas für ihn tun könne. Er sah blaß aus, sein Kopf war kahlgeschoren, und seine scharfe Nase verlieh ihm das Gesicht eines Vogels. Etwas Unverschämtes war in seinem Blick und in seinem Gehabe. Der Mund schien zu einem spöttischen Grinsen bereit, und seine Fingernägel waren abgebissen. Man konnte ihm ansehen, daß es ihm nicht gutging. Ich hatte immer wieder an ihn gedacht und bei jedem Brand, von dem ich in der Zeitung las, zuerst angenommen, er habe ihn gelegt. Daher platzte es förmlich aus mir heraus, ob er mit dem Feuerlegen aufgehört habe. In seinem kurzen Lachen war ein Anflug von Hohn, ja, ja, sagte er rasch, das sei Vergangenheit. Er habe nach der Matura seine Briefmarkensammlung verbrannt, weil sie aus dem Geschäft seines Vaters stammte – »in effigie«, spottete er, »und damit Schluß«. Mir fiel erst jetzt auf, wie rasch, wie hektisch er sich bewegte, wie unruhig er war. Er konnte nicht stillhalten, sprang auf, setzte sich nieder und nestelte an einer Packung Zigaretten.
»Ich möchte im ›Haus der Künstler‹ arbeiten, als Hilfspfleger«, stieß er hervor. »Wäre das möglich?«
Ich antwortete ausweichend, das komme darauf an.
»Ich finanziere mein Studium selbst – vorläufig als Statist beim Film und mit Gelegenheitsarbeiten. Ich wohne zwar noch im selben Gebäude wie meine Eltern, aber ich habe eine eigene Garçonnière.«
Er hatte alle Prüfungen mit Auszeichnung bestanden und erzählte mir von seinen Besuchen im Kunsthistorischen Museum und der Freundschaft mit Wolfgang Unger, den er häufig in der Restaurierungswerkstatt besuchte und über Bilder befragte, vor allem über die Kinder-Porträts der Infantin Margarita Teresa von Velázquez. Stourzh hatte diese Gemälde förmlich in sich aufgesogen, kannte jedes Detail und hatte erst vor kurzem das Bildnis der Infantin im blauen Kleid mit Ungers Kopflupe Pinselstrich für Pinselstrich betrachtet.
Er zog eine Kunstpostkarte aus der Jacke und legte sie auf den Tisch.
»Für Sie«, sagte Philipp.[*]
Er knipste das Feuerzeug an, nahm einen hastigen Zug aus der Zigarette und griff nach dem Aschenbecher.
»An mehreren Stellen war das Original beschädigt«, sagte er, den Rauch ausstoßend. Er sprach in einem eigenwilligen Stakkato, das er sich offenbar angewöhnt hatte, und ich bemerkte zum erstenmal den durchdringenden Blick aus seinen grünen Augen. Er hatte schöne lange Wimpern, fiel mir auf, und schob den Unterkiefer vor, wenn er zuhörte.
»Beschädigungen vor allem im Bereich des Gesichts«, fuhr er fort. »Im 18. Jahrhundert wurde das Gemälde in eine ovale Form geschnitten, weil man damit die Stallburg dekorierte. Irgendwann hat sich dann seine Spur verloren, man hielt es für eine Kopie von Cerreno. Erst Anfang der zwanziger Jahre wurde es in einem Depot der Hofburg wiederentdeckt und restauriert …«
Ich nickte.
Er war nervös und tippte mit der Zigarette während er sprach am Aschenbecher.
»Ich möchte im ›Haus der Künstler‹ mit den Patienten zeichnen …«, wiederholte Philipp. »Ich glaube, ich könnte das gut …«
Philipp konnte sich höchstens als Hilfskraft verdingen, und ich sagte ihm das auch, aber es machte ihm nichts aus. Er wollte am Vormittag seinen Dienst versehen und bat, mit den Patienten essen zu dürfen. Er fuhr übrigens einen zweitürigen, roten VW-Golf, den ihm sein Vater gekauft hatte und der, wie ich bei einem Blick aus dem Fenster feststellte, ziemlich verrostet war.
Allmählich begriff ich, daß Philipps Idee für mich eine glückliche Fügung war, denn ich hatte mir insgeheim gewünscht, ihn weiter beobachten zu können.
Das »Haus der Künstler« ist eine Erfindung von Primarius Neumann, den ich verehre. Er läßt die eingelieferten Patienten beim Aufnahmegespräch eine Zeichnung anfertigen und zieht daraus Schlüsse, die nicht nur medizinischer Natur sind, denn er hat auch einen Doktortitel in Kunstgeschichte erworben und kannte »Die Bildnerei der Geisteskranken« von Prinzhorn und Morgenthalers »Ein Geisteskranker als Künstler«, das Buch über Adolf Wölfli. Seit einem Jahr arbeitete sich außerdem der Bildhauer und Arzt Dr. Lesky bei ihm ein, da Neumann kurz vor der Pensionierung stand. Der Primarius war eine eindrucksvolle Persönlichkeit. Er hatte aus den anonymen Patienten angesehene Künstler gemacht, von denen auch ich Werke besaß.
Ich schickte Stourzh zu Neumann, der erwartungsgemäß über finanzielle Probleme klagte, aber Philipp, dessen Fall er natürlich kannte, interessierte ihn schon lange wegen seiner Amnesie. Eine Woche später nahm Stourzh den Dienst im »Haus der Künstler« auf. Ich sah ihn öfter mit seinem klapprigen Golf an unserem Anstaltsgebäude vorbeifahren, die Allee hinauf zu der kleinen Erhebung, wo sich das von den Patienten mit Figuren, Gesichtern, Ornamenten und blauen Sternen bemalte Haus befindet.
Längere Zeit meldete Philipp sich nicht bei mir. Wenn ich zu neugierig wurde und dem »Haus der Künstler« einen Besuch abstattete, traf ich ihn rauchend neben einem der Insassen an, während er zugleich amüsiert mit ihm sprach. Besonders mit einem Langzeitpatienten, Franz Lindner, schien er ein gutes Einvernehmen zu haben. Tatsächlich hatte ihn der Primar auf den schwierigen Fall angesetzt, denn es gab gewisse Parallelen zwischen den beiden. Lindner zeichnete häufig Brände, aber auch Morde, und immer wieder tauchten Gewehre, Pistolen und Messer in seinen Bildern auf. Geschahen diese Morde im Freien, war auch Wasser in der Nähe: ein Bach, ein Fluß, ein Teich … Ereigneten sie sich in geschlossenen Räumen, stellte Lindner den flüchtenden Täter und das Opfer von Flammen umgeben dar. Die Ermordeten waren meistens Frauen, aber sie sahen auf jeder Zeichnung anders aus. Der Täter hingegen war immer derselbe, wenn auch verschieden gekleidet. Einmal trug er Tracht, dann wieder einen dunklen Anzug, einmal eine Brille, dann wieder einen Hut, einmal war er halbnackt, dann wieder in einen Mantel gehüllt. Ich wußte, daß es sich um Lindners Vormund handelte, den Anwalt in Strafsachen, Alois Jenner, einen Jugendfreund des Patienten. (Tatsächlich war Jenner während seines Jusstudiums des Mordes an einer Frau angeklagt gewesen, der Prozeß war jedoch wegen erwiesener Unschuld vorzeitig beendet worden, weil der Täter, ein Obdachloser, verhaftet worden war und das Verbrechen gestanden hatte.) Neumann vermutete einen Racheakt Lindners, der Jenner für seine Einweisung in Gugging verantwortlich machte. Inzwischen ließ Lindner auch das »Irrenhaus« in seinen Zeichnungen brennen, selbst den Primarius verschonte er nicht vor den Flammen. Er war ein medizinisches Rätsel, denn er sprach nicht, obwohl es keinen Befund einer organischen Behinderung gab. Die Aufnahmediagnose war Schizophrenie gewesen, und seinem Verhalten nach traf dieser Befund zu. Aber Neumann schien daran zu zweifeln. Er überredete vor kurzem einen bekannten Schriftsteller, eine Monographie über Franz Lindner zu verfassen, die auch zahlreiche Zeichnungen und Texte des Patienten enthalten sollte. Es überraschte niemanden, daß Stourzh gerade von den Feuermotiven angetan war. Er breitete Lindners Bilder mitunter auf dem großen Tisch des Zeichenraumes aus, der zugleich als Speisesaal diente. Von weitem erweckten die zusammengelegten Blätter dann den Eindruck einer überdimensionalen Branddarstellung. (Oder als ob die Tischplatte in Flammen stehe.)
Neumann war mit Philipp außerordentlich zufrieden, auch die Patienten mochten ihn, und seine Studienerfolge an der Universität ließen nichts zu wünschen übrig.
Kapitel 2Rückfälle
Drei Jahre ereignete sich nichts Ungewöhnliches, außer daß Philipp seine Magisterarbeit über die Infantinnenbilder von Velázquez abbrach und das Manuskript vernichtete. Wir nahmen an, daß er es im Heizkeller des »Hauses der Künstler« verbrannt hatte, denn jemand sah ihn dort öfter am Ofen hantieren. Philipp bestritt das, aber als der Primarius eine Untersuchung anordnete, wurden in der Asche Papierreste mit der Handschrift von Stourzh gefunden. Was hatte das zu bedeuten? Philipp weigerte sich, Fragen darüber zu beantworten. Nach einigem Zögern beschloss Neumann, ihn trotzdem zu behalten, und schon eine Woche später erfuhren wir, daß Stourzh ein neues Thema für eine Magisterarbeit erhalten hatte: »Leben und Tod des letzten österreichischen Kaisers Karl oder der Untergang der Donaumonarchie.« Niemand hatte damit gerechnet, daß er nicht in Kunstgeschichte, sondern in Geschichte seinen Abschluß machen wollte, war Philipp doch ein künstlerischer Mensch und kein Wissenschafter. Er hatte sogar eine Abneigung gegenüber »der geisteswissenschaftlichen Passion am Detektivischen, am Pedantischen, am Spekulativen« (bis es sich endlich zur Theorie und zum Beweis entwickelt), wie er mir mehrmals sagte. Er vertraute mehr der Inspiration und Improvisation.
Es gelang mir, ihn in ein Gespräch zu verwickeln, in dem er mir eröffnete, daß alles historische und kunsthistorische Forschen ohnedies nur Fälscherarbeit sei, zum Teil wissentlich, zum Teil unwissentlich.
Am nächsten Tag, es war der 23. November, suchte er mich ohne Anmeldung auf, wartete, bis ich die Morgenvisite gemacht hatte, und fragte mich ohne Umschweife über die »1000 ermordeten Geisteskranken« aus, die in der Gugginger Anstalt dem Unternehmen lebensunwertes Leben der Nationalsozialisten zum Opfer gefallen waren. Er hatte den Essayband jenes österreichischen Schriftstellers, der die Monographie über Franz Lindner verfassen wird, gelesen, in dem dieser das »Haus der Künstler« beschreibt und auf die Gedenktafel im Park der Anstalt hinweist. Ehrlich gesagt, ich mag den Schriftsteller nicht. Ich kenne ihn nur flüchtig, doch hört man über ihn selbst in Kollegenkreisen wenig Gutes. Denn sein zuvorkommendes Äußeres steht in keinem Einklang zu seiner mitunter taktlosen Unerbittlichkeit. Es ist auch allgemein bekannt, daß er übermäßig trinkt und zu Wutausbrüchen neigt. Sein hervorstechendstes Merkmal allerdings ist seine Monomanie. Er besitzt eine umfangreiche Bibliothek und arbeitet seit Jahrzehnten an einem Projekt über den Wahnsinn. Philipp zitiert gerne aus seinem Essay »Was für den einen das Paradies ist, kann für den anderen die Hölle sein«, in dem der Schriftsteller mit Österreich abrechnet, was mir aber mißfällt.[*]
Als Stourzh mich nach der Gedenktafel fragte und in einem Atemzug den Autor nannte, verspürte ich daher Widerwillen. Ich muß gestehen, daß ich auch nicht sehr viel darüber wußte. Wer will schon in einem Gebäude therapieren, in dem Hunderte Menschen mit einer Injektion oder durch Inanition ermordet wurden? (Fast allen, die hier länger arbeiten, sind die Vorfälle bekannt, aber keiner will Genaueres erfahren.) Ich sagte etwas in diesem Sinne. Stourzh fragte sofort, was Inanition bedeute. Er stellte die Frage mit leiser Stimme, aber in einem Tonfall, den man als »Knurren« bezeichnen könnte.
Ich antwortete »durch Verhungern« und, indem ich es aussprach, wurde mir die Heimtücke und Gemeinheit der Morde doppelt bewußt. »Die Nahrung wurde reduziert, und die Patienten starben an Infektionen oder Kreislaufschwäche«, ergänzte ich monoton.
»Und wo ist das passiert?«
»In allen Gebäuden und in den meisten Räumen, denn es sollte ja unauffällig vor sich gehen.« Mir wurde immer unbehaglicher zumute … Ich fühlte mich schuldig, hier zu sitzen und meine Arbeit zu verrichten, als sei ich logischerweise ein Nachfolger der Ärzte, die die Verbrechen begangen hatten. Genauer gesagt: Als hätte ich gedankenlos hingenommen, was geschehen war, und würde dort fortsetzen, wo sie aufgehört hatten, nur daß die Verhältnisse andere geworden waren.
»Gibt es etwas darüber zu lesen?« fragte Stourzh.
»Ich müßte nachfragen.«
Philipp erhob sich, und ich erkannte an seinem durchdringenden Blick, daß er streitlustig war. Aber er sagte nichts, sondern ging stumm hinaus, und ich sah ihn durch das Fenster im Schneefall, der eingesetzt hatte, zum »Haus der Künstler« hinaufstapfen.
Natürlich telefonierte ich sofort mit dem Primarius und erfuhr, daß Stourzh inzwischen das Vertrauen von Lindner gewonnen hatte. Lindner erlaubte ihm sogar, seine Manuskripte zu lesen, die er ansonsten in seinem Schrank einschloß. Am Vortag hatte Stourzh in der Anstaltsumgebung eine tote Amsel gefunden und sie in seiner roten Flugtasche mitgenommen, damit Lindner sie abzeichnete. Dann aber verbrannte er den Vogel in Anwesenheit Lindners hinter dem Haus. Selbstverständlich ist es verboten, in der Nähe der Anstaltsgebäude mit Feuer zu hantieren, vor allem wegen der Laubbäume.
Stourzh habe sich beim Primar entschuldigt und herausgeredet. Im Laufe des Gespräches habe Philipp dann Neumann für den 26. November um Urlaub gebeten, da er am Nachmittag als Statist für eine Filmgesellschaft arbeiten wolle, die einen prunkvollen Ball im großen Redoutensaal der Wiener Hofburg und anschließend den Selbstmord eines österreichischen Verteidigungsministers drehen werde, der in Waffengeschäfte verwickelt gewesen sei.[*]
Die Hofburg ist für mich von besonderem Interesse, weil ich einer der 120 Bewohner bin und dort seit meiner Geburt lebe. Daher machte mich diese Nebensächlichkeit neugierig.
Kapitel 3Der Brand
Am 26. November fuhr ich vorzeitig von meiner Arbeit nach Hause, denn ich hatte eine Karte für »La Bohème« in der Wiener Staatsoper. Ich versorgte meinen Kater, der sich in den großen Räumen wohl fühlt, und ging die wenigen Schritte bis zum Ring, wo ich Dr. Mayerhofer traf. Dr. Mayerhofer leitet den Verlag, bei dem ich mein Buch »Über die Erscheinungsformen von Schizophrenie« in einer Neuauflage herausbringe.
Die Musik von Puccini hat mich immer bezaubert. An diesem Abend aber war ich seltsam unruhig.
Nach der Vorstellung fuhren wir in die Wohnung meines Verlegers, ein kleineres Palais in der Esterhazygasse, wo ich ihm die Krankengeschichte von Philipp Stourzh erzählte. Um 1 Uhr 30 bestellte ich ein Taxi, das längere Zeit nicht kam. Bei einem neuerlichen Anruf erhielt Dr. Mayerhofer die Auskunft, daß die Hofburg brenne und man nicht sagen könne, wann der Fahrer bei uns eintreffen werde. Ich war erschrocken, denn wir hatten den ganzen Abend über Feuer und Brände gesprochen. Dr. Mayerhofer war sofort der Meinung, wir hätten das Unglück heraufbeschworen oder vorausgeahnt. (Er sagte das mit einem ironischen Unterton, weil er weiß, daß ich gegenüber den Lehren von C. G. Jung aufgeschlossen bin.) Aber bevor ich noch etwas antworten konnte, läutete der Taxifahrer an der Tür.
Ich fragte ihn über den Brand aus, er bedauerte jedoch, nicht mehr darüber zu wissen, als daß die Hofburg in Flammen stünde und Feuerwehrautos und Polizeieinsatzwagen die Straßen versperrten. Mir fiel mein Kater ein, ich befürchtete, daß er ein Opfer der Rauchgase werden könnte, und eine geheime Wut auf Philipp Stourzh stieg in mir auf, der sich in meiner Vorstellung am Brand ergötzte … Hatte er für diesen Tag nicht dienstfrei genommen, um bei der Filmszene, die im großen Redoutensaal der Hofburg gedreht wurde, als Statist mitzuwirken? – schoß es mir durch den Kopf –, und wenn ich an die Amsel dachte, die er mit Franz Lindner hinter dem »Haus der Künstler« verbrannt hatte, hielt ich es auch für möglich, daß er … Andererseits ist die Hofburg ein so gewaltiges Bauwerk mit langen Gängen, riesigen Räumen, düsteren, oft menschenleeren Stiegen und die Mauern und den Himmel spiegelnden Fenstern, daß man sie sich nicht zerstört vorstellen kann.
Ich lebe im Schweizerhof, dem ältesten Teil des Gebäudes, und wie die meisten Mieter habe ich meine Wohnung von den Eltern übernommen. (Mein Vater erhielt sie nach dem Krieg als Direktor des Museums für Völkerkunde, das sich in der angebauten Neuen Hofburg befindet.) Ich bin daher in der Hofburg aufgewachsen und finde mich in ihr zurecht wie kaum jemand.[*]
Je näher wir unserem Ziel kamen, desto mehr Polizeifahrzeuge standen auf der Straße, voller Ungeduld stieg ich beim Hotel Sacher aus und lief zu Fuß weiter. Ich nahm sofort den Brandgeruch wahr wie etwas Tödliches, nicht mehr rückgängig zu Machendes. Mit klopfendem Herzen eilte ich weiter und bemerkte erst jetzt die schwarzen Rauchschwaden an dem vom Feuerschein rot gefärbten Himmel. Mehr und mehr Nachtschwärmer bevölkerten, angezogen vom Brand, die Gehsteige. Inzwischen war es zwei Uhr geworden. An einer Absperrung erfuhr ich, daß der Josefsplatz gesperrt sei, da man befürchte, daß die Steinskulpturen auf dem Gesims herunterstürzten. Ich benutzte jedoch einen Seiteneingang zum Redoutentrakt neben der Stallburg und der Nationalbibliothek und erreichte unbemerkt eines der Tore zum Platz, über den Feuerwehrmänner liefen. In diesem Augenblick geschah etwas Seltsames. Während ich entsetzt zu den Flammen hinaufstierte, die aus dem Dach tobten, fiel lautlos, und ohne daß ein Grund dafür zu erkennen war, dichter Feuerregen. Es sah aus, als lebten die Funken, als hätten sie Flügel und schwebten langsam durch die Luft. Andere wirbelten hoch und verloschen wieder, noch andere lösten sich aus den Flammen und bildeten bedrohliche Schwärme über den Gebäudedächern, als seien sie giftige Leuchtkäfer. Der Gestank war so heftig und der Rauch so dicht, daß ich mich hustend und keuchend in das Gebäude zurückzog, um gleich darauf wieder hinauszutreten. Die Frage war nur, auf welchen Teil der Hofburg das Feuer als nächstes übergreifen würde. In unmittelbarer Nähe befanden sich auf der einen Seite die Spanische Reitschule (mit den Lipizzanerstallungen) und die Schatzkammer, auf der anderen die Nationalbibliothek. Aus keinem der Fenster des großen Redoutensaales drang Feuerschein oder Rauch, da es sich um Attrappen handelt, aber auf der gegenüberliegenden Seite des Platzes spiegelte sich das zuckende Gelbrot des Dachbrandes in den Scheiben der oberen Stockwerke, als würde auch die Nationalbibliothek brennen. In der Mitte des Platzes trabte unverdrossen Kaiser Joseph I. mit seinem Bronzepferd im Stillstand. In ihrer bewegten Unbeweglichkeit erweckte die Statue den Eindruck, die Dauer zu repräsentieren, etwas, das dieser Bedrohung entgehen würde. Ich versuchte mich hinter einem der Einsatzwagen zu verstecken, um den Brand besser beobachten zu können, da brach mit dumpfem Getöse die Decke des Redoutensaales ein, und im auftosenden Feuer sah ich die Dachbalken, die noch nicht brannten. Funken stoben jetzt wie ein leuchtender Strichregen zu Boden. Ein aufgebrachter Feuerwehrmann befahl mir, sofort zu verschwinden, und ich beeilte mich, zum Schweizerhof zu kommen, in dem sich meine Wohnung befindet und der Zugang zu den Schatzkammern. Da man mich vor dem Durchgang nicht passieren lassen wollte, wartete ich im allgemeinen Wirrwarr, bis ich mich unbemerkt hindurchschwindeln konnte. Beim Betreten des Stiegenhauses wurde ich erneut von einem Polizisten aufgehalten, der mir erklärte, daß der Trakt evakuiert sei, die Bewohner habe man in Bussen untergebracht. Ich begab mich also zurück ins Freie und wartete. Der Schweizerhof wurde wegen der Schatzkammer besonders scharf bewacht, als jedoch einige Beamten erschienen, die sich für eine Räumung bereitmachten (denn um ein Übergreifen des Brandes zu verhindern, wurde Löschwasser auf das Gebäude gespritzt), gelangte ich unbemerkt über die Stiege bis vor meine Wohnung. Dort prallte ich auf einen entgeisterten Polizisten, der mir mit der Taschenlampe ins Gesicht leuchtete. Er fragte mich, was ich hier suchte, und ich antwortete wahrheitsgemäß, meinen Kater.
Etwas Licht von den Scheinwerfern, die für die Löscharbeiten aufgestellt worden waren, drang durch die Gangfenster und fiel auf sein jugendliches Gesicht.
»Und wie sind Sie in das Haus gekommen?« forschte er argwöhnisch weiter. Der Eingang sei »polizeilich«, wie er sich ausdrückte, gesperrt. Als ich keine Antwort gab, wollte er einen Ausweis von mir sehen. Ich suchte meinen Führerschein heraus, und er hielt die Taschenlampe über die Papiere. Dann sagte er rasch: »Entschuldigen Sie, Herr Doktor.«
Ich durfte zu meinem Kater in die Wohnung und fand ihn unter dem Bett, wohin er sich gerne verzieht. Da mir der Polizist versicherte, daß keine Gefahr bestünde, wenn nicht Unvorhersehbares geschähe, ließ ich das Tier zurück und ging in Begleitung des Beamten wieder auf die Straße. Dort sah ich einen abgekämpften Feuerwehrmann mit einem Journalisten sprechen und blieb stehen, um zuzuhören: »Wir haben über die Reitschule versucht, in das Gebäude einzudringen …«, sagte der Feuerwehrmann, »die Türen waren zugesperrt … Wir haben die erste Tür aufgebrochen, dann eine zweite, dritte, vierte … Schließlich haben wir versucht, über Wendeltreppen, Quergänge und Nebenräume vorzudringen. Wo immer wir hingekommen sind: irgendeine Tür war immer versperrt, irgendeine Treppe führte ins Nichts … Niemand war da, der sich im riesigen Palast ausgekannt hätte, keiner hat uns instruiert … Wir haben zwar unzählige Schlüssel bekommen, man konnte aber sicher sein, daß der richtige nicht darunter war … Wir sind hilflos herumgeirrt. Brandschutzeinrichtungen waren kaum vorhanden, Wachen habe ich keine gesehen. Wir mußten uns sogar mit verschlossenen schmiedeeisernen Toren herumquälen.«
Ich kannte den Journalisten, es war der innenpolitische Redakteur Viktor Gartner, der vielleicht zufällig zum Schauplatz des Brandes gekommen war und seiner Profession nachging.
Der erschöpfte Feuerwehrmann erklärte ihm auf die Frage, wie der Brand entdeckt worden sei, daß ein Angestellter des Österreichischen Wachdienstes gemeinsam mit zwei Beamten des Brandschutzes routinemäßig die Dachböden kontrolliert hätte. Um 1:08 Uhr habe der Kollege vom Wachdienst durch eine Öffnung der Decke – wo die Luster befestigt sind – das Inferno entdeckt. Zu dieser Zeit müsse es im Festsaal schon längere Zeit gebrannt haben. Der Feuerwehrmann nahm einen Schluck aus einer Wasserflasche und verstummte.
Ich folgte Gartner zum Josefsplatz. Man ließ ihn, nachdem er sich ausgewiesen hatte, passieren, und ich folgte ihm unbemerkt. Es war knapp nach drei Uhr. Funken ergossen sich über uns, es sah aus wie ein religiöses Ereignis, als hätte sich der Nachthimmel geöffnet und ließe rotgoldene Flammentropfen auf die Gebäude und Straßen niedergehen. Der Gestank nach Rauch war noch intensiver geworden. Dicke Schläuche lagen quer über den Pflastersteinen, ich hatte sie beim ersten Mal nicht registriert, obwohl sie schon dort gelegen haben mußten, und von zwei Drehleitern aus bekämpften Feuerwehrmänner scheinbar vergeblich den immer mehr um sich greifenden Brand. Über dem Redoutentrakt standen jetzt nur noch die schwarzen Balken des ehemaligen Dachgeschosses – Ziegel und Querverstrebungen waren weggebrochen –, und soeben stürzte eine der riesigen steinernen Amphoren vom Gesims auf das Kopfsteinpflaster und zersprang mit einem dumpfen Knall. Die Flammen schlugen jetzt hoch aus dem Bauwerk und schienen sich gegen die Ställe der Spanischen Reitschule, aber auch zum Michaelertrakt hin auszubreiten. Funken strömten von allen Seiten, gegen alle Seiten, und dieses Flimmern und Flirren von brennenden, winzigen Teilen der Hofburg, dieses Wirbeln ließ mich flüchten. Vor allem die glimmenden Partikel, die gegen mein Gesicht stießen wie heiße Nadelspitzen, irritierten mich, und ich fürchtete, selbst in Brand zu geraten.
Ich eilte zusammen mit dem Journalisten Gartner um die Häuser herum bis zum Graben. Gerade wurden dort die weißen Hengste, die Lipizzaner – mit Reitdecken vor der Kälte geschützt –, von Polizisten und Pferdeknechten über eine Hintertreppe ins Freie geführt, weitere und weitere drängten mit klappernden Hufen nach, manche in Panik, mit geblähten Nüstern und wiehernd. Die Polizisten beeilten sich, die Pferde blindlings an Anwesende zu übergeben, da zuwenig Stallburschen vorhanden waren. Einige Hengste schlugen mit den Hinterläufen aus, ihre Hufe schlugen Funken auf dem Pflaster, es war zweifellos gefährlich, die Zügel eines der Tiere zu übernehmen. Plötzlich erblickte ich Philipp Stourzh zwischen den Pferden und Polizisten.
»Wir müssen die Stallungen räumen, helfen Sie uns!« rief im selben Augenblick ein Tierpfleger und drückte den Passanten weiter Zügel von verschreckten Lipizzanern in die Hand, »es ist höchste Zeit, die Stallungen sind voll Rauch.«
Philipp übernahm eines der nervösen Pferde, ein geschecktes, noch junges Exemplar, und Viktor Gartner ein anderes, das sofort scheute.
»Ich muß Sie leider bitten. Nehman’s das Roß und reden’s gut drauf ein. Und führen Sie’s um Himmels willen zum Graben«, sprach mich ein Pferdeknecht an, und schon mußte ich ein gewaltiges Tier unter Kontrolle halten, das weiße Atemwolken ausstieß und mit hervorquellenden Augen nach einem Fluchtweg suchte.
Auch der Junghengst von Stourzh biß um sich. Philipp war so sehr mit ihm beschäftigt, daß er mich nicht sah. Zu meinem Glück lief ein älterer Herr mit einem der weißen Pferde hinter mir her und bot mir an, meinen wiehernden und wild ausschlagenden Lipizzaner zu übernehmen.
»Wohin geht’s?« fragte ich.
»Zum Volksgarten!« rief er … Und nachdem er den Lipizzaner beruhigt hatte: »Stellen Sie sich vor, nur sechs Pfleger sind im Dienst!«[*]
An der Straßenecke ging mein verängstigter Hengst durch. Zuvor hatten sich schon andere losgerissen, ohne daß jemand etwas dagegen hätte unternehmen können, und selbst ein Kutscher auf einem Fiaker, der sich aus Neugier zum Schauplatz begeben hatte, verlor die Herrschaft über seine Tiere, die in Panik den fliehenden Hengsten folgten. Es war absurd: Die Passanten einer Millionenstadt wurden mitten in der Nacht vom Getöse einer Herde galoppierender Pferde und einer ziellos dahinrasenden Kutsche überrascht, die durch die Gassen jagten. Einer der Lipizzaner traf mit seinem Huf eine junge Frau im Gesicht, die augenblicklich zu Boden stürzte. Benommen versuchte sie sich aufzurichten, tastete mit den Fingern nach den blutenden Lippen und starrte zwei ausgeschlagene Vorderzähne in ihrer Hand an. Ich führte sie zu einer Ambulanz in der Dorotheergasse, wo inzwischen mehrere Rettungswagen bereitgestellt waren. Man versorgte die Verletzte und brachte sie in ein Krankenhaus.
Die Polizei hatte in der Zwischenzeit begonnen, die Zugänge zur Hofburg abzusperren. Ich konnte gerade noch in den Michaelertrakt laufen, wo sich mir ein ungewohnter Anblick bot. Meine Nachbarn waren im Burghof in Bussen evakuiert, manche in Mänteln über gestreiften Flanellpyjamas, andere in Trainingsanzügen. Neben dem Chauffeur saß die 94jährige Tochter des ehemaligen Verwalters der kaiserlichen Gärten, die ihre Katzen in Käfigen mitgenommen hatte. Der Anblick der unruhigen Tiere ließ mich an meinen eigenen Kater denken, und da ich mich in der Hofburg ja auskenne, kam ich über ein wenig frequentiertes Stiegenhaus zur Schatzkammer. Dort herrschte die größte Aufregung. Die Beamten berieten lautstark über den Abtransport der wertvollsten Stücke, denn an den Wänden lief bereits das Löschwasser herunter. Es war jedoch weder etwas vom Brand zu riechen noch vom Einsatz der Feuerwehr zu hören, man konnte den Eindruck gewinnen, es spielte sich gleichzeitig ein ganz anderes Drama ab, das die Schatzkammer in einer Überschwemmung untergehen ließ. Ich wurde im allgemeinen Durcheinander nicht beachtet und benutzte einen Durchgang, der nur den Eingeweihten des Hofburglabyrinths bekannt ist. Unbemerkt lief ich die Treppen, über die Schläuche gelegt waren, bis in das zweite Stockwerk hinauf. Als ich den Treppenabsatz erreichte, kam mir ein junger Feuerwehrmann entgegen, der mich fragte, ob ich der Eigentümer der Wohnung sei. Er wischte sich den Schweiß von der Stirn und erklärte mir, daß man von einem meiner Zimmer aus versuchen wolle, den Brand zu bekämpfen. Ich sperrte die Tür auf, aber kaum hatte ich sie einen Spaltbreit geöffnet, schoß mein Kater zwischen meinen Beinen hindurch in das Stiegenhaus. Vielleicht flüchtete er auf den Dachboden, wo er sich am liebsten herumtreibt, oder in einen abgelegenen Winkel, wo er hoffte, nicht entdeckt zu werden, dachte ich. Jedenfalls rief ich ihn erfolglos bei seinem Namen. Ich öffnete das Fenster, von dem aus ich das Feuer sehen konnte, und ließ die Männer hereintrampeln. Zuerst war ich unentschlossen, wohin ich gehen sollte. In der Wohnung wollte ich nicht bleiben, denn die Löscharbeiten verursachten das gräßlichste Chaos, und mich in den Bus zu den Nachbarn zu setzen, reizte mich nicht. Also entschied ich mich, weiter Augenzeuge zu sein und meine Ortskenntnisse zu nutzen, um einen besseren Überblick zu erhalten. Ich bin davon überzeugt, daß nicht einmal der Burghauptmann alle Querverbindungen, Abkürzungen, Nebenstiegen, Wege und Umwege, die die Gebäudekomplexe miteinander verbinden, besser kennt als ich. Gerade wurde die Neue Galerie geräumt, in der fast 1000 Gemälde, darunter Werke von Degas, van Gogh, Monet, Manet und Toulouse-Lautrec, hingen. Aus den geöffneten Stallungen im Hof quoll Rauch, es sah bedrohlich aus. Da ich zielbewußt durch die Gänge eilte, fiel ich nicht weiter auf, außerdem waren die vorüberhuschenden Gestalten mit dem Tragen der gerahmten Bilder, die in Decken gehüllt waren, beschäftigt.
Schon stand ich wieder auf dem Josefsplatz, über den Feuerwehrleute liefen, und stellte fest, daß ich (außer den Fotografen und Journalisten) der einzige Zuschauer auf dem abgesperrten Areal war, weshalb ich rasch nach einem Kugelschreiber und meinem Taschenkalender griff.
Der Funkenflug war durch den starken Wind, gegen dessen einzelne Böen ich mich stemmen mußte, so heftig, daß ich zuerst glaubte, in ein fürchterliches Flammengestöber geraten zusein. Oben am Dachstuhl lösten Feuerwehrmänner die Holzbalken, die sich zu entzünden drohten und den Brand dadurch noch weiter anfachen konnten. Zum ersten Mal verspürte ich Angst, und meine Angst verband sich mit dem Gedanken an Philipp Stourzh. Der Verdacht, daß er den Brand gelegt haben konnte, ging mir nicht aus dem Kopf. Während ich mich vorankämpfte, ereignete sich der nächste Zwischenfall. Zuerst krachte eine weitere Steinamphore in einer Wolke aus glimmenden Teilchen vom Dach, weshalb ich erschrocken den Kopf hob. Mein Blick fiel dabei auf die beiden Seitenflügel der Nationalbibliothek, wo ich im Feuerschein die steinerne Figurengruppe, die ich seit meiner Kindheit kenne, sah: Atlas mit der Himmelskugel auf dem Rücken, zu beiden Seiten Astronomie und Astrologie und Gaea mit der Erdkugel in der Hand, umgeben von Geometrie und Geographie. (Die Vorstellung, daß die Statuen vernichtet werden könnten, schmerzte mich auf eine irrationale Weise.) Dann tauchten plötzlich uniformierte Polizeischüler aus der Dunkelheit auf, die im Laufschritt die Stufen zum Prunksaal, dem Herzstück der Nationalbibliothek, hinaufstürmten, gefolgt vom Journalisten Gartner und einem Fotografen. Ich hatte die ganze Zeit über gefroren, diesen Zustand aber als etwas Selbstverständliches empfunden. Jetzt aber wurde mir die Winterkälte bewußt. Ich war überdies müde, hatte bei meinem Verleger zuviel getrunken und war mit Abendanzug, Mantel und Halbschuhen nicht für einen nächtlichen Aufenthalt im Freien gekleidet. Ich schloß mich indessen vor Kälte zitternd Gartner an. Als wir das Vestibül betraten, wurden wir von einem Wachebeamten aufgehalten, der Gartner erkannte und durchließ. Ich gab an, Arzt zu sein und mich für den Notfall bereitzuhalten, worauf auch ich passieren durfte.[*]
Ich steckte den Kalender und den Kugelschreiber wieder ein und eilte die Stufen zum Prunksaal hinauf. Der beißende Brandgeruch und der hektische Funkenflug draußen, der durch die Gangfenster als wirbelnde Leuchtspuren bemerkbar war, steigerten noch meine Ängste. Inzwischen trafen die Generaldirektorin der Nationalbibliothek und der Bürgermeister ein, während die Polizeischüler – es waren 200 bis 300 – im Prunksaal eine Menschenkette gebildet hatten und Stapel alter Bücher weiterreichten. Andere trugen die wertvollen Folianten durch den Saal. Das Feuer war jetzt, erfuhren wir zur allgemeinen Beunruhigung, nur noch zwei Räume weit entfernt.[*]
Es schmerzte mich, daß ich zusehen mußte, wie die kostbaren Bücher aus dem 16., 17. und 18. Jahrhundert (zum Teil aus den Beständen Prinz Eugens und mit Kupferstichen reich illuminiert) aus ihrer Umgebung herausgerissen und weitergereicht wurden. Man hörte jeden Schritt und jeden Ruf, denn die akustischen Qualitäten des Prunksaales sind einzigartig.[**]
Die Flügeltüren standen weit offen, die Räume und Flure waren hell erleuchtet. Ich schaute – den scharfen Brandgeruch in der Nase – in den Katalograum, wo die bibliophilen Prachtstücke wie Dutzendware aufgetürmt waren. Mir war sofort klar: Noch katastrophaler würde eine Ausdehnung des Brandes oder das Eindringen von Löschwasser in die Handschriftensammlung sein.[***]
Als ich vor den aufgeschichteten Folianten und Büchern stand, zu denen in einem fort weitere kamen, fiel mir wieder Philipp Stourzh ein und gleich darauf mein Kater. Das Tier zu suchen war sinnlos – aber Stourzh, so sagte mir mein Instinkt, mußte sich irgendwo in der Nähe aufhalten. Ich war davon überzeugt, daß er den Lipizzanerhengst, wie es die Absicht der Tierpfleger war, in den Volksgarten gebracht hatte.
Der Rauch war so beißend scharf, daß ich den von Polizeischülern wimmelnden Prunksaal verließ und unbeachtet an der Absperrung vorbei zum Park ging. Um den Redoutensaal herrschte eine Art Schneetreiben aus Glutstücken, dazwischen apfelgroße Trümmer; man hörte das Zubodenprasseln der glühenden Brocken auf dem Pflaster und dem Asphalt wie bei einem vulkanischen Steinschlag. Und an einen Vulkanausbruch erinnerten mich auch die Rauchfahnen und -schwaden, die zum rotgefärbten Nachthimmel emporzogen.
Als ich mich über den Heldenplatz dem Volksgarten näherte, hörte ich schon von Weitem Gewieher. Die Innenstadt mußte inzwischen abgesperrt worden sein, denn die Straßen waren frei. Im Park selbst gab es kleinere Menschenansammlungen, aber es war zunächst nur das Dröhnen von Pferdehufen wahrzunehmen. Als ich nähertrat, galoppierte gerade einer der Hengste mit Schaum vor dem Maul an mir vorbei. Ein Passant kommentierte das Verhalten der Lipizzaner, die jetzt von allen Seiten wiehernd und schnaufend auf uns zustürmten, mit dem Hinweis, daß sie die Beete verwüstet und Bänke umgestoßen hätten.
In den weichen Rasen, sah ich, waren Löcher gestampft, auf den Wegen lagen Pferdemist und ausgerissene Grasbüschel, und die Reihen der Parkbänke waren gelichtet, die Trümmer überall verstreut. Währenddessen rasten die Hengste weiter ziellos umher, konnten aber aus dem umzäunten Gartengelände nicht entweichen. Einige der Tiere hatten Abschürfungen erlitten, die wegen des Blutes auf dem weißen Fell den Eindruck schwerer Verletzungen machten. Inzwischen hatten die Stallburschen begonnen, die Pferde einzufangen und an den Zaun zu binden. Aber noch immer hörte man von allen Seiten das Schnaufen, Schnauben und Wiehern der Lipizzaner, die plötzlich aus dem Dunkeln auftauchten und wild auf einen zugaloppierten, so daß man sich gerade noch mit einem Satz hinter einen Baum retten konnte. Ich bin oft in der Stallburg gewesen. Im Innenhof habe ich die Morgenarbeit der herrlichen weißen Pferde beobachtet. Daher kannte ich einen der Tierpfleger vom Sehen. Er war gerade dabei, das herbeigeschaffte Heu an das älteste Tier, den 24jährigen »Neapolitano«, zu verfüttern. Mit aufmerksam gespitzten Ohren fraß der Lipizzaner, während der Betreuer einen Schritt zurücktrat und einen Pappbecher Tee aus einem dampfenden Eimer schöpfte. Windstöße bogen die blattlosen Kronen der Parkbäume. Ein anderer Stallbursche machte seine Kollegen darauf aufmerksam, daß die Pferde nicht von den giftigen Buchsbaumrabatten fressen dürften.[*]
Im Hintergrund konnte ich den Feuerschein wie eine leuchtende, blutige Wunde in der Dunkelheit sehen. Die ganze Zeit über, während ich mich im Volksgarten aufhielt, war das Getrampel der Hengste zu hören, mitunter das Krachen von Holz und der Pfiff oder Ruf eines Tierpflegers. Unter den Lipizzanern entdeckte ich einige Remonten, die an ihrem dunklen Fell zu erkennen waren. (Da sie noch am Vortag auf der Weide in der Steiermark gewesen waren, waren sie abgehärtet und galoppierten daher ohne Decke herum.) Ich suchte vorsichtig zwischen den Bäumen und Bänken nach Stourzh, sah mich auch vor dem geschlossenen Café um, entdeckte aber nirgendwo eine Spur von ihm. Ich fror nun noch stärker, denn im Park traf mich der kalte Wind mit voller Wucht … Ich blickte auf die Uhr, es war 5 Uhr 16. Erst jetzt kam mir zu Bewußtsein, daß ich die ganze Nacht auf den Beinen gewesen war. Außerdem fängt mein Dienst in Gugging um 8 Uhr an, und ich mußte spätestens um 7 Uhr 30 in meinem Wagen sitzen, um noch zurechtzukommen.
Ich ging rasch über den Michaelerplatz zur Stallburg, wo ich erfuhr, daß die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle gebracht und die Gefahr für die Nationalbibliothek gebannt hatte. Auch die Winterreitschule war gerettet, allerdings war der Josefsplatz noch immer gesperrt. Ich konnte einen Blick in den Innenhof der Stallburg mit seinen schönen Arkaden werfen: Er war mit Löschwasser bedeckt, in dem schwarze Holzstücke schwammen. Die Skulpturen, von denen ich Meuniers »Lastträger« und Renoirs »Vénus Victorieuse« am meisten schätze, spiegelten sich fragmentarisch in den Pfützen, alles war in das traurige Gelb einer schwachen elektrischen Beleuchtung getaucht. Verkohlte Teilchen lagen auf dem Gehsteig, ich bückte mich und hob eines auf, wickelte es in ein Papiertaschentuch und steckte es ein. Es liegt heute vor mir auf dem Schreibtisch, ein Stück schwarzer Materie, wie aus einer anderen Welt. Woher stammt es? Vom Dachstuhl? Der Winterreitschule? Einem blinden Fenster?
Kapitel 4Die Begegnung
Ich stieg die Schatzkammerstiege hinauf und traf dort auf einen Polizeibeamten, der mir mit verquollenen Augen Auskunft gab, daß die Schauräume keinen Schaden erlitten hätten, auch die Vitrinen seien heil geblieben, ebenso die Bücher der Nationalbibliothek und die Gemälde der Neuen Galerie. Jetzt wollte ich unbedingt meinen Kater wiederfinden, ich eilte quer über den Hof zurück in das Stiegenhaus und rief mehrmals seinen Namen. Da ich nichts von ihm hörte, fing ich halblaut zu miauen an.[*]
Miauend stieg ich langsam höher, hielt an, lauschte. Machte wieder ein paar Schritte aufwärts, wartete, miaute kräftiger und horchte wieder. Angestrengt haftete mein Blick auf den Stufen, da entdeckte ich ein Bündel Federn. Es war eine tote, halbverbrannte Taube. Ich war mir sicher, daß mein Kater sie vom Dachboden heruntergeschleppt hatte. Daher rief ich noch einmal lauter seinen Namen.
Des öfteren hatte er mir erlegte Tiere vom Dachboden in die Wohnung gebracht, vorzugsweise Fledermäuse, und ich war davon überzeugt, daß er in der Nähe war. War die Taube nicht ein Beweis? Ich miaute wieder, und endlich erhielt ich eine Antwort aus dem oberen Stockwerk. (Also wartete er schon vor meiner Wohnungstür.) Ich ging hinauf, miaute begütigend und bemüht freundlich, schnalzte mit der Zunge und sah, daß meine Wohnungstür nur angelehnt war. Offenbar hatte die Feuerwehr vergessen, sie zu schließen … Ich trat ein und gab einen freudigen Begrüßungslaut von mir, worauf mir mein Kater ebenso antwortete. Das Geräusch kam aus dem finsteren Wohnzimmer, ich stieß vorsichtig die angelehnte Tür auf, um ihn nicht zu verletzen, falls er dahinter sein würde, da erhob sich eine Gestalt aus einem der Polsterstühle.
»Ich bin es«, sagte jemand.
Ich schaltete das Licht ein, und vor mir stand Philipp. Er war verschwitzt und betrunken und musterte mich mit glasigem Blick. Ungefragt erklärte er mir, daß er in einem Lokal in der Habsburggasse vom Brand erfahren habe und gerade rechtzeitig gekommen sei, um bei der Rettung der Lipizzaner mitzuhelfen. (Aus seinem Gesicht schloß ich, daß er mich bei der Übernahme der Tiere nicht bemerkt hatte.) Nachdem er seinen widerspenstigen Hengst in den Volksgarten gebracht habe, sei er von den Tierpflegern auf heißen Tee und einen Becher Rum eingeladen worden. Er habe schon zuvor »dem Alkohol zugesprochen« und sei ziemlich betrunken gewesen.
Er ließ den Kopf nach vorne fallen, starrte auf seine Brust und sagte, ich könne mit ihm machen, was ich wolle.
Jetzt erst bemerkte ich, daß er rauchte, Asche und Glut fielen aus seiner Zigarette auf den Teppich.
»Entschuldigen Sie«, sagte er, kniete nieder, griff nach einer Tasse auf dem Tisch und bemühte sich, mit Hilfe von Speichel, den er auf die Kuppe eines Mittelfingers spuckte, die Tabakreste einzusammeln.
»Warum haben Sie auf mein Miauen geantwortet?« fragte ich ungehalten.
Er sah mich traumverloren an und antwortete: »Ach, Sie waren das! Ich dachte mir, da miaut ein Kater, und wollte ihn anlocken!« Er lachte offenbar sich selbst aus.
»Ich habe seinen Namen gerufen«, insistierte ich.
»Ich muß lachen … Aber ich habe das nicht gehört … Tut mir leid … Ich nahm nur das Miauen wahr!«
Mit Sicherheit log er.
»Wo waren Sie gestern abend?« fragte ich.
Er hatte sich ächzend vom Boden erhoben und stand schwankend, in einer Hand die Tasse, in der anderen die Zigarette, vor mir.
»Gestern abend?« Er lachte weiter auf eine so verrückte Weise, als amüsierte er sich über sein eigenes Verhalten. »Ich habe als Statist für den ›Lucona-Film‹ gearbeitet – im großen Redoutensaal.«
»Wie lange?«
»Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht bis 17 Uhr …«
»Und dann? Was haben Sie dann gemacht?«
Er schwieg.
»Sie werden diese Frage vor der Polizei beantworten müssen.«
Er räusperte sich, und seiner Stimme waren jetzt deutlich Argwohn und Ärger zu entnehmen. (Offenbar hatte er den Braten gerochen, und das war die Botschaft an mich: Eine Warnung, weiter zu fragen, oder besser gesagt eine Drohung.)
»Wie-sooo?« fragte er, das »O« am Schluß in höherer Tonlage.
»Sie glauben, daß ich den Redoutensaal in Brand gesteckt habe?« Sein Blick war stechend geworden und seine Stimme scharf. Man sah ihm seinen schlechten Zustand plötzlich nicht mehr an.
»Es spielt keine Rolle, was ich glaube –«
»Doooch!« unterbrach er mich herausfordernd. »Es kommt sehr wohl darauf an, was Sie glauben!«
»Ich schließe zunächst nichts aus –«
Er lachte abfällig. »Das ist ja gut so«, sagte er gönnerhaft und lachte erneut, als applaudierte er sich selbst, und mir war klar, daß er Streit suchte.
»Wie haben Sie überhaupt hierher gefunden?« fragte ich und schaute auf meine Uhr.
»Das war nicht schwer«, antwortete er zerstreut. »Ich kenne Ihre Adresse schon lange. Einmal habe ich mir die Mühe gemacht, Sie zu suchen … Es war Neugierde.«
Ich sagte nichts.
»Ist das verboten?« fragte er. Etwas von Überlegenheit und Mißtrauen lag in seiner Stimme.
»Mich interessiert nur, wo Sie gestern waren«, bohrte ich weiter.
»Ich habe schon gesagt: im großen Redoutensaal«, antwortete er aufsässig.
»Wie lange?«
»Wie lange! Wie lange!« Er grinste, als amüsierte er sich über meine Frage.
»Ich habe nicht auf die Uhr geschaut.«
»Aber Sie werden bestimmt wissen, ob Sie als Letzter gegangen sind?«
»Nein, nicht als Letzter.« Und jetzt lachte er auf eine verächtliche Weise: »Aber ich bin noch einmal zurückgekehrt.«
Ich wartete, was er sagen würde, denn ich fürchtete, ihn durch weitere Fragen aus dem Konzept zu bringen. Er dachte nach und bewegte stumm seine Lippen.
»Ich habe mich im Gebäude verlaufen …«, sprach er wie zu sich selbst. Dann wandte er sich wieder mir zu: »Ich nehme, wie Sie wissen, Beruhigungstabletten, es hat Alkohol zu trinken gegeben … und ich bin auf irgendeiner Stiege eingeschlafen!«
Er machte wieder eine Pause und drückte seine Zigarette aus.
»Dann bin ich auf der Suche nach dem Ausgang in den Redoutensaal zurückgekehrt. Da ging gerade so ein komisches Diplomatentreffen zu Ende, und es gab noch etwas zu trinken.«
»Wie lange blieben Sie?« Die Frage war mir entschlüpft, und ich wußte im selben Moment, daß es ein Fehler war, sie zu stellen.
»Das weiß ich nicht!« antwortete er barsch.
Ich war mir sicher, daß er etwas angestellt hatte, sonst wäre er nicht zu mir gekommen. Mir fiel ein, daß ich längst zur Arbeit fahren mußte, und als ich das sagte, wollte er mich unbedingt begleiten. So begaben wir uns gemeinsam zu meinem Wagen, der auf dem Parkplatz vor dem Palmenhaus abgestellt war. Ich hatte mir inzwischen vorgenommen, zu schweigen und ihn dadurch vielleicht so weit zu bringen, daß er sich rechtfertigte.
Kapitel 5Kafka
Philipp nahm mein Schweigen an und schwieg selbst. Auf dem Weg nach Klosterneuburg, die Donau entlang, nickte er ein, als wir uns jedoch Kierling näherten, schlug er die Augen auf und fragte mich, wo wir seien. Ich sagte es ihm. Er wurde ganz aufgeregt und erklärte mir, daß Franz Kafka ganz in der Nähe gestorben sei. Ich wußte es, hatte aber noch nie das Sterbehaus betreten.
»Halten Sie an der Hauptstraße 71!« wies er mich an. »Es ist sehr wichtig.«
Ich glaubte ihm nicht. Aber konnte ich eine, wenn auch noch so geringe Möglichkeit, von ihm etwas zu erfahren, ignorieren, nur weil ich nicht zu spät kommen wollte und ihm mißtraute?
Ich rief meine Sekretärin an, sagte, daß ich erst in einer halben Stunde erscheinen würde, und hielt vor dem betreffenden Haus. An dem Gebäude war nichts Besonderes, ein dreistöckiges Haus, das ich seither mehrmals aufgesucht habe.[*]
Das Sterbezimmer kann man nicht betreten, es ist bewohnt. Statt dessen wird man in einen nüchternen, bürokratischen Raum geführt, der als Sterbezimmer ausgegeben wird. Ein paar Aktenschränke, ein eisernes Bücherregal, nicht einmal eine Kafka-Bibliothek ist vorhanden, selbst Fotografien fehlen.
Als ich mit Stourzh eintraf, lagen Wochenzeitschriften herum, es war so still, als lägen Haus und Hof in einem Universum des Vergessenen. Dorthin waren nicht nur die unausgesprochenen Gedanken Kafkas entschwunden, sondern auch die Möbel des Krankenzimmers, die Atemzüge des Sterbenden, seine Ängste und Schmerzen.
»Ist es nicht so, als ob die Seele des Hauses mit Kafka gestorben ist?« fragte Stourzh zu meiner Überraschung. »Jedes Haus hat eine Seele, eine Art Geist. Nach Kafkas Tod starb das Gebäude, und nach dem Tod des Hauses blieben nur seelenlose Räume zurück.«
Man hatte Stourzh, der das Zimmer immer wieder aufsucht, sofort erkannt und nicht den sonst üblichen Eintritt von uns verlangt. Eine ungepflegte Frau mit Bubikopf und großgeblümtem Morgenmantel hatte uns umständlich die Tür aufgeschlossen. Für eine halbe Minute war sie angestrengt nachdenkend neben uns stehengeblieben und anschließend wortlos hinausgegangen.
Stourzh öffnete – kaum hatte sie das angebliche Sterbezimmer verlassen – die Balkontür, wir gingen über den Bretterboden zum Geländer und schauten in die Landschaft hinaus.
»Unter dem ersten Balkon war eine kleine Liegehalle«, sagte Stourzh. Er zündete sich eine Zigarette an, nahm einen Lungenzug und fügte hinzu: »Kafka starb um die Mittagszeit, gerade als ein Regenbogen am Himmel stand, aber, wie gesagt, nicht in diesem Zimmer.«
Damals erschien mir jedes seiner Worte bedeutungsvoll. Ich täuschte mich jedoch oder besser gesagt, er war es, der die falsche Spur legte. Das Sterbehaus Kafkas war nur als Widerspruch zu meiner Besorgnis um die Hofburg gedacht. Hier Prunk, Macht, Ewigkeit: angehaltene, stillstehende Zeit, in der Hunderte von Menschen noch immer mit weißen Pferden, Büchern, Bildern, Globen, Landkarten, Papyri und so weiter lebten – da Tod, Vergänglichkeit, Unwiederbringlichkeit eines geistigen Reiches, das zwar untergegangen war mit seinem Schöpfer, aber in den Köpfen vieler tausend Leser immer wieder aufs neue erstand. Jedenfalls deutete ich Stourzh’ Drängen, Kafkas Sterbehaus aufzusuchen, nachträglich so.
Wir fuhren anschließend den Hügel zum »Haus der Künstler« hinauf, an den tristen Anstaltsgebäuden und der Kinderstation vorbei. Stourzh rauchte hektisch weiter. Ich hasse das Rauchen in meinem Auto. Natürlich redete er über den Hofburgbrand, aber er sagte mir nichts anderes als in meiner Wohnung – er erzählte alles nur ausführlicher, und oft verlor er dabei den Faden. Da er übernächtigt und angetrunken war, wiederholte er sich in einem fort.
Ich ließ ihn vor dem »Haus der Künstler« aussteigen. Er war so mit sich selbst beschäftigt, daß er sich nicht einmal von mir verabschiedete.
Kapitel 6Überlegungen
Während die Feuerwehr auf einem Kabelbrand als Ursache der Katastrophe beharrte, kamen Spezialisten der Polizei und des Innenministeriums zu einem anderen Ergebnis: Glimmende Teilchen hätten das Feuer auf der Bühne des großen Redoutensaales entfacht. Die Ermittlungen bestärkten meinen Verdacht, daß Stourzh der Brandstifter gewesen war. In einem Telefonat mit Primarius Neumann erfuhr ich, daß Philipp im »Haus der Künstler« als Patient aufgenommen worden war. Er habe einen Zusammenbruch erlitten, teilte mir der Primarius mit.
Da ich nur Vermutungen hatte, behielt ich mein Wissen für mich und überlegte, was zu tun sei. Ich glaubte, daß Stourzh mir in Kafkas Sterbehaus einen Hinweis gegeben hatte. Er betraf den Tod des Dichters; die Erzählung »Ein Hungerkünstler«, deren Druckbögen Kafka noch in seinen letzten Lebensstunden korrigiert hatte, und seine Fahrt im Einspänner nach Gugging, um dort einen Blick auf die Geisteskranken im Park zu werfen, hatten eine bestimmte Bedeutung. Ich selbst war es, der Stourzh erzählt hatte, daß Patienten der Anstalt in der Zeit des Nationalsozialismus durch Verhungernlassen umgebracht worden waren. – Kafka hatte in seinen Augen, nehme ich an, seherisch darüber geschrieben und mit seinem eigenen Tod den der Geisteskranken vorweggenommen. Zugegeben ein kühner Schluß, der mir selbst Zweifel bereitete, aber je länger ich darüber nachdachte, desto mehr war ich davon überzeugt, daß er stimmte.[*] Philipp sah überdies in mir jemanden, der sich der Frage nach den Folgen des Nationalsozialismus nicht genügend stellte und statt dessen einem idealistischen Geschichtsbild nachhing. Die Hofburg mußte für ihn geradezu ein Symbol für meine geistige Haltung sein, noch dazu, wo ich in ihr wohnte und diese Wohnung gewissermaßen geerbt hatte.