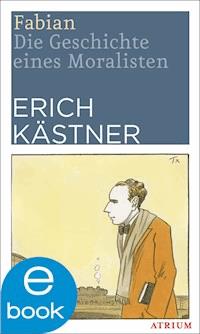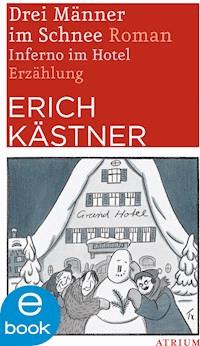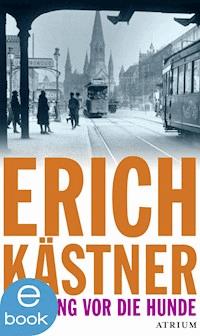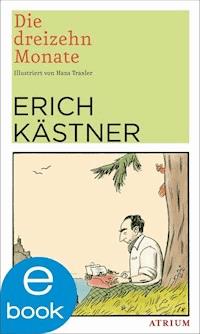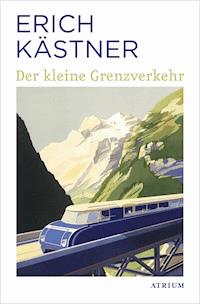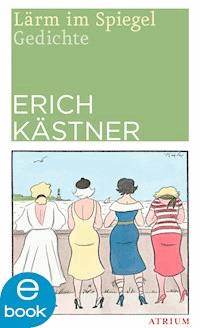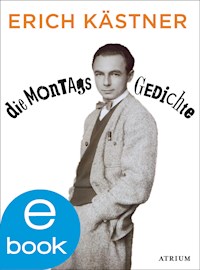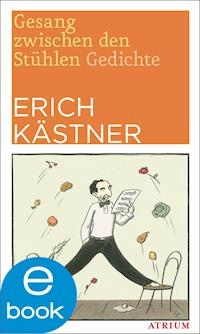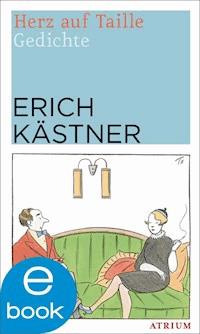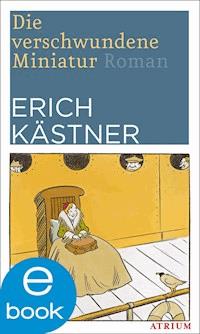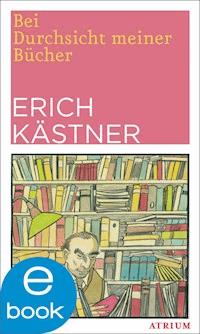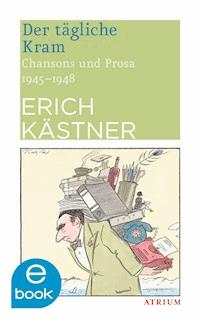9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atrium Verlag AG
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Erich Kästners Kampf für den Frieden In seinem Schaffen verdeutlicht Kästner immer wieder seine ethische Grundhaltung: die eines unerschütterlichen Pazifisten. Seine Erfahrungen aus zwei Weltkriegen und der Diktatur haben ihn stark beeinflusst und neben dem satirisch geschärften Blick auch den Kampfgeist für Frieden und Demokratie hervorgebracht. Diese Haltung spricht ebenso aus zahlreichen Gedichten wie aus seinen Prosatexten - mitunter erschütternd in ihrer Direktheit, aber stets unverkennbar in Kästners Tonfall. Die hier getroffene Auswahl bringt seine Sicht auf die Welt auf den Punkt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 70
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Erich Kästner
Das Land, wo die Kanonen blühn
Gedichte und Prosa für den Frieden
Erich Kästners Werke erscheinen im Atrium Verlag in ihrer originalen Textgestalt. Die Sprache hat sich im Lauf der Jahrzehnte gewandelt, manche Begriffe werden nicht mehr oder anders verwendet. Von minimalen Eingriffen abgesehen, wurde aus urheberrechtlichen Gründen darauf verzichtet, Kästners Sprache – die eines aufgeklärten Moralisten und Satirikers – dem heutigen Sprachgebrauch anzupassen.
© Atrium Verlag AG, Zürich 2024
© Thomas Kästner:
Friedensgas; Gegen den Krieg in Vietnam; Ostermarsch 1961; Über die Ziele des PEN-Clubs; Brief an den Weihnachtsmann; Das posthistorische Zeitalter.
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: www.b3k-design.de, Andrea Schneider
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
ISBN978-3-03792-234-7
www.atrium-verlag.com
www.facebook.com/atriumverlag
www.instagram.com/atriumverlag
TEIL I: Erfahrungen
Kennst Du das Land, wo die Kanonen blühn?
Kennst Du das Land, wo die Kanonen blühn?
Du kennst es nicht? Du wirst es kennenlernen!
Dort stehn die Prokuristen stolz und kühn
in den Bureaus, als wären es Kasernen.
Dort wachsen unterm Schlips Gefreitenknöpfe.
Und unsichtbare Helme trägt man dort.
Gesichter hat man dort, doch keine Köpfe.
Und wer zu Bett geht, pflanzt sich auch schon fort!
Wenn dort ein Vorgesetzter etwas will
– und es ist sein Beruf, etwas zu wollen –,
steht der Verstand erst stramm und zweitens still.
Die Augen rechts! Und mit dem Rückgrat rollen!
Die Kinder kommen dort mit kleinen Sporen
und mit gezognem Scheitel auf die Welt.
Dort wird man nicht als Zivilist geboren.
Dort wird befördert, wer die Schnauze hält.
Kennst Du das Land? Es könnte glücklich sein.
Es könnte glücklich sein und glücklich machen!
Dort gibt es Äcker, Kohle, Stahl und Stein
und Fleiß und Kraft und andre schöne Sachen.
Selbst Geist und Güte gibt’s dort dann und wann!
Und wahres Heldentum. Doch nicht bei vielen.
Dort steckt ein Kind in jedem zweiten Mann.
Das will mit Bleisoldaten spielen.
Dort reift die Freiheit nicht. Dort bleibt sie grün.
Was man auch baut – es werden stets Kasernen.
Kennst Du das Land, wo die Kanonen blühn?
Du kennst es nicht? Du wirst es kennenlernen!
Jahrgang 1899
Wir haben die Frauen zu Bett gebracht,
als die Männer in Frankreich standen.
Wir hatten uns das viel schöner gedacht.
Wir waren nur Konfirmanden.
Dann holte man uns zum Militär,
bloß so als Kanonenfutter.
In der Schule wurden die Bänke leer,
zu Hause weinte die Mutter.
Dann gab es ein bisschen Revolution
und schneite Kartoffelflocken;
dann kamen die Frauen, wie früher schon,
und dann kamen die Gonokokken.
Inzwischen verlor der Alte sein Geld,
da wurden wir Nachtstudenten.
Bei Tag waren wir bureau-angestellt
und rechneten mit Prozenten.
Dann hätte sie fast ein Kind gehabt,
ob von dir, ob von mir – was weiß ich!
Das hat ihr ein Freund von uns ausgeschabt.
Und nächstens werden wir dreißig.
Wir haben sogar ein Examen gemacht
und das Meiste schon wieder vergessen.
Jetzt sind wir allein bei Tag und bei Nacht
und haben nichts Rechtes zu fressen!
Wir haben der Welt in die Schnauze geguckt,
anstatt mit Puppen zu spielen.
Wir haben der Welt auf die Weste gespuckt,
soweit wir vor Ypern nicht fielen.
Man hat unsern Körper und hat unsern Geist
ein wenig zu wenig gekräftigt.
Man hat uns zu lange, zu früh und zumeist
in der Weltgeschichte beschäftigt!
Die Alten behaupten, es würde nun Zeit
für uns zum Säen und Ernten.
Noch einen Moment. Bald sind wir bereit.
Noch einen Moment. Bald ist es so weit!
Dann zeigen wir euch, was wir lernten!
Primaner in Uniform
Der Rektor trat, zum Abendbrot,
bekümmert in den Saal.
Der Klassenbruder Kern sei tot.
Das war das erste Mal.
Wir saßen bis zur Nacht im Park
und dachten lange nach.
Kurt Kern, gefallen bei Langemarck,
saß zwischen uns und sprach.
Dann lasen wir wieder Daudet und Vergil
und wurden zu Ostern versetzt.
Dann sagte man uns, dass Heimbold fiel.
Und Rochlitz sei schwer verletzt.
Herr Rektor Jobst war Theolog
für Gott und Vaterland.
Und jedem, der in den Weltkrieg zog,
gab er zuvor die Hand.
Kerns Mutter machte ihm Besuch.
Sie ging vor Kummer krumm.
Und weinte in ihr Taschentuch
vorm Lehrerkollegium.
Der Rochlitz starb im Lazarett.
Und wir begruben ihn dann.
Im Klassenzimmer hing ein Brett,
mit den Namen der Toten daran.
Wir saßen oft im Park am Zaun.
Nie wurde mehr gespaßt.
Inzwischen fiel der kleine Braun.
Und Koßmann wurde vergast.
Der Rektor dankte Gott pro Sieg.
Die Lehrer trieben Latein.
Wir hatten Angst vor diesem Krieg.
Und dann zog man uns ein.
Wir hatten Angst. Und hofften gar,
es spräche einer halt!
Wir waren damals achtzehn Jahr,
und das ist nicht sehr alt.
Wir dachten an Rochlitz, Braun und Kern.
Der Rektor wünschte uns Glück.
Und blieb mit Gott und den andern Herrn
gefasst in der Heimat zurück.
Sergeant Waurich
Das ist nun ein Dutzend Jahre her,
da war er unser Sergeant.
Wir lernten bei ihm: »Präsentiert das Gewehr!«
Wenn einer umfiel, lachte er
und spuckte vor ihm in den Sand.
»Die Knie beugt!«, war sein liebster Satz.
Den schrie er gleich zweihundertmal.
Da standen wir dann auf dem öden Platz
und beugten die Knie wie die Goliaths
und lernten den Hass pauschal.
Und wer schon auf allen vieren kroch,
dem riss er die Jacke auf
und brüllte: »Du Luder frierst ja noch!«
Und weiter ging’s. Man machte doch
in Jugend Ausverkauf …
Er hat mich zum Spaß durch den Sand gehetzt
und hinterher lauernd gefragt:
»Wenn du nun meinen Revolver hättst –
brächtst du mich um, gleich hier und gleich jetzt?«
Da hab ich »Ja« gesagt.
Wer ihn gekannt hat, vergisst ihn nie.
Den legt man sich auf Eis!
Er war ein Tier. Und er spie und schrie.
Und Sergeant Waurich hieß das Vieh,
damit es jeder weiß.
Der Mann hat mir das Herz versaut.
Das wird ihm nie verziehn.
Es sticht und schmerzt und hämmert laut.
Und wenn mir nachts vorm Schlafen graut,
dann denke ich an ihn.
Fort Douaumont, zwölf Jahre später
Es stand bei uns schon fest, bevor wir nach Paris fuhren, in Verbindung mit dieser Reise die Schlachtfelder aufzusuchen. Auf der Hinfahrt (durch Belgien, an Lüttich und Namur vorbei) war nichts allzu Auffälliges zu sehen. Erst in der Nähe von Paris, so bei St. Quentin, erblickten wir zerschossene Kirchen, zertrümmerte Häuser, Bäume ohne Wipfel und hier und da einen Bodenstreifen, der ein ausgefüllter Schützengraben sein konnte. Landschaft und Gebäude waren großenteils schon wieder »repariert«.
Auf der Rückfahrt von Paris schlugen wir eine andere Richtung ein. Wir reisten durch die Champagne, nach den Argonnen, und verließen den Zug in Verdun. Hatte schon die Fahrt bis zu dieser jahrelang umkämpften Festung einen viel tieferen Eindruck hinterlassen als die Tour durch Nordfrankreich, so stand uns jetzt ein Anblick bevor, den wir jedem wünschen, der gesonnen ist, den Krieg leichtfertig als eine unvermeidliche Laune der Geschichte hinzustellen, und dessen Erinnerungsvermögen nicht ausgereicht hat, vier Jahre unmenschlichen Mordens im Kopfe zu behalten. Stundenlang kann man hier im Umkreise fahren, und überall sieht es – soweit die Natur nicht mildernd eingreift – noch so aus wie in den Tagen, als Douaumont fiel. Die Bühne blieb erhalten, auf der das scheußliche Welttheater stattfand. Sie blieb so erhalten, wie man Wälder mit seltenen Tieren und Pflanzen erhält. Die Landschaft um Verdun kann, im Gegensatz zu diesen Naturschutzparken, ein »Kulturschutzpark« genannt werden. Die Schuljugend der ganzen Welt sollte man – wie früher uns in »Wilhelm Tell« – hierherführen, dass sie diese meilenweit von Granaten umgepflügte Erde sähe; die unabsehbaren Gräberreihen mit den dünnen, monotonen Holzkreuzchen; die Laufgräben und Sappen, in denen Kulturmenschen wie Wilde gekrochen sind; und nicht zuletzt die Sorte von Besuchern, die sich, in allen möglichen Stellungen, Arm in Arm wie Hochzeitspärchen, vor den Trümmern von Panzertürmen und an Stacheldraht und spanische Reiter gelehnt, photographieren lassen.
Am tiefsten erschraken wir – obwohl es wahrhaftig Schrecklicheres zu sehen gab –, als auf unserer Fahrt der Wagen das eine Mal anhielt, der Chauffeur sich umwandte, auf Gesträuch, Löwenzahn und Gestrüpp wies und erklärend hinzufügte: »C’est Fleury.«
Das war das Dorf Fleury