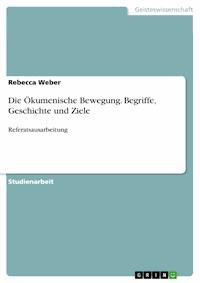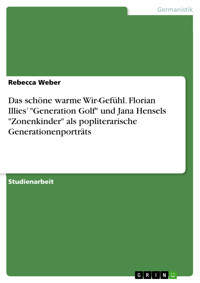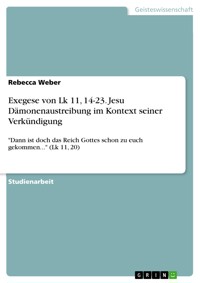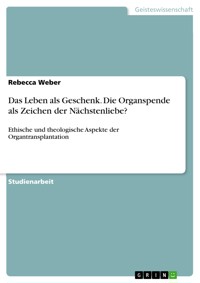
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Theologie - Praktische Theologie, Note: 1,0, Philipps-Universität Marburg (Katholisches Seminar), Sprache: Deutsch, Abstract: Die Fragestellung, unter der diese Arbeit zunächst stehen sollte, betraf die moralisch-ethische Legitimation der Organtransplantation, vor allem deren Beurteilung durch die christliche Ethik. Bei der Literaturrecherche und –aufbereitung zeigte sich jedoch recht schnell, dass sich weitaus mehr Problemfelder und ethische Fragen ergeben, als im Rahmen einer Seminararbeit behandelt werden können – eine Reduktion und Fokussierung auf einige zentrale Aspekte wird daher unumgänglich sein. So wird der Problemkreis der Lebendorganspende nur gestreift, ebenso die Frage nach Zustimmungslösungen, die in den vergangenen Monaten für neuen Zündstoff in der Debatte über mangelnde Spendebereitschaft und fehlende Spenderorgane gesorgt hat. Einen größeren Stellenwert wird hingegen die postmortale Organtransplantation einnehmen, wobei es sich durch die verschiedenen beteiligten Personen- und Interessengruppen ebenfalls um ein komplexes und vielschichtiges Thema handelt. Um die Thematik angemessen darzustellen, sollen zumindest grundlegende Fakten und aktuelle Daten zum Stand der modernen Transplantationsmedizin erwähnt werden, um einen Eindruck über Chancen und Möglichkeiten operativer Verfahren in diesem Bereich zu schaffen. Da die vorliegende Arbeit das Thema Organtransplantation vor allem aus ethischer bzw. christlich-religiöser Perspektive betrachtet, wird der medizinische sowie der rechtliche Hintergrund einbezogen, sofern er wesentliche Aspekte betrifft, die bei der Behandlung der Organspende-Problematik unbedingt berücksichtigt werden müssen. Vor allem das so genannte „Hirntod-Kriterium“ hat nicht nur medizinisch-rechtliche Konsequenzen, sondern berührt das Verständnis von Menschsein, von Leben und Tod und damit von ganz existenziellen Grundkonstanten im menschlichen Bewusstsein, die mit den Entwicklungen der modernen Medizin ins Wanken geraten sind. Im abschließenden Ausblick sollen neben einem Resümee aktuelle Entwicklungen in der Transplantationsmedizin erwähnt werden, die in der Zukunft – die bei der Geschwindigkeit der heutigen Wissenschaft immer schon in der Gegenwart beginnt – für weitere ethische Diskussionen sorgen werden und auch von den christlichen Kirchen eine Positionierung verlangen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt bei www.grin.com hochladen und weltweit publizieren.
Inhalt
1) Einleitung
2. ) Daten und Fakten zur modernen Transplantationsmedizin
2.1. ) Exkurs: Die Lebendspende - medizinische und ethische Aspekte
2.2.) Das Transplantationsgesetz - mehr Rechtssicherheit, aber nicht mehr Organe?
3. ) Wann ist ein Mensch tot? Todeskonzeptionen im Wandel
4. ) Die Kirchen und ihre Stellung zur Organtransplantation
4.1. ) Was ist der Mensch? Leben und Tod aus der Perspektive christlicher Anthropologie
5. ) Ethische Problemfelder im Bereich der postmortalen Organtransplantation
5.1. ) Die Würde des Menschen - gültig über den Tod hinaus?
5.2. ) Zwischen Pflicht und Freiwilligkeit
5.3. ) Die Angehörigen des Spenders - Verlustbewältigung und Entscheidungskonflikt
6. ) Weitere Problemfelder
7. ) Resümee und Ausblick Die Transplantationsmedizin vor neuen Herausforderungen
8. ) Verwendete Literatur
1) Einleitung
Die Fragestellung, unter der diese Arbeit zunächst stehen sollte, betraf die moralisch-ethische Legitimation der Organtransplantation, vor allem deren Beurteilung durch die christliche Ethik. Bei der Literaturrecherche und -aufbereitung zeigte sich jedoch recht schnell, dass sich weitaus mehr Problemfelder und ethische Fragen ergeben, als im Rahmen einer Seminararbeit behandelt werden können - eine Reduktion und Fokussierung auf einige zentrale Aspekte wird daher unumgänglich sein. So wird der Problemkreis der Lebendorganspende nur gestreift, ebenso die Frage nach Zustimmungslösungen, die in den vergangenen Monaten für neuen Zündstoff in der Debatte über mangelnde Spendebereitschaft und fehlende Spenderorgane gesorgt hat. Einen größeren Stellenwert wird hingegen die postmortale Organtransplantation einnehmen, wobei es sich durch die verschiedenen beteiligten Personen- und Interessengruppen ebenfalls um ein komplexes und vielschichtiges Thema handelt.
Um die Thematik angemessen darzustellen, sollen zumindest grundlegende Fakten und aktuelle Daten zum Stand der modernen Transplantationsmedizin erwähnt werden, um einen Eindruck über Chancen und Möglichkeiten operativer Verfahren in diesem Bereich zu schaffen. Da die vorliegende Arbeit das Thema Organtransplantation vor allem aus ethischer bzw. christlich-religiöser Perspektive betrachtet, wird der medizinische sowie der rechtliche Hintergrund einbezogen, sofern er wesentliche Aspekte betrifft, die bei der Behandlung der Organspende-Problematik unbedingt berücksichtig werden müssen. Vor allem das so genannte „Hirntod-Kriterium“ hat nicht nur medizinisch-rechtliche Konsequenzen, sondern berührt das Verständnis von Menschsein, von Leben und Tod und damit von ganz existenziellen Grundkonstanten im menschlichen Bewusstsein, die mit den Entwicklungen der modernen Medizin ins Wanken geraten sind.
Sehr beeindruckt hat mich die „medizinethnologische Studie“ - so der Untertitel - von Vera Kalitzkus aus dem Jahr 2003[1], die die Autorin mit dem bezeichnenden Titel „Leben durch den Tod“ veröffentlicht hat. In dieser Untersuchung stellt Kalitzkus nicht nur interessante Überlegungen zu divergierenden „Todeskonzepten“ in Geschichte und Gegenwart an, sondern hat den Kontakt zu den „beiden Seiten“ der Organtransplantation gesucht. Interviews mit Angehörigen von Organspendern sowie mit Organempfängern werfen Licht und Schatten auf die Problematik und werden in meiner Arbeit an einigen Stellen aufgegriffen. Nicht zu leugnen ist die emotionale Ebene, auf die man selbst als momentan nicht Betroffener bei derBeschäftigung mit dem Thema Transplantation leicht gerät; immerhin handelt es sich hierbei um ganz existenzielle Fragestellungen und Problemfelder, an deren Ende Einzelschicksale stehen und Lebensgeschichten stehen. Dies zu berücksichtigen soll nicht zu „blinder“ Subjektivität führen - das tut es meines Erachtens auch bei Vera Kalitzkus nicht - dennoch ist die „persönliche Seite“, die Frage nach dem konkreten Menschen, nicht zu vernachlässigen, wenn versucht werden soll, aus moraltheologischer bzw. christlicher Perspektive die Problematik der Organtransplantation zu beleuchten.
Im abschließenden Ausblick sollen neben einem Resümee aktuelle Entwicklungen in der Transplantationsmedizin erwähnt werden, die in der Zukunft - die bei der Geschwindigkeit der heutigen Wissenschaft immer schon in der Gegenwart beginnt - für weitere ethische Diskussionen sorgen werden und auch von den christlichen Kirchen eine Positionierung verlangen.