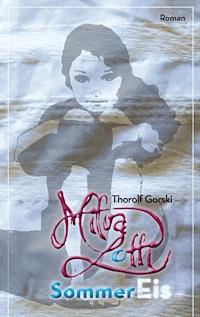Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
»Wer unter Strom steht, legt entweder einen Kavalierstart hin oder braucht eben länger. Ich nehme an, du wirst noch ein, zwei Wochen benötigen, um auf die richtige Formel und auf den Sinn zu kommen.« Sie öffnete ihre Augen wieder und härtete ihren Panzer von innen. Dabei sah sie auf den Boden und erwiderte betrübt: »Vielleicht auch ein Leben lang.« (...) Warum haben wir von innen gehärtete Panzer? Sind wir überhaupt noch am Leben? Wissen wir, wer wir sind und wie wir unsere Entscheidungen treffen sollen? Manchmal verlieren wir die Orientierung, ganz ohne es zu wollen. Da kommt die Frage auf: Ist das Leben eigentlich schön? Auf dieser Lesereise an ganz unterschiedliche Schauplätze lehrt das Buch ein Prinzip der Selbstfindung. Zücken Sie einen Stift und begeben Sie sich auf den Weg zu Ihrer Mitte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 241
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Frau D.
&
Keanu Semih
Inhaltsverzeichnis
1 Meine Welt
2 Das Seil zwischen Himmel und Erde
3 Der gelbe Junge und der Himmelsschlüssel
4 Gestohlene Zeit
5 Das Labyrinth
6 Schiss und Mumm
7 Das N-Modell
8 Das Gefuhl von Unsicherheit
9 Durch die Hintertür
10 Schwester Lills Werkzeugkittel
11 Rabenvogel
12 Fabeln
13 Der Plan
14 Dolores
15 Fussel
16 Pigus Gerbera
17 Wie ein getrockneter Schmetterling
Die letzte Aufgabe…
…ist deine eigene Geschichte
Mehr zum Lesen?
Es geht um dich
In Kurzgeschichten einzutauchen kann sehr viel Spaß machen. Es ist ein wenig so, wie in Fernsehprogramme hineinzuzappen. Genau so sind die Geschichten, die uns das Leben zuwirft.
Kurzgeschichten sind deshalb so besonders, weil wir in sie hineingeworfen werden und dann wieder herauskatapultieren. Am Ende einer jeden Geschichte stellt sich uns dann die Frage: Was hat das mit mir zu tun? Ich stelle dir dieselbe Frage.
Die Antwort darauf lautet: sehr viel! Denn du hast sie gelesen und wirst die gewonnenen Bilder mit eigenen Erfahrungen, Wünschen, Zuneigungen und Abneigungen abgleichen. Genau dort, wo wir uns von einer Geschichte trennen, kann die eigene beginnen.
Dieses Buch gibt dir anhand von Kurzgeschichten, Märchen und Fabeln die Möglichkeit in dich zu gehen und aufrichtig zu sein. Alles, was du dazu benötigst, sind die eigenen Gedanken und ein Stift. Schreibe deine Gedanken auf, sodass sie nicht wieder verloren gehen. Solltest du dich für die eBook-Version entschieden haben, beachte bitte: Zettel und Stift sollten griffbereit liegen. Bitte schreib nicht auf deinen eBook-Reader. Das funktioniert nicht.
Ich wünsche dir viel Freude dabei, dich in diesen Geschichten selbst zu entdecken. Trage deinen Namen ein und los geht‘s.
Dein Name
1 Meine Welt
An den Ort seiner Kindheit zurückzukehren kann von unsagbar viel, aber auch von ungehörig wenig Bedeutung sein. Je nachdem.
Die meisten gehen zu einem Zeitpunkt ihres Lebens dorthin zurück, an dem es ihnen nicht besonders gut geht, andere aus Gewohnheit. Von Letzteren aber reden wir nicht.
Wir sprechen von jenen, die - mal sehr, mal nicht so sehr - betonen, sie hätten eine schlechte Kindheit gehabt.
Durchgängig? Das fällt mir schwer zu glauben – unwahrscheinlich …
Mich beschleicht zuweilen der Eindruck, vielen jener Menschen fehlt die Fähigkeit, den guten Teil zu sehen oder ihn, wenn sie ihn erblicken, zu ertragen. Das mag viele Gründe haben: bei einigen scheint er tatsächlich in Vergessenheit geraten zu sein, bei anderen wiegt der negativ belegte Part so schwer, dass sie ihn eigenhändig verwischt haben, um sich zurechtzufinden.
In jedem Fall jedoch gilt eine Gesetzmäßigkeit: Kehrt man zurück, kommt man vom Wunschort des Erwachsenseins zurück zum Ort der Wünsche; dem Quell von Vertrautheit – guter oder schlechter.
Um so jemanden, der sich nur dunkel erinnern mag, soll es gehen: meinen Freund Daniel.
Den größten Teil seiner Vergangenheit verbirgt er in nächtlicher Unruhe und undurchdringlichen Verhaltensmustern. Er hält ihn stets gut verhüllt.
Die Art Heilung, die ich diesem Ort, dem Ursprung von Fantasie und Leichtigkeit von Natur aus zuspreche, vermutet er, sei nicht existent. Er ist trotzdem sichtlich auf der Suche danach, doch zurückzugehen kommt für ihn nicht in Frage. Was er dort gelernt hat ist, sich fern zu halten.
Aus Mitleid habe ich beschlossen, etwas mit ihm zu teilen. Ich möchte ihm die Möglichkeit geben, wenigstens eine schöne Erinnerung in sich zu schaffen, die mit dem Wort „Kindheit“ in Verbindung steht. So bringe ich ihn an den Ort meiner Kindheit, einem weitläufigen Waldgebiet an der schwedischen Westküste.
Der Wald ist still und schön. Das Moos leuchtet grün unter den hohen Fichtenstämmen, die sich aufgestellt haben wie stumme Wächter meiner Kinderträume. Ein Eichelhäher begrüßt mich aus den Wipfeln.
Daniel staunt über die kühne Wildheit dieses Ortes. Ich stelle fest, dass mein Freund gut hier hinein passt. Er ist selbst sehr kühn und wild, wirkt jetzt wie ein großes Tier. Seine breiten Schultern hängen ein wenig, seine Bewegungen sind behäbig, doch seine Augen sind groß. Er staunt mit glimmernden Blicken, bläht seine Nüstern und lobt die Freiheit, die er riecht. Er wird so still wie der Wald, scheint die angenehme, unvergängliche Feuchtigkeit wie vertrocknetes Moos in sich aufzusaugen, und bekommt ein seltenes Leuchten im Blick, als wir über Steinwälle hinweg und an Pilzfelder vorüber ziehen.
Es scheint Daniel hier sichtlich zu gefallen. Andächtig berührt er die Granitbuckel, die um uns aus der Erde steigen wie die Rücken einer Walschule. Er wirkt selig.
Wir nehmen den Weg hinunter zum Strand. Ich muss nicht lange überlegen, welche Richtung wir einschlagen. Trotzdem wundere ich mich. Einige Stellen des Waldes erkenne ich nicht wieder. Er wurde aufgeforstet. Der ausgezogene Wald befremdet mich, trotzdem finde ich meinen Weg entlang der alten Pfade.
Auf einmal allerdings kommen wir an eine Kreuzung, die ich nicht kenne. Da ist ein Weg, wo keiner war, ein anderer ist verschwunden. Es wachsen engmaschige Jungfichten darauf. Schon seltsam, wenn man gezwungen ist zum Landschaftsarchitekten seiner Erinnerungen zu werden.
An diesem Ort wurden meine Ideen geboren. Hier hat meine Fantasie ihren Lebensfunken erhalten. Ich glaube, er wird auch in Daniel entzündet werden können. Seine breiten Schultern hängen nicht mehr so, seitdem wir hier sind. Ich freue mich darüber.
Unser Weg führt aus dem Wald heraus, einen Abhang hinab, an dem junge Birken einander gegenseitig in die Höhe treiben. Der Himmel über uns wird weit, als wir an den verschlafenen Muschelstrand kommen. Ich kann nicht sagen, welche Jahreszeit wir haben. Vielleicht Herbst, vielleicht auch Frühling.
Das Wasser ist klar, die dunklen Küstenfelsen sehen gewaltig aus, und ungastlich.
Mein Freund sammelt ein paar Reste von Meeresbewohnern auf, lässt seine Finger über weißen Quarz und rohen Bergkristall gleiten. Er steckt ein paar davon in seine Jackentasche. Dann möchte er noch mehr sehen. Ich nicke und fordere ihn auf, mir zu folgen.
Muschelschalen krachen wie Eiskrusten unter unseren Gummistiefeln. Daniel geht aufrecht. Er sieht ruhig und zufrieden aus. Sein Blick wirkt aufmerksam und durstig.
Ich nehme mir vor, die Königsdisziplin mit ihm zu vollführen: den Granitfelsen zu besteigen. Dazu müssen wir ein Stück am Sund entlang, über weit reichende Rudel von Findlingen und nacktes Gestein. Später dann - an einer geeigneten Stelle, an die ich mich gut erinnere - wird der Fels wegsamer sein, um ihn nach oben zu führen.
Ich springe in sicherer Schrittfolge über das kalte Geröll. Rechts eine raue, steile Granitwand und ein schwarzes Bootshaus, links das Wasser, aus denen uralte Muschelbänke zu mir heraufwinken.
Als ich mich herumdrehe, sehe ich, dass ich einen beachtlichen Vorsprung habe. Ich bleibe stehen und warte.
Während ich ein paar Seeschnecken von den Steinen pflücke und sie ins Wasser kullern lasse, sehe ich Daniel zu. Er steigt vorsichtig von Stein zu Stein, lässt seine Füße tasten und die Sicherheit seines nächsten Schrittes testen. Er verlagert sein Gewicht nur zögerlich.
Sonst hat er einen festen Schritt, ist kühn und tapfer, manchmal überheblich. Er geht seine Wege sonst schneller und findet sich leicht zurecht, aber auf diesen Felsbrocken erscheint er mir hilflos, irgendwie unsicher. Mein Freund wirkt fremd auf mich.
Als er mich einholt, springe ich langsamer voran, warte seine Schritte ab, und ich hoffe, dass er sie mir nachmacht, denn sie sind erprobt.
Er folgt, jedoch weiter auf seine Art: tastend.
Ungeduld regt sich in mir.
Dann erreichen wir die Felswand – dort wo sie wegsamer ist. Ich greife nach jungen Bäumen, die mir verwurzelt genug erscheinen, dass sie mir kurz als Zug dienen können. Zum Auftreten sind Felskanten und Moosigel gut geeignet. Wie eine Gams schlage ich drei Haken auf dem Felsen und warte oben auf meinen Freund.
Er klettert unbeholfen, sein Gewicht nachschulternd, zögerlich - wie gehabt. Er rutscht sogar weg, greift nach einem kleinen Zweig, der ihn nicht halten kann, und ruft meinen Namen. Wieder zieht Ungeduld in mir auf - schließlich habe ich es ihm vorgemacht. Ich spiele mit einer Anleitung, wie er seine Füße zu setzen hat auf meiner Zunge, wie mit einer Zuckerperle. Daniel ist sonst kräftig und unverwüstlich wie eine Wildblume. In diesem Teil der Kulisse meiner Kindheit wirkt er jedoch schwerfällig und seltsam zerbrechlich.
Ich sage ihm nicht wie er aufzusteigen hat, gehe stattdessen ein Stück zurück und reiche ihm meine Hand, damit er sich nicht wieder auf den falschen jungen Baum verlässt. Er ist außer Atem, sieht mich verlegen an und macht sich daran, vor mir weiter zu klettern.
Jetzt sehe ich seine Schritte noch genauer. Er steigt nachfassend auf, stützt sich auf die Außenkante seiner Füße und schleppt sein Gewicht förmlich von Moosballen zu Moosballen. Stets droht er nach hinten zu fallen. Breiten Baumwurzeln, die am Felsen ragen, scheint er nicht zu trauen. Wenn er sein volles Körpergewicht einsetzte, sich auf seine Zehenspitzen verließe, tastete er flink und effizient, könnte sich bei Fehltritten schneller abstoßen, einen Satz zur Seite machen. Normalerweise lernt er nicht so langsam. Ich frage mich, ob er in diesem Moment überhaupt lernt.
Als wir endlich das Ziel erreichen, stößt er einen staunenden Laut aus. Er sieht über den Sund, lässt seinen Blick an den Silhouetten des fernen Festlandes entlang hangeln. Jetzt, da er wie ein König über mein Land blickt, schwillt seine Brust. Eigentlich ein Anzeichen für das, was ich mir für ihn wünsche. Seine Haltung jedoch kehrt sich plötzlich. Er wirkt, als falle er in sich zusammen, und als halte er seine Größe nur mühsam aufrecht. Er sagt, hier lerne man, was Weitblick sei, und dass er jetzt erst sehen würde, wie groß die Welt sein kann. Er sagt es, als fühle er sich klein. Ich denke über seine Worte nach und muss gestehen, gerade erst zu erkennen, dass ich selbst sehr kurzsichtig bin. Daniel kann hier keine Heilung erfahren. Er kann bestenfalls für einen Moment frei atmen.
Ich komme mir schäbig vor, ihm auf diese Weise den Unterschied zwischen uns aufgezeigt zu haben. Wir bewegen uns seit jeher auf unterschiedliche Weise. Das wird auch sein Besuch in meinem Land nicht ändern.
Im Gegensatz zu ihm vertraue ich meinen Schritten, und verlasse mich auf die ausgesuchten Stellen, auf die ich meine Füße setze. Ich nutze mein volles Gewicht. Mein Freund aber wird auch in Zukunft zaudern und sich mit Vorsicht bewegen. Ich hatte gehofft, dieser Ort könne ihm dies nehmen, doch es wird eigentlich nur noch verstärkt, denn er wirkt ehrfurchtsvoll und eingeschüchtert. Es gereicht ihm nicht zum Schaden. Aber ich komme mir vor wie ein Angeber.
Meine Welt scheint bedrohlich, unwegsam und nicht fassbar für ihn zu sein.
Darin liegt die Ironie verborgen, denn hier habe ich gelernt, dass die Welt mich tragen kann.
Diese Geschichte setzt sich mit dem Gefühl von Heimat und Geborgensein, dass sich in der Persönlichkeit des Menschen äußert, auseinander. Vor allem aber mit der Erkenntnis, dass jeder seine eigene „Heimat“ finden muss, die Auseinandersetzung mit seiner Herkunft und seiner Kindheit, mit den Dingen eben, die ihn geprägt haben.
Wo ist deine Heimat?
Schreibe auf woher du kommst.
Wie war es dort?
Was ist deine lebhafteste Erinnerung daran? Was hat dich geprägt? Was hast du aus deiner Kindheit mitgenommen, das du heute noch tust?
Formuliere kurz drei Dinge, die dich geprägt haben.
Zuletzt beantworte dir die folgende Frage:
Kann meine Welt mich tragen ?
2 Das Seil zwischen Himmel und Erde
Ein schriller Ton reißt mich aus dem Schlaf.
Meine Alarmanlage. Mitten in der Nacht ist die Sirene lauter als beim Test im Baumarkt.
Markerschüttert werfe ich meine Bettdecke von mir. Noch bevor ich senkrecht im Bett stehe, schlägt mein Puls bis zu den heruntergelassenen Jalousien. Für Kreislaufprobleme hab ich keine Zeit. Gestatten, mein Name ist Horst Seehagel. Ich habe es eilig, denn meine Alarmanlage schreit mein Haus zusammen. Das Licht mache ich wohl besser nicht an. Wer weiß, wer soeben um mein Haus herum schleicht.
Ich versuche ein Geräusch in meinem Haus zu orten, das sich von dem der Alarmanlage unterscheidet, um herauszufinden wo sich die Täter befinden. Mein Kreuzhackenstiel lehnt neben meinem Bett am Heizkörper. Ich packe ihn und ziehe ihn schlagbereit an meinen Oberkörper heran.
Diese Halunken! Dachte ich es mir doch, dass sie eines Tages bei mir zuschlagen würden. Solange sie keine Schusswaffen bei sich tragen, haben sie sich jedoch den falschen Hausbesitzer für einen Einbruch ausgesucht. Aber wer außer einem Förster trägt auf dem Land schon eine Waffe?
Da! Ein Schaben und ein darauf folgender Knall an der Hauswand. Sie haben den Besen umgeworfen, der an der Hauswand lehnte. Gleich bei meinem Garten.
Ach so! Zur Terrassentür wollen sie hereinkommen. Na, dann mal rein in die gute Stube!
Ich bin stinksauer und mehr als wach.
Das Adrenalin verwandelt meine Augen in Katzenaugen. Ich kenne mich gut aus in meinem Haus und sehe jetzt gestochen scharf im Dunkeln.
Ein Trappeln und Stolpern lässt sich vernehmen, begleitet von einem Grunzgeräusch oder einem Stöhnen.
Abgeschmiert würde ich sagen. Ich weiß schon, warum ich Löcher in den Garten gegraben habe.
Mittlerweile bin ich über den Flur hinunter ins Wohnzimmer gefegt. Zwar humple ich ein wenig seit meiner Kindheit, aber ich bin doch noch recht flink und vor allem großschrittig.
Wenn ich sie erwische, werden sie es nicht besonders leicht haben. Den Geräuschen nach zu urteilen sind es vier oder maximal fünf. Sie sind noch im Garten. Ich sehe einige Schatten über meine Beete huschen. Bio-Kartoffeln. Ich habe Bio-Kartoffeln angepflanzt, die gerade zertreten werden, wie es aussieht. Mit Stress auf der Stirn schalte ich meine Außenstrahler ein. Sie werden erschrecken und sich herumdrehen. Bis sich ihre Augen ans Licht gewöhnt haben, wissen sie, warum mich die Kinder in der Schule immer »Wildsau« genannt haben. Bis dann bin ich längst mit ihnen fertig!
Ohne zu schreien stürze ich auf die Terrasse hinaus, damit sie mich nicht orten konnten. Es sind insgesamt sieben Gestalten, die ich schemenhaft, aber zusammengestellt wie eine Traube vor mir im grellen Licht der Strahler ausmachen kann. Zwei Schatten huschen zu den Seiten weg. Sie verschwinden beim Gartentor, ein weiterer schießt durch den Knick.
Wildes Schnaufen fliegt im Garten umher, gefolgt von einem Angstschrei, als ich um die Ecke gestoben komme. Waffen haben sie keine. Zumindest keine Schusswaffen. Ich bleibe wie angewurzelt stehen und atme überrascht aus.
Vor 38 Jahren, ich war gerade elf geworden, zog meine Mutter mit mir von Bad Malente in der Holsteinischen Schweiz in ein anderes Dorf. Es war weit weg von meinem Zuhause am Kellersee. Wir zogen in ein regelrechtes Kaff mit grauen Häusern irgendwo in Dithmarschen. Wald gab es dort keinen und einen See schon mal gar nicht – bloß eine Landschaft, die sich deutlich von meinem Zuhause unterschied. Flacher Boden, so weit das Auge reichte, und gleich darüber fing der Himmel an. Auf dem Horizont tänzelten ein paar Schafe herum, wie Seiltänzer. Aus der Nähe habe ich, bis auf ein Versehen, nie welche gesehen in Dithmarschen, ausschließlich am Horizont.
Nur widerwillig ging ich in die Marner Schule und stellte mich der Klasse vor. Ich war größer und schlaksiger als die kleinen spackigen Kohlköpfe. Lieber Fischkopf als Kohlkopf, sagte meine Mutter immer. Warum sie mich trotzdem zwang, dort hin zu ziehen, weiß ich nicht. Die Ditschies, wie ich sie nannte, waren regelrechte Zwerge mit fiesen Gesichtern und schlichen in der Pause um mich herum, als wäre ich der Troll, der ihnen einen Schatz – wahrscheinlich einen Wintervorrat an Spitzkohl – strittig machen wollte. Sie zischten mich von der Seite an. Manchmal stahlen sie mir mein Pausenbrot aus der Schultasche. Das machten sie jedoch genau so lange, bis ich eine aufgespannte Mausefalle in meiner Schultasche platzierte und so herausfand, wer sich an meinem Ranzen zu schaffen machte.
Ein rot gelocktes, burschikoses Mädchen mit Sommersprossen und funkelnden Augen, die jederzeit einen Plan zu schmieden schienen, trug eine böse Quetschung davon, alle lachten sie aus und ich bekam einen Tadel. Unbeeindruckt verbrachte ich die Pausen mit sturem Blick auf die Schulglocke, den Unterricht mit eisernem Blick an die Tafel.
Freunde fand ich keine, also zog ich in den großen Ferien allein los, um das Ende des Horizontes zu erkunden. Ich kletterte nachmittags über Zäune und Drainagegräben, stiefelte über Salzwiesen und Kohläcker und so ging der erste Sommer in Dithmarschen an mir vorüber, wie in Trance.
Eines Tages, kurz bevor die Schule wieder beginnen sollte, nahm ich mir dann vor, ein Schaf aus der Nähe zu sehen. Ich lief an diesem Tag weiter, als ich den gesamten Sommer gelaufen war, und fand schließlich auch eines. Allerdings musste es sich verlaufen haben, denn sobald es bemerkte, dass ich auf es zuging, rannte es wie der Blitz vor mir davon. Ich lief so schnell ich konnte, doch es war schneller als ich. Es sprang wie mit einem Satz zum Horizont, und reihte sich neben die anderen Schafen auf das Seil zwischen Himmel und Erde.
Als ich mich resigniert herumdrehte, um nach Hause zu gehen, sah ich hinter mir eine Horde Dithmarscher Schulzwerge. Sie mussten hinter mir her gelaufen sein, wie ein Spähtrupp. Jetzt, da ich sie ansah, blieben sie abrupt stehen und begannen zischend zu tuscheln.
»Guckt mal, die Malente-Ente jagt ein Schaf!«, brüllte einer mit einer Stimme so schrill wie Kreide, die auf Schiefer entlang gezogen wird.
In ihrer Mitte stand die Sommersprossendiebin und zeigte mir ihren neuerdings krummen Mittelfinger mit den spitz gefeilten Fingernägeln. Sie waren schmutzig und sahen aus wie giftige Krallen.
Ich reagierte nicht auf den Satz des einen Zwerges und beschloss, in einem Bogen um sie herum zu gehen. Sie gingen jedoch rückwärts vor mir her und zischten weiter irgendwelches Zeug. Ich vergrößerte meine Schritte und schaffte es bald, mit ihnen auf selber Höhe über die Salzwiese zu laufen.
Kaum, dass ich ihnen dann den Rücken zuwenden konnte, weil mein Schritt es mir erlaubte, schneller zu laufen als sie, begann die Kreidestimme erneut zu schrillen: »Malente-Ente redet nicht mit uns!«
»Genau!«, dröhnte ein anderer. »Er fühlt sich, weil er größer ist als wir und weil seine Mutter eine Lehrerin ist!«
»Sie ist eine Schlampe, hat meine Mutter gesagt!«
»Ja, meine auch! Malente-Ente ist der Sohn einer Schlampe.« Ich lief schnaufend vor ihnen her und scherte mich nicht um die Dreckszwerge. Mit der Zeit wurden meine Beine jedoch müde und ich verlangsamte meinen Schritt.
Die Zwerge zischten noch immer wildes Zeug in meinem Rücken und holten ein Stückchen auf. In einiger Entfernung tauchte das Gatter auf, durch das ich auf diese Koppel gekommen war und ich lief weiter darauf zu.
Eines will ich zum Dithmarscher Zwergenvolk sagen: Man darf sie keinesfalls unterschätzen. Selbst wenn sie trippeln, sind sie schneller, als man erwartet, denn einer von ihnen brüllte mir plötzlich von hinten ins Ohr: »Deine Mutter ist `ne Schlampe, weil sie nicht verheiratet ist und trotzdem ein Kind hat!«
»Ein Kind? Seht ihn euch an, er ist viel zu groß«, kreischte jemand links hinter mir, ebenso unerwartet nah. »Er ist `ne Missgeburt!«
»Schlampen-Missgeburt!«, sangen sie im Chor und amüsierten sich auf meine Kosten.
Plötzlich traf mich ein Stein im Rücken. Kein großer, aber es schmerzte. Ich lief weiter auf das Gatter zu. Ein Stock piekste mich von hinten, während alle lachten. Vielleicht kam es daher, dass ich mich nicht auf ihr Kriegsangebot einließ, aber sie schienen es mir übel zu nehmen und trippelten noch näher an mich heran.
Dann trafen mich weitere Stockspitzen an den Armen und schmerzhafte Tritte von metallen erscheinenden Zwergenfüßen in den Hintern. Etwa zwanzig Meter vor dem Gatter reichte es mir dann. Meine Wut kochte hoch und schäumte über. Entschlossen drehte ich mich herum, packte zwei der zappelnden Schrumpfgermanen am Kragen und schlug ihre Köpfe zusammen. Während sie nach ihren wachsenden Beulen tasteten, rannte ich zwei weitere mit den Schultern um.
Die letzten drei der sieben Zwerge flohen kreischend vor mir und schwärmten aus. »Er ist ne Wildsau! Eine Wildsau!», gellten sie und feuerten mich dadurch im Grunde bloß an.
Denn während sich Sommersprosse mit dem krummen Finger immer weiter in Richtung Horizont entfernte und dabei am lautesten von allen schimpfte wie ein Rohrspatz, schoss ich wie ein Jagdhund über die Wiese und griff mir die verbliebenen Zwei. Ich schleuderte die beide Schreihälse durch die Luft, sodass sie ächzend auf dem harten Salzboden aufkamen, der eine mit dem Gesicht zuerst in einem Haufen Schafscheiße und der andere woanders.
Sommersprosse war weit weg gerannt und außer Gefahr.
Ihr Glück!, dachte ich bei mir und stapfte wutschnaubend durch mein Schlachtfeld, wieder auf das Gatter zu.
Kurz bevor ich es erreichte und mich daran machte, darüber zu klettern, um die Wiese zu verlassen, durchzog mich ein Schreck und zeitgleich ein ziehender Schmerz in meinen Kniekehlen. Es folgte ein Fauchen und Sommersprosse zog mir ihre Giftkrallen durch den Stoff meines Hemdes. Sie bohrten sich tief in meinen Rücken. Ich verlor die Kontrolle über meine Beine, stolperte nach vorn und schlug mit dem Kinn auf das Stahlgatter. Sommersprosse sprang behände darüber hinweg und ließ mich auf meinem eigenen Schlachtfeld zurück. »Wildsau!«, schrie sie und verschwand im grauen Dorf.
Ich sagte es ja bereits: Sie sind klein und schauen verschlagen drein, aber sie sind schnell und keinesfalls zu unterschätzen! Seither konnte ich nicht mehr richtig gehen.
Die Kinder ließen mich nach diesem Sommer zwar in Ruhe aber den Namen »Wildsau« hatte ich seither auf jeden Fall weg! Dabei hatten sie sich wie wilde Schweine verhalten, bis ich zurückschlug. Na ja, ich fand »Wildsau« besser als »Malente-Ente», schlug mich fortan humpelnd durch und zog zurück an den Kellersee zurück, sobald ich alt genug war.
Meine Mutter habe ich seitdem nicht mehr bei ihr zu Hause besucht.
Das Gartentor ist aufgestoßen worden, dort sind die ersten zwei hin verschwunden, weitere rennen hinter ihnen her und verschwinden auf dem Fußweg, der von meinem Haus zum Kellersee führt. Einer von ihnen jedoch versucht durch die Eisenstäbe des Gartenzaunes zu schießen und verkeilt sich.
Vor mir sehe ich eine etwa 50 Kilo schwere Bache, die ihren Kopf vergeblich versucht, weiter durch die Eisengitter zu schieben. Sie schnauft und hat Angst.
Die anderen Wildschweine aus ihrer Rotte sind bereits auf und davon.
Ein Schmunzeln zieht mir die Anspannung aus dem Gesicht und lindert meine Aufregung. Schließlich lache ich erleichtert auf und überlege, wie ich dem armen Ding helfen kann. Ein Blick zu meinem Kreuzhackenstiel bringt mich auf eine Idee. Ich nutze ihn als Stemmeisen und helfe der Bache, ihren Kopf zu befreien.
Sie sieht kurz zu mir auf, bevor sie grunzend hinter den anderen durch das offene Gartentor rennt. Ich schüttle mit dem Kopf und rufe ihr hinterher: »Wir Wildsäue müssen doch zusammenhalten!«
SONNTAG 8.JUNI, MARNER RUNDSCHAU
Hier klemmt die Sau
Sieben Wildschweine wühlen den Bio-Garten durch. Ein Tier bleibt auf der Flucht im Zaun stecken.
MARNE - Achtung, schweinisch! Eine außergewöhnliche Bekanntschaft machte Horst Seehagel auf seinem Grundstück in Marne in Dithmarschen: Eine Rotte von sieben Wildschweinen zugleich hatte es in der Nacht zu Freitag auf der Futtersuche in seinem Garten verschlagen. Als der Hobby-Bio-Gärtner die vermeintlichen Raudis mit Flutlicht stellen wollte, flüchteten die Borstentiere vom Grundstück herunter. Dabei geriet eine etwa 50 Kilo schwere Bache mit ihrem keilförmigen Kopf zwischen den Stäben des eisernen Gartenzaunsein dickes Ding! Horst Seehagel blieb gelassen und befreite das Tier mit einem Kreuzhackenstiel als Stemmeisen. Angst, von der wilden Sau über den Haufen gerannt zu werden, hatte er nicht: »Ich habe auf dem Land gelebt«, winkt er ab. »Ich bin als Kind mit Wildschweinen groß geworden.«
Warst du auch schon einmal in einer beängstigenden Situation? Hast du vielleicht Angst gehabt vor Schatten, die du dir nicht erklären konntest? Ängste sind häufig sehr präsent. Der Grund: Sie wollen beachtet werden und das sollten wir. Wenn wir uns mit ihnen beschäftigen, sie verstehen wie einen Gast, dann können wir sie verarbeiten und bald auch wieder verabschieden.
Schreib auf, wann du einmal Angst gehabt hast und was du befürchtet hast.
Wovor hattest du Angst ?
Ist schon einmal Angst von dir abgefallen, weil du dir umsonst Sorgen gemacht hast?
Fassekurz zusammen, wie es für dich war, als die Angst einfach verpufft ist.
Wie war es, Angst loszulassen?
3 Der gelbe Junge und der Himmelsschlüssel
Es ging bereits auf die heiß ersehnten Abendstunden zu. Für Yuen war er kaum zu erwarten, weil ihre beiden Väter sie bereits am Nachmittag mit einem aufgerüschten Sommerkleid ausgestattet hatten, das sie in der Nachmittagssonne aussehen ließ wie ein Himmelsschlüssel; für Raphael und York, weil sie mit väterlicher Freude sahen, wie sehr sich ihre Tochter auf das Zirkuszelt - das verzauberte, so hatten sie ihr gesagt-freute.
York war zusammen mit Yuen in ihrem Zimmer gewesen, um ihr in das neue Kleid zu helfen. Die Kleine hatte an der Bettkante gestanden und nachdenklich an der Spitze des Kleides genestelt, das vor ihr lag. Ihr Vater hatte bemerkt, dass Yuen auf etwas herumkaute, und schließlich war sie damit vorgekommen: »Was, wenn ich Zirkus nicht mag?«, lauteten ihre leisen Bedenken.
»Das ist kaum möglich. Du warst ja noch nie im Zirkus, Kleines. Erst ausprobieren, dann sehen, ob es dir gefällt oder nicht«, hatte York gegengesteuert.
»Warst Du denn schon mal da?« Ihre kleinen schmalen Äuglein hatten sich zu großen Mandeln geweitet.
»Natürlich!«
»Susanna aus meiner Klasse auch. Sie hat gesagt, es stinkt und die Ponys kacken auf die Bühne.«
York hatte hinter seiner Tochter gehockt und sich ein Lachen verkneifen müssen. Zum Ersatz hatte er einen ermahnenden Ausdruck aufgelegt, während er das Glockenblumenkleid hochnahm und über das glatte Haar seiner Tochter streifte. »Yuen! So etwas sagt man nicht. Und außerdem gibt es im Zirkus gar keine Bühne. Bei einer Bühne sitzen alle hintereinander und die Künstler treten vorne auf. Im Zirkus sitzen alle drum herum und die Artisten kommen in die Mitte. Deshalb nennt man die Bühne im Zirkus Manege.«
Altklug hatte sie sich zu ihm umgedreht und ihn in Frage gestellt: »Ich denke, es gibt keine Bühne?«
»Hab ich ja gesagt. Es heißt Manege.«
»Hast du nicht. Du hast gesagt, die Bühne heißt anders. Und Neger sagt man nicht!«
»Manege, Kleines, es heißt Manege.« Yuen hatte das fremd klingende Wort leise wiederholt und dann gefragt, was in einer Minäse denn passieren würde.
In diesem Moment war Raphael herein gekommen. Er hatte vor der Tür gestanden und sich still amüsiert, sich ein großes Handtuch um die Schultern gelegt, so wie er es immer tat, wenn er Märchen vorlas und dann die Tür aufgestoßen. »Meine sehr verehrten Damen und Herren« hatte er ausgerufen. Dann war er hereingesprungen gekommen und hatte einem Zirkusdirektor gleich verkündet, mit welcher Pracht die Artisten, mit welchem Mut die Löwenbändiger und mit welcher Anmut die Schlangenmenschen verzaubern würden.
Das Zelt, so hatte er gesagt und das Geschichtenhandtuch wie einen Zauberumhang vor sein Gesicht gehalten, wäre magisch und würde kleine Mädchen noch während der Vorstellung in Prinzessinnen verwandeln. Allerdings nur solche, die ein gelbes Kleid trügen.
Yuen hatte sich ungedurldig das Haarband von York binden lassen und war dann jauchzend in Raphaels Arme gesprungen. Danach hatte sie von nichts anderem geredet als von der verzauberten Zirkuswelt und mit kindlicher Akribie erfragt, wie die Verwandlung in eine Prinzessin genau vonstatten gehen sollte.
»Es beginnt mit einem Kribbeln im Bauch und wenn deine Aufregung so stark ist, dass du es beinahe nicht mehr aushältst und du so laut über die Clowns lachen musst, dass du dir den Bauch halten musst. Dann verwandelst du dich vom Bauchnabel aus in eine hübsche Prinzessin«, hatte er ihr geantwortet und sie dann Geheimnisse kremend zu sich hinter das Geschichtenhandtuch gewunken. »Die anderen können es nicht sehen. Aber wir wissen es ja.«
»Was wissen wir?«, hatte Yuen eingeschworen und aufgeregt geflüstert.
»Dass du heute Abend eine Prinzessin sein wirst. … Und jetzt sei schön brav. Wir gehen in zwei Stunden erst los. Keine Schokolade und kein Getobe, sonst ist dein Kleid hin, bevor wir dort ankommen, Princessa! Abgemacht?«
Mit einem leuchtenden Nicken hatte Yuen zugestimmt, war durch die Wohnung getänzelt und hatte sich schließlich auf dem Sofa im Wohnzimmer niedergelassen. Dort hatte sie sich das Buch über Zirkustiere angesehen und es immer und immer wieder durch jenes ersetzt, in dem die Magd zur Prinzessin wird. Manchmal war dabei ein verträumtes, ein anderes Mal ein verzücktes Lächeln über ihre Wangen geglitten und sie hatte sichtliche Mühe gehabt, den Startschuss geduldig abzuwarten.
Doch er kam wie versprochen. Sie war aufgesprungen, zur Tür gerannt und in ihre Schuhe geschlüpft. In Nullkommanichts hatte sie abmarschbereit vor der Eingangstür gestanden und ihre Väter gedrängt, sich eilig in ihre Mäntel zu begeben.
Auf dem Weg zum Zirkus löste sie sich leise von Raphaels Hand und sprang in ihrem gelben Kleid über die Gehwege, bis sie schließlich mit großen staunenden Augen vor dem mächtigen Zelt zum Stehen kam.
Auf dem gelb gestreiften Dach wehten weite Wimpel. Sie wurden von der tief stehenden Sonne gestreichelt und gaben sich dem Wind hin. Von Ungefähr brachte ebendieser Wind den Geruch von Stroh und Heu und Tierkäfigen mit sich. Er streifte über das herunter getretene Gras und an Yuens Wange vorüber, um ihren Blick durch das Geschehen zu lenken.