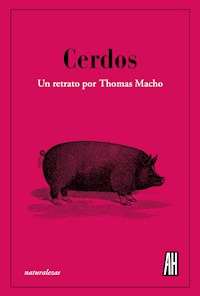Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Residenz
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Unruhe bewahren
- Sprache: Deutsch
Angesichts von Krisen und Zukunftsängsten fragt Thomas Macho nach den Grenzen der Fairness. Denn einerseits gilt: "Alle Menschen sind gleich", andererseits wissen wir auch: "Das Leben ist ungerecht". Krankheiten, Behinderungen, Lebensdauer und Todesarten stellen die sozialpolitischen Ideale der Gerechtigkeit infrage. Was nützen Arbeitszeit- und Steuerausgleichszahlungen, Kindergeld und Renten, Versicherungen und Bausparkredite, wenn manche Menschen schon als Kinder im Elend sterben, andere dagegen ein Jahrhundert - womöglich in Glück und Reichtum - erleben dürfen? Wie kann die Solidarität der Sterblichen, Fundament der Demokratie seit der griechischen Antike, mit der Sehnsucht nach Überleben in Einklang gebracht werden? Auf der Suche nach neuen Antworten diskutiert der bekannte Philosoph und Kulturwissenschaftler Thomas Macho die Frage nach dem Widerspruch zwischen Sterblichkeit und Gerechtigkeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 150
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thomas MachoDas Leben ist ungerecht
Thomas Macho
Das Lebenist ungerecht
UNRUHE BEWAHREN
Unruhe bewahren – Frühlingsvorlesung & Herbstvorlesung.
Eine Veranstaltung der Akademie Graz in Kooperation mit dem Kulturzentrum bei den Minoriten und DIE PRESSE.
Die Frühlingsvorlesung zum Thema »Das Leben ist ungerecht« fand von 29. bis 31. März 2010 im Kulturzentrum bei den Minoriten in Graz statt.
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek:
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
www.residenzverlag.at
© 2010 Residenz Verlag
im Niederösterreichischen Pressehaus
Druck- und Verlagsgesellschaft mbH
St. Pölten – Salzburg – Wien
Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte vorbehalten.
Keine unerlaubte Vervielfältigung!
ISBN ePub:
978-3-7017-4272-1
ISBN Printausgabe:
978-3-7017-1555-8
Inhalt
Vorwort
Grenzen der Gerechtigkeit
Pascals Moderne
Et exspecto
Nachbemerkung
Anmerkungen
Vorwort
»Life is unfair. And it’s not fair that life is unfair«, bemerkte der Ökophilosoph und Anarchist Edward Paul Abbey, und dieses Zitat zirkuliert hundertfach im Internet. Noch vor Beginn des Vietnamkriegs soll auch US-Präsident John F. Kennedy gesagt haben: »Some men are killed in a war and some men are wounded, and some men never leave the country. Life is unfair.« – Kurzum: ›Pourquoi la vie est in-juste?‹, ›Das Leben ist nicht fair‹, ›C’est la vie‹, ›La vita non è giusta‹, ›Das Leben ist ungerecht‹ ›¿Porqué la vida es tan injusta?‹ Solche Fragen und Sätze sind weit verbreitet; wie Stoßseufzer kommentieren sie alltägliches Missgeschick. Da wird die letzte Eintrittskarte für ein Konzert verkauft, just bevor man selbst an die Reihe gekommen wäre; in der Rangfolge auf einer Liste von Bewerbungen besetzt man (vielleicht schon zum wiederholten Mal) den zweiten Platz; kurz nach Ankunft am Urlaubsort verschlechtert sich das Wetter, und es beginnt zu regnen. Bei allen diesen Gelegenheiten kann die Ungerechtigkeit des Lebens beklagt werden, vielleicht mit resigniertem Lächeln. Der Satz gehört zum Sprachspiel der Enttäuschungen. Häufig wird er augenzwinkernd, ohne großes Pathos, ausgesprochen. Kommentiert wird zumeist ein Malheur, aber keine Katastrophe, ein Schaden, aber kein schweres Unglück, ein Pech, aber kein traumatisches Schicksal.
›Das Leben ist ungerecht‹: Dabei könnte diese Interjektion auch Fassungslosigkeit und Trauer über tragische Unfälle und Katastrophen zum Ausdruck bringen. Die Rhetorik der Erschütterung, die sich mit Nachrichten über Flugzeugabstürze, Flutwellen, Waldbrände, Seuchen oder Terroranschläge verbindet, kulminiert häufig im Hinweis auf die Unschuld der Opfer: als hätten zwar vielleicht manche Passagiere des abgestürzten Flugzeugs, manche Bewohner der überschwemmten oder niedergebrannten Häuser, manche Opfer eines Erdbebens, einer Virusinfektion oder eines Bombenattentats den Tod verdient gehabt, aber gewiss nicht alle (oder auch nur die meisten) Betroffenen und gewiss nicht im selben Moment. Es war diese Frage nach Kontingenz und Sinn, die Thornton Wilder in seinem zweiten, mehrfach verfilmten und 1928 mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Roman The Bridge of San Luis Rey (1927) diskutierte: die Frage nach Blindheit oder Vorsehung, am Beispiel des 1714 erfolgten Einsturzes einer alten Hängebrücke in Lima, bei dem fünf Menschen zu Tode kamen. In Wilders Roman geht es auch um das verbotene Wissen, das dem Chronisten des Romans – dem Franziskanermönch Bruder Juniper – den Feuertod des Häretikers einträgt: die philosophischen Systeme und mathematischstatistischen Formeln, mit deren Hilfe die Biographien der Opfer dem Ereignis ihres geteilten Todes, dem fatalen Einsturz der Brücke, zugeordnet werden sollen. Die Frage nach Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit des Lebens findet im Roman nur ein knappes Schlusswort: »Nicht einmal eines Erinnerns bedarf die Liebe. Da ist ein Land der Lebenden und ein Land der Toten, und die Brücke zwischen ihnen ist die Liebe. Das einzige Bleibende – der einzige Sinn.«1
Das literarische Urteil Wilders gegen Bruder Juniper und dessen Recherchen kann als implizite Kritik an einer programmatischen, sozialpolitischen Auffassung des Satzes ›Das Leben ist ungerecht‹ interpretiert werden. Denn eine solche Auffassung denkt den Satz nicht als bloße Interjektion oder als philosophisch-theologische Betrachtung, sondern als Imperativ: ›Das Leben ist ungerecht‹, daher müssen wir versuchen, es gerechter zu gestalten. Zu diesen Versuchen leisten Sozialgesetze, Versicherungen oder Steuerzahlungen einen Beitrag, auch wenn beispielsweise die weltweit gewaltigen Vermögens- und Einkommensdifferenzen durch unterschiedliche Besteuerung oder durch Entwicklungshilfe nur marginal ausgeglichen werden können. Dennoch bemühen sich zahlreiche Institutionen, Regierungen und Organisationen um die partielle Reduktion existentieller Nachteile und kollektiver Ungerechtigkeiten wie Armut, Hunger, Krankheit, Analphabetismus oder eine hohe Kindersterblichkeit. Jeder Versuch, die Aussage ›Das Leben ist ungerecht‹ als Imperativ zu lesen und zu befolgen, muss allerdings notwendig mit Statistiken, Kriterienkatalogen und großen Mengen von Zahlen und Daten operieren. Aktuelle Theorien der Gerechtigkeit können auf Prognosen, Hochrechnungen und Mittelwerte nicht verzichten; denn sie sind unweigerlich auf eine bessere Zukunft bezogen: auf eine Steigerung durchschnittlicher Gerechtigkeit (nach verschiedenen Parametern). Daraus folgt aber auch, dass sie weithin trostlos – in wörtlichem Sinne – bleiben müssen. Den Ungerechtigkeiten der Vergangenheit können sie nur den Appell zur künftigen Verbesserung abgewinnen; den Opfern darf lediglich versichert werden, dass sie mit ihren Leiden den Fortschritt ermöglichen und ermöglicht haben.
Doch welchen Trost spendet die Nachricht von strukturell erfolgreicher Bekämpfung des Hungers den aktuell Hungernden? Welche Genugtuung verspricht die Statistik sinkender Kindermortalitätsraten den Eltern, die gerade ein Kind verloren haben? Welchen Ausgleich gewährt ein Friedensvertrag den Angehörigen der Ermordeten? Und welchen Trost dürfen die Liebsten der Toten der Duisburger Loveparade 2010 von der offiziell bekundeten Einsicht erhoffen, dass künftige Großveranstaltungen professioneller geplant (oder gleich abgesagt) werden sollen? Gerechtigkeitstheorien müssen zumeist die Grenzen ignorieren, die dem einzelnen Leben gezogen sind. Darin besteht ihre unvermeidliche Ungerechtigkeit, die dem Satz ›Das Leben ist ungerecht‹ noch eine andere Bedeutung gibt. Denn die Ungerechtigkeit des Lebens besteht auch in seiner Inkommensurabilität, die in theoretisch-programmatischer Komparatistik notwendig ausgelöscht wird, obwohl gerade eine Kommunität der Sterblichen – ohne Hoffnung auf Himmel, Erlösung und Weltgericht – die Verpflichtung zu existentieller Gerechtigkeit anerkennen muss. Sie will den Widerspruch zwischen Sterblichkeit und Gerechtigkeit ertragen und symbolisch aufzulösen versuchen, in der Gewissheit, dass gerade die Unmöglichkeit, einem Menschen das Sterben abzunehmen (wie Heidegger im § 47 von Sein und Zeit betonte2), das Fundament einer politischen Synthesis legt, nach deren Maßgabe die Grenzen der Vertretbarkeit, Bedingungen und Möglichkeiten demokratischer Repräsentation, erst kenntlich werden.
Hier könnte der Einwand erhoben werden, dass in diesem Text verschiedene Gerechtigkeitsbegriffe – Spheres of Justice im Sinne Michael Walzers3 – vermischt werden: Begriffe der politischen, sozialen, ökonomischen, juristischen oder existentiellen Gerechtigkeit. Der Einwand ist berechtigt. Er trifft tatsächlich eine Intention des Textes, der – angesichts einer Vielzahl neuer und umfangreicher Publikationen zu Fragen der Gerechtigkeit – das Ziel verfolgt, an ungelöste (und mitunter auch unlösbare) Fragen zu erinnern, die im Spannungsfeld zwischen Sozialpolitik, Ökonomie, Rechtsprechung und Religion auftauchen. Selbstverständlich ist es sinnvoll, zwischen existentieller, moralischer und ökonomischer Schuld zu unterscheiden; aber es ist auch sinnvoll und notwendig, die wechselseitigen Übertragungen und Transformationen dieser Schuldbegriffe und ihrer Evidenzen zu untersuchen. Selbstverständlich ist es sinnvoll, zwischen politischer, sozialer, ökonomischer, juristischer und existentieller Gerechtigkeit zu unterscheiden; aber es ist auch sinnvoll und notwendig, die Zusammenhänge und Widersprüche zwischen diesen Gerechtigkeitsbegriffen zu erkunden und wenigstens ansatzweise zu verweben. Vielleicht sollten wir nicht vergessen: Gerechtigkeit ist keine Tabelle und kein Rechenexempel – sondern eine Göttin, eine Sehnsucht, eine Utopie.
»Einer von den Schächern wurde erlöst.
Pause.
Das ist ein guter Prozentsatz.«1
SAMUEL BECKETT
Grenzen der Gerechtigkeit
1.
Zu den Grundprinzipien moderner Moral zählt die Gewissheit: ›Alle Menschen sind gleich.‹ Dieser Satz hat den Niedergang und die Wiederkehr der Religionen ebenso erfolgreich überlebt wie alle Versuche, seinen Sinn exklusiv zu erfassen und folglich die Gattung in Über- und Untermenschen einzuteilen. So heißt es etwa in der Präambel der US-amerikanischen Declaration of Independence (vom 4. Juli 1776): »We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal«, und im ersten Artikel der französischen Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (vom 26. August 1789): »Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits«, »die Menschen werden frei und gleich an Rechten geboren und bleiben es«. Der erste Satz des ersten Artikels der Universal Declaration of Human Rights, die von der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 10. Dezember 1948 beschlossen wurde, lautet: »All human beings are born free and equal in dignity and rights«; und auch die Präambel des Vertrags über eine Verfassung für Europa (vom 29. Oktober 2004) beginnt mit der Berufung auf das »kulturelle, religiöse und humanistische Erbe Europas, aus dem sich die unverletzlichen und unveräußerlichen Rechte des Menschen sowie Freiheit, Demokratie, Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit als universelle Werte entwickelt haben«. Zusammenfassend lässt sich also folgern, dass die Idee, Menschen seien von Natur aus gleich – jenseits der Frage, ob sie von Natur aus böse sind (wie Thomas Hobbes befürchtete) oder gut (wie Jean-Jacques Rousseau hoffte) –, zu den elementaren Forderungen einer modernen Verfassung gehört. Niemand soll durch seine Geburt bevorzugt oder benachteiligt werden. Dabei meint Gleichheit – egalité, equality – nicht nur Gleichheit vor dem Gesetz (wie im dritten Artikel des deutschen Grundgesetzes), nicht nur Gleichberechtigung der Geschlechter, Abstammungen, Sprachen oder Religionen, sondern auch Chancengleichheit, etwa in Bildung, Arbeit, wirtschaftlichem, politischem oder sportlichem Wettbewerb.
›Alle Menschen sind gleich.‹ Und dennoch wissen wir: Dieser Satz kollidiert unentwegt mit der Wirklichkeit. Eine andere, nicht weniger elementare Gewissheit der Moderne lautet darum: ›Das Leben ist ungerecht.‹ Als der zwangsneurotische Schriftsteller Melvin Udall (gespielt von Jack Nicholson), der schwule Maler Simon (Greg Kinnear) und die Kellnerin Carol (Helen Hunt) zu einer gemeinsamen Autofahrt aufbrechen, entspinnt sich – in As Good As It Gets, einer mit zwei Oscars ausgezeichneten Filmkomödie (1997) des Regisseurs James L. Brooks – ein Gespräch über traumatische Erinnerungen. Simon erzählt, er habe seit seiner frühen Kindheit gemalt, stets ermutigt durch eine Mutter, die gelegentlich nackt für ihn posierte: »Well, one day my father came in on one of those painting sessions when I was nine – and he just started screaming at her – at us – at evil. I was trying to defend my mother and make peace, in the lamest way. I said, ›she’s not naked – it’s art.‹ And then he started hitting me.« Melvin, ein wenig eifersüchtig auf das Interesse, das die Kellnerin dem Bericht Simons entgegenbringt, unterbricht mehrfach, erwähnt seinen eigenen Vater, der elf Jahre lang das Zimmer nicht verlassen und ihn mit einem Stock auf die Finger geschlagen habe, wenn er beim Klavierspiel patzte. Carol reagiert jedoch nicht auf Melvins Geschichte; sie resümiert vielmehr, nach einer zärtlichen Berührung der Wange Simons: »We all have these horror stories to get over.« An dieser Stelle widerspricht jedoch Melvin mit Nachdruck: »That’s not true. Some of us have great stories … pretty stories that take place at lakes with boats and friends and noodle salad. Just not anybody in this car. But lots of people – that’s their story – good times and noodle salad. And that’s what makes it hard. Not that you had it bad but being that pissed that so many had it good.«
Die ungerechte Verteilung von Booten mit Nudelsalat ist ärgerlich; doch kann sie vermutlich hingenommen werden. Sie ist auf den ersten Blick ebenso akzeptabel wie die von Natur aus ungerechte Verteilung von Schönheit, Intelligenz oder Stärke, wie die Testosteronwerte im Blut mancher Athleten, auf die sich der ehemalige Diskuswerfer, Sohn eines Chemieprofessors und spätere Doping-Papst Angel Heredia berufen hat, in einem Interview, das am 11. August 2008 – anlässlich der gerade eröffneten Olympischen Spiele von Peking – im Nachrichtenmagazin Der Spiegel publiziert wurde. Gegen Ende des Gesprächs wurde Heredia gefragt, ob er denn »eigentlich für die Freigabe des Dopings« plädiere; die Antwort lautete: »Nein, aber ich glaube, wir sollten Epo [Erythropoetin, ein Glykoprotein-Hormon, das die Bildung roter Blutkörperchen beschleunigt], die IGF [insulinähnliche Stoffe] und Testosteron freigeben, außerdem Adrenalin und Epitestosteron, jene Stoffe also, die der Körper auch selbst produziert – schon aus pragmatischen Gründen, weil nämlich die Verfolgung unmöglich ist, aber auch wegen der Fairneß.« Der Redakteur fragt verblüfft nach: »Das ist Ihr Ernst: Fairneß?« Antwort: »Ja, nehmen wir die populärste Droge: Epo. Epo verändert den Hämoglobinwert, und die Menschen haben nun einmal unterschiedliche Hämoglobinspiegel. Die Freigabe würde also jene Gerechtigkeit und Gleichheit ermöglichen, die angeblich alle wollen. Es gibt nun mal genetische Unterschiede zwischen Athleten. […] Normale Athleten haben einen Level von 3 Nanogramm Testosteron pro Milliliter Blut; der Sprinter Tim Montgomery hat 3 Nanogramm, Maurice Greene aber hat 9 Nanogramm. Was kann Tim tun? Nicht Doping mit körpereigenen Stoffen ist ungerecht, die Natur ist ungerecht.«2 Mit ähnlicher Argumentation könnte genetisches Doping legitimiert werden. »Es wäre ein Horror-Szenario: Die Athleten spritzen sich Gene für Ausdauer, für Schnelligkeit, für Reaktionsvermögen.«3
2.
Die Diskussion um Boote mit Nudelsalat oder Testosteron-Quoten wirft die Fragen auf, welche Ungerechtigkeiten akzeptiert werden können und welche Ungerechtigkeiten bekämpft werden müssen. Welche Ungleichheiten zwischen Menschen sind erträglich, vielleicht sogar wünschenswert, und welche Ungleichheiten dürfen nicht toleriert werden? Anders gefragt: Worin bestehen die elementaren Ansprüche des Lebens? Auf welche Lebensinhalte und Gestaltungsmöglichkeiten sollte nicht verzichtet werden? Auf den ersten Blick wirkt die Antwort naheliegend und einfach: Ein gutes Leben braucht beispielsweise Trinkwasser. Nicht umsonst hat die UN-Vollversammlung am 28. Juli 2010 den Anspruch auf sauberes Wasser zum Menschenrecht erklärt; aus dieser Entscheidung lässt sich aber kein Recht auf ein bestimmtes Mineralwasser ableiten. Ein gutes Leben braucht Gesundheit, vermutlich aber keine Goldtinkturen; es braucht Bildung, aber kein Studium in Eton; es braucht Mobilität, aber keine Motorboote; es braucht Nahrungsmittel, aber nur ausnahmsweise Nudelsalat. Wie aber sollen Ansprüche und Qualitäten des Lebens definiert werden, damit sie nicht in Widerspruch geraten zur Überzeugung, dass alle Menschen gleich sind? Im Anschluss an den indischen Ökonomen und Sozialwissenschaftler Amartya Sen4 hat die Rechtsphilosophin und Ethikerin Martha C. Nussbaum, Professorin an der University of Chicago, eine Liste von zehn Fähigkeiten und Ansprüchen – Capabilities – entworfen, die den Grundsatz ›Alle Menschen sind gleich‹ programmatisch konkretisieren. Nicht verhandelbar sind aus Nussbaums Perspektive die Ansprüche auf (1) Leben, (2) Gesundheit und (3) körperliche Integrität, (4) die Ansprüche auf Bildung, Entwicklung der Sinne, der Vorstellungskraft und des Denkens (»Senses, Imagination, and Thought«), ein Recht auf (5) Emotionen (»in general, to love, to grieve, to experience longing, gratitude, and justified anger, not having one’s emotional development blighted by fear and anxiety«) und auf eine (6) individuelle Moralität (»Practical Reason: Being able to form a conception of the good and to engage in critical reflection about the planning of one’s life«), die Freiheit (7) zur Gestaltung sozialer Beziehungen (»Affiliation«), im erwünschten Wechsel zwischen Geselligkeit und Einsamkeit, (8) zum Leben in und mit der Natur (»Being able to live with concern for and in relation to animals, plants, and the world of nature«), (9) die Möglichkeiten des Spiels (»Play: Being able to laugh, to play, to enjoy recreational activities«) und (10) die politische wie materielle »Control over One’s Environment«, vom Recht auf Partizipation und Mitsprache bis zum Recht auf persönliches Eigentum.5
Amartya Sens und Martha C. Nussbaums als Capability Approach berühmt gewordener Ansatz verschiebt die Forderung ›Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen‹ nicht auf die Zukunft einer »höheren Phase der kommunistischen Gesellschaft«,6 sondern behauptet sogar deren empirische Mess- und Bewertbarkeit. Darin folgt dieses Modell den Prinzipien einer egalitaristischen Theorie der Gerechtigkeit als »Fairness«, wie sie John Rawls – etwa in seiner Theory of Justice (1971) – vorgelegt hat. Rawls gründete seine Theorie auf wenige, logisch operationalisierbare Axiome; er forderte einerseits ein »gleiches Recht auf das umfangreichste System gleicher Grundfreiheiten«, das »mit dem gleichen System für alle anderen verträglich« bleibe, und andererseits eine Einschränkung (oder wenigstens Gestaltung) tatsächlicher sozialer und wirtschaftlicher Ungleichheit durch zwei Voraussetzungen: (1) durch einen kollektiven Vorteil, und (2) durch die Bindung an Ämter und Positionen, die prinzipiell »jedem offen stehen«.7 Aus diesen Axiomen leitete Rawls die sogenannte »Maximin-Regel« ab, die den gemeinsamen Vorteil, der durch soziale und wirtschaftliche Ungleichheit erzielt werde, als den »größtmöglichen Vorteil« für die »am wenigsten Begünstigten« definiert.8 Denn wer »von der Natur begünstigt ist, sei es, wer es wolle, der darf sich der Früchte nur so weit erfreuen, wie das auch die Lage der Benachteiligten verbessert. Die von der Natur Bevorzugten dürfen keine Vorteile haben, bloß weil sie begabter sind, sondern nur zur Deckung der Kosten ihrer Ausbildung und zu solcher Verwendung ihrer Gaben, dass auch den weniger Begünstigten geholfen wird. Niemand hat seine besseren natürlichen Fähigkeiten oder einen besseren Startplatz in der Gesellschaft verdient.«9
Die Rede vom »Startplatz in der Gesellschaft« oder von Fairness erinnert noch einmal an sportliche Wettkämpfe. Doch kann die Chancengleichheit im Sport vergleichsweise leicht durchgesetzt werden: nicht nur durch umfassende Qualifikationen oder Dopingkontrollen, sondern auch durch die Einrichtung von Alters-, Gewichts- oder Geschlechtsklassen. Bereits seit 1948, als die ersten Olympischen Spiele nach dem Zweiten Weltkrieg in London veranstaltet wurden, organisierte etwa Ludwig Guttmann, ein Neurochirurg aus dem Jüdischen Krankenhaus von Breslau, der 1933 nach England geflohen war und 1944 die Leitung des National Spinal Injuries Centre im Stoke Mandeville Hospital von Aylesbury übernommen hatte, jeweils zur Zeit der Olympischen Spiele die Stoke Mandeville Games für körperlich behinderte Personen. Aus diesen Spielen entwickelten sich die Paralympics, die seit 1960 regelmäßig ein paar Wochen nach den Olympischen Spielen am selben Austragungsort organisiert werden. 1976 fanden die ersten Paralympischen Winterspiele statt. Selbst Behinderungen sind also so vergleichbar, dass sie ähnlichen Wettkampfbedingungen unterworfen werden können. Die viel diskutierte Frage der Vergleichbarkeit unterschiedlicher Arten von Behinderung erzwang allerdings vielfältige Diversifikationen: Zur Kompensation der Ungerechtigkeiten des Lebens oder der Natur treten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Paralympics in sechs verschiedenen Klassen an: als Athletinnen und Athleten (1) mit Amputationen, (2) mit Schädigungen zerebraler Steuerungszentren, die zu einer Beeinträchtigung des Bewegungsablaufs oder der Körperhaltung führen, und (3) mit Sehbehinderungen bis zu völliger Blindheit. In eine vierte Klasse werden alle Sportlerinnen und Sportler eingeordnet, die einen Rollstuhl brauchen, und zur fünften Klasse zählen alle kleinwüchsigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die nicht größer sind als 1,45 Meter. Eine sechste Klasse umfasst alle übrigen körperlichen Behinderungen, die sich keiner bereits definierten Klasse zuweisen lassen. Freilich hat gerade die Ausprägung immer feinerer Unterschiede dazu geführt, dass etwa dem südafrikanischen Sprinter Oscar Pistorius – bis wenige Wochen vor Eröffnung der Olympischen Spiele in Peking – ein Startverbot erteilt wurde, und zwar aufgrund seiner beiden Unterschenkelprothesen, die in einem Gutachten der Deutschen Sporthochschule Köln als illegitime technische Hilfsmittel beurteilt wurden.
3.
Was ist gerecht, was ist ungerecht? Wie gleich müssen Menschen sein, um fair miteinander in Konkurrenz treten und ihre Ungleichheiten eruieren zu können? In Frontiers of Justice, den