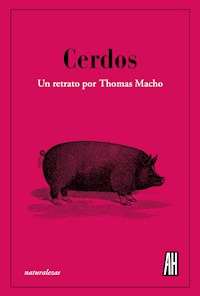29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Der Selbstmord«, schrieb Walter Benjamin in seinem Passagen-Werk, erscheint »als die Quintessenz der Moderne«. Und in der Tat: Nachdem der Versuch, sich das Leben zu nehmen, über Jahrhunderte als Sünde oder Ausdruck einer psychischen Krankheit betrachtet, in einigen Ländern sogar strafrechtlich sanktioniert wurde, vollzieht sich seit dem 20. Jahrhundert ein tiefgreifender Wandel, der zur Entstehung einer neuen Sterbekultur beigetragen hat. Der eigene Tod gilt immer häufiger als »Projekt«, das vom Individuum selbst zu gestalten und zu verantworten ist. Wer sich das Leben nimmt, will es nicht mehr nur auslöschen, sondern auch ergreifen und ihm neue Bedeutung geben.
Thomas Macho erzählt die facettenreiche Geschichte des Suizids in der Moderne und zeichnet dessen Umwertung in den verschiedensten kulturellen Feldern nach: in der Politik (Suizid als Protest und Attentat), im Recht (Entkriminalisierung des Suizids), in der Medizin (Sterbehilfe) sowie in der Philosophie, der Kunst und den Medien. Er geht zurück zu den kulturellen Wurzeln des Suizids, liest Tagebücher, schaut Filme, betrachtet Kunstwerke, studiert reale Fallgeschichten und zeigt insbesondere, welche Resonanzeffekte sich zwischen den unterschiedlichen Freitodmotiven ergeben. Seine Diagnose: Wir leben in zunehmend suizidfaszinierten Zeiten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 787
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Thomas Macho
Das Leben nehmen
Suizid in der Moderne
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1. Wem gehört mein Leben?
2. Suizid vor der Moderne
3. Werther-Effekte
4. Fin-de-Siècle-Suizide
5. Suizide in der Schule
6. Suizid, Krieg und Holocaust
7. Philosophie des Suizids in der Moderne
8. Suizid der Menschengattung
9. Praktiken des politischen Suizids
10. Suizidaler Terrorismus
11. Bilder meines Todes: Suizid in den Künsten
12. Orte des Suizids
13. Debatten um Sterbehilfe und assistierten Suizid
Nachwort
Anmerkungen
Abbildungsverzeichnis
Namenregister
Einleitung
»So erscheint der Selbstmord als die Quintessenz der Moderne.«
Walter Benjamin1
1.
In den letzten Jahrzehnten sind verschiedene und durchaus großformatige Charakterisierungen des gegenwärtigen Zeitalters publiziert worden. Ihnen zufolge leben wir in einer Zeit des Zorns und der Ungeduld,2 in einer Welt der Müdigkeit und Erschöpfung,3 der Beschleunigung und Akzeleration,4 der neuen Kriege und des Kampfs der Kulturen,5 in einer Gesellschaft der Angst,6 des Narzissmus7 oder der Unruhe.8 Auch die älteren Begriffe der Säkularisierung – neuerdings im Widerstreit mit der ebenfalls behaupteten Wiederkehr der Religionen –, der Postmoderne oder der digitalen Revolution sind keineswegs vom Tisch, wenn es darum geht, die Epochensignatur der Moderne zu beschreiben. Als einer der größten und folgenreichsten Umbrüche des 20. und 21. Jahrhunderts müsste indes auch ein Wandel betrachtet werden, der zwar in verschiedenen Aspekten untersucht und diskutiert, aber noch selten in übergreifender Perspektive thematisiert wurde: die radikale Umwertung des Suizids. Viele Jahrhunderte lang wurde der Suizid als schwere Sünde, sogar als »Doppelmord« – nämlich an Seele und Körper –, als Verbrechen, das streng bestraft wurde, nicht allein durch Verstümmelung und Verscharrung der Leichen, sondern beispielsweise auch durch Beschlagnahmung des Familienvermögens, zumindest aber als Effekt des Wahnsinns und als Krankheit bewertet. Während der Suizid noch in der Antike mit Ehre assoziiert werden konnte, erschien er spätestens seit Beginn der Herrschaft der christlichen Religion als Schande und finales Versagen. In einem erst vor wenigen Jahren publizierten Brief an Carl Schmitt vom 27. April 1976 beklagte Hans Blumenberg, »dass wir die pagane Sakramentalisierung des Selbstmords in unerreichbare Ferne gerückt haben. Man muß da aber nicht nur an Seneca denken, sondern auch an Masada und Warschau. Am erstaunlichsten ist, dass dieser Zug der ›Modernität‹ noch nie sonst beschrieben worden ist.«9 Lediglich Walter Benjamin hatte bereits in seinen Baudelaire-Studien bemerkt, die Moderne stehe »im Zeichen des Selbstmords«, der »das Siegel unter ein heroisches Wollen« setze; der Suizid sei schlicht »die Eroberung der Moderne im Bereiche der Leidenschaften«.10
Die Frage nach dem Suizid ist ein zentrales Leitmotiv der Moderne. Seit dem Fin de Siècle, spätestens aber nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, hat sich die radikale Umwertung des Suizids – einerseits als Prozess der Enttabuisierung, andererseits als Verbreitung einer emanzipatorischen »Selbsttechnik« – auf mehreren kulturellen Feldern vollzogen: als Protest in der Politik, als Strategie des Anschlags und Attentats in neueren Erscheinungsformen des bewaffneten Konflikts, als Grundthema der Philosophie und der Künste, in Literatur, Malerei und Film. Suizid und Suizidversuch wurden entkriminalisiert, im Vereinigten Königreich erst ab 1961; rechtlich liberalisiert wurden verschiedene Formen der Sterbehilfe und des assistierten Suizids in der medizinischen Praxis. Auch in den Wissenschaften vollzog sich eine Umwertung des Suizids. Die Drucklegung von Émile Durkheims Le Suicide von 1897, oft verglichen mit Sigmund Freuds Traumdeutung (1900), eroberte das Thema für die Sozialwissenschaften; kulturkritische Betrachtungen, wie sie noch Tomáš Masaryk, der spätere Präsident der Tschechoslowakei, mit Der Selbstmord als sociale Massenerscheinung der modernen Civilisation (1881) vorgelegt hatte, wurden zunehmend von Argumentationen verdrängt, die sich auf Statistiken und empirische Daten stützten. Durkheim unterschied vier elementare Typen des Suizids: den egoistischen, den altruistischen, den anomischen und den fatalistischen; und er formulierte eine Theorie des »sozialen Todes« als Korrelation zwischen Suiziden und den Bindungskräften einer Gemeinschaft. Zu den Pionieren der psychiatrischen Suizidforschung gehörte Jean-Étienne Esquirol, ein Schüler Philippe Pinels. In seinem Werk Des maladies mentales, in deutscher Übersetzung unter dem Titel Die Geisteskrankheiten in Beziehung zur Medizin und Staatsarzneikunde (1838), unterschied er Suizide aus Leidenschaft und Suizide nach einem Mord, er bezog sich auf Jahreszeiten, Klima, Alter und Geschlecht als mögliche Ursachen eines Suizids, sowie auf Maßnahmen zur Vorbeugung und Therapie.11 Esquirol stützte seine Darstellung nur selten auf Zahlen, vielmehr vorrangig auf Fallgeschichten. Und in gewisser Hinsicht ist es bis heute dabei geblieben: Soziologen kommentieren Statistiken, Psychologen besprechen Fallgeschichten. Nur der Brückenschlag zwischen Statistik und Fallgeschichte will nach wie vor nicht recht gelingen.
Als eigenständige Disziplin wurde die Suizidforschung erst nach dem Zweiten Weltkrieg etabliert. Noch 1938 beklagte der Psychiater und Psychoanalytiker Karl Menninger in Man Against Himself – ein Jahr vor dem Freitod Sigmund Freuds, der dabei von seinem Arzt und Freund Max Schur begleitet wurde12 – die wissenschaftliche Tabuisierung der Frage. Angesichts hoher Suizidzahlen
sollte man annehmen, daß ein weitverbreitetes Interesse an diesem Thema besteht, daß viele Untersuchungen und Forschungsprojekte im Gange sind, daß unsere medizinischen Zeitschriften und unsere Bibliotheken Bücher über das Thema enthalten. Dem ist nicht so. Es gibt Romane, Dramen, Legenden in Fülle, die sich mit Selbstmord befassen – Selbstmord in der Phantasie. Aber die wissenschaftliche Literatur darüber ist überraschend spärlich. Dies ist, wie ich meine, ein weiterer Beweis für das auf dem Gegenstand lastende Tabu, ein Tabu, das mit heftig verdrängten Emotionen zu tun hat. Die Menschen lieben es nicht, ernsthaft und realistisch über den Selbstmord nachzudenken.13
Im Jahr 1948 gründete der Psychiater und Individualpsychologe Erwin Ringel eine der weltweit ersten Einrichtungen zur Suizidprävention in Wien; damals hieß diese – unter dem Dach der Wiener Caritas angesiedelte – Beratungspraxis schlicht »Lebensmüdenfürsorge«. Sie hatte eine Vorläuferin: die »Lebensmüdenstelle« der »Ethischen Gemeinde Wien«, die 1928 von Wilhelm Börner gegründet und bis 1939 mit zahlreichen ehrenamtlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, darunter August Aichhorn, Charlotte Bühler, Rudolf Dreikurs oder Viktor Frankl, geführt wurde.14 1975 wurde Erwin Ringels »Lebensmüdenfürsorge« in ein zeitgemäßes und kirchenunabhängiges Kriseninterventionszentrum umgewandelt, das bis heute besteht.15 Die Differenz zwischen den beiden Begriffen »Lebensmüdenfürsorge« und »Krisenintervention« spiegelt einen Mentalitätswandel, der interpretationsbedürftig ist: »Lebensmüdigkeit« bezeichnet ja eine psychische Verfassung, die allmählich – am Ende eines langen Prozesses – erreicht wird und nur mehr schwer beeinflusst werden kann. Der Begriff »Krise« wurde dagegen schon in der griechischen Antike von der Gerichtssprache – krísis bedeutete ursprünglich die Entscheidung, das Urteil – in die ärztliche Terminologie eingeführt; als Krise galt der an bestimmten Tagen erreichte Zeitpunkt im Krankheitsverlauf, an dem eine Veränderung zur Genesung oder zum Tod eintritt. In diesem Sinne betonte Hippokrates im ersten Buch der Epidemien, dass »die Krisen zum Leben oder zum Tode führen oder entscheidende Wendungen zum Besseren oder Schlimmeren bringen werden«.16 In einer Krise kann interveniert werden, Fürsorglichkeit wird dagegen mit affektiver Zuwendung assoziiert. Der ältere Begriff zielte auf Personen und deren Betreuung, der neuere Begriff könnte hingegen viele Arten von heiklen Situationen – politische, ökonomische oder strukturelle Krisen als Entscheidungsmomente einer Entwicklung – betreffen. Offene Frage: Warum sind so viele Wörter mit dem Präfix »für« aus unserem alltäglichen Sprachschatz verschwunden oder haben pejorative Bedeutungsverschiebungen erlitten? Warum sind »Fürsorger« oder »Fürsprecher« so unbeliebt? Werden sie vielleicht mit Vormundschaft, Paternalismus und Entmündigung verknüpft?
Im Jahr 1960 wurde die International Association for Suicide Prevention (IASP) gegründet, 1968 die American Association of Suicidology (AAS) in den USA, vier Jahre später die Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention (DGS). Während Erwin Ringel im deutschsprachigen Raum – als erster Präsident der IASP – eine führende Position einnahm, war es in den USA der klinische Psychologe Edwin S. Shneidman, der – als Mitbegründer des Los Angeles Suicide Prevention Center und von 1970 bis zu seiner Emeritierung 1988 als erster Professor für Thanatologie an der University of California in Los Angeles – die Etablierung der Suizidologie als eigene Wissenschaft nachhaltig förderte. Zunächst reüssierte die Suizidologie freilich als therapeutische Fachdisziplin zur Prävention und Verhinderung von Suiziden. Zu dieser Orientierung hatten auch Ringels Forschungen über das »präsuizidale Syndrom« – mit den drei relevanten Merkmalen der Einengung, Aggressionsumkehr und Suizidphantasie – beigetragen. Aber wie können Motive oder Fragen verstanden und interpretiert werden, wenn vorrangig die Voraussetzungen der möglichen Verhinderung ihres Auftretens im Vordergrund stehen? In seinen späteren Werken hat Shneidman das suizidale Bewusstsein – suicidal mind – in den Mittelpunkt seiner Arbeit gerückt und eine Art von close reading einzelner Fallgeschichten von Suiziden und Suizidversuchen unternommen.17 Auf diesem Weg ist ihm David Lester, inzwischen emeritierter Professor für Psychologie an der Stockton University in New Jersey und ehemaliger IASP-Präsident, gefolgt. Lester hatte sowohl ein Doktorat für Psychologie (1968 an der Brandeis University) als auch ein Doktorat für Sozial- und Politikwissenschaften (1991 an der University of Cambridge) erworben und er initiierte einen cultural turn der Suizidologie, indem er die bereits zitierte Bemerkung Karl Menningers zum Suizid in der kulturellen, literarischen oder künstlerischen Phantasiebildung, die so auffällig reichhaltiger ausfalle als die wissenschaftliche Analyse des Suizids, schlicht umkehrte und die Romane, Filme oder Kunstwerke, in denen Suizide verhandelt werden, als Forschungsgegenstände ernstnahm. In The »I« of the Storm (2014) kommentierte Lester Tagebücher (Cesare Pavese), Briefe (Vincent van Gogh) und suicide notes, Gedichte (Sylvia Plath) oder Interviews mit Personen, die einen Suizidversuch überlebt hatten. Am Ende des Buchs betonte er, wie nötig es sei, den Worten und Texten der Suizidenten aufmerksam zuzuhören, denn klinische Fallgeschichten und Statistiken seien viel zu weit entfernt von den wirklichen Schmerzen, Erfahrungen und Gedankengängen einer suizidalen Persönlichkeit.18
Die Bestimmung der Suizidologie als Präventions- und Interventionswissenschaft ist schwierig und heikel, weil sie deskriptive und normative Ansätze vermischen muss, aber auch, weil sie implizit die traditionelle Bewertung des Suizids fortzusetzen droht: Suizide müssen verhindert werden, weil sie den Überlebenden – sei es den Angehörigen oder den Suizidenten selbst, etwa durch die Folgen eines Suizidversuchs – Schmerzen und Leid zufügen und der Gesellschaft schaden. Kurzum, Suizide sind schlecht: Sie gelten zwar nicht mehr als schwere Sünden oder Verbrechen, aber doch als irrationale, pathologische Handlungen. Dabei begehen jährlich – nach Berichten der Weltgesundheitsorganisation – signifikant mehr Menschen Suizid, als durch Kriege oder Gewalttaten ums Leben kommen. In Zahlen ausgedrückt: 2012 starben weltweit rund 56 Millionen Menschen, davon 620 000 durch Gewalt, nämlich 120 000 in Kriegen und etwa 500 000 durch Mord und Totschlag; aber mehr als 800 000 Menschen begingen im selben Zeitraum Suizid.19 In Deutschland ist die Suizidrate seit den frühen neunziger Jahren deutlich gesunken und dennoch nahmen sich 2015 mehr Menschen das Leben als – zusammengenommen – durch Verkehrsunfälle, Morde, illegale Drogen und Aids zu Tode kamen. Ganz abgesehen von Dunkelziffern fordern die Zahlen eine neutralere Betrachtung des Suizids; nicht umsonst wird in Debatten um Alterssuizid und Sterbehilfe eine Enttabuisierung des Themas gefordert, konkret: eine Vertiefung der bereits vollzogenen Entheroisierung, Entkriminalisierung und Entmoralisierung des Suizids durch seine Entpathologisierung. Nicht alle, die sich das Leben nehmen, sind krank oder verrückt. Es kommt mir daher ganz passend vor, dass die im Deutschen übliche Redeweise »sich das Leben nehmen« in zahlreiche Sprachen nicht korrekt übersetzt werden kann. Schwierigkeiten bereitet dabei nicht nur die Verdoppelung der Akteure in den, der etwas nimmt, und den, dem etwas genommen wird, sondern auch der zweideutige Sinn des Verbs »sich etwas nehmen«, der bezogen werden könnte auf eine Aneignung: Ich ergreife etwas oder nehme es in Besitz. Ich mache das Leben zu meinem Leben, selbst indem ich es auslösche. Das Leben nehmen: Die Ambiguität von »annehmen« und »wegnehmen« muss ausgehalten werden; und sie benötigt kein rekursives »sich«. Dass Suizidphantasien nicht bloß ein »präsuizidales Syndrom« anzeigen, behauptete übrigens schon Friedrich Nietzsche: »Der Gedanke an den Selbstmord ist ein starkes Trostmittel: mit ihm kommt man gut über manche böse Nacht hinweg.«20 Kate, die suizidale Heldin in Walker Percys Roman Der Kinogeher (1961), krönt dieses Argument mit der paradoxen Versicherung, der Selbstmord sei »das einzige, was mich am Leben hält. Wenn alles andere schiefgeht, muss ich nur an Selbstmord denken, und in Null komma nichts bin ich wieder gut drauf. Wenn ich mich nicht umbringen könnte – ja, das wäre ein Grund, es zu tun. Ich kann ohne Nembutal oder ohne Krimis leben, aber nicht ohne Selbstmord.«21
2.
Ich folge in diesem Buch einerseits der historischen Chronologie, andererseits konzentriere ich mich auf die verschiedenen Erscheinungsformen der kulturellen Erfahrung von Suiziden. Im Zentrum stehen also nicht die persönlichen Motive oder sozialen Hintergründe von Suiziden, und auch nicht die Möglichkeiten der Prävention und Therapie oder gar die praktikablen Methoden des Suizids; gefragt wird vielmehr, welche kulturellen Bedeutungen dem Suizid verliehen werden. Statistiken und Fallgeschichten werden zwar zitiert, aber nicht, um irgendeine Art von Ursachenforschung zu betreiben, sondern um dominante Diskurse und Kontexte beleuchten zu können. In diesem Sinne werden Thematisierungen des Suizids in Werken der Malerei, der Literatur oder der Filmkunst als Quellen, die zur Beschreibung von Suizidkulturen beitragen können, ebenso ernst genommen wie philosophische, sozialwissenschaftliche oder psychologische Untersuchungen. Welche Begriffe sollen dabei verwendet werden? Die meisten zeitgenössischen Studien entscheiden diese Frage gleich zu Beginn: Um präskriptive Wertungen zu vermeiden, erklären sie gewöhnlich den Verzicht auf Ausdrücke wie »Selbstmord« oder »Freitod«. Die Rede vom »Selbstmord«, die in der deutschen Sprache erst ab dem 17. Jahrhundert gebräuchlich wurde, sei allzu negativ konnotiert, während »Freitod« – lateinisch: mors voluntaria – eine allzu positive Bedeutung nahelege. Daher hat sich der Begriff »Suizid« durchgesetzt, der moralisch neutraler klingt, vor allem aber der internationalen Verständlichkeit dient: suicide heißt es im Englischen und Französischen, suicidio im Italienischen und Spanischen; nur in den skandinavischen Sprachen oder im Niederländischen hat sich der Selbstmord – selvmord (dänisch, norwegisch), självmord (schwedisch), zelfmoord (niederländisch) – behauptet. Umgangssprachlich werden gern verschiedene Euphemismen verwendet: »sich umbringen«, »sich entleiben«, »Hand an sich legen«, »sich das Leben nehmen«; neuerdings kann im Englischen – unter Bezug auf die Schweizer Sterbehilfe-Vereine – auch von »going to Switzerland« gesprochen werden.22
Wie können Suizidkulturen charakterisiert werden? In manchen Kulturen ist es schwierig, vom Suizid zu sprechen; mitunter wird er schamhaft verschwiegen, häufig metaphorisch umkreist, wie Sterbeanzeigen und Grabinschriften bis heute bezeugen; öffentliche Debatten über Suizide können rasch Vokabular und Register wechseln. Dennoch ist die Unterscheidung zwischen Räumen und Zeiten heuristisch hilfreich, in denen der freiwillige Tod verschwiegen oder nur selten und zurückhaltend kommentiert wird und in denen er vor dem Horizont polymorpher kultureller Diskurse, ritueller, ästhetischer, literarischer, musikalischer oder philosophischer Gestaltung, häufig thematisiert und ausgemalt wird. Ich möchte daher eine Differenzierung vorschlagen zwischen suizidfaszinierten Kulturen und Epochen, die dem Suizid ein hohes Maß an Aufmerksamkeit schenken, und suizidkritischen Zeiten und Lebensformen, die den Suizid tendenziell tabuisieren und abwerten. Suizidfaszinierte Kulturen neigen zur Idealisierung des Suizids, der aus vielen Gründen anerkannt und bewundert wird; suizidkritische Kulturen halten den Suizid für eine moralische Schande und existentielle Niederlage. Suizidfaszinierte Kulturen heroisieren ein kurzes, intensives, abenteuerliches, amplitudenreiches und innovationsorientiertes Leben: »I hope I die before I get old«, sangen The Who 1965 in »My Generation«. Suizidkritische Kulturen favorisieren dagegen ein langes, ruhiges, friedliches, amplitudenarmes, traditionsorientiertes Leben. Diese Haltungen sind freilich nicht zwingend korreliert mit niedrigen oder hohen Suizidraten: China ist beispielsweise – anders als Japan – geprägt von einer eminent suizidkritischen Tradition und zugleich von steigenden Suizidraten, die sich teilweise gerade aus fehlendem Respekt vor dem Suizid ableiten lassen. Vor einigen Jahren wurde in der Boulevardpresse berichtet, ein chinesischer Passant habe einen zögerlichen Lebensmüden, der – auf einer Brücke in der südchinesischen Stadt Guangzhou – einen Verkehrsstau verursacht hatte, kurzerhand in die Tiefe geschubst. »Der von der Polizei festgenommene Lian Jiansheng sagte, er habe den Mann hinabgestoßen, weil jeder Selbstmörder egoistisch sei. Außerdem habe er gegen das öffentliche Interesse verstoßen.«23 Während suizidkritische Kulturen die Suizidenten in ihrer Mitte häufig verachten und folglich gewähren lassen, waren es umgekehrt dominant suizidfaszinierte Kulturen, in denen die Techniken und Strategien der Suizidprävention entwickelt und institutionalisiert wurden: als wüssten deren Protagonisten nur allzu genau, welcher gewaltigen Verführung, welchem enormen Sog Widerstand geleistet werden muss. Vielleicht vertrat die christliche Religion gerade darum eine besonders rigorose Haltung gegenüber dem Suizid, weil sie ihren eigenen Faszinationskern – die Sehnsucht nach dem Martyrium als Königsweg der »Nachfolge Christi« – so gut kannte.
Vor dem Hintergrund der groben Unterscheidung zwischen suizidfaszinierten und suizidkritischen Epochen und Kulturen lässt sich Walter Benjamins These erweitern: Die Frage nach dem Suizid ist ein zentrales Leitmotiv, ja sogar die »Quintessenz der Moderne«; und die Moderne erscheint in vielfacher Hinsicht als Zeitalter wachsender Suizidfaszination, der zunehmend positiver imaginierten Idee, sich das Leben zu nehmen. Zwar versichern die meisten Abhandlungen zumindest im Vorwort, jeder Suizid sei ein tragisches und erschütterndes Ereignis; zugleich aber zirkulieren diverse Anleitungen zum Suizid in Buchhandel und Internet,24 die den Aufstieg des Suizids in den Kanon der techniques de soi, der »Selbsttechniken« – nach einem Begriff Michel Foucaults25 – begünstigen. Diese »Selbsttechniken«, die Foucault an Beispielen aus der Antike – von den Stoikern bis zu den frühchristlichen Asketen – untersuchte, erklären das eigene Ich, dessen physische oder psychische Entfaltung, Steigerung und Optimierung, zum Projekt. Sie verfolgen verschiedene Ziele: Glück (als griechische eudaimonía), Reinheit, Weisheit, Vollkommenheit, Heiligkeit oder Unsterblichkeit. Dabei operieren sie mit vielfältigen Strategien der »Subjektspaltung«: Das Selbst als aktiver Produzent entwirft sich selbst als Werk, als Produkt, dessen Verbesserung angestrebt wird. In solchem Sinne sehen sich die Subjekte als Besitzende, die sich selbst als ihren Besitz gestalten, als Täter und Opfer – etwa im Sinne Ernst Jüngers, der den Suizid scheut, um sich nicht selbst als Opfer gegenüberzutreten, »das sich nicht wehren kann«26 –, als Spieler und Spieleinsätze, als Schreiber und Leser, als »Erlöser« und »Erlöste«, als Wächter und Gefangene,27 im Sinne Immanuel Kants: als transzendentale und empirische Subjekte, als homo noumenon und homo phaenomenon.28 Völlig zu Recht schrieb Théodore Jouffroy 1842: »Suicide est un mot mal fait; ce qui tue n'est pas identique à ce qui est tué« – »Suizid ist ein schlecht gewähltes Wort; wer tötet, ist niemals identisch mit dem, der getötet wird.«29 Derselben Logik folgte noch Bertolt Brechts Trost, den er in einem seiner letzten Gedichte als die Gewissheit ausdrückte, dass »nichts mir je fehlen kann, vorausgesetzt ich selber fehle«.30 Die grammatikalische Konstruktion setzt das Subjekt, dem etwas fehlt, in Beziehung zum Fehlenden, den Verlierer zum Verlorenen. Häufig wird diese »Subjektspaltung« auch metaphorisiert als Differenz zwischen Seele oder Geist und dem Körper. So beginnt die Rede Domenicos, gespielt von Erland Josephson, in Andrei Tarkowskis Film Nostalghia (1983): Der alte Mathematiker steht auf dem Reiterstandbild Marc Aurels und bekennt, bevor er sich in Flammen setzt: »Ich kann nicht gleichzeitig in meinem Kopf und in meinem Körper leben. Deshalb gelingt es mir nicht, eine einzige Person zu sein.«
Selbsttechniken werden erzählt und mündlich gelehrt, aufgeschrieben, abgebildet und besungen. Sie setzen die Anwendung symbolischer Kulturtechniken – der Sprachen, Schriften, Bilder oder Gesänge – voraus. Symbolische Kulturtechniken wie Sprechen, Schreiben, Lesen, Abbilden oder Singen unterscheiden sich von anderen kulturellen Techniken durch ihre epistemischen Leistungen. Sie können als Techniken beschrieben werden, mit deren Hilfe symbolische Arbeiten verrichtet werden. Als symbolische Kulturtechniken sind sie der Möglichkeit nach selbstreferentiell: So kann vom Sprechen gesprochen, vom Schreiben geschrieben, vom Lesen gelesen, vom Singen gesungen werden; Bilder können auf Bildern erscheinen. Dagegen ist es so gut wie unmöglich, etwa das Jagen im Jagen, das Kochen im Kochen oder das Pflügen im Pflügen zu thematisieren, es sei denn durch Anwendung symbolischer Techniken: durch Anweisungen eines Bauern, durch die Lektüre von Kochrezepten oder durch die Herstellung von Amuletten, die auf den erhofften Jagderfolg Einfluss nehmen sollen. Die potentiell selbstreferentiellen symbolischen Kulturtechniken stehen in merkwürdigem Kontrast zu diesen anderen Kulturtechniken (Jagen, Kochen, Pflügen usw.), weil sie zwar ebenfalls in Praktiken der Übung, Habitualisierung und Routine angeeignet werden, jedoch stets bedroht bleiben vom Risiko reflexiver Unterbrechung. Die bei den Surrealisten so beliebte écriture automatique kann nicht dauerhaft praktiziert werden. Daraus lassen sich nicht nur hohe Irritationspotentiale, sondern auch ebenso hohe Innovationschancen ableiten. Wer stets Gefahr läuft zu bemerken, was er gerade tut, kann das, was er gerade tut, auch leichter verändern. Selbsttechniken – als symbolische Kulturtechniken – erschöpfen sich freilich nicht in Selbstreferenzen, sondern brauchen und generieren Medien. Als primäres Medium der Sprache figurierte die Stimme; Knochen, Stoßzähne, Steine oder Metallobjekte waren die frühen »Träger« verschiedenster Bilder und Aufzeichnungen, danach kamen flache Tafeln aus unterschiedlichen Materialien (Holz, Stein, Metall, Papier usw.), schließlich technische Apparate und Geräte, von der Fotokamera bis zum Telefon, vom Radio und Fernseher bis zum Computer. Auffällig ist, wie leicht die Medien ignoriert und übersehen werden. Die spiegelmetaphorische Deutung des Selbstbewusstseins in der Philosophie des deutschen Idealismus erkundete etwa niemals – ebenso wenig wie die psychoanalytische Beschreibung eines »Spiegelstadiums« (nach Jacques Lacan) – die konkreten Glasplatten mit Metallbeschichtung, die erst im 17. Jahrhundert ein akzeptables Reflexionsniveau erreicht hatten. Kulturtechniken erzeugen Medien – und umgekehrt; denn natürlich hängt auch ihre Geschichte ab von den Medien, die sie vermitteln und ermöglichen.
Der Begriff der Subjektspaltung klingt dramatischer als intendiert. Er erinnert an ältere Konzepte der Schizophrenie oder an das breite Feld der »dissoziativen Störungen«, die auch in psychologischer und psychiatrischer Fachliteratur über Suizidalität beschrieben und kommentiert werden.31 Doch sind diese »dissoziativen Störungen« zumeist mit Bewusstseinstrübungen und Kontrollverlusten verbunden; die nach wie vor umstrittenen »multiplen Persönlichkeiten« wissen beispielsweise wenig voneinander. Dagegen erweitern die Subjektspaltungen, die durch die Ausübung von Selbsttechniken ermöglicht werden, den Spielraum der Handlungsmöglichkeiten und Freiheitserfahrungen; sie vertiefen die Hoffnung, sich verändern und ein anderer werden zu können. Beim Zeichnen oder Schreiben von Briefen und Tagebüchern entwerfen wir uns selbst; und manchmal entwerfen wir auch – wie Fritz Zorn oder Roberta Tatafiore – unseren eigenen Tod.32 Zunehmend wird der Tod dann nicht mehr bloß als Schicksal wahrgenommen, sondern als kalkulierbares, gestaltbares Projekt. In den acht Räumen des Projekts Nachlass, die Stefan Kaegi von Rimini Protokoll, zusammen mit dem Bühnenbildner Dominic Huber, im September 2016 für das Théâtre de Vidy in Lausanne – und danach für Aufführungen in Douai, Zürich, Amsterdam, Dijon, Strasbourg, Dresden und Berlin – eingerichtet haben, werden wir mit letzten Botschaften, Liedern und Tonaufzeichnungen, Filmen, Fotos und Objekten konfrontiert; wir betreten »Mausoleen des 21. Jahrhunderts«, des digitalen Zeitalters der Hinterlassenschaften.33 Unmittelbar wird evident, welchen Einfluss die Geschichte medialer Revolutionen auf die Verbreitung von Selbsttechniken genommen hat: etwa die Erfindung der Schrift, die bereits vor 4000 Jahren die Niederschrift des rätselhaften »Gespräch(s) eines Lebensmüden mit seiner Seele«34 erlaubte, die Erfindung des Buchdrucks, der Fotografie, der Tonaufzeichnung, des Films oder des Computers. Freilich waren es jahrtausendelang nur kleine Eliten, die jene Selbsttechniken praktizierten, welche Foucault beschrieben hatte. Erst der Aufschwung des frühneuzeitlichen Theaters, die allmähliche Alphabetisierung breiter Bevölkerungsschichten ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, zuletzt die aktuelle digitale Globalisierung haben diese Lage grundlegend verändert. Nicht umsonst wurden seither »Selbstmordmoden« oder gar »Selbstmordepidemien« auf den Besuch von Theateraufführungen oder die Lektüre von Romanen zurückgeführt. Die Faszination der Trauerspiele seit der Shakespeare-Zeit sei verantwortlich für die Ausbreitung der »English malady« steigender Suizidraten; 1786 schrieb Zacharias Gottlieb Hußty im ersten Band seines Diskurs über die medizinische Polizei:
In England war es lang Mode, nicht leicht ein Trauerspiel aufzuführen, bei welchem nicht der Verfasser, am Ende, wenigstens fünf bis sechs Personen ermorden ließ: diese trauriggrausamen Vorstellungen gefielen dem tiefsinnigen Volke, und unvermerkt ward sein Hang zur Melancholie und finstern Kirchhofsgedanken vermehret. In Frankreich ist nie der Selbstmord so im Schwunge gewesen, als seitdem sich alle Woche auf einer öffentlichen Bühne, bald eine zärtlichliebende Verlassene den Dolch in die Brust stößt, bald ein Unglücklicher heldenmäßig das Leben sich raubt, um nicht länger leiden zu dürfen: die Schwermuth läßt sich nach und nach auf dieses Land nieder, seitdem des Gewinsels auf allen Schaubühnen kein Ende mehr ist, und so sieht sich die immer siegende, aufgewekte Nazion ihr schönstes Eigenthum, die Fröhlichkeit aus dem Herzen winden.35
Mit ähnlich polemischen Kommentaren wurde zu Beginn des 19. Jahrhunderts gegen das »Werther-Fieber« gewettert, und heute werden soziale Plattformen und das Internet, vor allem aber die Formen medialer Berichterstattung verdächtigt, die Benutzer zu Melancholie und Suizid zu verführen.36
3.
2014 hat der österreichische Schriftsteller Michael Köhlmeier den Roman Zwei Herren am Strand veröffentlicht, der um das Thema der Depression und Suizidalität, des »schwarzen Hundes«, kreist. Im Mittelpunkt steht die – in einem vielschichtigen Labyrinth dokumentarischer und fiktiver Referenzen beschriebene – Freundschaft zwischen Charlie Chaplin und Winston Churchill, die beide den wiederkehrenden »schwarzen Hund« genau kennen. Und so erkennen sie einander bei einem nächtlichen Strandspaziergang geradezu als Doppelgänger:
Nachdem sie mit hochgezogenen Hosenbeinen über den Sand gelaufen und auf dem harten feuchten Streifen nahe am Wasser angekommen waren, wo sie parallel zu den erleuchteten Strandhäusern von Santa Monica Beach nordwärts gingen, frage Churchill: »Sind Sie krank?« »Sehe ich so aus?«, fragte Chaplin zurück. »Ja.« »Wie sehe ich aus?« »Wie ein Mann, der an Selbstmord denkt«, hatte Churchill geantwortet. »Das können Sie in der Dunkelheit nicht beurteilen.« »Ist es so?« Bei anderer Gelegenheit erklärte einer dem anderen, er habe in diesem Augenblick beschlossen, sich nicht vorzustellen. Beide fanden die Aussicht auf eine Beichte im Schatten von Nacht und Anonymität verlockender als eine namentliche Bekanntschaft mit welcher Zelebrität auch immer. Sie gaben zu, vielleicht nicht die Person des anderen erkannt zu haben, sehr wohl aber die Persönlichkeit, und meinten damit deren Drangsal. Chaplin – der ohne Zweifel eine Affinität zu romantischen Archetypen hatte – sagte, es sei ihm ein Schauder über den Rücken gelaufen bei dem Gedanken, einem Doppelgänger zu begegnen, freilich einem, dem er nicht im geringsten ähnlich sah, einem zweiten Ich im fleischlichen Kleid eines anderen, sozusagen.37
Es beginnt also mit einer beinahe unheimlichen Selbstbegegnung, einer Subjektspaltung, die prompt mit Dracula und Dr. Jekyll und Mr. Hyde assoziiert wird. Die Geschichte der Freundschaft zwischen Chaplin und Churchill, die einander am Strand versprechen, im Krisenfall den anderen sofort – von welchem Ort der Welt auch immer – aufzusuchen, wird darüber hinaus gespiegelt in einer Rahmenerzählung über die Beziehung zwischen dem Ich-Erzähler und seinem Vater, der als geradezu besessener Churchill-Kenner vorgestellt wird.
Köhlmeiers Roman skizziert eine Theorie der Geburt des Komischen aus dem Geist einer Selbsttechnik: der »Methode des Clowns«. Schon im ersten Teil des Buchs erläutert Charlie diese Methode seinem neuen Freund, der ihn sofort unterbricht: »Die Methode, Charlie! Keine Theorie! Uns interessiert nur die Praxis!« Chaplin antwortet:
»Gut. Die Praxis. Ich schreibe mir einen Brief. Verstehen Sie, Winston? Einen Brief an mich selbst. […] Buster Keaton hat mich auf diese Methode aufmerksam gemacht. Ich soll mir einen großen Bogen Papier besorgen, hat er gesagt. Den soll ich über den Fußboden ausbreiten. […] Auf diesen Bogen Papier lege ich mich.« »Wie?« »Bäuchlings.« »Bäuchlings, gut. Weiter, weiter!« »Wie eine Speise auf einem Tischtuch liege ich auf dem Papier. Sie lachen mich aus, Winston?« »Nein, Charlie. Lache ich? Sehen Sie mich an! Lache ich? Ist das Lachen? Das ist nicht Lachen. So ist mein Gesicht.« »Gegen den Gedanken, ich könnte verrückt sein, hilft nur, etwas Verrücktes zu tun. Das ist etwas sehr Ernstes, Winston. Das ist die Methode des Clowns. Es gibt keinen Menschen auf der Welt, der ernster wäre als ein Clown.«
Und Chaplin erklärt, es sei notwendig, sich nackt auf das Papier zu legen – »Das ist sehr wichtig. Eine Hose bereits ist die Welt, und ein Hemd ist auch die Welt« –, und dann einen Brief an sich selbst zu schreiben: »Lieber Charlie, schreibe ich und schreibe, was mir gerade einfällt.« Dabei müsse sich der nackte Schreiber wie ein Uhrzeiger auf dem Bauch drehen und wie in einer Spirale von außen nach innen schreiben, gleichsam in einem »Mahlstrom«.38 Und auch der Roman dreht sich wie in einer Spirale um diese »Methode des Clowns«, die am Ende noch einmal klar pointiert wird:
Wir teilen unser Ich in zwei, sehen uns zwergenhaft und monströs – und finden beides komisch. Wir finden uns komisch. Und siehe da, für eine kleine Zeit kann uns die Welt nichts anhaben. Die Methode des Clowns bestehe also aus nichts anderem als der Leistung, sich selbst vor sich selbst lächerlich zu machen – mit dem Ziel, sich selbst zu entfremden. Ganz bei sich selbst kann der Mensch nämlich nicht über sich selbst lachen, denn Lachen bedeutet immer Lachen auf Kosten eines anderen. Er muss sein Ich aufspalten in ein Ich, das lacht, und in ein anderes, das ausgelacht wird. Dies ist das Ziel der Methode.39
Die Selbsttechnik der »Methode des Clowns« erinnert an ein Spiel: ein Spiel mit klaren Regeln, das ich mit mir selbst spielen muss, als ein Lachen mit dem Tod und über den Tod, wie Chaplin im Roman einmal bemerkt:
»Ich bin mir immer bewusst gewesen, dass der Tramp mit dem Tode spielt. Er spielt mit ihm, verspottet ihn auch, dreht ihm eine lange Nase, doch in jedem Augenblick des Lebens ist er sich des Todes bewusst, und gerade deshalb ist er sich so erschreckend klar darüber, dass er lebt.« […] »Der Clown ist dem Tod so nahe, dass ihn nur eines Messers Schneide von ihm trennt, und manchmal überschreitet er sogar diese Grenze, doch kehrt er immer wieder zurück. Deshalb ist er auch nicht ganz wirklich, er ist in gewissem Sinn ein Geist.«40
Kann man spielen und lachen mit dem Tod? Schon die Toten in den spätmittelalterlichen Totentanzdarstellungen traten nicht als Bußprediger auf, die Gottes Vorsehung über das menschliche Unwissen triumphieren ließen. Manchmal schienen sie die Lebenden zu verhöhnen; häufiger jedoch wirkten sie selbst vergnügt, als würden sie lachen, grinsen, scherzen: ein wenig schadenfroh, denn sie hatten das Sterben bereits hinter sich. Nur selten war ihr Gesichtsausdruck grimmig und erzürnt; gelegentlich tanzten sie, spielten Flöte oder Laute. Ihre Erscheinung repräsentierte Traditionen des Totenkults, bei denen viel gelacht werden muss, wie im europäischen Karneval oder am Día de los Muertos, dem Tag der Toten in Mexiko. Auch dort wird praktiziert, was Nigel Barley eine »Spaßmacherbeziehung zum Tod« nannte:
Einmal im Jahr, um Allerheiligen (1. November) herum, werden die Toten ins Land der Lebenden zurückgebeten und königlich bewirtet. Sie bekommen neue Kleider geschenkt; ihnen werden Getränke und Leckerbissen vorgesetzt. Die regionalen Gebräuche sind verschieden, abhängig davon, wie sehr die kirchlichen Behörden auf »Achtung vor den Toten« und Nüchternheit dringen; die Tradition bevorzugt überbordende Fröhlichkeit, Exzesse und Tanz. Mancherorts verkleiden sich die Männer zum Tanz als Frauen. Die Toten werden unter Umständen durch Fährten aus Ringelblumen zum Haus ihrer Angehörigen geleitet, oder man zieht mit festlichem Essen und mit Musik zum Friedhof. Für die Kinder werden zum Lutschen üppig glasierte oder schokoladenüberzogene Totenschädel aus Zuckermasse hergestellt. Figürchen aus Pappmaché, Zucker, Zinn und Papier zeigen die Toten bei allen möglichen Lebenstätigkeiten. Sie telefonieren, fahren in Straßenbahnen, verkaufen an Straßenecken Zeitungen oder auch sich selbst.41
Selbst Suizidversuche und Suizide können komisch dargestellt werden, in Filmen wie Hal Ashbys Harold und Maude (1971), The World's Greatest Dad (2009) oder in Nick Hornbys Roman A Long Way Down (2005), der 2014 von Pascal Chaumeil ebenfalls verfilmt wurde. Auch die unlängst erschienene Kleine Geschichte des Suizids von Anne Waak (2016) präsentiert mehrere Beispiele, die geeignet sind, unseren Sinn für schwarzen Humor zu testen.42
Düstere und tragische Dimensionen treten interessanterweise gerade dann in den Vordergrund, wenn wir wagen, Suizide und Suizidversuche im Kontext des Spielerischen zu diskutieren:43 als Einsatz des Lebens, etwa in den römischen Spielen der Gladiatoren, in Kriegen, Turnieren, Duellen oder in gefährlichen Wettkämpfen, vom Autorennen bis zum Apnoe-Tauchen, dessen suizidale Faszination Luc Besson in seinem Kultfilm Im Rausch der Tiefe (1988) so virtuos herausgearbeitet hat. Bekannte Theorien des Spiels wie Johan Huizingas Homo ludens (1938)44 erwähnen das suizidale Element des Spiels nicht; Roger Caillois spricht nur an einer einzigen Stelle in Les jeux et les hommes (1958) über imitative Suizide nach den Toden James Deans oder Rudolph Valentinos.45 Und auch Georges Bataille kommentiert in seinem Essay zu Huizinga zwar das Spiel als »Risiko«, in dem »jeder Rivale sich aufs Spiel setzt«,46 nicht aber den Suizid. Wie können Spiele klassifiziert werden? Huizinga bezieht sich auf die Felder, in denen das Spiel die Kultur durchdringt: in Sprache, Recht, Religion, Krieg, Wissen, Kunst und Philosophie; Caillois operiert mit den Kategorien Agon (Wettkampf), Alea (Glück und Zufall), Mimicry (Nachahmung) und Ilinx (Rausch und Ekstase), während Friedrich Georg Jünger die Glücksspiele, Geschicklichkeitsspiele und die »vorahmend-nachahmenden Spiele« unterscheidet.47 Auch Jünger erwähnt zwar den Einsatz des Lebens und der eigenen Person,48 nicht aber den Suizid. Vermutlich war der französische Soziologe Jean Baechler der erste Theoretiker, der in seiner Dissertation zu Les Suicides (1975 bei Raymond Aron) den spielerischen Suiziden neben den eskapistischen, aggressiven, oblativen und institutionalisierten Suiziden besondere Aufmerksamkeit schenkte. Unter Bezug auf die vier Kategorien von Roger Caillois erläuterte Baechler einige suicide games, etwa das jeu du pendu, bei dem es darum ging, mit einer Schlinge um den Hals von einem Baum zu springen und zu versuchen, während des Falls das Seil mit einem Messer zu durchtrennen. Heute wird das jeu du pendu nur mehr symbolisch, im Deutschen etwa als »Galgenmännchen-Spiel«, praktiziert. Bei einem anderen Spiel, es hieß murder party, erhielten alle Spielteilnehmer eine Pistole, von denen aber nur eine Pistole geladen war. Die Spieler wurden in ein verdunkeltes Zimmer eingesperrt und mussten auf Kommando ihre Pistolen abfeuern. Schließlich zitierte Baechler noch einen jugoslawischen Club der Zwischenkriegszeit, in dem Karten gespielt wurden; unter die Karten wurde eine zusätzliche Karte gemischt, die den Tod symbolisierte. Wer diese Karte zog, musste sich am folgenden Tag das Leben nehmen.49
Wesentlich populärer als diese Spiele ist »Russisch Roulette«. Der Begriff wird gewöhnlich auf eine Kurzgeschichte mit dem Titel »Russian Roulette« von Georges Surdez zurückgeführt, die im New Yorker Wochenmagazin Collier's am 30. Januar 1937 erschien.50 Darin erzählt ein deutscher Fremdenlegionär namens Hugo Feldheim von den Wetten des russischen Sergeants Burkowski, der eine Kugel aus seinem Revolver entfernte, die Trommel drehte, den Abzug betätigte und regelmäßig – trotz einer Chance von 5 zu 1 für seinen Suizid – überlebte. Aber er hatte geschwindelt und heimlich alle Kugeln entfernt. Der Trick wurde allerdings aufgedeckt, und aus Scham habe sich der Sergeant dann wirklich erschossen. Vermutlich sollte auch seine Erzählung von den russischen Offizieren, die angeblich 1917 in Rumänien ihren Suizid auf diese Weise dem Zufall anheimgestellt hatten, bloß zum Wetteinsatz animieren. Kurzum, historische Quellen für russisches Roulette sind unbekannt, und vielleicht nahm das Spiel den direkten Weg von der Fiktion in die Realität. Zwar hat der Schriftsteller Graham Greene – etwa in einem BBC-Gespräch mit Christopher Burstall vom 15. August 1969 – behauptet, schon in seiner unglücklichen Jugend russisches Roulette gespielt zu haben, aber seine Biographen haben das zumindest bezweifelt. Wie auch immer, als literarisches und filmisches Thema hat sich russisches Roulette behauptet und verbreitet. In Alejandro Jodorowskys Film El Topo (1970), in Michael Ciminos The Deer Hunter (1978), in Luc Bessons Léon (1994) oder in Géla Babluanis 13 Tzameti (2005) wird das Spiel in unterschiedlichen Kontexten präsentiert: als eine Art von Gottesurteil und Gottesbeweis in einer Kirche, als Foltermethode im Vietnamkrieg, als Erpressung eines Profikillers durch ein junges Mädchen, als düstere Parabel für den Finanzkapitalismus. Weitere Beispiele könnten genannt werden, doch darf nicht übersehen werden, dass russisches Roulette tatsächlich gespielt oder als Foltermethode – etwa in Chile nach 1973 – praktiziert wird. David Lester hat in einem Beitrag zum Sammelband Suicide as a Dramatic Performance (2015) einige konkrete Zahlen angeführt: 20 Russisch-Roulette-Opfer – 19 Männer, eine Frau – in Dade County, Florida, in den Jahren von 1957 bis 1985, was 0,31 Prozent sämtlicher Suizide in dieser Zeit und Region entspricht, 15 Opfer in Wayne County, Michigan, zwischen 1997 und 2005, und 71 Russisch-Roulette-Tote im gesamten US-Staatsgebiet von 2003 bis 2006.51 Die Auswertung nach Geschlecht, Lebensalter, Alkohol- und Drogenkonsum, Höhe des Einkommens oder ethnischer Zugehörigkeit ist freilich wenig überraschend: Zumeist sind es jüngere, oft arbeitslose Männer aus afroamerikanischen oder hispanischen Familien; selten sind sie nüchtern, wenn sie russisches Roulette spielen, und so gut wie nie spielen sie allein. Aufschlussreicher erscheint dagegen der Vergleich mit dem Duell, das Lester ebenfalls als eine Art von Risiko-Suizid auffasst. Er bezieht sich auf das berühmte Duell zwischen Alexander Hamilton und Aaron Burr am 11. Juli 1804. Seinen Freunden hatte Hamilton, einer der Gründerväter der USA, zuvor mitgeteilt, dass er nicht schießen werde; er starb im Duell. Nach seinem Tod wurde ein Abschiedsbrief veröffentlicht, in dem Hamilton seine Entscheidung rechtfertigte. Unwillkürlich erinnert die Geschichte an das Duell zwischen Settembrini und Naphta im vorletzten Kapitel von Thomas Manns Roman Der Zauberberg (1924): Settembrini schießt in die Wolken, Naphta ist empört: »›Sie haben in die Luft geschossen‹, sagte Naphta mit Selbstbeherrschung, indem er die Waffe sinken ließ. Settembrini antwortete: ›Ich schieße, wohin es mir beliebt.‹ ›Sie werden noch einmal schießen!‹ ›Ich denke nicht daran. Die Reihe ist an Ihnen.‹« Settembrini repräsentiert also Hamilton; Naphta aber will dem Script nicht folgen. »›Feigling!‹ schrie Naphta, indem er mit diesem Aufschrei der Menschlichkeit das Zugeständnis machte, daß mehr Mut dazu gehöre, zu schießen, als auf sich schießen zu lassen, hob seine Pistole auf eine Weise, die nichts mehr mit Kampf zu tun hatte, und schoß sich in den Kopf.«52 Auch auf dem Zauberberg mehren sich – nach dem Freitod Mynheer Peeperkorns – die Suizide, kurz vor Beginn des Ersten Weltkriegs. Heute dagegen wirken russisches Roulette und Duelle nahezu antiquiert, in einer Zeit, die zahlreiche Varianten virtueller suicide games kennt, Techniken digitaler Subjektspaltung, die mit Avataren und Todesarten auf allen Levels praktiziert werden können.53
4.
Die Frage nach dem Suizid ist das Leitmotiv der Moderne. Würde ein Besucher von einem fremden Stern unseren Planeten tatsächlich als Ort der Selbstzerstörung wahrnehmen, wie Karl Menninger zu Beginn von Man Against Himself mutmaßte?
Menschen fliegen über schöne alte Städte und werfen Sprengbomben auf Museen und Kirchen, auf große Gebäude und kleine Kinder. Sie werden dabei von den offiziellen Vertretern von zweihundert Millionen anderer Menschen ermutigt, die alle täglich mit ihren Steuern zur wahnwitzigen Produktion von Instrumenten beitragen, dazu bestimmt, andere menschliche Wesen zu zerfetzen und zu verstümmeln, Wesen, die ihnen gleichen, die von denselben Trieben, denselben Empfindungen beherrscht sind, denselben kleinen Vergnügungen nachgehen und ebenso wie sie wissen, daß der Tod kommen und alle diese Dinge nur zu rasch beenden wird. Dieser Anblick würde sich jemandem bieten, der unseren Planeten flüchtig beobachtete, und wenn er tiefer in das Leben von Einzelnen und Gemeinschaften hineinschaute, würde er noch mehr sehen, was ihn verwirrte. Er würde Zänkereien, Haß und Kampf sehen, nutzlose Verschwendung und kleinliche Zerstörungslust. Er würde Leute sehen, die sich selbst opfern, um andere zu verletzen, die Zeit, Mühe und Energie vergeuden, um die jämmerlich kurze Unterbrechung der Vergessenheit, die wir Leben nennen, zu verkürzen. Und am erstaunlichsten von allem: Er würde einige sehen, die – als hätten sie nichts anderes zu zerstören – ihre Waffen gegen sich selbst richten.54
Wir könnten dieses Panorama für Marsmenschen leicht weiter ausmalen, etwa durch den Hinweis auf Menschen, die Bücher lesen, Bilder betrachten, Filme sehen und Spiele spielen, die um das Thema des Suizids und der Selbstzerstörung kreisen. Während die Akteure der Suizidprävention vor den Effekten imitativer Suizide und medialer Berichterstattung warnen, und während der Physiker Stephen Hawking gerade heute – am 6. Mai 2017 – die Auswanderung auf andere Planeten empfiehlt, weil die Erde schon in hundert Jahren kein bewohnbares Habitat mehr bilden werde, halten andere die Fähigkeit zum Suizid geradezu für einen Inbegriff des Humanen.
So viele Kompetenzen wurden ehemals als Alleinstellungsmerkmale der Menschengattung charakterisiert! Der Mensch sei einzigartig, behauptet schon Aristoteles, weil er zu Staatenbildung, zu Sprache und Kommunikation fähig sei.55 Er sei das kluge Tier, das arbeiten, sprechen, denken, lernen, spielen, weinen und lachen könne; er sei das Tier, das in die Zeit gefallen sei, das – losgerissen vom »Pflock des Augenblicks« – als sorgendes und rächendes, planendes und trauerndes Wesen aufzutreten vermöge, als Tier, das sich erinnern kann und das »versprechen darf«.56 Der Mensch sei das Tier, das eben wisse, dass es ein Tier ist,57 und folglich die Sphäre des Animalischen überschreite. Inzwischen haben jedoch Experten und Expertinnen der Ethologie, der Kognitionswissenschaften und der Animal Studies diese Palette von Einzigartigkeitsbehauptungen systematisch relativiert: Sie haben demonstriert, dass verschiedene Tierarten Werkzeuge konstruieren und gebrauchen, dass sie – auch ohne menschliche Anleitung – Lernprozesse absolvieren, dass sie symbolische Kommunikationstechniken anwenden können und zur Selbsterkennung im Spiegel fähig sind, dass sie erinnern, planen, trauern, verzeihen, ja sogar lügen und täuschen und natürlich spielen. Gleich auf der ersten Seite von Homo ludens betont Johan Huizinga: »Ja, man kann ruhig sagen, daß die menschliche Gattung dem allgemeinen Begriff des Spiels kein wesentliches Kennzeichen hinzugefügt hat. Tiere spielen genau so wie Menschen. Alle Grundzüge des Spiels sind schon im Spiel der Tiere verwirklicht. Man braucht nur junge Hunde beim Spielen zu beobachten, um in ihrem munteren Balgen alle diese Züge zu erkennen.«58 Zumindest in der Theorie wurden also die alten Grenzbefestigungen zwischen Menschen und Tieren erfolgreich abgebaut; und manchmal hat es sogar den Anschein, als sei die Fähigkeit, sich selbst zu töten und zu zerstören, als einzige Kompetenz übriggeblieben, die als singulär menschlich behauptet werden darf.
Können Tiere wirklich nicht Suizid begehen? Und warum wird die Diskussion über Kollektiv- und Nachahmungssuizide immer noch mit dem Verweis auf die Lemminge illustriert? Der Mythos vom »Massenselbstmord« der Lemminge – einer Familie der Wühlmäuse, die in den arktischen Tundren lebt – hat sich vermutlich in Skandinavien entwickelt; richtig daran ist allenfalls, dass erhebliche, periodisch auftretende Populationsschwankungen zu Wanderungen führen, bei denen ein Teil der Tiere zu Tode kommt. Aber die Vorstellung von den Lemmingen, die sich zu Tausenden von den Klippen ins Meer stürzen, gehört zweifellos ins Reich der Phantasie. Weltweit verbreitet wurde der Mythos ausgerechnet durch einen Disney-Dokumentarfilm aus dem Jahr 1958: White Wilderness (Weiße Wildnis), in dem die »Massensuizide« der Lemminge eindrucksvoll gezeigt wurden. Doch hatten die Tierfilmer nachgeholfen, wie der Journalist Brian Vallee in einem Beitrag für das kanadische Fernsehen von 1983 nachwies. Nach seiner Darstellung
wurden die Szenen im kanadischen Bundesstaat Alberta gedreht, wo es gar keine Lemminge gibt. Die Filmemacher hatten die Tiere von Eskimokindern in Manitoba gekauft und dann zum Drehort geschafft. Um den Eindruck einer Massenwanderung zu erzeugen, wurden die Lemminge auf eine große, schneebedeckte Drehscheibe placiert, die dann in Rotation versetzt und aus allen möglichen Kamerawinkeln gefilmt wurde. Der Strom der Lemminge – nichts als eine »Schleife«, bei der immer wieder dieselben Tiere zu sehen sind. Und dann kommt der böse Teil der Geschichte. »Die Lemminge erreichen den tödlichen Abgrund«, raunt der Sprecher, »dies ist ihre letzte Chance zur Umkehr. Aber sie laufen weiter, stürzen sich in die Tiefe.« Aus einer dank perfekter Tiefenschärfe phantastisch anmutenden Kameraperspektive sieht der Zuschauer die Nager in die gähnende Schlucht eines Flußtales fallen, angeblich getrieben vom Todesinstinkt. Die Wirklichkeit war nach Vallees Recherchen erheblich profaner: Die Disney-Leute halfen nach, schubsten und warfen die wenig lebensmüden Lemminge in den Abgrund. In der Schlußeinstellung sieht man die sterbenden Tiere im Wasser treiben. »Langsam schwinden die Kräfte, die Willenskraft läßt nach, und der Arktische Ozean ist übersät mit den kleinen toten Leibern.«
Der Autor schließt entrüstet: »Von wegen Arktischer Ozean, von wegen nachlassende Willenskraft: Ein Massenmord an Tieren im Dienste der Illusionsfabrik Hollywood.«59 Beglaubigt und in Szene gesetzt wurde insgeheim bloß unsere eigene Suizidfaszination.
In einem Beitrag für die Zeitschrift Endeavour sind die britischen Wissenschaftshistoriker Edmund Ramsden und Duncan Wilson der Frage nach Tiersuiziden genauer nachgegangen. Dabei beziehen sie sich nicht nur auf Mythen – wie die christliche Legende vom Pelikan, der sich die Brust aufreißt, um mit seinem Blut die Jungen zu füttern –, sondern auch auf wissenschaftliche Untersuchungen und Laborexperimente im 19. Jahrhundert, wie sie beispielsweise durch einen Bericht (abgedruckt in den Illustrated London News vom 1. Februar 1845) über die wiederholten Suizidversuche eines Hundes angeregt wurden, der sich angeblich ertränken wollte, indem er sich ins Wasser stürzte und mit dem Kopf untertauchte, ohne die Beine zu bewegen.60 Neuerdings werden Forschungen zu animal suicides verfolgt, so legen die Autoren in ihrer Zusammenfassung dar, um biochemische oder genetische Ursachen des nicht intendierten Suizids bei Tieren wie Menschen klassifizieren und eruieren zu können.61 Eine ganz andere Richtung schlägt dagegen Claire Colebrook, eine an der Pennsylvania State University lehrende australische Kulturwissenschaftlerin, in ihrem Beitrag zu dem von Patricia MacCormack herausgegebenen Sammelband The Animal Catalyst (2014) ein. Unter Bezug auf die Arbeiten von Jacques Derrida und Gilles Deleuze spricht sie von der »counter-animality« des Menschen, der gerade im Versuch, als organischer, materieller Organismus zu überleben, eine Existenz jenseits aller Grenzen seiner eigenen Natur entwerfe. Der Mensch sei ein »suicidal animal«, fähig zur Überschreitung der Interessen und Grenzen seines organischen Selbst.62 In gewisser Hinsicht entspringen die menschlichen Suizide, so Colebrook, gerade der Konfrontation mit der eigenen Animalität: »Dem menschlichen Tier ist es nur möglich, einen Krieg gegen sich selbst zu führen, in seiner extremsten Form bis zur Selbstauslöschung, weil Humanität geradezu notwendig die Form eines Krieges gegen Animalität annimmt.«63 Die menschliche Fähigkeit, das eigene Selbst als höher oder zumindest ganz anders als seine Animalität zu fassen, sei eine Art von Angriff gegen dieses Selbst, formuliert Colebrook mit Derrida, eben »ein Krieg des suizidalen Tiers«,64 und dieser Krieg gegen Tiere und Umwelt sei nur möglich, solange sich der Mensch als autonomes, immunes Selbst jenseits der Welt wahrnehme. Anders gesagt: Die letzte Grenzziehung zwischen Menschen und Tieren – in Gestalt der These, der Mensch sei das einzige Tier, das Suizid begehen könne – ist ein rekursiver Effekt, gleichsam das finale Ergebnis einer ganzen Serie von Kriegen und Abgrenzungen gegen die Tiere und die eigene Animalität.
Umso bemerkenswerter ist vielleicht, dass gerade die technischen Träume von einer Überwindung organischer Animalität – die Visionen von Cyborgs und langlebigen, womöglich unsterblichen »Übermenschen« – zumindest im Kino auf eine Entscheidung für Sterblichkeit und Suizid hinauslaufen. Begonnen hatte es bereits mit Ridley Scotts Blade Runner (1982), mit dem grandiosen Schlussmonolog des Replikanten Roy Batty, gespielt von Rutger Hauer, der zuerst gegen die Programmierung seiner kurzen Lebenszeit von vier Jahren revoltiert, dann aber den Tod akzeptiert und beinahe zum christlichen Märtyrer – mit Taube und genagelter Hand – konvertiert: »Ich habe Dinge gesehen, die ihr Menschen niemals glauben würdet. Gigantische Schiffe, die brannten, draußen vor der Schulter des Orion. Und ich habe C-Beams gesehen, glitzernd im Dunkeln, nahe dem Tannhäuser Tor. All diese Momente werden verloren sein in der Zeit, so wie Tränen im Regen. Zeit zu sterben.« Gewiss, der Replikant begeht nicht Suizid, aber er ist auch nicht mehr sicher, ob er länger leben will. Neun Jahre später ist es der Cyborg-Killer in James Camerons zweitem Terminator-Film (1991), gespielt von Arnold Schwarzenegger, der ebenfalls nach christlichem Vorbild den Tod – allerdings nicht am Kreuz, sondern in der Stahlschmelze – wählt. Da er nicht auf Suizid programmiert ist, muss er Sarah Connor (Linda Hamilton) um die bereitwillig gewährte Assistenz bitten. Ein Jahr später stürzt sich auch die Heldin von David Finchers Alien III (1992) – Ellen Ripley (Sigourney Weaver) – in eine Stahlschmelze, um nicht ein Alien-Baby austragen zu müssen. Und in Bicentennial Man (1999), unter der Regie von Chris Columbus, ist es der Android Andrew Martin, gespielt von Robin Williams, der aus Liebe zu Portia (Embeth Davidtz) seiner Verwandlung in einen sterblichen Menschen zustimmt. Sie alle – und weitere Beispiele sind leicht zu finden – folgen dem Vorbild des Kentauren Cheiron, der im griechischen Mythos freiwillig der Unsterblichkeit entsagt. Liegt eine Epoche der machine suicides vor uns?65 Schon am Abend des 17. März 1960 hatte der Schweizer Künstler Jean Tinguely im Skulpturengarten des Museum of Modern Art in New York seine Maschinenskulptur Homage to New York vorgestellt: ein kinetisches Arrangement aus verschiedensten Abfällen und Resten, die Tinguely auf den Müllhalden und Schrottplätzen der Stadt gefunden hatte – einer alten Badewanne, einem Wetterballon, mehreren Fahrrädern, einem Klavier. Nach seinem ursprünglichen Plan sollte sich das Gebilde rauchend und knatternd in Bewegung setzen, um zuletzt in einen kleinen Teich zu stürzen und somit »Suizid« zu begehen; allerdings geriet die Maschine rasch in Brand und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Marcel Duchamp grüßte die autodestruktive Maschine, indem er ein Gedicht aus dem Jahr 1912 auf seine Einladungskarte schrieb und nach New York schickte: »si la scie scie la scie/et si la scie qui scie la scie/est la scie que scie la scie/il y a suissscide métallique« – »Wenn die Säge die Säge sägt/und wenn die Säge, die die Säge sägt/die Säge ist, die die Säge sägt/dann liegt ein metallischer ›Suissscide‹ vor«.66 Damals war von »going to Switzerland« aber noch keine Rede …
1. Wem gehört mein Leben?
»Die größte Sache der Welt ist, daß man sich selbst zu gehören weiß.«
Michel de Montaigne1
1.
Albert Camus ist 28 Jahre alt, als er 1942 – mitten im Weltkrieg – zwei seiner wichtigsten Bücher publiziert: den Roman Der Fremde und den philosophischen Essay Der Mythos des Sisyphos. Der Essay beginnt mit einem programmatischen Satz: »Es gibt nur ein wirklich ernstes philosophisches Problem: den Selbstmord.«2 Auch Der Fremde handelt nicht nur vom sinnlosen Mord an einem Araber und einer ebenso sinnlosen Hinrichtung, sondern in gewisser Hinsicht vom Suizid des Helden. Diese Wahrnehmung hat sogar Kamel Daoud in seinem 2013 in Algier erschienenen, von der Kritik gefeierten Zwillings- und Gegenroman Der Fall Meursault ausgedrückt: »Er hat getötet, aber ich wusste, dass es sich um seinen eigenen Selbstmord handelte.«3 Die Anspielung auf den Roman Der Fall (1956), für den Camus 1957 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde und der ebenfalls um einen Suizid kreist, findet sich allerdings nur im Titel der deutschen Übersetzung; allein im Deutschen kann der Fall vor Gericht und der Fall als Sturz mit demselben Wort bezeichnet werden.
Warum wird der Suizid – zu Beginn der Abhandlung vom Mythos des Sisyphos – als einzig »wirklich ernstes philosophisches Problem« charakterisiert? Camus selbst hat diese Frage rasch übersetzt, nämlich in die Frage, »ob das Leben es wert ist, gelebt zu werden oder nicht«. Doch gegen diese Fassung des Problems lässt sich nicht nur einwenden, dass die Wahrnehmung des Lebens als »nicht lebenswert« historisch oft genug – etwa in den nationalsozialistischen Euthanasie-Programmen – als Urteil über das Leben anderer Menschen gefällt wurde, sondern auch, dass diese Wahrnehmung nicht zwingend zur Entscheidung für den Suizid führen muss. Es ist durchaus möglich, den Wert des Lebens zu leugnen, ohne das Leben aufgeben zu wollen; und für diese Möglichkeit argumentiert ja auch Camus, wenn er uns dazu auffordert, uns Sisyphos – mit dem letzten Satz seines Essays – als »glücklichen Menschen«4 vorzustellen. Wir könnten sogar behaupten, vermutlich im Einklang mit Camus, die Welt sei bevölkert von Menschen, die weder an einen höheren Sinn und Wert des Lebens glauben noch an die Notwendigkeit, den Ausweg des Suizids zu wählen. Und umgekehrt: Manche Menschen entscheiden sich für den Suizid, etwa in Gestalt des Selbstopfers oder Martyriums, gerade weil sie an einen höheren Sinn und Wert des Lebens glauben.
Naheliegender als die These, der Suizid bilde das einzig »wirklich ernste philosophische Problem«, weil er eine Entscheidung für oder gegen den Wert des Lebens treffe, erscheint darum die Frage, die seit der antiken Philosophie – und bis zu unseren heutigen Debatten um Sterbehilfe – leidenschaftlich diskutiert wird: Ist der Suizid erlaubt oder verboten? Sie verbirgt sich gern hinter Aspekten der Terminologie oder Übersetzung: Sollen wir von Suizid sprechen, von Freitod oder von Selbstmord? Die Rede vom Selbstmord erinnert an das Tötungsverbot des Dekalogs; sie wird darum in aktueller Literatur zumeist vermieden. Dennoch hat Vincent von Wroblewsky in seiner Neuübersetzung des Traktats vom Mythos des Sisyphos das französische suicide stets mit »Selbstmord« übersetzt, und dies vermutlich zu Recht. Camus selbst hat den Suizid nämlich in die Nähe des Mordes gerückt, nicht nur im Roman Der Fremde, sondern auch in den Entwürfen zu diesem Werk, die zwischen 1936 und 1938 entstanden, aber erst 1971, mehr als zehn Jahre nach dem Tod des Autors, unter dem damaligen Arbeitstitel Der glückliche Tod, veröffentlicht wurden. In dieser Erstfassung des Romans tötet der Protagonist, hier heißt er Patrice Mersault, den reichen Roland Zagreus, der seit einem Unfall, bei dem er beide Beine verloren hat, im Rollstuhl sitzt. Mersault tarnt den Raubmord erfolgreich als Selbstmord, was ihm insofern leichtfällt, als Zagreus sein Geld in einer Kassette aufbewahrt, gemeinsam mit einem Abschiedsbrief und einem Revolver, mit dem er gelegentlich herumspielt, um sich dann doch für die Fortsetzung des Lebens zu entscheiden.5 Sein Name verweist übrigens auf die thrakische Mythologie: Zagreus ist der Sohn des Zeus und der Persephone, häufig wird er als kleines Kind mit einem Stierkopf dargestellt. Mersault ist dagegen, offensichtlicher noch als in der publizierten Romanversion von 1942, ein Wiedergänger Rodion Raskolnikows.
Ist der Suizid erlaubt oder verboten? Das »Gesetz« Iwan Karamasows, von dem er sich »nie lossagen« will – »Alles ist erlaubt«6 –, schließt ausdrücklich den Suizid ein; nicht umsonst spricht Iwan im Gespräch mit Aljoscha mehrmals davon, mit dreißig Jahren den Becher gegen die Wand werfen und dem Schöpfer das Eintrittsbillet für die Welt zurückgeben zu wollen. Alles erlaubt? Am 10. Januar 1917 schreibt der Philosoph Ludwig Wittgenstein – an der Ostfront des Ersten Weltkriegs – in sein Tagebuch: »Wenn der Selbstmord erlaubt ist, dann ist alles erlaubt.«7 Der Satz lässt sich mühelos umkehren: Nur wenn alles erlaubt ist, dann ist auch der Selbstmord erlaubt. Diese Haltung hat jahrhundertelang die Rechtsprechung geprägt. Erst nach der Jahrtausendwende, am 3. November 2006, hat das schweizerische Bundesgericht den Suizid zum Menschenrecht im Sinne des Artikels 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention erklärt; noch bis 1961 galt der Suizidversuch dagegen etwa im Vereinigten Königreich als Straftat. So verurteilte ein Londoner Gericht am 9. Dezember 1941 die 29-jährige Jüdin Irene Coffee zum Tod durch den Strang, weil sie zwei Monate davor – gemeinsam mit ihrer Mutter – eine Überdosis von Schlaftabletten eingenommen hatte, um sich das Leben zu nehmen. Die Mutter starb, die Tochter überlebte und wurde nach geltendem Gesetz des Muttermordes angeklagt. Die Todesstrafe wurde erst im letzten Augenblick in eine lebenslange Haftstrafe umgewandelt.8 In BBC News vom 3. August 2011 erinnerte der Journalist Gerry Holt an einen anderen Fall aus dem Jahr 1958:
Die Polizei fand Lionel Henry Churchill mit einer Schusswunde in der Stirn, neben dem bereits teilweise verwesten Körper seiner Frau. Es ist schwer vorstellbar, wie emotional aufgewühlt er gewesen war. Er hatte versucht, sich im Bett der gemeinsamen Wohnung in Cheltenham das Leben zu nehmen und war gescheitert. Die Ärzte meinten, der 59-Jährige benötige eine medikamentöse Behandlung in einer psychiatrischen Klinik, aber die Behörden verweigerten die Zustimmung. Im Juli 1958 wurde er für sechs Monate inhaftiert, nachdem er des Suizidversuchs schuldig gesprochen worden war.9
Diese Urteile erscheinen uns heute widersinnig. Sie wurden begründet mit der Strafwürdigkeit des Versuchs, der Krone einen Untertanen (oder dessen künftige Steuerzahlungen) zu entziehen, was nichts anderes heißt als: Das Leben gehört nicht uns selbst. Auf diese scheinbar evidente Feststellung haben sich die meisten religiösen, moralischen oder rechtlichen Suizidverbote der Geschichte berufen. Die Frage, ob der Suizid erlaubt sei oder verboten, lässt sich daher in die Frage transformieren, wem unser Leben eigentlich gehört.
»Sich selbst gehören« heißt das vierte Kapitel von Jean Amérys berühmtem Plädoyer für den Freitod. Darin behauptet er als »Grundtatsache, daß der Mensch wesentlich sich selbst gehört – und dies außerhalb des Netzes gesellschaftlicher Verstrickungen, außerhalb desgleichen eines biologischen Verhängnisses und Vor-Urteils, das ihn zum Leben verurteilt«.10 Selbst in der Antike, die den Suizid meist respektierte, wurde diese »Grundtatsache« keineswegs anerkannt. Allzu leicht bewirkte eine militärische Niederlage oder die Unmöglichkeit, eine ökonomische Schuld zurückzuzahlen, den Verlust der Bürgerrechte; und dieser Verlust konnte sich auch auf die nächsten Generationen erstrecken. Ein Sklave gehörte nicht sich selbst, sondern seinem Besitzer, denn »der Sklave ist ein Teil des Herrn«, behauptete Aristoteles in seiner Politik.11 In den Briefen an Lucilius klagte Seneca, mehr als vierhundert Jahre später, »wie wenigen« es gelinge, »sich zu besitzen«, obwohl es doch »ein unschätzbares Gut« sei, »sein eigenes Eigentum zu werden«.12 Seneca glaubte also nicht, dass wir uns von vornherein selbst gehören, sondern dass wir dieses Ziel anstreben sollten; und er wusste auch, dass dieses »unschätzbare Gut« von uns verlangt, stets sorgfältig zu prüfen, »wie beschaffen das Leben ist, nicht wie lang es ist«. Wenn dem Weisen »vieles begegnet, was beschwerlich ist und die Ruhe stört, entlässt er sich; und das tut er nicht nur in äußerster Notlage, sondern sobald ihm sein Schicksal verdächtig zu werden beginnt, schaut er sich sorgfältig um, ob er etwa an dieser Stelle aufhören muss.«13 Seneca selbst hat diese Maxime konsequent befolgt, als ihn Neros Befehl zur Selbsttötung erreichte.
2.
Warum sind wir nicht die Eigentümer unseres Lebens? Und warum hält Seneca die Idee, »uns selbst zu gehören«,14 für keine »Grundtatsache«, sondern für ein schwer erreichbares Ziel und wertvolles Gut? Die Antwort liegt nahe, und sie wurde schon in frühester Zeit formuliert: Unser Leben gehört uns nicht, weil es uns geschenkt wurde, weil wir es uns nicht selbst gegeben haben. Wir haben uns nicht erzeugt; wir sind nicht unsere Urheber. Schon in den Veden – etwa in den rund dreitausend Jahre alten Shatapatha Brahmana – wurde diese Einsicht als elementares Schuldverhältnis imaginiert, weshalb David Graeber in seiner Geschichte der Schulden einige Sätze aus diesen Texten als Motto zitiert: »Durch die Geburt wird jedes Wesen als eine Schuld gegenüber den Göttern, den Heiligen, den Vätern und den Menschen geboren. Wenn man ein Opfer bringt, dann weil man den Göttern von Geburt an etwas schuldet.«15 Das Opfer ist die Gabe, die eine vorherige Gabe – die Gabe des eigenen Lebens: dass es uns überhaupt gibt – erwidert. Graeber hätte auch manchen Satz aus den prophetischen Büchern Israels, aus den griechischen Tragödien oder den berühmten Spruch Anaximanders anführen können: »Das Vergehen der seienden Dinge erfolge in die Elemente, aus denen sie entstanden seien, gemäß der Notwendigkeit: Denn sie zahlten einander Strafe und Buße für die Ungerechtigkeit nach der Ordnung der Zeit.«16 Dieser Satz ist übrigens rund tausend Jahre älter als die Theologie der Erbschuld, die der Bischof und Kirchenvater Augustinus im Streit mit dem britischen Mönch Pelagius entwickelt; er lässt allerdings – mit der Berufung auf einen Begriff der Gerechtigkeit und die »Ordnung der Zeit« – offen, wem wir unser Leben tatsächlich verdanken oder schulden. Der vedische Spruch nennt dagegen die Götter, Heiligen, Väter und Menschen als Instanzen, die uns das Leben geschenkt haben und folgerichtig ein Verbot des Suizids – als Verwerfung dieses Geschenks – fordern könnten.
Wem verdanken wir also das Leben? Die ersten Antworten auf diese Frage verschwinden im prähistorischen Dunkel. Sie verlangen geradezu nach einer Projektion der »Urszene« auf die Geschichte.17 Als »Urszene« hatte Sigmund Freud die Beobachtung des Geschlechtsverkehrs der Eltern bezeichnet, erstmals etwa in seiner Fallgeschichte des »Wolfsmanns«.18 Implizit war jedoch klar: Das Pathos dieses Begriffs bezog sich nicht allein auf das Sexualverhalten der Eltern,19 sondern auf das nachträgliche Wissen, selbst einer solchen Szene entsprungen zu sein. Seit Johann Jakob Bachofens Mutterrecht (1861) und Lewis Henry Morgans Urgesellschaft (1877) hat die Verwandtschaftsethnologie darüber gestritten, ob die sogenannten »Naturvölker« den Zusammenhang zwischen Sexualität und Fortpflanzung kennen. Bronisław Malinowski betont etwa in seiner Studie über das Geschlechtsleben der Trobriander (1929) deren »Unkenntnis vom ursächlichen Zusammenhang zwischen Geschlechtsverkehr und Schwängerung«. Ein Gewährsmann habe ihm berichtet, »daß er nach mehr als einjähriger Abwesenheit nach Hause zurückkehrte und ein neugeborenes Kind vorfand. Er erzählte mir das als Beispiel und endgültigen Beweis dafür, daß Geschlechtsverkehr mit Schwängerung nichts zu tun habe.«20 Vaterschaft, so folgerte Malinowski, werde als »soziale Vaterschaft« praktiziert; die Kinder jedoch verdanken ihre Geburt den Geistern verstorbener Vorfahren, die das Kind auf den Kopf der Frau legen. »Blut aus ihrem Körper strömt in den Kopf, und auf diesem Blutstrom rutscht das Kind allmählich nach unten, bis es sich im Schoß festsetzt.«21
Für eine Beantwortung der Frage, wem wir unser Leben verdanken oder schulden, spielt es allerdings keine Rolle, ob wir eine natürliche oder soziale Konstruktion von Verwandtschaft postulieren. Denn die prähistorische »Urszene« setzt eine Imagination von Geburt und Sterben voraus, die nicht auf die Bildung von Differenzen zwischen Natur und Kultur bezogen werden muss: eine Symbolisierung der Wege, auf denen wir zur Welt kommen und sie irgendwann wieder verlassen. Spuren dieser Symbolisierung lassen sich ausgerechnet in jener Zeit – vor rund siebzigtausend Jahren – entdecken, die der israelische Historiker Yuval Noah Harari als »kognitive Revolution«,22 analog zur agrarischen Revolution, bezeichnet. Als zentrale kulturelle Errungenschaft dieses Zeitalters, in dessen Verlauf Gruppen der Gattung Homo sapiens aus Ostafrika aufbrachen und Westeuropa besiedelten, auf die Neandertaler trafen und sich mit ihnen vermischten,23 behauptet Harari die Entwicklung einer Sprache der Fiktion: die »Fähigkeit, große Mengen an Information über Dinge zu kommunizieren, die gar nicht existieren«.24