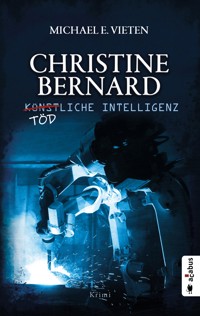Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: TWENTYSIX
- Sprache: Deutsch
"Der größte Friedhof ist der Friedhof der Träume und Hoffnungen. Seine unsichtbaren Gräber bedecken jeden Winkel dieser Welt. Was bereut man am Ende seines Lebens mehr? Das, was man getan hat, oder jenes, was man unterließ? Und was hast du aus den Talenten gemacht, die Gott dir auf deinen Weg mitgab?" Jason Wunderlich wurde nicht geboren, er wurde hervorgezerrt in ein Leben voller Mühsal, Enttäuschungen und widrige Umstände. Jeder soll nur so viel auferlegt bekommen, wie er tragen kann, heißt es. Doch bei Jason funktioniert das nicht. Er trifft eine folgenschwere Entscheidung und muss feststellen, dass im Himmel auch nicht alles glatt läuft. Dort hat man seine Akte verlegt. Jason muss mit dem Sterben warten. Am Ende seines Lebens liegt er hilflos und schwerst verletzt in einem Weinberg und hat alle Zeit der Welt, uns und seinem schmierigen 'Umzugshelfer' Benicio aus seinem Leben zu berichten. Ein Roman über die Last des Lebens, unerfüllte Träume und verlorene Hoffnung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 299
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Handlung in diesem Roman ist frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen wären rein zufällig und sind nicht beabsichtigt.
Vieten, Michael E., Das Leben und Sterben des Jason Wunderlich
2. überarbeite Ausgabe 2017
Informationen über den Autor und seine Arbeit auf: www.mvieten.de
Mein besonderer Dank geht an Prof. Dr. A. Raedler-Seidel für seine freundliche Genehmigung, die „Regenballade“ von Ina Seidel verwenden zu dürfen.
Der von mir verwendete wunderbare Liedtext „In einem kühlen Grunde“ stammt von Joseph von Eichendorff (1788-1857).
Ein Leben im Gegenwind. Das unglaublich langsame Sterben des Jason Wunderlich und seine große Suche auf seiner Reise durch die Zeit.
Es gibt Menschen, die hinterlassen keine Lücken. An sie wird sich niemand erinnern. Nicht, wenn sie sich von jemandem verabschieden oder ihn verlassen, und auch dann nicht, wenn sie sterben. Sie sind einfach nicht mehr da, und die Welt dreht sich weiter, als wäre nichts geschehen.
Inhaltsverzeichnis
Tag
Tag
Tag
Tag
1. Tag
Auf der von der Sonne verwöhnten Wiese am Bach steht eine prächtige Eiche. Sie wuchs nicht aus der Frucht, die im dunklen Wald auf den trockenen Boden herabfiel.
Mein Name ist Jason Wunderlich. Ich wurde in einer heißen Sommernacht in Düsseldorf geboren.
Unterdessen sich die schwarzen Fluten des Rheins in Richtung Nordsee wälzten und die Klimaanlage den Kreißsaal im Krankenhaus mühsam herunterkühlte, kämpften die Ärzte bereits um mein junges Leben. Es gab Schwierigkeiten während meiner Geburt, und so hatte ich schon bei meinem ersten Schritt auf dieser Welt ernsthafte Probleme.
Doch die Damen und Herren verstanden ihr Handwerk gut, und nachdem ich mir meinen Unmut aus dem Leib geschrien hatte, beglückwünschten sie sich, mich aus der Geborgenheit des warmen und schützenden Mutterleibs gerissen zu haben. Ich wurde nicht in diese Welt geboren, ich wurde hervorgezerrt.
Die Hitze jenes wolkenlosen Tages sollte ich mein Leben lang in mir tragen. Mein angeborenes aufbrausendes Gemüt musste von mir stets mühsam im Zaum gehalten werden. Versetzte ich meine Mitmenschen in früher Jugend gelegentlich in Erstaunen über einen unkontrollierten Wutanfall, so gelang es mir in reiferen Jahren zunehmend, diese jähzornigen Ausbrüche zu unterdrücken.
In mir brannte immer ein Feuer. Mal eines der Begeisterung, welches für Antrieb, Unternehmungslust, Hingabe und Zuversicht sorgte. Ein anderes Mal eines der Niedergeschlagenheit, der Enttäuschung, welches mich schwermütig und traurig werden ließ. Und ein weiteres Mal eines der Demut und der Schicksalsergebenheit. Was es auch war, es beherrschte mich. Ich kam nie zur Ruhe. Irgendein Dämon saß immer auf meiner Schulter.
Fortwährend war ich auf der Suche nach der Antwort auf die große Frage meines Lebens. Wozu war ich hier, und wann darf ich wieder gehen?
Stets war ich ein wenig anders als die Anderen. Was alle wollten, lehnte ich ab. Was mir gefiel, bekam ich nicht. Und wenn doch, so durfte ich es nicht behalten.
Wenn andere froren, blieb mir warm, und während es die meisten Menschen in ihrem Urlaub in den sonnigen Süden zog, liebte ich den kühlen, bewölkten und oft regnerischen Norden. Ich liebte den Sturm, das Meer und die Brandung, Gummistiefel und Gewitter.
Schon als Kind war mir die Schönheit von Regenwolken aufgefallen. Ihre Farben reichten von grau bis hin zu grün, rot, gelb und dunkelblau. Manchmal sogar fast schwarz.
Während sie über mich hinweg zogen und sich von ihrem Ballast befreiten, schaute ich zu ihnen hinauf. Dann schloss ich meine Augen und spürte kleine Rinnsale über mein Gesicht laufen und wie sich das weiche Wasser langsam seinen Weg durch meine Kleidung suchte.
Manchmal wurde ich anschließend mit dem Erscheinen eines Regenbogens belohnt. Dann stand ich nur da, wartete ergriffen, bis er wieder verschwunden war. So ein Regenbogen und die faszinierenden Polarlichter, die ich später auf meinen Reisen in den hohen Norden sah, blieben für mich immer Hinweise auf Gottes Hand.
Mutters Hand hingegen verpasste mir nach meiner Heimkehr an solchen Tagen einen Klaps an meinen Hinterkopf. Sie zog mir die nasse Kleidung aus, und ich verschwand sogleich in der Badewanne, gefüllt mit heißem Wasser und einer Badetablette darin. Diese Badetabletten sprudelten im Wasser, färbten es grün und dufteten nach Fichtennadeln. Ich liebte es, mich darauf zu setzen, während sie sich blubbernd auflösten.
Meine kindliche Vorliebe für Regenwolken hielt der Umerziehung durch die Erwachsenen nicht stand. Ich lernte: Sonne ist gut, Regenwolken sind nicht gut, Regen ist ganz schlecht. Es sei denn, man ist Gärtner oder Landwirt.
Demnach war der Himmel meines Lebens meistens bewölkt, und wenn die gute Sonne es doch einmal durch die bösen Regenwolken schaffte, ließ der nächste Schauer nicht lange auf sich warten.
Nachmittag.
Ich liege nun schon seit Stunden auf dem Rücken in diesem Wingert am Rande eines Weinbergs.
Ein Wingert ist jenes geordnete Grün eines Winzers, eines Weinbauern, welches sich in langen Reihen von Rebstöcken einen Hang hinauf zieht. Heutzutage modern und maschinengerecht an gespannten Drähten entlang. An besonders steilen Hängen stehen die Rebstöcke noch einzeln, traditionell mit zwei aufgebundenen Ästen, dem Bogen, links und rechts.
Zur Erntezeit im Herbst bedienen diese Weinberge mit ihrem bunten Laub und den reifen Trauben jede romantische Vorstellung eines Stadtmenschen von der Winzerei.
Von denen kann sich kaum einer vorstellen, welch unglaubliche Anstrengungen das ganze Jahr hindurch notwendig sind, bis dieses süffige Nass Wein endlich in Flaschen abgefüllt vor ihnen auf dem Tisch steht, um sie in feuchtfröhlicher Runde ihren Alltag in ihren Etagenwohnungen vergessen zu lassen.
Immer wieder muss der Winzer in den Berg und seinen Kampf gegen Unkraut, Schädlinge, Schimmel und wucherndes Laub führen. Doch nur ein einziger Hagelschlag, Frost zur Unzeit oder mangelnder oder übermäßiger Regen kann die Ernte gefährden und alle Mühen fruchtlos bleiben lassen.
Ich war eine Zeit lang bewusstlos. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Offenbar habe ich keinen heilen Knochen mehr im Leib. Ich spüre meinen Körper nicht mehr. Ich kann nicht sprechen. Ich glaube, mir ist kalt. Wie seinerzeit in jenem klimatisierten Kreißsaal, in dem man mir mein Leben aufzwang.
Der würzige Duft zerdrückter Kräuter unter meinem Körper steigt mir in die Nase. Darunter mischt sich der Geruch von Urin und Kot. Ich kann nichts mehr bei mir behalten. Ich kann nicht einmal mehr meinen Kopf drehen. Nur die Augenlider schließen und öffnen sich wie gewohnt, und ich kann schlucken, sehen, riechen, hören und flach atmen.
Mein Kopf liegt etwas erhöht, so, als wenn mir jemand ein Kissen in den Nacken geschoben hätte. Ich vermute, es ist ein Büschel Gras, ein dicker Ast oder ein Stein.
Ich kann meine Brust, meine Beine und meine Füße sehen und darüber hinaus ein Stück weit den Berg hinunter. Ich liege lang gestreckt an einem Hang, mit den Füßen voran und dem Gesicht nach oben. An meinem linken Fuß fehlt der Schuh. Er ist weg. Ich kann ihn nirgends entdecken. Tschüss Schuh.
Wenn ich meine Augen ganz nach rechts bewege, kann ich meinen Arm sehen. Er liegt seltsam verdreht im Gras. Meinen linken Arm sehe ich nicht. Ich schaue hinauf in den wolkenlosen Himmel.
Schmerzen habe ich keine. Ich sollte längst tot sein, aber ich lebe noch. Damit habe ich nicht gerechnet. Vor dem Tod habe ich keine Angst, aber vor Siechtum und Schmerzen. Wenigstens die Schmerzen bleiben mir erspart.
Jetzt kann ich nichts mehr tun. Ich muss hier liegen bleiben und ausharren. Stunde für Stunde. Bis es endlich vorbei ist und das Leben mit einem letzten Flackern von mir weicht.
Hoffentlich bald.
Ich spüre Panik in mir aufsteigen. Was habe ich nur getan?
Der leichte Spätsommerwind streicht über mich hinweg, flüstert mir zu und nimmt mir meine Furcht.
Ich habe mich entschieden und muss das hier jetzt ordentlich zu Ende bringen.
Ich war schon oft unbeweglich, und mich hat irgendwer oder irgendwas daran gehindert, zu tun, wonach mir gerade der Sinn stand. Und jedes Mal war es für mich schwer zu ertragen. Immer wenn ich in eine scheinbar ausweglose Lebenssituation geraten war, quälte mich diese bleierne Unbeweglichkeit, fühlte ich mich wie gelähmt, aufgehalten, behindert, hingehalten.
Zum Beispiel, wenn mein Vater mich stundenlang in meinem Kinderwagen fixiert hat. Das tat er immer dann, wenn er seine Ruhe haben wollte oder während er mit mir durch die Kneipen zog. Er war zu jener Zeit oft arbeitslos und ließ bei den Wirten anschreiben. Meine Mutter sorgte damals mit ihrem bescheidenen Gehalt als Buchhalterin für das Einkommen unserer kleinen Familie und bezahlte seine Deckel. Anstatt ihr zu danken, schlug er sie. Weil er es nicht ertragen konnte, von ihr abhängig zu sein.
Wie ein Käfigtier saß ich abends oft noch in meinem Kinderwagen und schaukelte apathisch hin und her. Ich quiekte vor Freude, wenn Mutter erschöpft von der Arbeit nach Hause kam und mich endlich von meinen Fesseln befreite.
Ich selbst konnte mich an diese Zeit nicht erinnern. Meine Mutter erzählte mir erst viele Jahre später davon.
Meine erste, wenn auch lückenhafte Erinnerung, die mir selbst von meinem Vater im Gedächtnis blieb, habe ich von einem Tag im Jahr 1966 ohne Fixierung am Flussufer. Mein Vater und ich kickten einen Ball über die Rheinwiesen. Den Geruch des damals noch verunreinigten Wassers durch Chemieabfälle und Fäkalien habe ich nie mehr vergessen. Meine Mutter saß nicht weit von uns entfernt auf einer Bank, genoss die wärmenden Sonnenstrahlen und beobachtete uns. Es war wohl einer der wenigen Momente, in denen meine Mutter die Familie hatte, die sie sich wünschte, und für die sie alle Unbill auf sich nahm.
Ich erinnere mich auch noch an ein kleines, graues Haus und einen großen Garten. Meines Vaters Eltern großer Garten. Was für ein Paradies.
Es war der schönste Garten, den ich je in meinem Leben sehen sollte. Alle Gemüsebeete waren von umgekehrt in den Boden gesteckten bunten Glasflaschen eingesäumt. Es gab dort Obstbäume, deren Äste schwer mit Früchten behangen bis zum Boden reichten, sodass auch ich, so klein wie ich noch war, sie erreichen konnte. Und die herrlichen Büsche. Johannisbeeren, Stachelbeeren, Himbeeren, Brombeeren. Und erst die von der Sonne gereiften Erdbeeren. Prall und dunkelrot glänzend. Was für ein Paradies. Mein Paradies.
Doch mein Paradies ging mir verloren. Meine Eltern ließen sich scheiden und meine Mutter bekam vom Gericht das alleinige Sorgerecht zugesprochen. Ich betrat diesen Garten nie wieder. Auch die Liebe und Fürsorge von Omas, Opas, Tanten und Onkeln lernte ich nicht kennen. Mutter war eine Kriegsvollweise aus Ostpreußen und hatte keine Verwandten. Im eisigen Januar 1945 flüchtete sie vor den heranrückenden Truppen der Roten Armee in den Westen. Jegliche Dokumente mit Hinweisen auf ihre Herkunft gingen kurz vor Kriegsende verloren.
Mein Kontakt zu Vater und seiner Familie brach nach der Scheidung ab. Ich habe meinen Vater und seine Verwandten nie wieder gesehen. Er starb einsam Anfang der achtziger Jahre, kurz nach seinem zweiundfünfzigsten Geburtstag.
Ich erfuhr von Vaters Tod durch einen Polizeibeamten, der eines Morgens überraschend vor meiner Tür stand. Er sprach mir sein Beileid aus und teilte mir die letzte Adresse meines Vaters mit. Ich kümmerte mich um seinen Nachlass.
Mein Vater hatte nach der Scheidung von meiner Mutter nicht wieder geheiratet. Sein ungewöhnlich aufgeräumtes Appartement in einer Wohnblocksiedlung war mit Möbeln aus den fünfziger und sechziger Jahren eingerichtet. Ich fand nur wenige persönliche Gegenstände und zwei Fotoalben. Kein Bild darin wurde vor weniger als zwanzig Jahren aufgenommen. Schwarz-weiß. Jason mit Mama, Mama mit Jason, Jason mit Oma, Opa, Jason im Zoo, Jason im Schnee, Weihnachten, Ostern, Jason im Garten.
In der Wohnanlage kannten meinen Vater nur sein Nachbar und dessen Frau. Für mich sah es so aus, als hätte er nach der Scheidung von meiner Mutter aufgehört zu leben.
Gerne hätte ich erfahren, wie er diese Welt gesehen hat.
Schon vor der Scheidung von meinem Vater zog meine Mutter vorübergehend zu einer Freundin in deren kleine Wohnung. Mutter ging weiter arbeiten und versteckte mich in einem Kindertagesheim. Ich war das einzige Kind, welches auch dort übernachtete. Alle anderen Kinder wurden abends von ihren Eltern wieder abgeholt. Ich hingegen verblieb in der Obhut der leitenden Kinderschwester. Wo ich mich befand, hat Mutter meinem Vater nicht verraten. Sie wollte nicht, dass er mich besucht.
Meine Mutter befürchtete, Vater könnte mich in ihrer Abwesenheit aus Rache entführen, nicht mehr herausgeben und einfach bei sich behalten.
Meine Erinnerung an die Zeit im Kindertagesheim ist auch nur unvollständig vorhanden.
Es gab dort einen langen, dunklen fensterlosen Flur mit Linoleumboden. Dieser Flur machte mir Angst. Auf der einen Seite hingen die Jacken und Mäntel der Kinder in langen Reihen an ihren Haken an der Wand. Von der anderen Seite fiel spärliches Licht durch kleine Oberlichter über den Türen zu anliegenden Räumen und sorgte für ein Licht- und Schattenspiel, welches genug Raum für meine Fantasien bot. Die Lichtschalter waren so hoch angebracht, dass ich sie nicht erreichen konnte. Wenn mein Weg mich durch diesen Flur führte, fürchtete ich, dass aus den Kleidungsstücken Arme und Hände nach mir greifen und mich in irgendein dunkles Reich ziehen könnten.
Mutter besuchte mich an den Wochenenden. Wir gingen in den Zoo, in den Stadtpark oder ein Eis essen. Eines Tages brachte sie mir ein großes, teures ferngelenktes Auto mit. Es sei ein Geschenk von Mutters neuem Mann, verkündete sie verlegen. Ein roter Mercedes. Er war mein ganzer Stolz. Leider waren die Batterien schnell leer. Und so stand das Auto die meiste Zeit auf der Fensterbank in meinem Zimmer, bis meine Mutter mich wieder besuchte und mir neue Batterien mitbrachte. Ihren neuen Mann lernte ich erst später kennen. Er hatte am Wochenende keine Zeit für mich.
An den großen Spielplatz neben der Kindertagesstätte erinnere ich mich gern. Dort standen viele Klettergerüste auf tiefem, grobem Sand und eine Affenschaukel aus einem alten Traktorreifen.
An einem Morgen gab es beim gemeinsamen Frühstück einen Tumult. Ich war der Anlass, weil ich einem anderen Jungen seine Tasse Kakao über den Kopf geschüttet hatte. Warum weiß ich nicht mehr.
Er saß nur da und schrie. Ich schwieg, trank weiter meinen Kakao und schaute ihm über meinen Becherrand hinweg beim Schreien zu. Eine der Schwestern brachte ihn in den Waschraum.
Daraufhin legte man meiner Mutter nahe, mich wieder zu sich zu nehmen. Sie holte mich ein paar Tage später mit ihrem neuen Mann ab. Ein kleiner dicker Kerl mit Hut, Brille und wenigen schwarzen Haaren auf dem Kopf. Reinhard. Er fuhr ein großes, schwarzes Auto. Sicher war es teuer. Was mich nicht davon abhielt, mich bei fast jeder Fahrt auf der Rücksitzbank zu übergeben. Ich vertrug Autofahrten lange Zeit nicht. Wann genau Mutter und Reinhard sich ewige Treue geschworen hatten, wusste ich nicht. Sie waren schon verheiratet, als sie mich von der Kindertagesstätte abholten.
Die neue Wohnung war groß. Ich bekam ein eigenes Zimmer.
Wer kennt nicht den Satz, der von Vorgesetzten in einem Arbeitszeugnis für den Kollegen, bei dem man sich als Nächstes bewirbt, als Warnung eingefügt wird. 'Er/sie bemühte sich stets, die an ihn gestellten Anforderungen zu erfüllen.' Klingt zwar nicht schlecht, aber nach Schulnoten bedeutet das ungenügend. Sechs, setzen.
Reinhard bemühte sich auch. Vielleicht sogar ehrlich. Aber ich war nicht sein Sohn. Und das konnte ich spüren.
Abends, vor dem Zubettgehen, ließ er mich gerne im Schlafanzug vor dem Sofa antreten, um mich für irgendeine Verfehlung zu maßregeln. Oder er forderte mich auf, auswendig gelernte Gedichte, das Einmaleins oder Länder und deren Hauptstädte aufzusagen. Offenbar glaubte er, erzieherische Maßnahmen dieser Art sei er mir schuldig. Aus mir soll doch mal was werden, bekräftigte er. In dem Arm genommen hat er mich nie.
An einem solchen Abend schlug er einmal wegen einer unbedeutenden Ungezogenheit mit einem Kleidungsstück nach mir. Er verfehlte mich, und der schwere Schieber des Reißverschlusses traf die Glasscheibe in der Wohnzimmertür. Als er mich später vor dem Glaser für die kaputte Scheibe verantwortlich machte, stellte ich die Situation peinlich genau richtig, was der Harmonie zwischen uns nicht förderlich war. An jenem Tag spürte ich das erste Mal den mächtigen Drang in mir, die Wahrheit zu sagen. Ungeachtet der Folgen.
In dieser Zeit begann ich damit, unbemerkt kleine Lebensmittelvorräte in meinem Kinderzimmer anzulegen, weil Reinhard mich oft zur Strafe ohne Abendbrot zu Bett schickte. Ich stahl in Mutters Küche alles, wessen ich habhaft werden konnte und lagerte es unter meinem Bett, in meinem Kleiderschrank oder in den Hohlräumen von Möbelstücken. Oft lag ich heimlich im Dunkeln unter meiner Bettdecke, stillte meinen Hunger und lauschte dabei, ob sich jemand der Zimmertür näherte.
Die Verluste fielen meiner Mutter zwar auf, sie konnte sich den Verbleib der Lebensmittel aber zunächst nicht erklären.
Da ich mich nicht immer an alle Verstecke erinnern konnte, gammelten meine Schätze im Verborgenen vor sich hin, und ihr Geruch brachte meine Mutter beim Hausputz auf deren Spur. Das hatte ein erneutes Antreten vor Reinhards Sofa und die Konfiszierung meiner Vorräte zur Folge. Noch am gleichen Abend machte ich auf meinem Gang vom Badezimmer in mein Kinderzimmer einen Umweg durch die Küche und begann damit, wieder neue Lebensmittel zu verstecken. Geprägt durch diese Erfahrungen in meiner frühen Jugend bildete sich eine Art Eichhörnchen-Gen in mir. Ich hatte zwar noch keinen Krieg miterlebt, aber wenn er ausbräche, wäre ich nicht unvorbereitet. Was mir später als erwachsener Mensch wichtig war, besaß ich doppelt, und die Lebensmittelvorräte in meiner Wohnung reichten immer für mehrere Monate.
Abend.
Patamm, patamm. Patamm, patamm. So schallt es zu mir herunter. Immer dann, wenn ein Fahrzeug über die Dehnungsfugen der Autobahnbrücke über mir fährt. Patamm, patamm. Patamm, patamm. Darunter mischt sich das gleichmäßige Rauschen von vorbeifahrenden Fahrzeugen auf einer nahe gelegenen Landstraße.
Es ist früher Abend. Die Spätsommersonne verschwindet hinter den Betonpfeilern der mächtigen Talbrücke. Ihre Schatten reichen weit über das Gelände vor mir. Über dem Boden bilden sich Nebelschwaden, deren Feuchtigkeit legt sich auf die Erde, das Gras und die Rebstöcke. Je nachdem, welche Rebsorte angebaut wurde und welche Pläne der Winzer mit dem Ausbau seines Weines verfolgt, ist das nicht gut für die heranreifenden Weintrauben. So können sich Schimmelpilze bilden und die Trauben beginnen zu faulen.
Es ist sicher kühl geworden, aber ich fühle weiterhin keine Temperatur. Unter den Geruch von meinen verlorenen Fäkalien und den zerdrückten Kräutern mischt sich jetzt der Duft der feuchten Erde.
Rechts von mir, am Ende einer Reihe Rebstöcke, liegt ein großer Stein. Dem Winzer war es wohl zu mühsam, ihn aus seinem Weinberg zu entfernen. Wenn ich meine Augen ganz nach rechts bewege, kann ich eine Krähe darauf sitzen sehen. Ich habe sie bemerkt, als sie heran geflogen kam, ihr aber keine weitere Beachtung geschenkt. Sie beobachtet mich mit einem Auge und schüttelt ihr Gefieder. Ich höre es rascheln.
Krähen fressen Aas. Wenn sie mich für tot hält, wird sie an mir herumpicken. Ich bewege die Augen und atme so tief aus und ein, wie es mir noch möglich ist. Doch mir gelingt nur ein schwacher Hauch, und die Krähe bleibt unbeeindruckt auf dem Stein sitzen und beobachtet mich weiter. Sie hält ihren Kopf schräg nach oben, als ob sie die Brücke hinauf schaut.
Dann hüpft sie von dem Stein herunter und spaziert in meine Richtung. Mit jedem Schritt vollführt ihr Kopf eine Nickbewegung. Sie schaut mal hier hin, mal dort hin. Doch sie kann mich nicht täuschen. Sicher überlegt sie sich angestrengt, ob eine Attacke gegen mich für sie gefahrlos ist. Ich lasse sie nicht aus den Augen und atme so laut, wie ich kann, während sie sich mir vorsichtig nähert.
In Schlangenlinien umrundet sie mich und kommt mir dabei immer näher, um sich sogleich wieder ein kleines Stück zurückzuziehen. Sie prüft, ob ich mich bewege, wenn sie ihre Fluchtdistanz kurz unterschreitet, schießt es mir durch den Kopf. Ihr Angriff steht unmittelbar bevor.
Ich habe gelesen, dass Krähen zuerst die Augen von Kadavern fressen. Mein Herz schlägt mir vor Angst sicher bis zum Hals, aber auch das kann ich nicht mehr spüren.
Plötzlich schwingt sich die Krähe auf und gleitet ein Stück davon. Sie scheint vor irgendetwas geflüchtet zu sein. Vielleicht ein größeres Tier. Ein Fuchs, ein Hund, eine Katze, ein Greifvogel etwa. Wenn dieses Tier mutiger ist als diese Krähe, stehen mir schreckliche Stunden bevor.
Jetzt höre ich Schritte hinter mir durch das Gras auf mich zukommen. Ein Mensch. Gott sei Dank. Ich werde gefunden. Ich werde gerettet.
"Wie kommst du darauf, dass du gerettet wirst? Du wolltest doch sterben." Ein großer, schlanker Mann steht vor mir und schaut zur Brücke hinauf. Dann schüttelt er seinen Kopf. "Wirklich unangenehm das Ganze, nicht wahr?" Dabei schaut er der Krähe nach, die sich wankend von uns entfernt, als hätte sie heute noch etwas Besseres zu tun. Dann setzt er sich breitbeinig auf den großen Stein und zündet sich mit einem goldenen Feuerzeug eine Zigarette an, die er einem ebenfalls goldenen Etui entnommen hat. Er zieht den Rauch seines ersten Zuges tief in seine Lunge ein, lässt das Feuerzeug in seiner Jackettasche verschwinden und klappt mit einer Hand das Etui zu. Klack. Mit einer geübten Bewegung lässt er es in die andere Jackettasche gleiten. Dann atmet er aus und bläst den Rauch in meine Richtung.
Diese Vorstellung wirkt auf mich wie ein exakt einstudiertes Ritual, welches eine genau beabsichtigte Wirkung erzielen soll. Ich bin cool. Bist du auch so cool?
Ich atme ein. Der Tabakrauch riecht angenehm. Mein Besucher beugt sich nach vorn und stützt seine Unterarme auf seinen Knien ab. Dabei rutschen seine Jackettärmel zurück und geben den Blick auf eine protzige goldene Uhr und eine goldene Panzerkette an seinen Handgelenken frei. Er schaut mich einen kurzen Moment schweigend an und zieht mit gerunzelter Stirn wieder an seiner Zigarette.
"Bist du Nichtraucher? Obwohl, das spielt jetzt wohl keine Rolle mehr, oder?" Rauch quillt aus seinem Mund, während er spricht. Ich kann seine Socken sehen. Die Hosenbeine seiner Anzughose sind herauf gerutscht. Es sind schwarze Socken. Sie verschwinden unten in polierten, schwarzen Schuhen und oben in hellbeigefarbenen Hosenbeinen. Er trägt ein weißes Hemd mit dunklem Schlips. Was macht jemand in diesem Aufzug hier draußen?
Sein Gesicht ist glatt rasiert, seine dunklen Haare sind zurückgekämmt. An seinem rechten kleinen Finger steckt ein klobiger Siegelring. Er sieht aus wie ein Versicherungsvertreter oder ein Zuhälter.
Was ist denn das für ein schmieriger Typ? Und zu meiner größten Überraschung antwortet er mir.
"Na, na. Nicht so unhöflich. Ich organisiere deinen Umzug. Nur habe ich heute meinen freien Tag. Deswegen liegst du noch hier. Sagen wir mal so, dein Ableben kommt uns etwas ungelegen. Personalmangel. Aber du kannst dich ja beim Alten beschweren."
Ich bin völlig irritiert. Bei was für einem Alten? Und wieso weiß er, was in meinem Kopf vorgeht?
"Tja, Kumpel. Dann denk doch mal nach. Bist doch ein schlaues Kerlchen."
Ich habe es mir zwar immer anders vorgestellt. Aber der Kerl da muss der Tod sein. Sicher ist er hier, um mich jetzt zu holen. Allerdings missfallen mir seine überhebliche Art und seine für meinen Geschmack zu lässige Ausdrucksweise. Immerhin handelt es sich dabei für mich um einen überaus bedeutenden Vorgang.
"Du bist der Tod, nicht wahr? Du kommst, um mich zu holen." Obwohl kein Laut über meine Lippen kommt, verzieht er sein Gesicht.
"Der Tod, der Tod", wiederholt er. "Stellst du dir so den Tod vor, Jason? Ich bin sozusagen ein Mitarbeiter einer großen Company. Überleg' doch mal, wie viele Leute am Tag so abtreten. Kann einer alleine doch gar nicht schaffen. Mein Job ist es, solche Freaks wie dich hier abzuholen und euch am Empfang abzugeben, damit ihr da drüben nicht herumirrt und alles durcheinander bringt. Auch kein leichter Job. Du siehst ja noch manierlich aus, obwohl, du stinkst. Aber der Motorradfahrer letzte Woche, manno Mann. Kein schöner Anblick. Und was heißt: '… mich holen?' Du hörst nicht zu. Ich habe meinen freien Tag. Du musst warten."
„Warten? Soll ich hier etwa bewegungsunfähig die Nacht verbringen müssen, weil gerade niemand Zeit für mein Ableben hat? Erlösung stelle ich mir anders vor. Es dämmert bereits. Weinberge werden nachts von Füchsen, Wildschweinen und allerlei anderem Getier durchstreift. Wahrscheinlich werden sie mich anfressen. Allein der Gedanke daran ist mir unerträglich.“
"Tut mir leid, mein Freund. Deine Papiere sind noch nicht ausgestellt. Aber das hast du dir selber zuzuschreiben. Du wärst erst in mehr als dreißig Jahren dran gewesen. Und wie gesagt, ich habe heute meinen freien Tag. In zwei Stunden treffe ich mich mit einer Kleinen aus der Verwaltung. Die baggere ich schon seit Monaten an."
Er schaut auf seine protzige Uhr, schnippt die Zigarettenkippe fort und steht auf. Dann lässt er seinen Blick in Richtung Mosel und die gegenüberliegenden Hänge schweifen.
"Eine schöne Gegend. Wirklich eine schöne Gegend."
Er schreitet durch das feuchte Gras an mir vorbei und verschwindet aus meinem Blickfeld.
"Kopf hoch, Kumpel. CU."
Ich höre, wie sich seine Schritte hinter mir entfernen.
Ich bin wieder allein.
Bis ich in die fünfte Schulklasse kam, wohnten wir in einer drei Zimmer Wohnung im dritten Stock eines großen Mehrfamilienhauses in Düsseldorf-Rath.
Mein bester Freund hieß Peter. Er wohnte in einem Haus gleicher Bauweise nebenan, auf derselben Etage wie wir. Die beiden Wohnblocks wurden direkt aneinander gebaut. Unsere Mütter unterhielten sich gerne von Balkon zu Balkon. Mehrmals planten Peter und ich, den geringen Abstand der Geländer zu nutzen, um von einem Balkon auf den anderen zu klettern. Auf diese Weise hätten wir uns den Umweg durch die beiden Treppenhäuser erspart, wenn einer den anderen besuchen wollte. Doch wir haben es nie gewagt, unseren Plan in die Tat umzusetzen. Unser Respekt vor der erheblichen Höhe hielt uns davon ab.
Dass Peter seit seiner Geburt die linke Hand und der halbe Unterarm fehlten, störte mich nicht. Er war mein bester Freund. Und er war ebenso vernarrt in die Figuren von Karl May wie ich. Winnetou und Old Shatterhand. Das war unser tägliches Spiel auf dem verwilderten Damm der Stadtbahn.
Und dann war da noch Ulrike, genannt Ulli. Ulli war wie wir. Wild, unerschrocken und ein begeisterter Indianer. Sie war ein Mädchen. Das wussten wir. Was es genau bedeutet, wussten wir nicht. Bis auf den kleinen Unterschied. Den hatte ich mir an einem Sommernachmittag bei einem Sturz von einem Baum verletzt. Ein selbst geschnitztes Holzmesser, welches ich im Hosenbund bei mir trug, stach hinein, als ich auf dem Boden aufschlug. Höchst interessiert nahm Ulli die Verletzung in Augenschein und entschied, dass ich umgehend ins nahe gelegene Krankenhaus muss. Also suchten wir die Notaufnahme auf. Eine verständnisvolle und amüsierte Krankenschwester kümmerte sich um den Kratzer, um Ulli nicht wegen ihres Übereifers vor Peter und mir bloßzustellen. Ulli und Peter kicherten noch tagelang darüber, wie die Krankenschwester mein bestes Stück versorgte.
Die Zeit in Rath mit Ulli und Peter war eine glückliche Zeit für mich. Doch sie sollte schon bald zu Ende sein.
Reinhard hatte sich selbstständig gemacht. Er war jetzt Immobilienmakler. Das Startkapital hatte er von meiner Mutter. Sie hatte sich ihre bis dahin erworbenen Rentenansprüche auszahlen lassen, was sie später bitter bereuen sollte.
Wir zogen um. Nach Ratingen. In ein großes, weißes Haus. Es war eine Villa auf einem riesigen Grundstück in Ortsmitte. Allein das Wohnzimmer war mehr als 100 Quadratmeter groß. Ich musste die Schule wechseln. Dadurch verlor ich alle meine Freunde und die nette Klassenlehrerin aus der Grundschule.
Mein Klassenlehrer in der neuen Schule, Herr Grantner, war ein ehemaliger Polizist, der aus gesundheitlichen Gründen seinen Dienst dort quittieren musste. Um die Aufmerksamkeit seiner Schüler während seiner langweiligen Unterrichtsstunden wiederzuerlangen, warf er mit Kreide, seinem Schlüsselbund oder sonstigen Gegenständen nach ihnen. Meist traf er uns nicht, aber das Geräusch des Wurfgeschosses riss uns unsanft aus unseren Tagträumen, wenn es neben einem aufschlug.
Ich hasste diesen Kerl. Er stank nach einem Rasierwasser, welches einen Würgereiz bei mir hervorrief, wenn er dicht neben mir stand. Also saß ich in seinem Unterricht nur meine Zeit ab. An irgendeinem Tag fragte er mich etwas auf seine penetrante Weise, und ich antwortete völlig zusammenhanglos. "Draußen blüh'n die Rosen schön." Dabei sah ich aus dem Fenster und ignorierte ihn.
Sekundenlang war es still im Klassenzimmer, niemand wagte etwas zu sagen, geschweige denn zu lachen. Ich blickte in die verständnislosen Gesichter der anderen Schüler und begann laut hysterisch zu lachen. Zu komisch sahen sie aus, in ihrer maßlosen Ratlosigkeit, was wohl in diesen Spinner aus Rath gefahren war.
An einem anderen Tag sollten wir in den letzten zwei Schulstunden einen langen Aufsatz über unseren letzten Traum schreiben. Ich kritzelte fünf Worte in mein Heft, stand auf, nahm meinen Ranzen, knallte das Heft im Vorbeigehen auf das Lehrerpult und ging nach Hause. 'Ich träume, dass ich träume.', stand darin geschrieben.
Solcherlei Scherze liebte Herr Grantner überhaupt nicht und verteilte Tadel und Eintragungen ins Klassenbuch. Diverse blaue Briefe folgten, deren Posteingang ich bei uns Daheim größtenteils abfangen konnte.
Ich kam mit dem Unterrichtsstoff nicht mit und meine Versetzung in die sechste Klasse war gefährdet. Meine Mutter ließ mich auf den Rat der Schulleitung hin die fünfte Klasse wiederholen.
Meine neue Klassenlehrerin hieß Frau Winckler. Ich fand sie ausgesprochen attraktiv und sympathisch. Sie roch gut, hatte lange rote Haare, grüne Augen und eine beeindruckende Oberweite. Damit bediente sie alle meine frühpubertären Bedürfnisse und Fantasien. Ich genoss ihre Aufmerksamkeit und Betreuung, und mir wurde heiß und kalt gleichzeitig, wenn sie neben mir stand und meine Hausaufgaben kontrollierte.
Ich lernte für sie und lieferte ihr Bestnoten. Mein Notendurchschnitt war so gut, dass man beschloss, mich eine Klasse überspringen zu lassen. Dann wäre ich wieder in die Klasse von Herrn Grantner gekommen. Aber eine andere Katastrophe kam dieser zuvor. Frau Winckler eröffnete uns, dass sie schon seit Langem lieber an einer anderen Schule lehren wollte und sie nun ein Angebot von dort erhalten hätte. Sie nahm es an und verließ uns. An ihre Stelle trat Hinkebein.
Da war er also, mein erster Liebeskummer. Begleitet von der Niedergeschlagenheit durch die erste Erkenntnis über die Sinnlosigkeit, etwas nur für jemand anderen anstatt auch für sich selbst tun zu wollen.
Kurz darauf wurde ich schwer krank und musste das Bett hüten. Ich fieberte heiß und fantasierte lautstark über wilde Tiere, von denen ich kurz zuvor in Brehms Tierleben gelesen hatte. So bestand ich darauf, dass eine Großkatze, ein Löwe oder ein Tiger, am Fußende meines Bettes Platz nehmen würde, sobald meine Mutter den Raum verlässt. Sie machte sich größte Sorgen. Unser Hausarzt war ratlos und beschäftigte meine Mutter damit, mir fiebersenkende Wadenwickel anzulegen.
Schon bald setzte meine Genesung ein und das Fieber sank.
Hinkebein war grauhaarig, blass und meistens so hell gekleidet, dass man kaum mehr als ihren schwarzen Koffer vorbei schweben sah, wenn sie an einer weiß gestrichenen Wand entlang ging. Dabei bezog sich ihre Blässe auch auf ihre Persönlichkeit. Ebenso blass wie sie selbst war später auch meine Erinnerung an Hinkebein. Obwohl sie mir bis zum Ende meiner Schulzeit als Klassenlehrerin erhalten blieb. Vielleicht hatte ich meine Erinnerung an sie auch nur erfolgreich verdrängt. Nur ihr Satz '… aus dir wird nichts' klang mir oft noch in den Ohren. Hinkebein nannten wir sie, weil sie nach einer Verletzung ein Bein nachzog.
Mein Notendurchschnitt sank bei ihr wieder und die Versetzung in Grantners Klasse war vom Tisch.
Reinhards Geschäfte liefen gut, es fehlte uns an nichts. Ich erlebte eine Zeit in Wohlstand und Sicherheit. Ich spielte mit meinen Klassenkameraden im eigenen Park, Reinhard chauffierte uns in seinen teueren Autos, wir aßen in den besten Restaurants, und in der Schule galt ich als Sohn reicher Eltern.
Wenn wir am Wochenende bei Reinhards Geschäftspartnern eingeladen waren, sah und spürte ich die Polster, die ein sorgenarmes Leben ermöglichen. Es gab üppige Essen, die Herren hatten feine, gut riechende Damen an ihrer Seite, man saß in dicken Sesseln, lief auf flauschigen Teppichen und man hatte ein eigenes Schwimmbad im Haus.
Wenn ich am Abend müde wurde, schlief ich bis zur Heimfahrt auf einem teuren Ledersofa des Gastgebers, und man brachte mir eine flauschige Decke.
Während Reinhard unseren Wagen durch die kalte Nacht nach Hause lenkte, lag ich schlummernd auf der Rückbank und meine Mutter schaute hin und wieder nach mir.
Ich war zwar nicht Reinhards Kind, aber ich war das einzige Kind in seinem Haus. Diesen Vorteil genoss ich. Je mehr er arbeitete und damit beschäftigt war, unseren Wohlstand zu sichern, desto seltener musste ich vor seinem Sofa antreten. In dieser Zeit lag ich schon im Bett, wenn er abends nach Hause kam, und befand mich schon auf meinem täglichen Weg in die Schule, wenn er morgens aufstand.
Als meine Mutter Nachwuchs bekam, Axel, ahnte ich sogleich, der Kerl macht irgendwann Ärger. Mein Halbbruder war Reinhards Sohn und das schwächte meine Position in der Familie. Außerdem machte er mir Arbeit, kostete Nerven und schränkte meinen Bewegungsradius ein. Ich war nämlich in Abwesenheit meiner Mutter für ihn verantwortlich. Und da sie zunehmend mit Büroarbeit beschäftigt war, hatte ich Axel an der Backe.
Als Reinhard mir das wichtigtuerisch eröffnete, glaubte er offenbar, dass ich nichts lieber täte als das. Aber Axel war einfach nur ein neues Problem in meinem Leben.
Alles was bis dahin mir gehörte, gehörte nun auch ihm. Ich musste nicht nur Lebensmittel verstecken, sondern auch meine liebsten Spielsachen vor der Zerstörungswut eines Kleinkindes in Sicherheit bringen. Wenn er anfing zu heulen, sollte ich groß und vernünftig sein und ihm geben, was er verlangte. Ich sollte nur noch im Park spielen, weil ich mit ihm nicht die Straße überqueren durfte.
Meine Kinderzeit war vorüber. Ich wurde mit einer Verantwortung beladen, die ich nicht tragen konnte. Und nicht wollte.
Während Reinhard unseren Komfortbereich ausweitete, indem er mit uns kostspielige Reisen unternahm, für unser allgemeines Wohlbefinden sorgte und ein zweites Auto in die Doppelgarage stellte, entdeckte Mutter die Emanzipation.
Aus meiner Aushilfstätigkeit als Kindermädchen für Axel wurde ein Vollzeitjob. Meine Mutter ließ sich ein zweites Mal scheiden und hatte es sich in den Kopf gesetzt, wieder arbeiten zu gehen. Nun ja, eine gewisse Notwendigkeit dazu war durchaus zu erkennen. Schließlich zog sie zwar überaus selbstbewusst mit ihren beiden Kindern aus dem schönen, großen Haus aus und verzichtete für uns drei auf alle Annehmlichkeiten, aber sie hatte kein eigenes Einkommen. Und Reinhard zahlte zu ihrer Überraschung keinen Unterhalt. Da saßen wir nun am Stadtrand, in einer billigen Drei-Zimmer Dachwohnung ohne Heizung im dritten Stock. Von dort aus betrug der Weg zur Schule fünf Kilometer. Da wir nun auch kein Fahrzeug mehr besaßen und Mutter das Geld für den Bus fehlte, marschierten wir jeden Morgen zu Fuß hinunter in die Stadt. Meine Mutter stieg in den Zug, mit dem sie zur Arbeit fuhr, und ich tat, wie mir befohlen wurde, und lieferte meinen Halbbruder im Kinderhort ab.
Auf meinem anschließenden Weg zur Schule stahl ich heimlich Brötchentüten, Kakao und Milchflaschen von den Treppen vor den Haustüren der besseren Einfamilienhäuser, weil bei uns selbst die Lebensmittel hin und wieder knapp wurden. Dabei vermied ich es geschickt, mehrmals in denselben Straßen zu stehlen. So wurde ich nie erwischt.
Nach der Schule erledigte ich die mir aufgetragenen Einkäufe in der Stadt und trug die Sachen nach Hause. Dort warteten im Wohnzimmer die Brandreste im Ofen auf mich, der Staubsauger, der volle Mülleimer in der Küche und der Abwasch vom Frühstücksgeschirr. Nachdem ich die mir überlassenen Hausarbeiten erledigt hatte, die Asche entsorgt, neues Holz, Kohlen und Briketts aus dem Keller geholt hatte, machte ich mich wieder auf den Weg in die Stadt. Axel musste aus dem Kinderhort abgeholt werden. Gegen 18:00 Uhr waren wir wieder in der Wohnung. Um 18:30 Uhr kam Mutter von der Arbeit nach Hause, um 19:00 Uhr aßen wir zu Abend und um 19:30 Uhr lagen wir im Bett. Oft hungrig, weil aufgrund der angespannten finanziellen Lage Lebensmittel rationiert wurden. Egal wie viel Hunger wir hatten. Axel bekam eine Scheibe Brot zugeteilt, ich zwei. Ich pflegte weiterhin meinen lieb gewonnenen Brauch der Lebensmittelbevorratung im Kinderzimmer und schlich mich heimlich in die Küche, während meine Mutter im Wohnzimmer vor dem Fernseher saß.
Damit Axel mich nicht verriet, und das hätte er sicher getan, musste ich meine Beute mit ihm teilen.
Da meine Mutter die entwendeten Lebensmittel keinem Täter eindeutig zuordnen konnte, strafte sie uns kollektiv. Axel und ich bekamen Hausarrest.
Mich schreckte das nicht ab. Nach dem Unterricht in der Schule, meinen Hausaufgaben, den Pflichten für den Haushalt und die Beaufsichtigung von Axel blieb ohnehin kaum freie Zeit für mich übrig.
Dass ich derartige Sanktionen gelassen über mich ergehen ließ, brachte meine Mutter auf die Palme. Aus Ärger über den ausbleibenden Erfolg ihrer Maßnahmen verprügelte sie mich.