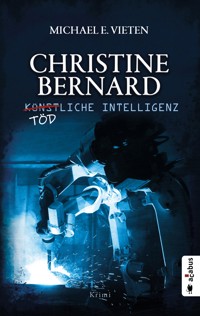Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: TWENTYSIX
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Glaube nie, das Leben sei vorhersehbar." Gibt es den einen Zeitpunkt, an dem sich zwei Menschen, die füreinander bestimmt sind, begegnen müssen? Und was passiert, wenn sie sich verpassen? Jonas Hartmann ist sich sicher, man bekommt die Dinge immer erst dann, wenn man sie nicht mehr braucht. Er plant seinen Ausstieg in die Einsamkeit der finnischen Wälder. Nur sein Wolfshund Rolf soll ihn begleiten. Doch dann begegnet er Isabelle, der Liebe seines Lebens. Was nun? Die große Liebe wagen und das geordnete Leben aufgeben? Plötzlich ist da noch diese rebellische Nadine, die behauptet, seine erwachsene Tochter zu sein. Eine Reise durch den Herbst eines Lebens. Ein Roman über die große Liebe, die Vergänglichkeit des Seins und die Macht des Schicksals.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 286
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mein besonderer Dank geht an Birgit D. für ihre wertvolle Unterstützung und ihre Zuversicht.
Vieten, Michael E., Das letzte Leuchten vor dem Winter
Informationen über den Autor und seine Arbeit auf: www.mvieten.de
Erkenne, wenn dein Leben dir bereits alles gegeben hat und du bereits alles empfangen hast, was möglich ist. Sei zufrieden damit und beende dein Streben. Denke nicht, im Leben bekommt man die Dinge erst, wenn man sie nicht mehr gebrauchen kann. Man bekommt sie, wenn man reif genug dafür ist, sie zu schätzen weiß und verantwortungsvoll damit umgehen kann.
Überlege dir gut, was du dir wünschst. Denn, bist du wirklich bereit, wenn sich alle deine Wünsche erfüllen?
Glaube nie, das Leben sei vorhersehbar.
Inhaltsverzeichnis
Lappland
Isabelle
Wintermorgen
Sehnsucht im Sonnenuntergang
Wilde Tiere
Der einsame Rolf
Nordlicht
Die Hütte
Nadine
Eine Reise in die Vergangenheit
Zum hungrigen Wolf
Wünsche
Ein perfekter Moment
Beethovens Muse
Weihnachtssterne
Pasta und Schopenhauer
Alles hat seine Zeit
Tage des Zorns
Goethe wusste Bescheid
Das letzte Leuchten vor dem Winter
Jonas‘ letzte Reise
Nadines Auferstehung
Lappland
20. Januar.
Der Wind heult und wirft Schneeflocken und kleine Eisnadeln gegen die Hütte. Ich höre es knistern und rieseln.
Das dicke Holz der Wände ächzt unter der Schneelast auf dem Dach und stemmt sich dennoch tapfer dem Sturm entgegen.
Seit 16:00 Uhr ist es dunkel.
Ich habe die Schlagläden geschlossen gelassen. Das Glas der Fenster hält den Winterstürmen nicht stand.
Draußen ist es kalt. Weit mehr als zwanzig Grad minus.
Die beiden alten Öfen halten dagegen. Die Raumtemperatur der fünfmal sieben Meter großen Hütte hält sich bei knapp zweiundzwanzig Grad plus.
Es riecht wie in einer Räucherkammer, weil der Wind hin und wieder den Qualm in den Kaminen niederdrückt.
An die Hütte schmiegt sich ein aus Brettern zusammengenagelter Schuppen. Darin herrscht Frost und der Wind pfeift durch die Ritzen. Durch eine mit einem dicken Vorhang verhangene Tür gelangt man dort hin.
Hunderte Scheite gespaltenes Holz stehen mannshoch in gewissenhaft gestapelten Reihen.
Wenn mir der Brennstoff ausgeht, beeile ich mich und lade mir flink ein paar Holzscheite auf die Arme. Nur schnell zurück in die warme Hütte. Meine Gesichtshaut glüht rosig, die Finger sind klamm. Dann lasse ich das Holz neben den Ofen poltern.
Ruhig brennen die dicken Kerzen in den Laternen. Sie tauchen meine Umgebung in ein schummriges Licht. Es gibt noch zwei Petroleumlampen, sturmsicher, falls man die Hütte bei Nacht mal verlassen muss.
Auf einem der Öfen dampft ein Kessel. Der Tee in dem schäbigen Porzellanbecher ist nur noch lau.
Ich binde mir mein Haar neu zu einem langen Pferdeschwanz, setze mich wieder an den Tisch und lese im Schein zweier Kerzen aus fremden Lebenserinnerungen.
Etwas anderes könnte ich ohnehin nicht tun. Bis der Sturm vorüber gezogen ist, muss ich in der Hütte bleiben.
Vor mir liegen vier dicke Kladden, die diesen Raum nie verlassen haben. Nur hier hat sich Jonas Hartmann all jenes von der Seele geschrieben, was er nicht mit sich herumtragen wollte. Blaue Tinte auf leicht feuchtem Papier. Seine Handschrift ist gut lesbar. Sehr ordentlich, als hätte er sich jedes Wort wohl überlegt. Die Bücher riechen muffig.
Zu dem Heulen und Sausen des Windes gesellt sich plötzlich ein Knacken und Krachen. Ich lausche.
Eine der riesigen Fichten am Waldrand ist anscheinend unter der Last aus Schnee und Eis im Sturm gebrochen und stürzt um. Hoffentlich fällt sie nicht auf die Hütte.
Dann reißt mich ein lauter Knall von meinem Stuhl hoch und lässt mich erschrocken aufschreien.
Wild schlägt einer der Schlagläden zwischen Fenster und Hüttenwand hin und her. Der Wind hat ihn losgerissen. Lange wird das Fenster den heftigen Schlägen und dem Winddruck nicht standhalten. Schnee und Eis rieseln gegen das Glas.
Ich muss raus auf die Veranda und den Laden wieder dichtmachen.
Ich werfe mir Jonas‘ kratzigen Wollpullover über und öffne die Tür.
Eisig und wild faucht mir der Wind aus Westen ins Gesicht und bewirft mich mit allem, was er mit sich trägt. Beinahe raubt er mir den Atem.
Ich verriegele die Tür und taste nach dem Laden. Hart schlägt er mir gegen die Hand und staucht mir einen Fingerknöchel. Der Schmerz lässt mich kurz aufschreien, aber mein Gezeter geht unter in der wilden, lauten Nacht. In diesem rauen Land bleibt keine Zeit für Befindlichkeiten. Das Fenster muss geschützt werden!
Ich erwische den Laden, als er wieder zufällt und presse ihn gegen den Rahmen. Dann lege ich den vereisten Riegel um und drücke noch einmal nach. Mehr kann ich nicht tun. Es gibt nur den einen Riegel, und der muss halten.
Schnell schlüpfe ich zurück in die Hütte, deren warmes Inneres mich gnädig empfängt.
Ich spüre meine Finger nicht mehr und reibe die Hände über der Ofenplatte aneinander. Meine Augen tränen. Die Gesichtshaut spannt. Schnee und Eis schmelzen an meinen Haaren und auf dem Pullover. Ich ziehe die Nase hoch.
Mir wird wieder warm. Ich streife den Pullover ab und binde mein Haar neu. Zum wievielten Mal heute bereits?
Bevor ich weiterlese, gieße ich mir einen zweiten Becher Früchtetee auf. Während er zieht, massiere ich sanft den verstauchten Knöchel an der Hand. Er wird blau werden. Aber was bedeutet das schon?
Ehe ich mich wieder setze, lege ich die Hände um den warmen Becher und nehme vorsichtig einen Schluck Tee. Achtsam genieße ich das heiße Getränk, schmecke den Zucker auf den Lippen und die feine Fruchtsäure in meinem Mund. Man wird demütig hier draußen und dankbar für die einfachen Dinge, die einem vergönnt sind.
Man muss in dieser Gegend nicht viele Fehler machen, um zu sterben. Man erfriert, wird von einem wilden Tier angefallen oder man überlebt die Begegnung mit einem Elchbullen nicht. Mit ein bisschen Pech tritt man in die Falle eines Wilderers und stirbt an der Verletzung. Nicht wenige werden auch einfach nur von einem umstürzenden Baum erschlagen.
Mit unverminderter Kraft fegt der Sturm weiter über das Land. Treibt Eis und Schnee vor sich her und die Menschen in ihre Häuser.
Die Tiere verstecken sich tief im Wald. Wer einen Bau hat, verschwindet darin, wer einen Gefährten hat, kuschelt sich an ihn. Die Natur verschafft sich Respekt. Zeigt unmissverständlich, wer hier der Herr ist.
Ich nehme wieder auf dem knarrenden Holzstuhl Platz und ziehe Jonas‘ Aufzeichnungen zu mir heran. Mit dem dampfenden Becher in den Händen lese ich weiter.
Isabelle
An dem Vormittag, an dem ich Isabelle zum ersten Mal sah, zog bereits der zweite Wintersturm in diesem Monat über das Land. Er heulte um die Ecken des Hauses und rüttelte an den Menschen auf der Straße.
Ich stand am Fenster und schaute hinaus. Der eiskalte Wind trieb die mit Schnee vermischten Regentropfen vor sich her und warf sie gegen das Glas. Für einen kurzen Moment blieben sie daran haften, um sich dann in kleinen Rinnsalen auf das Fensterbrett herabzustürzen. Das letzte Blatt des Jahres klammerte sich verzweifelt an seinen Ast und trotzte den Kräften der Lüfte. Doch dann, letztendlich, riss es ab und flog davon.
Ich wandte mich ab und verließ meine Wohnung. Ich wollte pünktlich sein, bei Madame Dupin.
Sie stellte sich mir am Telefon als Frau Dupin vor. Da sie einen französischen Akzent hatte, ersetzte ich das unromantisch klingende Wort durch die schmeichelhafteste Anrede für eine reife Frau. „Madame“.
Dieses Wort zwingt einen Mann unweigerlich zu einer Verneigung, sei sie auch noch so spärlich, vor der Dame, die er damit anspricht. Madame Dupin, also.
Sie trug ihr langes Haar sorgfältig hochgesteckt. Ein dunkler, glänzender Braunton mit ein wenig Rot darin. Wie reife Rosskastanien. Erste silberne Fäden schimmerten seidenmatt im Novemberlicht.
Madame Dupin hatte gelernt, das Leben zu genießen. Davon zeugten ihre zarten Rundungen. Wahrscheinlich erlag sie aber auch hin und wieder der übermächtigen Anzahl von Verlockungen in ihrem reichhaltigen Kuchenbuffet.
Die Spuren der Freuden und Leiden des Lebens trug sie ungeschminkt in ihrem Gesicht. Vielleicht ein wenig Rouge. Aber wohl eher die Röte eines anstrengenden Morgens in der Backstube auf ihren Wangen.
Sie hatte hellbraune Augen. Ich wollte das Wort Bronze nicht verwenden. Die Harmonie mit ihrer Haarfarbe war beeindruckend.
Eine lange Strähne hatte sich befreit. Mit gepflegter Hand schob Madame Dupin sie hinter ihr Ohr und reichte mir die freie Hand zum Gruß.
„Bonjour. Ich bin Frau Dupin.“
Ich nahm ihre Hand und hielt sie fest. Wie zart sie war.
Und wieder ersetzte ich das harte Wort, bevor ich meinen Griff löste.
„Guten Tag, Madame. Ich bin Herr Hartmann.“
Viel lieber hätte ich mich als Monsieur Hartmann vorgestellt. Aber mein deutscher Familienname machte ohnehin jeden Wohlklang zunichte.
„Bitte nehmen Sie Platz. Möchten Sie einen Kaffee?“
„Sehr gern. Vielen Dank.“
Ich zog meine Jacke aus, hängte sie an einen kunstvoll geschwungenen schmiedeeisernen Garderobenständer und setzte mich an den kleinsten Tisch am Fenster.
Madame Dupins Café war erfüllt von den Düften nach Kaffeebohnen und Schokolade, Vanille und Bittermandel und aus der Backstube zog das Rum-Aroma von soeben fertiggestelltem Kuchenteig in den Gastraum.
Madame Dupin bereitete die Tasse Kaffee für mich selbst zu. Ihre Bedienung, ein junges Mädchen, kümmerte sich weiter um die übrigen Gäste.
Ich beobachtete jede Bewegung dieser eleganten und anmutigen Frau. Wie sie ihren Kopf hielt, ihren Körper drehte, mit ihren Händen nach etwas griff, wie sie ihre Augen aufschlug, wenn sie mir einen Blick zuwarf und wie sie einen Fuß vor den anderen setzte, während sie mit wiegenden Hüften zu mir an den Tisch zurückkehrte.
Madame Dupin stellte die Tasse vor mir ab und nahm mit einer eleganten Bewegung auf dem gepolsterten Stuhl mir gegenüber Platz.
„Möchten Sie ein Stück Kuchen?“
Ihre zartrosa Lippen formten die Worte, wie es nur eine französische Frau vermag, wenn sie deutsch spricht.
Ich fürchtete, die überaus angenehme Stimmung in diesem Moment durch eine Zurückweisung zu stören. Aber ich hätte es als unerhört empfunden, ihre Gabe nur aus Höflichkeit anzunehmen. Ich wollte sie wirklich haben wollen und dann genießen können. Leider hatte ich vor weniger als einer Stunde erst gefrühstückt.
Immer noch plagte mich Schlaflosigkeit in der Nacht. Wenn ich in den frühen Morgenstunden dann endlich in den Schlaf fand, schlief ich bis spät in den Vormittag hinein. Sehr lästig. Dabei liebte ich den zeitigen Morgen. Seine Kühle und das Frösteln, das er mir bereitete. Die ersten Geräusche des jungen Tages und die Gerüche nach geröstetem Weißbrot und nach Kaffee oder Tee.
Bis ich es üblicherweise dann endlich aus dem Bett schaffte, war meine Wohnung bereits wieder warm und die morgendliche Ruhe vor der Tür einer allgemeinen Betriebsamkeit gewichen.
„Nein, danke. Sehr freundlich“, lehnte ich Madame Dupins Angebot ab.
Ich war bereit, jede Regung des Missfallens in ihrem Gesicht zu deuten. Aber da war nichts, worüber ich mir hätte Sorgen machen müssen. Ruhig schaute sie mir direkt in die Augen und lächelte sanft. Sie wusste, was mir entging.
„Vielleicht beim nächsten Mal. Trinken Sie Ihren Kaffee. Dann zeige ich Ihnen die Wohnung.“
Sie stand auf und verschwand in einem Raum hinter der Kuchentheke. Es fühlte sich an, als hätte sie mir etwas weggenommen. Der Entzug ihrer Gegenwart ließ die Raumtemperatur um mich herum sinken.
Ich wusste an jenem Vormittag schon, dass ich wieder in ihr Café kommen werde, nur um dann ein Stück Kuchen von Isabelle Dupin entgegenzunehmen und bei jedem Bissen daran zu denken, dass diese Frau ihn selbst gebacken hatte. Ich würde ein Hefestück nehmen und mir vorstellen, wie lange sie es mit ihren zarten gepflegten Händen bearbeiten musste.
Bis dahin war ich noch nie einem Menschen mit einer Wirkung, wie sie Madame Dupin auf mich ausübte, begegnet. Ich trank meinen Kaffee und fühlte mich plötzlich krank. Ich schaute durch das große Fenster hinaus auf die Straße und suchte die Ursache dort draußen, im feuchtkalten Wetter.
Die Serviererin räumte die leere Tasse ab und ich folgte Madame Dupin. Mit eleganten Schritten ging sie voraus.
Beim Hinaufsteigen der Stufen gab ihr Rock den Blick auf ihre Beine frei. Ich bemühte mich, nicht hinzusehen.
Auf dem ersten Treppenabsatz blieb sie stehen und deutete mit einer lässigen Armbewegung auf eine Tür.
„Dort ist meine Wohnung.“
Ich nickte und lächelte. Mir fiel nichts ein, was ich hätte sagen können.
Sie schritt weiter vor mir her durch das Treppenhaus.
Die Wohnung im zweiten Stock des aus der Gründerzeit stammenden Gebäudes entsprach meinen Vorstellungen. Hohe Decken, große Fenster, Gasanschluss. In der Küche befand sich bereits ein Herd mit sechs Flammen.
„Sie müssen den Herd nicht übernehmen“, hörte ich sie neben mir sagen, während ich mich schon auf das künftige Kochen darauf freute.
„Aber, nein“, erwiderte ich schnell. „Auf Gas kocht es sich doch am besten.“
Zufrieden lächelnd ging sie wieder voraus und zeigte mir die restlichen Räume. Ich lobte die hölzernen Dielenböden. Vom Wohnzimmer aus gelangte man sogar auf einen überdachten Balkon.
Ich verhandelte nicht über die Miete, sie war günstig und mehr als angemessen.
„Tres bien. Sind wir uns also einig.“
„Ja, natürlich.“
„C´est bon. Ich freue mich.“
Wieder reichte sie mir ihre schlanke Hand und besiegelte damit unsere Übereinkunft. Einen Monat später hielt der Umzugswagen einer Spedition vor dem Haus und drei schwitzende Männer schleppten meine Möbel die Treppe hinauf.
Die darauf folgende Woche war ich mit Auspacken und Einräumen beschäftigt. Und Lampen montieren. Ich wollte die Spuren des Umzugs so schnell wie möglich beseitigt wissen.
Madame Dupin sah ich in diesen Tagen nicht. Nur manchmal hörte ich sie morgens oder abends die hölzernen Stufen im Treppenhaus hinab oder hinaufsteigen.
Ich begegnete ihr erst wieder an einem frühen Vormittag, in der Mitte es Monats. Am Abend zuvor war ich zeitig zu Bett gegangen und hatte erstaunlicherweise bis in die Morgenstunden durchgeschlafen.
Seit ich von Hamburg nach Itzehoe umgezogen war, fand ich allmählich zu einer erholsamen Nachtruhe zurück. Sogar das Fenster im Schlafzimmer konnte ich nachts geöffnet lassen. Kaum ein Geräusch drang zu mir hinauf in dieser ruhigen Straße, die nirgendwohin führte.
Ich hatte mir an jenem frostigen Morgen ein „Hamburger Abendblatt“ gekauft und schlenderte mit einer Tüte Brötchen zurück an meinen Frühstückstisch.
Als ich die Haustür erreicht hatte und nach dem Schlüssel tastete, war sie plötzlich da.
„Guten Morgen“, rief sie.
Sie stand in einem altrosafarbenen Etui-Kleid vor der Eingangstür ihres Cafés und verschränkte fröstelnd die Arme vor der Brust. Ohne die weiße Schürze mit den gestärkten Rüschen, die sie sonst immer trug, wirkte Madame Dupin schlanker, jugendlicher.
„Guten Morgen“, grüßte ich und wollte weitergehen.
Doch sie hatte wohl auf mich gewartet.
„Möchten Sie mit mir frühstücken? Um diese Zeit habe ich nur wenige Gäste.“
Für einen Moment dachte ich daran, ihr abzusagen. Ich war darauf nicht vorbereitet und hatte auch nur zwei Brötchen in der Tüte.
Auf irgendetwas nicht vorbereitet zu sein verunsicherte mich seit meiner Jugend. Diese Unsicherheit nährte die Befürchtung in mir, einer Situation nicht gewachsen zu sein.
„Aber ja, gerne“, entfuhr es mir dann doch und überraschte mich selbst. Ich glaube, wenn das Schicksal etwas mit uns vorhat, dann kann man sich dessen übermächtigen Willen nicht entziehen.
Der Gastraum war leer. Eine Angestellte, die ich bis dahin noch nicht gesehen hatte, füllte die gläserne Auslage mit Backwaren auf.
„Meine Tochter, Sophie“, unterbrach Madame Dupin meine Beobachtungen. „Sie hilft hin und wieder hier im Café aus. Sie studiert in Hamburg.“
Ich nickte grüßend in Sophies Richtung, dann klingelte das Telefon.
„Haben Sie auch Kinder?“
Ich suchte nach einer Antwort und wurde erlöst. Das Schicksal wollte es wohl so.
„Mama“, rief Sophie. „Telefon. Bestellung.“
„Einen Moment“, entschuldigte sich Madame Dupin, legte ihre Hand an meinen Oberarm und deutete mit ihrer anderen Hand auf einen Tisch etwas abseits in einer Ecke. „Nehmen Sie doch dort schon mal Platz.“
„Sophie, zwei Frühstücke“, rief sie dann und eilte zum Telefon. Ich zog die Jacke aus und hängte sie an den Garderobenständer.
Der Tisch war zur Hälfte von einer gepolsterten Sitzbank umgeben. Eine einzelne aufgeblühte rote Rose stand in einer Vase darauf. Das gestärkte Tischtuch leuchtete weiß.
Ich rutschte auf die Bank und legte etwas verlegen meine Brötchentüte und die Zeitung neben mir ab. Sophie brachte Geschirr und Besteck und lächelte mild.
„Kaffee?“
„Ja, gerne.“
Madame Dupin hatte ihre Bestellung durchgegeben und kehrte zu mir zurück.
„Möchten Sie ein gekochtes Ei?“
„Nein, danke.“
„Rührei? Ei im Glas? Ein Spiegelei?“
„Sehr liebenswürdig. Nein, danke.“
Sie setzte sich zu mir auf die Bank und sah mich an.
„Haben Sie sich eingerichtet?“
„Ja, und ich schlafe besser, als in Hamburg.“
„Das freut mich. Was machen Sie eigentlich beruflich? Ich sehe Sie morgens gar nicht wegfahren.“
Ich hatte mich bereits darüber gewundert, dass sie mir diese Frage nicht schon gestellt hatte, als ich mich für die Wohnung interessierte. Üblicherweise war es eine der ersten Auskünfte, die man über einen zukünftigen Mieter einholte.
„Ich schreibe für einen Verlag. Das kann ich von zu Hause aus.“
„Sie sind Schriftsteller? Was schreiben Sie?“
Auf diese immer wieder gestellte Frage antwortete ich in der dafür von mir zurechtgelegten Weise und lächelte verlegen.
„Kriminalromane. Nichts Besonderes.“
Ich war eben kein berühmter Bestsellerautor, dem die Frauenherzen entgegenflogen. Im Gegenteil. Mich kannte kaum jemand. Ohne den Erlös durch den Verkauf von internationalen Lizenzen hätte ich von den Tantiemen nicht einmal leben können.
Sophie brachte unser Frühstück und zog sich zurück. Ab und zu hörte ich sie in dem Raum hinter der Kuchentheke mit Geschirr klappern.
Ich griff nach einem Croissant und begann damit, es auf französische Art zu essen.
Madame Dupin entschied sich für ein einfaches Brötchen, verzichtete auf Butter und bestrich eine Hälfte mit Aprikosenkonfitüre.
Ihre Bewegungen waren ausnahmslos von einer Eleganz und einer Anmut, wie ich es noch nie bei einem Menschen zuvor beobachtet hatte. Es kostete mich große Mühe, interessiert zu wirken, aber nicht aufdringlich und dabei trotzdem keine ihrer Bewegungen zu verpassen.
Sie entfernte mit ihrer Zungenspitze Aprikosenkonfitüre von ihren Lippen. Ich schaute schnell auf meinen Teller. Sie lächelte, als ich sie wieder ansah.
Ich dachte darüber nach, ob es wohl einen Herrn Dupin gibt oder einen solchen in spe. Einen Hinweis darauf hatte ich nicht, wagte es aber auch nicht, danach zu fragen.
Schon diese eine Frage zu stellen würde das mir zur Verfügung stehende Maß an Mut bei Weitem übersteigen. Die Furcht vor der Antwort umso mehr.
Madame Dupin hingegen fürchtete sich nicht, oder sie ließ es sich nicht anmerken. Später erfuhr ich, sie erlag ihrer Neugierde.
„Gibt es eine Frau in Ihrem Leben?“
Was für eine Frage! So direkt gestellt und doch so verständlich.
„Äh, nein“, stammelte ich.
Madame Dupin hob ihr Kinn und ließ es langsam sinken.
Ich weiß nicht, was in diesem Moment in mich gefahren war, aber plötzlich hörte ich mich fragen: „Und Sie? Ich sehe Sie immer nur allein.“
„Ich hatte mit meinen Männern bisher kein glückliches Händchen. Sophie ist das Einzige, was mir blieb.“
Sie goss sich Kaffee nach und trank ihn schwarz.
„Die Plätze neben uns sind also frei. Wir haben etwas Gemeinsames. Darauf stoßen wir an.“
Sie hob ihre Tasse und hielt sie mir entgegen. Es war mir ein wenig peinlich, aber ich wollte die vertraute Stimmung in diesem Moment nicht zerstören.
„Isabelle“, sagte sie leise und stieß gegen meine Tasse.
„Jonas“, brachte ich mühsam hervor. Dann tranken wir einen Schluck. Ich lächelte verlegen.
Ich bemühte mich, entspannt zu wirken und knabberte an einem Croissant. Aber mir war zu warm, und ich schwitzte.
Isabelles Parfüm stieg mir süß und herb zugleich in die Nase und erinnerte mich an den Duft des Sommerjasmins. Ich glaubte, die Wärme ihres Körpers zu spüren, obwohl zwischen uns die Zeitung und die Brötchentüte lagen. Sie bemerkte meinen Blick darauf.
„Ich habe jeden Tag frische Brötchen. Wenn du magst, können wir zusammen frühstücken.“
„Ja, warum nicht“, versuchte ich, einen gleichgültigen Ton zu treffen, was mir aber nicht gelang. Ich wollte ihr nicht verraten, wie sehr sie mir gefiel. Ich fürchtete, mich lächerlich zu machen. Womöglich empfand sie nicht so viel für mich, wie ich für sie.
Wir sprachen über Belanglosigkeiten. Ich achtete sehr darauf, was ich sagte. Wie ich mich ausdrückte. Denn in meinem Alter weiß man, bevor wir etwas Kluges sagen können, womit wir unser Rendezvous beeindruckt hätten, quatschen wir gerne irgendeinen Unsinn daher und machen alles zunichte. Und die Angebetete denkt: „Das ist genauso ein Depp wie mein Ex.“
Dann betraten die ersten Gäste das Café. Isabelle musste sich um sie kümmern. Ich verabschiedete mich und vergaß die Zeitung und die Brötchentüte auf der Sitzbank. Sophie brachte mir später beides an die Wohnungstür.
Wintermorgen
21. Januar.
Es ist still in der Hütte. Kein Laut dringt an meine Ohren. Und es ist kalt. Ich öffne die Augen. Ich liege vollständig bekleidet auf dem Bett. Auf mir liegt der viel zu große Wollpullover.
Durch die Ritzen der Schlagläden scheint die Sonne hindurch. Staub tanzt in ihren Strahlen. Der Sturm hat sich gelegt, die Nacht ist vorüber.
Mühsam und mit steifen Gliedern wälze ich mich aus dem knarrenden Bett. Die Feuer in den beiden Öfen sind aus. Ich lege die letzten Holzscheite auf die Glutreste. Es wird eine Weile dauern, bis es in der Hütte wieder warm ist. Ich werde mit dem Waschen und Zähneputzen so lange warten. Aber die Schlagläden kann ich schon mal aufklappen.
Ich schlüpfe in den dicken Wollpullover und krempele die Ärmel hoch. Er reicht mir bis fast an die Knie.
Die Eingangstür ist festgefroren. Nach zwei kräftigen Tritten kann ich sie knirschend und knackend öffnen.
Messerscharf schneidet die Kälte in mein Gesicht, während ich auf die Veranda heraustrete. Überall liegt Schnee. Auch unter dem Vordach. Er reflektiert die gleißende Helligkeit der Sonne und blendet mich. Ich kneife die Augenlider zu dünnen Schlitzen zusammen.
Der Himmel ist wolkenfrei. Ich stapfe durch eine lange Schneewehe und öffne die Läden vor den Fenstern. Dann entdecke ich die umgestürzte Fichte. Ihr Stamm liegt quer über dem Weg zur Hütte. So ein Mist. Darum werde ich mich kümmern müssen. Doch zuerst muss ich die Veranda von Schnee befreien. Wenn er in der Sonne taut und dann wieder gefriert, könnte ich ausrutschen und stürzen.
Sich in dieser einsamen Gegend zu verletzen, sollte man unbedingt vermeiden. Im Schuppen habe ich einen Besen gesehen.
Ich kämpfe mich durch den Tiefschnee um die Hütte herum. Die Schuppentür steht eine Handbreit offen. Der Wind muss sie aufgestoßen haben. Eine große Schneewehe hat sie blockiert. Im Dunkeln gestern Abend ist mir das nicht aufgefallen.
Mit den Füßen schiebe ich den Schnee beiseite, stemme die Tür ein Stück weiter auf und zwänge mich hindurch. An der Wand lehnt der Besen.
Ich habe den Stiel schon in der Hand, als plötzlich etwas Braunschwarzes auf mich zugeschossen kommt. Etwa so groß wie ein mittelgroßer Hund. Und es faucht und knurrt und es fletscht seine spitzen Zähne. Ich erschrecke mich furchtbar und stoße einen gellenden Schrei aus. Ich kann das tobende Irgendwas gerade noch mit dem Besen abwehren und zurückstoßen. Doch es startet sofort einen neuen Angriff und schnappt nach meinem Hosenbein. Dann erkenne ich, was mir da gegenübersteht. Ein Vielfraß!
Das rund dreißig Kilo schwere Tier muss in der Nacht Schutz vor dem Sturm gesucht haben.
Vielfraße sind sehr wehrhaft. Mit seinem Gebiss kann er mir tiefe Verletzungen zufügen. Aber er muss aus dem Schuppen heraus. Keinesfalls möchte ich im Dunkeln nach Holz tasten und dann von ihm angegriffen werden.
An mir vorbei wird er den Schuppen nicht verlassen. Er hat genauso viel Angst vor mir, wie ich vor ihm.
Langsam trete ich einige Schritte zurück und nehme den Besen mit. Der Vielfraß hört auf zu knurren und schaut mir nach.
Schnell kämpfe ich mich durch den Schnee auf die andere Seite des Schuppens und schlage mit dem Besen an die Wand. Dazu schreie ich und stoße mit den Schuhen gegen die Bretter. Dieser Lärm müsste ihn verscheuchen.
Ich lausche. Und höre, nichts. Ist er weg?
Sofort stapfe ich zurück zum Eingang des Schuppens und sehe seine Spuren im Schnee. Sie führen von der Hütte weg.
Gott sei Dank. Mir schlägt mein Herz bis in den Hals hinauf.
Ich trete den Schnee platt, bis ich die Schuppentür schließen kann, und schiebe den Riegel vor. Noch einmal möchte ich nicht von einem wilden Tier da drin überrascht werden.
Die Veranda von dem vielen Schnee zu befreien ist eine anstrengende Angelegenheit. Ich rieche meinen Schweiß. Wird Zeit, dass ich mich wasche.
Ich lasse den Besen stehen und betrete die Hütte. Die beiden Öfen haben ganze Arbeit geleistet. Trocken schlägt mir ihre Wärme entgegen.
Ich habe kein Holz zum Nachlegen mehr. Mit einem mulmigen Gefühl im Bauch gehe ich in den Schuppen und stapele mir mehr Scheite auf die Arme, als ich tragen kann. In der Mitte der Hütte verlassen mich meine Kräfte und sie poltern auf den Boden. Fluchend sammele ich sie wieder ein und lege sie neben die Öfen.
Die Hütte hat keinen Wasseranschluss. Also mische ich kaltes Wasser aus einem der Kanister und warmes Wasser aus dem Kessel auf dem Ofen in einer Schüssel. So, wie es die Menschen früher auch gemacht haben. Dazu ein Stück halb vertrocknete Seife mit tiefen Rissen und ein steifes Handtuch. Wer braucht schon eine heiße Dusche und einen weichgespülten Frottee-Bademantel?
Das Thermometer in der Hütte steigt, es zeigt bereits achtzehn Grad plus. Doch das verdunstende Wasser auf meiner feuchten Haut lässt mich frösteln. Bibbernd ziehe ich mich wieder an.
Die Vorräte in Jonas‘ Hütte sind reichhaltig und gut sortiert. Ich schaue mir die vorhandenen Konserven an. Sogar Brot in Dosen ist dabei. Allerdings habe ich noch keinen Öffner gefunden.
Mein Frühstück steht vor mir auf dem Tisch. Schwarzbrot, eine Tube Margarine und Konfitüre aus Moltebeeren. Aber ich bekomme die Dose nicht auf.
Im Schuppen habe ich ein Beil gesehen. Vielleicht schaffe ich es damit.
Wenn man weiß, wie es geht, ist es ganz einfach. Bis dahin aber schlage ich mir einen Fingerknöchel blutig, weil ich mit dem Beil an der Dose abrutsche.
Der höllische Schmerz treibt mir die Tränen in die Augen und nimmt mir für einen Moment den Atem. Die Wut über meine Ungeschicktheit gibt mir die Kraft für einen zweiten Versuch. Zur Belohnung sitze ich jetzt am Tisch und genieße Schwarzbrot mit Moltebeeren-Konfitüre und trinke einen heißen Instantkaffee dazu. Der Finger blutet nicht mehr.
Draußen steigt langsam die Temperatur. Das Thermometer zeigt nur noch 18 Grad minus. Ich werde bis zum Mittag warten und dann versuchen, mit dem Geländewagen die umgestürzte Fichte zu umfahren. Wenn die Hauptstraße geräumt ist, fahre ich zur Lodge und bitte Mika, den Stamm zu zersägen.
Bis dahin lese ich weiter in Jonas‘ Aufzeichnungen.
Sehnsucht im Sonnenuntergang
Ich bin gerne mit mir allein, aber nicht gerne einsam. Isabelle ging es ebenso. Wir genossen unser allmorgendliches Frühstück und starteten gemeinsam in den Tag. Es wurde unser Ritual.
Wir entdeckten weitere Gemeinsamkeiten und worin wir uns unterschieden. Der Umgang miteinander erinnerte mich an den von Geschwistern. Unverfänglich. Unbeschwert. Vertraut.
Meist saßen wir mehr als eine Stunde beieinander und sprachen über uns selbst und wie wir diese Welt sahen. Danach ging sie an ihre Arbeit und ich in meine Wohnung. Dort saß ich zufrieden an meinem Schreibtisch und schrieb an den Manuskripten. Ich war produktiver geworden und unterbot sogar die Abgabetermine.
Eines Morgens rief mein Verleger Konrad Bernstein an und bot mir ein neues Buchprojekt an.
„Jonas, wir müssen mal was anderes machen.“
„Was anderes? Was meinst du? Stimmt mit den Krimis was nicht?“
„Doch, aber Mord und Totschlag sehen die Leute mittlerweile jeden Abend im Fernsehen. Ist ja eine richtige Krimischwemme derzeit. Wir brauchen irgendwas mit starken Gefühlen, der großen Liebe, du weißt schon. Schicksal und so.“
„Der großen Liebe? Was soll das denn jetzt? Du hast doch genug Autorinnen, die dir das schreiben können.“
„Die schreiben ja auch alle an ihren Projekten. Aber da ist eben nicht genau das dabei, was ich mir so vorstelle. Im Genre ‚Romantik‘ sind wir unterbestückt. Du hättest die Zeit dazu. Und, Jonas, am besten etwas mit einem tragischen Ende.“
Konrads Begeisterung steckte mich nicht an. Ich habe mich noch eine halbe Stunde gewehrt. Ohne Erfolg. Er ließ mich nicht mehr aus seinen Fängen. Ich willigte schließlich ein und übernahm auch gleich seinen Titelvorschlag. „Sehnsucht im Sonnenuntergang“, faselte er andächtig. Etwas Besseres wäre mir ohnehin nicht eingefallen. Für Romantik und große Gefühle fühlte ich mich nicht zuständig.
Ich fühlte mich bestraft. Das hatte ich nun davon, dass ich dem Lektorat so eifrig meine Arbeiten eingereicht hatte. Anstatt mehr Zeit für das nächste Buch hatte ich nun diesen unsäglichen Auftrag an der Backe.
Tagelang saß ich vor dem Computer und grübelte. Hin und wieder hatte ich eine diffuse Idee von einer Idee, aber ich brachte nicht einen einzigen vorzeigbaren Absatz zustande.
In einem Baumarkt an der Kasse glaubte ich, einen brauchbaren Ansatz gefunden zu haben, aber der ungeduldige Blick der Kassiererin hielt mich davon ab, ihn aufzuschreiben. Als ich mit dem Einkauf endlich mein Auto erreicht hatte und Block und Stift zur Hand nahm, war nichts mehr da. Alles vergessen. Weg.
Ideen sind wie scheues Wild. Wie Rehe, die schon bei der geringsten Störung flüchtend im Wald verschwinden.
Ich erzählte Isabelle von meinem Problem. Sie sah mich lange an und schmunzelte.
„La grande amour. Glaubst du daran?“
„Nein. Wenn es vorgesehen wäre, dass wir unsere große Liebe finden, dann gäbe es nicht so viele Menschen, die in Sehnsucht leben auf dieser Welt. Unserer Bestimmung ist es einerlei, was aus uns wird. Und weil es so ist, leben davon Tausende von Menschen. Sie verdienen ihr Geld mit unseren Sehnsüchten, Träumen und Hoffnungen. Und wir kaufen sie ihnen ab. Jeden Tag. Schundromane, Kitsch-Filme, Radio-Schnulzen.“
„Das klingt sehr traurig.“
„Findest du?“
„Qui.“
„Du glaubst an die eine große Liebe im Leben?“
„Natürlisch“, hauchte Isabelle hinreißend akzentuiert.
„Dann wird es aber Zeit.“
„Für die große Liebe ist es nie zu spät“, sagte sie leise und schaute mich vielsagend an.
„Hmm“, brummte ich.
Die ersten Gäste beendeten das gemeinsame Frühstück und wir gingen an unsere Arbeit.
Lange saß ich an meinem Schreibtisch und dachte darüber nach, was Isabelle gesagt hatte.
Es entsprach weder meiner Überzeugung noch meiner Erfahrung.
Bis zur Mitte meines Lebens hatte ich noch darauf gewartet, irgendwann dieser einen Frau meines Lebens gegenüber zu stehen. Es war mehr ein banges Hoffen, als Gewissheit oder Überzeugung. Doch als ich die Fünfzig überschritten hatte, wich diese Hoffnung der Überzeugung, dass es den einen Partner, der alles richtig macht, der einen im Leben begeistert, verzückt und befriedigt, nicht gibt.
Der Glaube daran ist eben nur eine Hoffnung. Und die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man. Aber auch sie stirbt letztlich. Was danach kommt, ist eine Aneinanderreihung freudlos durchlebter Tage ohne Aussicht auf Erlösung.
Irgendwann habe ich mich selbst erlöst. Freigesprochen von diesem Irrglauben und damit begonnen, mich auf die Dinge in meinem Leben zu konzentrieren, die ich auch beeinflussen konnte. Schluss mit der Warterei, der Sucherei. Schluss mit dem spätpubertären Wunsch, sein Gegenstück doch endlich in die Arme zu schließen und mit ihr alle seelischen Wunden zu heilen, die das Leben bis dahin geschlagen hatte.
Den idealen Partner gibt es nicht. Ein Mythos.
Schon die Schriftstellerin Ann Ratcliff, eine Zeitgenossin von Jane Austen, sagte, sie schreibe über das, was ihr Leben für sie nicht bereithält. Und genau das tat ich auch und tippte endlich die ersten Zeilen für Konrads Liebesroman in den Computer.
Wilde Tiere
Am westlichen Himmel ziehen Wolken auf. Ich sollte versuchen, die Lodge zu erreichen, bevor es sich zuzieht. Vielleicht beginnt es dann wieder zu schneien.
Ich habe Jonas‘ alten Geländewagen gestern Abend im Carport neben der Hütte abgestellt. Seine Scheiben sind zwar zugefroren, aber der Toyota ist frei von Schnee.
Der starke Motor springt nach drei Startversuchen an und läuft ein paar Minuten später rund. Die warme Luft aus den Heizungsdüsen hat den Innenraum erwärmt und die Frontscheibe angetaut. Den Rest erledigen die Scheibenwischer.
Langsam setze ich den schweren Wagen zurück. Er fährt sich erstaunlich gut. Nach anfänglichem Respekt vor seinen Abmessungen habe ich ihn in mein Herz geschlossen.
Derart fette Autos habe ich immer verabscheut. Ich hielt es für eine rücksichtslose Verschwendung von Ressourcen. Aber hier draußen ist der Toyota ein großer, starker und hoffentlich treuer Freund. Jedenfalls fühle ich mich darin, hoch oben thronend, sicher.
Mit den Augen suche ich nach einer geeigneten Stelle, um den umgestürzten Fichtenstamm zu umfahren. Ich entscheide mich für die rechte Seite und lege den Vorwärtsgang ein. Die niedrigen Fichten am Wegesrand kann ich bestimmt leicht überwinden.
Knirschend rollen die Räder über den Schnee. Das grobe Profil stanzt kleine Bröckchen heraus und lässt sie hinter sich wieder fallen. Der Schnee reicht fast bis an den Wagenboden.
Vor dem abgebrochenen Fichtenstamm lenke ich den Toyota vom Weg herunter. Die dicken Reifen rumpeln über irgendetwas unter der Schneedecke und lassen die Karosserie wanken. Der Aufbau neigt sich bedrohlich. Ich klammere mich am Lenkrad fest. Dann richtet er sich wieder auf und ich gebe Gas. Mit gewaltiger Kraft wühlen sich alle vier Räder gleichzeitig durch den Schnee. Überfahrene Fichten verschwinden vor der Motorhaube und kratzen am Unterboden entlang.
Ich habe den Fichtenstamm umfahren. Der Geländewagen wühlt sich weiter voran. Ich drehe am Lenkrad und will zurück auf den Weg, da passiert es. Der Motor heult auf, der Toyota wird langsamer, schüttelt sich. Irgendwoher steigt Qualm auf. Ich trampele auf das Gaspedal. Bloß jetzt nicht stecken bleiben!
Doch es ist zu spät. Der Motor jault, die Räder schmeißen mit Schnee und Dreck um sich und es qualmt und es stinkt. Der Geländewagen schüttelt sich noch einmal und bäumt sich auf. Ich nehme den Fuß vom Gas und lege den Rückwärtsgang ein. Vorsichtig trete ich auf das Pedal und rede mit Jonas‘ Wagen.
„Komm, sei brav. Lass mich jetzt nicht hängen. Du schaffst das.“
Der Allradantrieb ackert. Der Toyota bemüht sich. Aber er bewegt sich nicht. Die Räder drehen, ohne Halt zu finden. Es hat keinen Zweck.
Ich nehme den Gang raus und ziehe die Handbremse an. Dann springe ich fluchend aus dem Wagen und schreie: „Was? Was willst Du?“
Und dann sehe ich das Problem. Der schwere Geländewagen sitzt auf. Die Räder erreichen kaum den Boden. Er liegt auf einem kleinen Hügel oder einem festen Haufen Schnee. Ich fluche weiter.
„Scheiße“, und dass immer mir so etwas passiert. Und dann muss ich lachen. Wieso immer? Das hier ist das erste Mal, dass ich mich festgefahren habe. Und sogleich erkenne ich genau darin mein Problem.
Sicher kann man etwas tun, um den Wagen wieder freizubekommen. Aber was? Ich habe keine Ahnung.
Ich gebe auf, schalte wütend den Motor ab und stapfe zurück zur Hütte.
Mit einem dampfenden Becher Tee in den Händen stehe ich daran nippend auf der Veranda und schaue Jonas‘ Toyota böse an. Dann habe ich eine Idee.