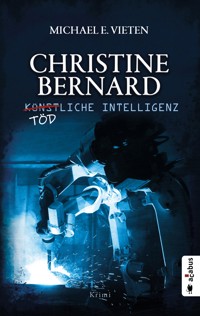Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: TWENTYSIX
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Handbuch zur Rettung der Welt
- Sprache: Deutsch
"Hast du niemanden, der um dich weint?"Das Abenteuer geht weiter. Mila lässt ihren alten Freund Josh zurück und stellt sich allein dem gnadenlosen Kampf um die letzten Ressourcen. Sie setzt ihre Suche nach dem rettenden Hochtal fort. Eine Reise geprägt von Entbehrungen und Verlusten.Die junge Bogenschützin wandert durch eine zerstörte Welt. Feindlich, lebensbedrohlich. Jeden Tag kämpft sie gegen die Hinterlassenschaften einer untergegangenen Zivilisation, die den Planeten rücksichtslos ausgebeutet hat.Nur wenige Menschen haben die Apokalypse überlebt und streifen ziellos umher. Gezeichnet von Krankheiten, Hunger und Durst. Sie wurden in das Leben der Jäger und Sammler vor mehr als 10.000 Jahren zurückgeworfen.Band 2 der Trilogie um ein großes Abenteuer, verzweifelte Hoffnung, grenzenlose Zuversicht und aufrichtige Freundschaft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 255
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mein besonderer Dank geht an Birgit D. für ihre wertvolle Unterstützung und ihre Zuversicht.
Vieten, Michael E., Handbuch zur Rettung der Welt - Mila
Informationen über den Autor und seine Arbeit auf: www.mvieten.de
Wir alle leben heute im Anthropozän. Die Wissenschaft streitet noch darüber, ob dieses neue Zeitalter 1610 mit der Eroberung der „neuen Welt“ und den katastrophalen Folgen für den amerikanischen Kontinent seinen Anfang genommen hat oder erst um 1800 mit der industriellen Revolution in Europa.
Wie dem auch sei. Der Mensch hat begonnen seine Umwelt zu verändern, ohne fundiertes Wissen zu besitzen, welche Auswirkungen das haben wird.
Ein weiterer Begriff hat für das Verständnis des Geschehens in der Geschichte der Menschheit eine zentrale Bedeutung. Die neolithische Revolution, die gleichbedeutend mit der Vertreibung aus dem Paradies angesehen werden kann.
Beide Begriffe möchte ich nachfolgend kurz erläutern.
Inhaltsverzeichnis
Anthropozän
Neolithische Revolution
Auf ein Wort
Prolog
Aufbruch
Silber
Der Pass
Ein Rest Zuversicht
Lavi
Das Tal
Das Dorf
Milas Rache
Ruud
Abschied
Lavis Entscheidung
Ein Wiedersehen
Winter
Gottes Faust
Der letzte Marsch
Anthropozän
(Altgriechisch: „Das menschlich [gemachte] Neue“)
Der Begriff „Anthropozän“ beschreibt die Benennung einer neuen geochronologischen irdischen Epoche. Sie soll den Zeitabschnitt umfassen, in dem der Mensch zu einem der wichtigsten Einflussfaktoren auf die biologischen, geologischen und atmosphärischen Prozesse auf der Erde geworden ist.
Dazu zählen:
Albedo
(Gesamt-Rückstrahlvermögen der Erdoberfläche (Schwund der Eisflächen))
Artensterben, Artenverschleppung
Klimawandel
Abschmelzen der Gletscher und der Polkappen
Anstieg der Meeresspiegel
Rückgang von Permafrost
Veränderung der globalen Meeres- und Luftströmungen
Versauerung der Ozeane
Lichtverschmutzung, Lärmverschmutzung
Kohlenstoffdioxid, Ozonloch, Treibhausgase
Radioaktiver Staub, Atomversuche, -Unfälle, Risiko eines Atomkriegs
Übernutzung bzw. Verlust zur Verfügung stehender Ressourcen insbesondere der Vorkommen (Peak-) Erdöl, Phosphor, Sand, seltene Erden
Bodendegradation, -erosion, -schutz oder – versauerung, Erschöpfung der vorhandenen Trinkwasservorkommen
Landraub durch Konzerne
Überfischung
Vermüllung der Umwelt „Plastik-Planet“
(Quelle: Wikipedia, gekürzt)
Neolithische Revolution
Der Begriff „neolithische Revolution“ beschreibt den Zeitpunkt in der Entwicklung des Menschen, an dem unsere Vorfahren erstmals das Leben als Jäger, Fischer und Sammler aufgegeben haben und mit Ackerbau und Viehzucht begannen.
Viele Wissenschaftler bezeichnen die neolithische Revolution als einen der bedeutendsten Umbrüche in der Geschichte der Menschheit.
Der Mensch löste sich aus der bis dahin erzwungenen Anpassung an die Umwelt und wurde sesshaft. Er produzierte Lebensmittel und betrieb Vorratshaltung.
Dies leitete die Epoche der Jungsteinzeit (Neolithikum) ein und bedeutete die Abkehr von einem Leben in Verbundenheit mit der Natur unter Berücksichtigung der natürlich vorhandenen Ressourcen.
Dieser Prozess gilt bis heute als unumkehrbar.
Aufgrund der Konzentration auf wenige Nahrungsmittel entstand eine Abhängigkeit von Erträgen. Bei Missernten drohten Hungersnöte. Monokulturen erhöhten das Verlustrisiko durch Unwetter, Schädlingsbefall oder Bodenerschöpfung.
Es bildeten sich soziale Schichten mit unterschiedlichem Zugriff auf Ressourcen. Durch Viehhaltung in Herden oder dem Horten von Feldfrüchten war erstmals die Bildung von Vermögen möglich. Dies führte zu den heute noch vorherrschenden Ungerechtigkeiten und zu Ausbeutung und Unterdrückung.
Der durch die Sesshaftigkeit stark angestiegene Bevölkerungszuwachs und die Unmöglichkeit von schnellen Ortswechseln schufen Konflikte, denen die Menschen nicht mehr ausweichen konnten.
Besitz musste fortan gegen Verlust durch Raub oder Untergang verteidigt werden.
(Quelle: Wikipedia, gekürzt)
Auf ein Wort
Für den Autor dieses Buches bedeutet die neolithische Revolution den Anbeginn der globalen Katastrophe.
Schon vor fünf Millionen Jahren lebten die Vorfahren des modernen Menschen auf der Erde als Fischer, Jäger und Sammler.
Vor etwa 150.000 Jahren folgte der Homo Sapiens.
Noch bis vor etwa 10.000 Jahren lebte der Mensch im Einklang mit der Natur. Er nahm sich, was er für sich und seine Familie zum Leben brauchte. Mehr zu erlegen oder zu sammeln als man benötigte, verschaffte niemandem zu dieser Zeit einen Vorteil. Was man nicht selbst essen konnte, wäre dann verdorben.
Mit der neolithischen Revolution änderte sich das.
Auf einmal war es möglich, der Natur mehr zu entnehmen als man selbst zum Leben brauchte. Es entstanden Arm und Reich, stark und schwach, Ausbeutung und Sklaverei und Mord und Totschlag um das Vermögen eines Anderen.
Geschwister waren nun nicht mehr gut aufeinander abgestimmte und erfolgreiche Jäger, sondern plötzlich Konkurrenten um den landwirtschaftlichen Besitz des Vaters, den nur ein Nachkomme weiterführen konnte, um mit den Erträgen seine Familie zu ernähren.
Der ganze Wahnsinn gipfelte dann in Siedlungen, Großstädten und längst untergegangenen Riesenreichen.
Vorausgegangen waren Bodenerschöpfung, Abholzungen bis zum Kahlschlag und schließlich der Zusammenbruch kompletter Gesellschaften.
Nicht nur das Römische Reich entwaldete bereits weite Teile des Mittelmeerraums für Hausbau, Schiffbau, Heizmaterial und durch Überweidung und nicht zuletzt durch sein gigantisches Heer. Einst fruchtbare und nun ungeschützte Böden wurden durch Erosion vernichtet und blieben bis heute verloren.
Ab Mitte des 18. Jahrhunderts folgte das Industriezeitalter, in dem der Mensch endgültig jeglichen Kontakt zu seinem natürlichen Lebensraum aufgegeben hatte. Die fortschreitende und rücksichtslose Urbanisierung ging einher mit Flächenversiegelung, Vernichtung von Naturreserven und der Ausrottung von Arten.
Und heute erleben wir das Anthropozän im Endstadium.
Beinahe 8 Milliarden Menschen übervölkern die Erde und sie verhalten sich uneinsichtiger und ignoranter als je zuvor. Und jeden Tag werden es mehr und alle wollen alles haben. Sie erschöpfen den Planeten und beuten seine Ressourcen rücksichtslos aus.
Der Mensch hat längst den Respekt vor der Natur verloren und ordnet deren Schutz kommerziellen Interessen unter.
Naiv, zu glauben, dass dieses Verhalten ein gutes Ende nimmt.
Nach erfolgreichen 5 Millionen Jahren als Fischer, Jäger und Sammler hat es die invasivste Spezies auf der Erde in nur 10.000 Jahren geschafft, die natürlichen Abläufe in seiner Umwelt an den Rand des Kollapses zu führen.
Leben in irgendeiner Form wird es vermutlich auch in Zukunft auf der Erde immer geben. Es stellt sich nur die Frage, ob der Mensch daran noch teilnehmen wird.
Durch sein anhaltendes Wirken verändern sich sogar globale Luft- und Wasserströmungen auf der Erde und es ist bis dahin nur wenig bekannt, wie sich derartige Veränderungen auf das Klima auswirken werden.
Die Vollendung des Manuskripts zu diesem Buch fand im Spätherbst 2018 in Mitteleuropa (Hunsrück, Deutschland) statt.
Nach einem Dürresommer mit Rekordtemperaturen, Gewitterstürmen, Starkregenereignissen, Insektensterben und den ersten Ernteausfällen erwarten wir 29 Grad Celsius am morgigen Tag. Es ist Freitag der 12. Oktober 2018. Wolkenfreier Himmel und Sonnenschein seit Ende März, und eine nennenswerte Wetteränderung ist weiterhin nicht abzusehen.
Die Flüsse führen Niedrigwasser, die Schifffahrt wurde eingeschränkt oder bereits ganz eingestellt, Kraftwerke wurden herunter gefahren oder abgeschaltet, die Wälder sind trocken, Brandgefahr droht. Viele Jungbäume sind verdurstet. Die Landwirtschaft bekommt Nothilfen vom Staat. Tankstellen werden nur noch unzureichend mit Treibstoff versorgt, die Preise steigen.
Wer den Suchbegriff „Dürre und Hitze in Europa 2018“ in eine Internetsuchmaschine eingibt, erhält zum jetzigen Zeitpunkt beinahe 200.000 Treffer.
Ungeachtet dieser Entwicklung verkündete die Regierung der Bundesrepublik Deutschland, ihr Klimaziel, die Erderwärmung auf unter 2 Grad zu begrenzen, aufzugeben.
Die USA leisten sich einen Präsidenten, der den Klimawandel gleich ganz leugnet und es gibt Politiker, die tatsächlich die Sonne als alleinigen Verantwortlichen entdeckt haben wollen.
All jenes lässt mich oft sprachlos zurück und zwingt mich, ernsthaft daran zu zweifeln, dass die Menschheit unter den vorherrschenden Bedingungen noch eine Chance hat. Ohne Zweifel müsste sie sich dafür sehr verändern.
Ich zitiere an dieser Stelle den Astrophysiker, Naturphilosophen, Wissenschaftsjournalisten und TV-Moderator Harald Lesch, der in einer Fernsehsendung von zwei Planeten sprach, die sich treffen.
„Du siehst aber schlecht aus“, sagt der Eine. „Was ist denn los mit dir?“
„Ich habe Menschen.“
„Das vergeht.“
(Anm. des Autors)
Prolog
Anthropozän 2051.
Zwei Jahrzehnte nach dem Zusammenbruch der menschlichen Zivilisation streifen nur noch wenige Überlebende durch verwüstete Landschaften auf der Suche nach Nahrung, Kleidung und Unterschlupf. Ihr Leben wird ständig bedroht von den gefährlichen Hinterlassenschaften der zügellosen und rücksichtslosen Gesellschaften des 21. Jahrhunderts und von einer aus dem Gleichgewicht geratenen Natur mit verheerenden Wetterereignissen.
Das Risiko, in dieser feindlichen Umwelt zu erkranken, sich zu verletzen oder sich zu vergiften, oder zum Opfer marodierender Horden zu werden ist übermächtig.
Der alte Josh, der die Zeit vor der Apokalypse noch erlebt hat, und die junge Waise Mila, die nur diese zerstörte Welt kennt, begegneten sich und wurden Freunde. Sie setzten ihren Weg gemeinsam fort. Die beiden suchen ein abgelegenes Hochtal im Gebirge, von dem sie sich bessere Lebensbedingungen versprechen.
Sie überwintern in einer verfallenen Hütte und warten auf das Frühjahr.
Dann ist es endlich soweit und sie könnten weiterziehen.
Doch beide wissen, Josh ist alt und der vor ihnen liegende Weg über das mächtige Gebirge mühsam und gefährlich. Das Gepäck wiegt schwer und Joshs Kräfte schwinden. Sie würden nur langsam vorankommen.
Vielleicht würde der alte Freund unter den Strapazen sterben, ohne das rettende Hochtal erreicht zu haben.
Schließlich treffen sie eine Entscheidung, die beiden nicht leicht fällt.
Nach einem langen gemeinsamen Weg und dem monatelangen Trotzen aller Gefahren trennen sich die zwei Gefährten.
Mila sucht das Tal im Gebirge allein und Josh bereitet die morsche Hütte auf den nächsten Winter vor.
Im Herbst wollen sie sich dort wieder treffen.
„Hast du niemanden, der um dich weint?“
Aufbruch
Sie hatte den Fuß des Hanges erreicht und lief in den Wald hinein. Nach wenigen Schritten blieb sie stehen und drehte sich um.
Zwischen den Stämmen der mächtigen Fichten hindurch sah sie Josh auf der Veranda im Morgenlicht. Er schaute ihr nach. Dann wandte er sich ab und verschwand in der Hütte.
Die Augen des greisen Mannes waren nicht mehr die Besten. Hier unten umgeben von den Bäumen konnte er Mila nicht mehr erkennen.
Sie wird ihn vermissen, den weisen Alten.
Sie dachte an das schwere Buch in ihrem Rucksack. Das „Handbuch zur Rettung der Welt“.
Wer würde ihr nun die Bedeutung der Zeilen erklären? Doch das war nicht ihr vordringlichstes Problem.
Sie musste ihr Tal finden. Jenes Hochtal oben in den Bergen, welches ihr und Josh einen sicheren Platz zum Leben bieten sollte.
Sie tastete in der Außentasche ihrer Cargo-Hose nach dem zerknitterten Foto und zog es heraus. Sie strich es liebevoll glatt und betrachtete es.
Grüne Wiesen, bunte Blumen, blauer Himmel, Schnee auf den Bergspitzen.
Sie schob den Rest der Postkarte zurück in die Beintasche und verschloss sie sorgfältig. Dann rannte sie los.
Die Bäume des Waldes standen dicht. Das Unterholz erwies sich oft als undurchdringlich. Umgestürzte Baumriesen versperrten ihr zusätzlich den Weg.
Mila wich den Hindernissen aus und konnte nur mühsam die Richtung halten. Sie verringerte ihr Lauftempo und suchte immer wieder nach dem günstigsten Weg.
Sie kam nicht so schnell voran, wie sie es sich gewünscht hätte. Sie lief weiter bis zum Höchststand der Sonne, dann gönnte sie sich am Rande einer Lichtung die erste Pause.
Sie öffnete den Bauchgurt und ließ den Rucksack vom Rücken rutschen. In einer Seitentasche suchte sie nach Räucherfleisch, einer anderen entnahm sie die Trinkflasche. Dann setzte sie sich in das Gras.
Ein leichter Wind blies den Schweiß auf der Haut trocken und spielte mit ihren Haaren. Sie biss ein Stück Fleisch ab und kaute.
Josh hatte ihr die besten Teile mitgegeben. Sie würde nicht viel Zeit zum Jagen haben, gab er sich überzeugt. Auch einen ansehnlichen Vorrat der getrockneten Pilze hatte er in die Seitentaschen des Rucksacks geschmuggelt.
Dessen Entdeckung entlockte Mila ein Lächeln.
Ein rhythmisches Geräusch im Dickicht hinter ihr ließ sie aufspringen.
Ein größeres Tier war über trockenes Laub gelaufen. Mila legte eine Hand auf den Griff ihres Messers am Gürtel. Handelte es sich um Wild oder um einen Räuber? Vielleicht Wölfe oder streunende Hunde? Irgendwelche gefährlichen Viecher konnten einem überall und jederzeit begegnen. Dann begann ein Kampf um Leben und Tod.
Konzentriert beobachtete sie den Waldrand vor sich. Doch sie sah kein Tier. Außer dem Rauschen des Windes in den Kronen der Bäume und dem Rascheln des Laubes auf dem Boden hörte sie nichts mehr.
Trotzdem löste sie die Verschnürung, mit der sie ihren Feldbogen auf den Rucksack gebunden hatte.
Sie spannte die Waffe, verstaute die Trinkflasche und nahm ihr Gepäck wieder auf.
Nachdem Mila den Bauchgurt geschlossen hatte, überquerte sie die Lichtung und setzte ihren Weg fort.
In unregelmäßigen Abständen blieb sie einen Moment stehen und lauschte. Folgte ihr ein Jäger? War sie nicht allein? Hatte ein Raubtier beschlossen, sie zur Beute werden zu lassen?
Das Gelände stieg an. Der Waldboden war nun von Moosen bedeckt. Das machte es einem Räuber leichter, ihr unbemerkt zu folgen und für einen Angriff einen Augenblick abzuwarten, in dem sie unaufmerksam war.
Am späten Nachmittag stand sie am Waldrand und schaute auf eine Bergwiese. Sie wuchs auf dem Rücken eines mächtigen Abhangs.
Das Gras glänzte silbrig in der Sonne und duftete süß. Windböen drückten es nieder, und wenn es sich wieder aufrichtete, erinnerten die Wogen an den Anblick der Wasseroberfläche eines Meeres.
Mila beschloss, den Hang bis zum Einbruch der Dunkelheit zu bezwingen und oberhalb der Bergwiese ihr Nachtlager aufzuschlagen.
Keuchend setzte sie einen Fuß vor den anderen. Steil stieg das Gelände vor ihr an. Der Schweiß drückte sich aus allen Poren. Immer wieder musste sie ihren Aufstieg unterbrechen und verschnaufen.
Der schwere Rucksack auf ihrem Rücken zog mächtig. Sie nutzte den Bogen als Stecken und kämpfte sich Meter für Meter hinauf.
Erneut blieb sie stehen und schaute zurück.
Der Waldrand unter ihr war bereits weit entfernt. Sie sah die Bäume und das Dunkel darunter. Mehr war nicht zu erkennen.
Sie glaubte, im Gras eine Bewegung wahrgenommen zu haben. Aber in dem wogenden Meer aus Halmen war es aus der Entfernung kaum möglich, Einzelheiten auszumachen.
Beunruhigt setzte sie ihren Aufstieg fort und schaute immer wieder unvermittelt zurück. Doch einen überraschten Verfolger entdeckte sie nicht.
Mila erreichte das Ende der Bergwiese kurz nach Sonnenuntergang.
Unter einem einzelnen windschiefen Bäumchen ließ sie das Gepäck vom Rücken gleiten und fiel daneben in das Gras. Sie war erschöpft und verspürte Durst. Doch sie wartete noch einen Moment, bis sich ihr Puls beruhigte. Dann holte sie ihre Flasche hervor und trank.
Plötzlich erinnerte sie sich an das Fernglas. Sie öffnete ihren Rucksack und suchte danach. Dabei stieß sie auf das dicke Buch. Auch das hatte sie den steilen Hang herauf geschleppt, aber niemals hätte sie es zurückgelassen. Es hatte ihr das Leben gerettet und würde das Leben vieler Menschen in der Zukunft retten. Doch zum Lesen der für sie oft schwer verständlichen Zeilen war sie an diesem Abend zu müde.
Sie nahm das Fernglas aus dem Rucksack und schaute hindurch. Langsam ließ sie ihren Blick über das unter ihr liegende Gelände schweifen.
Der Waldrand wirkte verlassen. Das Gras bewegte sich nicht mehr so stark. Der Wind wehte nur noch mäßig. Alles erschien ihr friedlich. Doch sie traute diesem Frieden nicht. Irgendetwas oder irgendjemand verfolgte sie. Sie spürte es.
Mila legte sich auf den Rücken und ließ das Fernglas über das Gelände über ihr gleiten.
Felsen, Moose, Flechten. Hier und da eine verkrüppelte Kiefer, ein Dornenbusch oder ein Büschel Gras. Sie hatte die Baumgrenze erreicht. Ab jetzt wurde die Landschaft offener.
Sie suchte nach der Passstraße, die sie auf einem ihrer Streifzüge in der Ferne entdeckt hatte, aber sie konnte sie nicht finden. Vielleicht morgen, nachdem sie höher hinauf gestiegen war.
Aufmerksam beobachtete sie wieder die Bergwiese unter sich.
„Komm schon“, murmelte sie. „Zeig dich, du Feigling.“
Das Tageslicht schwand. Die Lichtstärke des Fernglases reichte nicht mehr aus, um etwas zu erkennen.
Ab jetzt verließ Mila sich auf ihr Gehör und starrte in die Dunkelheit. Über ihr leuchteten die Sterne, ein halber Mond ging auf. Sie bemühte sich, wach zu bleiben. Der unbekannte Feind sollte keine Gelegenheit haben, sie zu überraschen. Doch nur wenig später fielen ihr die Augen zu.
Silber
Zum Sonnenaufgang weckte sie ein Knurren und Hecheln. Jemand machte sich an ihrem Rucksack zu schaffen. Sie tastete nach ihrem Messer. Dann riss sie es aus der Lederscheide, sprang auf und brüllte. Für einen Sekundenbruchteil blickte sie in zwei erschrockene Augen. Dann stob der Fuchs davon und blieb wenige Meter entfernt von Mila stehen.
„Ach, du bist das also gewesen“, stellte sie erleichtert fest.
Das Tier sah sie aufmerksam an. Es war abgemagert. Sein Fell schimmerte matt in der Morgensonne. Ein schmutziges rot-braun, silbrig-grau auf der Brust, ein grau-weißer Schwanz. Offenbar die Reste eines Winterfells. Die Pfoten waren schwarz. Es sah aus, als hätte es schicke Stiefel an.
Mila gähnte und warf einen Blick auf ihren Rucksack. Der Fuchs hatte versucht, eine der Seitentaschen zu öffnen. Darin befand sich das geräucherte Fleisch.
„Du hast Hunger“, stellte sie fest. „Wieso fängst du keine Wühlmäuse? Sind doch bestimmt genug da.“
Der Fuchs sah sie an und spielte mit den Ohren. Dann antwortete er mit einem Gähnen und zeigte eine tadellose Zahnreihe mit spitzen Reißzähnen.
Mila entnahm der Seitentasche ein Stück Fleisch.
Unruhig tänzelte das Tier auf seinen langen Beinen umher und konnte den Blick nicht davon abwenden.
Sie warf dem Fuchs den verlockend duftenden Leckerbissen entgegen. Er purzelte ihm vor die Pfoten. Gierig schnappte er danach und entfernte sich damit ein paar Meter. Dann begann er, das Räucherfleisch zu verschlingen.
„Du wirst einen irren Durst davon bekommen“, prophezeite Mila und biss ihrerseits in ein Stück des würzigen Fleisches. Dann stopfte sie sich noch einige getrocknete Pilze in den Mund, trank einen Schluck Wasser und erhob sich.
Sie entspannte ihren Bogen und befestigte ihn wieder auf dem Rucksack. Nachdem sie sich ihr Gepäck auf den Rücken gewuchtet hatte, setzte sie ihren Marsch fort.
Der Fuchs folgte ihr in einigen Metern Abstand.
„Ich werde dich ‚Silber‘ nennen“, rief sie.
Der Aufstieg war mühsam. Der felsige Untergrund verlangte große Aufmerksamkeit. Ein falscher Tritt und sie würde stürzen und sich verletzten.
Silber hingegen setzte trittsicher eine Pfote vor die andere.
Mila war sich sicher, er folgte dem Duft des Fleisches.
Gegen Mittag rasteten sie auf dem Kamm des Bergrückens. Mit dem Fernglas suchte sie nach der Passstraße. Warme Luft flimmerte am Horizont. Dann hatte sie sie gefunden.
Grau schlängelte sich das Asphaltband in der Ferne an den Berghängen entlang. Die Straße war weiter entfernt, als sie gehofft hatte. Sie war ihr trotz eines Marsches von anderthalb Tagen kaum näher gekommen. Enttäuscht ließ sie das Fernglas sinken.
„Das wird ein langer Weg“, murmelte sie niedergeschlagen.
Mila trank etwas und biss von ihrem Räucherfleisch ab. Ein Stück davon hielt sie Silber entgegen. Doch der Fuchs zeigte sich misstrauisch und blieb auf Abstand. Schließlich warf sie ihm seine Portion erneut vor die Pfoten.
Sie stiegen hinab in eine Schlucht und auf der anderen Seite wieder hinauf. Sie folgten einem weiteren Bergrücken über dessen Kamm und liefen über eine Almwiese hinunter in ein enges Tal.
Silber trank durstig aus einem Bach. Mila füllte ihre Wasserflasche auf und wusch sich das Gesicht.
Am Nachmittag erklommen sie einen kargen Steilhang und stiegen auf der anderen Seite über ein Geröllfeld wieder hinab. In einem Hain aus verkrüppelten Kiefern rasteten sie. Erschöpft ließ Mila sich auf den Nadelteppich fallen.
Silber unterschritt das erste Mal seine bisherige Fluchtdistanz und legte sich zwei Armlängen von Mila entfernt in den Schatten und hechelte. Offenbar hatte er weniger Angst vor ihr als vor der unbarmherzig niederbrennenden Sonne, die bereits zu dieser frühen Jahreszeit alles verdorrte, was nicht tief genug Wurzeln schlug, um an Wasservorkommen unter den Felsen zu gelangen.
Mila verzichtete auf einen Bissen Fleisch und begnügte sich mit einigen Schlucken Wasser. So zeitig im Jahr gab es kaum reife Früchte oder Pilze, die ihren Proviant hätten ergänzen können. Wild hatte sie bisher auch keines gesehen.
Sie rationierte ihre Vorräte und hoffte, dass sie reichen würden, bis sie etwas anderes zu essen fand.
Sie zogen weiter bis zum Einbruch der Dunkelheit.
Am nächsten Morgen regnete es. Ein Wasserproblem sollten sie also vorerst keines bekommen. Aber in dieser Höhe im Gebirge wurde es schnell kalt. Auch die tief hängenden Wolken waren ein Problem. Mila hatte Mühe, ihre Richtung zu bestimmen. Die Gipfel zeigten sich dicht verhangen.
Sie suchte mit dem Fernglas nach der Passstraße. Aber sie fand sie nicht.
Mila drosselte das Marschtempo und konzentrierte sich auf essbare Pflanzen und Wild. Aber außer einigen Flechten und Moosen fand sie kaum etwas. Gegen Abend erwischte Silber in einem Bergeinschnitt eine Wühlmaus und verschlang sie hungrig.
„Teilen ist nicht so dein Ding, was?“, rief sie.
Der Fuchs warf ihr einen schuldbewussten Blick zu und schnürte weiter mit der Nase dicht über den Boden.
In der Nacht schliefen sie unter der Plane. Mila spannte sie abends auf und wies Silber einen Platz zu. Doch er hatte Angst. Er legte sich etwas abseits nieder und wartete, bis sie eingeschlafen war. Der Regen trieb ihn schließlich doch unter das schützende Dach. Er rollte sich zusammen und bedeckte die Schnauze mit dem buschigen Schwanz. Früh morgens war er als erster auf den Beinen. Ausgefallene Haare aus seinem Fell an ihrem Rucksack verrieten Mila, dass er den ihm angebotenen Platz genutzt hatte.
Tag für Tag marschierten sie über Wiesen, kletterten über Geröllfelder und stiegen auf Berge.
Mal folgten sie einem ausgetrockneten Bachlauf, dann wieder einem Wildwechsel, oder sie nutzten halb zugewucherte Wege und Pfade aus vergangenen Zeiten.
Ihr Proviant war aufgebraucht. Sie benötigten dringend etwas zu essen. Mila knurrte der Magen. Silber fing tagelang keine Mäuse.
An einem Nachmittag witterte er eine abgestürzte Gämse. Mila konnte nur die Hufe sehen. Der Körper lag auf einer Felsnase hoch über ihr.
„So ein Mist“, fluchte sie. „Und ich soll da jetzt rauf klettern?“
Silber schaute sie auffordernd an. Sie ließ schnaufend ihren Rucksack von den Schultern rutschen.
Josh hatte ihr riskante Klettermanöver verboten. Wenn sie sich ein Bein brach oder gar abstürzte, würde sie dort oben allein sterben. Aber sie brauchten dringend Nahrung. Essen oder verhungern. So einfach war das.
Mila forschte mit den Augen nach einer Route und setzte ihren Fuß auf den ersten Vorsprung. Mit den Fingern in Ritzen und Spalten zog sie sich hinauf. Mit den Sohlen ihrer Stiefel suchte sie Halt auf feinen Unebenheiten oder winzigen Felsnasen. Zwei Füße und eine Hand am Berg, die freie Hand tastete nach einer zerklüfteten Stelle im Fels. Dann einen Fuß und zwei Hände am Berg, der andere Fuß fand Halt auf einem schmalen Absatz. So schob sie sich Zentimeter für Zentimeter dem Kadaver entgegen. Schweiß lief ihr in die Augen und trübte ihren Blick. Sie wischte ihn fort und schaute nach oben. Zwei Meter trennten sie von der Gämse. Verwesungsgeruch stieg ihr in die Nase. Sie hörte deutlich das Summen von Fliegen.
Nachdem sie weit genug hinauf geklettert war, streckte sie ihre Hand nach einem der Hufe aus, packte kräftig zu und zog daran. Ein abgenagtes Gerippe kippte über die Felsenkante, sauste an ihr vorbei und stürzte in die Tiefe.
Der Kadaver bestand praktisch nur noch aus Fell, und Horn. Die Fleischreste an den Knochen waren vertrocknet und verdorben. Wahrscheinlich hatten Vögel alles andere gefressen. Nur Silber vermochte damit noch etwas anzufangen. Er sprang erschrocken davon, als das Gerippe krachend neben ihm aufschlug. Dann stürzte er sich auf die mageren Reste.
Füchse konnten Aas verdauen, Menschen nicht.
Hinauf ist immer leichter als herunter. Diese Weisheit bewahrheitete sich wieder einmal.
Mila war keine geübte Bergsteigerin und rutschte während ihres Abstiegs mehrmals mit dem Stiefel aus dem Halt und wäre beinahe abgestürzt. Es kostete sie die letzten Kräfte, sich mit den Fingern in die Felswand zu krallen. Unten angekommen ließ sie sich erschöpft zu Boden fallen.
Am liebsten wäre sie dort einfach liegen geblieben, aber die Stelle erschien ihr für ein Nachtlager ungeeignet. Ungeschützt wären sie Wind und Wetter ausgeliefert gewesen. Sie mussten weiter gehen und einen besseren Platz suchen.
Erst nach Einbruch der Dunkelheit entschied sich Mila notgedrungen für eine flache Bergwiese. Ein mickriger Dornenbusch, halb verdorrt, bot die einzige Möglichkeit, die Plane anzubinden. Sie befestigte den Regenschutz mit der anderen Seite an ihrem Rucksack. Dann kroch sie darunter und schlief sofort ein. Irgendwann in der Nacht rollte Silber sich hinter ihr zusammen. Es hatte begonnen, zu regnen.
Der nächste Morgen begann kühl und nass. Regenwasser war den Hang hinunter gelaufen und in Milas Kleidung gesickert. Sie fror. Aber sie fühlte sich zu schwach, um etwas dagegen zu unternehmen. Hunger und Erschöpfung verdammten sie zu einer Pause. Sie zitterte im Schüttelfrost. Ein Fieberschub zwang sie, den Tag zu verschlafen. Erst am späten Nachmittag weckte sie ein Sonnenstrahl, der seinen Weg unter die Plane in ihr Gesicht gefunden hatte. Der Himmel zeigte sich blau-weiß. Ein starker Wind trieb die Wolken auseinander.
Mila fühlte sich besser. Zwei Meter von ihr entfernt entdeckte sie ein totes Murmeltier. Halb aufgefressen. Silbers Beute.
Am liebsten hätte sie ihre Zähne sofort in das rohe Fleisch geschlagen. Aber Josh hatte sie auch davor gewarnt.
Keime und Bakterien konnten zu heimtückischen Mördern werden. Zumal der Fuchs davon gefressen hatte. In den Mäulern von Aasfressern tummelte sich eine gefährliche Mikro-Fauna, die in der Lage war, einen Menschen tödlich zu infizieren. Ein Feuer musste her.
Mila raffte sich auf. Doch viel Brennmaterial gab die Bergwelt in dieser Höhe nicht her. Sie brach trockene Äste aus dem Dornenbusch und suchte die Umgebung nach allem ab, was irgendwie brennbar erschien.
Es sollte reichen für ein Häufchen Glut. Das Murmeltier schmeckte köstlich. Nur war an einem solchen Wildtier nicht viel dran und davon hatte Silber bereits die Hälfte gefressen.
„Wo war der überhaupt?“, fragte Mila sich selbst und schaute umher. Doch er blieb verschwunden.
Sie trank etwas Wasser und rollte sich wieder unter die Plane. Es war schon zu spät, um ihre Suche nach dem Tal an diesem Tag fortzusetzen. Lieber wollte sie sich noch einige Stunden Erholung gönnen.
In der Nacht schreckte sie auf. Sie glaubte, einen Schrei gehört zu haben. Sie lauschte einen Moment, konnte aber keinen weiteren Laut mehr vernehmen.
Nach dem grausamen Tod ihrer Mutter plagten sie grässliche Albträume. Mit jedem Jahr, das verging, nahmen sie ab. Doch manchmal quälten sie sie erneut. Vielleicht hatte sie nur geträumt. Sie versuchte, in der Dunkelheit Silber auszumachen. Aber er befand sich offenbar nicht in ihrer Nähe. Sie bemühte sich, wieder einzuschlafen. Aber es gelang ihr nicht. Bis zum Morgengrauen dämmerte sie halb wachend halb schlafend dahin. Mit dem ersten Licht am Horizont stand sie auf und baute ihr Lager ab.
Silber blieb verschwunden. Mila setzte ihren Marsch ohne ihn fort. Er war ein freies, wildes Tier. Vielleicht hatte er genug von ihr und war in sein bisheriges Leben zurückgekehrt.
Am Himmel zog ein Bussard weite Kreise.
Sie stieg die Hangwiese hinauf und lief auf der anderen Seite den Bergrücken hinunter. Feiner Schotter knirschte zwischen ihren Stiefelsohlen.
Das Tal unter ihr lag in einem beinahe undurchdringlichen Nebel. Er benetzte kalt und feucht ihre Kleidung, ihr Haar und ihre Haut. Das Gras war nass, Wasser drang durch die Nähte ihrer Schuhe.
Wenige Meter vor ihr nahm sie eine Bewegung in der Wiese wahr. Sie blieb stehen, ließ ihren Rucksack leise zu Boden gleiten und löste die Schnüre, die den Bogen hielten. Sie spannte ihn, legte einen Pfeil an die Sehne und schlich lauernd weiter. Lautlos setzte sie einen Fuß vor den anderen.
Ein Steinadler saß mit halb ausgebreiteten Schwingen am Boden. Mit den spitzen Krallen packte er fest zu und hackte mit dem scharfen Schnabel Fleischstücke aus einem Beutetier heraus, die er sogleich verschlang.
Er wandte Mila den Rücken zu. Sie prüfte den Wind. Es gab keinen. Also konnte er auch keine Witterung aufnehmen.
Die Gier nach Fleisch verringerte seine Aufmerksamkeit. Mila legte auf ihn an und zog die Sehne an ihre Wange. Dann ließ sie los.
Der Pfeil durchbohrte den Adler und steckte bis zur Hälfte in der breiten Brust. Tödlich getroffen bemühte sich das Tier, mit einem letzten aussichtslosen Versuch aufzufliegen. Es breitete die mächtigen Schwingen aus, doch ein unsicheres Taumeln beendete den Fluchtversuch. Der imposante Greifvogel fiel um und blieb, nicht weit von seiner Beute entfernt, liegen.
Mila zog ihr Messer aus der Lederscheide und trat vor. Dann erkannte sie das Beutetier des Adlers. Es war Silber.
Das rote Fell, die silber-graue Brust, der buschige Schwanz. Kein Zweifel. Der große Vogel hatte den Fuchs erbeutet und bereits zur Hälfte aufgefressen. Er hatte die Bauchdecke geöffnet und die Innereien verschlungen. Die Vorder- und Hinterläufe waren noch da.
Mila zerteilte Silbers Kadaver und trennte auch die Vorderläufe samt Schulterstück und Unterschenkel ab.
Seit dem Tod von Wolf hatte sie ihr Herz verschlossen.
Nie wieder wollte sie es sich erlauben, einen Freund zu haben, auf den sie nicht ohne Seelenschmerz verzichten könnte.
Der große schwarze Hund wurde von Wölfen zerfleischt und ihr Mitgefühl hatten sie ebenfalls verschlungen. Diese Welt war grausam und sie musste sich dem stellen. Für Gefühle war da kein Platz. Die einzelne Träne wischte sie fort. Es war nur die kalte Morgenluft, redete sie sich ein.
Sie nahm den Adler aus, schlug ihn aus seinem Federkleid und entfernte Kopf und Fänge. Dann wickelte sie die Reste beider Tiere in ihren Poncho und band sie außen an den Rucksack. Den Bogen musste sie fortan tragen. Aber das nahm sie hin. Ihr Fleischvorrat reichte nun mindestens für fünf Tage. Vielleicht auch länger.
Mit zwei kräftigen Schnitten trennte sie auch die Schwingen vom Rumpf. Die konnte sie zur Herstellung neuer Pfeile gut gebrauchen. Das Befiedern der hinteren Enden ihrer Geschosse diente der Stabilisierung des Fluges und war unerlässlich.
Mila warf sich den Rucksack auf den Rücken, nahm ihren Bogen auf und stieg weiter hinab in das Tal. Sie musste ihren Weg fortsetzen, von nun an allein. Aber war es am Ende nicht immer so gewesen?
Nur für den Fall, dass sich dennoch ein wenig Trauer um den Fuchs in ihr Herz schleichen sollte, erhöhte sie ihr Marschtempo. Sie wollte keine Zeit mehr verlieren. Sie musste ihr Tal endlich finden.
Der Pass
Das Fleisch reichte für etwas mehr als eine Woche, dann begannen die Reste zu schimmeln. Mila hatte es am ersten Tag gegrillt, nachdem sie in einem trockenen Bachbett ausreichend Schwemmholz für ein Feuer gefunden hatte. Nun hatte sie seit zwei Tagen nichts mehr gegessen. Wenigstens war es hoch oben in den Bergen kein Problem an sauberes Trinkwasser zu gelangen. Irgendwo suchte sich immer ein Rinnsal seinen Weg ins Tal oder sie überquerte verharschte Schneefelder und stopfte ihre Trinkflasche mit dem halbgefrorenen Eis voll.
Jetzt stand sie auf der Straße und stampfte sich den Schnee von den Schuhen.
Das löchrige und rissige Asphaltband schlängelte sich vor ihr den Berg hinauf und hinter ihr ins Tal hinab. In irgendein Tal. Nicht in ihr Tal. Sie hatte viele Täler gesehen. Immer wieder überschwemmt von Sturzfluten, verschüttet von Gerölllawinen und Muren-Abgängen oder regelrecht planiert von der Kilotonnen schweren Urgewalt der Schnee- und Eislawinen im Winter. In dem was übrig blieb, war kein Leben mehr möglich. Selbst Brennnesseln und Disteln wurden in dieser Umwelt nicht alt, bevor die nächste Katastrophe alles wieder dem Erdboden gleich stampfte.
Mila folgte dem Pass bergauf. Irgendwohin sollte er wohl führen. Niemand hätte eine Straße gebaut, wenn es am Ende nicht etwas Bedeutendes gäbe.
Seit zwei Tagen ernährte sie sich von Taubnesseln. Sie rupfte sie aus und verspeiste sie, wo sie die niedrig gewachsenen Pflanzen fand.