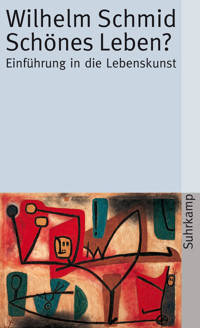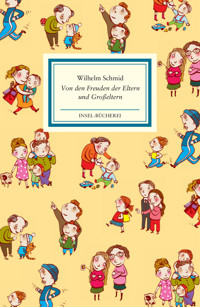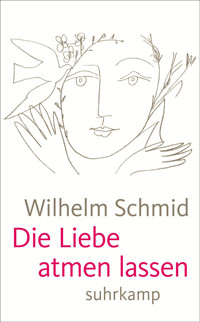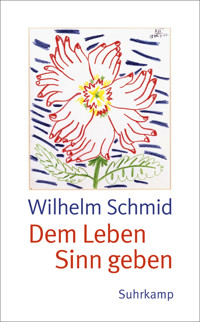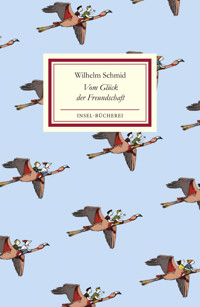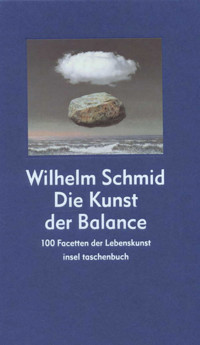13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Unsere Zeit bedarf einer Philosophie, die sich den kleinen und großen Lebensfragen stellt: Welche Bedeutung haben Berührungen, Gewohnheiten, Sehnsüchte, Schönes? Was ist Glück? Hat das eigene Leben, das Leben überhaupt einen Sinn? Welchem Zweck dient die Arbeit? Wie lässt sich Orientierung fürs Leben finden? Wie umgehen mit Ärger, Lebenskrisen, Enttäuschungen, Schmerzen, Krankheit und Tod? Ein Philosoph kann Lebenssituationen analysieren und mögliche Antworten vorschlagen. Philosophie wird zur Lebenshilfe durch die immer neue Orientierung des Lebens mithilfe des Denkens.
Wilhelm Schmid, Bestsellerautor (Gelassenheit, Glück), konnte seine Ideen zur Neubegründung einer philosophischen Lebenskunst über zehn Jahre hinweg in einem Krankenhaus in der Nähe von Zürich erproben. Und er machte die Entdeckung, wie wichtig für Menschen die bloße Tatsache eines Gesprächs über all das ist, was sie bewegt und wofür kaum irgendwo sonst Zeit zur Verfügung steht.
Der Philosoph ist ein Partner für das Lebensgespräch, ein säkularer Seelsorger. Bereits Sokrates bezeichnete seine Tätigkeit lange vor dem Christentum als Seelsorge, als Hilfestellung für andere Menschen zu ihrer Sorge für sich selbst.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 491
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Wilhelm SchmidDas Leben verstehen
Von den Erfahrungen eines philosophischen Seelsorgers
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Was ist eigentlich Leben? Gespräche mit Patienten und Klienten
Überraschende Begegnungen bei der Visite
Bruch im Leben: Jede Krankheit kann eine Lebenskrise sein
Aber nicht jede Lebenskrise geht mit einer Krankheit einher
Wie umgehen mit sich selbst? Die Kunst des Neuanfangs
Was ist schön? Wieder anzufangen, das Leben zu genießen
Werde ich jemals glücklich sein? Was ist der Sinn?
Haben die Krise, die Krankheit, das Leben irgendwelchen Sinn?
Kann es eine Lebenskunst angesichts des Todes geben?
Leben auf zwei Planeten: Die Welten drinnen und draußen
Wie hängt das alles zusammen? Gespräche mit Ärzten und Mitarbeitenden
Transversale Arbeit: Quer durchs ganze Haus
In der Verwaltung: Das Haus von oben her betrachtet
Im Operationssaal, dem Atelier der Chirurgen
Ars Medici: Die Kunst des Arztes und seine Lebenskunst
Die Pflege als Kunst und Lebenskunst
Physiotherapie: Die wahre Bedeutung der Arbeit am Körper
Psychotherapie: Die Möglichkeiten der Kunst und des Ausdrucks
Psychiatrie: Aus welchem Stoff besteht die Seele des Menschen?
Theologie: Religiöse Seelsorge
Was macht ein Philosoph? Grundzüge einer weltlichen Seelsorge
Zur Geschichte der philosophischen Seelsorge
Das philosophische Gespräch: Rat oder Beratung?
Die Fragen der Philosophie: Was die Gespräche antreibt
Die Frage der Autonomie: Was bedeutet Selbstbestimmung?
Die Lebenshilfe der Philosophie: Worin besteht der Gewinn der Gespräche?
Meine eigene Frage nach dem Sinn: Wozu das alles?
Fundamentale Fragen: Was ist Krankheit?
Ein Ort für die Krankheit: Seit wann gibt es Krankenhäuser?
Integrative Idee: Arbeit an einer etwas anderen Art von Krankenhaus
Was ist Lebenskunst? Themen und Diskussionen
Lebenskunst und Kürze des Lebens, Heiterkeit und Zorn
Freiheit und Formgebung, Selbstbestimmung und Selbstbegrenzung
Von der Kunst des Berührens und Berührtwerdens
Schattenseiten des Lebens
Macht und Ohnmacht
Sinn und Sinnlosigkeit
Lebenskunst im Umgang mit sich selbst und Anderen
Liebe und Lieblosigkeit
Andere Dimensionen der Liebe
Mensch sein, in Beziehung sein
Wie finden Theorie und Praxis zusammen? Werkstatt der Lebenskunst
Zum Umgang mit Gewohnheiten im Pflegeheim
Wie umgehen mit Überbelastung in der Arbeit?
Was bleibt nach einem langen Arbeitsleben?
Die Rolle eines starken Teams bei der Betreuung von Krebskranken
Überlegungen mit Pflegenden zum Umgang mit Sterben und Tod
Die Deutung der Seele: Ein Gemeinschaftsprojekt
Haben Schmerzen einen Sinn?
Schlussbetrachtungen
Abschied nehmen
Was bleibt von der Arbeit im Krankenhaus?
Überlegungen zu einer veränderten Philosophie in einer anderen Moderne
Vorwort
Zügig bleibt die Stadt zurück und anstelle der Häusersäulen erstrecken sich Wiesen und Äcker, Obstfelder und Mischwälder über sanfte Hügel. Am Zugfenster ziehen schmucke Dörfer mit alten Höfen und neuen Betonbahnhöfen vorbei, dann wieder stoisch vor sich hin käuende Kühe, tatsächlich fast lila, wie in einer Werbung für Milchschokolade. Die Bahntrasse durchschneidet, als wäre es nie anders gewesen, einen Seerosenteich unter leicht bedecktem Himmel, in der Ferne überragen die Zacken hoher Berge den Morgennebel.
Südwestlich von Zürich liegt Affoltern am Albis, ein kleines, unspektakuläres Städtchen, in einer halben Stunde vom Hauptbahnhof aus mit der S-Bahn zu erreichen. Zum Spital, etwas bergan gelegen, gehe ich eine Viertelstunde zu Fuß. Es ist ein normales, schulmedizinisches Krankenhaus für die Grundversorgung von mehreren zehntausend Menschen in der Region Knonauer Amt (im Volksmund auch »Säuliamt« genannt). Zwischen Geburt und Tod wird ein weites Diagnosespektrum behandelt: Menschen mit allerlei Wunden, Rheuma, Rückenleiden, Darmerkrankungen, Herzleiden, Krebs, Hirnschlag, aber auch Menschen in Lebenskrisen, etwa im Falle von Panikattacken, Unfallverarbeitung, Depressionen, Suizidgefahr, psychotischen Episoden. Behandelt wird im so genannten Akutspital in den Abteilungen Innere Medizin, Chirurgie, Gynäkologie und Geburtshilfe. Der Inneren Medizin zugeordnet sind (zu dieser Zeit) ein Pflegeheim, ein Altersheim, ein geriatrisches und ein psychiatrisches Tagesheim. Eine besondere Errungenschaft ist die Abteilung für Psychotherapie, in der mehrere Kunst- und Ausdruckstherapeuten arbeiten. Nach jahrelangem Ringen entsteht außerdem eine Palliativstation, in der Menschen bis in den Tod begleitet werden.
Wie kam ich dazu, als Philosoph in diesem Krankenhaus zu arbeiten? Den Anfang machte ein Essay, »Vom Sinn der Schmerzen«, den ich 1995 in der Basler Zeitung publizierte.* Ein Arzt in Affoltern am Albis las ihn und fand ihn interessant, der Chefarzt der Inneren Medizin, Dr. Christian Hess, nahm Kontakt auf und lud mich ein, die Thesen im Rahmen der hauseigenen Weiterbildung vorzustellen, nebst einem gemeinsamen »Nachtessen«. Der Vortrag fand Anklang und zog die Einladung nach sich, für einige Zeit im Krankenhaus zu arbeiten und die Ideen zu einer neuen Lebenskunst – die den weiteren Rahmen zum erwähnten Essay bildeten – in der Praxis zu erproben. Die Praxis ist für so manchen Philosophen freilich ein Ärgernis. Im praktischen Leben können theoretische Überlegungen scheitern, denn das Leben hält sich nicht immer an die Begriffe, mit denen es zu fassen versucht wird. Philosophen lasten die Schuld dafür nicht so sehr den Begriffen an, eher dem Leben, das sich nicht fügen will. Umso schlimmer für das Leben, das ohnehin die Gefahr mit sich bringt, die Distanz zur Unmittelbarkeit zu verlieren, die für jedes Denken wesentlich ist.
Die größten Zweifel, ob die Philosophie dort hilfreich sein kann, wo es doch oft in einem sehr direkten Sinne um Leben und Tod geht, hegte ich selbst. Was soll ein Philosoph im Krankenhaus? Das war zuallererst meine Frage. Da ich mich aber um die Neubegründung einer Philosophie der Lebenskunst bemühte, konnte ich mich nicht gut vor der Erprobung in der Praxis drücken, denn wozu Lebenskunst, wenn sie im wirklichen Leben nichts taugt? Lebenskunst ist nicht in erster Linie für das gelingende Leben da, sie wird vielmehr vor allem dann gebraucht, wenn das Gelingen ausbleibt und Lebensfragen aufbrechen. Das aber geschieht verschärft dort, wo Menschen das Leben nicht mehr verstehen, da sie mit Lebenskrisen und Krankheiten konfrontiert sind. Also sagte ich zu und nahm die Arbeit auf, erstmals im September 1998, dann jedes Jahr wieder für die von Anfang an so genannten Philosophiewochen, während derer ich auf dem Klinikgelände wohnte. Ich bat lediglich um eine zeitliche Begrenzung des Engagements auf zehn Jahre: Der überschaubare Zeitraum, so hoffte ich, würde alle Beteiligten und mich selbst dazu motivieren, alles zu geben, mit der Aussicht, dann auch wieder etwas Anderes machen zu können. So kam es zum schwierigsten und zugleich lehrreichsten Projekt, auf das ich mich bis dahin eingelassen hatte.
Da ich durch nichts auf diese Tätigkeit vorbereitet war, wurde alles zum Experiment. Zwar hatte ich mir viele Gedanken zu den Bedingungen und Möglichkeiten des Lebens gemacht, doch was davon würde sich in der Praxis bewähren? Es bedurfte eines tastenden Vorgehens, um Schritt für Schritt ausfindig zu machen, was unter den gegebenen Umständen möglich ist. Zunächst war ungewiss, ob das Angebot überhaupt Anklang bei Patienten und Mitarbeitenden finden würde, sodann ungewiss, was daraus werden würde. Aber der Zuspruch war vom ersten Tag an groß und ließ auch nicht nach, als die Anfangsjahre vorbei waren, in denen das ungewöhnliche Projekt viel Aufmerksamkeit auf sich zog. Es musste etwas damit verbunden sein, das nicht nur mir, sondern auch Anderen viel bedeutete, jedenfalls stellte sich mir die anfängliche Frage nach ein paar Jahren genau andersherum: Wie kommen eigentlich all die vielen Krankenhäuser ohne Philosophen aus?
Was ist dran an der Philosophie, die doch niemanden behandeln, niemanden im engeren Sinne therapieren kann? Sie kann helfen, das Leben besser zu verstehen, indem sie der Besinnung Raum gibt, also der Frage nach Sinn, um allein oder gemeinsam mit Anderen nach Antworten zu suchen. Sie ist ein Innehalten und Nachdenken, um Probleme zu identifizieren und zu analysieren, sie mit handlichen Begriffen fassbarer zu machen und mögliche Lösungen zu erkunden. Dass es im Krankenhaus außer um Behandlung auch um Besinnung geht, liegt nahe, aber ich bemerkte es erst vor Ort: Viele Menschen, die darniederliegen, verspüren ein existenzielles Bedürfnis, über ihre Situation, ihre Krankheit, ihr Leben und die Welt, in der sie leben, nachzudenken. Die Schlüsse, zu denen sie kommen, sind von Bedeutung dafür, wie sie ihre Situation bewältigen können. Und auch diejenigen, die für sie sorgen, sei es im direkten Umgang mit ihnen oder im Hintergrund, werden von Fragen zu ihrer Arbeit und ihrem Leben umgetrieben. Die Antworten, die sie finden oder die offenbleiben, sind von Bedeutung dafür, wie die Institution »funktioniert«, denn die lebt von den Menschen, die in ihr arbeiten.
In früheren Büchern habe ich die Lebenskunst im Umgang mit sich selbst, mit Anderen und der Welt insbesondere im vertrauten persönlichen Umfeld thematisiert.* Das vorliegende Buch widmet sich dem Leben und Arbeiten von Menschen außerhalb dieses Kokons. Auch wenn Lebenskunst als bewusste Lebensführung immer vom Ich ausgeht, kann sie nie beim Ich stehenbleiben, sonst wäre sie keine Kunst, sondern eine Dummheit. Das Ich ist verloren ohne Andere, die ihm zur Seite stehen, im engeren Umfeld wie auch außerhalb. Die Voraussetzung für den Beistand Anderer aber ist, dass es seinerseits Anderen beisteht und dies als Element seiner Lebenskunst begreift. Die Sorge für sich dient im Wesentlichen dazu, sich zur Sorge für Andere zu befähigen, aus bloßer Freude, aus Menschen- und Nächstenliebe oder eben in der Hoffnung, dass Andere sich zu gegebener Zeit um das Ich sorgen. Meist erst dann, wenn ein Ich die Sorge für Andere wahrnimmt, bemerkt es außerdem, wie sehr dies zu einer Erfüllung seines Lebens beiträgt, die es aus sich allein heraus kaum gewinnen kann.
Aus all diesen Gründen geht die Lebenskunst mit einer Ethik der Sorge einher, die außer der Selbstsorge eines Ich für sich auch die Sorge für Andere umfasst, um ihnen wiederum bei der Sorge für sich behilflich zu sein, und dies gerade dann, wenn ihr Leben schwierig wird. Die Ethik der Sorge macht andere Ethiken nicht überflüssig, die nach allgemein verbindlichen Werten und Prinzipien (Prinzipienethik) und nach gut begründeten Vorgehensweisen und Entscheidungen etwa in medizinischen Grenzfragen suchen (Angewandte Ethik). Aber jede Ethik ist letztlich auf die Haltung (das Ethos im Griechischen) und bewusste Lebensführung Einzelner angewiesen, die sich um ethische Fragen kümmern. Noch dazu ist die individuelle Ethik der Sorge die einzige, die auch Lebensfragen ernst nimmt und sie nicht als trivial abtut, also Fragen, die sich in Bezug auf kleine Alltagsdinge oder große Zusammenhänge des Lebens stellen, ohne dass es endgültige Antworten darauf geben könnte. Wo einst eine Religion mit heteronomer Sorge vorgeben konnte, letzte Antworten zu kennen, geht es in der philosophischen Lebenskunst um die Stärkung der autonomen Sorge Einzelner, um sie in die Lage zu versetzen, eigene Antworten zu finden, ausgehend von ihrem eigenen Interesse am Leben, ihren Erfahrungen und allem, was damit zusammenhängt. Mit dem Innehalten und Nachdenken, dem Philosophieren in diesem Sinne, beginnt die Suche nach provisorischen Antworten, die in der aktuellen Situation weiterhelfen und zugleich für andere Erfahrungen und Einsichten offenbleiben.
In einer Institution, die ganz auf die Sorge für Andere ausgerichtet ist, nehme ich selbst nun diese Ethik der Sorge wahr. Nach dem engeren Kreis des Umgangs mit sich und nahen Anderen ist dies der weitere Wirkungskreis der Lebenskunst: Vom individuellen zum institutionellen Rahmen. Fragen stellen sich: Was können Institutionen, auch Unternehmen, für die bewusste Lebensführung von Menschen tun? Was können Menschen in Institutionen und Unternehmen für sich und Andere und für die Rahmenbedingungen ihres Lebens tun?
Ein solches Nachdenken wäre an vielen Orten wünschenswert, nicht nur in Krankenhäusern. Alle Institutionen und Unternehmen nehmen Einfluss auf die Haltung und das Verhalten von Menschen, strukturieren zeitlich und räumlich ihr Leben vor, stellen Zusammenhänge zwischen ihnen her, ermöglichen ihnen Entfaltung oder hemmen sie, stellen Arbeit und Einkommen zur Verfügung oder auch nicht, eröffnen Chancen fürs Leben oder verschließen sie. Dass sie das Ich übergreifen und überdauern, gibt ihnen Bedeutung weit über das einzelne Leben hinaus: Viele Individuen können in ihnen aufblühen, aber auch verwelken. Individuen sind es im Gegenzug, die die Institutionen und Unternehmen mit Leben erfüllen oder leerlaufen lassen, je nachdem, wie sie die Sorge für sich und Andere wahrnehmen.
Auf dem Weg zur Lebenskunst und Ethik der Sorge können Philosophen behilflich sein, nicht zwingend nur Berufsphilosophen, sondern auch philosophisch interessierte Psychologen, Therapeuten, Theologen und Andere, die sich durch das Bemühen um einen weiten Horizont des Denkens und der Erfahrung auszeichnen. Auf der Suche nach einem Begriff für meine eigene Arbeit als Philosoph im Krankenhaus kam mir die philosophische Seelsorge in den Sinn, in Erinnerung an Sokrates, der seine Tätigkeit, Gespräche mit Menschen über Lebensfragen und Fragen einer Ethik der Sorge für sich und Andere zu führen, Seelsorge nannte. Erst später wurde ein Begriff der Theologie daraus. Die erneute Befassung mit der Seelsorge könnte eine notorische Schwäche der modernen Philosophie beheben und den Praxisbezug stärken, den diese bräuchte, um ihre Theorien erproben und korrigieren zu können. Nicht nur die immer neue Produktion von Theorien ist von Interesse, sondern auch deren gelegentliche Überprüfung, um aussortieren zu können, was sich nicht bewährt.
Was ich der Zeit in Affoltern verdanke, ist ein enormer Reichtum an Empirie im Sinne von Erfahrungen, die zum Korrektiv für meine eigenen Theorien werden konnten. Der vorliegende Bericht davon will nicht etwa ein Modell schildern, das auf andere Situationen und Institutionen übertragbar wäre, sondern diskutable Beispiele für eine philosophische Praxis im weiteren Sinne vorstellen. Einige Erkenntnisse könnten in eine philosophische Aus- und Weiterbildung einfließen, die über die weiterhin erforderlichen theoretischen Grundlagen hinaus auch auf praktische Tätigkeitsfelder vorbereitet. Die akademische Philosophie sollte sich verstärkt auf dieses Terrain der Lebenshilfe vorwagen, das sie grundlos scheut: Ihre denkerische Kompetenz, historisch und systematisch geschult, kann für Menschen in praktischen Nöten sehr hilfreich sein, auch wenn sie selbst das kaum für möglich hält.
Da die Arbeit im Krankenhaus eine sehr persönliche Erfahrung war, die mir naheging, obwohl sie vergleichsweise wenig Zeit beanspruchte, habe ich dieses Buch aus der Ich-Perspektive geschrieben. Namen und Daten wurden geändert, wenn es um des Persönlichkeitsschutzes willen nötig erschien, angezeigt mit einem Sternchen* bei der ersten Nennung. Das Buch enthält keine objektiven Wahrheiten, sondern subjektive Wahrnehmungen. Ich widme es den Menschen, denen ich begegnet bin und die damals dort gearbeitet haben, wo ich so viel über das menschliche Leben, die Bedingungen einer Institution und die Möglichkeiten der Philosophie lernen konnte. Gemeinsam praktizierten wir die Philosophie in ihrer einfachsten Form: Als Methode, sich zu besinnen. Ein auf Schritt und Tritt spürbares Entgegenkommen vieler Menschen hat die Erfahrung der Fremdheit an diesem ungewohnten, ungewöhnlichen Ort abgemildert. Zu keinem Zeitpunkt musste ich befürchten, ein unerwünschter Fremdkörper zu sein. Nur selten hatte ich den Eindruck, fehl am Platz zu sein. Von Grund auf fühlte ich mich aufgenommen in das Haus mit dem Wort, das ich zuallererst hörte: »Willkommen!«
Was ist eigentlich Leben? Gespräche mit Patienten und Klienten
Überraschende Begegnungen bei der Visite
Wie anfangen? Kaum jemand kennt mich hier. Die Vorbereitungsgruppe im Haus schlug mir vor, mich am besten selbst auf den Weg zu machen, um Menschen kennenzulernen, also gehe ich mit auf Visite. Weißer Kittel, auch für mich. Gemeinsam mit den medizinischen Kollegen stehe ich am Bett der Patienten, der Unterschied ist gleichwohl augenfällig: Sie können ad hoc wirksam sein und beispielsweise eine Wundheilung beurteilen und genau wissen, was jetzt zu tun ist. Welche Wunden kann ich heilen? Zwar lassen die Menschen, wenn ich als Philosoph vorgestellt werde, großen Respekt erkennen, manche fragen aber auch postwendend nach: »Und was macht ein Philosoph?« Nicht einmal diese Frage kann ich auf Anhieb beantworten, denn ich weiß es selbst nicht immer so genau.
»Wozu braucht man eigentlich einen Philosophen?« Nach der gestrigen Visite habe er die ganze Nacht darüber gegrübelt, sagt ein älterer, herzkranker Mann. Das Fenster in seinem Zimmer ist weit geöffnet, als ich ihn aufsuche, und er erzählt mir, dass er stundenlang nur auf seinem Bett liege, mit Blick zum Fenster. Jede Bewegung koste ihn Kraft und er wisse, dass keine wirkliche Aussicht auf Besserung besteht, »und so sinniere ich vor mich hin«.
»Schönes Wort«, sage ich. »So anspielungsreich.«
»Geistige Nahrung«, meint er, »die brauche ich, um mich im Denken zu üben, denn meine größte Befürchtung ist, ich könnte zu allem Überfluss auch noch Alzheimer bekommen.«
»Beim Denken kann ich helfen. Wahrscheinlich kann man einen Philosophen brauchen, um mit ihm über das Leben nachzudenken und über die mögliche Haltung zum Leben und darüber, was sinnvoll, wichtig und richtig ist und aus welchen Gründen.«
So kommen wir ins Gespräch und unterhalten uns eine halbe Stunde lang, bis ich bemerke, dass die Anregung für ihn in Ermüdung umschlägt. Ein Gespräch muss also limitiert bleiben, um nicht zu anstrengend zu werden; auch die »geistige Nahrung« ist eine Frage des Maßes.
Geistige Nahrung – könnte es das sein, was die Philosophie zu bieten hat? Diesen Begriff höre ich hier zum ersten Mal, fortan aber oft, viele im Haus gebrauchen ihn, Patienten ebenso wie Mitarbeitende, bezogen auf meine Arbeit. Sie sind dankbar dafür, etwas zu naschen oder auch zu beißen zu bekommen, das den Hunger nach gedanklicher Anregung stillen kann. Menschen ernähren sich offenkundig nicht nur physisch mit Essen, psychisch mit Gefühlen, sondern auch geistig mit Gedanken. Der Redeweise von »geistiger Nahrung« könnte neurobiologisch die Einsicht entsprechen, dass das Gehirn ständig dazu bereit ist, Neuronen und Synapsen zu bilden. Es braucht Stoffe, die ihm zu denken geben, um in Bewegung zu bleiben und nicht schon zu Lebzeiten tote Materie zu sein. Philosophische Fragestellungen und Denkanregungen können vermutlich den Prozess unterstützen, neue Informationen und Inhalte aufzunehmen, sie einzuordnen, zu organisieren und miteinander zu verknüpfen.
Für Menschen ist das Bedürfnis, sich Gedanken über alles Mögliche zu machen, wohl nie größer als in der ungewissen Situation, in der sie sich als Patienten befinden. Tag für Tag begegne ich Menschen, deren gewohntes, gesichertes Leben zerbrochen ist, momentan oder für lange Zeit, manchmal für immer. Häufig bettlägerig, haben sie alle Zeit der Welt, über ihr Leben nachzudenken, aber wo sind die Gesprächspartner für all das, was ihnen durch den Kopf geht? Kann ich ein solcher sein? Hilft ihnen das in irgendeiner Weise weiter? Und wenn ja, könnten auch Nichtphilosophen diese Aufgabe übernehmen? Nahestehende Menschen vielleicht, sofern sie damit nicht überfordert sind. Etliche Ärzte sicherlich, nur haben sie beim besten Willen oft nicht die Zeit dazu, eingehendere Gespräche am Bett oder im Sprechzimmer zu führen. Pflegende selbstverständlich, aber auch ihre Zeit ist knapp. Theologen ebenfalls, aber ihnen wird ein Gespräch über das Leben abseits von Glaubensfragen häufig zu Unrecht nicht zugetraut. Psychotherapeuten zweifellos, aber in den Augen vieler sind sie ausschließlich für psychische Krankheiten und Störungen zuständig, sodass der Gang zu ihnen mit einem Eingeständnis eigener Gestörtheit gleichgesetzt wird.
Der Bedarf nach Gesprächen ist vom ersten Augenblick an groß und ich finde rasch Gefallen daran, da sie ein ums andere Mal sehr spannend sind. Das wird zum ersten Schwerpunkt der philosophischen Seelsorge: Gespräche zu führen, vor allem mit Patienten. Da ich das nie gelernt habe, lege ich mir vorweg Fragen zurecht, die etwas in Gang bringen könnten. Und jedes Mal kommt in kurzer Zeit das Leben eines Menschen mit der ihm eigenen Welt zum Vorschein. Oft bin ich verblüfft über die tiefen Einblicke, die mir gewährt werden. Bei der Visite fällt mir beispielsweise ein beschriebenes Notenblatt neben dem Bett des Patienten auf. Er lässt es gerade verschwinden, als sollte niemand es sehen, aus welchen Gründen auch immer. Eine CD liegt auf dem Nachttischchen, eine Sammlung von Arien, gesungen von Barbara Bonney: Exsultate, jubilate von Wolfgang Amadeus Mozart, Stabat mater von Joseph Haydn. Auch Arien aus der Solokantate 199 von Johann Sebastian Bach: Stumme Seufzer, stille Klagen, Tief gebückt und voller Reue, Wie freudig ist mein Herz. Das macht mich hellhörig: Was für eine Geschichte steckt hinter einer so großen Liebe zur Musik?
Ich frage Herrn Steiner*, ob ich ihn wieder aufsuchen darf, und nach einer Weile weiht er mich in sein Geheimnis ein: Dass seine eigentlichen Interessen der Musik gelten, nicht nur sie zu hören, sondern auch sie selbst zu komponieren. Leider durfte diese Leidenschaft nie zum Ausdruck kommen, die Familie drängte ihn früh dazu, Elektriker zu werden, um schließlich den hundert Jahre alten Familienbetrieb zu übernehmen. Als er vor kurzem geschäftlich angefeindet wurde, brach dann seine ganze Wut über das verfehlte Leben aus ihm heraus, ohne jede Kontrolle, er selbst hätte das nie für möglich gehalten: Eines schönen Tages schlug er, der Inhaber eines Elektrofachgeschäfts, 45 Jahre alt, ein rundum gesunder Mensch, sein Firmenbüro kurz und klein und warf das Mobiliar durch die zersplitternden Fenster auf die Straße. Es fehlte nicht viel und er hätte sogar noch »mit sich selbst Schluss gemacht«. Er hatte Glück, dass er nicht in der Psychiatrie, sondern hier im Spital ankam, wo ein Angebot zur Krisenintervention bereitsteht, 1989 bereits von einem Team engagierter Kunst- und Ausdruckstherapeuten unter Leitung von Annina Hess-Cabalzar geschaffen.
Beim nächsten Gespräch lade ich Herrn Steiner ein, zum Vortrag zu kommen, den ich in der Mittagspause für alle Interessierten im Haus halte, Thema »Vom Umgang mit sich selbst und Anderen«. Als wir uns danach wieder treffen, hat er ein halbes Notizheft mit seinen Gedanken dazu vollgeschrieben. Ob der Vortrag ihm Anregungen gegeben habe, frage ich ihn. »Ja, aber er war auch eine Gefahr für mich«, antwortet er. »Da war vieles zu hören, was ich nicht kannte, und ständig ging mir durch den Kopf, was ich eigentlich noch alles lesen müsste. Lücken in meiner Bildung machen mich unruhig.«
Nur mit Mühe kann ich ihn davon überzeugen, dass es unmöglich und auch nicht erforderlich sei, alles zu wissen, dass es stattdessen wichtiger sein könnte, eine Anregung aufzunehmen und eigene Schlüsse daraus zu ziehen. Was fand er denn besonders interessant? »Dass ein Mensch eine ›innere Gesellschaft‹ ist und deren Zusammenhalt sich nicht von selbst versteht, sondern einer Strukturierung bedarf, die jeder selbst leisten muss. Und dass die Voraussetzung für diese Strukturierung eine Zuwendung zu sich selbst ist, die nicht nur legitim, sondern geradezu geboten ist, da sie dem Leben Sinn gibt und auch die Voraussetzung für die Zuwendung zu Anderen darstellt.«
Herr Steiner hat nur den Selbstverzicht kennengelernt und empfindet es als Befreiung seines Lebens, sich auch um sich selbst kümmern zu dürfen. Parallel zu unseren Gesprächen geht er jeden Tag zu den Kunst- und Ausdruckstherapeuten, die nicht nur die Krisenintervention anbieten, sondern auch als eine Art von Kreativitätspool im Haus fungieren. In ihren Räumen kann er die von ihm geliebte musikalische Seite seines Selbst nach Herzenslust erklingen lassen. Ich setze mich neben ihn und lausche seinen Kompositionen, die er selbst am Klavier spielt. Alles läuft auf die Frage hinaus, wie er diese Seite besser in sein Leben integrieren kann. In den Gesprächen kristallisiert sich endlich die Lösung heraus: Er mietet eine zusätzliche kleine Wohnung und stattet sie zur »Komponistenwohnung« aus, in der er neben der Tätigkeit im Betrieb für ein oder zwei Tage in der Woche seiner eigentlichen Berufung nachgehen kann.
Das ist ein erstes Beispiel für zahlreiche vertiefte Gespräche, die noch folgen sollten. Vielen anderen Menschen, ihrem Leben und Leiden begegne ich nur im Vorbeigehen, meist bei der Visite. Ärzte, Pflegende und Therapeuten kümmern sich mit ihrer alltäglichen Sorge um sie, etwa um die Patientin mit Beschwerden im Brustbereich, die vor Schmerzen weint, aber was für Schmerzen sind das? Die Diagnostik versagt fürs Erste, es sind weitere Abklärungen nötig. Eine andere Frau wird von Weinkrämpfen geschüttelt, dann wieder von Lachanfällen, sie kann nicht anders, macht sich dennoch bittere Vorwürfe und ist dankbar für jede Hilfe, aber wie ist ihr zu helfen? Eine alte Frau blickt apathisch vor sich hin, sie kann nicht mehr bei der Familie ihres Sohnes zuhause bleiben, »es geht nicht mehr«, nun braucht sie einen Pflegeplatz. Ein älterer Mann mit zupackendem Händedruck leidet an unerklärlichen Schwindelgefühlen. Ein Landwirt im Ruhestand, der Herzbeschwerden hat, ergibt sich voller Vertrauen in sein Schicksal in einem Dialekt, von dem ich kein Wort verstehe. Mühelos unterhalten sich die Ärzte auf Englisch mit einem weiteren Mann, der trotz offensichtlicher Gebrechlichkeit nicht daran denkt, sich in sein Schicksal zu fügen, und auf Französisch mit einer Asylbewerberin aus Burundi, die dort vergewaltigt wurde und völlig traumatisiert ist, sie leidet noch dazu an einem Beckenbruch, an Aids und Malaria.
Beim wöchentlichen gemeinsamen Rapport der Ärzte, an dem ich teilnehmen darf, werden Informationen über die Patienten ausgetauscht: Alle sollen einen Überblick haben, keiner in seiner Spezialisierung versinken. Es geht um Menschen, die hier keine »Fälle« sind, sondern beim Namen genannt werden, mit ihren Beschwerden und Krankheiten, persönlichen Geschichten und psychischen Belastungen. Eine Versammlung ganz in Weiß, in einer informellen, lockeren Atmosphäre. In schneller Folge schwirren Fachbegriffe durch die Luft, wie immer, wenn Experten unter sich sind. Soll man mit Antibiotika oder besser konservativ behandeln, soll operiert werden oder nicht? An der Lichtwand hängen die zugehörigen Röntgenbilder. Erfahrungen und Ratschläge flirren hin und her, einer nach dem Anderen muss zwischendurch dringend ans Telefon. Von der Pinnwand grüßen urlaubende Kollegen aus vielen Städten und Ländern der Erde, im Hintergrund treiben Pressluftbohrer unaufhörlich die Erweiterung des Hauses voran. Am Schluss herrscht eine Situation wie auf dem Marktplatz, jeder spricht mit jedem, einige kommunizieren schnell und konzentriert über ein geplantes Vorgehen, die Chefärzte leisten die Unterschriften, die gebraucht werden.
Bruch im Leben: Jede Krankheit kann eine Lebenskrise sein
Das Krankenhaus besteht aus vielen kleinen und größeren Häusern, die sich über einen Hang erstrecken. Die unteren Gebäude sind (damals) eingebettet in eine dichte Bepflanzung mit vielerlei Blumen, Büschen, Efeu, scheinbar wilden Gärten, durch die ein schmaler Pfad führt, seitlich zu Nischen mit Sitzbänken geöffnet, von meterhohem Bambus umstanden. Unten vor dem Altersheim plätschert ein Brunnen, Bewohner sitzen auf der Terrasse, wenn das Wetter es erlaubt. Sie schauen über die Dächer des Städtchens hinweg zu den Bergen im blauen Dunst oder erblicken, wie ich zu erkennen glaube, ein imaginäres Land, das nur diejenigen sehen können, die sich in diesem Alter und in dieser Lebenssituation befinden. Werde ich es auch sehen, ebenfalls von einer schönen Terrasse aus, wenn ich in ferner Zukunft so weit bin? Jetzt aber bin ich erst einmal auf dem Weg zur Arbeit. Was erwartet mich heute?
Abweichend von der strengen Raum- und Zeitordnung, die um der Effizienz der Abläufe willen aufrechterhalten werden muss, kann der Philosoph mit jedem an jedem Ort zu jeder Zeit ins Gespräch kommen. Wichtig ist mir dennoch, einen festen Ort innerhalb des Hauses zu haben, den ich über die Jahre hinweg nicht wechseln muss. Der mir zugewiesene Raum ist eine Art Bibliothekszimmer ohne große Bibliothek, von nun an Philosophenzimmer genannt, mit vorgelagerter Terrasse und einem Blick in die Berge, im Vordergrund Rigi und Pilatus, im Hintergrund die schneebedeckten Zentralschweizer Alpen. Hier arbeite ich und führe Gespräche, soweit diese nicht quer durchs ganze Haus stattfinden. Auf der weitläufigen Terrasse kann ich zwischendurch im Gehen Gedanken erproben oder sie zerstreuen. Dafür, dass es nicht zu idyllisch wird, sorgt die rastlose Moderne: Die Wiese gegenüber, auf der anfänglich noch Schafe weideten, wird im Laufe der Jahre Stück für Stück zugebaut. Dann wird mein Zimmer renoviert und ist plötzlich so kalt und aseptisch, ohne jede Patina, dass mit ein paar Bildern, einer Sitzgruppe, einer eigenwilligen Lampe wieder die Atmosphäre herbeigezaubert werden muss, in der Menschen gerne zum Gespräch verweilen.
Herr Wintermann* kommt aus Neugierde zu mir. Mit einem Philosophen zu reden, stellt er sich spannend vor, und während wir die Pflaumen essen, die mir jemand mitgebracht hat, erzählt er, ein Gymnasiallehrer und promovierter Germanist, 37 Jahre alt, von Schmerzen im Bauch, die ihn aus heiterem Himmel während einer Zugfahrt überfallen haben. Er musste sich übergeben, vom Bahnhof aus konnte er gerade noch seine Frau anrufen, die ihn zum Hausarzt chauffierte. Der wusste keinen Rat und wies ihn ins Krankenhaus ein, wo der Durchbruch einer Entzündung im Dickdarm festgestellt wurde. Eine lebensgefährliche Situation, die früher nur bei älteren Menschen vorkam und mittlerweile immer jüngere betrifft, eine so genannte Zivilisationskrankheit: Die Darmwände werden schlaff, wenn zu wenig natürliche Kost gegessen wird – woran es bei diesem Patienten aber gar nicht fehlte. Die Behandlung der Entzündung mit Antibiotika schlägt unmittelbar an, der behandelnde Arzt warnt jedoch davor, dass da »noch etwas nachkommen kann«. Tatsächlich stellen sich binnen kurzer Zeit entsetzliche Schmerzen ein, Darmverschluss, rasch wird operiert und ein vorübergehender künstlicher Darmausgang geschaffen, damit die Erkrankung in Ruhe ausheilen kann.
Magen- und Darm-Geschichten, sagen die Ärzte, hätten oft mit psychosomatischen Verwicklungen, mit Wechselwirkungen von Psyche und Soma, Seele und Körper zu tun. »Was war los in Ihrem Leben?«, frage ich den Patienten.
Die Antwort kommt prompt: »Ich war derjenige, der sich schnell über etwas aufregte.« Dazu habe es viel Anlass gegeben, denn er habe hohe Ansprüche gestellt, vor allem an sich selbst. Von den Verhältnissen um sich herum habe er Perfektion erwartet, vornehmlich in Fragen der Gerechtigkeit, jede leise Ungerechtigkeit habe ihn in Rage gebracht, »und weil ich das nicht ständig zum Ausdruck bringen konnte, habe ich viel Ärger heruntergeschluckt«. Er überlegt einen Moment. Er sei sehr streng erzogen worden, »handfest«, daher rührten wohl auch die Perfektionsansprüche. Sie seien ihm eingebläut worden und es entsetze ihn jetzt, dass er diesen Willen zur Perfektion bei seinem kleinen Sohn wiederfinde, der den Vater nicht im Krankenhaus besuchen wolle, weil vermutlich sein Bild eines perfekten Vaters darunter leiden würde.
Ich bin nur der, der zuhört, mein Gegenüber kommt selbst auf die Idee, dass er einiges in seinem Leben ändern könnte. Der lächelnde, höchst reflektierte Germanist will die Krankheit und die Erfahrung der Schmerzen zum Anlass nehmen, ein anderes Leben zu führen, Resultat eines langen, einsamen Nachdenkens ohne Einsamkeitsgefühl, wie er sagt: »Seit ich aus der Narkose und dem darauf folgenden Dämmerzustand erwacht bin, geht mir sehr viel durch den Kopf. Ich will mein Leben mehr erfüllen, weniger mit Perfektion, mehr mit Muße, an der es mir fehlte, da ich immer an meiner Perfektionierung zu arbeiten hatte.«
Ich ermuntere ihn, seine hohen Ansprüche an Gerechtigkeit zu überdenken, ohne aber ins Gegenteil zu verfallen, also nun keinerlei Ansprüche mehr aufrechtzuerhalten und Gerechtigkeit für völlig unmöglich zu halten. Vorstellungen davon seien wichtig für das Zusammenleben in der Gesellschaft wie in der Familie. Das Kunststück sei, sie in einem Maß zu halten, das für einen selbst wie auch für Andere realisierbar sei. Es gebe ohnehin nicht den einen, einzigen Begriff von Gerechtigkeit, anhand dessen die Realität präzise zu beurteilen wäre. Und selbst dann, wenn Gerechtigkeit zur Perfektion getrieben werden könnte, würde sie womöglich wieder in Ungerechtigkeit umschlagen, da ihre Vervollkommnung Maßnahmen erfordern würde, die ungerechte Konsequenzen haben könnten.
Herr Wintermann stimmt zu. Aber noch etwas Anderes will er in sein neues Leben mitnehmen: Den Gedanken an den Tod, dem er bisher keinen Raum zugestanden hat. Er hält es selbst für kurios, sich so verhalten zu haben, denn immerhin sei dies die einzige Gewissheit: Dass dem Leben, wie lange es im Einzelfall auch dauern möge, eine Grenze gesetzt sei. Für jeden sei das so, aber kaum jemand wolle im Alltag daran denken. »Als ich darniederlag, überkam mich der Gedanke: Was wäre, wenn …? Mir wäre sehr viel Leben mit meiner Frau entgangen, auch mit meinen beiden kleinen Kindern, die ich nicht hätte heranwachsen sehen können. Eine unglaubliche Angst hat sich in mir breitgemacht, das nicht mehr zu erleben, denn tot zu sein heißt für mich nicht etwa, von anderswoher zuschauen zu können.« Was auch immer nun geschehe, er sei entschlossen, dem Gedanken an den Tod einen festen Platz in seinem Leben zu geben. Auch seine Vorstellung vom Sterben sei jetzt eine andere, denn zunächst habe er wie viele Andere auch gemeint, es solle, wenn es schon sein müsse, schnell gehen, jetzt aber würde er sich lieber schrittweise herantasten.
Er ist erstaunlich, welche Perspektivenwechsel Menschen vollziehen können, wenn ihnen das Leben Anlass dazu gibt. Eine Krankheit wirft Fragen auf, wächst sich zur Lebenskrise aus und stellt womöglich das Leben selbst in Frage. Ist die Beunruhigung groß genug, wird die Besinnung unumgänglich: Was war mein Leben, was ist es, was kann es noch sein? Wie kann ich mit dem Bruch im Leben umgehen, wie mit dem Schmerz, der mich dominiert und das Denken unterminiert? Das bisher gelebte Leben zerbricht und nun kommt es darauf an, die Bruchstücke wieder zusammenzufügen, eventuell auf radikal veränderte Weise, damit das Ich sich neu finden kann und das Leben Sinn gewinnt. Auch bei dieser Aufgabe kann ich behilflich sein, aber nicht indem ich sage, wie das Leben fortan zu leben sei, denn das weiß ich mit knapper Not für mich selbst, keinesfalls für Andere. Meine Art der Sorge für Andere sind vielmehr die Gespräche mit ihnen, bei denen sie selbst auf die Gedanken kommen, die anregend und überzeugend genug für sie sind, um ihr Leben daran zu orientieren. Die Neuorientierung im Denken stärkt das jeweilige Selbst und ermöglicht einen Neuanfang im Leben, vorausgesetzt, die Situation wird nicht nur als lästige Störung abgetan und überspielt.
Der erste Versuch, für mich selbst zu beschreiben, was da geschieht, führt mich zum Begriff einer Hermeneutik der Existenz (von griechisch hermeneuein, deuten). Die Gespräche bringen eine Deutung und Interpretation des Lebens in Gang, die dazu verhilft, das Leben besser zu verstehen und in diesem Moment, in dem ein Mensch nicht weiterweiß, einen gangbaren Weg auszumachen. Die Gelegenheit ist günstig für ein Innehalten, denn die Krise zwingt dazu, das Leben zu überdenken, im stillen Selbstgespräch oder im Gespräch mit Anderen, um in der unklaren Situation mehr Klarheit über Gegebenheiten und Möglichkeiten und das eigene Vorgehen zu gewinnen. Oft gilt die Deutung und Interpretation dabei »dem Sinn«, dem Sinn der Krise, der Krankheit, des Lebens, immer wieder wird in den Gesprächen danach gefragt.
Wer ist eigentlich für die Beantwortung dieser Frage zuständig? Im gesamten Gesundheitswesen gibt es Spezialisten für alles, aber wo sind die Spezialisten für die Frage nach dem Sinn? Theologen und Therapeuten stehen für Gespräche darüber bereit, aber was ist mit den Philosophen, die von alters her mit dieser Frage befasst sind? Niemand verfügt über endgültige Antworten darauf, aber in der akademischen Philosophieausbildung, wie ich sie selbst absolvierte, wurde bereits die Frage als esoterisch abgetan, abgeschoben in die Ecke eines Spezialgebiets namens Hermeneutik, in dem man sich meist damit begnügte, Texte auf die in ihnen enthaltene Wahrheit hin zu deuten.
Hier aber hat die Hermeneutik mit der Existenz zu tun und bei den Deutungen geht es darum, diejenigen Zusammenhänge zu sehen und herzustellen, die einer Situation oder dem gesamten Leben Sinn geben können. Vermutung: Die Zusammenhänge sind dieser Sinn. Wo keine Zusammenhänge zu sehen und herzustellen sind, entsteht demzufolge ein Eindruck von Sinnlosigkeit. Mit Deutungen lassen sich, wie bei Herrn Steiner und Herrn Wintermann, neue Zusammenhänge zwischen Erfahrungen und Vorstellungen im eigenen Selbst, darüber hinaus zwischen Selbst und Anderen, Selbst und Welt knüpfen. Nicht auszuschließen ist, dass dabei, wie bei der Deutung von Texten, von einem hermeneutischen Zirkel die Rede sein kann: Demnach wird ein Sinn zumindest teilweise in die Dinge und Ereignisse hineingelegt, um aus ihnen herausgelesen werden zu können. Die hermeneutischen Kriterien für Sinn sind umstritten, in der Lebenssituation aber dürfte die Schlüssigkeit, die Plausibilität in den Augen des Menschen, der dieses Leben lebt, entscheidend sein. Gedachte und wirkliche Zusammenhänge müssen nicht deckungsgleich sein, wichtiger ist, die Zusammenhänge zu finden, auch zu erfinden, die so tragfähig sind, dass es sich in ihrem Geflecht leben lässt und aus ihnen neue Kräfte zu schöpfen sind. Gut möglich, dass die entsprechende Selbstbesinnung des Menschen wie auch die Besinnung im Gespräch den Prozess der Heilung beeinflussen.
Mit dem gefundenen Sinn geht eine Wahrheit einher – ist das Leben von Sinn erfüllt, erkennt ein Mensch es als »wahres Leben«. Es kann sich dabei aber nicht um eine objektive Wahrheit handeln, für die es an zweifelsfreien Maßstäben fehlt, nur um eine subjektive Wahrheit, die länger Bestand hat, wenn sie besser begründet ist. In Frage steht eine Lebenswahrheit, eine Sichtweise und eine Lebensauffassung, die die Einordnung einer Situation, eines Problems, einer Krankheit ermöglicht, sodass das Leben weitergehen kann, mit allen Schwierigkeiten, Ungereimtheiten und Widersprüchen. Die Wahrheitsfrage ist somit eine doppelte: Was ist wahr im Sinne des wirklichen Geschehens, das zu dieser Situation geführt hat, und was ist wahr im Sinne des richtigen Verhaltens, das in dieser Situation sinnvoll erscheint? Die Lebenswahrheit ließe sich ohne aufwändige Besinnung zügiger gewinnen, aber fundierter und haltbarer ist die kritische Prüfung ihrer Plausibilität durch das Selbst und Andere, etwa durch den philosophischen Gesprächspartner, der weitere Aspekte und Argumente beisteuern kann.
Von Herrn Steiner höre ich nichts mehr, hoffentlich ein Indiz dafür, dass es ihm gelungen ist, sein Leben umzustellen. Herr Wintermann berichtet nach einem Jahr davon, dass er sein Leben wirklich neu orientiert habe, mehr Zeit mit seiner Familie verbringe und Kollegen ihm erfreut attestierten, weit umgänglicher als früher zu sein. Für viele Menschen beginnt ein solcher Prozess mit einer Lebenskrise, ausgelöst womöglich durch eine Krankheit.
Aber nicht jede Lebenskrise geht mit einer Krankheit einher
Anfangen, das ist jedes Mal von Neuem eine Herausforderung bei den Gesprächen. »Wie ist es dazu gekommen, dass Sie nun hier sitzen?« Es ist diese naheliegende Frage, mit der ich die besten Erfahrungen mache, da sie den meisten Menschen ermöglicht, von sich zu erzählen. Viele Gespräche gewinnen dann rasch eine Tiefe, in der verborgene Dinge und Verhältnisse sichtbar werden, von denen sich an der Oberfläche gar nichts abzeichnete. Als hätten die Menschen nur auf diesen Moment gewartet, um sich endlich zu öffnen und mit einem interessierten Anderen über ihr Leben nachzudenken.
Frau Augst* beispielsweise führte ein aus ihrer Sicht vollkommen erfülltes Leben als Chefsekretärin. Jetzt aber, da sie pensioniert ist, klagt sie über eine Sinnlosigkeit, auf die sie ihre »Wehwehchen« zurückführt. Sie fühle sich verloren, zähle sich nicht mehr zu den normalen Leuten, verstehe in dieser Welt von heute die Menschen nicht mehr. Die seien nicht mehr von Werten und Prinzipien geleitet. Das Leben laufe an ihr vorbei, sie sei nur noch Zuschauerin. Für junge Menschen sei sie, 70 Jahre alt, ein »Grufti«, ein »Komposti«, jedenfalls nimmt sie das so wahr und findet es schlimm.
Zu allem Überfluss muss sie seit längerem schon ohne ihr Hobby zurechtkommen. Was ist ihr Hobby? Sie spricht vom »Hobby Mann«, ohne das sie nicht leben könne, ihr Gatte sei viel zu früh gestorben und ihr Alter mache es schwer, wenn nicht unmöglich, einem anderen Mann zu begegnen, der wieder zum Hobby werden könnte. Es fehle ihr an Berührung, die doch zur Gesundheit gehöre, es fehle der Sex, es fehle das gelegentliche Kompliment, das Gespräch mit einem Menschen, der mitfühle, sonst sei alles sinnlos. Ihr bedeute Romantik alles, aber mit wem könne sie das leben? Ihre Erziehung sei total weltfremd gewesen, »bloß nichts Negatives«, und das wirke das ganze Leben hindurch nach.
Ich versuche, ihren Blick zu erweitern: »In Ihrer Person trifft zusammen, was die moderne Kultur an Problemen aufwirft: Der Sinn löst sich auf, und damit die Menschen nicht darüber verzweifeln, soll immer alles positiv sein, auch ein Älterwerden soll es nicht geben.« Die Fixierung auf das Positive könne tragischerweise Ängste vor dem Negativen verursachen, das in jedem Leben in irgendeiner Form vorkomme und nie gänzlich verbannt werden könne. »Aber lassen Sie uns überlegen: Wie könnten Sie, sollte Ihr Hobby als Sinngebung weiterhin ausfallen, neuen Sinn im Leben finden? Etwa durch ein ehrenamtliches Engagement?«
»Das ist nicht meine Sache«, wehrt sie ab.
»Durch Weiterbildung an einer Senioren-Universität, schon damit Sie die absolute Isolation, über die Sie klagen, durchbrechen können?«
Auch hier spricht etwas dagegen: »Zu beschwerlich. Gespräche mit Anderen sind manchmal ganz nett, aber die haben immer null Ahnung.«
»Wovon sollten sie denn Ahnung haben?«
»Etwa von der Geschichte.« Frau Augst fängt an, aus ihrem Leben zu erzählen: »Ich wuchs in Deutschland auf und Hitler war für mich ein Gott. Nach dem Krieg wurde ich als angebliche Spionin monatelang in eine Zelle gesperrt und immer abends um zehn zu Verhören abgeholt, bevor ich nach Russland verschleppt wurde. Ich war jung und kräftig und wurde in einem Viehwaggon in ein Lager am Eismeer transportiert, wo ich Baumstämme abladen und Eisenbahnschienen verlegen musste, Sommer wie Winter, in einem Lager voller Frauen. Die Männer mussten in Kohlegruben arbeiten. Für eine Schachtel Zigaretten gingen die Frauen mit jedem Russen mit, die Kinder wurden ihnen weggenommen. Nach dem Tod Stalins 1953 und nach dem Besuch Adenauers in Moskau 1955 durften die Ersten heimkehren, auch ich.«
»Das alles hat Sie hart gemacht?«
»Hinter der harten Fassade steht eine Person, die fast nicht lebensfähig ist.«
Frau Augst, die so viel durchlebte, hat panische Angst vor dem Leben, wie sie mir in einer längeren Pause zwischen den Gesprächen auch per Brief anvertraut: »Man steht ja völlig hilflos da und ist dem Schicksal restlos ausgeliefert, ohne jeglichen Schutz, ohne irgendeine Unterstützung eines vertrauten bzw. vertrauenswürdigen näherstehenden Menschen. Ist es unter diesen grausamen Umständen nicht verständlich, wenn man oft an Selbstmord denkt, obwohl man eigentlich noch so gerne leben und etwas Schönes erleben möchte«
Was ich für sie tun kann, ist dennoch nur, im Laufe der jeweiligen Philosophiewochen mit ihr ein, wie sie es nennt, »so richtig tiefschürfendes Gespräch« zu führen. Von ärztlicher Seite sind die Symptome, die ihr zu schaffen machen, nicht erklärbar, etwa ein Juckreiz, der nicht von Hautproblemen herrühren kann. Frau Augst sagt: »Kein Arzt kann mir helfen.« Aber ist es denkbar, dass sie sich unbewusst ein gewohntes, alltägliches Leben mit ihren Symptomen eingerichtet hat, deren Funktion es ist, Phantome zu sein, Phantasiegestalten, zu denen sie Beziehungen unterhält und die sie wie ein Hobby pflegt? Da sie nach eigener Aussage am Fehlen jeglichen sozialen Umfelds leidet, könnte ihr am ehesten die Aufnahme und Pflege von Beziehungen helfen, aber solche unterhält sie bereits zu den Phantom-Symptomen, die in ihrem Selbst mögliche Andockstellen für Andere blockieren. Ist es sogar der Sinn dieses Verhaltens, keine Beziehungen zu realen Anderen mehr eingehen zu müssen, die im selben Moment existenziell vermisst werden? Ist das »Hobby Mann« nur ein Ideal, das als solches bewahrt werden muss, da jede Realität enttäuschend ausfallen würde?
Sie will nicht darüber nachdenken, sie will nur über ihre Erfahrungen und Empfindungen sprechen, die Fragen bleiben offen. Veränderungen oder Entwicklungen sind in all den Jahren nicht erkennbar, sie scheut davor zurück, lieber leidet sie still weiter. Ich sage ihr, dass ich das verstehen kann, denn Veränderungen seien nun mal energetisch aufwändig, kraftsparender sei das Verweilen im Vertrauten, Gewohnten, auch wenn es schmerzlich ist. Nicht jeder Mensch verfügt nach Belieben über die Energien, die als Mut, Willensstärke, Entschlossenheit zum Vorschein kommen. Wenn kein Gespräch, kein Beispiel Anderer, keine Einsicht in den Sinn von Veränderung etwas in Gang bringen kann, bleibt mir lediglich übrig, die Situation zu akzeptieren und mir jeden noch so leisen Vorwurf wegen Willensschwäche zu versagen.
Das Leben nicht ändern zu können, zugleich aber ideale Vorstellungen vom Leben zu hegen, die im realen Leben nur scheitern können: Das scheint ein Grundmuster im Leben vieler Menschen zu sein. Beispielhaft kommt dies in einem weiteren Gespräch zum Ausdruck, das ich routiniert beginne, da ich nun schon einige Erfahrungen gesammelt habe. Aber jetzt ist alles wieder ganz anders: »Welchen Plan haben Sie?«, fragt die 36-jährige Frau trocken. Sie hat alle Formen von Analyse und Therapie bereits durchlaufen und will es sich soeben bequem machen, neugierig, mit welchem Muster man ihr dieses Mal beizukommen gedenkt. Sich selbst hat sie die Rolle der amüsierten Beobachterin zugedacht, »therapieresistent«, wie sie sich charakterisiert, an der sich eben alle die Zähne ausbeißen, da ihr nicht zu helfen sei: Auch so kann eine Identität aussehen. Ich wolle sie gar nicht therapieren, sage ich. Was dann? Es wird ein packendes Gespräch über die Abgründe menschlicher Existenz.
Ins Krankenhaus kam Frau Bebel* zwei Jahre zuvor mit Magen- und Darmkrämpfen: Ihre Ernährung war unzureichend, Medikamente nahm sie im Übermaß. Und jetzt? Ein Anfall von Selbstzerstörung, Schrammen ziehen sich quer über Wangen und Hals. Sie weiß selbst nicht, wie es dazu kam, es sei einfach Verzweiflung gewesen, eine Depression, nirgendwo sei ein Sinn, nichts und niemand halte sie, es gebe keine einzige verlässliche Beziehung.
»Ja, das ist so in der Zeit, in der wir leben«, konstatiere ich.
»Das ist keine Zeit wirklicher Freiheit«, klagt sie, und als ich sie frage, was denn ihre Auffassung von Freiheit sei, gibt sie mir umgehend zur Antwort: »Freiheit heißt, frei zu sein von Einengung, aber dann darf ich in einer Beziehung wieder nicht ich selbst sein, soll mich einschränken und rechtfertigen, und alles zerbricht.«
Ich versuche ihr nahezubringen, dass engere Beziehungen nun mal mit Einbußen an Freiheit einhergehen: »Ich kann in einer Beziehung nicht jederzeit restlos tun und lassen, was ich will. Je stärker jeder auf seinem Ich beharrt, desto schwieriger wird das Beziehungsleben, das trifft vor allem sensiblere Menschen, die keine dicke Haut haben. Ansonsten bleibt nur der Verzicht auf Beziehung, eine Konsequenz moderner Freiheitsansprüche. Moderne kann sehr einsam machen. Aber vielleicht lassen sich Mittel und Wege finden, Freiheit und Beziehung besser miteinander zu vereinbaren, etwa in einer Freundschaft.«
»Ja«, meint Frau Bebel, »aber das ändert doch nichts an der Gesellschaft, die nicht frei ist.«
»Jede gesellschaftliche Veränderung setzt mit der Veränderung einzelner Menschen ein«, entgegne ich. »Das Problem der Zeit kann anstelle mangelnder Freiheit aber ein Mangel an Formen sein, wie die Freiheit gelebt werden kann. Solche Formen können am ehesten sensible Menschen erkunden. Könnte es nicht der Sinn der übergroßen Sensibilität eines Menschen sein, dass damit die ganze Gesellschaft an Sensibilität gewinnt, jedenfalls solange dieser Mensch sich mit der Art und Weise seines Lebens um eine Antwort auf offene Fragen bemüht? Könnte das nicht Ihrem Leben den Sinn geben, den Sie für sich ersehnen?«
Der Gedanke, dass sie trotz allem Teil eines größeren Ganzen sein könnte und ihr Leben in diesem Zusammenhang keineswegs sinnlos wäre, spricht Frau Bebel sehr an. Das könnte nun allerdings erneut ein Teil ihres Problems sein: Aus abgrundtiefer Niedergeschlagenheit springt sie direkt in eine übergroße Begeisterung. Ist das nicht die Symptomatik einer so genannten bipolaren Störung oder manisch-depressiven Erkrankung? Aber sie will von solchen Begriffen nichts wissen, sie will über das Leben sprechen. Immer wieder fragt sie geradezu vorwurfsvoll: »Das soll das Leben sein?«
»Gehen wir der Frage nach: Was ist das Leben? Ist es nicht wie ein Frosch? Der taucht auf, taucht ab, quakt vorlaut, hüpft herum, entgleitet dem, der ihn zu fassen versucht, verwandelt sich in Prinz und Prinzessin und ist dann doch wieder nur ein Frosch«, sage ich. »Das Leben ist merkwürdig, rätselhaft, widersprüchlich, faszinierend, langweilig, unerklärlich, paradox, unvorhersehbar. In moderner Zeit stellen Menschen Ansprüche und richten Erwartungen an das Leben, die kaum noch zu steigern sind: Immer intensiv, spektakulär, strahlend, kaum je langweilig, niemals alltäglich soll es sein. Keine Widerstände sollen den Menschen an seiner freien Entfaltung hindern, stets sollen ihm alle Möglichkeiten offenstehen, Hindernisse sollen ihm nur aus sportlichen Gründen kurzfristig den Weg versperren, nie soll es irgendwelche Verpflichtungen geben, materielle Schwierigkeiten sowie Krankheiten und Behinderungen aller Art sollen endgültig überwunden werden: So soll das Leben sein! Aber wie realistisch ist das?«
Wir sprechen über die Gegensätze, die jede und jeder im eigenen Leben beobachten kann und denen niemand entkommt: Dass das Leben keine dauerhafte Gesundheit garantieren kann, immer auch Krankheit möglich ist, dass nicht nur Lüste, sondern auch Schmerzen erfahrbar sind, nicht nur (hoffentlich) viel Freude, sondern auch Ärger, nicht nur Jugend, sondern auch Älterwerden, nicht nur Wohlwollen, sondern auch Missgunst, nicht nur Freundschaft, sondern auch Feindschaft, nicht nur Erfolg, sondern auch Misserfolg, nicht nur Gelingen, sondern auch Misslingen, nicht nur Oberflächlichkeit, sondern auch Abgründigkeit.
»Das ist offenkundig die Polarität des Lebens«, meine ich. Diese Grundstruktur habe sich ganz sicher nicht erst in der Moderne entwickelt, aber die Moderne sei die Zeit, in der viele Menschen glaubten, die positiven Seiten des Lebens allein behalten und die negativen abschaffen zu können. Es gebe keinen Grund, sich vormoderne Zeiten zurückzuwünschen, aber allen Grund, moderne Erwartungen an das Leben zu mäßigen, um nicht immerzu maßlos von ihm enttäuscht zu sein. So könnte es leichter werden, schwere Zeiten durchzustehen und das Negative, das ebenfalls Leben ist, zu akzeptieren, wie es zu anderen Zeiten üblich war und in traditionsbewussten Kulturen nach wie vor ist.
»Und warum sollen die negativen Seiten so unverzichtbar sein?« fragt sie zweifelnd.
»Gründe der Spannung könnten dafür verantwortlich sein«, versuche ich eine Erklärung. »Nur zwischen gegensätzlichen Polen kann Spannung entstehen. Wäre das Leben noch spannend, wenn immer alles positiv wäre? Aber Vorsicht: Von jedem Pol aus ist die perspektivische Täuschung möglich, dass es so negativ, so positiv für immer bleiben wird. Und doch ist das nie der Fall, immer bleibt es beim Hin und Her zwischen den Gegensätzen des Lebens. Wie wäre es, das Leben in dieser Spannweite atmen zu lassen? Und Tag für Tag in seinem Rhythmus mitzuatmen, also zwischen erfreulichen und ärgerlichen, hoffnungsvollen und enttäuschenden Seiten hin- und herzupendeln und zumindest in Gedanken damit einverstanden zu sein, dass mal der negative, dann wieder der positive Pol überwiegt?«
Mit dem Leben zu atmen, dieses organische Bild leuchtet Frau Bebel ein, sie will es sich zu eigen machen. Die Frage ist nur, wie lange das vorhält. Ich begegne ihr im Rahmen der Philosophiewochen über die Jahre hinweg immer wieder, sie hat anhaltend mit dem Auf und Ab ihrer Stimmungen zu kämpfen. Aber ihr Gefühl, das Leben nun besser zu verstehen, hilft ihr, sich weniger als zuvor beim vergeblichen Versuch, die Gegensätze aus ihrem Leben auszuschließen, selbst zu verlieren.
Wie umgehen mit sich selbst? Die Kunst des Neuanfangs
Idealvorstellungen vom Leben färben auf das Selbstbild ab, das makellos sein soll, und wenn schon nicht das Selbst, so doch wenigstens dessen Bild. Bis es zersplittert. Eine freundliche, nachsichtige Beziehung zum eigenen Selbst begegnet mir nicht bei vielen Menschen, eher eine funktionale, fordernde, gar feindselige. Ich sitze Herrn Stramm* gegenüber, der notfallmäßig ins Krankenhaus kam, mitten aus seiner Berufstätigkeit heraus. Auch er scheint ein Opfer der Moderne zu sein, aber ein ganz anderes: Er ist Broker, Wertpapierhändler, der sekündlich zwischen Käufern und Verkäufern vermittelt, sehr stressig.
Die Arbeit sei sinnlos gewesen, meint er, aber er habe seine Familie gut davon ernähren können. Jetzt erst im Alter von 43 Jahren überkam ihn eine große Lebensmüdigkeit und Leere, plötzlich stand er vor der Frage: »Funktioniere ich nur oder lebe ich?« Ihm sei, sagt er, »das Leben immer leicht von der Hand gegangen bis jetzt«. Nun aber finde er keine Balance mehr, er fühle sich den Anforderungen des bloßen Funktionierens restlos ausgeliefert, die Welt um ihn herum renne immer schneller und er müsse mitrennen, immer schneller. Nun kann er nicht mehr, Burnout.
Zu diesem Zeitpunkt ist nicht klar, dass er ein Vorbote der schwelenden und 2008 ausbrechenden weltweiten Finanzkrise ist. Aber aus seinen Erzählungen wird damals schon deutlich, dass sich da etwas anbahnt, das nicht gutgehen kann, auch weil es mörderisch für die Beteiligten selbst ist, die sich als Getriebene fühlen, getrieben von einem Prozess, den sie selbst antreiben, bis sie ausbrennen. Die große Frage für Herrn Stramm ist: »Kann der Einzelne abbremsen?« Ich frage ihn, ob er trotz allem irgendwo Sinn für sich sehen konnte. Ja, sagt er, in der Familie, in seinen Kindern, aber ihm sei die Zeit abhandengekommen, dieser Einsicht entsprechend zu leben. Die Liebe musste in den Hintergrund treten, Freunde waren wichtig, aber mit denen konnte er nie so offen sprechen wie jetzt hier. Auch die Sinnlichkeit musste in jeder Hinsicht leiden, er konnte nichts mehr genießen, egal, was es war, so sehr war er »beschäftigt mit Aktivitäten«.
Er ist froh über das Gespräch, in dem er seine Situation schildern und darüber nachdenken kann: Wie lässt sich ein neuer Anfang machen? Wir sprechen über den Neuanfang als eine Errungenschaft, aber auch als eine Norm der modernen Zeit. Nachdem es über Jahrhunderte hinweg geboten war, Dinge und Situationen hinzunehmen, im Zweifelsfall bis zum tragischen Ende, ist es mit der modernen Idee der Veränderbarkeit von allem und jedem möglich, neu zu beginnen, wenn Altes sich nicht bewährt hat oder nicht mehr lebbar ist. Das ist erst einmal ein Gewinn: Der moderne Mensch ist nicht mehr lebenslang auf eine Wirklichkeit festgelegt, sondern kann Möglichkeiten erschließen oder sie geboten bekommen, um damit andere Wirklichkeiten zu begründen. Die Bedingungen dafür, insbesondere die materiellen und sozialen Verhältnisse, die Neuanfänge erlauben, sind erst in der Moderne geschaffen worden. Ein Neuanfang kann freiwillig angestrebt werden, um etwas Anderes als bisher zu machen, eine Chance wahrzunehmen oder vor Problemen zu fliehen, in der Lebensmitte auch auf die Angst vor dem Verlust von Lebensmöglichkeiten zu reagieren. Häufig ist der Neuanfang jedoch ein unfreiwilliger, wenn eine Krise, eine Krankheit, eine Entlassung oder ein Verlassenwerden dazu zwingen. Das bisherige Leben, das Menschen gerne beibehalten würden, weil sie am Vertrauten und Gewohnten hängen, kann nicht mehr weitergelebt werden.
Schwierig ist das Leben auf der Schwelle. Das Alte geht zu Ende, das Neue hat noch nicht begonnen, das Leben »hängt in der Luft«. Übergänge sind das große Problem des Lebens, aus diesem Grund gestalten und erleichtern Konventionen, Traditionen und Religionen sie durch Rituale: Übergang vom Nichtleben zum Leben, von einem Lebensalter zum anderen, vom freien Leben allein zum Leben in Beziehung, vom Leben ohne Kinder zum Dasein für sie, später dasselbe rückwärts, zuletzt vom Leben zum Tod. Schon die vermeintlich problemlosen Übergänge vom Wachen zum Schlafen, von der Nacht in den Tag, von der Freizeit zur Arbeit und umgekehrt haben es in sich. An all diesen Nahtstellen ist nach der Befreiung von alten Formen eine Leere entstanden, die modern und säkular kaum ausgefüllt werden kann. Ist es möglich, dass so manche Krankheit in dieses Vakuum einströmt? Jedenfalls leitet sie in vielen Fällen einen Übergang ein: Sie erzwingt den Abschied vom bisherigen Leben und wirft die Frage auf, was aus dem Leben nun werden soll. Als Übergang von einer Lebensphase zur anderen ist die Krankheit eine Metapher im Wortsinne (von griechisch metapherein, anderswohin tragen), sie trägt hinüber von hier nach dort.
Was heißt das für Herrn Stramm? Wohin wird er getragen? Bevor er sich eventuell erneut auf das Funktionieren in einem sinnlosen Job einlässt, könnte es ihn unterstützen, meine ich, mehr Sinn aus der Beziehung zu sich zu gewinnen und sich erst einmal um sich selbst zu sorgen. Meine Ethik der Sorge besteht in diesem Fall darin, ihn bei der Sorge für sich zu unterstützen. Er stimmt sofort zu, aber wie soll das gehen? Einige Schritte auf dem Weg dazu, die ich in den bisherigen Gesprächen ausfindig machen konnte, kann ich ihm nennen. Ein erster Schritt ist eine größere Selbstaufmerksamkeit, geleitet von Fragen wie: Welche Vorlieben, welche Abneigungen sind mir eigen? Welche Hoffnungen hege ich, welche Befürchtungen? Wo bin ich mutig, wo ängstlich? Was kann ich gut, was nicht? Welche Gewohnheiten pflege ich, wovon träume ich? Was finde ich schön, was hässlich? Was waren meine größten Erfolge und Misserfolge? Was bedeuten mir finanzielle, was andere Werte? Was ist mir Freiheit wert, was die Verbundenheit mit Menschen, denen ich vertrauen kann?
Sich auf diese Weise besser kennenzulernen, ermöglicht den nächsten Schritt, einige Eckpunkte für das eigene Selbst zu definieren, also Festlegungen zu treffen, die ihm mehr Widerständigkeit gegen die Vereinnahmung durch Andere oder eine fordernde Arbeit erlauben, die beste Burnout-Prophylaxe. Dazu ist es zuallererst nötig, sich mit sich über die wichtigsten Beziehungen im eigenen Leben zu verständigen: Welche Beziehungen der Liebe und der Freundschaft sind Herrn Stramm so wichtig, dass er sich über sie definieren will? Niemand außer ihm kann das wissen, nur er selbst kann den für ihn wertvollsten Menschen die gebührende Aufmerksamkeit zukommen lassen, um sich im Gegenzug ihrer Zuwendung zu erfreuen. Und was sind die wichtigsten Erfahrungen in seinem Leben, die er als feste Elemente seines Selbst betrachten will? Mit der Erinnerung an sie kann er sich, sollte er sich verlieren, immer wiederfinden. Was ist ferner sein Traum, dem er im Leben folgen will, sein Weg und vielleicht sein Ziel, seine Sehnsucht, sein Wohin, Wofür, Wozu? Mit Zielen und Zwecken, die er vor Augen hat, kann er dem Leben sehr viel Sinn geben. Und was sind seine Werte, die er hochhalten will, um deren Realisierung er sich aber auch selbst bemühen muss? Welcher dieser Werte soll Vorrang haben, wenn eine Entscheidung ansteht, beispielsweise zwischen Freiheit und Bindung, Risiko und Sicherheit, Geiz und Großzügigkeit?
Welche Gewohnheiten will er sorgsam pflegen, in denen er sich wohnlich einrichten kann und die ihm stets eine Rückzugsmöglichkeit bieten? Natürlich ist es wichtig, offen für Neues zu sein, aber Gewohnheiten erleichtern das Leben, da sie im Unterschied zu Neuem keinen Kraftaufwand erfordern: Nichts muss neu überlegt und organisiert werden, alles läuft wie von selbst ab. Und welche Ängste, welche Verletzungen, welche Traumata hat Herr Stramm erfahren, gegen die er nicht ankommt, die er aber in sein Selbst integrieren kann, statt sich endlos daran abzuarbeiten? Eine unverzichtbare Ressource ist dabei das Schöne, an dem er sich orientieren kann: Wo findet er es? Was sind für ihn schöne Momente, Anblicke, Tätigkeiten, Lüste, Gespräche, Gedanken, die er bejaht? Bewusst wahrgenommen, werden sie zu einer Quelle von Kraft, mit der sich auch große Schwierigkeiten überwinden lassen.
Aus Herrn Stramms Antworten auf diese Fragen entsteht eine Geschichte seiner selbst, die er in diesen Gesprächen zum ersten Mal hört und die ihm eine Basis bietet, von der aus er allmählich in ein anderes Leben aufbrechen kann. Er muss nicht länger ein makelloses und immer gleiches Bild seiner selbst, eine Identität (von lateinisch idem, gleich) wie eine Monstranz vor sich hertragen, sondern kann an seiner Integrität arbeiten, die er selbst definiert und in die er auch Abweichungen, Veränderungen, Widersprüche integrieren kann.
Herrn Stramm hilft das weiter, ihm gelingt es, seinen Horizont zu öffnen und sich »neu aufzustellen«, wie er das bezeichnet. Verharrt ein Mensch beim Übergang zwischen Lebensphasen jedoch im undefinierten Schwebezustand, spitzt sich die Situation zu. Diesen Eindruck habe ich bei Herrn Lang*, der wegen Depressionen ins Spital eingewiesen worden ist. Zuvor setzte er Beruhigungsmittel gegen sie ein, mit dem Resultat, die Dosis immer mehr steigern zu müssen und in eine Abhängigkeit zu geraten, die ihn erst recht mit dem Problem konfrontierte, dass sein bisheriges Leben nicht mehr weitergehen kann. Bei dem 63-Jährigen stünde der Übergang in den Ruhestand an, aber er kann sich nicht mit dem Gedanken anfreunden, bald seine Firma verlassen zu müssen, denn was kommt danach? Womit soll er seine Tage und Jahre füllen? Ist das Leben mit all den Gebrechen, die immer spürbarer werden, und dem Gefühl, nicht mehr gebraucht zu werden, noch lebenswert? In der Firma haben Jüngere seine Aufgaben übernommen, sie machen ihre Arbeit besser, als er es ihnen zugetraut hätte, einerseits erfreulich, andererseits der Beweis, dass er tatsächlich nicht mehr gebraucht wird. Wir konzentrieren uns zunächst auf den scheinbar einfachen morgendlichen Übergang in den Tag, mit dem er bereits Mühe hat, der sich aber mit Ritualen gestalten lässt (ihm gefällt es, einen Spaziergang zu machen). Sodann scheint auch ihm eine größere Selbstaufmerksamkeit und die Festlegung einiger Eckpunkte für sich zu helfen, das genügt ihm für den Moment. Die Psychotherapeuten übernehmen seine weitere Betreuung.
Von noch größerem Ernst ist die Frage der Selbstbeziehung, des Übergangs und Neuanfangs bei Frau Weber*, einer 45-jährigen Lehrerin, die von der Diagnose Brustkrebs aus dem gewohnten Leben gerissen worden ist. Bereits ihre Mutter war davon betroffen, daher hatte sie sich schon einmal mit der Situation befasst, die alles relativiert. Sie fühlt sich schutzlos wie ein Baby, symbolisch steht dafür in ihren Augen der glattrasierte Kopf, mit dem sie dem Haarausfall zuvorkommen wollte, den die Chemotherapie verursacht. Die »Chemo« sei wie eine Bombe, die langsam im Körper explodiert, sie gehe mit Geschmacksveränderungen einher, mit trockener Haut, Dünnhäutigkeit, auch einem Austrocknen der Schleimhäute. Sie fürchtet den Verlust ihrer Lust und ängstigt sich vor Sterben und Tod. Was sie während der vier Chemotherapie-Zyklen erlebt habe, sei jedes Mal wie »Sterben, Tod und Auferstehung in drei Wochen« gewesen. Aber es sei ihr zu eng, sich nur mit sich zu befassen, wozu ihrer Meinung nach die Psychodisziplinen verleiten. Bei Ärzten wiederum fehlt es an Muße, um über all das zu sprechen, was sie bewegt. Daher sucht sie nun das philosophische Gespräch.
»Ich habe immer und gerne philosophiert
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: