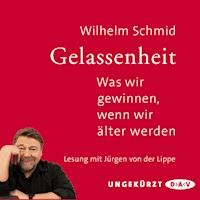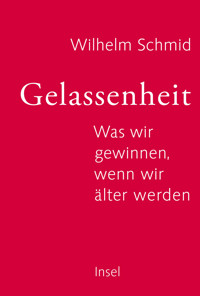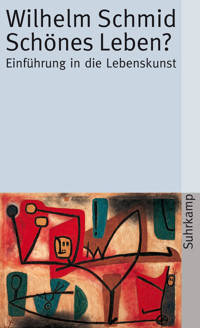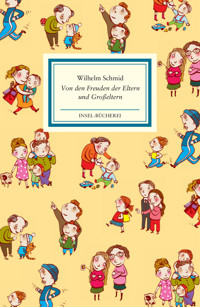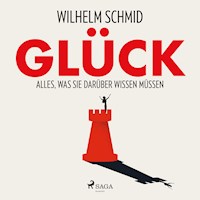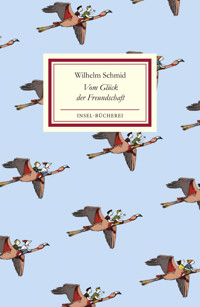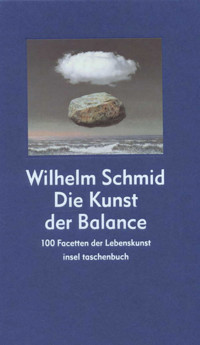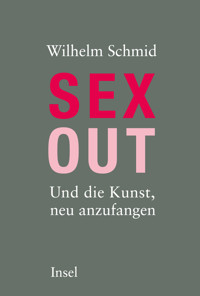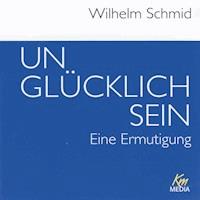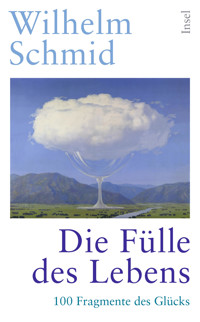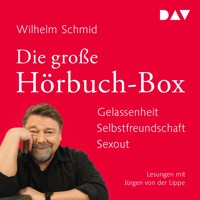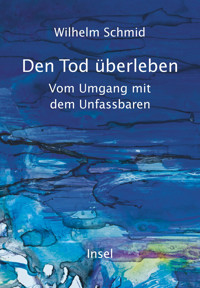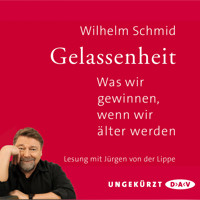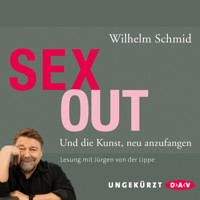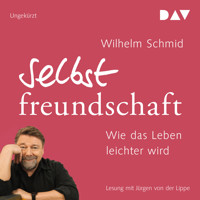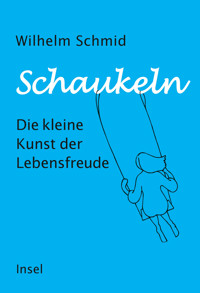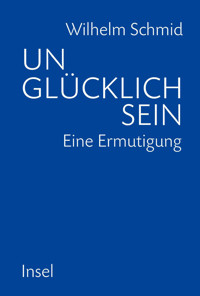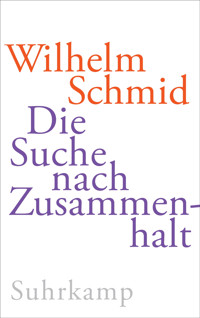
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Alle wollen in unserer Gesellschaft gesehen und verstanden werden, aber die wenigsten wollen sehen und verstehen ‒ ein krasses Missverhältnis. Alle beanspruchen für sich »Einzigartigkeit«, aber der Gesellschaft liegt nicht Selbstverwirklichung, sondern Beziehungsverwirklichung zugrunde.
In seinem neuen Buch geht Wilhelm Schmid daher der Frage nach, welche Werte die Gesellschaft braucht. Was hält sie (halbwegs) zusammen? Bedarf sie einer »Identität« oder besser einer »Integrität«? Einer »Leitkultur«? Wie wichtig ist Wahrheit für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, und wie wird sie gefunden? Und warum haben Autokratien keine Zukunft, auch wenn sie aktuell auf dem Vormarsch sind?
Die Gesellschaft lebt von Bürgern, denen nicht alles egal ist und die Sorge für sie tragen. Höchste Zeit, das Wort »bürgerlich« zu rehabilitieren, das einst in Verruf gebracht worden ist. Und wie umgehen mit Wutbürgern? Bei Begegnungen mit ihnen entdeckt der Autor, was trotz allem verbindend wirkt: Die kleinen und großen Lebensfragen.
Ein erzählendes Sachbuch, prallvoll mit Einblicken, Hintergründen und überraschenden Begegnungen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 593
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Cover
Titel
Wilhelm Schmid
Die Suche nach Zusammenhalt
Ich und Wir: Vom schönen und schwierigen Leben in Gesellschaft
Suhrkamp Verlag
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2025
Der vorliegende Text folgt der Erstausgabe, 2025.
© Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2025
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Hermann Michels und Regina Göllner
eISBN 978-3-518-78216-3
www.suhrkamp.de
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Vorwort
In Gesellschaft leben, was heißt das?
Wenn die Gesellschaft sich versammelt
Gestaltung des Soziallebens: Jeder Mensch ein Künstler
Was Busfahrer und Philosophen zur Gesellschaft beisteuern
Aufklärung im Klärwerk: Die Wahrheit der Gesellschaft
Wer gehört dazu? Die feinen und unfeinen Unterschiede
Identitätspolitik: Die gereizte Gesellschaft
Wie wir miteinander reden: Canceln oder alles sagen?
Unterhalb der Brücke und oberhalb: Ränder der Gesellschaft
Auto und Autonomie: Die Gesellschaft auf der Straße
Was mich interessiert: Der Gebrauch von Medien
Wie das Ich zum Wir wird: Medien der Geselligkeit
Wer kümmert sich um die Gesellschaft?
Kleines Land: Wie sich eine Gesellschaft organisiert
Staat machen, wirklich? Wozu Staat?
Politisch interessiert: Was es heißt, bürgerlich zu sein
Warum machen die das? Glück und Unglück der Politiker
Macht von oben, Macht von unten
Können Menschen jemals wirklich frei sein?
Die moderne Gesellschaft und ihre Veränderung
Die Wissenschaft der Gesellschaft: Was weiß die Soziologie?
Zu dir, zu mir oder zum Standesamt? Institutionen!
Und was macht eigentlich ein Ordnungsamt?
Verzauberung und Verstörung: Kunst und Gesellschaft
Was tun Wirtschaft und Gesellschaft füreinander?
Die Einzelnen und ihr Eigentum
Grundeinkommen: Leben, um zu arbeiten, oder Lebensarbeit?
Wofür streiken? Für die Erweiterung des Bewusstseins!
Was es heißt, Unternehmer, Unternehmerin zu sein
Sozialökologische Marktwirtschaft: Welchen Wohlstand wollen wir?
Die Dekarbonisierung des Apfels: Erneuerbare Energien
In Molekülen denken: Kann das eine Bank?
Machen grüne Waschmaschinen Menschen glücklich?
Markt, Marketing und menschlicher Eigensinn
Lebensmittelindustrie: Das Food der Gesellschaft
Plattformökonomie: Ist der digitale Deal fair?
Europa ist kein Kontinent. Was dann?
Wann ist der Kapitalismus am Ende?
Welche Gefahren drohen der Gesellschaft?
Was läuft hier falsch?
»Es ist unfassbar!« Warum Freiheit Grenzen braucht
Polizeistaat oder »meine« Polizei?
Kann die Lebenskunst Faschismus verhindern?
Militär! Die Verteidigung der Gesellschaft
Warum Autokratien keine Zukunft haben. 10 Gründe
Wie sind Wahlen in der freien Gesellschaft zu schützen?
Polarisierung: Ist der Wutbürger auch ein Bürger?
Auf der Suche nach dem Intellekt der Intellektuellen
Die Wahrheit der Gesellschaft in der Pandemie
Krank, und dann? Das Gesundheitssystem
Was ist Leben? Eine gesellschaftliche Frage
Wokeness: Menschenrechte und aggressiver Humanismus
Was hält die Gesellschaft (halbwegs) zusammen?
Werte? Die Verlässlichkeit, die Vertrauen begründet
Braucht die Gesellschaft eine Identität?
Was die Lebenskunst zum Zusammenhalt beiträgt
Spielend leben lernen: Schule der Lebenskunst
Kuratieren: Die Sorge der Kultur für das Gemeinwohl
Volksmusik: Das ganze Volk ist durchdrungen von Musik
Was Seelsorge, Therapie, Coaching für die Gesellschaft tun
Die Gesellschaft reparieren: Die Arbeit der Handwerker
Für mich und Andere: Bürgerschaftliches Engagement
In den Schuhen der Anderen: Die Kluft der Generationen
Recht und Gerechtigkeit als Kitt der Gesellschaft
Die Suche nach Wahrheit als Arbeit am Zusammenhalt
Die Sorge der Religionen: Wir statt Ich
Zum Autor
Informationen zum Buch
Vorwort
Der Zug fährt ein, die Türen öffnen sich, eine junge Frau mit Kinderwagen will aussteigen. Es ist schwierig, den Wagen über die Stufen am Zug hinab zu manövrieren. Sofort sind helfende Hände da. Den zugehörigen Gesichtern nickt die Frau kurz zu, Danke, dann gehen alle weiter. Keine spektakuläre Szene, einfach nur Alltag. Hilfe für jemanden, der sie benötigt. Niemand musste lange überlegen. Niemand fand das Verhalten falsch. Etwas lief richtig, ohne dass es der Rede wert gewesen wäre. Was sagt das über die Gesellschaft aus, in der wir leben? Ist sie besser als ihr Ruf? Wird das Ich eben doch flugs zum Wir, wenn es darauf ankommt?
Augenblicklich ist ein Zusammenhalt entstanden, ohne dass ein Ich sich dafür hätte aufgeben müssen. Ich und Wir, in dieser Reihenfolge: Ein Ich muss bereit sein und die Kraft dafür haben, Anderen zur Seite zu stehen. Die Wahrscheinlichkeit für die Bereitschaft dazu oder gar die Freude daran wird größer, wenn es mit sich selbst gut zurechtkommt. Wer sich auf den Umgang mit sich versteht, kann sich auch eher Anderen zuwenden. Damit ein zugewandtes Ich entsteht, ist allerdings ein vorgängiges Wir hilfreich, eine förderliche soziale Umgebung, eine freundliche Gesellschaft. Deren Entstehen wiederum auf Ichs angewiesen ist …
Wo anfangen? Manche meinen, das Ich gehöre der Vergangenheit an, Wir statt Ich. Aber das Ich ist eine Errungenschaft, die nicht aufgegeben werden sollte. Es wurde gegen ein dominantes Wir erkämpft, gegen übermächtige Zwangsgemeinschaften mit einem Ober-Ich, Herrscher, Fürst, König, Kirchenführer, Familienpatriarch. Viele Unter-Ichs taten sich zusammen, um eine Gesellschaft frei von solcher Herrschaft zu begründen, die Geburtsstunde der modernen Demokratie. Erkämpft wurde das Recht jedes Einzelnen, ein eigenständiges Wesen zu sein. Das befreite Ich war die treibende Kraft der Moderne, die viele Verbesserungen des Lebens herbeigeführt hat. Begeistert von sich, neigt es jedoch zu Übertreibungen, Ich statt Wir. Es hat zu oft nur noch Selbstverwirklichung im Sinn und beansprucht »Einzigartigkeit« für sich, die es zweifellos auch gibt, aber ist das schon alles?
Einiges spricht dafür, das Ich nicht zu überhöhen, vorweg das kluge Eigeninteresse: Es ist nützlich, nicht nur mich zu sehen. Jedem Ich hilft es, sein Beziehungsgeflecht zu einem Wir zu verdichten: Im Verbund mit Anderen ist das Leben besser zu bewältigen, insbesondere wenn es schwer wird. Ein noch besserer Grund ist das freudige Interesse an Anderen: Es ist schön, nicht nur mich zu sehen. In jeder Art von Wir ist die Vertrautheit und Geborgenheit einer Heimat zu finden, die das Leben bejahenswerter macht. Schon aus diesen Gründen ist die Selbstverwirklichung unvollständig ohne Beziehungsverwirklichung. Beziehung begründet Sinn. Je mehr mir bewusst wird, wie sehr ich trotz unterschiedlicher Tätigkeiten und Sichtweisen mit Anderen zusammenhänge, desto mehr Sinn im Leben sehe ich. Ich und Wir: Das Hin und Her dazwischen ist von Interesse. Im Und liegt der Sinn, der die Ichs umso mehr erfüllt, je vielfältiger ihre Beziehungen sind. Die Sorge für Zusammenhänge zwischen Ich und Wir mündet in den Zusammenhalt, der allen zusammen Halt verleiht und im besten Fall lange hält. Wo aber Zusammenhänge verschwinden, und sei es nur aus den Augen, entschwindet auch der Sinn. Niemand sieht Sinn dort, wo alles auseinanderfliegt.
Das befreite Ich, das kein Und und somit kein Wir mehr kennt, driftet in die Sinnlosigkeit. Seine Freiheit erschöpft sich im Freisein von Anderen. Es verfehlt die gesteigerte Freiheit, das Freisein zu Anderen, um sie zu sehen, mit ihnen zu denken, zu fühlen und zu handeln. Ein veraltetes, verkürztes Verständnis von Autonomie ist das Problem. Es liegt aber am Ich selbst, daran etwas zu ändern. Nicht nur ich will gesehen werden, sondern auch Andere wollen das. Ich schaffe ein Wir schon durch das gelegentliche Entgegenkommen, das Andere erfreut. So wird das solitäre Ich in Situationen wie der geschilderten, erst recht in weit schwierigeren, zum solidarischen Wir. Das Streben danach wird erkennbar im Bemühen vor allem jüngerer Menschen, alles Mögliche zu teilen, to share, und auf jede Weise zu kooperieren, Co-Working, Co-Living, Co-Creation. Das neu entstehende Wir aber sollte nicht wieder in Zwangsverhältnisse zurückfallen. Nachdem das alte, unterjochende Wir in moderner Zeit überwunden wurde, sollte es möglich sein, zu einem neuen, freien Wir zu kommen, ohne die Ichs zu negieren, die in der endlosen Kette der Existenzen, der Blockchain des Lebens, die unverzichtbaren Bindeglieder sind.
Freies Wir, ja, aber wie? Wie kommt das Zusammenwirken von Menschen zustande, durch das Gesellschaft entsteht? Nicht nur von Mal zu Mal, sondern anhaltend? Das ist bereits seit Sokrates, Platon und Aristoteles eine philosophische Frage. Sie wird wieder virulent in Zeiten, in denen die bestehende Gesellschaft zu zerbrechen droht. Aber wir Ichs sind keine Monaden mehr, also abgeschlossene Einheiten ohne Fenster und Türen, wie Gottfried Wilhelm Leibniz noch zu Anfang des 18. Jahrhunderts meinte. Uns verbinden Lebensfragen, die sich nicht nur mir stellen. Wir sind auch nicht die Atome einer atomisierten Gesellschaft, die zu Molekülen keine Kraft mehr haben. Vielmehr sind wir mit Neuronen vergleichbar, die mit Synapsen für die Vernetzung untereinander sorgen. Eine gesteigerte individuelle und gesellschaftliche Intelligenz wird dadurch möglich. Die Gesellschaft ist ein Megabrain, ein großes Gehirn, für das nicht die Zahl der Neuronen, sondern die Vernetzung entscheidend ist, ein Wir im Kleinen und großen Ganzen, bei dem jedes Ich sich mit vielen anderen Ichs verbinden kann.
Dass die Neuronen ohne Synapsen auskommen wollen: Das ist die Gefahr der Auflösung des Zusammenhalts. Das Problem der modernen Gesellschaft sind dabei nicht nur fehlende und zerbrechende Beziehungen, sondern auch – unsichtbare Menschen. Viele klagen darüber, nicht gesehen zu werden, aber nicht viele bemühen sich darum, Andere zu sehen, ein krasses Missverhältnis. Ich will mit diesem Buch gegensteuern und mich auf eine Reise durch die Gesellschaft begeben, um so viele Andere wie möglich zu sehen. Mich interessiert, was es heißt, in Gesellschaft zu leben. Wie kommt sie zustande? Wer kümmert sich um sie? Welche Bedeutung hat etwa die Wirtschaft für sie? Welchen Gefahren ist sie ausgesetzt? Was hält sie (halbwegs) zusammen und stärkt sie? Weniger in einer Analyse der Gesellschaft sehe ich meine Aufgabe, mehr in einer Synthese, einer Zusammenfügung ihrer Bestandteile. Neben der punktuellen Vertiefung geht es mir um das größere Bild, das die Gesellschaft konkret sichtbar macht und sie näher an das Ich heranrückt, statt nur eine abstrakte Größe zu sein.
Den Anfang soll hier, wie auch sonst, die Phänomenologie machen, die Wahrnehmung der Phänomene und das Nachdenken darüber. Wem begegne ich und was erlebe ich, wenn ich mich »in Gesellschaft begebe«? Gesellschaft entsteht täglich neu in den Begegnungen, die gewohnt oder überraschend sind, in den Geschichten, die dabei erzählt werden, in den Auseinandersetzungen, die durchzustehen sind. Ich berichte von Gesprächen etwa mit einem philosophisch interessierten Busfahrer, einem ökologisch desinteressierten Unternehmer, einem wütenden Gelegenheitsarbeiter. Ich erinnere mich an eigene Erfahrungen in der Politik und wie ich ins Visier des Staatsschutzes geriet, besuche ein Klärwerk, interessiere mich für die Arbeit des Ordnungsamts, sammle Erfahrungen in der Wirtschaft, gründe ein Café, mache mir Gedanken zur Volksmusik und absolviere mit der 12. Klasse eines Gymnasiums eine Schulstunde, aus der Überlegungen zu einer »Schule der Lebenskunst« hervorgehen.
Und was hält die Gesellschaft nun zusammen? Die Antwort finde ich bei sorgenden Ichs, denen das Wir nicht egal ist. Wir brauchen Sorgende, jedes Wir braucht sie. Sie erneuern und erweitern das Verständnis von Autonomie. Sie sorgen auf allen Ebenen und in allen Bereichen dafür, dass eine vertraute Heimat für möglichst viele in der Gesellschaft entsteht. Nach einer längeren Zeit größerer Sorglosigkeit nehmen sie die neue Zeit der Sorge ernst, die in der Geschichte angebrochen ist. Für mehr Zusammenhalt ist sicherlich eine äußere Verfassung mit garantierten Rechten unverzichtbar für die Gesellschaft, aber ebenso wichtig ist die innere Verfassung der Menschen selbst. Ihre Bereitschaft, sich füreinander zu interessieren, sorgt für die anregende Atmosphäre, die die Gesellschaft bejahenswert macht.
Die Suche nach Zusammenhalt bewegt viele. Manche erhoffen sich davon eine Harmoniepflege, aber das ist wohl zu romantisch. Realistischer ist ein Zusammenwirken durch Auseinandersetzung. Ich beziehe mich dabei auf die Gesellschaft, die ich am besten kenne, da ich seit Geburt in ihr lebe, sie auf Reisen aber auch von außen sehe. An ihrem Beispiel herauszufinden, wie Gesellschaft funktioniert, dient nicht dazu, sie als beispielhaft darzustellen. Ihre Darstellung ist auch nur eine Momentaufnahme. Schon bald wird sie eine andere sein, ganz so, wie sie vor Jahren und Jahrzehnten eine andere war. Menschen haben Ideen, begegnen Anderen, reagieren auf Erfahrungen, produzieren andere Dinge als zuvor. Die unmerklichen Mikroveränderungen summieren sich zu merklichen Veränderungen des Ganzen, oft auf überraschende Weise. Im Rückblick erst wird der Prozess erkennbar, der stattgefunden hat.
Eine Bemerkung noch. Wer über Gesellschaft spricht, äußert unweigerlich Meinungen über sie. Meinungen sind subjektive Wahrnehmungen, nicht schon objektive Wahrheiten. Über das graue Zahlenwerk hinaus, das die Gesellschaft statistisch erfasst, ist sie vor allem ein bunter Meinungsteppich – und manchmal vermintes Gelände, wenn Andere ganz anderer Meinung sind. Auch ich als Philosoph bin nicht im Besitz der Wahrheit, sondern auf der Suche danach, neugierig darauf, was Andere für wahr halten und welche Gründe sie dafür vorbringen, die mich überzeugen könnten. Die Suche nach Wahrheit ist nie das Werk Einzelner, immer vieler, die sich in diesem Fall darum bemühen, die gesellschaftliche Wirklichkeit so zutreffend wie möglich zu erfassen, um so wenig wie möglich in die Irre zu gehen. Kommt auf diesem Weg im Laufe der Zeit eine Gesellschaft zustande, in der alle gerne leben wollen, hat sich das Investment gelohnt, das jedes Ich für das Und zwischen Ich und Wir erbringt.
In Gesellschaft leben, was heißt das?
Wenn die Gesellschaft sich versammelt
Ich fühle mich wohl in diesem Kreis. Wir treffen uns nur einmal im Monat, aber dann ist es eine Art Familientreffen. Wir stehen ein wenig herum und plaudern, bevor wir uns an lange Tische setzen. »Wir«, das sind Alteingesessene und Zugezogene, etwa paritätisch Frauen und Männer, verschiedenste Berufe, Jüngere und Ältere, auch aus anderen Ländern und Kulturen, wenngleich nicht aus allen Schichten, aber das scheint typisch für kleine Gesellschaften zu sein. Wir sind 40 oder 50 Leute, die sich nicht alle schon kennen, es ist kein geschlossener Kreis, manche bleiben weg, neue kommen hinzu, sodass immer ein paar Andere miteinander bekannt werden. Ein Vortrag steht im Mittelpunkt, das Thema wird kurz angerissen, der Referent oder die Referentin vorgestellt, dann essen wir gemeinsam, heben das Glas »zum allseitigen Vergnügen« und hören anschließend aufmerksam zu. Es ist immer interessant und am meisten dann, wenn mich das Thema vorweg nicht sonderlich interessierte. Ein Buchhändler erzählt, eine Ghostwriterin berichtet, ein Museum wird vorgestellt, ein ethisches Dilemma zur Diskussion gestellt. Zum Nachtisch Gespräche über dies und jenes beim Kaffee. Seit vielen Jahren geht das so. Angeregt und aufgewärmt kehre ich in den Alltag zurück.
Was ist Gesellschaft? Zuallererst Geselligkeit. Es ist schön, gesellig zu sein, ein wenig Zeit miteinander zu verbringen, zu reden und zuzuhören. Manche Gespräche sind geradezu beglückend, offen und tiefgehend. Die kleine Geselligkeit macht die große Gesellschaft erfahrbar, ich fühle mich mitten in ihr und im Leben. Den Gegenpol kenne ich auch: Mangelt es an Geselligkeit, wird mir die Gesellschaft fremd. Ich fühle mich ausgeschlossen, Leere umgibt mich und Einsamkeit breitet sich in mir aus, die mir nicht willkommen ist. Aber die Situation ist nicht ausweglos. Mit meinem Verhalten nehme ich Einfluss darauf, ob Geselligkeit entsteht. Bin ich missmutig, ermutigt das niemanden. Zeige ich Freude, erfreut das auch Andere. Interessiere ich mich für sie, öffnen sie sich gerne. Ihrerseits schaffen sie durch Offenherzigkeit die Atmosphäre, die mich zur Geselligkeit ermuntert.
Aus den beteiligten Ichs entsteht ein Wir, auf das wir fortan Bezug nehmen können: »Wir sind uns schon mal begegnet.« Außer schön ist es ganz nebenbei auch nützlich, gesellig zu sein. Wir können uns über viele Dinge austauschen, gemeinsam beraten, einen Hinweis geben oder erhalten, uns wechselseitig weiterhelfen und in manchen Fällen auch trösten. Aus Geselligkeit entsteht Gesellschaft. Bereits dann, wenn wir nicht allein sind, sind wir umgangssprachlich »in Gesellschaft«. Und nicht nur der Umgang mit bekannten, befreundeten, geliebten Anderen begründet Gesellschaft, sondern auch die Begegnung mit Menschen, die wir gar nicht kennen. Eine einsame Geselligkeit ist möglich, wenn ich im Café oder auf einem öffentlichen Platz ganz für mich bin und mich dennoch »in Gesellschaft« fühle. Bei anderer Gelegenheit gehe ich auf Andere zu und weise sie nicht ab, wenn sie auf mich zukommen.
Geselligkeit überbrückt die Lücke zwischen Ich und Wir, die größer geworden ist, seit Ichs sich auf ihre Autonomie zurückzogen und das Wir der Gesellschaft in Anonymität verschwand. Der Übergang vom einzelnen Ich zum geselligen Wir und zurück geschieht vielfach, aber er beginnt – beim Ich selbst. Bin ich gerne mit mir »in Gesellschaft«? Jedes Ich lernt im Umgang mit sich, wie schwierig es sein kann, unterschiedliche Interessen »unter einen Hut zu bringen«, die das Ich jeweils für sich beanspruchen. Noch dazu findet sich alles, was die äußere Gesellschaft bewegt, auch in der inneren. Die äußeren Stimmen sprechen auch in mir. Äußere Auseinandersetzungen trage ich in mir selbst aus. Die Probleme der großen Gesellschaft machen auch meinem kleinen Ich zu schaffen. »Angenommen, ich wär die Gesellschaft«, sang der Liedermacher Funny van Dannen (Album Trotzdem Danke, 2007): »Ich hätte so viele Meinungen, Konflikte und etliche Schichten.«
Ein spannungsreiches Verhältnis zwischen Ich und Wir charakterisiert erst recht die äußere Gesellschaft. Schon die engeren Kreise von Paaren, Familien und Freundschaften in jeder Konstellation halten die Erfahrung bereit, wie anspruchsvoll es für Ichs ist, zum Wir zu werden und sich selbst darüber nicht zu vergessen. Und dies nicht erst bei der Frage, wer bei dieser oder jener Unternehmung mitmacht, sondern von Grund auf: Bezieht sich das Wir auf die engere oder weitere Familie? Beruht es auf Verwandtschaft, bis zu welchem Grad? Sind Freunde und Freundinnen Teil der Familie? Jedes Wir, das bejaht wird, sorgt für ein Gefühl der Zusammengehörigkeit und Vertrautheit. Mit der Konsequenz jedoch, dass es Andere gibt, die nicht als zugehörig betrachtet werden. Insbesondere in Patchwork-Familien sind nicht immer alle davon überzeugt, dass auch alle Anderen Teil des Wir sind. Weniger umstritten ist meist die Zugehörigkeit von Haustieren.
Das Wir wird erweitert in geselligen Gesprächsrunden, wie eingangs geschildert, in Tisch- und Abendgesellschaften, Salons, Clubs, Vereinen, Spielgemeinschaften, Nachbarschaften, Arbeitsteams. In ihrer Mitte agiert oft ein Ich, das das Wir zusammenhält, ein soziales Wunder, eine sorgende, umtriebige, kommunikative, gut vernetzte, angesehene oder »coole« Persönlichkeit. Hat sie in früheren Zeiten »eine Gesellschaft gegeben«, organisiert sie nun Social Events. Aus vielen dieser kleinen Geselligkeiten und Gesellschaften sind größere informelle Verbindungen zusammengesetzt, im Dorf und im Stadtviertel, im Milieu und in einer Belegschaft, einer Berufsgruppe, einer Alterskohorte, einer sozialen Schicht. Zu den Bayreuther Festspielen, die formell als Gesellschaft »mit beschränkter Haftung« firmieren, trifft sich alljährlich »die Gesellschaft«, die dennoch kein Abbild der ganzen Gesellschaft ist. Untereinander und gegenüber Anderen sprechen die Beteiligten davon, was »uns« verbindet. »Die Anderen« sind die, die nicht, noch nicht oder auch nie dazugehören. Meist ist damit kein Ausschluss gemeint. Kein Othering macht diese Anderen erst zu Anderen, die fernzuhalten wären. Sie könnten zum Wir werden, wenn sie sich dafür interessieren würden.
Was in der großen Gesellschaft vor sich geht, mit der die gesamte Bevölkerung eines Landes gemeint ist, kündigt sich meist in den kleinen Gesellschaften an. Bei geselligen Begegnungen sind Bruchlinien zu spüren, in Gesprächen tauchen neue Fragen auf. Ungewissheiten oder allzu heftig geäußerte Gewissheiten schlagen einem in Posts entgegen. Was die einzelnen Ichs diskutieren, verbreitet sich rasch über mediale Kanäle, zu denen viele Zugang haben. Und umgekehrt: Was in Medien diskutiert wird, findet umgehend Eingang in die Gespräche einzelner Ichs. Erst scheinen es vereinzelte Ansichten zu sein, bevor deutlich wird, dass viele sie teilen. Irgendwann habe ich bemerkt, dass es Leute gibt, die Nahrungsmittel danach beurteilen, ob sie »vegan« sind. Ich hielt das für eine seltene Exzentrik, bis mir klar wurde, dass eine gesellschaftliche Bewegung ihren Anfang nahm, die niemand ausgerufen hatte.
Was ist Gesellschaft? Auf jeder Ebene ist sie ein Zusammenleben von Menschen auf Basis dehnbarer oder strikter Regeln, seien sie festgeschrieben oder unausgesprochen. Schön daran ist das Mehr: Mehr Leben, mehr Möglichkeiten, mehr Informationen, mehr Gemeinsamkeit, mehr Absicherung gegen Misslichkeiten. »In Gesellschaft zu sein« macht das Leben kurzweilig, abwechslungsreich, überraschend, inspirierend. Sehnen Menschen sich nach Gesellschaft, haben sie meist die Geselligkeit im Sinn, die die Einsamkeit verringert, nach der sie nicht gesucht haben. Das ist zu erreichen mit mehr Sozialleben über die engste Umgebung hinaus, mit einem vielfältigen »sozialen Portfolio«, wie das in der Psychologie genannt wird. Dann kann ein Wir entstehen, bei dem die Stimmen der Ichs wie bei einem Chor zu einem vielstimmigen Klangkörper verschmelzen. Jedem Ich tut es gut, körperlich und seelisch, seine Stimme zu erheben und wenigstens mit ein paar Tönen und Worten Ausdruck für sein Inneres zu finden, erst recht mit Anderen an einem Werk zu arbeiten, das keine und keiner für sich allein bewerkstelligen kann, wie bei der Aufführung eines Stücks. Durch die Summe einzelner Anstrengungen etwas gemeinsam zu bewirken, macht alle stolz auf ihr Wir.
Aber das Zusammenleben ist oft überraschend anders als gedacht. Schwierig daran ist der Zwist: Gesellschaft ist nicht nur ein Wir. Ständig begegne ich Anderen, mit denen ich nicht übereinstimme, die mir nicht sympathisch sind und deren Verhalten und Sichtweisen mich befremden. Das Bestreben, lieber in Gesellschaft mit Menschen zu sein, mit denen ich einige Auffassungen teile, ist mir ziemlich vertraut. Für die Geselligkeit kann das arrangiert werden, aber die ganze Gesellschaft darauf auszurichten, ist aussichtslos. Immer sind unterschiedliche Meinungen von Menschen im Spiel, teils widerstreitende Perspektiven, die dazu führen, dass die Gesellschaft zu zerfallen scheint. Die Gesellschaft ist kontrapunktisch organisiert, ohne dass je eine Harmonie daraus wird. Zu jeder Position gibt es eine Gegenposition, zu jedem Pol einen Gegenpol, zu jedem Wort ein Widerwort. Wie damit umgehen, dass da immer Andere sind, die aus meiner Sicht das reine Wir stören? Ist nicht genau das die Wahrnehmung auch von deren Seite? Können »wir« die wechselseitige Störung akzeptieren?
Die große Gesellschaft beruht auf der kleinen Begegnung einzelner Ichs, die nicht immer erfreulich ist. Immer aber reduziert sie die Anonymität der modernen Gesellschaft. Was dafür nötig ist, rückte ins Bewusstsein, als es mit Beginn der Corona-Pandemie 2020 entbehrt werden musste: Eine Begegnung von Angesicht zu Angesicht in wirklichen, nicht virtuellen Räumen. Es war irritierend, als die Gesichter hinter Masken verschwanden und die öffentlichen Räume sich leerten. Es ist trist, nirgendwo Platz nehmen zu können, um sich zu treffen und zu plaudern, geschützt vor Kälte, Regen und Wind. Der Eindruck schwand, in einer vitalen Gesellschaft zu leben: Keine Geselligkeit mehr! Bei allen Verlusten, die die Pandemie mit sich brachte, war ein Gewinn die Erkenntnis, was die Begegnung und der physische Umgang mit Anderen für die Erfahrung bedeuten, kein verlassenes, sondern ein soziales Wesen zu sein. In realen Begegnungen können die Energien hin- und herströmen, die das Lebensgefühl intensivieren. Fehlt es an Begegnung, ist Strömungsabriss die Folge.
Ein großer Reichtum an Geselligkeit macht die Gesellschaft resilient gegen alle Wechselfälle der Geschichte. Das gesellige Gespräch einzelner Ichs markiert dabei den Übergang zur gesellschaftlichen Kommunikation. Davon, wie auch dann noch ein Gespräch möglich ist, wenn es unmöglich erscheint, wird später im Buch die Rede sein. Wesentlich für die Kommunikation ist zunächst nicht ihr Inhalt, sondern die Tatsache, dass sie stattfindet, denn sie verbindet die Ichs, begründet ein wenig Gemeinschaft (communio im Lateinischen) und ist somit das Herzstück jeder kleineren und größeren Community. Die Art und Weise der Kommunikation legt jedes Ich mit seinem Lebensstil selbst fest. Nicht alle haben immer Freude daran, zu kommunizieren. In jeder Beziehung kann ein Zuwenig jedoch zum Problem werden und zur Implosion der Kommunikation führen. Ein Zuviel wiederum kann eine Explosion zur Folge haben, bei der alle nur noch reden und niemand mehr zuhört.
Zum großen Teil findet die Kommunikation sprachlich statt. Über eine gemeinsame Sprache zu verfügen ist hilfreich für jede Gesellschaft, aber jede weitere Sprache, die Ichs sprechen, stärkt die Fähigkeit zur Verständigung. Die Bedeutung des Gesprochenen kann kulturell und individuell variieren, sodass es angebracht ist, immer wieder rückzufragen, was der oder die Andere unter diesem oder jenem Wort versteht. Ein Einvernehmen über den einzig richtigen Gebrauch der Sprache ist nicht zu erzielen, keine Instanz kann darüber wachen. Die Sprache lebt davon, wie sie vom einzelnen Ich gesprochen wird, ohne dass sie sein Eigentum sein könnte. Sie gehört allen und ist immer schon da, kann genutzt und weiterentwickelt werden, wenn neue Worte erfunden werden, die einem Ich plötzlich auf der Zunge liegen und von Anderen übernommen werden, da sie ihnen zusagen. Die Sprache ist die wahre Cloud, aus der die aktuell verfügbaren Worte abgerufen, in die aber auch neue hochgeladen werden können.
Bereits in kleiner Gesellschaft profitieren alle von der Kommunikation auf eine Weise, die Friedrich Schleiermacher 1799 in seinem Versuch einer Theorie des geselligen Betragens beschrieb. Er zeigte sich beeindruckt von den Salons in seiner unmittelbaren Nähe, die Rahel Varnhagen mit viel Liebe zur Geselligkeit in der Berliner Jägerstraße 54/55 veranstaltete. Schon damals gewährten abseits von Wohnsitz und Arbeitsstätte »Dritte Orte« bei zwanglosen Begegnungen Einblicke in andere und fremde Welten. Alle möglichen Erscheinungsweisen des Menschseins konnten dort dem einzelnen Ich »nach und nach bekannt, und auch die fremdesten Gemüther und Verhältnisse ihm befreundet und gleichsam nachbarlich werden«.
Unsere monatlichen Zusammenkünfte nicht weit vom damaligen Ort sind genau das: Eine wechselseitige Weiterbildung, ein Update und Upgrade als Alternative zu Hate Speech und Shit Storms. Bei der Geselligkeit geht die Rede herum, alle können zu Wort kommen, und es entsteht ein »Diskurs« im Wortsinne. Das »Diskurrieren« (lateinisch discurrere), besteht dem Wort entsprechend aber nicht nur darin, herumzugehen, sondern auch darin, abzuweichen und auseinanderzulaufen. Jede und jeder entscheidet frei, sich am Diskurs zu beteiligen, ihn überhaupt erst anzustoßen oder aber sich zurückzuhalten. Entscheidend für die kleinere wie die größere Gesellschaft ist die Möglichkeit, nicht der Zwang zur Teilhabe. Es kommt dem Diskurs auch zugute, wenn den Beteiligten klar ist, dass in jeder Situation diverse und auch kontroverse Diskurspositionen zu besetzen sind: Dafür zu sein und dagegen, neugierig, skeptisch, ignorant, verständnisvoll, sachlich, leidenschaftlich und vieles mehr. Was ist meine eigene Position? Darüber kann ich nachdenken und in der Zwischenzeit Andere zu Wort kommen lassen, statt das Herumgehen der Rede zu blockieren. Immer aber ist es ein Ich, das sich um Geselligkeit und damit um die Gesellschaft bemüht. Oder es versäumt.
Gestaltung des Soziallebens: Jeder Mensch ein Künstler
Die junge Frau weint still vor sich hin. Sie sitzt auf einer Bank in einem Berliner Park, in dem ich gerne spazieren gehe. Mein erster Impuls ist, sie anzusprechen und zu fragen, was sie bewegt und ob ich etwas für sie tun kann. Mein zweiter Impuls ist, genau das zu lassen, denn sie könnte es als aufdringlich oder gar als Anmache empfinden. Älterer weißer Mann nützt die Notlage einer jungen Frau aus: Ist es nicht das, worüber die Leute sich entrüsten? Will ich das riskieren? Für einen Moment zögere ich noch, dann gehe ich weiter, als hätte ich nichts bemerkt, eine von vielen anonymen Begegnungen in der Großstadt.
Es ist ein paar Jahre her, aber es kommt mir immer wieder in den Sinn. War es richtig, wie ich mich damals verhalten habe? Längst bin ich mir sicher: Nein. Schade, ich kann es nicht mehr revidieren. Aber künftig könnte ich es besser machen. Mir selbst und Anderen könnte eine Idee auf die Sprünge helfen, die im südostafrikanischen Simbabwe ihren Ursprung hat. Dort richteten Großmütter bereits in den 1980er Jahren im Schatten von Baobab-Bäumen eine »Freundschaftsbank« ein. Freundschaft, die geselligste Form von Gesellschaft, geht daraus hervor, dass Menschen, die einander fremd sind, miteinander vertraut werden. Vielleicht ist es nur eine Bekanntschaft, die zustande kommt, aber auch diese Art der Beziehung ist wertvoll. Mit ihrer Bereitschaft, geduldig zuzuhören, und mit ihrer langen Lebenserfahrung konnten die Frauen verzweifelten Menschen behilflich sein, beispielsweise Aids-Kranken, die sonst nirgendwo auf Verständnis für ihre Lage hoffen durften. Die Frauen nannten sich »Hüterinnen der Gesundheit«. Ihre Gesprächspartner fühlten sich, wie Rückfragen ergaben, ermutigt, sie konnten ihre Probleme besser angehen, statt tiefer in Depressionen zu versinken. In anderen afrikanischen Ländern wurde die Idee adaptiert, bevor sie schließlich den Atlantik überquerte und mit einem Zwischenstopp in der Karibik 2017 in New York landete.
Dort traf sie als Friendship Bench auf die Welt der Moderne, in der soziale Zusammenhänge schon länger kriseln. Nun also die neue Idee. In mehrwöchigen Weiterbildungen werden alle, die sie ehrenamtlich realisieren wollen, auf die möglichen Gespräche vorbereitet. Psychologen und Therapeuten wissen, dass oft nur ein Mirroring genügt, eine Spiegelung: »Wirklich, das haben Sie erlebt? Erzählen Sie mal!« Es ist klar, dass es um persönliche Begegnungen geht, nicht um einen Ersatz für therapeutische Angebote. Immer mehr Bedürftige machen seither die Erfahrung, dass es Menschen gibt, die bereit sind, zuzuhören, und dass allein das in vielen Fällen schon weiterhilft. Ein »Dankeschön« ist den Helfern Lohn genug. Ein Gewinn ist für sie selbst das Zuhören, denn wer Anderen zuhört, weiß mehr vom Leben. Zwischen Menschen, die sich nicht persönlich kennen, wird die unüberschaubare Gesellschaft wieder zur erfahrbaren Größe. Freundschaftsbänke senden das Signal aus, dass ein Wir möglich ist, bei dem sich die Menschen nicht egal sind. Das soziale Netz wird neu gestrickt. Die Begegnungen mit Anderen bringen verlorenen Sinn ins Leben zurück.
Es muss nicht immer ein ausgewiesenes Stadtmobiliar sein, auch ein deutlich gezeigtes Interesse an Anderen genügt, signalisiert durch ein freundliches Wort, eine beiläufige Bemerkung, eine Rückfrage. Es kommt lediglich darauf an, eine Gelegenheit dafür, anders als ich, nicht verstreichen zu lassen, sondern sie im Gegenteil beim Schopf zu packen. Alle lieben es, einem Menschen zu begegnen, der zugänglich, aufgeschlossen, verständnisvoll und unkompliziert ist. Alle finden es toll, jemanden zu treffen, der sich aus freien Stücken um sie bemüht und nicht, weil es seine institutionelle Pflicht ist. Kann ich selbst so ein Mensch sein? Das Leben hält genug Schwierigkeiten bereit, ich muss sie nicht noch vermehren. Spricht mich jemand an, bin ich gerne zum Gespräch bereit. So kann ich mit Anderen Geselligkeit pflegen, Gesellschaft gestalten und an der sozialen Wirklichkeit arbeiten. Alle Menschen streben nach Glück? Nein, alle sehnen sich danach, gesehen, gehört und verstanden zu werden. Es begründet auf Anhieb Beziehung. Es zu entbehren, führt zu Verlassenheit.
Wie jede Kunst braucht auch diese ein Wissen, das jedoch erworben werden kann, und ein Können, das einzuüben ist. Die soziale Kunst startet mit ein wenig Aufmerksamkeit, Zeit und Entgegenkommen – eine Sache einzelner Ichs, die immerhin institutionell unterstützt werden kann. In Luzern in der Schweiz hat die Stadt die Installation von Freundschaftsbänken übernommen. In Berlin, wo Freundschaft ein flüchtiges Gut ist, reichte es immerhin zu ein paar »Plauderbänken« im Fennpfuhlpark. Platz nehmen können alle, die ein Gespräch suchen. Ein Lebensgespräch wird daraus, wenn da jemand ist, der gerne zuhört. Wer Anderen von sich erzählt, sieht dabei allmählich den roten Faden des eigenen Lebens hervorleuchten und findet so wieder zu sich. Wäre die junge Frau damals auf einer deklarierten Freundschaftsbank im Park gesessen, hätte ich mir keine Gedanken über ein unangemessenes Verhalten gemacht. Ich hätte sie gefragt, ob ich mich zu ihr setzen darf, und hätte sie gebeten, ihren Kummer mit mir zu teilen. Wahrscheinlich wäre sie froh darüber gewesen.
Sosehr die soziale Kunst eine individuelle Aufgabe ist, können Institutionen mit ihrer personellen und materiellen Ausstattung eine große Hilfe dabei sein. Für Alice Salomon (1872-1948), die Mitbegründerin der Sozialen Arbeit, ging es bei dieser Arbeit ausdrücklich um Lebenskunst. »Die wenigsten Menschen sind sich darüber klar, daß ›leben‹ eine Kunst ist« (Soziale Diagnose, Berlin 1926, 51). Sie machte ein praktisches Programm daraus, das Ich so zu stärken, dass es mit seinem Leben und Sozialleben gut zurechtkommt und auch für Andere da sein kann. In Frage stehe die »Wiederaufrichtung eines Menschen«, eine Wiederherstellung seiner Selbstständigkeit, seiner Gesundheit und seiner Fähigkeit zu verantwortlicher Lebensführung. Niemand, der den Einsatz dafür bedenke, werde leugnen, dass das Leben sogar »die höchste aller Künste« sei. Aber es fehle vielen an Unterstützung bei der Bewältigung des Lebens. Jeder ringe für sich allein mit misslichen Umständen, »schweigend und vielleicht mit der frohen Maske vor dem Antlitz«.
Die Berliner Nationalökonomin und Philosophin, die bei Georg Simmel studierte, war wesentlich daran beteiligt, aus der Sozialen Arbeit ein wissenschaftlich fundiertes Berufsfeld zu machen. Die Hochschule in Berlin-Hellersdorf, die dazu ausbildet, ist nach ihr benannt. Das einzelne Ich nicht damit alleinzulassen, eine Antwort auf die Herausforderungen des Lebens zu finden, verstand Alice Salomon aber auch als Aufgabe für die ganze Gesellschaft. Engagierte Ichs, für die sie ein Beispiel gab, sollten politische Veränderungen ins Werk setzen, um die Ursachen für soziale Benachteiligungen anzugehen. Eine Sozialgesetzgebung und die darauf beruhende Ausgestaltung institutioneller Fürsorge sollte Schwächere stärken und so für jede und jeden günstigere Lebensbedingungen schaffen. Durch Institutionen unterstützt, sollte jedes Ich einen eigenen Beitrag zu seiner Lebenskunst erbringen können.
Was Salomon unter diesem Beitrag verstand, kann aus späterer Sicht umstritten sein. Um der Entwicklung der Persönlichkeit willen hielt sie es für nötig, dass Menschen sich an ihre Umwelt »anpassen«. Leben sei »dieser Vorgang der Anpassung«. Wer dazu in der Lage sei, »beherrscht die Kunst des Lebens«. Sich anzupassen ist freilich das, was im weiteren Verlauf der deutschen Geschichte in Verruf geriet. War es nicht das, was der nationalsozialistischen Herrschaft Vorschub leistete? Manche halten Salomon vor, ein Kind ihrer Zeit gewesen zu sein, aber das ist ein Vorwurf, der auch diejenigen trifft, die immer unangepasst sein wollen (»Ich mache, was mir passt«). Im Gefolge der Studentenbewegung von 1968 wurde das zur Norm, der man sich – anzupassen hatte. Sinnvoller wäre wohl die Frage, wann Anpassung angebracht ist, wann nicht. Worauf Alice Salomon zielte, war vermutlich das, was im 21. Jahrhundert Resilienz genannt wird. Was meist mit Widerstandskraft übersetzt wird, ist eigentlich Wiederaufrichtungskraft, eine Biegsamkeit, um sich vorübergehend einem Sturm zu beugen und dadurch nicht zu brechen, eine Bereitschaft, sich auf Gegebenheiten einzustellen, statt mit dem Kopf durch die Wand zu wollen. Mit Denk- und Verhaltensweisen, die der jeweiligen Lebenssituation Rechnung tragen, wird es möglich, auf Schwierigkeiten zu reagieren, Krisen durchzustehen, aus ihnen zu lernen und sich weiterzuentwickeln.
Das wird leichter mit jedem Wir, um das ein Ich sich beizeiten kümmert. Mit der Gestaltung seines Soziallebens wird ein Mensch zum Künstler, der das eigene Leben zum Kunstwerk macht. Bereits Friedrich Schleiermacher hatte das im Blick, als er in seinen Vorlesungen von 1805/06 kundtat, »alle Menschen sind Künstler« (Brouillon zur Ethik, Vorlesungen, 61. Stunde). Aber erst die Version von Joseph Beuys, jeder Mensch sei ein Künstler, sorgte für eine nachhaltige Wirkung dieser Idee. Wobei vielen nicht geläufig ist, dass Beuys selbst das auf die Sozialkunst bezog (sein Begriff im Gespräch, wiedergegeben im Film Beuys, Regie Andres Veiel, 2017). Was das für ihn konkret hieß, dokumentieren Tausende von Bäumen, die in Kassel das Stadtbild prägen. Beuys pflanzte sie mit vielen Helfern im Rahmen der Documenta 1982. Die Aktion war für ihn eine Soziale Plastik, die noch viele Jahre danach das Leben der Menschen bereichert, die sich in diesem Landschaftskunstwerk gerne bewegen, ohne über den ursprünglichen Impuls nachzudenken, der von einem einzelnen Ich ausging.
Die erste und die letzte Eiche der Pflanzaktion bilden Jahrzehnte später immer noch das Empfangskomitee vor dem Fridericianum in Kassel. Was einst die Idee eines Künstlers war, der dafür angefeindet wurde, rückte bei der Documenta 2022 ins Zentrum der Ausstellung, die keine mehr sein wollte. Die Gestaltung des Soziallebens als Kunst zu begreifen, wurde von Ruangrupa wieder aufgegriffen, einer indonesischen Künstlergruppe, die mit über 50 ähnlich gesinnten Gruppen vor allem aus dem Globalen Süden die Documenta bestritt. Aber wieder reichte es nur zu Anfeindungen. Die Kulturkritik konnte mit dieser Art von Kunst nichts anfangen und stürzte sich ersatzweise auf das, was leichter fassbar erschien. Vereinzelte (und umgehend zurückgezogene und bedauerte) antisemitische Bildinhalte wurden zum nicht endenden Skandal erklärt. Hatten die deutschen Auftraggeber die Ausstellung ursprünglich als Wiedergutmachung für frühere kolonialistische Übergriffe gedacht, gerieten die Reaktionen darauf zu einem neuerlichen Übergriff mithilfe intellektueller Deutungshoheit. Die heftigen Meinungsäußerungen und Protestaktionen wären als neues soziales Kunstwerk zu verstehen gewesen, aber die enttäuschte Künstlergruppe vermochte das nicht mehr so zu interpretieren.
Dabei wollte sie doch die Trennung von Kunst und Leben aufheben. Es ging ihr darum, nicht weitere Kunstobjekte zu schaffen, sondern an der Gestaltung des sozialen Lebens zu arbeiten und die ganze Gesellschaft als Werk zu begreifen. Es sollte dafür keinen einzelnen Urheber mehr geben. Der Übergang vom Ich zum Wir, vom singulären Genie zum pluralen Kunstschaffen, sollte keine »Kunst« mehr sein, eher eine gesellschaftspolitische Aktion. Das indonesische Wort dafür ist jedenfalls Lumbung, das eigentlich eine Reisscheune bezeichnet, hier aber für Orte der Begegnung, des Austauschs und Feierns stehen sollte. Kunst sei für ihre Aktion nur noch ein »Alibi«, meinte einer, der für das Kollektiv aus Indonesien sprach. Damit konnte das übliche elitäre, exaltierte Kunstpublikum nichts anfangen; es blieb der Ausstellung fern. In der mit Wellblech verkleideten Documenta-Halle war keine »hohe Kunst« zu sehen, vielmehr machten die bereitstehenden Skateboards ein niedrigschwelliges Angebot. Junge Leute führten in der Halfpipe ihre Art von Kunst vor. Indem ich die Räume durchwanderte, wurde ich selbst zu einem Teil der sozialen Plastik. Mit jedem Menschen, der kam und ging, veränderte sich spürbar die Energie im Raum: Jeder Mensch ist ein Künstler, ohne es zu bemerken.
Dafür bedarf es keiner Kunst im engeren Sinne. Für die Gestaltung der Räume, die auf das Verhalten Einfluss nehmen, aber sehr wohl. Die soziale Kunst ist auf Community Managerangewiesen, die Freude daran haben, Gelegenheiten für Begegnungen zu schaffen, bei denen sich Lebenswege überkreuzen. Indem sie am Geflecht der Gesellschaft arbeiten, werden sie zu sozialen Künstlern und Künstlerinnen. Es spricht sich herum, wo interessante Menschen zu treffen sind und etwas Spannendes geschieht. Angeregte Gespräche können geführt werden, bei denen Gesellschaft erfahrbar wird. Ohne solche Möglichkeiten bleiben die Menschen in ihre Einzelleben zerstreut. Ihre Energien schaukeln sich nicht wechselseitig zu angeregten Zuständen hoch. Mit jeder Zusammenkunft aber, auch mit jedem Zusammenstoß, entsteht Gesellschaft neu, um eine Unmerklichkeit anders als am Tag zuvor. Wer viel in ihr unterwegs ist, kann mehr als Andere an diesem Prozess teilhaben. Das nutze ich ausgiebig.
Was Busfahrer und Philosophen zur Gesellschaft beisteuern
Zu dem geselligen Anlass, den ich erwähnte, fahre ich mit dem städtischen Bus. Der befördert eine kleine Gesellschaft, die der Zufall zusammengewürfelt hat. Ein Kind überschüttet seine Oma mit Kaskaden von Fragen, auf die sie mit Engelsgeduld antwortet. Zwei ältere Freundinnen haben sich viel zu erzählen. Ein junger Mann versteckt sich unter seiner schwarzen Kapuze. Ein Paar hält sich eng umschlungen. Ein älterer Herr führt seine in die Jahre gekommene Garderobe aus, ein anderer schleppt schwer an seiner Einkaufstasche. Am Ku'damm steigt, als wäre es eine Karikatur, eine Dame mit Hündchen auf dem Arm zu. Die kleine Gesellschaft ist ein Spiegel der großen. Mit stoischer Ruhe fährt der Busfahrer die Haltestationen seiner Route ab, angenehm anders als einige seiner Kollegen, die mit abrupten Wechseln zwischen Gaspedal und Bremse die Fahrgäste wissen lassen, dass sie lieber einen Maserati lenken würden. Anders als ein Taxi hält ein Bus nicht genau dort, wo ich hinwill. Das gefällt mir. So kann ich noch ein wenig gehen und nachdenken.
Was unterscheidet Busfahrer und Busfahrerinnen von Philosophinnen und Philosophen? Wie alle, die »nahe am Menschen« arbeiten, erfahren sie sehr direkt, was in der Gesellschaft vor sich geht. Sie sehen die Formen der Höflichkeit schwinden und die Schwelle zur Gewaltanwendung sinken. Morgens lärmen Schulkinder, abends betrunkene Partygäste. Gerüche von Döner und Haarspray dringen bis zu ihnen vor, auch Reste der Pausensnacks ihrer Vorgänger liegen manchmal unter dem Lenkrad. Passagiere laden ihren Ärger, egal worüber, gerne bei dem Menschen da vorne ab. Der muss jede Situation aussitzen und kann nicht einfach weglaufen. Für ihn oder sie kann Unfreundlichkeit zum Selbstschutz werden, um durchzuhalten (Susanne Schmidt, Machen Sie mal zügig die Mitteltüren frei – Eine Berliner Busfahrerin erzählt, 2021). Dabei hätten die Fahrgäste allen Grund, den Fahrerinnen und Fahrern da vorne dankbar zu sein. Sie sichern die Mobilität der Gesellschaft. Für relativ wenig Geld können alle einsteigen und ihrem Ziel näherkommen.
Auch Kassiererinnen, Postboten, Bäckerinnen, Schreiner, Pflegerinnen, Lehrer, Stewardessen, Landwirte, Steuerberaterinnen, Bergführer, Kellnerinnen, Lastwagenfahrer, Schwerlastfahrer, Fahrradkuriere erfüllen eine Funktion im Rahmen der Gesellschaft, die keiner Erklärung bedarf. Aber wozu braucht man Philosophen und Philosophinnen? Die haben die Gesellschaft allenfalls theoretisch im Blick. Deren Wirklichkeit nehmen sie abgepuffert am Schreibtisch und im Seminarraum wahr. Den gesellschaftlichen Alltag, oft auch ihren eigenen, strafen sie mit Verachtung, viel zu trivial, ephemer, kontingent, unsubstanziell, unwichtig, random. Das Pult im Vorlesungssaal ist definitiv ein anderer Ort als das Lenkrad im Bus. Am ehesten werden in Philosophischen Praxen, die es in vielen Städten gibt, Menschen mit ihren Fragen aus dem wirklichen Leben ernst genommen: Welchen Sinn hat meine Arbeit? Warum zerbricht meine Beziehung? Wie geht Liebe? Worauf kommt es im Leben an? Brauche ich ein Ziel? Wie kann ich dem Ziel näherkommen, das ich erreichen will? Welchen Sinn hat das Leben überhaupt? Viele bedürfen der Philosophie, um ihre Gedanken zu ordnen, auf andere Gedanken zu kommen und ihr Leben wieder in größeren Zusammenhängen zu sehen.
Die professionell Denkenden könnten sich als geistige Busfahrer verstehen. Zwar bringen sie niemanden physisch von hier nach dort, aber sie steuern etwas zur gedanklichen Mobilität der Gesellschaft bei. Sie liefern Stoff zum Nachdenken. Bei einer zeitweiligen Arbeit als philosophischer Seelsorger in einem Krankenhaus in der Nähe von Zürich nannten meine Gesprächspartner den gedanklichen Kick »geistige Nahrung«, eine Inspiration zu eigenen Gedanken. Hatte nicht Sokrates seine Art der Gesprächsführung einst als »Hebammenkunst« bezeichnet, mit der er Menschen dabei helfe, ihre eigenen Gedanken zu gebären? Gedankliche Impulse können in mancher Situation unmittelbar hilfreich sein, aber vor allem auf längere Sicht können sie den Anstoß dazu geben, einen misslichen Zustand hinter sich zu lassen. Im besten Fall können Geistesarbeitende damit nicht nur bei einzelnen Menschen, sondern auch in der Gesellschaft Reflexionen anregen und einen Beitrag zur geistigen Beweglichkeit leisten. Das Werden der modernen Gesellschaft wäre ohne die Ideen und Überlegungen von Philosophen wie John Locke, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot, Kant, Herder, Adam Smith, Benjamin Franklin oder Thomas Jefferson undenkbar gewesen.
Fragen zur Orientierung in der räumlichen Umgebung beantworten freundliche Busfahrer und -fahrerinnen. Philosophen und Philosophinnen werden gebraucht, um Orientierungsfragen anderer Art aus der Gesellschaft aufzunehmen, gründlich nach allen Seiten zu durchdenken und Gedanken dazu sowie mögliche Antworten an die Gesellschaft zurückzugeben. Im Rahmen der Arbeitsteilung ist es ihr Job, sich die Zeit zur Besinnung zu nehmen, die Andere nicht haben. Was mich angeht, nehme ich gerne Anfragen zum Anlass, dies oder jenes zum Thema zu machen, beispielsweise die Hoffnung, naheliegend in einer Zeit, in der es nicht viel Grund dafür zu geben scheint. Viele kennen die Frage Kants: Was darf ich hoffen? Mein Vorschlag ist, die Frage um eine weitere zu ergänzen: Was sollte ich besser nicht hoffen? Denn enttäuschte Hoffnung sorgt für Verbitterung, sowohl im privaten Leben, wenn Menschen ewig vergeblich hoffen, ihr Partner möge sich zum Positiven verändern, als auch im politischen Leben, wenn etwa die Hoffnung auf dauerhaften Frieden wieder einmal zerbricht. Hoffnung ist unverzichtbar, um den Horizont der Möglichkeiten offenzuhalten. Blinde Hoffnung aber neigt dazu, gegen eine üble Wirklichkeit nicht gewappnet zu sein.
Interessant wird es, wenn die reale Bewegung, um die es beim Lenken eines Busses geht, auf die geistige Bewegung trifft, um die ein Philosoph sich bemüht. Ein Busfahrer, dem ich mal begegnete, forderte mich mit einer überraschenden Frage heraus. Zurück von einer Flugreise, bestieg ich sein Gefährt und zeigte mein Ticket vor. Der Bus war voll, die Straße auch, eine stressige Situation für den Fahrer, neben dem ich nur noch einen Stehplatz fand. Berliner Busfahrer sind bekannt für ihren herben Charme. Neuankömmlinge machen da schon gleich Bekanntschaft mit dem Charakter der Stadt. Er wandte sich beiläufig zu mir um und fragte: »Und was machen Sie so beruflich?« Wahrheitsgemäß outete ich mich als Philosoph und war gespannt, was nun kommen würde. »Das trifft sich gut«, freute sich der Busfahrer, »dann kann ich Ihnen ja jetzt mal die Frage stellen: Was ist eigentlich der Sinn des Lebens?«
»Schwierig«, sagte ich. »So weit bin ich auch schon«, sagte er. Was jetzt? Ich befand mich ja selbst erst am Beginn des Nachdenkens über »Sinn«. Wir sollten, fuhr ich fort, erst einmal besser verstehen, was mit dem Wort gemeint sei. Im Alltag sei erstaunlich oft vom »Sinn« die Rede, es scheine also schon ein Wissen von ihm zu geben. Für »sinnvoll« halten es viele, wenn Dinge, Menschen und Erfahrungen erkennbar zusammenhängen. Stimmt nichts zusammen, führt dies dazu, »keinen Sinn« darin zu sehen. Als »unsinnig« wird etwa eine Idee bezeichnet, die keine oder falsche Zusammenhänge herstellt, also zu nichts führt, jedenfalls in der subjektiven Wahrnehmung. Als »sinnlos« wird empfunden, wenn Menschen ihr Tun nicht aufeinander abstimmen und somit zusammenhanglos agieren, wie es in Firmen und Behörden zuweilen geschieht. Ist Sinn also Zusammenhang? Sind die wichtigsten Zusammenhänge nicht die Beziehungen, in denen Menschen leben? Entsteht der Eindruck von Sinnlosigkeit, wenn über das eigene Lenkrad hinaus keine Zusammenhänge erkennbar sind? Und müssten für den »Sinn des Lebens« nicht erst sämtliche Zusammenhänge des Lebens bekannt sein?
Die Zeit im Bus verging wie im Flug. Wir stimmten überein, dass die Frage nach »dem Sinn« wohl kaum je zu beantworten ist, »Danke, und tschüss!«. Erst im Nachhinein entdeckte ich noch etwas, das uns verbindet. Ein Busfahrer kommt viel herum in der Gesellschaft, alle möglichen Menschen steigen bei ihm ein und aus. Meinerseits will ich ein philosophisches Programm daraus machen, kreuz und quer in der Gesellschaft unterwegs zu sein und mit vielen Menschen zu reden. Berufsmäßig Denkende müssen keine »Universalisten« mehr sein, die über alles Bescheid wissen. Aber sie können sich als Transversalisten für alle und alles interessieren, und insbesondere dafür, wie alles zusammenhängt. Überall in der Gesellschaft können sie die Fragen aufgreifen, die Menschen umtreiben. Während die moderne Gesellschaft in zahllose Spezialisierungen und eine unüberschaubare Vielfalt zu zersplittern scheint, können Transversalisten die verschiedensten Gebiete und Ichs in Bezug zueinander setzen, um der Unüberschaubarkeit entgegenzuwirken, die Unsichtbarkeit der einzelnen Ichs zu reduzieren und deren Zusammenwirken zu fördern. Unterschiedliche Logiken und Denkweisen können Transversalisten nachvollziehen und sich um Vermittlung dazwischen bemühen. Ohne von einer Parteiperspektive geleitet zu sein wie Politiker oder von ökonomischen Interessen wie Manager, können sie eine Metavision ins Spiel bringen, einen Blick von außen auf das größere Bild, das aus der Binnensicht nicht gut zu sehen ist.
Geht es wie bei Sokrates um die Geburt von Gedanken, heißt Philosophieren, gebären zu lernen und darauf aufmerksam zu sein, dass mit jedem Tag, in jedem Augenblick Leben von Neuem beginnt. In der »Natalität« sah Hannah Arendt (Vita activa, 1960) den Gegenpol zur Mortalität. Mitten im Leben heißt Philosophieren sodann, leben zu lernen. Eine bewusste Lebensführung, Lebenskunst in diesem Sinne, besteht darin, sich immer wieder Gedanken darüber zu machen, ob das Leben auf dem richtigen Weg ist. Mit Ideen, Kreativität und viel Mut ist es am besten zu führen, bevor Philosophieren letzten Endes heißt, sterben zu lernen, wie Seneca meinte (De brevitate vitae, Von der Kürze des Lebens, 7, 3). Vor dem Tod kommt immer das Leben, das sich nicht immer von selbst versteht. Aber alles, was lebt, stirbt. In der Gesellschaft ist das Interesse groß, über Leben und Tod zu »philosophieren«. Nicht so groß ist die Bereitschaft von Philosophen, darauf einzugehen und nicht auf dem hohen Ross ihres Fachvokabulars sitzen zu bleiben. Im 21. Jahrhundert wäre eine philosophische Bewegung willkommen, die bereit wäre, gedankliche Lebenshilfe zu leisten, transversal zu agieren und auch an ungewöhnlichen Orten mehr Klarheit über das Leben der Gesellschaft zu gewinnen.
Aufklärung im Klärwerk: Die Wahrheit der Gesellschaft
Was ist los in der Gesellschaft? Gewöhnlich bietet der Supermarkt Aufklärung darüber, ein Surplus, das an der Kasse zu Buche schlägt, ohne dass der Rechnungsbetrag erhöht würde. Durch diese hohle Gasse des Geschäfts und der Gesellschaft muss jede und jeder hindurch. Die Wahrheit der Gesellschaft tritt dort zutage, wo sich alle begegnen, jung, alt, scheu, exaltiert, schäbig gekleidet, gut situiert. An der Kasse menschelt es, an Selbstzahlerkassen auf andere Weise auch. Die hohle Gasse ist mit Süßigkeiten ausstaffiert, was Eltern dazu zwingt, jetzt endlich ihre Kinder zu erziehen oder endgültig zu kapitulieren. Der Oma fehlen ein paar Münzen? Jemand kramt sie hervor. Die Kassiererin, der Kassierer lässt alle stoisch an sich vorüberziehen und bedenkt Kunden angesichts vieler Flaschen mit einem launigen Spruch: »Na, feuchter Abend heute?« Sollte ich besser im Internet bestellen und mir den Einkauf nach Hause bringen lassen? Nicht, solange ich ihn schleppen kann. Würde ich einen implantierten Chip bevorzugen, über den die Erfassung und Abrechnung automatisch läuft? Aber ich lasse mir doch dieses Schauspiel nicht entgehen! An vorderster Front schüttet jetzt einer seine Geldbörse mit kleinen Münzen aus, die Kassiererin beginnt zu zählen.
An der Kasse wird der Laden zum Ort des Lebens, der er sonst nicht ist. Schon am Eingang frage ich mich meist: Wie komme ich möglichst schnell durch? Gedimmtes Licht, Gedränge in den Gängen, Warten an der Kasse, bis ich gnädigerweise die Karte oder das Portemonnaie zücken darf. Damit ich nicht zu rasch wieder draußen bin, werden die Produkte immer wieder umplatziert. Den Verkaufsstrategen entgeht, dass ich mehr einkaufen würde, wenn ich mich weniger oft neu orientieren müsste. Wo bleibt die Konsumentenpsychologie, die mein Denken, Fühlen und Verhalten lückenlos erfasst? Erfolgreich umkurve ich die besonders umsatzträchtigen Stirnseiten der Regale, die »Gondelköpfe«. Bei mir ist Zeit Geld. Hier aber ist der Raum Geld, jeder Kubikzentimeter soll Umsatz bringen. Wäre es nicht eine gute Idee, wenn die Macher des Marktes mal selbst mit den Augen der Kunden durchgehen würden? Dann könnte ich vom Augen-zu-und-durch-Käufer zum leidenschaftlichen Kunden werden, der ich im Grunde bin, denn sonst würden mir die Geschichten an der Kasse entgehen, wo jetzt jemand ansetzt: »Ich hätte da nur mal 'ne Frage …«. Ich muss mich zusammenreißen.
Hebt eine gesellschaftliche Debatte an, frage ich mich gleich: Was sagen die Menschen im Supermarkt dazu? Interessiert es sie? Da so viel von Inklusion die Rede ist, sollten doch wohl auch sie inkludiert sein. Aber nicht alle denken so. Die immens wertgeschätzte Achtsamkeit setzt aus, wenn es um Nachrichten aus dem wahren Leben geht. Dabei gewähren manche Menschen sogar in Buchform spannende Einblicke in unbekanntes Gelände der Gesellschaft wie etwa die Fußpflege in einem Plattenbauviertel (Katja Oskamp, Marzahn, mon amour, 2021). Ein gelegentlicher Austausch fördert unerwartete Vorgänge zutage. Ein Bademeister weiß von Begegnungen mit Meerjungfrauen zu berichten, die die Augen bei einem Kindergeburtstag erstrahlen lassen, oder von Leuten, die nach dem Schwimmen die Klopapierrollen aus den Toiletten mit nachhause nehmen. Ein Facilitymanager, der die Gebäudetechnik fest im Griff hat, ist stolz auf seine Menschenkenntnis, die ihm sagt, dass nie die Klimaanlage das Problem ist, wenn es jemandem im Büro zu kalt wird. Immer hat der frierende Mensch entweder Beziehungsprobleme oder er weiß noch nichts vom Infekt in seinem Körper.
Ein Fahrradkurier kennt Geheimnisse der Großstadt, die in einer Kleinstadt niemandem verborgen bleiben. In Ghost Kitchens, von denen weder das Finanzamt noch der Hotel- und Gaststättenverband etwas weiß, holt er Speisen ab und bringt sie im Tiefflug zu denen, die sie hungrig erwarten. Sperma muss mit noch mehr Hochdruck von der Samenbank ins Kinderwunschzentrum expediert werden. Der Rider folgt den Anweisungen einer App, deren Dateneinspeiser er nicht kennt. Mit seinen Kollegen chattet er über die besten Abkürzungen und tollsten Leistungen. Ihr Wir-Gefühl behaupten sie trotz hoher Fluktuation. Das forcierte Herumfahren in der Stadt gefällt ihm, es bewahrt ihn davor, selbst wie viele seiner Kunden zur Couchpotato zu werden. Sein Leben ist abwechslungsreich. Mal durchquert er eine marmorne Eingangshalle, mal einen desolaten Hinterhof. Gleich fährt er im verspiegelten Aufzug zur 12. Etage hoch und überreicht die Lieferung einer Sekretärin. Dann jagt er über die Treppen eines Wohnblocks in den vierten Stock, wo Schlabberhosen im Türspalt stehen. Die Kunden und Kundinnen erfährt er als kurz angebunden oder freundlich, häufiger ohne als mit Trinkgeld. Statt Mitleid für seine schwere, prekäre Arbeit hätte er lieber mehr Respekt.
Und wie nimmt der Änderungsschneider das Leben in unserem Kiez wahr? In der deutschen Gesellschaft der 2020er Jahre ist er typischerweise noch immer türkisch, genauer gesagt, deutscher Staatsbürger türkischer Herkunft. Seine Kinder sind hier geboren. Viermal in der Woche verlässt er sein Häuschen im Umland mit dem geliebten Rosengarten und bessert geduldig die Kleidung aus, die ihm die Leute in der Stadt anvertrauen. Seine Heimat ist die Nähmaschine. Niemand stört sich daran, dass er türkisches Radio hört. Nur weil ich ihn frage, in welchem Buch er gerade liest, als ich den Laden betrete, lässt er mich an seiner Koran-Lektüre teilhaben, die er begonnen hat. Dass es »Gottes Wort« ist, steht für ihn außer Frage, Menschen haben es nur aufgeschrieben. Wie ein Seismograph registriert er die kleinsten Erschütterungen in der Stimmung seiner Kunden. Als Gründe dafür erkennt er nicht nur individuelle Probleme, sondern auch eine entstehende gesellschaftliche Unruhe. »Die Leute sind so aggressiv«, nicht etwa ihm gegenüber, aber in der Art, wie sie über Andere reden.
Das bestätigt sich im Gespräch mit der Witwe des Steinmetzmeisters, die sich in Rage redet. Mit Grabsteinen sei kein Geld mehr zu verdienen. Sie will den Betrieb aufgeben. Bald würden die Leute ihre Toten nur noch in gelben Müllsäcken zum Abholen an den Straßenrand stellen. Da sei nichts mehr geblieben von der Kultur, die sie selbst noch erlebte, als die Familie am Sonntagnachmittag einen Spaziergang zu Opa auf dem Friedhof machte. Beschuldigen will sie niemanden, aber nichts mehr sei übrig von der »alten Art«. Ihr Mann habe immer einen familiären Umgang mit den Kunden gepflegt. Konnten die nur am Sonntag Zeit finden, dann hatte das Vorrang vor der Familie, keine Frage. Jetzt aber gehe die ganze Gesellschaft »den Bach runter«, da sei nichts mehr zu retten. Wer bewahre denn noch irgendwelche Werte?
Viele beklagen die mangelnde Wertschätzung ihrer Tätigkeit, ja, die völlige Unkenntnis davon. Ein Chemiker schwärmt vom ästhetischen Reiz der Moleküle, die er zerlegt und neu zusammenbaut. Ist es möglich, dass die Menschen von dieser Schönheit rein gar nichts ahnen? Ein Schmetterlingsforscher ärgert sich darüber, dass die Leute nur Schmetterlinge und Motten kennen, wo es doch darauf ankomme, die Tagfalter, von denen es nicht so viele Arten gibt, von Klein- und Nachtschmetterlingen zu unterscheiden, deren Arten sehr zahlreich sind. Eine Casting-Direktorin, die sich um die beste Besetzung der Rollen in Filmen kümmert, ist sich sicher, dass ihre Arbeit nur deswegen im Hintergrund bleibt, weil vor allem Frauen sie leisten. Verfügen Frauen, frage ich, vielleicht über mehr Gespür, wer wozu passt? Nein, sagt sie, das sei stereotypes Genderdenken. Eine Ärztin, der ich bei einer Podiumsdiskussion begegne, gewährt Einblicke in ihren Notfall-Alltag, in dem sie »alles schon mal gesehen« hat. Immer wieder kommt sie an ihre Grenzen, aber sie liebt ihre Arbeit sehr und hat ein Buch darüber geschrieben, um nicht übersehen zu werden (Carola Holzner, Eine für alle, 2021).
Der Universitätspräsident meint, dass halt jeder »von seinem eigenen Fach kommt«, soll heißen, ohne Blick für andere Fächer und schon gar nicht für das Ganze. Seine Aufgabe sei es, die vielen Einzel- und Spezialgebiete zu integrieren und auf Eines, eben auf das Unum, auszurichten, das das Wesen der Universität ausmachen sollte. Er selbst sieht seine Institution wahlweise als großen Tanker, der schwer zu manövrieren ist, oder als Geschwader vieler kleiner Boote, von denen jedes für sich allein im weiten Meer navigiert. Wie können sie koordiniert werden? Die Autonomie der Hochschule sei eine große politische Errungenschaft, aber größer sei das Problem, dass jedes Fach und letztlich jedes Ich absolute Autonomie für sich beanspruche. Überall in der Gesellschaft sei das Problem bekannt, aber nicht überall könne es in Win-Win-Situationen aufgelöst werden. Er als Präsident könne nicht etwa, wie alle glauben, ein »Machtwort« sprechen. Da würde er es sich mit einigen, letztlich mit allen dauerhaft verderben. Also versucht er es mit Entgegenkommen, mit Offerten, um mit Deals die Kooperation zu erreichen, die mit Drohungen nie zustande käme.
Jetzt noch ein Besuch bei den Wasserbetrieben. Für die individuelle Lebensführung und für die Gesellschaft als Ganzes werden in Zeiten des Klimawandels Fragen interessant, die in Ländern der gemäßigten Breiten lange keine große Rolle spielten: Woher kommt das Wasser, das tagtäglich gebraucht wird? Was geschieht damit? Wie kann es nach Gebrauch gereinigt werden? Wohin fließt es? Mehr Aufmerksamkeit als je zuvor gilt dem Wasserstand. Manche Regionen trocknen aus, der Grundwasserspiegel sinkt, die Wüste wächst, die Leute bemerken es im eigenen Garten. In anderen Regionen kommt zu viel Wasser am falschen Ort zur falschen Zeit vom Himmel und richtet Verwüstungen an.
Auch die Menschen, die hier arbeiten, freuen sich über das freundliche Interesse. Zu selten, finden sie, wird ihre Arbeit wahrgenommen, geschweige denn gewürdigt. Dabei stellen sie die Wasserversorgung sicher. Sie wissen alles über das Wasser und sorgen sich um die Brunnen, aus denen es sprudelt, die aber nicht verunreinigt werden oder gar trockenfallen dürfen. Eine neue Abteilung, die »Regenwasseragentur«, ist allein dafür da, das kostbare Nass aufzufangen und zu speichern, das die Natur kostenlos anliefert. Die Stadt soll zur »Schwammstadt« werden, statt den Regen wie in alten Zeiten durch die Kanalisation abfließen zu lassen. Der Chef hat die Parole ausgegeben: »Wir müssen gucken, dass wir mehr Pfützen in den Untergrund bekommen.« Versickerung statt Versiegelung, aber der Umbau der Infrastruktur kostet nicht etwa »nur« Millionen, sondern Milliarden.
Am anderen Ende der Wasserbetriebe, im Klärwerk, haben sie mit anderen Problemen zu schaffen. Die Gesellschaft verändert sich, es gibt immer mehr ältere Leute, und die benutzen gerne Feuchttücher, die sie praktischerweise auch gleich im Klo entsorgen. Zusammen mit Haaren und Papiertaschentüchern verstopfen diese Lappen regelmäßig die Anlagen. Junge Frauen wiederum nehmen seltener die Pille, umso häufiger landen Kondome im Abwasser statt im Müll. Etliche Unternehmen überschreiten hier und da Grenzwerte bei den Einträgen von Chemikalien. Und die Menschen trinken, ziehen Kokainlines, werden krank, schlucken Medizin, gehen auf die Toilette und wenig später kommt es im Klärwerk zum Vorschein: Wo werden besonders viele Antibiotika eingesetzt? Welche Hormone werden weggespült? Wie hoch ist der Alkoholpegel aktuell? Wann werden in welchem Stadtteil welche Drogen konsumiert? Die messbaren Rückstände erlauben Rückschlüsse.
Klärwerke klären über die Zustände in der Gesellschaft auf, wer hätte das gedacht! Was auch immer ins Abwasser gelangt, lässt sich rückverfolgen, wenngleich nicht bis in die einzelne Wohnung. Zur Zeit der Corona-Pandemie konnten Sequenzierungsdaten aus den Abwässern die Infektionsraten liefern, die anderweitig nicht so schnell und so präzise feststellbar waren. Wo und in welcher Menge waren die Viren und ihre Varianten unterwegs? Bedenkliche Virusvarianten wurden entdeckt, bevor sie klinisch erfasst werden konnten. Das Abwasser des Flughafens verriet, ob Ankommende eine erhöhte Virenlast mitbrachten. Zwar ist die Brühe trüb, aber die darin enthaltene Datenmenge beachtlich. Abwasser ist ein Frühwarnsystem. Es muss nur genutzt werden. Und vor allem gesäubert.
Die Reinigung erfolgt mehrstufig, erst mechanisch, dann biochemisch. Phosphor-, Stickstoff- und andere Verbindungen werden durch Ozon und Mikroorganismen abgebaut. Eisenchlorid sorgt für die »Flockungsfiltration«, mit der sich Schadstoffe entfernen lassen. Schließlich wird das Wasser mit UV-Strahlung desinfiziert. Auch besonders problematische Spuren von Süßstoffen, Wirkstoffen der Medizin, Beschichtungen von Baustoffen und Zusätzen aus Reinigungsmitteln lassen sich so angehen. Klärwerke klären, danach handelt es sich um Klarwasser. Jedenfalls relativ klar, denn ähnlich wie bei vielen Lebenssituationen lässt sich nicht alles klären. »Kein Prozess ist perfekt.« Einiges kehrt in den Wasserkreislauf zurück, das ihm besser fernbliebe, etwa »ewige Chemikalien«, die nicht abbaubar sind, sondern sich nur noch weiter anreichern. Hormone gehen ins Grundwasser über und rinnen im Trinkwasser wieder aus dem Wasserhahn. Betätige nicht auch ich die Toilettenspülung gerade dann gedankenlos, wenn ich in Gedanken bin? In jeder Hinsicht wäre es gut, ab und zu einen Blick über die eigene Blase im Wortsinne hinaus zu wagen. Mehr als nur das eigene Bächlein zu sehen, kann die alltägliche Sorge des Einzelnen für eine Gesellschaft im Fluss sein.
Wer gehört dazu? Die feinen und unfeinen Unterschiede
Zurück zum Anfang. Der Bus hat mich zum geselligen Anlass gebracht. Kann ich mich setzen? Alle Anderen stehen noch. Worauf warten sie? Es scheint eine geheime Verabredung zu geben, einen Code, jede und jeder kennt ihn. Außer mir. Nicht das Sein, sondern der spezielle Modus des Seins, setzen oder nicht setzen, das ist hier die Frage. Ich hasse Codes und setze mich. Andere tun es mir gleich, erleichtert, wie sie bekunden, dass endlich einer mit den starren Regeln bricht. »Sie dürfen das«, flüstert mir meine Sitznachbarin zu. »Sie sind Professor.« Also quasi verrückt von Amts wegen. Auch das ist offenbar ein Teil des Codes. Meinetwegen, wenn es uns weiterbringt …
Eine Steigerung der Verrücktheit wäre möglich gewesen, aber den zugehörigen Fehltritt, den Fauxpas