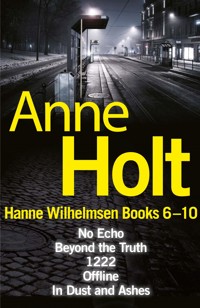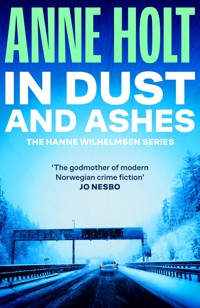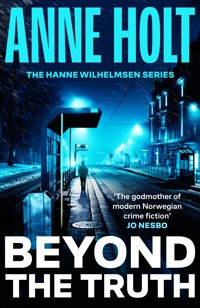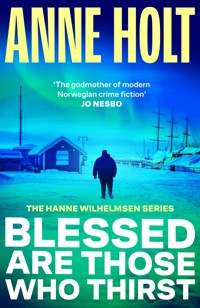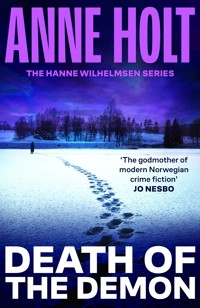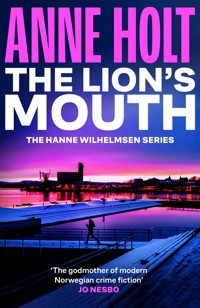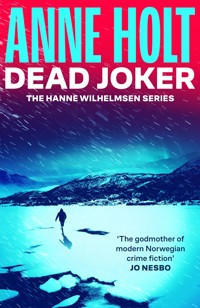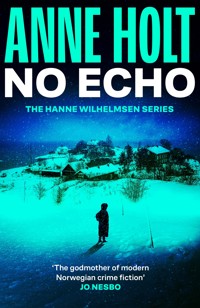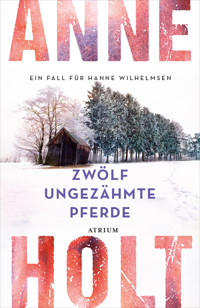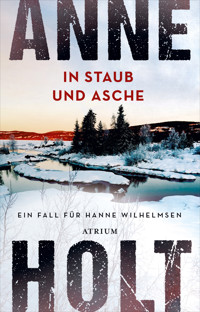11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atrium Verlag AG
- Kategorie: Krimi
- Serie: Hanne-Wilhelmsen-Reihe
- Sprache: Deutsch
Mord à la carte Hanne Wilhelmsen ist nach dem tragischen Tod ihrer Lebensgefährtin wieder nach Oslo zurückgekehrt. Ein neuer Fall stellt sie und Billy T. vor Rätsel: Wer hat den Osloer Starkoch Brede Ziegler mit einem japanischen Messer erstochen? Ging es um Eifersucht oder Habgier? Nach und nach rücken immer mehr Verdächtige ins Visier, denn der Restaurantchef scheint nicht überall beliebt gewesen zu sein. Auch Hanne hat seit ihrer Rückkehr mit Ablehnung zu kämpfen und setzt alles daran, diesen Fall zu lösen. Denn ihre Kollegen stehen kurz davor, einen verhängnisvollen Fehler zu begehen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 522
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Anne Holt
Das letzte Mahl
Hanne Wilhelmsens sechster Fall
Aus dem Norwegischen von Gabriele Haefs
Die deutsche Erstausgabe erschien 2003 im Piper Verlag, München.
This translation has originally been published with the financial support of NORLA, Norwegian Literature Abroad
© Atrium Verlag AG, Zürich, 2024
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © Anne Holt und Berit Reiss-Andersen 2000
Die Originalausgabe erschien 1997 unter dem Titel Uten ekko bei Cappelens Forlag, Oslo.
Für die vorliegende Ausgabe wurde die deutsche Übersetzung von der Übersetzerin überarbeitet.
Published by agreement with Salomonsson Agency
Covergestaltung: zero-media.net, München
Covermotiv: Stocksy/Guille Faingold
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
ISBN978-3-03792-215-6
www.atrium-verlag.com
www.facebook.com/atriumverlag
www.instagram.com/atriumverlag
1
An ihren richtigen Namen konnte Harrymarry sich kaum erinnern. Sie war im Januar 1945 auf der Ladefläche eines alten Lastwagens zur Welt gekommen. Ihre Mutter war eine sechzehnjährige Waise gewesen. Neun Monate zuvor hatte sie sich für zwei Päckchen Zigaretten und eine Tafel Schokolade an einen deutschen Soldaten verkauft. Und dann war sie nach Tromsø unterwegs gewesen. Finnmark brannte. Das Kind hatte sich bei zweiundzwanzig Grad unter null herausgeschoben, war in eine mottenzerfressene Wolldecke gewickelt und dann einem Ehepaar aus Kirkenes überlassen worden. Dieses Ehepaar war die Straße entlanggekommen und hatte kaum gewusst, wie ihm geschah, als der Lastwagen mit der Sechzehnjährigen auch schon weiterfuhr. Die zwei Stunden alte Kleine hatte von ihrer biologischen Mutter nichts mitbekommen als ihren Namen. Marry. Mit zwei r. Und darauf hatte sie immer großen Wert gelegt.
Der Familie aus Kirkenes gelang es unglaublicherweise, den Säugling am Leben zu erhalten. Marry blieb anderthalb Jahre bei ihnen. Mit zehn hatte sie bereits vier weitere Pflegefamilien hinter sich gebracht. Marry hatte ein helles Köpfchen, ein ausnehmend wenig hübsches Äußeres und war außerdem von Geburt an behindert. Sie hinkte. Bei jedem Schritt mit dem rechten Bein beschrieb ihr Körper eine halbe Drehung, als habe sie Angst, verfolgt zu werden. Doch während es ihr schwerfallen mochte, sich fortzubewegen, funktionierte ihr Mundwerk umso besser. Nach zwei kriegerischen Jahren in einem Kinderheim in Fredrikstad war Marry nach Oslo gegangen, um ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Da war sie zwölf Jahre alt gewesen.
Und Harrymarry hatte ihr Leben wahrlich selbst in die Hand genommen.
Jetzt war sie Oslos älteste Straßennutte.
Sie war eine bemerkenswerte Frau, und das in mehr als nur einer Hinsicht. Vielleicht besaß sie ein halsstarriges Gen, das ihr geholfen hatte, fast ein halbes Jahrhundert in diesem Gewerbe zu überleben. Vielleicht hatte sie das auch aus purem Trotz geschafft. Während der ersten fünfzehn Jahre hatte der Alkohol sie auf den Beinen gehalten. 1972 war sie dann ans Heroin geraten. Da sie schon so alt war, hatte sie damals zu den ersten norwegischen Junkies gehört, denen Methadon angeboten wurde.
»Fissu spät«, hatte Harrymarry gesagt und war weitergehinkt.
Zu Beginn der Siebzigerjahre hatte sie zum ersten und zum letzten Mal mit dem Sozialamt zu tun gehabt. Sie brauchte Essensgeld, nachdem sie sechzehn Tage gehungert hatte. Einige Kronen nur, weil sie immer wieder ohnmächtig wurde. Das war nicht gut fürs Geschäft. Der Canossagang von einem Sachbearbeiter zum anderen endete mit dem Angebot einer dreitägigen Ausnüchterungskur und führte dazu, dass sie nie wieder einen Fuß in ein Sozialamt setzte. Selbst als ihr 1992 eine Rente bewilligt wurde, wurde das alles vom Arzt geregelt. Der Doktor war in Ordnung. Er war genauso alt wie sie und hatte nie ein böses Wort gesagt, wenn sie mit einem Abszess oder Frostbeulen zu ihm gekommen war. Die eine oder andere Geschlechtskrankheit hatte sich im Laufe der Jahre auch eingestellt, aber deswegen hatte er nicht weniger herzlich gelächelt, wenn sie in seine warme Praxis am Schous plass gehumpelt kam. Die Rente reichte gerade für Miete, Strom und Kabelfernsehen. Das Geld vom Straßenverkauf brauchte sie für die Drogen. Harrymarry hatte nie einen Wirtschaftsplan aufgestellt. Wenn ihr Leben zu sehr durcheinandergeriet, vergaß sie die Rechnungen. Der Gerichtsvollzieher kam. Sie war nie zu Hause, erhob nie Einspruch. Ihre Tür wurde versiegelt, ihre Habseligkeiten wurden entfernt. Eine neue Wohnung zu finden war nicht leicht. Und deshalb war sie für ein oder zwei Winter in eine Notunterkunft gezogen.
Sie war erschöpft, durch und durch erschöpft. Die Nacht war beißend kalt. Harrymarry trug einen rosa Minirock, zerrissene Netzstrümpfe und eine hüftlange Silberlaméjacke. Sie versuchte, ihre Kleider fester um sich zu ziehen. Das half nicht viel. Irgendwo musste sie Zuflucht suchen. Das Nachtasyl der Stadtmission war immer noch die beste Alternative. Dort hatten Leute unter Drogen- oder Alkoholeinfluss zwar keinen Zutritt, aber Harrymarry war seit so vielen Jahren auf der Piste, dass niemand ihr ansah, ob sie nüchtern war oder nicht.
Bei der Wache bog sie nach rechts ab.
Der Park hinter dem geschwungenen Gebäude in Grønlandsleiret 44 war Harrymarrys Freistätte. Die guten Bürger ließen sich dort nicht blicken. Nachmittags war der eine oder andere Kanacke mit Frau und einer Unmenge von Kindern da, wobei die Kinder Fußball spielten und verängstigt kicherten, wenn Harrymarry auf sie zukam. Die Säufer hier waren von der redlichen Sorte. Die Bullerei störte auch nicht weiter, die hatte längst aufgehört, eine ehrliche Hure zu schikanieren.
In dieser Nacht war der Park leer. Harrymarry schlurfte aus dem Lichtkegel des Scheinwerfers, der über dem Eingang zum alten Gefängnis hing. Den ehrlich verdienten Schuss für die Nacht hatte sie in der Tasche. Sie brauchte nur noch einen Ort, wo sie ihn setzen konnte. Auf der Nordseite der Wache lag ihre Treppe. Die war nicht beleuchtet und wurde nie benutzt.
»Verdammt. Scheiße.«
Jemand hatte sich auf ihrer Treppe breitgemacht.
Hier hatte sie warten wollen, bis das Heroin ihren Körper ins Gleichgewicht brachte. Die Treppe auf der Rückseite der Wache, einen Katzensprung von der Gefängnismauer entfernt, war ihre Treppe. Und jetzt hatte sich da jemand breitgemacht.
»He! Du!«
Der Mann schien sie nicht gehört zu haben. Sie stolperte näher. Ihre hohen Absätze bohrten sich in verfaultes Laub und Hundekacke. Der Mann schlief wie ein Stein.
Vielleicht sah er ja gut aus. Das konnte sie nicht sagen, selbst dann nicht, als sie sich über ihn beugte. Es war zu dunkel. Aus seiner Brust ragte ein riesiges Messer.
Harrymarry war ein praktisch veranlagter Mensch. Sie stieg über den Mann hinweg, setzte sich auf die oberste Treppenstufe und fischte ihre Spritze aus der Tasche. Das gute warme Gefühl der Notwendigkeit stellte sich ein, noch ehe sie die Nadel herausgezogen hatte.
Der Mann war tot. Ermordet vermutlich. Er war nicht das erste Mordopfer, das Harrymarry sah, aber das am edelsten bekleidete. Sicher ein Überfall. Raubüberfall. Oder vielleicht war dieser Mann ein Schwuler, der sich bei den Jungen, die sich für fünfmal soviel verkauften, wie eine Runde Lutschen bei Harrymarry kostete, zu große Freiheiten herausgenommen hatte.
Sie erhob sich mühsam, schwankte leicht. Einen Moment lang blieb sie stehen und musterte die Leiche. Der Mann trug einen Handschuh. Der Handschuhzwilling lag daneben. Ohne nennenswertes Zögern bückte Harrymarry sich und griff nach den Handschuhen. Sie waren ihr zu groß, aber aus echtem Leder und mit Wolle gefüttert. Der Mann brauchte sie ja nun nicht mehr. Sie zog sie an und machte sich auf den Weg zum letzten Bus, der zum Nachtasyl fuhr.
Einige Meter von der Leiche entfernt lag ein Schal. Harrymarry hatte an diesem Abend wirklich Glück. Sie wickelte sich den Schal um den Hals. Ob es an den neuen Kleidern lag oder am Heroin, wusste sie nicht. Jedenfalls fror sie nicht mehr so schrecklich. Vielleicht sollte sie sich ein Taxi gönnen. Und vielleicht sollte sie die Polizei anrufen und sagen, dass auf dem Hinterhof der Wache eine Leiche lag.
Das Wichtigste aber war, ein Bett zu finden. Ihr fiel nicht ein, welcher Wochentag war, und sie brauchte Schlaf.
2
Maria, Mutter Jesu.
Das Bild über dem Bett erinnerte an alte Glanzbilder. Ein frommes Gesicht, der Blick auf zum Gebet gefaltete Hände gesenkt. Der Heiligenschein war längst zu einer vagen Staubwolke verblasst.
Als Hanne Wilhelmsen die Augen öffnete, ging ihr auf, dass die sanften Züge, der schmale Nasenrücken und die dunklen, straff in der Mitte gescheitelten Haare sie die ganze Zeit irregeführt hatten. Jesus höchstselbst wachte seit fast einem halben Jahr Nacht für Nacht über sie.
Ein Streifen Morgenlicht traf Mariens Sohn an der Schulter. Hanne setzte sich auf. Sie kniff die Augen zusammen und sah zu, wie die Sonne sich durch den Vorhangspalt kämpfte. Dann griff sie sich ins Kreuz und fragte sich, warum sie quer im Bett lag. Sie konnte sich nicht erinnern, wann sie zuletzt eine ganze Nacht durchgeschlafen hatte.
Die kalten Steinfliesen unter ihren Füßen ließen sie aufkeuchen. In der Badezimmertür drehte sie sich um, um das Bild noch einmal zu betrachten. Ihr Blick fegte über den Boden und verharrte.
Der Badezimmerboden war blau. Das war ihr noch nie aufgefallen. Sie hielt sich den gekrümmten Zeigefinger vor ein Auge und starrte mit dem anderen auf die Fliesen.
Seit Mittsommer wohnte Hanne Wilhelmsen in dem spartanischen Zimmer in der Villa Monasteria. Jetzt ging es auf Weihnachten zu. Die Tage waren braun gewesen, denn in dem großen Steingebäude und seiner Umgebung fehlte jegliche andere Farbe. Selbst im Sommer hatte es in der Valpolicella-Landschaft vor dem riesigen Fenster im ersten Stock keine wirkliche Farbe gegeben. Die Weinranken hatten sich an gelbbraune Stöcke geklammert, das Gras sonnenverbrannt vor den Mauern gelegen.
Ein kalter Dezemberwind schlug ihr entgegen, als sie eine halbe Stunde später die Doppeltür zum mit Kies bestreuten Innenhof der Villa Monasteria öffnete. Ohne eigentliches Ziel schlenderte sie zum Bambuswald auf der anderen Seite hinüber, vielleicht zwanzig Meter waren das. Auf dem Weg, der den Wald teilte, standen zwei eifrig in ein Gespräch vertiefte Nonnen. Ihre Stimmen wurden leiser, als Hanne näher kam. Und als sie an den beiden älteren, grau gekleideten Frauen vorüberging, senkten diese die Köpfe und verstummten.
Auf der einen Seite des Weges war der Wald schwarz, auf der anderen hatten die Stämme eine grünliche Färbung. Die Nonnen waren verschwunden, als Hanne sich umschaute und wieder einmal darüber nachdachte, wie dieser farbliche Unterschied zwischen den daumendicken Pflanzen zu beiden Seiten des Weges zu erklären sein mochte. Sie hatte die vertrauten schlurfenden Schritte über den Kiesboden nicht wahrgenommen. Für einen Moment fragte sie sich, wo die Nonnen geblieben sein mochten, dann fuhr sie mit den Fingern über einen Bambusstamm und ging weiter zum Karpfenteich.
Irgendetwas ging hier vor sich. Irgendetwas stand bevor.
In der ersten Zeit waren die Nonnen freundlich gewesen. Nicht besonders redselig, natürlich, die Villa Monasteria war eine Stätte der Kontemplation und des Schweigens. Ab und zu ein kurzes Lächeln, bei den Mahlzeiten vielleicht, ein fragender Blick über Händen, die gern Wein nachschenkten, das eine oder andere freundliche Wort, das Hanne nicht verstand. Im August hatte sie kurz mit dem Gedanken gespielt, ihren Aufenthalt hier zu nutzen, um Italienisch zu lernen. Dann hatte sie diesen Plan wieder aufgegeben. Sie war nicht zum Lernen hergekommen.
Irgendwann hatten die Nonnen begriffen, dass Hanne einfach in Ruhe gelassen werden wollte. Auch der smarte Direktor hatte das eingesehen. Alle drei Wochen nahm er ihr Geld entgegen und sagte dazu nur ein nüchternes »Grazie«. Die lustigen Studentinnen aus Verona, die ab und zu so laut Musik laufen ließen, dass die Nonnen schon nach wenigen Minuten angerannt kamen, hatten Hanne für eine Gleichgesinnte gehalten. Allerdings nur zu Anfang.
Hanne Wilhelmsen hatte ein halbes Jahr damit verbracht, ganz allein zu sein.
Die meiste Zeit hatte sie ihren täglichen Kampf darum, sich mit gar nichts zu befassen, in Ruhe ausfechten können. In der letzten Zeit jedoch hatte sie ihre Neugier nicht mehr gegen die Tatsache abschotten können, dass in der Villa Monasteria offenbar etwas vor sich ging. Il direttore, ein schlanker, allgegenwärtiger Mann von Mitte vierzig, hob immer häufiger die Stimme, wenn er mit den nervös flüsternden Nonnen sprach. Seine Schritte knallten härter über den Steinboden als früher. Er eilte von einer rätselhaften Tätigkeit zur anderen, tadellos gekleidet, eingehüllt in eine Wolke aus Schweiß und Rasierwasser. Die Nonnen lächelten nicht mehr, und immer weniger von ihnen fanden sich zu den Mahlzeiten ein. Zum Ausgleich waren sie immer häufiger im stillen Gebet auf den Holzbänken der kleinen Kapelle aus dem vierzehnten Jahrhundert anzutreffen, auch dann, wenn keine Messe war. Hanne konnte von ihrem Fenster aus sehen, wie sie zu zweien durch die klobigen Holztüren schlüpften.
Es war schwer auszumachen, wie tief der Karpfenteich war. Das Wasser war unnatürlich klar. Die trägen Bewegungen der Fische über dem Boden wirkten abstoßend, und Hanne empfand einen Anflug von Übelkeit bei dem Gedanken, dass sie durch das Trinkwasser des Klosters schwammen.
Sie setzte sich auf die Mauer, die den Teich umgab. Schwere Eichen zeichneten sich halb nackt vor dem vorweihnachtlichen Himmel ab. Am Hang im Norden weidete eine Schafherde. In der Ferne bellte ein Hund, und die Schafe drängten sich aneinander.
Hanne hatte Heimweh.
Es gab nichts, wonach sie Heimweh hätte haben können. Aber es war etwas passiert. Sie wusste nicht, was, und sie wusste nicht, warum. Ihre Sinne, träge geworden durch einen bewussten Prozess, der sich über viele Monate hingezogen hatte, schienen sich die aufgezwungene Muße nicht mehr gefallen zu lassen. Sie hatte angefangen, Dinge zu registrieren.
Cecilie Vibes Tod lag ein halbes Jahr zurück. Hanne war nicht einmal zur Beerdigung der Frau gegangen, mit der sie fast zwanzig Jahre lang zusammengelebt hatte. Sie hatte sich in ihrer Wohnung eingeschlossen. Vage hatte sie registriert, dass alle sie in Ruhe ließen. Niemand klingelte. Niemand steckte den Schlüssel ins Schloss. Das Telefon blieb stumm. Im Briefkasten lagen nur Reklame und Rechnungen. Und später eine Mitteilung einer Versicherungsgesellschaft. Hanne hatte nichts von der Lebensversicherung gewusst, die Cecilie viele Jahre zuvor zu ihren Gunsten abgeschlossen hatte. Sie rief bei der Versicherung an, ließ das Geld auf ein hoch verzinstes Konto überweisen, schrieb dem Polizeidirektor und bat, für den Rest des Jahres beurlaubt zu werden. Sollte das nicht möglich sein, fügte sie hinzu, sei ihr Brief als Kündigung zu betrachten.
Sie hatte die Antwort nicht abgewartet, sondern ihren Rucksack gepackt und sich in den Zug nach Kopenhagen gesetzt. Streng genommen war ihr nicht klar, ob sie noch einen Arbeitsplatz hatte, aber das interessierte sie auch nicht, in diesem Moment nicht. Sie wusste nicht, wo sie hinwollte oder wie lange sie unterwegs sein würde. Nachdem sie zwei Wochen ziellos durch Europa gefahren war, hatte sie die Villa Monasteria gefunden, ein heruntergekommenes Klosterhotel in den Bergen nördlich von Verona. Was die Nonnen ihr anbieten konnten, waren Stille und selbst gemachter Wein. Sie war an einem späten Juliabend angekommen und hatte am nächsten Morgen weiterreisen wollen.
Im Teich gab es auch Krebse. Sehr kleine zwar, aber einwandfrei Krebse; durchsichtig und ruckhaft flohen sie vor den trägen Karpfen. Hanne Wilhelmsen hatte noch nie von Süßwasserkrebsen gehört. Sie schniefte, wischte sich mit dem Jackenärmel die Nase und folgte il direttore mit den Augen durch die Allee. Eine Gruppe von Frauen in grauer Tracht stand unter einer Pappel und starrte zu ihr herüber. Trotz der Entfernung konnte sie die Blicke förmlich spüren, scharf wie Messer in der vom Tau feuchten Luft. Als der Wagen des Direktors auf der Hauptstraße verschwand, fuhren die Nonnen herum und liefen in die Villa Monasteria, ohne sich noch einmal umzusehen. Hanne erhob sich von der Mauer. Ihr war kalt, aber sie fühlte sich ausgeruht. Ein großer Rabe zog unter der Wolkendecke seine ovalen Runden und ließ sie erschauern.
Es war Zeit, nach Hause zu fahren.
3
Der Verlag gehörte zu den drei größten des Landes. Trotzdem befand sich der unscheinbare Eingang eingeklemmt in einer Seitenstraße des ungastlichsten Viertels der Stadt. Die Büros waren klein und sahen alle gleich aus. An den Wänden hing keine Verlagssaga, es gab weder dunkle Möbel noch edle Teppiche. An den Glaswänden, die die Bürozellen von den ewig langen Fluren abteilten, hingen Zeitungsausschnitte und Plakate; sie zeugten von einem Gedächtnis, das nur wenige Jahre zurückreichte.
Der Konferenzraum der Belletristikabteilung lag im zweiten Stock und hatte Ähnlichkeit mit dem Pausenzimmer eines Sozialamtes. Der helle Furniertisch war von schlichtestem Bürostandard, die Sessel mit ihren orangen Bezügen gehörten in die Siebzigerjahre. Es war der älteste Verlag Norwegens, gegründet 1829. Das Haus hatte eine Geschichte. Eine gewichtige literarische Geschichte. Dennoch sahen die meisten der Bücher in den billigen IKEA-Regalen wie Kioskromane aus. Eine zufällige Auswahl an Herbstnovitäten drohte jederzeit umzukippen und auf den hellgelben Linoleumboden zu klatschen.
Idun Franck starrte mit leerem Blick Ambjørnsens viertes Elling-Buch an. Jemand hatte es auf den Kopf gestellt, und der Umschlag war zerrissen.
»Idun?«
Der Verlagsleiter hob die Stimme. Die fünf anderen wandten ihre ausdruckslosen Gesichter Idun Franck zu.
»Verzeihung …« Sie blätterte ziellos in den Papieren, die vor ihr lagen, und machte sich an einem Kugelschreiber zu schaffen. »Die Frage ist streng genommen wohl weniger, wie viel dieses Projekt uns schon gekostet hat, sondern vielmehr, ob das Buch überhaupt erscheinen kann. Das wäre eine ethische Entscheidung, abhängig von … Können wir ein Kochbuch herausgeben, wenn der Koch soeben mit einem Schlachtermesser erstochen worden ist?«
Die anderen schienen nicht so recht zu wissen, ob Idun Franck einen Witz machte. Einer kicherte kurz. Verstummte aber sofort wieder und starrte errötend die Tischplatte an.
»Wir wissen ja nicht, ob es sich um ein Schlachtermesser handelt«, fügte Idun Franck hinzu. »Aber dass er erstochen worden ist, stimmt offenbar. So steht’s in den Zeitungen. Auf jeden Fall könnte es als ziemlich geschmacklos aufgefasst werden, kurz nach so einem blutigen Mord ein Porträt des Ermordeten und seiner Küche herauszubringen.«
»Und geschmacklos wollen wir doch nicht sein. Hier ist schließlich die Rede von einem Kochbuch«, sagte Frederik Krøger und zeigte seine Zähne.
»Also echt«, murmelte Samir Zeta, ein junger Mann, der drei Wochen zuvor im Vertrieb angefangen hatte.
Krøger, der untersetzte Verlagsleiter mit dem kahlen Schädel, den er unter auf bewundernswerte Weise arrangierten Haarsträhnen zu verbergen suchte, machte eine bedauernde Handbewegung.
»Wenn wir für einen Moment zurückgehen und uns die eigentliche Idee ansehen«, fuhr Idun Franck fort, »zeigt sich doch, dass wir definitiv auf einem guten Weg waren. Zu einer Weiterentwicklung des Kochbuchtrends sozusagen. Einer Art kulinarischer Biografie. Einer Mischung aus Kochbuch und persönlichem Porträt. Da Brede Ziegler seit mehreren Jahren der beste …«
»Auf jeden Fall der profilierteste«, fiel Samir Zeta ihr ins Wort.
»… der profilierteste norwegische Koch war, sind wir bei diesem Projekt natürlich auf ihn gekommen. Und wir waren mit der Sache schon ziemlich weit.«
»Wie weit?«
Idun Franck wusste sehr gut, was Frederik Krøger wirklich interessierte. Nämlich, wie viel das Projekt bereits gekostet hatte. Wie viel Geld der Verlag für ein Projekt, das bestenfalls für eine ganze Weile auf Eis gelegt werden musste, schon aus dem Fenster geworfen hatte.
»Die allermeisten Bilder haben wir schon. Die Rezepte auch. Was Brede Zieglers Leben und Person angeht, ist allerdings noch eine Menge Arbeit zu leisten. Er wollte sich zunächst auf die Rezepte konzentrieren; die Anekdoten und Betrachtungen, die mit den einzelnen Gerichten verknüpft sind, wollten wir uns später vornehmen. Wir haben natürlich viele Gespräche geführt, und ich habe … Notizen, zwei Tonbänder und so weiter. Aber … so, wie ich das heute sehe … kannst du mir mal die Kanne geben?«
Sie versuchte, Kaffee in eine henkellose Tasse mit Teletubbies-Bild zu gießen. Die Hand zitterte, vielleicht war die Thermoskanne einfach zu schwer. Kaffee floss über die Tischplatte. Jemand reichte ihr ein Stück unbeschriebenes Papier. Als sie die Kaffeelache damit bedeckte, quoll die braune Flüssigkeit an den Seiten hervor und tropfte über die Tischkante auf ihr Hosenbein.
»Also so was … Wir könnten natürlich aus dem vorhandenen Material ein ganz normales Kochbuch machen. Eins unter vielen. Es sind wirklich schöne Bilder. Und tolle Rezepte. Aber wollen wir das? Meine Antwort lautet …«
»Nein«, sagte Samir Zeta, der sich schon ein bisschen zu gut eingelebt hatte.
Frederik Krøger runzelte die Stirn und hüstelte.
»Bitte, schreib das alles auf, Idun. Und dann werde ich … mit Zahlen und allem. Danach sehen wir weiter. In Ordnung?«
Niemand wartete die Antwort ab. Stuhlbeine schrammten über den Boden, und eilig verließen die Leute den Konferenzraum. Nur Idun blieb sitzen und starrte auf das Schwarz-Weiß-Foto eines Kabeljaukopfes.
»Hab dich gestern im Kino gesehen«, hörte sie jemanden sagen und schaute auf.
»Was?«
Samir Zeta lächelte und fuhr mit der Hand über den Türrahmen. »Du hattest es eilig. Was sagst du?«
»Was ich sage?«
»Über den Film. Shakespeare in Love!«
Idun hob die Tasse zum Mund und schluckte.
»Ach. Der Film. Hat mir gefallen.«
»Für mich war’s ein wenig zu viel Theater. Film sollte Film sein, finde ich. Auch wenn sie Kostüme aus dem 16. Jahrhundert tragen, müssen sie doch nicht so reden.«
Idun Franck stellte die Teletubby-Tasse auf den Tisch, stand auf und wischte vergeblich an dem dunklen Flecken auf ihrem Oberschenkel herum. Dann schaute sie auf, lächelte kurz und fegte Papier und Fotos zusammen, ohne auf den Kaffee zu achten, der zwei große Farbbilder von Fenchel und Lauchzwiebeln zusammenkleben ließ.
»Mir hat der Film sehr gut gefallen«, sagte sie. »Er war … warm. Liebevoll. Bunt.«
»Romantisch«, kicherte Samir. »Du bist eine hoffnungslose Romantikerin, Idun.«
»Bin ich überhaupt nicht«, erwiderte Idun Franck und schloss ruhig die Tür hinter sich. »Obwohl mir das in meinem Alter auf jeden Fall zustünde.«
4
Billy T. war fasziniert. Er hielt sein Glas ins Licht und betrachtete einen rubinroten Punkt, der in zerstoßenes rosa Eis eingeschossen war, Russian Slush war bei Weitem nicht das köstlichste Getränk, das er kannte. Aber es sah gut aus. Er drehte das Glas im Licht des Kronleuchters und kniff die Augen zusammen.
»Entschuldigung …« Billy T. streckte die Hand nach einem Kellner in blauer Hose und kreideweißem, kragenlosem Hemd aus. »Was ist das hier eigentlich?«
»Russian Slush?« Der Kellner verzog einen Mundwinkel fast unmerklich, als wage er nicht so recht, das Lächeln zu erwidern. »Zerstoßenes Eis, Wodka und Preiselbeeren, der Herr.«
»Ach. Danke.«
Billy T. trank, obwohl er streng genommen im Dienst war. Er hatte nicht vor, die Rechnung der Spesenkasse zu präsentieren; es war Montag, der 6. Dezember, sieben Uhr abends, und ihm war alles schnurz. Er saß da und spielte mit dem Glas, während er seine Blicke durch das Lokal schweifen ließ.
Das Entré war im Moment ganz einfach angesagt.
Billy T. war in Grünerløkka geboren und aufgewachsen. In einer Zweizimmerwohnung im Fossevei hatte seine Mutter ihn und seine drei Jahre ältere Schwester durchgebracht, indem sie sich in einer Wäscherei ein Stück die Straße hoch abplackte und nachts durch Flickarbeiten noch etwas dazuverdiente. Seinen Vater hatte Billy T. nie kennengelernt. Noch immer wusste er nicht, ob der Mann sich einfach davongemacht hatte oder ob er von der Mutter noch vor der Geburt des Sohnes vor die Tür gesetzt worden war. Jedenfalls war der Vater nie erwähnt worden. Das Einzige, was Billy T. über ihn wusste, war, dass er auf Socken zwei Meter gemessen hatte und ein begnadeter, wenn auch durch und durch alkoholisierter Frauenheld gewesen war. Was vermutlich zu einem ziemlich frühen Tod geführt hatte. Billy T. hatte die vage Erinnerung, dass seine Mutter eines Tages überraschend früh von der Arbeit gekommen war. Er mochte damals so um die sieben gewesen sein, und wegen einer kräftigen Erkältung war er an jenem Tag nicht in die Schule gegangen.
»Er ist tot«, hatte die Mutter gesagt. »Du weißt schon, wer.«
Ihre Augen hatten jegliche Frage untersagt. Sie war ins Bett gegangen und erst am nächsten Morgen wieder aufgestanden.
In der Wohnung im Fossevei hatte es nur ein Bild des Vaters gegeben; ein Hochzeitsbild der Eltern, das aus irgendwelchen Gründen an der Wand hängen blieb. Billy T. hatte den Verdacht, dass seine Mutter es als Beweis dafür nutzen wollte, dass die Kinder ehelich geboren waren – sollte jemand die Unverschämtheit besitzen, daran zu zweifeln. Wer auch immer einen Fuß in die überfüllte Wohnung setzte, erblickte als Erstes das Hochzeitsbild. Bis zu dem Tag, an dem Billy T. in strammer Uniform nach Hause zurückkehrte, nachdem er sein Examen an jener Institution bestanden hatte, die damals Polizeischule genannt wurde. Er war den ganzen Weg gerannt. Unter dem Kunstfasergewebe brach ihm der Schweiß aus. Seine Mutter legte ihre dünnen Arme um seinen Hals und wollte ihn gar nicht mehr loslassen. Im Wohnzimmer saß seine Schwester und öffnete lachend eine Flasche billigen Sekt. Sie hatte zwei Jahre zuvor ihr Examen als Krankenschwester abgelegt. Noch am selben Tag wurde das Hochzeitsbild von der Wand genommen.
Billy T. hatte erst mit dreißig angefangen, Alkohol zu mögen.
Inzwischen war er vierzig, und noch immer konnten Wochen vergehen, in denen er nur Cola und Milch trank.
Seine Mutter wohnte nach wie vor im Fossevei. Seine Schwester war mit ihrem Mann und inzwischen drei Kindern nach Asker gezogen, Billy T. dagegen war in Grünerløkka geblieben. Er hatte seit Beginn der Sechzigerjahre das ganze Auf und Ab im Stadtteil miterlebt. Er war mit einem Plumpsklo groß geworden und erinnerte sich an den Tag, an dem die Mutter, stolz und den Tränen nahe, mit der Hand über ein in einer ehemaligen Abstellkammer frisch installiertes Wasserklosett gestrichen hatte. Er hatte zugesehen, wie die Stadtsanierung in den Achtzigern den sozialen Wohnungsbau in der Gegend abgewürgt hatte, er hatte Trends und Moden kommen und gehen sehen wie Zugvögel auf Kuba.
Billy T.s Liebe zu Grünerløkka war keinem Trend unterworfen. Er war nicht frisch verliebt in die winzigen, überfüllten Bars und Cafés in der Thorvald Meyers gate. Billy T. lebte am Rande der Løkka-Gemeinschaft, wie sie sich während der vergangenen vier oder fünf Jahre herausgebildet hatte. Und deshalb fühlte er sich alt. Nie war er im Sult gewesen, um eine Stunde auf einen Tisch zu warten. In der Bar Boca, in die er sich einmal getraut hatte, um ein Glas Cola zu trinken, hatten ihm nach einigen klaustrophobischen Minuten am Tresen die Augen gebrannt. Billy T. ging lieber mit seinen Kindern zu McDonald’s gegenüber. Die Welt vor den Fenstern war zu etwas geworden, das ihn nichts anging.
Billy T.s Liebe zu Grünerløkka machte sich an den Gebäuden fest. An den Häusern, ganz einfach, den alten Mietskasernen. Unterhalb der Grüners gate standen sie auf Lehmboden, und ihre Fassaden waren von Rissen durchzogen. Als Kind hatte er geglaubt, die Häuser hätten Falten, weil sie so alt waren. Er liebte die Straßen, vor allem die kleinen. Die Bergverksgate war nur einige Meter lang und endete am Hang vor dem Akerselv. Die Strömung kann dich mitreißen, erinnerte er sich; du darfst nicht baden, die Strömung kann dich mitreißen. Jeden Sommer hatte ein roter Ausschlag seine Haut bedeckt. Seine Mutter hatte geklagt und geschimpft und mit wütenden Bewegungen seinen Rücken mit Salbe eingerieben. Trotzdem war er am nächsten Tag wieder in das verschmutzte Wasser gesprungen. Sommer für Sommer. Für ihn waren das großartige Ferien gewesen.
Das Entré lag an der Südwestecke der Kreuzung zwischen Thorvald Meyers gate und Sofienberggate. Ein Laden mit altmodischen Damenkleidern, die nie verkauft wurden, hatte der Schickimickisierung der Gegend viele Jahre lang widerstanden. Aber am Ende hatte das Kapital doch den Sieg davongetragen.
Er saß allein an einem Tisch bei der Tür. Selbst an einem Montag war das Restaurant voll besetzt. Das provisorische Schild an der Tür war mit Filzstiften geschrieben, die Farbe hatte sich durch das Papier gedrückt. Billy T. konnte den Text von seinem Tisch aus in Spiegelschrift lesen.
UNSER CHEFKOCH BREDE ZIEGLER IST VON UNS GEGANGEN. ZUR ERINNERUNG AN SEIN LEBEN UND SEIN WERK IST DAS RESTAURANT ENTRÉ HEUTE GEÖFFNET.
»O verdammt«, sagte Billy T. und schlürfte ein Stück Eis in sich hinein.
Er hätte hier nicht sitzen dürfen. Er hätte zu Hause sein müssen. Auf jeden Fall hätte Tone-Marit dabei sein müssen, wenn er ausnahmsweise einmal im Restaurant aß. Sie waren seit Jennys Geburt nicht mehr zusammen ausgegangen. Seit fast neun Monaten also.
Ein Backenzahn tat schrecklich weh. Billy T. spuckte das Eisstück in eine halb geballte Faust und versuchte, es unbemerkt auf den Boden fallen zu lassen.
»Stimmt etwas nicht?«
Der Kellner deutete eine Verbeugung an und stellte ein Glas Chablis vor ihn hin.
»Nein. Alles in Ordnung. Sie … Sie haben heute geöffnet. Meinen Sie nicht, dass das auf viele … anstößig wirkt, irgendwie?«
»The Show must go on. Brede hätte das so gewollt.«
Der Teller, der eben vor Billy T. gelandet war, sah aus wie eine künstlerische Installation. Billy T. starrte die Mahlzeit hilflos an, hob Messer und Gabel und wusste nicht, wo er anfangen sollte.
»Entenleber auf einem Bett aus Waldpilzen, an Spargel mit einer Andeutung von Kirsche«, erklärte der Kellner. »Bon appétit!«
Der Spargel ragte wie ein Indianertipi über der Leber auf.
»Essen im Gefängnis«, murmelte Billy T. »Und wo zum Teufel steckt die Andeutung?«
Eine einsame Kirsche thronte am Tellerrand. Billy T. schob sie in die Mitte und seufzte erleichtert auf, als das Spargelzelt in sich zusammensackte. Zögernd schnitt er ein Stück von der Entenleber ab.
Erst jetzt entdeckte er den Tisch gleich neben der gediegenen Treppe, die in den ersten Stock hinaufführte. Auf einer kreideweißen Decke stand zwischen zwei silbernen Kerzenhaltern ein großes Bild von Brede Ziegler. Um eine Ecke war ein schwarzes Seidenband geschlungen. Eine Frau mit hochgesteckten Haaren näherte sich dem Tisch. Sie nahm einen bereitliegenden Stift und schrieb etwas in ein Buch. Danach griff sie sich an die Stirn, als sei sie kurz vorm Weinen.
»Man könnte meinen, der Kerl wär ein König gewesen«, murmelte Billy T. »Der hat doch verdammt noch mal kein Kondolenzbuch verdient!«
Brede Ziegler hatte alles andere als königlich ausgesehen, als die Polizei ihn fand. Irgendwer hatte bei der Wache angerufen und ihnen nuschelnd empfohlen, einen Blick auf ihre Hintertreppe zu werfen. Zwei Polizeianwärter hatten sich die Mühe gemacht, diesen Rat zu befolgen. Gleich darauf war der eine atemlos zurück in die Wache gestürmt.
»Der ist tot. Da liegt wirklich einer. Tot wie …«
Beim Anblick von Billy T., der nur einige Unterlagen abholen wollte, barfuß und ansonsten nur mit Unterhemd und Shorts bekleidet, war der Junge verstummt.
»… wie ein Hering«, hatte Billy T. für den jungen Uniformierten den Satz vollendet. »Tot wie ein Hering. Ich komme gerade vom Training, weißt du. Brauchst mich also nicht so anzuglotzen!«
Diese Szene lag jetzt achtzehn Stunden zurück. Billy T. war nach Hause gegangen, ohne sich mehr über den Toten erzählen zu lassen, hatte geduscht und neun Stunden geschlafen und war am Montagmorgen eine Stunde zu spät zum Dienst erschienen in der vergeblichen Hoffnung, dass der Fall auf dem Schreibtisch eines anderen Hauptkommissars gelandet sein möge.
»Zwei Seelen, ein Gedanke.«
Billy T. fuhr hoch und versuchte, ein Stück Spargel hinunterzuschlucken, das nie im Leben mit kochendem Wasser in Berührung gekommen war. Severin Heger zeigte auf den Stuhl neben Billy T. und hob die Augenbrauen. Ohne die Antwort abzuwarten, ließ er sich schließlich auf den Stuhl sinken und starrte skeptisch den Teller an.
»Was ist denn das da?«
»Setz dich auf die andere Seite«, fauchte Billy T.
»Warum denn? Hier sitz ich doch gut.«
»Verdammt, hau schon ab. Wir sehen doch aus wie …«
»Ein Liebespaar. Seit wann so schwulenfeindlich, Billy T.? Jetzt reg dich mal ab.«
»Rüber mit dir!«
Severin Heger lachte und hob langsam den Hintern vom Sitz. Dann zögerte er einen Moment und setzte sich wieder. Billy T. fuchtelte mit der Gabel herum und verschluckte sich.
»Sollte nur ein Witz sein«, sagte Severin Heger und erhob sich erneut.
»Was machst du überhaupt hier?«, fragte Billy T., als sein Hals wieder frei war und Severin sicher auf der anderen Seite des Tisches saß.
»Dasselbe wie du, nehme ich an. Ich dachte, es könnte ja nicht schaden, mir einen Eindruck von diesem Laden zu verschaffen. Karianne hat heute einen Haufen Angestellte vernommen …« Er zeigte vage mit dem Daumen über seine Schulter, als stünden die Leute hinter ihm Spalier. »… aber wir müssen das Lokal doch sehen. Die Stimmung in uns aufnehmen, sozusagen. Was isst du da eigentlich?«
Das Gericht hatte sich in eine amorphe braungrüne Masse verwandelt.
»Entenleber. Was meinst du?«
»Bäh!«
»Ich rede nicht vom Essen. Sondern von dem Laden!«
Severin Heger schaute sich in aller Eile um. Die vielen Jahre beim Polizeilichen Überwachungsdienst, POT, hatten ihn gelehrt, sich umzusehen, ohne dass andere es bemerkten. Er hielt den Kopf still und kniff die Augen halb zu. Nur ein kaum wahrnehmbares Vibrieren der Wimpern verriet die Bewegung der Augäpfel.
»Komischer Laden. Aufgemotzt. Hip. Trendy und fast altmodisch mondän zugleich. Nicht my cup of tea. Ich musste mit dem Dienstausweis wedeln, um überhaupt eingelassen zu werden. Angeblich gibt es für die Wochenenden Wartezeiten von mehreren Wochen.«
»Also echt. Das ist doch ein Saufraß.«
»Du sollst es auch nicht zu einem Brei zusammenmatschen.«
Billy T. schob seinen Teller zurück und schüttete aus einem riesigen Glas einen Rest Weißwein in sich hinein.
»Was meinst du?«, murmelte er. »Wer kann ein Interesse daran gehabt haben, diesen Brede Ziegler umzubringen?«
»Ha! Da gibt es jede Menge Kandidaten. Sieh dir den Mann doch an. Er ist … Brede Ziegler war siebenundvierzig. Zum einen hatte er ein seltsames Lieblingshobby: Er hat sich mit allen und absolut jedem in der norwegischen Kochszene angelegt. Zum anderen hatte er bei allen seinen Unternehmungen großen Erfolg.«
»Wissen wir das eigentlich so genau?«
»Und zwar ökonomisch und fachlich. Dieser Laden hier …«
Jetzt schauten sich beide ganz unverhohlen um.
Das Restaurant repräsentierte das Schwingen des Modependels wieder weg vom funktionellen Minimalismus, der die Branche in den vergangenen Jahren geprägt hatte. Die überaus langen weißen Tischdecken fegten über den Boden. Die Kerzenhalter waren aus Silber. Die Tische standen asymmetrisch im Lokal verteilt, einige zehn bis fünfzehn Zentimeter höher als die anderen auf kleinen Podien. Vom ersten Stock her wogte eine Treppe nach unten, die ein Requisit aus einem Fitzgerald-Roman hätte darstellen können. Der Innenarchitekt hatte erkannt, dass nichts diese Kaskade aus abgenutztem Edelholz blockieren durfte, und deshalb einen breiten Korridor zum Eingangsbereich freigelassen. Von der Decke hingen vier unterschiedlich große Kronleuchter. Billy T. brütete über einem Lichtreflex in allen Regenbogenfarben, der vor ihm auf der Tischdecke zitterte.
»… war vom ersten Tag an ein Erfolg. Das Essen, die Einrichtung, die Gäste … hast du das nicht in der Zeitung gelesen?«
»Die Frau«, sagte Billy T. müde. »Hat schon jemand mit der Frau gesprochen?«
»Mineralwasser, bitte. Mit viel Kohlensäure. Ohne Eis.« Severin Heger nickte einem Kellner zu.
»Die ist in Hamar. Zu Mama geflohen, ehe irgendwer von uns richtig mit ihr reden konnte. Der Pastor kam, das Mädel weinte, und eine Stunde später saß sie in der Bahn. Kann ja verstehen, dass sie mütterlichen Trost braucht. Sie ist erst fünfundzwanzig.«
»Womit unser Freund Brede ziemlich genau … doppelt so alt war wie seine Frau.«
»Fast.«
Der Kellner, der eben die misshandelten Reste der Vorspeise entfernt hatte, unternahm einen neuen Versuch. Der Teller war diesmal größer, das Gericht jedoch ebenso unzugänglich. Inseln aus Kartoffelpüree waren wie Trutzburgen rund um ein Stück Seezunge aufgeschichtet, das von dünnen Streifen aus etwas bedeckt war, bei dem es sich um Möhren handeln musste, und auf dessen Rücken etwas undefinierbares Grünes saß.
»Das sieht doch aus wie ein Scheißmikadospiel«, sagte Billy T. genervt. »Wie isst man so was bloß? Was ist eigentlich gegen Steak und Pommes einzuwenden?«
»Ich kann das essen«, erbot sich Severin. »Danke.«
Der Kellner stellte ein Glas Mineralwasser mit einem Zweiglein Minze vor ihn hin und verschwand.
»Nie im Leben. Dieses Gericht kostet dreihundert Kronen! Was sind das für grüne Streifen in der Soße? Lebensmittelfarbe?«
»Pesto, stell ich mir vor. Probier doch einfach mal. Sie waren erst sechs oder sieben Monate verheiratet.«
»Weiß ich. Ist etwas über Vermögen, Erbschaft, Testament oder so weiter bekannt? Kriegt das alles die Gattin?«
Severin Heger ließ seinen Blick zu einem Paar von Mitte vierzig wandern, das schon sehr lange vor dem Kondolenzbuch stand. Der Mann trug einen Smoking, die Frau ein eierschalenfarbenes Kleid, das besser in eine andere Jahreszeit gepasst hätte. Ihre Haut wirkte in der schweren Seide schlaff und bleich. Als sie sich umdrehte, sah Severin, dass sie weinte. Er wandte sich ab, als ihre Blicke sich begegneten.
»Du hast doch nicht etwa Rotwein zur Seezunge bestellt?«
Der Kellner goss ein neues Glas ein, ohne mit der Wimper zu zucken.
»Meine Schwester sagt, dass man zu weißem Fisch Rotwein trinken darf«, erklärte Billy T. mürrisch und nahm einen großen Schluck.
»Zu Kabeljau, ja. Und vielleicht auch zu Heilbutt. Aber zu Seezunge? Na ja, deine Sache. Und nein, über Geld und so weiter wissen wir so gut wie nichts. Karianne und Karl sind aber schon an der Arbeit. Morgen werden wir einiges mehr haben.«
»Weißt du, dass er in Wirklichkeit Freddy Johansen hieß?«, fragte Billy T. grinsend.
»Wer?«
»Brede Ziegler. Er hieß wirklich jahrzehntelang Freddy Johansen. Trottel. Pathetisch, den Namen zu ändern. Vor allem für einen Mann …«
»Sagt einer, der seinen Nachnamen schon vor zwanzig Jahren aufgegeben hat.«
»Das ist etwas anderes. Etwas ganz anderes. Das hier schmeckt ja sogar.«
»Das seh ich. Wisch dir das Kinn ab.«
Billy T. faltete die gestärkte Leinenserviette auseinander und fuhr sich über die Mundpartie.
»Ich habe heute Nachmittag mit der Rechtsmedizin geredet. Ziegler hatte totales Pech. Dieser Messerstich …« Er hob sein eigenes Messer und richtete die Klinge auf seine Brust. »… hat ihn ungefähr hier getroffen. Nur zwei Millimeter weiter rechts, und Ziegler wäre noch am Leben.«
»O scheiße.«
»Das kannst du wohl sagen.«
»Wissen sie noch mehr? Die Heftigkeit, meine ich, von oben, von unten, linkshändiger Mörder, Mörderin vielleicht? Solche Sachen?«
»Nada. Die sind schließlich auch keine Hellseher. Aber wir kriegen schon noch mehr. Nach und nach. Willst du denn gar nichts essen?«
»Bin schon satt. Aber du … Himmel, da ist ja Wenche Foss!«, flüsterte Severin und strengte sich an, in eine andere Richtung zu blicken.
»Na und?«, erwiderte Billy T. »Die darf doch auch mal ausgehen. Was meinst du damit, dass alle Welt ein Motiv für den Mord an Brede Ziegler gehabt hätte? Abgesehen davon, dass der Typ Karriere gemacht hat, meine ich.«
»Ich dachte, die geht nur ins Theatercafé.«
»Hal-lo!«
»Tut mir leid. Ich habe mit Karianne gesprochen …« Severin gab sich Mühe, Billy T. anzuschauen und nicht abzuschweifen. »… und mir die Zeugenvernehmungen zusammenfassen lassen. Wir sind daran gewöhnt, dass alle losfaseln: ›Ach, wie schockierend‹, und: ›Nein, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand diesen Mann umbringen wollte‹, und so … aber in diesem Fall scheint es anders zu sein. Die Zeugen wirken natürlich erschüttert und so, aber sie sind nicht wirklich schockiert. Nicht so, wie wir das kennen. Alle machen sie sich Gedanken darüber, wer es gewesen sein könnte. Und darüber spekulieren sie, ohne mit der Wimper zu zucken.«
»Das kann aber mehr mit den Zeugen zu tun haben als mit dem Opfer. Viele von denen, die einen Mann wie Ziegler umschwirren, sehnen sich wahrscheinlich nach Aufmerksamkeit. Die wollen sich nur wichtigmachen.«
Die Diva des Nationaltheaters stand jetzt zusammen mit einem jungen lockigen Schauspieler vor dem Kondolenzbuch.
»Darf man lesen, was die Leute in dieses Buch schreiben?«, fragte Severin Heger.
»Meine Fresse, du bist ja vielleicht promifixiert. Reiß dich zusammen!«
»Wir könnten Hanne Wilhelmsen brauchen«, sagte Severin plötzlich und setzte sich gerade hin. »Das ist ein typischer Fall für sie.«
Billy T. legte das Besteck beiseite, ballte die Fäuste und schlug zu beiden Seiten des Tellers auf den Tisch.
»Sie ist nicht hier«, erwiderte er langsam und ohne Severin in die Augen zu blicken. »Und sie kommt auch nicht. Das ist ein Fall für dich, mich, Karianne, Karl und fünf oder sechs andere, wenn wir die brauchen sollten. Hanne Wilhelmsen dagegen brauchen wir nicht.«
»Na gut. Ich wollte nur nett sein.«
»Alles klar«, sagte Billy T. müde. »Die Spritze. Wisst ihr schon mehr darüber?«
»Nein. Sie lag dicht neben der Leiche, war aber wohl eben erst da gelandet. Sie braucht nicht unbedingt etwas mit dem Mord zu tun zu haben. Oder hast du von der Rechtsmedizin etwas anderes gehört?«
»Nein.«
Das Dessert war mit bloßem Auge kaum zu erkennen. Innerhalb von dreißig Sekunden war es verzehrt. Billy T. winkte nach der Rechnung.
»Gehen wir«, sagte er und bezahlte bar. »Das ist kein Lokal für uns.«
Bei der Tür blieb er plötzlich stehen.
»Suzanne«, sagte er leise. »Suzanne, bist du das?«
Auch Severin Heger blieb stehen und musterte die Frau von Kopf bis Fuß. Sie war groß, schlank an der Grenze zur krankhaften Magerkeit und dramatisch in Schwarz und Blau gewandet. Ihr Gesicht war bleich und schmal, die Haare hatte sie sich aus der Stirn gestrichen. Sie schien Billy T. die Hand geben zu wollen, überlegte es sich dann aber anders und nickte nur kurz.
»B. T.«, sagte sie ebenfalls leise. »Lange nicht gesehen.«
»Ja, ich … was machst … schön, dich zu sehen.«
»Würden Sie bitte nach draußen gehen oder hereinkommen?«, fragte lächelnd der Oberkellner, ein seltsam aussehender Mann mit viel zu großem Kopf. »So, wie Sie hier stehen, blockieren Sie die Tür.«
»Ich will rein«, sagte die Frau.
»Ich will raus«, sagte Billy T.
»Hallo«, sagte Severin Heger.
»Vielleicht sehen wir uns mal wieder«, sagte die Frau und verschwand im Lokal.
Der Dezemberabend war ungewöhnlich mild. Billy T. hob sein Gesicht zum schwarzen Himmel.
»Du siehst aus, als ob du einem Gespenst begegnet wärst«, sagte Severin Heger. »Einem, das dich B. T. nennen darf. Ha!«
Billy T. gab keine Antwort.
Er war vollauf damit beschäftigt, Haltung zu bewahren. Er hielt den Atem an, um nicht aufzukeuchen. Plötzlich rannte er los.
»Mach’s gut«, rief Severin. »Wir sehen uns morgen früh!«
Billy T. war schon zu weit weg, um ihn zu hören.
Keiner der beiden Polizisten achtete auf den jungen Mann, der durch das zur Sofienberggate gelegene Fenster ins Restaurant spähte. Er hielt sich die Hände wie Trichter hinter die Ohren und stand schon sehr lange dort.
Severin Heger ging in östlicher Richtung davon. Hätte er die Gegenrichtung eingeschlagen, dann hätte ein Impuls ihn vielleicht dazu gebracht, mit dem Jungen zu reden.
Auf jeden Fall hätte er dann dessen Gesicht gesehen.
Vernehmung des Sebastian Kvie, bearbeiteter Auszug.
Vernehmung durchgeführt von Kommissarin Silje Sørensen. Abgeschrieben von Sekretärin Rita Lyngåsen. Von dieser Vernehmung existiert ein Tonband. Die Vernehmung wurde am Montag, dem 6. Dezember 1999, auf der Osloer Hauptwache aufgezeichnet.
Zeuge: Kvie, Sebastian, Personenkennnummer 161179 48062
Wohnhaft: Herslebsgate 4, 0561 Oslo
Arbeitsplatz: Restaurant Entré, Oslo
Über seine Rechte belehrt, aussagebereit. Weiß, dass die Vernehmung auf Band aufgenommen und später ins Protokoll überführt werden wird.
PROTOKOLLANTIN:
Können Sie uns als Erstes etwas über Ihre Arbeit sagen? Über Ihr Verhältnis zu dem Toten und so weiter? (Husten, unverständliche Rede)
ZEUGE:
Ich arbeite seit der Eröffnung im Entré. Also seit dem 1. März dieses Jahres (Papiergeraschel, Gemurmel im Hintergrund). Ich habe im Frühjahr ’98 den Leistungskurs Koch- und Restaurantfach an der Sogn-Schule beendet. Außerdem war ich längere Zeit in Lateinamerika. Neun Wochen, genauer gesagt. Brede Ziegler kannte mich vom Hörensagen und wollte mich im Entré haben. Und ich war natürlich total scharf auf den Job. Hat mich wohl auch ziemlich happy gemacht, dass so ein Typ schon von mir gehört hatte. Die Bezahlung ist sauschlecht, aber das ist sie überall, solange man noch keinen großen Namen hat.
PROTOKOLLANTIN:
Wie … wie gefällt Ihnen die Arbeit?
ZEUGE:
Ich habe die ganze Zeit mehr oder weniger ohne Unterbrechung gearbeitet. Hab zum Beispiel keinen Sommerurlaub genommen. Eigentlich habe ich montags und an jedem zweiten Mittwoch frei – eigentlich. Aber scheiße, ich find die Arbeit toll. Das Entré hat im Moment die spannendste Küche in der Stadt. Nur weil … ich meine (undeutlich).Ich muss ja eigentlich nur Befehle ausführen, aber trotzdem lerne ich verdammt viel. Der Küchenchef geizt auch nicht mit Lob, wenn Extraarbeit anfällt. Und das ist eigentlich dauernd der Fall. Außerdem ist Brede sich nicht zu schade, selbst mit anzufassen. Er kocht auch selbst, jedenfalls so fünf- oder sechsmal bisher. Das ist verdammt klasse, wenn man bedenkt, was er sonst noch alles um die Ohren hat. Ich meine, scheiße, dem gehört doch der ganze Laden. Größtenteils jedenfalls. Das glaube ich wenigstens. Ich habe gehört, dass ihm auch sonst noch einiges gehört, aber darüber weiß ich nichts.
PROTOKOLLANTIN:
Nicht, dass ich prüde wäre, aber Sie sollten nicht so viel fluchen. Die Vernehmung kommt wortwörtlich ins Protokoll, und diese Unflätigkeiten sehen geschrieben nicht gerade gut aus.
ZEUGE:
Ach ja. Tut mir leid. Sorry. Werd mich zusammenreißen.
PROTOKOLLANTIN:
Haben Sie Brede Ziegler gut gekannt?
ZEUGE:
Gut … gut? Der war mein Chef. Klar hab ich mit ihm geredet, bei der Arbeit, mein ich. Aber was heißt schon kennen … (Lange Pause) Er war doch älter als ich. Viel älter. Befreundet waren wir also nicht. Das kann ich nicht behaupten. Wir sind nicht zusammen in die Kneipe oder zum Fußball gegangen. (Lacht) Nein. Das nicht.
PROTOKOLLANTIN:
Wissen Sie, mit wem der Verstorbene befreundet war?
ZEUGE:
Mit allen. You name ’em. (Lautes Lachen) Bei Brede hat’s von Promis nur so gewimmelt. Die haben ja geradezu an ihm geklebt. Es war so was … natürlich war ich ziemlich geschockt, als ich von dem Mord hörte. Aber Brede war auch ziemlich umstritten. In der Szene, meine ich. Er war so verdammt … so verflucht erfolgreich. (Kurzes Lachen) Verzeihung. Soll ja nicht fluchen. (Pause) Brede war der Allerbeste, wissen Sie. Das haben ihm bestimmt viele nicht gegönnt. Was er anfasste, wurde zu Gold, so war das. Und es gibt nun mal viele kleinliche Leute. In unserer Branche blüht der Neid. Mehr als anderswo, glaube ich. So kommt es mir jedenfalls vor.
PROTOKOLLANTIN:
Verstehe ich das richtig, … Sie haben Brede Ziegler bewundert? Ein bisschen so wie einen Filmstar?
ZEUGE:
(Kurzes Lachen, Husten) Ich habe mit elf Jahren in einer Illustrierten einen Artikel über Brede Ziegler gelesen. Und von da an war er mein Held. Ich will unbedingt so werden, wie er war. Tüchtig und großzügig. Ich habe zum Beispiel gehört, dass er zu Weihnachten allen ein Masahiro-Messer schenken wollte. Mit Namen und so. Eingraviert, mein ich. Vielleicht war das nur ein Gerücht, aber ich hab es gehört. Und es würde zu Brede passen. (Lange Pause, Papiergeraschel) Er hat sich immer an Namen erinnert. Selbst mit den Spülhilfen hat er geredet wie mit guten Bekannten. Ich würde sagen, dass Brede Ziegler große Menschenkenntnis besaß. Und der beste Koch in ganz Norwegen war. Auf jeden Fall, wenn Sie mich fragen.
PROTOKOLLANTIN:
Haben Sie die Frau des Verstorbenen gekannt?
ZEUGE:
Ich bin ihr nur ein Mal begegnet. Glaube ich. Sie heißt Vilde oder Vibeke oder so. Viel jünger als Brede. Hübsch. Vor zwei Monaten hat sie ihn einmal abgeholt. Hat keinen besonderen Eindruck bei mir hinterlassen. Keine Ahnung, ob sie häufiger im Entré ist, ich stehe doch den ganzen Abend in der Küche und komme nur selten dazu, einen Blick ins Lokal zu werfen. Als sie Brede abholte, hatten wir noch nicht geöffnet. Ich hab gerade mit Claudio geredet, dem Oberkellner. Sie hat uns nicht gegrüßt. Kam mir vielleicht ein bisschen arrogant vor. Vielleicht hatte sie es auch nur sehr eilig.
PROTOKOLLANTIN:
Haben Sie …
ZEUGE(fällt ihr ins Wort):
Man soll ja nicht auf Gerüchte hören. Aber es heißt, Brede hätte die Frau einem Kerl ausgespannt, der nicht viel älter ist als ich. Fünf- oder sechsundzwanzig vielleicht. Ich kenn den Typen nicht, aber er heißt Sindre mit Vornamen und arbeitet in Stadholdergaarden. Soll tüchtig sein. Aber wie gesagt, das sind alles nur Gerüchte.
PROTOKOLLANTIN:
Und was denken Sie?
(Pause. Stühlescharren. Jemand kommt ins Zimmer, etwas wird in ein Glas gegossen.)
ZEUGE:
Worüber?
PROTOKOLLANTIN:
Über den ganzen Fall.
ZEUGE:
Ich habe keine Ahnung, wer Brede umgebracht hat. Aber wenn ich raten sollte, würde ich sagen, dass Neid dahintersteckt. Bescheuert natürlich, jemanden umzubringen, bloß weil man sich darüber ärgert, dass er so erfolgreich ist, aber so sehe ich das eben. Ich selbst hab den Sonntagabend im Entré in der Küche verbracht. Ich bin gegen drei Uhr nachmittags gekommen und erst um zwei Uhr morgens nach Hause gegangen. Ich war die ganze Zeit mit anderen zusammen – abgesehen davon, dass ich drei- oder viermal pissen musste.
Anmerkung der Protokollantin:
Der Zeuge erklärte sich flüssig und zusammenhängend. Während der Vernehmung ließ er sich Kaffee und Wasser bringen.
5
»Stazione termini. Il treno per Milano.«
Der Direktor hatte sie zu dem vor dem Tor wartenden Taxi begleitet. Er erteilte dem Fahrer Anweisungen und bekundete sein Bedauern über Hanne Wilhelmsens plötzliche Abreise.
»Signora, why can’t you wait – very good flight from Verona tomorrow!«
Aber Hanne konnte nicht warten. Von Mailand aus ging noch am selben Abend eine Maschine nach Oslo. Die Bahnfahrt von Verona nach Mailand dauerte knapp zwei Stunden. Hundertzwanzig Minuten näher an zu Hause!
Bei der Passkontrolle wurde ihr schwindlig. Vielleicht lag das an ihrer Reisejacke. Die hatte Cecilie gehört. Wie eine schwache Erinnerung nahm Hanne einen Duft wahr, den sie für verschwunden gehalten hatte. Sie lehnte sich an den Schalter und winkte die Leute, die hinter ihr standen, vorbei.
Die Wohnung.
Cecilies Sachen.
Cecilies Grab, von dem sie nicht einmal wusste, wo es lag.
Ein Flughafenangestellter reichte ihr den Pass. Sie konnte ihn nicht entgegennehmen. Ihr Arm wollte sich einfach nicht heben. Der Ellbogen tat weh, weil sie ihn so energisch auf den Schaltertisch gepresst hatte. Sie zählte bis zwanzig, riss sich zusammen, steckte das weinrote Heft ein und rannte los. Weg aus der Warteschlange, weg aus dem Flughafengebäude. Weg von der Heimreise.
Hanne Wilhelmsen stand wieder in Verona. Sie war ihrem allerersten Impuls gefolgt. Am nächsten Morgen konnte sie über München nach Oslo fliegen.
Sie kannte Verona kaum. Seit sie im Juli hergekommen war, hatte sie sich an die Villa Monasteria und die umliegenden Hügel gehalten. Anfangs hatten die Studentinnen versucht, sie an den Wochenenden nach Verona zu locken, es dauerte mit dem Auto eine knappe halbe Stunde. Hanne hatte sich nie locken lassen.
Die lange Reihe aus Tagen zwischen braungelbem Sommer und feuchtem Dezember hatte etwas von dem Schmerz betäubt, der sie seit Cecilies Tod gelähmt hatte. In gewisser Hinsicht war Hanne weitergekommen. Und trotzdem brauchte sie noch Zeit. Vierundzwanzig Stunden wenigstens. In vierundzwanzig Stunden würde sie sich ins Flugzeug nach Norwegen setzen.
Sie würde in die Wohnung und zu Cecilies vielen mehr oder weniger vollendeten Renovierungsprojekten zurückkehren. Zu Cecilies Kleidern, die noch immer ordentlich zusammengefaltet in der einen Hälfte des Kleiderschrankes im Schlafzimmer lagen, neben Hannes Chaos aus Hosen und Pullovern.
Sie würde Cecilies Grab ausfindig machen.
Hanne stand auf der Piazza Bra in Verona und suchte ihre Ohren vor dem Lärm der Stadt zu verschließen. Das gelang ihr nicht, und ihr ging auf, dass dieser Lärm nur aus Stimmen bestand. Der Autoverkehr war von dem großen Platz ausgeschlossen. Rufe hallten von den uralten Marmorgebäuden rund um die mitten in der Stadt gelegene Arena de Verona wider und wurden über die vielen Marktbuden hinweggeweht, wo Hunderte von Händlern Schinken und Porzellan, Autostaubsauger und Trödel per la donna feilboten.
Der Rucksackriemen grub sich in Hannes Schulter. Sie lief ziellos weiter, fort von dem Menschengewimmel, in den Schatten, in eine Seitenstraße. Sie musste sich ein Hotel suchen, einen Ort, wo sie ihr Gepäck abladen, eine Nacht schlafen und sich auf die lange Heimreise vorbereiten konnte. Sie wusste nicht so recht, ob diese Reise bereits begonnen hatte.
6
Die Morgenbesprechung hätte seit zwölf Minuten im Gange sein sollen. Billy T. war noch nicht aufgetaucht. Karianne Holbeck starrte einen Haken an, der gleich über der Tür in der Decke befestigt war. Sie versuchte, nicht auf die Uhr zu sehen. Kommissar Karl Sommarøy hatte ein Schweizer Messer hervorgezogen und schnitzte vorsichtig an einem Pfeifenkopf herum.
»Viel zu groß«, erklärte er denen, die das möglicherweise interessierte. »Liegt nicht gut in der Hand.«
»Fährst du mit Spikes oder ohne?«
»Hä?« Karl Sommarøy schaute auf und wischte sich einige Späne von der Hose.
»Ich will jedenfalls bei den Spikes bleiben«, sagte Severin Heger. »Ich werde diese verdammte Gebühr bezahlen, solange das überhaupt möglich ist. Gestern Morgen zum Beispiel, als ich …«
»Morgen, Leute.«
Billy T. fegte zur Tür herein und knallte einen Ordner auf den Tisch.
»Kaffee.«
»Say the magic word«, befahl Severin.
»Kaffee, zum Teufel!«
»Jaja. Hier. Nimm meinen. Ich hab ihn noch nicht angerührt.«
Billy T. hob die Tasse halb zum Mund, stellte sie dann aber grinsend wieder hin.
»Lasst uns mal zusammenfassen, was wir schon haben, und dann die Aufgaben für die nächsten zwei Tage verteilen. Oder so. Severin. Mach du den Anfang.«
Severin Heger hatte viele Jahre in den allerobersten Etagen der Wache verbracht. Er hatte sich beim POT wohlgefühlt. Die Arbeit beim Überwachungsdienst war spannend, abwechslungsreich und hatte ihm ein Gefühl von Bedeutung gegeben. Eine erschöpfende Periode voller Skandale und Dauerbeschuss durch die gesamte norwegische Presse hatte ihm seine Begeisterung für den Posten nicht nehmen können, den er angestrebt hatte, seit er alt genug gewesen war, um zu begreifen, was sein Vater Tag für Tag machte. Severin Heger liebte seine Arbeit, hatte aber ununterbrochen Angst.
Als er achtzehn war, hatte er sich widerstrebend mit seiner Homosexualität abgefunden. Sie sollte ihn nicht daran hindern, die selbstgesteckten Ziele zu erreichen. An seinem zwanzigsten Geburtstag – nach einer Pubertät, die geprägt war von Kampfsport, Fußball und Wichsen praktisch rund um die Uhr – hatte er beschlossen, niemals etwas durchblicken zu lassen, niemals ein Geheimnis zu verraten, das seinen Vater das Leben kosten würde. Der Vater war während des Krieges mit Shetland-Larsen gefahren und für seinen Einsatz für das Vaterland hoch dekoriert worden. In den Fünfziger- und Sechzigerjahren hatte er selbst beim Überwachungsdienst gearbeitet. Damals hatten die Kommunisten in jeder Gewerkschaft ihr Unwesen getrieben, und der Kalte Krieg war durch und durch eisig gewesen. Severin war Einzelkind und Papasöhnchen, und seine Fassade war nur ein einziges Mal gebröckelt. Er hatte versucht, Billy T. anzubaggern. Er war taktvoll zurückgewiesen worden, und Billy T. hatte die Episode mit keinem Wort mehr erwähnt.
Als der Überwachungschef nach dem Furre-Skandal seinen Hut nehmen musste, hatte der POT zum ersten Mal eine Chefin bekommen. Sie war nicht lange im Dienst geblieben. Doch ehe sie ging, hatte sie es noch geschafft, Severin Heger in ihr Büro zu rufen und ihm zu sagen: »Es ist kein Sicherheitsrisiko, dass du schwul bist, Severin. Das Problem ist, dass du so viel Kraft vergeudest, um es zu verbergen. Hör doch auf damit. Sieh dich um! Wir gehen auf ein neues Jahrtausend zu.«
Severin wusste noch, dass er sich wortlos erhoben hatte. Dann war er nach Hause gegangen, hatte lange geschlafen, war aufgestanden, hatte geduscht und sich in einer feinen Duftwolke in die Schwulenkneipe Castro begeben. Nach einer Nacht, in der er nach Kräften versucht hatte, seine Versäumnisse aufzuholen, hatte er seine Versetzung zur Kriminalpolizei beantragt. Mittlerweile war sein Vater seit zwei Jahren tot. Severin Heger fühlte sich endlich frei.
»Das Einzige, was wir sicher wissen, ist Folgendes …« Er klopfte mit einem Finger gegen die Tischkante. »Bei der Leiche handelt es sich um Brede Ziegler. Geboren 1953. Frisch verheiratet. Kinderlos. Als er ermordet wurde, trug er eine Brieftasche mit über sechzehntausend Kronen in bar bei sich. Sechzehntausendvierhundertachtzig Kronen und fünfzig Öre, wenn wir pingelig sein wollen.«
»Sechzehntau…«
»Sowie vier Kreditkarten. Nicht weniger. AmEx, VISA, Diners und Master Card. Gold und Silber und Platin und weiß der Teufel was noch.«
»Damit wäre die Möglichkeit, dass es ein Überfall war, geplatzt«, murmelte Karianne.
»Nicht unbedingt.« Severin Heger rückte seine Brille zurecht. »Der Täter kann von Passanten überrascht worden sein, ehe er die Beute an sich reißen konnte, um es mal so zu sagen. Aber wenn es ein Raubüberfall war, dann handelt es sich um eine seltsame Tatwaffe. Ein Masahiro 210.«
»Ein was?« Karianne verschluckte den Zuckerwürfel, an dem sie herumgelutscht hatte. »Ist er also wirklich erstochen worden? Mit einem Massa-was?«
»Masahiro 210. Das ist ein Messer. Ein teures, erstklassiges Küchenmesser. Eigentlich müsste es dafür einen Waffenschein geben. Es ist ein besonders gefährliches Teil.«
»Das hat doch dieser Küchenjunge erwähnt«, sagte Silje Sørensen eifrig. »So eins sollten sie zu Weihnachten bekommen.«
Billy T. blickte Karianne missbilligend an.
»Wenn du es nicht nötig hast, zu den Besprechungen zu kommen, und lieber periphere Zeugen vernimmst, dann musst du dich verdammt noch mal informieren, worüber wir reden.«
»Aber … du bist derjenige, der zu spät gekommen ist!«
»Lass den Scheiß. Das mit dem Messer haben wir gestern erfahren.«
Er rang sich ein Lächeln ab. Karianne beschloss, es als eine Art Entschuldigung zu deuten, sah ihn aber unverwandt an, bis er sich abwandte und weitersprach.
»Gestern Morgen hat die Rechtsmedizin mitgeteilt, dass auf der Klinge ›Masahiro 210‹ steht. Wir hätten das sofort erfahren müssen. Noch Sonntagnacht. Sowie sie ihm das Messer aus der Brust gezogen hatten. Vielleicht können wir irgendwann im nächsten Jahrtausend den verdammten Ärzten klarmachen, dass sie mit uns kommunizieren müssen.«
»Da hast du doch geschlafen«, murmelte Karianne kaum hörbar.
Severin Heger erhob sich und breitete dramatisch die Arme aus.
»Ihr Lieben. Hochverehrte Kolleginnen und Kollegen. Wie wollen wir diesen Fall lösen, wenn wir viel mehr darauf brennen, uns gegenseitig an die Gurgel zu gehen?«
»Ich hab keine Probleme.«
Silje Sørensen lächelte breit und prostete den anderen mit ihrer Kaffeetasse zu. Sie hatte gerade erst ihre Ausbildung beendet und war glücklich darüber, sofort bei der Kriminalpolizei gelandet zu sein. Die anderen aus ihrem Jahrgang liefen im Dienst der Ordnungspolizei auf der Straße herum.
»Du ja. Aber unser Hauptkommissar hier …«
Er legte ihm eine Hand auf die Schulter. Billy T. schüttelte sie ab.
»… der ist denkbar schlechtester Laune. Ich weiß nicht, warum, aber als sonderlich fruchtbar können wir das nicht bezeichnen. Und du, schöne Frau …«
Er richtete den Finger auf Karianne Holbeck und zeichnete eine Spirale in die Luft.
»… du scheinst derzeit einen etwas verspäteten Aufruhr gegen sämtliche Autoritäten zu veranstalten. Könnte das hormonell bedingt sein? PMS zum Beispiel?«
Karianne lief tiefrot an und wollte sich wehren. Billy T. brachte ein weiteres Lächeln zustande, ein sehr viel echteres diesmal.
»Darf ich vorschlagen, dass wir das Kriegsbeil begraben, dass Karl von seiner hübschen Handarbeit ablässt, dass jemand neuen Kaffee aufsetzt – trinkbaren diesmal – und dass ich mich danach ganz ruhig hinsetze, um dieser hervorragenden, wenn auch leicht vergrätzten Ermittlungsgruppe etwas mehr von meinen Kenntnissen über die Mordwaffe mitzuteilen?«
Er lächelte die sechs anderen an. Karianne war noch immer tiefrot. Silje Sørensen hielt sich die Hand vor den Mund, um ein Kichern zu unterdrücken; an ihrem Ringfinger funkelte ein Diamant, der sicher einen halben Wachtmeisterjahreslohn gekostet hatte. Karl zögerte, klappte dann aber sein Messer zusammen und steckte die Pfeife in die Jackentasche. Annmari Skar, die Polizeijuristin, die sich bisher in ihre Unterlagen vertieft und offenbar auf den ganzen Auftritt gepfiffen hatte, starrte ihn mit einem schwer zu deutenden Blick an. Dann lachte sie plötzlich laut.
»Du bist ein Gewinn für uns, Severin. Du bist wirklich ein Gewinn.«
Kommissar Klaus Veierød war schon auf dem Weg zur Kaffeemaschine. »Wer will Kaffee?«
»Alle«, sagte Severin munter. »Wir wollen alle Kaffee. So …« Er setzte sich und holte tief Luft. »Auf der Klinge steht noch mehr.«
Er wühlte in seinen Papieren und hielt schließlich einen gelben Zettel dicht vor seine Augen.
»Ich muss mir endlich angewöhnen, meine Brille zu benutzen. ›Molybdenum Vanadium Stainless Steel‹. Auf gut Norwegisch heißt das wahrscheinlich so etwas wie Raumfahrtstahl. Stabil und unglaublich leicht. In einem gegossen. In allen besseren Restaurantküchen benutzen sie solche Messer. Die sind im Moment einfach das Heißeste. Das Beste. Das hier kostet bei GG Storkjøkken in der Torggate eintausendfünfundzwanzig Kronen und zweiundachtzig Öre. Mit anderen Worten, es ist die Sorte Messer, die ihr wohl kaum bei uns in der Kantine finden würdet.«
Er hob den Daumen zur Decke.
»Im Entré dagegen benutzen sie nur solche Messer. Das Problem ist, dass das auch für zehn bis zwölf andere Restaurants hier in der Stadt gilt. Mindestens. Die Klinge ist übrigens zweihundertzehn Millimeter lang. Zweiundachtzig davon haben in Zieglers Brust gesteckt. Die Spitze hatte den Herzbeutel ganz am Rand perforiert.«
Er verstummte. Niemand sagte etwas. Das Rauschen einer schrottreifen Klimaanlage verpasste Billy T. eine Andeutung von Kopfschmerzen, und er rieb sich die Nasenwurzel.
»Leicht«, seufzte er. »Das Messer ist also außergewöhnlich leicht?«
»Ja. Ich war gestern bei GG und hab mir eins angesehen. Ich kann mir so ein Ding leider nicht leisten, aber du meine Güte, was für ein Messer! Ich hatte immer Sabatier für das Alleinseligmachende gehalten, aber jetzt weiß ich es besser.«
»Leicht«, wiederholte Billy T. und zog eine Grimasse. »Mit anderen Worten, wir können nicht ausschließen, dass wir es mit einer Frau zu tun haben.«
»Das könnten wir sowieso nicht«, sagte Karianne, offenkundig bemüht, nicht übellaunig zu klingen. »Ich meine, kein Messer wiegt so viel, dass eine Frau damit nicht …«
»Oder ein Kind«, fiel Billy T. ihr nachdenklich ins Wort.
»Genau. Die Waffe sagt uns eigentlich nur, dass der Mörder oder die Mörderin keine finanziellen Probleme hat oder in der Restaurantszene verkehrt.«
Wieder lief Karianne rot an. Sie fuhr sich energisch über eine Wange, wie um die Röte wegzuwischen.
»In der Restaurantszene«, wiederholte Karl. »Es kann sich aber auch um jemanden handeln, der diesen Eindruck erwecken will.«
»Wie wir es so oft haben.«
Billy T. schabte sich mit seinem Dienstausweis über den Hals, als wollte er sich rasieren.