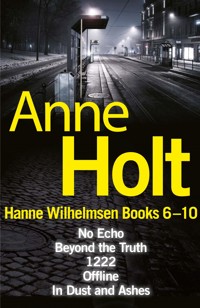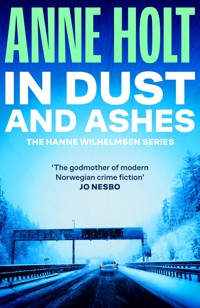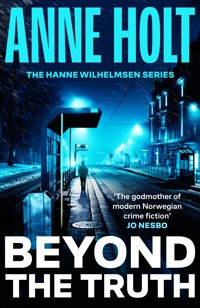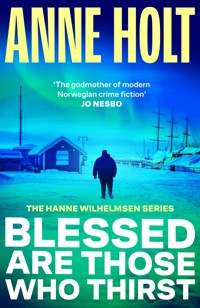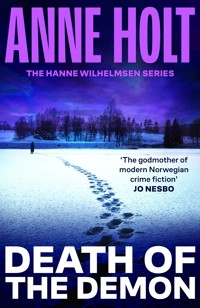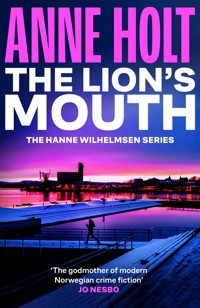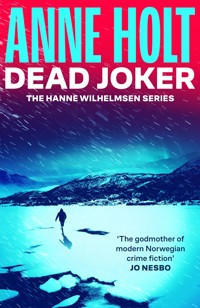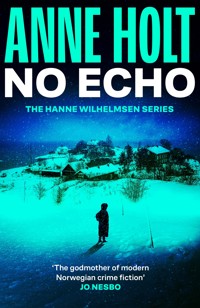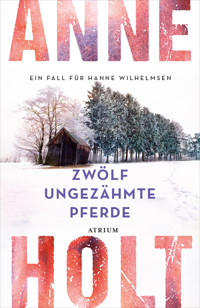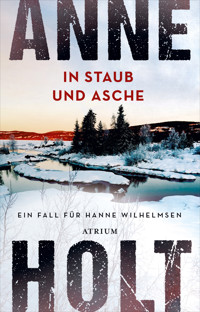11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atrium Verlag AG
- Kategorie: Krimi
- Serie: Hanne-Wilhelmsen-Reihe
- Sprache: Deutsch
Ein Mord in einem abgelegenen Bergdorf Ein Schneesturm wütet in den Bergen und lässt einen Zug entgleisen. Die Passagiere – unter ihnen die ehemalige Kommissarin Hanne Wilhelmsen – müssen Zuflucht in einem einsamen Berghotel suchen. Während sie eingeschneit werden, geschieht ein grausamer Mord. Panik macht sich breit. Zudem stehen geheimnisvolle Wachen vor den Türen, die etwas oder jemanden zu beschützen scheinen. Hanne, die im Rollstuhl sitzt, ist ganz auf sich allein gestellt, während sie alles daran setzt, den Mörder zu enttarnen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 430
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Anne Holt
Der norwegische Gast
Hanne Wilhelmsens achter Fall
Aus dem Norwegischen von Gabriele Haefs
Die deutsche Erstausgabe erschien 2008 im Piper Verlag, München.
This translation has been published with the financial support of NORLA, Norwegian Literature Abroad
© Atrium Verlag AG, Zürich, 2024
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © Anne Holt 2007
Die Originalausgabe erschien 2007 unter dem Titel 1222 bei Piratforlaget, Oslo.
Für die vorliegende Ausgabe wurde die deutsche Übersetzung von der Übersetzerin überarbeitet.
Published by agreement with Salomonsson Agency
Covergestaltung: zero-media.net, München
Covermotiv: Stocksy/Marilar Irastorza
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
ISBN978-3-03792-217-0
www.atrium-verlag.com
www.facebook.com/atriumverlag
www.instagram.com/atriumverlag
In diesem Buch ist einiges ernst gemeint,
das meiste aber ist nur ein Spiel, Iohanne.
Deshalb ist dies mein erstes kleines Buch für dich.
0 laut Beaufortskala:Auswirkungen des Windes im Gebirge
Windstille. Windgeschwindigkeit: unter 1 km/h Schneeflocken fallen fast senkrecht, oft in pendelnder Bewegung.
1 Da nur der Lokomotivführer ums Leben kam, kann von einer Katastrophe keine Rede sein. Zweihundertneunundsechzig Menschen befanden sich an Bord, als der Zug aufgrund eines meteorologischen Phänomens, das ich noch immer nicht ganz verstanden habe, entgleiste und die Einfahrt zum Finsenut-Tunnel verfehlte. Ein toter Lokomotivführer entspricht nur 0,37 Prozent einer solchen Menschenmenge. In Anbetracht der Verhältnisse hatten wir mit anderen Worten ein Schweineglück. Obwohl viele bei dem Unfall verletzt wurden, handelte es sich in den meisten Fällen um leichtere Blessuren. Arm- und Beinbrüche. Gehirnerschütterungen. Schrammen und Schnittwunden und Kratzer: Es gab kaum einen Menschen an Bord, der unversehrt geblieben war. Aber es gab nur ein einziges Todesopfer. Dem Geschrei nach zu urteilen, das den Zug in den Minuten nach dem Unfall erfüllte, hätte man jedoch auf eine geradezu kosmische Katastrophe schließen können.
Ich verhielt mich still. Ich war davon überzeugt, eine der wenigen Überlebenden zu sein, und außerdem hatte ich einen strampelnden Säugling auf den Knien liegen. Das Kind war bei der Kollision durch die Luft geflogen, hatte meine Schulter gestreift und war gegen die Wand direkt vor dem Rollstuhl geprallt, um dann auf meinem Schoß zu landen. Reflexartig hatte ich meine Arme um das schreiende Bündel geschlungen. Ich fing wieder an zu atmen und bemerkte den trockenen Geruch von Schnee.
Die Temperatur sank in bemerkenswert kurzer Zeit von unbehaglicher, stickiger Wärme auf Frostschädenniveau. Der Zug hatte Schlagseite. Nicht sehr stark, aber genug, dass meine Schulter schmerzte. Ich saß auf der linken Seite im Abteil, als einzige Rollstuhlfahrerin im ganzen Zug. Eine grauweiße Wand presste sich auf meiner Seite gegen die Fenster. Mir wurde klar, dass diese gewaltige Schneemasse uns gerettet hatte; ohne den Schnee hätte der Zug sich überschlagen.
Die Kälte war lähmend. Kurz vor Hønefoss hatte ich meinen Pullover ausgezogen. Jetzt saß ich in einem dünnen T-Shirt da und drückte ein Baby an meine Brust, während ich feststellte, dass es in den Wagen schneite. Die nackte Haut meiner Arme war schon so unterkühlt, dass die wirbelnden blauweißen Flocken dort erst eine kalte Sekunde lang liegen blieben, ehe sie schmolzen. Auf der gesamten rechten Zugseite waren die Fensterscheiben zerbrochen.
Der Wind musste stärker geworden sein in den wenigen Minuten, die vergangen waren, seit wir im Bahnhof Finse zum Ein- und Aussteigen gehalten hatten. Nur zwei Fahrgäste waren ausgestiegen. Ich hatte zwar beobachtet, wie sie sich gegen den Wind stemmen mussten, als sie sich über den Bahnsteig in Richtung Hotel kämpften, aber ich hatte doch nur den Eindruck von einem normalen, stürmischen Wintertag im Hochgebirge gehabt. Als ich da aber so saß, meinen Pullover fest um das Baby gewickelt und außerstande, meinen Mantel vorn Haken zu nehmen, befürchtete ich, der Wind könne so stürmisch und der Schnee so kalt sein, dass wir innerhalb kurzer Zeit erfrieren würden. Ich beugte mich, so weit ich konnte, schützend über den Säugling. Im Nachhinein kann ich wirklich nicht mehr sagen, wie lange ich so dasaß, ohne Kontakt zu anderen Menschen, ohne ein Wort zu sprechen, während die Rufe der anderen Fahrgäste sich als vereinzelte Lautfetzen in das kompakte Wüten des Sturmes mischten. Vielleicht waren es zehn Minuten. Vielleicht nur wenige Sekunden.
»Sara!«
Eine Frau starrte mich und das Baby wütend an. Das Baby war ganz in Rosa gekleidet, von der Jacke bis zu den winzigen Socken. Auch die kleinen Fäuste, die ich mit den Händen zu schützen versuchte, und das wütende Gesicht, das schrie und schrie, waren zartrosa.
Das Gesicht der Mutter dagegen war blutrot. Aus einem tiefen Schnitt auf der Stirn lief Blut. Das hinderte sie allerdings nicht daran, ihr Töchterchen an sich zu reißen. Mein Pullover fiel auf den Boden. Die Frau wickelte das Kleine mit so geübten Griffen in eine Decke, dass es sich unmöglich um ihr erstes Kind handeln konnte. Sie verbarg das Köpfchen unter der Decke, drückte das Bündel an ihre Brust und schrie mich vorwurfsvoll an:
»Ich bin gefallen! Ich bin durch den Wagen gegangen, und dann bin ich gefallen!«
»Alles in Ordnung«, sagte ich langsam, meine Lippen waren so steif, dass mir das Sprechen schwerfiel. »Ihrem Kind ist nichts passiert, soweit ich das beurteilen kann.«
»Ich bin gefallen«, weinte die Mutter und trat nach mir, ohne mich jedoch zu treffen. »Ich habe Sara fallen lassen. Ich habe sie fallen lassen!«
Da ich nun von dem lästigen Kind befreit war, griff ich nach meinem Pullover und zog ihn an. Obwohl ich unterwegs nach Bergen war, wo mich strömender Regen und zwei Grad über null erwarteten, hatte ich die Daunenjacke mitgenommen. Endlich konnte ich sie vom Haken nehmen, an dem sie wie durch ein Wunder noch immer hing. Da ich keine Mütze hatte, band ich mir den Schal um den Kopf. Auch Handschuhe hatte ich keine dabei.
»Keine Angst«, sagte ich und schob die Hände in die Jackenärmel. »Sara weint. Das ist ein gutes Zeichen, glaube ich. Schlimmer sieht es da bei Ihnen aus …«
Ich nickte in ihre Richtung. Aber sie registrierte das nicht. Das Kind weinte noch immer und ließ sich auch nicht dadurch beruhigen, dass die Mutter versuchte, es unter ihre eigene, viel zu enge Pelzjacke zu stopfen. Die Stirnwunde blutete sehr stark, und ich würde schwören, dass das Blut gefroren war, ehe es den Boden erreichte, der bereits von Blut und Eis bedeckt war. Irgendjemand war auf einen Karton Orangensaft getreten. Der gelbe Eisbuckel lag wie ein riesiges Eidotter auf dem weißen Schneeteppich.
Die Wärme wollte nicht in meinen Körper zurückkehren. Im Gegenteil, die viel dickere Kleidung schien die Lage noch zu verschlimmern. Das Taubheitsgefühl legte sich zwar nach und nach, aber es war einem Prickeln auf meiner Haut gewichen, das sich wie Messerstiche anfühlte. Ich zitterte so sehr, dass ich die Zähne zusammenbeißen musste, um meine Zunge nicht zu verletzen. Vor allem hätte ich gern den Rollstuhl umgedreht, um die vielen Stimmen mit Gesichtern in Verbindung bringen zu können. Das Weinen einer Frau, die sich offenbar unmittelbar hinter mir befand, oder der Sturzbach von Flüchen und Verwünschungen eines Jungen im Stimmbruch. Ich wollte wissen, wie viele Tote es gab, wie schwer die Überlebenden verletzt waren und ob es möglich wäre, die Fenster abzudichten, durch die das mit jeder Sekunde stärker werdende Unwetter drang.
Ich wollte mich umdrehen, konnte aber die Hände nicht aus den Jackenärmeln ziehen.
Ich wollte auf die Uhr schauen, konnte aber die Vorstellung von Kälte an meiner Haut nicht ertragen. Die Zeit war so verschwommen wie das Schneegestöber vor dem Wagenfenster, ein Chaos in Grau mit bläulich schimmernden Streifen, die von den Leuchtröhren an der Decke stammten. Seit dem Unfall musste doch mehr Zeit verstrichen sein, als ich gedacht hatte. Es musste auch kälter sein, als der Zugführer noch kurz vor Finse über Lautsprecher bekannt gegeben hatte. Er hatte die Raucher gewarnt, es herrschten zwanzig Grad unter null, und es lohne sich nicht, für zwei Minuten Genuss auf dem Bahnsteig herumzustehen. Aber da musste er sich geirrt haben. Zwanzig Grad unter null hatte ich schon oft erlebt. Aber noch nie hatte es sich so angefühlt wie jetzt. Das hier waren tödliche Minusgrade, und meine Arme wollten mir nicht gehorchen, als ich doch entschied, auf die Uhr zu schauen.
»Hallo!«
Ein Mann hatte die automatischen Glastüren vor den Gepäckfächern aufgestemmt. Er stand breitbeinig auf dem schräg abfallenden Boden, bekleidet mit einem blauen Spezialanzug für Schneemobile, einer riesigen Ledermütze mit Ohrenklappen und einer knallgelben Alpinbrille.
»Ich komme, um euch zu retten«, brüllte er und streifte sich die Brille unter das Kinn. »Und immer ganz ruhig bleiben. Ist nur eine kleine Spritztour bis zum Hotel!«
Was ein einzelner Mann in diesem Wagen voller jammernder Menschen ausrichten könnte, war mir allerdings unklar. Trotzdem schien die bloße Anwesenheit des Burschen auf uns alle beruhigend zu wirken. Sogar das rosafarbene Baby hörte auf zu weinen. Der Junge, der seit dem Unfall in einem fort geflucht hatte, brüllte ein letztes Mal:
»Wird ja auch verdammt noch mal Zeit, dass jemand kommt. Fuck, Mann. Scheiße!«
Dann verstummte er.
Ich war unter Umständen kurz eingeschlafen. Vielleicht war ich im Begriff zu erfrieren. Die Kälte machte mir jedenfalls nicht mehr sonderlich viel zu schaffen. Ich habe von solchen Fällen gelesen. Obwohl ich nicht behaupten will, diese behagliche, einlullende Wärme verspürt zu haben, die angeblich den Erfrierungstod ankündigt, klapperte ich wenigstens nicht mehr mit den Zähnen. Mein Körper schien sich für eine andere Strategie entschieden zu haben. Er wollte jedenfalls nicht mehr kämpfen und zittern. Stattdessen spürte ich, wie ein Muskel nach dem anderen nachgab und sich entspannte. Zumindest in dem Teil meines Körpers, dessen Bewegungen ich weiterhin unter Kontrolle habe.
Ich bin aber nicht sicher, ob ich eingeschlafen war.
Aber mir fehlt ein Stück Erinnerung. Der Retter musste schon vielen geholfen haben, als ich plötzlich zusammenschreckte.
»Was zum Teu–«
Er stand über mich gebeugt. Sein Atem brannte an meiner Wange, und ich glaube, dass ich lächelte. Eine Sekunde später hockte er vor mir und betrachtete meine Knie. Oder vielmehr meine Wade, wie ich kurz darauf erfuhr.
»Sind Sie gelähmt? Sind Ihre Beine gelähmt? Von früher, meine ich?«
Ich ließ mich nicht zu einer Antwort herab.
»Johan«, brüllte der Mann plötzlich, ohne aufzustehen. »Johan! Komm her!«
Er war also nicht mehr allein. Durch den Sturm hörte ich Motorendröhnen, und die Windböen von draußen trugen einen schwachen Abgasgeruch mit sich. Das Dröhnen kam und ging, wurde immer stärker, um dann zu verschwinden, und ich ging davon aus, dass es sich um sehr viele Schneemobile handeln musste. Der Mann, der Johan hieß, ging in die Hocke und kratzte sich den Bart, als er sah, worauf sein Kumpel da zeigte.
»Sie haben einen Skistock in der Wade stecken«, sagte er endlich.
»Was?«
»Ein Skistock hat sich quer durch Ihre Wade gebohrt.«
Er legte fasziniert den Kopf zur Seite.
»Der Stockteller ist abgebrochen und hat sich vor der Hose verkeilt, aber der Stock an sich …«
Jetzt konnte ich seinen Kopf nicht mehr sehen.
»Der ragt auf der anderen Seite zwanzig Zentimeter raus«, rief er. »Sie haben Blut verloren. Ziemlich viel sogar. Frieren Sie? Ich meine, frieren Sie mehr als … der Stab scheint sich ein wenig verbogen zu haben, sodass …«
»Wir dürfen ihn nicht herausziehen«, sagte der Mann mit der gelben Alpinbrille um den Hals, so leise, dass ich es fast nicht hörte. »Dann verblutet sie. Wer war denn bloß so blöd, die Stöcke hier abzustellen?«
Er schaute sich mit vorwurfsvollem Blick um.
»Wir müssen sie sofort rüberbringen, Johan. Aber was zum Teufel machen wir mit dem Stock?«
An mehr kann ich mich, ehrlich gesagt, nicht erinnern.
Von den zweihundertneunundsechzig Menschen an Bord des Zuges Nr. 601 von Oslo nach Bergen, am Mittwoch, dem 14. Februar 2007, verlor also bei der Kollision nur eine Person ihr Leben. Diese Person war der Lokomotivführer, und er wird kaum begriffen haben, was geschehen war, bevor er starb. Wir waren übrigens nicht gegen den Berg geprallt. Unterhalb von Finsenut bohrt sich ein Betonrohr in die Steinmassen, als wäre jemand der Auffassung gewesen, der etwa zehn Kilometer lange Tunnel sei nicht lang genug und müsse deshalb mit einigen Metern hässlichen Betons in der ansonsten schönen Landschaft am Finsevann verlängert werden. Spätere Untersuchungen sollten dann ergeben, dass der Zug circa zehn Meter vor der Tunnelöffnung entgleist war. Die Ursache dafür war eine beträchtliche Eisbildung auf diesem Streckenverlauf. Viele Fachleute haben versucht, mir zu erklären, wie so etwas geschehen kann. In der letzten Stunde vor dem Unglück hatten zwei Güterzüge den Tunnel in der Gegenrichtung passiert. Wenn ich das richtig verstanden habe, hatten sie die wärmere Luft im Tunnel hinaus in die immer kälter werdende Luft vor dem Tunnel geschoben. Ungefähr wie in einer Fahrradpumpe, ist mir gesagt worden. Da kalte Luft Feuchtigkeit schlechter speichern kann als warme, kondensiert die Feuchtigkeit aus dem Tunnel, und diese Tropfen fallen zu Boden und werden zu Eis. Und zu noch mehr Eis. Zu einer so dicken Eisschicht, dass nicht einmal das Gewicht eines Zuges sie zum Bersten bringen kann. Im Nachhinein habe ich mir überlegt, ob das Betonrohr, dessen Zweck sich mir ansonsten nicht erschließt, vielleicht dort liegt, um für eine stufenweise Abkühlung der Luft im Tunnel zu sorgen. Bisher hat mir allerdings niemand sagen können, ob ich mit dieser Annahme recht habe.
Ich kann es nicht fassen, dass ein Wetterphänomen, das seit undenklichen Zeiten bekannt sein muss, einen Zug auf einer Strecke zum Entgleisen bringen kann, die schon seit 1909 in Betrieb ist. Ich lebe in einem Land mit unzähligen Tunneln. Wir Norweger müssten uns mit Eis und Schnee und Sturm im Gebirge doch auskennen. Aber in diesem hochtechnologischen Jahrtausend, mit seinen Flugzeugen und Atom-U-Booten und Fahrzeugen auf dem Mars, mit den Möglichkeiten des Klonens von Tieren und der nanometerpräzisen Laserchirurgie, kann also etwas so Einfaches und Natürliches wie die Luft aus einem Tunnel, die auf einen Wintersturm im Gebirge trifft, einen Zug zum Entgleisen bringen und ihn an einem riesigen Betonrohr zerschmettern.
Ich verstehe das nicht.
Später wurde dieses Unglück die »Finse-Katastrophe« genannt. Aber da es ja faktisch keine Katastrophe war, sondern nur ein großes Unglück, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass dieser Name sich auf all das bezieht, was in den Stunden und Tagen nach der Kollision auf dem Bahnhof und in seiner Umgebung geschah, 1222 Meter über dem Meer. Während draußen der schlimmste Sturm seit über hundert Jahren tobte.
2 Ich lag auf dem Boden einer heruntergekommenen Hotelrezeption, als ich wieder zu mir kam. Der scharfe Geruch von feuchter Wolle und Kartoffeleintopf stach mir in die Nase. Über mir starrte ein ausgestopftes Rentier glasig vor sich hin. Ohne mich umzusehen, spürte ich, dass dieser Raum voller Menschen war, weinender, stummer oder aufgeregt plappernder Menschen.
Vorsichtig versuchte ich mich aufzusetzen.
»Tun Sie das nicht«, sagte eine Stimme, die ich wiedererkannte.
»Ich muss weiter«, teilte ich dem Rentier benommen mit.
Der Mann in dem blauen Schneeanzug erschien plötzlich in meinem Blickfeld. Als er sich zwischen mir und dem Tier herunterbeugte, sah es aus, als trüge er das Geweih.
»Sie bleiben eine Weile hier«, sagte er und grinste. »Wie wir anderen auch. Ich heiße übrigens Geir Rugholmen. Und Sie?«
Ich gab keine Antwort.
Ich hatte nicht vor, auf dieser Reise Bekanntschaften zu schließen. Es stimmt zwar, dass Finse über keine Straßenverbindung zur Umwelt verfügt. Sogar im Sommer ist der historische Bahnarbeiterweg für den normalen Autoverkehr gesperrt, und im Winter kann er an guten Tagen bestenfalls als Schneemobilpiste dienen. Angesichts der Tatsache aber, dass ein Zugwrack in westlicher Richtung auf den Schienen lag und das Unwetter allem Anschein nach von Stunde zu Stunde heftiger wurde, hielt ich es doch nur für eine Frage der Zeit, wann sich die gewaltigen Schneepflüge der norwegischen Staatsbahn NSB von Haugastøl oder Ustaoset hochkämpfen und uns alle in Sicherheit bringen würden. Nach Bergen würde ich vorerst zwar nicht gelangen, aber in Finse würden wir alle nicht sonderlich lange bleiben müssen.
Ein paar Stunden vielleicht.
Kein Grund, sich Freunde zuzulegen.
3 Es stellte sich heraus, dass sich unter den Fahrgästen des Unglückszugs acht Ärzte befanden. Eine erfreuliche Überzahl, die sich damit erklären ließ, dass sieben von ihnen im Haukeland-Universitätskrankenhaus an einem Kongress über Brandverletzungen teilnehmen wollten. Auch ich war dorthin unterwegs gewesen, als der Zug entgleiste. Nicht zu diesem Kongress natürlich, sondern zu einem amerikanischen Spezialisten für Rückgratfrakturen. Seit mich kurz nach Weihnachten 2002 ein Schuss in den Rücken traf und ich von der Taille abwärts gelähmt bin, hat auch mein restlicher Körper begonnen zu kränkeln. Ich brauchte eine Weile, um festzustellen, dass ich nicht mehr so gut hörte wie früher. Ich war bei dem Anschlag mit dem Kopf auf den Boden aufgeschlagen, und die Ärzte waren zu dem Schluss gekommen, dass dabei mein Gehörnerv verletzt worden war. Es spielt aber keine Rolle. Ich brauche kein Hörgerät, auf keinen Fall, und ich komme sehr gut zurecht. Vor allem weil ich selten mit anderen spreche und weil Fernsehapparate einen Lautstärkeregler haben.
Aber ab und zu habe ich Atemprobleme. Hier und da spüre ich einen stechenden Schmerz im Kreuz. Solche Dinge. Kleinigkeiten, finde ich, aber ich hatte mich überreden lassen. Dieser Amerikaner galt eben als außergewöhnliche Koryphäe.
Sieben Ärzte aus dem Zug waren also Fachleute für Verletzungen, an denen keiner von uns litt. Nr. 8 war eine Ärztin, eine etwa sechzigjährige Gynäkologin. Wie durch eine überraschende Gunst der Götter hatten sie alle das Unglück unversehrt überstanden. Und obwohl sie sich eigentlich auf Haut und den weiblichen Unterleib spezialisiert hatten, arbeiteten sie sich doch unbeschwert durch Schnittwunden und Knochenbrüche.
Ich wurde vom Zwerg behandelt.
Er konnte unmöglich größer als eins vierzig sein. Zum Ausgleich war er fast genauso breit. Sein Kopf war viel zu groß für seinen Körper, und die Arme waren noch kürzer, also relativ gesehen, als ich das je zuvor bei Kleinwüchsigen beobachtet hatte. Ich versuchte, ihn nicht anzustarren.
Ich bleibe meistens zu Hause. Das hat viele Gründe, einer davon ist, dass ich das Glotzen der Leute nicht ertragen kann. Weil ich eine normal aussehende Frau mittleren Alters im Rollstuhl bin und ich darum eigentlich für niemanden besonders interessant sein dürfte, konnte ich mir gut vorstellen, wie es diesem Mann ergehen musste. Ich sah es, als er auf mich zukam. Jemand hatte mir ein Kissen unter den Kopf geschoben. Ich war nicht mehr auf die Betrachtung des Rentierkopfs angewiesen, dessen Fell verschlissen war und dessen grobe Nähte die schlechte Arbeit des Präparators verrieten. Als der kleinwüchsige Arzt mit einem seltsamen Watschelgang den Raum durchquerte, öffnete sich eine Gasse, wie damals, als Moses das Rote Meer teilte. Alle Gespräche verstummten, sogar Wimmern und Schmerzensschreie erstarben, als er vorbeiging.
Sie starrten nur. Ich schloss die Augen.
»Mmm«, sagte er und setzte sich neben mir auf die Knie. »Und was haben wir hier?«
Seine Stimme war überraschend dunkel. Ich hatte vermutlich mit einer Art Heliumstimme gerechnet, wie bei einem Clown auf einem Kindergeburtstag. Da es ausgesprochen unhöflich gewesen wäre, den Arzt nicht anzusehen, und da meine geschlossenen Augen zudem den Eindruck erwecken könnten, es gehe mir schlechter, als das tatsächlich der Fall war, öffnete ich sie.
»Magnus Streng«, sagte er und packte mit einer klobigen, riesigen Pranke meine zögernde rechte Hand.
Ich murmelte meinen Namen und konnte mir den Gedanken nicht verkneifen, dass seine Eltern einen ganz besonderen Sinn für Humor besessen haben mussten. Magnus. Der Große.
Er blinzelte kurz und hob den Zeigefinger. Dann breitete sich ein strahlendes Lächeln über seinem Gesicht aus.
»Die Polizistin«, sagte er begeistert. »Sie sind vor ein paar Jahren in Nordmarka angeschossen worden, nicht wahr? Von diesem …«
Erneut nahm sein Gesicht eine aufgesetzte Denkermiene an. Diesmal legte er den Finger an die Schläfe, ehe er noch breiter lächelte.
»Von diesem korrupten Polizeichef, nicht wahr? Das war etwas ganz Be…«
»Es ist lange her«, fiel ich ihm ins Wort. »Sie haben ein gutes Gedächtnis.«
Er unterdrückte sein Lächeln und konzentrierte sich auf meine Wade. Erst jetzt bemerkte ich, dass der allgegenwärtige Geir Rugholmen sich neben den Arzt gesetzt hatte. Sein Schneeanzug war verschwunden. Sein Wollpullover schien noch aus dem Krieg zu stammen, nackte Ellbogen ragten aus beiden Ärmeln. Seine Kniebundhose war vermutlich irgendwann einmal blau gewesen, jetzt aber zu einem undefinierbaren Grauton verwaschen. Der Mann roch nach Lagerfeuer.
»Wo ist mein Stuhl?«, fragte ich.
»Der Stock ist einfach rausgerutscht«, erklärte Geir Rugholmen dem Arzt und schob mit der Zunge seinen Lutschtabak zurecht. »Wir wollten ihn nicht herausziehen, aber wir mussten den Stock kurz vor der Wunde abbrechen, um sie transportieren zu können. Und dann … dann ist er einfach rausgerutscht. Aber die Blutung hat nachgelassen.«
»Wo ist mein Stuhl?«
»Ich weiß, der Stock hätte in der Wunde bleiben sollen«, fuhr Rugholmen fort.
»Wo ist ihr Stuhl?«, fragte Dr. Streng, ohne den Blick von der Wunde zu nehmen, er hatte mein Hosenbein aufgerissen, und ich hatte den Eindruck, dass seine Hände trotz ihrer Größe und ihrer Form schnell und präzise arbeiteten.
»Der Stuhl? Der Rollstuhl? Im Zug.«
»Ich will meinen Stuhl«, sagte ich.
»Ja, verdammt, wir können doch nicht einfach zurückfahren und …«
Der Arzt hob den Blick. Er fischte eine riesige Brille mit Horngestell aus seiner Brusttasche, setzte sie auf und sagte leise:
»Ich würde es über alle Maßen zu schätzen wissen, wenn jemand den Rollstuhl dieser Dame hier holen könnte. Und zwar so schnell wie überhaupt nur möglich.«
»Haben Sie eine Ahnung, was da draußen für ein Wetter ist? Sind Sie …«
»Holen Sie den Stuhl! Und zwar gleich. Ich glaube, Sie würden sich auch nicht gerade wohlfühlen, wenn Ihre Beine in einem Zugabteil lägen und Sie hier hilflos herumliegen müssten. So kompetent wie Sie und Ihre hervorragenden Kollegen in diesem Sturm gearbeitet haben, halte ich es für eine relativ unproblematische Angelegenheit, dieses für unsere Freundin so wichtige Hilfsmittel zu holen.«
Wieder dieses strahlende Lächeln. Ich hatte das Gefühl, dass der Mann sein Handicap bewusst einsetzte. Sobald man im Gespräch aufgehört hatte, auf seine Zirkuserscheinung zu achten, sorgte er sofort dafür, dass er wieder an einen Clown erinnerte. Sein Mund brauchte nicht einmal die traditionelle rote Bemalung, die Lippen waren auch so groß genug. Das war alles sehr verwirrend und bestimmt auch Sinn der Sache. Geir Rugholmen jedenfalls richtete sich widerwillig auf, murmelte eine Bemerkung und ging auf den Windfang zu, wo er seinen Schneeanzug abgelegt hatte.
»Ein Mann der Berge«, sagte Dr. Streng zufrieden, ehe er mir wieder seinen Blick zuwandte. »Und diese Wunde sieht fabelhaft aus. Da haben Sie Glück gehabt. Zur Sicherheit eine kräftige Dosis Antibiotika, und alles wird gut.«
Ich setzte mich auf. Er brauchte nur Sekunden, um mein Bein zu verbinden.
»Wir haben wirklich Glück gehabt«, sagte er leise und steckte die Brille wieder in die Tasche. »Das hätte sehr böse enden können.«
Ich war nicht sicher, ob er von meiner Wunde oder von dem Unfall sprach.
Er rieb die Hände aneinander, als wäre ich voller Staub gewesen. Dann watschelte er weiter zum nächsten Patienten, einem verängstigten Jungen von vielleicht acht Jahren, der den Arm in einer provisorischen Schlinge trug. Während ich versuchte, zum Hoteltresen zu robben, um mich anlehnen zu können, stellte sich ein Mann breitbeinig in den großen Raum. Er zögerte einen Moment, dann sprang er auf einen Stuhl und von dort auf den fünf oder sechs Meter langen, groben Holztisch, der vor den Fenstern Richtung Südwesten stand. Da er etliche Kilo Übergewicht mit sich herumtrug, wäre er dabei fast heruntergefallen. Als er das Gleichgewicht wiedergefunden hatte, erkannte ich ihn. Um seinen Hals trug er einen rot-weißen Schal der Fußballmannschaft Brann Bergen.
»Liebe Freundinnen und Freunde«, sagte er mit einer Stimme, die deutlich machte, dass er oft vor vielen Menschen sprach. »Hinter uns allen liegt ein sehr traumatisches Erlebnis!«
Er wirkte ehrlich begeistert.
»Unsere Gedanken gehen natürlich vor allem zu Einar Holters Familie. Einar war unser Zugführer. Ich habe ihn nicht gekannt, aber ich habe bereits erfahren, dass er ein Familienmann war, ein liebevo–«
»Seine Familie ist von dem Todesfall noch nicht unterrichtet worden«, unterbrach ihn eine Frauenstimme von der anderen Seite des Raumes.
Dort, wo ich saß, konnte ich die Frau nicht sehen. Sie war mir aber jetzt schon sympathisch.
»Es ist nicht gerade angebracht, jetzt eine Trauerrede zu halten, so wie die Dinge stehen«, fuhr sie fort. »Überhaupt finde ich …«
»Natürlich«, sagte der Mann auf dem Tisch und hob die Handflächen zu einem demütigen Segen. »Ich meinte nur, es sei an der Zeit, jetzt, wo es sich herausgestellt hat, dass wir alle in Sicherheit sind und niemand ernsthaft verletzt ist, uns vor Augen zu halten, dass in unserer gemeinsamen Freude über …«
»Brann is’ ’n Scheißverein«, brüllte jemand. Ich erkannte sofort den fluchbegeisterten Jüngling aus meinem Abteil.
Der Mann auf dem Tisch lächelte und öffnete den Mund, um etwas zu sagen.
»Brann is’n Scheißverein«, sagte der Junge noch einmal und stimmte an: »Vål’enga, du bis meine Relljon, einer aus ’ne Milljon, stolze alte Tradizjion!«
»Wunderbar«, sagte der Mann mit dem Brann-Schal und nickte zufrieden. »Es tut gut zu sehen, dass die Jugend so engagiert ist. Überhaupt scheint sich hier drinnen jetzt alles langsam zu beruhigen, und draußen ja auch.«
Er zeigte in Richtung Hoteleingang. Ich hatte keine Ahnung, was sich dort abspielte.
»Ich möchte nur darauf aufmerksam machen …«
Mir tat der Mann fast leid. Alle kicherten. Irgendjemand rief leise: »Buh«, als ob diese Person nicht wagte, sich zu erkennen zu geben, und doch ihre Verachtung zum Ausdruck bringen wollte. Das schien zu wirken. Jedenfalls hatte der Mann den Wohlfühl-Halleluja-Ton abgelegt, als er versuchte weiterzusprechen.
»… dass für alle, die es wünschen, in einer Viertelstunde im Kaminzimmer eine Andacht gehalten wird. Wer auf der Treppe Hilfe braucht, soll bitte Bescheid sagen. Ich bin sicher nicht der Einzige, der …«
»Maul halten!«
Der Junge ließ nicht locker. Jetzt war er aufgesprungen. Er stand nur wenige Meter von mir entfernt und legte die Hände wie ein Megafon an seinen Mund.
»He, du«, sagte ich mit scharfer Stimme. »Du da!«
Der Junge drehte sich zu mir um. Er konnte unmöglich älter sein als vierzehn.
Sein Blick war beängstigend vertraut.
Vielleicht wissen sie es. Vielleicht versuchen sie deshalb immer, ihre Augen zu verstecken, hinter ihren Haaren, im Flackern hinter halb geschlossenen Augenlidern. Dieser Junge hatte seine Mütze viel zu tief in die Stirn gezogen.
»Ja, du«, sagte ich und winkte ihn zu mir. »Komm her. Halt’s Maul und komm her.«
Er rührte sich nicht von der Stelle.
»Soll ich laut erzählen, warum du hier bist, sodass alle es hören können, oder willst du näher kommen? Damit wir eine gewisse … Diskretion wahren können?«
Zögernd machte er einen Schritt auf mich zu. Blieb stehen.
»Komm her«, sagte ich, jetzt eine Spur freundlicher.
Noch einen Schritt. Und noch einen.
»Setz dich.«
Der Junge lehnte sich mit dem Rücken gegen die Rezeption und ließ sich langsam auf den Boden sinken. Er legte die Arme um die Knie und sah mich an.
»Du bist abgehauen«, fasste ich mit leiser Stimme zusammen. »Du wohnst in einem Jugendheim. Du warst in mehreren Pflegefamilien, aber es ist jedes Mal schiefgegangen.«
»Bullshit«, murmelte er.
»Ich will gar nicht diskutieren. Ein Vierzehnjähriger wie du ohne Begleitung … oder gehörst du vielleicht zu einer reizenden Familie, die einfach bei dem schönen Wetter einen Spaziergang macht? Kannst du mir sagen, mit wem du unterwegs bist?«
»Ich bin keine vierzehn.«
»Dann eben dreizehn.«
»Ich bin fünfzehn, verdammt«, fauchte er.
»In ein oder zwei Jahren vielleicht.«
»Im Januar! Vor ’nem Monat. Soll ich das beweisen, oder was?«
Wütend zog er eine Brieftasche aus seiner viel zu großen Jeans. Die Brieftasche aus Nylon war mit Tarnfarben bedruckt und mit einer Kette an einer Gürtelschlaufe befestigt. Als er eine EC-Karte herausfischte, sah ich, dass er sich seine Nägel bis aufs Nagelbett blutig gekaut hatte.
»Himmel«, sagte ich, ohne ihn anzusehen. »EC-Karte und überhaupt. Großer Junge. Na gut, dann sagen wir fünfzehn. Und jetzt hör mir mal zu. Wie heißt du?«
Er hatte ungefähr so großes Interesse daran, sich Winterfreunde zuzulegen, wie ich.
»Wie heißt du?«, wiederholte ich mit scharfer Stimme. Im selben Augenblick las ich seinen Namen auf der Karte, die er wieder in seiner Brieftasche verstaute.
Stumm und abwesend starrte er seinen Mützenrand an. Er strömte einen säuerlichen Geruch aus, als habe jemand seine Wäsche gewaschen und sie nicht richtig getrocknet, ehe sie in den Schrank gelegt worden war.
»Adrian«, sagte ich resigniert. »Jetzt hör mir mal zu.«
Der Junge zuckte zusammen, fuhr sich mit der Hand über die Mütze und starrte mich drei endlose Sekunden lang an.
Adrian war fünfzehn Jahre alt. Ich wusste nichts über ihn, und doch wusste ich alles. So dünn, wie er war, würde er sich nicht einmal richtig prügeln können, ich tippte sein Gewicht unter der viel zu großen Kleidung auf knapp fünfzig Kilo. Adrian hatte eine große Klappe. Ein Dieb, das war ziemlich sicher, und ich war überzeugt davon, dass er auf seinem Weg zu einem zerstörerischen Drogenkonsum schon ziemlich weit gekommen war. Ein kleinkrimineller Mistkerl von fünfzehn Jahren, der noch nicht gelernt hatte, seine Augen zu verbergen.
»Sind Sie Hellseherin, oder was? Wieso wissen Sie …«
»Ja. Ich bin Hellseherin. Und jetzt hältst du die Klappe. Bist du verletzt?«
Er machte eine Kopfbewegung. Ich deutete das als ein Nein.
»Hier ist Ihr Stuhl!«
Hinter Geir Rugholmen wehte ein kalter Luftzug von draußen in die Halle. Erst jetzt fiel mir auf, dass sich die große Rezeption langsam leerte.
»Wir müssen für Sie auch ein Zimmer finden«, sagte er, während er überraschend geschickt meinen demontierten Rollstuhl wieder zusammensetzte. »Die meisten haben hier im Hotel ein Bett bekommen. Aber wir haben auch einige in den Privatwohnungen untergebracht.«
Er zeigte in Richtung Treppe und drehte dann das letzte Rad am Rollstuhl fest.
»Zum Glück war das Hotel so gut wie nicht belegt. Ist nicht gerade Hochsaison im Moment. Aber bald sind Winterferien. Dann wäre es schwieriger gewesen. Die jüngsten und gesündesten Erwachsenen sind in die Häuser in Bahnhofsnähe gebracht worden. Und jetzt brauchen wir ein Zimmer für …«
Er unterbrach sich und musterte Adrian aus zusammengekniffenen Augen.
»Gehören Sie zusammen?«, fragte er skeptisch.
»Gewissermaßen«, sagte ich. »Bis auf Weiteres jedenfalls.«
»Ich glaube, wir haben für Sie Platz in einem der Zimmer in der Nähe der Rezeption. Da sind schon zwei Personen untergebracht, aber wenn wir eine Matratze auf den Boden legen, kann auch Ihr Kumpel …«
»Es geht los«, rief der Mann mit dem Brann-Schal und versuchte, einige Jugendliche zu sich zu winken. Die saßen an dem langen Tisch und aßen etwas, das ich für einen Kartoffeleintopf hielt, das sich später aber als eine sogenannte Straßenarbeitersuppe entpuppte. »Wir versammeln uns hier. Es gibt auch Kaffee und Kuchen!«
Die Reaktion des Publikums fiel offenbar nicht aus wie erwartet. Der Geistliche packte eifrig den Arm einer vorbeigehenden Frau, ließ ihn aber sofort los, weil ihre in seinen Augen modische Wandermütze sich als Hidschab entpuppte.
Die Jugendlichen aßen schweigend weiter. Sie hatten es nicht eilig. Im Gegenteil, ohne den Mann eines Blickes zu würdigen, nahmen sie sich Nachschlag. Jemand fing an, ein nerviges, hänselndes Kinderlied zu summen. Ein Mädchen kicherte und wurde rot.
»Kann irgendjemand diesem Scheißpfaffen bitte bald eine Kugel in den Kopf jagen«, murmelte Adrian, ehe er laut wurde. »Verdammt, ich will nicht mit anderen in ein Zimmer! Scheiße, nein!«
Er schlenderte zu dem langen Tisch hinüber und ließ sich am Ende der Tafel auf einen Stuhl fallen.
Geir Rugholmen kratzte seine dichten blauschwarzen Bartstoppeln.
»Ein kleiner Streithammel, Ihr junger Freund.«
Er wollte mir hochhelfen.
»Nicht«, sagte ich. »Das schaffe ich selbst. Er ist nicht mein Freund.«
»Schön für Sie.«
»Beachten Sie ihn einfach nicht.«
»Geb mir alle Mühe. Soll ich nicht doch …«
»Nein!«
Meine Stimme klang schärfer als notwendig. Das ist häufig so.
Eigentlich ist das fast immer so, um ganz ehrlich zu sein.
»Okay, okay! Ganz ruhig. Herrgott, ich dachte doch nur …«
»Ich brauche auch kein Bett«, sagte ich und zog mich hoch. »Ich möchte lieber hier sitzen bleiben.«
»Heute Nacht? Wollen Sie die ganze Nacht in diesem Stuhl sitzen? Hier?«
»Wann rechnen Sie damit, dass Hilfe kommt?«
Geir Rugholmen reckte sich. Er stemmte die Hände in die Seiten und schaute auf mich herunter. Der Blick der Stehenden, der Aufgerichteten, der Funktionierenden.
Streng genommen macht es mir nichts aus, behindert zu sein. Ich will unbeweglich sein, ich habe mich entschieden, so zu leben. Der Stuhl stört mich im Alltag nicht sonderlich. Oft verlasse ich die Wohnung wochenlang nicht. Probleme gibt es, wenn ich dazu gezwungen werde. Die Leute wollen mir auf Teufel komm raus immer wieder helfen. Heben, schieben, tragen.
Deshalb bin ich mit der Bahn gefahren. Fliegen ist für mich ein Albtraum, das muss ich schon sagen. Zug ist einfacher. Weniger Berührung. Weniger fremde Hände. Der Zug ermöglicht mir ein gewisses Maß an Autonomie.
Abgesehen davon, wenn er entgleist.
Und ich kann diesen Blick der Gesunden und Beweglichen, von oben herab, wirklich nicht ertragen. Deshalb erwiderte ich ihn nicht. Ich schloss die Augen und gab vor, schlafen zu wollen.
»Ich glaube, Sie haben den Ernst der Lage nicht ganz begriffen«, sagte Geir Rugholmen.
»Wir sind im Gebirge eingeschneit.«
»Das kann man wohl sagen. Wir sind verdammt solide eingeschneit. Im Moment wütet da draußen ein Sturm in Orkanstärke. Orkan in Finse! Das kommt wirklich nicht sehr häufig vor. Wir befinden uns auf der windabgewandten Seite von …«
»Mich interessiert im Grunde nur eines: Wann können wir damit rechnen, hier rausgeholt zu werden?«
Es wurde ganz still. Ich merkte trotzdem, dass er da war. Der Geruch nach alter Wolle und Lagerfeuer war unvermindert.
»Ich habe Sie etwas gefragt«, sagte ich leise, mit geschlossenen Augen. »Wenn Sie das nicht beantworten können, dann ist das natürlich in Ordnung. Aber ich habe jetzt vor, ein wenig zu schlafen.«
»Sie sind wie ein Strauß.«
»Was?«
»Sie glauben, dass niemand Sie sieht, wenn Sie die Augen zumachen.«
»Der Strauß steckt den Kopf in den Sand, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und außerdem soll das nur ein Mythos sein.«
Ich gähnte ausgiebig, mit geschlossenen Augen.
»Niemand kann behaupten, ich hätte mir keine Mühe gegeben«, sagte Geir Rugholmen beleidigt. »Wenn Sie hier sitzen und das Arschloch spielen wollen, bitte sehr … Ach, scheiß drauf.«
Seine Skistiefel trampelten über den Boden, und er war verschwunden.
Ich kann so was gut.
Es kann durchaus sein, dass ich danach ein wenig eingenickt bin.
1 laut Beaufortskala:Auswirkungen des Windes im Gebirge
Leichter Zug. Windgeschwindigkeit: 1–5 km/h Wind kaum spürbar. Die Schneeflocken treiben leicht im Wind.
1 Angeblich soll die Kronprinzessin im Zug gewesen sein. Niemand wusste, wo sie sich jetzt aufhielt.
Als ich darauf bestand, dass mein Rollstuhl aus dem Zugwrack geholt wurde, lag das nicht nur daran, dass ich mich ohne ihn hilflos fühle. Mobilitätsmäßig war der Unterschied nämlich nicht sehr groß. Ich würde mich ja doch in der Nähe der Rezeption aufhalten müssen. Die Toiletten lagen zwar im selben Stock direkt neben der Haupttreppe, und das ermöglichte es mir Gott sei Dank, meine Beutel relativ unauffällig entleeren zu können, aber ansonsten gab es keinen Ort, den ich ohne Hilfe hätte aufsuchen können.
Das Wichtigste am Rollstuhl ist, dass er Distanz schafft.
Nicht physisch, Gott bewahre; wie ich schon sagte, werde ich dauernd angestarrt und muss viele Hilfsangebote abwehren. Ich denke hier mehr an eine psychische Distanz. Der Stuhl verändert mich. Er definiert mich als etwas anderes, anders als die anderen, und es kommt nicht selten vor, dass ich für dumm gehalten werde. Oder taub. Es wird im wahrsten Sinne des Wortes über meinen Kopf hinweg geredet, und wenn ich mich zurücksinken lasse und die Augen schließe, dann ist es, als ob ich nicht existiere.
Auf diese Weise erfährt man sehr viel.
Meine Beziehung zu anderen Menschen ist, wie soll ich sagen, von eher akademischem Charakter. Ich möchte lieber nichts mit ihnen zu tun haben, und das kann leicht als fehlendes Interesse gedeutet werden. Das stimmt aber nicht. Menschen interessieren mich. Deshalb sehe ich viel fern. Ich lese Bücher. Ich habe eine DVD-Sammlung, um die viele mich beneiden würden. Früher war ich eine gute Ermittlerin. Eine von den besten, möchte ich behaupten. Das alles wäre unmöglich gewesen ohne Neugier auf die Schicksale anderer, auf ihr Leben.
Aber Menschen in meiner Nähe zu haben, das macht mir zu schaffen.
Ich interessiere mich für Menschen, aber ich will nicht, dass Menschen sich für mich interessieren. Das ist sehr anstrengend. Insbesondere, wenn man von Freunden und Kollegen umgeben ist und wenn man – wie bei der Polizei – im Team arbeiten muss. Nachdem ich angeschossen wurde und fast mein Leben verlor, verließen mich meine Kräfte.
Ich fühlte mich wohl, so ganz für mich allein.
Die Leute starrten, das konnte ich spüren, aber es war trotzdem so, als ob ich nicht existierte. Sie redeten unbeschwert über alles Mögliche. Obwohl viele sich nach der Verteilung der Zimmer zurückgezogen hatten, war es doch noch zu früh, um schlafen zu gehen. Viele kamen deshalb auch zurück in die Lobby, einige lungerten im Rezeptionsbereich herum. Der Schock des Unfalls ließ langsam nach. Das Lachen fiel wieder leichter. Die Situation war nicht mehr bedrohlich, auch wenn der Sturm, der draußen vor dem alten Hotel tobte, stärker war als alles, was wir je erlebt hatten. Es war vielmehr so, dass gerade die zerschlissene Standfestigkeit des Hauses uns beruhigte. Das schiefe braune architektonische Flickwerk trotzte seit fast hundert Jahren Wind und Wetter, und es würde auch in dieser Nacht nicht besiegt werden. Die Ärzte hatten sich durch die Reihen der Hilfsbedürftigen hindurchgearbeitet. Ein paar Jugendliche pokerten. Ich hatte meinen Stuhl in die Nähe des langen Holztisches gerollt, sodass ich die Pokerrunde beobachten und den vielen Menschen zuhören konnte, die aus ihren Zimmern kamen, um sich die letzten Neuigkeiten erzählen zu lassen, um Wunden und Verletzungen zu vergleichen und um aus den riesigen Fenstern in den Sturm zu starren, der vergeblich versuchte, das Hotel Finse 1222zu erobern.
Ich hörte mir an, was die Leute so redeten. Sie glaubten, ich schliefe.
Und als endlich alle satt und verarztet waren, nachdem alle erzählt hatten, wo im Zug sie beim Aufprall gewesen waren, und weil sich außerdem die Gläser mit Bier und Rotwein füllten, galt das größte Interesse der Frage, wo um alles in der Welt Mette-Marit stecken könnte.
Bereits während der Zugfahrt waren Gerüchte im Umlauf gewesen. Zwei Frauen mittleren Alters, die hinter mir gesessen hatten, hatten kaum über etwas anderes gesprochen. Es gebe einen zusätzlichen Wagen, flüsterten sie laut. Den letzten Wagen, ganz anders als der restliche Zug, so sehe der normale Vormittagszug nach Bergen sonst nie aus. Und der hintere Teil des Bahnsteigs sei überdies abgesperrt gewesen. Es müsse also der Königswaggon sein. Er sehe zwar nicht sonderlich königlich aus, aber niemand könne schließlich wissen, wie er eingerichtet sei, und außerdem wisse doch das ganze Land von Mette-Marits Flugangst. Natürlich könne es sich bei der Reisenden auch um Sonja handeln, die die Berge so liebt, das wüssten ja auch alle, aber andererseits sei es eigentlich undenkbar, dass sie so kurz vor dem siebzigsten Geburtstag des Königs auf Reisen ginge.
Ich war aufrichtig erleichtert, als die Damen in Hønefoss ausstiegen.
Ich hatte mich zu früh gefreut.
Der Klatsch hatte neuen Schwung bekommen und war dabei, zur Wahrheit zu werden. Fremde Menschen redeten miteinander. Der Zug wurde immer unnorwegischer, je mehr er sich dem Hochgebirge näherte. Reiseproviant wurde geteilt, Kaffee füreinander geholt. Manche wollten etwas von Bekannten gehört haben, und eine Frau Mitte zwanzig besaß die sichere Information, dass ein alter Schulkamerad aus dem Gymnasium, der jetzt bei der Königlichen Leibwache diente, in dieser Woche nach Bergen reisen musste.
Als wir in Oslo losfuhren, gab es ganz einfach einen zusätzlichen Waggon am Zug.
Als wir uns Finse näherten, war dieser Wagen zum Königlichen Reisewaggon geworden, und alle wussten, dass sich Mette-Marit samt Leibwächtern und mit großer Wahrscheinlichkeit auch dem Prinzen Sverre an Bord befanden. Der war ja noch so klein. Ein älterer, aufgeregter Mann wollte durch das Fenster noch ein kleines Mädchen gesehen haben, ehe er von der Polizei unfreundlich vertrieben worden war, also war auch Ingrid Alexandra mit von der Partie.
Aber wo steckten sie jetzt, diese vielen Königlichen?
An manchen Tagen verstehe ich besser als an anderen, warum ich lieber nichts mit anderen Menschen zu tun haben will.
2 Ihre Stimme war charakteristisch, sie grenzte an eine Parodie. Es heißt, Meinungen an sich seien niemals gefährlich. Ich bin mir da nicht so sicher.
Es ist schwer zu sagen, ob mir Kari Thues Meinungen oder ihr missionarischer Eifer größere Angst machen. Jedenfalls ist sie unheimlich clever. Mit ihrer absurden Logik, ihrem kühnen Umgang mit Tatsachen und ihrem beeindruckenden Glauben an ihre eigene Botschaft könnte sie die Protagonistin in einem Holberg-Stück darstellen. Zudem ist sie verdammt präsent. Und zwar überall: im Fernsehen, im Radio, in den Zeitungen. Kari Thue lässt ängstliche Menschen aggressiv werden und verführt ansonsten kluge Männer zur Torheit. Die Frau mit einer Stimme, die so messerscharf war wie der Mittelscheitel in ihren dünnen Haaren, hatte schon Streit angefangen. An diesem Nachmittag hielten sich in Finse zwei Muslime auf. Ein Mann und eine Frau. Kari Thue ist ein hervorragender Spürhund, und sie hatte schon längst die Witterung des Bösen aufgenommen.
»Ich rede nicht mit Ihnen«, schrie sie. Ich musste meine Augen einen Spaltbreit öffnen. »Ich rede mit ihr!«
Ein ziemlich kleiner Mann mit einem gewaltigen Schnurrbart versuchte, sich zwischen Kari Thue und eine Frau zu schieben, mit der er aller Wahrscheinlichkeit nach verheiratet war. Sie trug dunkle, lange Kleidung und ein eng sitzendes Kopftuch, sie war die Frau, die der Fußballpastor in seiner Verwirrung zur Teilnahme an der Andacht im Kaminzimmer hatte bewegen wollen. Ich hielt die beiden für Kurden. Sie konnten natürlich auch Iraner, Iraker oder von mir aus muslimische Italiener sein, aber ich entschied mich doch für Kurden. Seit ich Nefis kenne, die selbst Türkin ist, habe ich ziemlich gut gelernt, auf Details zu achten, die ich gar nicht genau erklären kann, die aber dafür sorgen, dass ich mich selten irre. Die Frau weinte und schlug die Hände vors Gesicht.
»Da sehen Sie nur«, rief Kari Thue. »Sie haben …«
Der Geistliche mit dem Brann-Schal, der aus den Medien mindestens ebenso bekannt war wie Thue selbst, kam angelaufen.
»Jetzt beruhigen wir uns erst einmal alle wieder«, sagte er mit sonorer Pastorenstimme und legte beruhigend die Hand auf die Schulter des erregten Kurden. »Ich heiße Cato Hammer. Wir müssen alle freundschaftlich miteinander umgehen und Rücksicht nehmen in einer Situation wie …«
Seine andere Hand fuhr über Kari Thues Rücken. Sie reagierte, als ob er sie mit Schwefelsäure eingeschmiert hätte, und drehte sich so schnell um, dass fast ihr kleiner Rucksack von der Schulter gerutscht wäre.
»Hauen Sie ab da«, fauchte sie. »Fassen Sie mich nicht an!«
Er ließ sie sofort los.
»Ich finde, Sie sollten sich jetzt ein wenig beruhigen«, sagte er väterlich.
»Sie haben hier überhaupt nichts zu finden«, sagte sie. »Ich versuche, ein Gespräch mit dieser Frau zu führen.«
Sie war so beschäftigt mit dem jovialen Geistlichen, dass der Kurde die Gelegenheit nutzte. Mit festem Griff umklammerte er den Arm seiner Frau, entfernte sich eilig von der Rezeption und verschwand Richtung Treppenhaus, wo ein geschnitztes Schild an der Decke ankündigte, dass man nun die St. Paal’s Kro betrete.
Ich kann Pastoren nicht leiden. Ich kann auch Imame nicht leiden, obwohl mir Letztere nur sehr selten über den Weg gelaufen sind. Nur ein Mal bin ich einem wirklich netten Rabbiner begegnet, aber das war in New York. Mir liegt das alles nicht, Religionen ganz im Allgemeinen und die Verwalter des Aberglaubens im Besonderen. Am wenigsten habe ich für Pastoren übrig. Und ganz besonders stark reagiere ich auf Geistliche wie Cato Hammer. Sie predigen eine Toleranztheologie, bei der die Grenze zwischen Recht und Unrecht verschwimmt und ich nicht begreife, wozu man sich dann überhaupt eine Religion leisten soll. Sie breiten ihre Arme aus und lächeln fromm. Verurteilen niemanden. Lieben alle. Ab und zu habe ich den Verdacht, dass Pastoren wie Cato Hammer überhaupt nicht an Gott glauben. Sie sind vielmehr in ein Jesus-Klischee verliebt, in den gütigen Mann in Sandalen, mit Dackelblick und einladenden Handflächen, kommt zu mir, ihr armen Kleinen. Ich kann das einfach nicht ertragen. Ich will nicht umarmt werden. Ich will Schwefelpredigten und Drohungen von Fegefeuer und ewiger Verdammnis. Gebt mir Pastoren und Bischöfe mit flammenden Blicken, gebt mir Unversöhnlichkeit, Verachtung und die Verheißung jenseitiger Strafen. Ich will eine Kirche, die ihre Mitglieder über den schmalen Pfad des Lebens peitscht und unmissverständlich darlegt, dass der Rest der Welt der ewigen Finsternis entgegengeht. Auf diese Weise ist wenigstens auch der Unterschied zwischen uns leichter zu erkennen. Und ich muss nicht das Gefühl haben dazuzugehören. Denn darum habe ich zu keinem Zeitpunkt in meinem Leben je gebeten.
Ich mochte den Typen ganz einfach nicht.
Ohne dem Gang der Ereignisse vorgreifen zu wollen, möchte ich aber doch bereits jetzt erzählen, dass mein erster Gedanke, als ich einige Stunden später von Cato Hammers Tod erfuhr, folgender war: Er war kein so schlechter Mensch gewesen.
»Sie dürfen sich nicht so aufregen«, ermahnte er die wütende Furie. »So entsteht Distanz zwischen den Menschen, Kari Thue. Muslime und Islamisten sind nicht dasselbe. So einfach ist das nicht. Sie teilen uns auf in …«
»Idiot!«, fauchte sie. »So etwas habe ich nie gesagt und nie gemeint. Sie aber sind auf diese naive norwegische politische Korrektheit hereingefallen, die es zulässt, dass dieses Land überflutet wird von …«
Ich hörte weg.
Obwohl Religion meiner Ansicht nach wirklich die Geißel der Menschheit ist, kann ich weder Logik noch großes Einfühlungsvermögen darin erkennen, unter den Gläubigen eine Rangordnung aufzustellen. Religion ist immer sowohl Tyrannei als auch Zivilisation, Verstoßen und Einbinden, Liebe und Unterdrückung. Und warum gerade der Islam schlimmer sein sollte als ein anderer Aberglaube, das leuchtet mir nicht ein. Kari Thue hingegen schon. Sie ist die Anführerin einer Bewegung, die behauptet, aus Solidarität Alarm zu schlagen, aus Solidarität mit Frauen, Homosexuellen, Kindern und allem, was es sonst noch so an norwegischen Werten geben mag.
Ich bin allergisch gegen den Begriff Wert.
Und in Verbindung mit dem Adjektiv norwegisch wird das Ganze unerträglich. In ihrem fanatischen Drang, hart gegen die islamistische Weltbedrohung vorzugehen, machen Kari Thue und ihre immer zahlreicheren und beängstigend einflussreichen Spießgesellen den hart arbeitenden, gut integrierten norwegischen Muslimen das Leben schwer.
Das andere Gefühl, das mich überkam, als ich einige Stunden später die Todesnachricht hörte, war eine tiefe Verärgerung darüber, dass nicht Kari Thue anstelle von Cato Hammer starr gefroren in der Schneewehe lag.
Aber so etwas darf man wohl nicht sagen.
3 »Schläfst du?«
»Nein«, sagte ich und versuchte, mich in meinem Stuhl aufzusetzen. »Jedenfalls noch nicht.«
Ich fühlte mich steif. Auch wenn ich meine Beinverletzung nicht spürte, tat mir alles weh wie nach einer Prügelei. Mein Rücken schmerzte, meine linke Schulter war verspannt, mein Mund ausgetrocknet. Dr. Streng hatte sich einen Stuhl herangezogen. Er bot mir Rotwein an.
»Nein, danke. Aber ein Glas Wasser wäre jetzt gut.«
Schon wenige Minuten später war er wieder da.
»Danke«, sagte ich und leerte das Glas in einem Zug.
»Gut«, sagte Dr. Streng. »Es ist wichtig, Flüssigkeit aufzunehmen.«
»Immer«, sagte ich und lächelte verkrampft.
»Entsetzliches Wetter«, sagte er fröhlich.
Auf solche Phrasen gebe ich grundsätzlich keine Antwort.
»Ich wollte vorhin nach draußen gehen«, erzählte er unverdrossen weiter. »Um die Kälte mal zu spüren. Aber das war nicht möglich! Da draußen wütet nicht nur ein Orkan, angeblich hat hier oben niemand je zuvor solche Schneemassen erlebt. Der Schnee bedeckt bereits Wände und Fenster, und … wir haben jetzt sechsundzwanzig Grad unter null, und bei diesem Wind wird die effektive Kälte …«
Er überlegte.
»Eiskalt?«, schlug ich vor.
Ich stellte das Glas auf den Boden. Löste die Bremsen meines Stuhls und nickte dem Arzt kurz zu, ehe ich mich langsam in Bewegung setzte. Aber er verstand diesen Hinweis leider nicht.
»Wir können uns hierhin setzen«, schlug er vor und kam mit zwei Rotweingläsern in den Händen hinter mir hergewatschelt. »Dann können wir uns das Wetter ansehen.«
Ich gab auf und stellte mich vor das Fenster.
»Nicht viel zu sehen«, sagte ich. »Weißes Wetter. Eis. Schnee.«
»Und Wind«, sagte Magnus Streng. »Was für ein Wind!«
Damit hatte er allerdings recht. Der Lärm von draußen zwang alle, ihre Stimmen zu heben, um gehört zu werden. Bemerkenswerter war es jedoch, dass der Wind die Fenster vibrieren ließ, als wäre das Unwetter ein lebendiges Wesen mit Herz und schwerem Puls. Der Blick fand keine Anhaltspunkte, keinen Halt. Keine Bäume, keine Gegenstände, sogar die Wände des Anbaus verschwanden in einem wirbelnden Chaos aus Schnee.
»Ganz ruhig«, sagte eine Stimme hinter mir. »Diese Fenster halten dem Druck stand. Das ist dreischichtiges Glas. Wenn eine Schicht bricht, sind immer noch zwei übrig.«
Geir Rugholmen war offenbar kein nachtragender Mensch. Er setzte sich auf die Tischkante und prostete mir zu. Sein Getränk sah aus wie Cola.
»Bestimmt«, sagte ich.
»Faszinierend«, sagte der Arzt vergnügt. »Diese Fenster hier sind ja nicht so groß, aber in der Blåstue wird einem anschaulich demonstriert, dass Glas ein elastisches Material ist. Sag mal, Rugholmen, kannst du uns erzählen, ob etwas an den Gerüchten stimmt, dass Angehörige der Königsfamilie unter uns weilen?«
Ich war mir sicher, im Gesichtsausdruck des Bergensers eine minimale Veränderung gesehen zu haben. Etwas Wachsames, ein winziges Flackern des Blickes, ehe er sich hinter seinem Glas versteckte.
»Purer Unsinn«, sagte er dann. »Man darf nicht alles glauben, was man hört.«
»Aber dieser Wagen«, protestierte Magnus Streng. »Da war doch wirklich ein Extra–«
»Alles in Ordnung bei dir?«, fragte Rugholmen und sah mich mit einem leichten Lächeln an, als wolle er damit unsere letzte Auseinandersetzung ungeschehen machen.
Ich nickte und schüttelte danach den Kopf, als Magnus Streng abermals versuchte, mir das Rotweinglas aufzudrängen.
»Jetzt müssten eigentlich alle untergebracht sein«, sagte Rugholmen. »Und wir können froh sein, dass wir die anderen rechtzeitig in die umliegenden Häuser schaffen konnten. Im Moment ist es unmöglich, sich draußen zu bewegen. Man wird sofort zu Boden gerissen.«
»Wann werden wir hier abgeholt?«, fragte ich.
Geir Rugholmen lachte. Sein Lachen war hell und dünn, wie das eines Mädchens. Er zog eine Dose Kautabak hervor.
»Du gibst wohl nie auf«, sagte er.
»Wie lange wird dieser Sturm noch dauern?«, fragte ich.
»Lange.«
»Was heißt lange?«
»Schwer zu sagen.«
»Aber ihr müsst doch in Kontakt zum Meteorologischen Institut stehen«, sagte ich und versuchte nicht einmal, meine Verärgerung zu verbergen.
Er rammte sich ein Stück Tabak unter die Oberlippe und steckte die Dose wieder in die Hose.
»Es sieht nicht gut aus«, sagte er. »Aber du kannst beruhigt sein. Wir haben genug zu essen, genug Brennstoff und jede Menge zu trinken. Also mach es dir gemütlich.«
»Da es nun einmal passiert ist«, sagte Magnus Streng, »haben wir doch fantastisches Glück gehabt, dass wir nur wenige Hundert Meter vom Bahnhof entfernt waren. Und auch unsere Geschwindigkeit war deshalb noch nicht so hoch. Etwas unter siebzig Stundenkilometern, habe ich gehört. Und da können wir wirklich vom Glück im Unglück reden. Und dann noch dieses Hotel! Was für ein Zufluchtsort! Was für ein Service! Nur Lächeln und Freundlichkeit überall. Man könnte meinen, dass die jeden Tag Unfallopfer aufnehmen …«
»Wer ist hier eigentlich verantwortlich?«, fiel ich ihm ins Wort und sah Geir Rugholmen an.
»Verantwortlich? Für das Hotel?«
Ich seufzte.
»Für den Unfall?«, fragte er sarkastisch und breitete die Arme aus. »Für das Wetter?«
»Für uns«, sagte ich. »Wer ist für die Rettungsarbeiten verantwortlich? Dafür, uns hier wegzuholen? Soviel ich weiß, liegt die operative Verantwortlichkeit bei der lokalen Polizei. Wer ist das? Die Dienststelle Ulvik? Gibt es einen lokalen Repräsentanten? Ist die Hauptrettungszentrale in Sola …«
»Das waren aber verdammt viele Fragen«, unterbrach Geir Rugholmen mich so laut, dass alle, die in der Nähe saßen, in unsere Richtung blickten. »Und es ist wohl nicht meine Aufgabe, solche Fragen zu beantworten.«
»Ich dachte, du bist vom Rettungsdienst. Dem Roten Kreuz?«
»Da irrst du dich aber gewaltig.«
Er knallte sein Glas auf den Tisch.
»Ich bin Anwalt«, sagte er wütend. »Und wohne in Bergen. Ich habe hier eine Wohnung und habe mir eine Woche freigenommen, um vor den Winterferien die Küche zu renovieren. Als es knallte, brauchte man nicht viel Fantasie, um zu begreifen, was da passiert war. Ich habe ein Schneemobil. Ich habe dir und vielen anderen geholfen und verlange dafür keinen Dank. Aber ein bisschen freundlicher könntest du schon sein? Oder nicht?«
Sein Gesicht war so nah an meinem, dass ich einen feinen Speichelregen spürte, als er weiterfauchte: