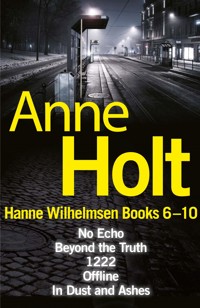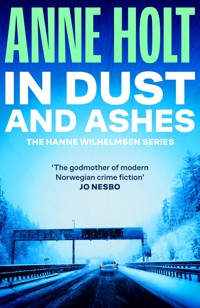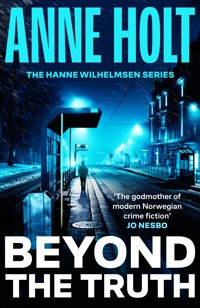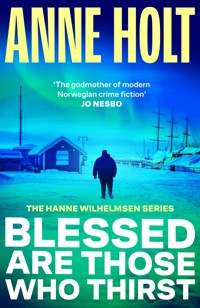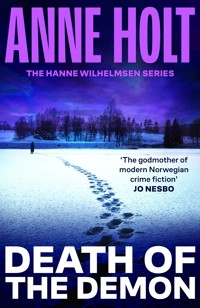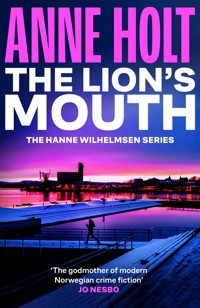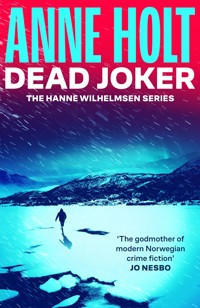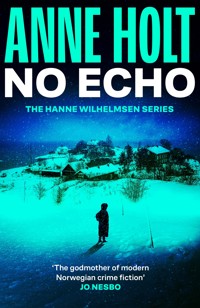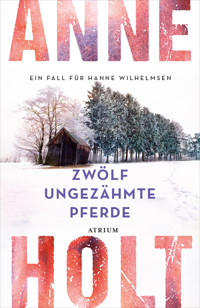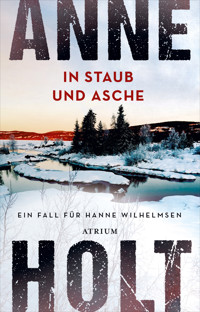18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atrium Verlag AG
- Kategorie: Krimi
- Serie: Hanne-Wilhelmsen-Reihe
- Sprache: Deutsch
Kriminalromane können lebensgefährlich sein. Buchstäblich ... Die ehemalige Kommissarin Hanne Wilhelmsen lebt seit Jahren völlig zurückgezogen. Als in Oslo der erste pandemiebedingte Lockdown stattfindet, sieht sie ihre Chance, die leergefegte Stadt zurückzuerobern. Zur gleichen Zeit kämpft der Polizeibeamte Henrik Holme mit einem mysteriösen Mordfall: Eine Frau wurde im Kofferraum eines Autos gefunden, das Gesicht bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Niemand hat sie als vermisst gemeldet, niemand weiß, wer sie ist. Holme sucht Rat bei seiner alten Mentorin Hanne Wilhelmsen. Doch diese hat keine Zeit für ihn: Hanne hat einen Kriminalroman geschrieben und ihr Verlag ist in heller Aufruhr, weil ein wichtiges Manuskript verschollen ist ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 561
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Anne Holt
Das elfte Manuskript
Hanne Wilhelmsens elfter Fall
Aus dem Norwegischen von Gabriele Haefs
This translation has been published with the financial support of NORLA, Norwegian Literature Abroad
© Atrium Verlag AG, Zürich, 2024
Alle Rechte vorbehalten
Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel Det ellevte manus bei Gyldendal Norsk Forlag AS, Oslo.
Copyright © Anne Holt 2021
Published by agreement with Salomonsson Agency
Lektorat: Nike Karen Müller
Covergestaltung: zero-media.net, München
Covermotiv: imageBROKER.com/Sonja Jordan; FinePic®, München
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
ISBN978-3-03792-209-5
www.atrium-verlag.com
www.facebook.com/atriumverlag
www.instagram.com/atriumverlag
Prolog
I
Die Alte
Es war drei Uhr nachts.
Der Duft von zeitigem Frühling erfüllte die Straßen, getragen von einer schwachen Brise aus den Wäldern im Norden. Geschmolzener Winter und nasser Asphalt. Es regnete nicht, aber die Luft war feucht und fühlte sich kälter an, als sie tatsächlich war. Fernes Meeresrauschen war bis hier oben in Frogner zu hören, wie die Frau im Rollstuhl meinte. Vielleicht irrte sie sich. Ihre Ohren hatten sich noch nicht wieder daran gewöhnt, draußen zu sein. Das Lautbild kam ihr fremd vor. Stille herrschte, doch sie war nicht vollkommen. Ab und zu legte sie den Kopf schräg, um festzustellen, wo ein Fernseher lief oder wo hinter den geschlossenen Fenstern dort oben ein gedämpfter Ruf ertönt war.
Die Frau hatte ihre Wohnung seit über vier Jahren nicht verlassen, außer zum alljährlichen Zahnarztbesuch und einem zweitägigen Aufenthalt im Krankenhaus. Es war ungewohnt, über den unebenen Boden und die Bordsteine zu rollen. Aber sie bekam die Sache allmählich in den Griff. Ab und zu hielt sie inne. An Straßenecken, wo die Ampeln den nicht vorhandenen Autos ihre Befehle erteilten, vor dem einen oder anderen dunklen Schaufenster. Voller Staunen darüber, wie viel sich verändert hatte.
Vier Jahre waren eine Ewigkeit.
Vier Jahre, so schnell vergangen.
Auf diesen Augenblick hatte sie gewartet, ohne es zu wissen: auf die erste Stunde jenes Tages. Es war Freitag, der 13. März 2020, und Norwegen war geschlossen. Alle waren zu Hause. Die Stadt war leer und sicher, und die Frau konnte sich endlich hinauswagen.
Der Stuhl rollte langsam zum Solli plass hinunter. Die Frau trug keine Handschuhe und fror an den Fingern. Bei dem großen Verteilerkreis stellte sie die Bremsen fest und formte die Hände zu einer Kugel, in die sie behutsam Wärme hauchte. Das half, aber nur für einen Moment. Dann schob sie die Hände in ihre Achselhöhlen, blieb einfach sitzen und hoffte, dass alles um sie herum wirklich war.
Sie lebte seit fast sechzig Jahren auf dieser Welt, und viele würden sicher meinen, dass sie ein eingeschränktes Leben führte. Sie selbst war nie so zufrieden gewesen wie jetzt. Eine Pandemie war über die Welt hereingebrochen und hatte sie in die Knie gezwungen.
»Endlich«, flüsterte die Frau in die leere Nacht hinaus.
Endlich war Oslo wieder zu Hanne Wilhelmsens Stadt geworden.
II
Die Junge
Das Foto war so grotesk, dass Hauptkommissar Henrik Holme es mit zusammengekniffenen Augen betrachtete und den Kopf in den Nacken legte, in dem Versuch, das Motiv auf diese Weise weniger aufdringlich aussehen zu lassen.
Das gelang ihm jedoch nicht sonderlich gut.
Nach dem Leichenfund waren Untersuchungen durchgeführt worden, die ergeben hatten, dass die Frau zwischen vierzig und fünfzig Jahren alt war. Sie sah jünger aus, ihr Körper war schlank, fast sehnig. Sie sah aus, als habe sie ihr Leben lang körperliche Arbeit geleistet, ohne davon jedoch erschöpft zu werden. Ihre Hände waren schmal, ihre Finger lang, und auf den Großaufnahmen glaubte er, die Schwielen sehen zu können, die im Obduktionsbericht beschrieben wurden. Die Nägel waren kurz geschnitten, aber ziemlich ungepflegt.
Die Haare waren sehr dunkel und lang, mit einzelnen Grausträhnen in verschiedenen Nuancen. Henrik Holme versuchte sich vorzustellen, wie sie ausgesehen hatte, als sie noch am Leben gewesen war.
Eine Hexe, war sein Fazit.
Er klickte das Bild weg und stieß ein leises Seufzen aus.
Henrik Holme war ein einsamer Mensch, aber er war dennoch ziemlich zufrieden. Das freundlose Dasein machte ihn besonders aufmerksam. Er war ein Mann mit viel Zeit, und der beste Teil dieser Zeit wurde auf den Beruf aufgewendet. Er hatte seine kleine Wohnung in Grünerløkka, seine alte Mutter, die er so oft besuchte, wie er konnte, und an die dreitausend Kolleginnen und Kollegen im Polizeibezirk Oslo. Einige von diesen wussten, wer er war. Einzelne lachten hinter seinem Rücken über ihn, das wusste er, aber die meisten behandelten ihn mit dem Respekt, den er nach seinen Leistungen in seinen neun Jahren bei der Polizei auch verdiente. Aber es war nie mehr als Respekt. Seit Jahren schon hatte niemand mehr ihn zu irgendeinem geselligen Anlass eingeladen. Er selbst traute sich nie zu fragen, wenn er die üblichen Anzeichen dafür wahrnahm, dass ein Freitagsbier oder eine Geburtstagsfeier bevorstanden. Sein dreißigster Geburtstag vor zwei Jahren war unbemerkt verstrichen. Ein Facebook-Profil hätte vielleicht geholfen. Im Besprechungsraum wurden keine Zettel mehr aufgehängt, um auf anstehende Feste oder Fußballspiele hinzuweisen.
Alle waren bei Facebook. Nur Henrik Holme nicht.
Einmal hatte er einen zaghaften Versuch unternommen. Nach zwei Wochen hatte er zwei Freundschaftsanfragen bekommen, beide von Leuten, die ihm gänzlich unbekannt waren. Als er drei Kollegen gefunden und ihnen seine Freundschaft angetragen hatte, hatten sie sich nicht einmal zu einer Antwort herabgelassen. Am Ende hatte er das Konto gelöscht und nie mehr zurückgeblickt.
Henrik Holme fühlte sich bei der Polizei sehr wohl.
Die Arbeit beinhaltete alles, wovon er jemals geträumt hatte. Das Systematische daran sprach ihn an. Der Kontakt zu Menschen außerhalb des Polizeigebäudes tat ihm gut. In der Uniform, die er sehr viel häufiger trug, als vorgeschrieben war, wuchs er über sich hinaus. Opfer und Täter sahen ihn mit einer Mischung aus Hoffnung und Furcht an. Er wusste selbst viel zu viel über Hoffnung und Furcht und hatte eine ganz besondere Fähigkeit dafür entwickelt, ängstliche Menschen gelassener werden zu lassen. Dafür brachten ihm diese Menschen Dankbarkeit entgegen. Manchmal klammerten sie sich fast schon an ihn, als ob er ihr Vater wäre. Oder ein lieber Bruder, in Anbetracht seines Alters. So lange, bis der Fall gelöst war und sie wieder aus seinem Blickfeld verschwanden.
Es gab nichts an seiner Arbeit, was ihm nicht gefiel, abgesehen davon, dass die, die ihn brauchten, am Ende immer wieder verschwanden.
Seit drei Jahren arbeitete Henrik Holme jetzt als Mordermittler. Noch immer war er bei jedem neuen Todesfall so verzweifelt wie bei seinem ersten. Seit er kurz nach seinem Dienstantritt zu einer Villa in Grefsenåsen geschickt worden war, wo ein acht Jahre alter Junge tot auf dem Boden lag. Seine Fantasie ging beim Anblick einer Leiche immer mit ihm durch. Er stellte sich vor, wer die Toten gewesen waren. Was für ein Leben sie geführt hatten. Machte sich Gedanken darüber, wie sie gelacht hatten und geliebt worden waren oder wie einsam sie auf der Welt gewesen waren. Bei jedem Mordfall, mit dem er zu tun hatte, musste er auf dem Heimweg einen Umweg von drei Stunden machen, um sich wieder zu beruhigen.
Henrik Holme war ein Wanderer. Er streifte zu allen Tageszeiten durch Oslo. Jede Gasse, jeder Winkel und jede Straßenecke, im Zentrum und am Stadtrand: Henrik Holme kannte die Stadt, in die er mit neunzehn Jahren zum ersten Mal einen Fuß gesetzt hatte, wie seine Westentasche.
Er schlenderte durch die Straßen und fühlte sich einsam, und dadurch interessierte er sich umso mehr für Lebende und für Tote.
Vor allem für Tote, und abermals klickte er das Bild der verstümmelten Frauenleiche auf. Vielleicht hatte sie eine krumme Nase gehabt. Ein spitzes Kinn. Möglicherweise mit einer Warze. Eine richtige Hexe.
Das war schwer zu sagen, denn dort, wo ihr Gesicht hätte sein müssen, klaffte ein blutiger Krater der Verwesung.
III
Die Neue
Ebba Braut hatte noch nie so einen faszinierenden Kriminalroman gelesen.
Nachdem sie am Vortag den Ausdruck überflogen hatte, hatte sie die halbe Nacht dagesessen und alles noch einmal gelesen. Gründlich.
So vertieft war sie gewesen, und so müde war sie jetzt, dass sie die dramatische Pressekonferenz der Regierung am Vortag total vergessen hatte. Lockdown. Pandemie. Obwohl die Stadt ungewöhnlich still gewirkt hatte, als sie die wenigen Hundert Meter von ihrer kleinen Wohnung in Sankthanshaugen zu Fuß zum Verlag gegangen war, fiel ihr die Sache mit dem Homeoffice erst wieder ein, als sie neben der alten Deichmanske Bibliotek stand und an der prachtvollen Eingangspartie hochschaute.
Das Verlagshaus Storkhøj, zweifelsohne Norwegens größter Verlag, hatte das vernachlässigte Gebäude 2015 gekauft, als die Zentralbibliothek nach Bjørvika verlegt worden war. Die Instandsetzungsarbeiten sollten anderthalb Jahre in Anspruch nehmen und zweihundert Millionen Kronen kosten. Am Ende kostete es so viel, dass die Eigentümer den Betrag nicht nennen wollten, und die Arbeiten hatten das vierte Jahr erreicht, als die über vierhundert Angestellten endlich das Haus in Beschlag nehmen konnten. Und wenn sich Kauf und Renovierung einer heruntergekommenen Zentralbibliothek in den nächsten hundert Jahren vielleicht nicht amortisieren würden, so waren jedenfalls die Räumlichkeiten von Storkhøj zu Europas schönstem Verlagsgebäude gekürt worden, als endlich alles und alle ihren Platz gefunden hatten.
Ebba Braut liebte das Gebäude, aber mehr noch die Vorstellung, dass das hier wirklich ihr Arbeitsplatz war.
Sie hielt inne und betrachtete die polierten Stahlbuchstaben an der Querwand des nach Südosten gelegenen Nebengebäudes. Die Buchstaben wurden von hinten angeleuchtet. Es war früh am Morgen, und vielleicht hatte sie deshalb nicht auf die Stille in den Straßen geachtet und wurde überrumpelt von der Mitteilung, die ihr zuteilwurde, als sie am Eingang auf einen Wachmann in Signalweste stieß.
»Homeoffice«, sagte er schroff, als sie die Treppe ansteuerte.
»Huch?«
Ebba Braut zuckte zusammen und legte den Kopf schief.
»Das hatte ich total vergessen.«
Sie hatte den Mann noch nie gesehen. Er musterte sie skeptisch.
»Man kann ja wohl kaum vergessen, dass Norwegen geschlossen ist.«
»Doch«, sagte sie. »Ich kann, wirklich. Ich habe die ganze Nacht ein Manuskript gelesen. Kann ich kurz reingehen und ein paar Sachen holen, die ich brauche? Computer und so was? Ich habe nur eine winzige Wohnung und kein …«
»Und was ist das da?«, unterbrach er sie und zeigte auf ihre Umhängetasche, aus der ein Laptop herauslugte. In ihrer Eile hatte sie ihn nicht ordentlich verstaut, ehe sie von zu Hause aufgebrochen war.
»Das ist mein privater. Und wenn ich von zu Hause aus arbeiten soll, brauche ich einen, der mit dem Server hier verbunden ist.«
Ebba Braut zeigte mit der ganzen Hand auf das Nebengebäude, als ob sich dort Storkhøjs Computerzentrale befände.
Der Mann warf einen Blick auf seinen blauen Klemmblock.
»Wie heißen Sie?«
Ebba antwortete.
Ein faszinierend schmaler Zeigefinger huschte über die Listen. Jedes Mal, wenn er umblättern musste, leckte er den Finger an. Diese Angewohnheit wird er während der Pandemie wohl ablegen müssen, dachte Ebba, sagte jedoch nichts. Stattdessen lächelte sie strahlend und freundlich.
Das half. Jedenfalls ließ er sie durch, unter der Bedingung, dass sie nicht länger als eine halbe Stunde brauchte. Ebba versprach, es schneller zu schaffen, und betrat das Gebäude.
In dem großen Verlagshaus war es noch nie so still gewesen. Sogar das Directional Sound System gleich neben dem Eingang war ausgeschaltet. Die Stimmen, die sonst die Gäste vom Deckengewölbe her mit Zitaten willkommen hießen, wurden jede Woche ausgetauscht. An den letzten vier Tagen hatte der erfolgreichste Lyriker des Verlags Gedichte vorgetragen für alle, die das Haus betraten. Die meisten konnten der lebensmüden, klagenden Stimme nicht widerstehen und lauschten eine Weile, ehe sie weitergingen. Bisweilen war es schwierig gewesen, hereinzukommen, weil zu viele Menschen zuhören wollten.
Damit war jetzt ebenfalls Schluss.
Überhaupt hatte sich die Welt gewaltig verändert. Ebba Braut bog nach links ab und ging in den ersten Stock hoch. Die Abteilung für norwegische Belletristik verfügte in diesem Gang über neun Büroräume. Ihrer war der kleinste, was befremdlich erscheinen mochte, da sie ihn von der angesehensten und erfahrensten Lektorin des Verlags geerbt hatte. Aber das spielte keine Rolle. Ebba kam sehr gut zurecht damit, solange genügend Platz für ein Bücherregal, einen Schreibtisch und einen einigermaßen bequemen Sessel war. Und für alle Pflanzen und kleinen Dinge, mit denen sie ihr Büro wohnlich gestaltet hatte.
Ein bisschen überfüllt vielleicht, aber es war immerhin ihr Büro.
Ein eigenes Büro ganz für sich allein und mit abschließbarer Tür, das hatte sie noch nie gehabt.
Der Raum ganz hinten, das Eckzimmer mit Blick auf den vom Abriss bedrohten Y-Block, gehörte Marion Kovig. Sie war die Programmleiterin der Belletristik und wurde selten anders genannt als die »Chefin«. Ob das liebevoll gemeint war oder ob damit auf subtile Weise angedeutet werden sollte, sie sei autoritär, wusste Ebba Braut noch nicht. Die Chefin hatte jedenfalls die Sache mit dem Homeoffice offenbar ebenfalls vergessen, denn sie stand vor ihrer eigenen Bürotür, die Hand auf der Klinke, und starrte die Wand an, als ob sie versuchte, sich an irgendetwas zu erinnern. Als Ebba ihr Büro betreten wollte, schaute die andere Frau nach links, und ihre Blicke trafen sich.
»Du hier? Jetzt?«
Die Stimme der Chefin war freundlich, aber Ebba spürte, wie ihr Pulsschlag beschleunigte. Bisher hatte sie erst zwei Mal mit Marion Kovig gesprochen. Das erste Mal vor drei Monaten, bei ihrem Bewerbungsgespräch. Damals musste Ebba Braut einen guten Eindruck gemacht haben, denn sie wurde eingestellt, obwohl es noch hundertzweiundfünfzig weitere Bewerbungen gegeben hatte. Trotz ihres jungen Alters und ihrer ungewöhnlichen Ausbildung.
Zum zweiten Mal waren sie einander am vergangenen Montag begegnet. Das war Ebbas erster Arbeitstag im Verlag gewesen, und Marion Kovig hatte sehr viel weniger entgegenkommend gewirkt. Sie hatte etwas Abwesendes gehabt, als sie gegen Mittag in dem winzigen Büroraum aufgetaucht war, um die neue Mitarbeiterin willkommen zu heißen. Ihr Blick hinter der Brille mit den getönten Gläsern war unstet gewesen. Ebba hatte die Frage gegoogelt, warum jemand sich dafür entscheiden könnte, die Welt in gelbem Licht zu sehen, war aber nicht viel klüger geworden; immerhin hatte sie erfahren, dass auch Jo Nesbø und Bono auf diesen wenig beschriebenen Effekt schworen.
Es wirkte fast, als bereue Marion Kovig, Ebba angestellt zu haben, und müsse sich nun aufgrund der unbeugsamen norwegischen Arbeitnehmerrechte damit abfinden.
»Ich hatte den Lockdown total vergessen«, sagte Ebba verlegen. »Aber ich brauche noch … ein paar Sachen von hier. Den Rechner und so weiter. Und meine Manuskripte.«
Die Chefin fuhr sich mit der Hand durch die halblangen kupferroten Haare und drückte die Klinke herunter. Mit einem kurzen Nicken wollte sie in ihr Büro verschwinden, als Ebba sich ein Herz fasste:
»Das unterste Manuskript ist wirklich vielversprechend«, sagte sie laut und schluckte.
»Das unterste?«
Sogar hier auf dem halbdunklen Gang konnte Ebba sehen, dass sich die Augenbrauen der Chefin hinter den großen gelben Brillengläsern ein wenig hoben. Ob das aus Interesse war oder aus Verärgerung, war unmöglich zu erkennen.
»Ja. Im Stapel, meine ich. In dem Berg von unverlangt eingereichten Manuskripten. Der Rest ist eigentlich nicht der Rede wert, aber das hier …«
Eifrig begann sie, in ihrer umfangreichen Schultertasche zu wühlen. Sie bekam einen dicken Papierstoß zu fassen und zog ihn heraus.
»Ein Kriminalroman«, sagte sie zaghaft. »Etwas ganz Besonderes. Frisch und unverbraucht, aber auf altmodische Weise, könnte man sagen. Fast ein wenig …« Sie suchte nach einem passenden Wort. Die Chefin stand noch immer mit einem Fuß auf der Türschwelle.
»… britisch«, beendete Ebba ihren Satz. »Ein bisschen wie die großen Britinnen. Wie P.D. James zum Beispiel. Es ist sogar ein Polizeiroman. Eine ziemlich langsame, breit angelegte Erzählung, mit einer komplexen Handlung. Spannende Hauptpersonen, kaum Schilderungen von Gewalt. Eine in vieler Hinsicht ziemlich …«
Abermals wägte sie ihre Wortwahl ab.
»… graue Geschichte. Alltäglich, aber brutal. Roh, aber leise. Für einen Erstling wirkt das Manuskript erstaunlich reif.«
»Hm.«
Marion Kovig ließ ihre Bürotür los und kam mit ausgestreckter rechter Hand auf Ebba zu.
»Gute Krimis interessieren uns immer«, sagte sie. »Autorin oder Autor?«
»Es ist eine Frau. Aus dem Begleitschreiben geht hervor, dass sie früher selbst bei der Polizei war und …«
»Früher? Wie alt ist sie denn?«
Eine vage Skepsis war in der Stimme der Chefin aufgetaucht. Sie hielt inne und ließ ihre Hand sinken, als wäre ihr plötzlich eingefallen, dass man Abstand halten sollte.
»Geboren 1960«, sagte Ebba.
»1960? Dann ist sie … sechzig Jahre alt?«
Das Interesse sank schlagartig.
»Debütanten in diesem Alter kosten in der Regel viel mehr, als sie einbringen«, sagte die Chefin. »Bestenfalls sind sie Eintagsfliegen.Sie haben nur diese eine Geschichte, und nur die können sie erzählen. Künstlerische Schöpferbegabung dagegen …«
»Kannst du nicht einfach mal reinlesen?«, fiel Ebba ihr eifrig ins Wort und merkte, dass sie wegen dieser Respektlosigkeit rot wurde. »Als eine Art … Einweisung? Für mich, meine ich.«
Die Chefin schob die Brille nach unten und musterte Ebba über den Brillenrand hinweg mit scharfem Blick.
»Ich lese zwar alles, was wir veröffentlichen«, sagte sie langsam. »Aber wenn ich mich auch noch mit den unsortierten Stapeln beschäftigen wollte, dann müsste ich …«
Sie blickte auf das Manuskript, das Ebba jetzt mit dem rechten Arm an sich drückte. Die Autorin hatte ein Titelblatt beigelegt, auf dem der Name des Krimis und ihr eigener in großen, fetten Lettern zu lesen waren.
»Was?«, rutschte es Marion Kovig heraus. »Lass mal sehen, bitte.«
Sie trat einen Schritt auf Ebba zu, schnappte sich das Manuskript und schlug mit geübter Handbewegung das Titelblatt auf. In ihren Mundwinkeln spielte ein Lächeln, da war Ebba Braut sich sicher.
»Himmel«, sagte die Chefin. »Ich muss schon sagen. Das überrascht mich. Kennst du sie?«
»Die Autorin? Äh … nein.«
»Dann bist du zu jung. Sie ist ziemlich bekannt. Oder war es zumindest. In den Neunzigerjahren und ein Stück weit ins neue Jahrhundert hinein. Norwegens berühmteste Ermittlerin, damals auf jeden Fall. Ziemlich eigenwillig, glaube ich. Und wirklich schräg, die Frau, nach allem, was ich gehört habe. Sie wurde im Dienst angeschossen, glaube ich mich zu erinnern, und ist danach einfach von der Bildfläche verschwunden.«
Nun strahlte sie übers ganze Gesicht. Ihre Zähne waren regelmäßig und ein kleines bisschen zu hell für ihr Alter.
»Ist das auf die altmodische Weise gekommen?«, fragte sie.
»Was?«
»Auf Papier? Oder elektronisch?«
»Es lag einfach da, in meinem Erbstapel. Mit einem Begleitschreiben. Einem vorbildlich kurzen Begleitschreiben, übrigens. Ob es ursprünglich als PDF gekommen ist, weiß ich nicht.«
»Mach für mich eine Kopie«, sagte die Chefin. »Jetzt sofort, bitte.«
»Ich darf nur eine halbe Stunde hierbleiben«, wandte Ebba ein, ohne nachzudenken. »Das hat jedenfalls der Typ unten vor der Tür gesagt. Und das hier ist das einzige Exemplar. Und ich habe sehr viele Randbemerkungen reingeschrieben.«
»Umso besser. Dann bekomme ich einen Eindruck davon, wie du arbeitest. Für die Einweisung, wie du selbst gesagt hast.«
Sie war bereits auf dem Weg zurück in ihr Büro.
»Denn das ist plötzlich interessant geworden«, sagte sie mit dem Rücken zu Ebba.
Sie lispelte ein wenig, und Ebba ertappte sich bei der Frage, ob sie das charmant oder irritierend fand. Vor allem irritierend, vielleicht, wie auch die gelben Brillengläser, durch die die Chefin sie nun erneut anstarrte, während sie befahl:
»Finde raus, ob dieses Manuskript nur an uns geschickt worden ist oder ob es schon eine Runde durch die Verlagsszene gedreht hat.«
Sie unterbrach sich. In der Ferne war ein Kompressor eingeschaltet worden. Sie hob die Stimme und drehte sich langsam wieder zur Tür.
»Hanne Wilhelmsen«, sagte sie mit einer Mischung aus Respekt und Verwunderung. »Ich wusste nicht einmal, dass sie noch lebt. Und nun hat sie einen Polizeiroman geschrieben. Sieh an, sieh an.«
Einen Moment lang blieb sie in Gedanken versunken stehen, dann hob sie die Hand zu einem kurzen Gruß und setzte sich wieder in Bewegung. Vielleicht sollte es auch ein Kommando sein, dachte Ebba und eilte weiter in Richtung Kopierraum.
IV
Die Älteste
Der Totengräber war ein Mann Anfang siebzig, und sein kleiner Schaufelbagger war defekt. Die Arbeit dauerte deshalb viel länger als sonst.
Das machte nichts.
Astrid Hrossaland hatte ein langsames Grab verdient. Zu ihren Lebzeiten hatten sich nur wenige um sie gekümmert, und jetzt, einige Tage, nachdem sie zum letzten Mal die Augen geschlossen hatte, hatte sich niemand gemeldet, um sie unter die Erde zu bringen. Am Ende hatte die Gemeinde die Sache in die Hand nehmen müssen.
Dem Kirchenbuch nach war sie kürzlich dreiundsiebzig geworden. Kein hohes Alter heutzutage, dachte der Gräber und legte eine Verschnaufpause ein. Er stützte sich auf seinen Spaten und schaute in das Loch, das bald groß genug sein würde. Es hatte gedauert, den gefrorenen Boden aufzutauen, aber er hatte mehr als genug Zeit. Er setzte seinen ganzen Ehrgeiz daran, die Gräber für die Särge exakt rechteckig zu machen. Zehn Zentimeter Spielraum auf jeder Seite des Sarges genügten in seinen Augen, aber dann mussten die Wände haargenau lotrecht sein. Es konnte leicht passieren, dass der Sarg in Schräglage geriet, wenn er nicht aufpasste, und dann würde die Kiste auf halbem Weg nach unten stecken bleiben. Das wollte er unbedingt vermeiden.
Dann sollte es lieber dauern.
Sie waren gleich alt, Astrid und er. Waren zusammen zur Schule gegangen, jedenfalls in den ersten zwei, drei Jahren, als die Obrigkeit es noch barmherzig gefunden hatte, den Kleinen eine Art Schulbesuch zukommen zu lassen. Die Mutter war bei Astrids Geburt gestorben, und der Vater, ein Arbeiter im Sägewerk, der ungefähr gleichzeitig arbeitslos geworden war, hatte sich zu Tode gesoffen, als seine Tochter zehn war. Was danach aus ihr geworden war, wusste offenbar niemand so genau. Auf jeden Fall war sie als Erwachsene wiederaufgetaucht. Irgendwer hatte sie in einer alten Hütte in Hovet untergebracht, gerade so weit vom Ortskern entfernt, dass sie ihre Ruhe hatte. Und zugleich nah genug, dass sie ihn zu Fuß erreichen konnte. Viele Jahre lang hatte sie sich vor allem in den Bergen herumgetrieben. Sie konnte für Wochen oder Monate verschwinden, ehe sie plötzlich und wie aus dem Nichts wiederauftauchte und für einige Tage in Hovet ihr Lager aufschlug. Angeblich spukte es dort, ein Gerücht, das Astrid sicher recht gut gefallen hatte, dachte der Gräber. Das hielt ihr die Leute vom Leib. Und egal, wie verschroben sie war, sie gehörte schließlich dazu. Sie war im Dorf geboren worden und erregte deshalb auch kein sonderliches Aufsehen, als sie aus dem Waisenhaus zurückkehrte, in dem sie angeblich aufgewachsen war.
Was ihr gefehlt hatte, wusste er nicht. Als Kind hatte er gehört, sie sei geistesschwach. Zurückgeblieben. So geboren, die Arme, sagten die Erwachsenen, wenn sie glaubten, dass er sie nicht hörte. Er selbst war sich nicht sicher. Astrid war zwar wortkarg, aber der Blick unter dem zerzausten Schopf war absolut wach und klar. Fast wie der eines Eichhörnchens, immer auf der Hut. Oder wie ein Hermelin. Sie konnte zudem allerlei Arbeiten im Dorf verrichten, mal hier, mal da, als die Jahre vergingen und die Menschen Vertrauen zu ihr entwickelten. Astrid Hrossaland war eine ungeheuer fähige Putzkraft, und zudem konnte sie Hütten und Häuser im Tal im Auge behalten, die zeitweise leer standen. Sie mochte zwar dumm sein, aber den Umgang mit einem Mobiltelefon hatte sie schon sehr früh gelernt. Sie hatte es immer bei sich, worüber hinter ihrem Rücken geschmunzelt wurde. Sie konnte ja fast nicht sprechen. Nicht, dass es den Gräber wirklich interessiert hatte, aber er hatte mehr als einmal gesehen, wie sie das Telefon ans Ohr hielt. Um einfache Mitteilungen entgegenzunehmen, dachte er, und außerdem gab es ja SMS.
Vermutlich lag es an ihrer Schweigsamkeit, dass die Leute ihr aus dem Weg gingen. Natürlich konnte auch das Muttermal eine Rolle spielen, das ihr Gesicht zerteilte. Die linke Seite lag immer in einem tiefen blauen Schatten, und die Haut war körnig. Das brachte andere dazu, sich von ihr abzuwenden. Sogar einen Bogen um sie zu machen. Er hatte es selbst gesehen: Wenn jemand sie bezahlte, beeilten sich die anderen nach Kräften, sie aus dem Haus und fortzuschaffen.
Astrid Hrossaland hatte ihr Leben als halbwegs Ausgestoßene gelebt, und sie war ohne Angehörige gestorben.
Der Totengräber griff wieder zum Spaten und ließ sich ins Loch gleiten. Der Boden war immerhin aufgetaut, und die weiche Erde machte ihm keine größeren Probleme.
Es war schon spät, als er sich endlich zufriedengab.
Hier oben auf dem Friedhof, auf einem breiten Felsvorsprung ungefähr auf halber Höhe des Hangs, war es in der Regel ziemlich still. Nun aber schien der Tod selbst das Tal angehaucht zu haben. Sogar die Vögel, die um diese Jahreszeit einen Höllenlärm veranstalteten in ihrem Eifer, sich Partner und Nachkommen zuzulegen, waren verstummt. Der Gräber strich den Erdhaufen auf dem schwarzen Grab an einer Seite mit dem Spaten glatt und ließ seinen Blick über das Dorf schweifen.
In allen Häusern brannte Licht. Kaum ein Auto war unterwegs.
Dieses neue, allgegenwärtige Virus verhieß nichts Gutes.
Vor über sechshundert Jahren hatte der Schwarze Tod die Gegend entvölkert. Der Gräber interessierte sich für Geschichte und hatte viel darüber gelesen, wie die Einödhöfe nach und nach verfallen und fast verschwunden gewesen waren, bis die Menschen abermals nach oben gekrabbelt kamen, aufs Neue Land rodeten und ihre Hütten auf den Grundrissen der alten errichteten.
So schlimm konnte es diesmal doch nicht sein.
Eher wie die Spanische Grippe, dachte er.
Die war schlimm genug gewesen. Zu schlimm. Er schüttelte den Kopf und rammte den Spaten in den Erdhügel, wo er stecken blieb.
1968 hatte er selbst die Mao-Krankheit gehabt. Oder die Hongkong-Grippe, wie der herbeigerufene Arzt sie genannt hatte. Der Gräber war damals einundzwanzig Jahre alt gewesen, aber einige Tage lang hatte er sich so elend gefühlt, dass er glaubte, dem Tod ins Auge zu blicken. Zum Glück hatte seine Mutter ihn rechtzeitig vom Straßenbau in Østerdalen weggeholt, wo er damals arbeitete, und mit guter und liebevoller Pflege konnte er vierzehn Tage später, elf Kilo leichter und schwach wie ein Wickelkind, vom Krankenlager aufstehen.
Die Mao-Krankheit war auch eine Pandemie gewesen.
Aber niemand hatte deshalb Norwegen abgeriegelt, dachte der Gräber und warf noch einen Blick in das klaffende Rechteck.
Er selbst müsste sich einigermaßen sicher fühlen können. Er war Witwer, lebte allein und war eigentlich in Rente. Das Geld kam jeden Monat auf sein Konto, und daran konnte niemand etwas ändern. Die Arbeit als Gelegenheitsgräber hatte er, weil niemand sonst sie wollte und weil Pastor und Bürgermeister ihn für einen umgänglichen Mann hielten. Hier oben war er ziemlich allein, und im Fernsehen war am Vorabend mehrfach gesagt worden, im Freien dürfe man sich unbesorgt aufhalten.
Das neue Virus, dessen Namen er sich noch nicht gemerkt hatte, war beängstigend, aber daran konnte er ja nun nichts ändern. Ein langes Leben hatte ihn gelehrt, sich auf seine Aufgaben zu konzentrieren. Er wischte sich Erde und Sand vom Hosenbein, zog den Spaten wieder aus dem Boden und machte sich auf den Weg zum Schuppen hinten in einer Ecke des Friedhofs. Doch nach wenigen Schritten drehte er sich um.
Astrid Hrossaland hatte wenigstens nicht mehr miterleben müssen, dass Norwegen wegen einer lebensgefährlichen Krankheit ganz einfach geschlossen wurde. Vielleicht hätte sie nicht einmal begriffen, was ein Virus war, und deshalb hätte sie als eine der Ersten angesteckt werden können. Das ist ihr erspart geblieben, tröstete sich der Gräber. Morgen würde sie sicher und geborgen im Grab liegen. Er würde sie mit Erde bedecken, und er würde ein kleines Holzkreuz aufstellen, bis irgendjemand mit einem angemessenen Stein käme.
Was vermutlich niemals passieren wird, dachte er, zuckte mit den Schultern und beschloss, Feierabend zu machen.
Die Geschichte
I
Wenn der Alte nicht diese übergroße Prostata hätte, wäre alles leichter.
Henrik Holme saß wie üblich allein in seinem Büro. Es war inzwischen Montag, und Norwegen war im wahrsten Sinne des Wortes geschlossen. Das große Militärmanöver Cold Response war bereits einen Tag, bevor die Regierung den Schlüssel umgedreht und die Bevölkerung eingesperrt hatte, abgeblasen worden. Das Oberste Gericht hatte alle mündlichen Verhandlungen eingestellt. Die Gerichte liefen nicht einmal auf halbem Dampf. Der Polizei dagegen hatte die Justizministerin vierhundert neue Stellen versprochen, aber von denen hatte Henrik Holme noch nichts gesehen.
Die Besprechung war vorüber, und auch dieses Mal hatte er nicht besonders viel gesagt. Im Haus herrschte eine neue Unruhe. Oder vielleicht war es eher die Ruhe, die alles anders machte. Das Publikum, das sonst in das riesige Foyer im Erdgeschoss strömte, um einen Pass oder Ähnliches zu beantragen, blieb aus. Niemand durfte persönlich erscheinen, um eine Straftat zu melden. Waffenangelegenheiten wurden nicht behandelt. Das Stimmengewirr von allen, die sonst im gewaltigen Bauch des Polizeigebäudes ein und aus gingen, strömte sonst bis zur mehr als zwanzig Meter höher gelegenen Decke empor. Empor und durch die engen Gänge in jedes Stockwerk, zu denen nur die Polizei selbst Zutritt hatte. Das Summen von menschlicher Anwesenheit war der Puls des Gebäudes, und jetzt war er verstummt.
»Ansteckungsvermeidungspolizei«, hatte der Abteilungsleiter zu Beginn der Besprechung gefaucht, gefolgt von wütenden Verwünschungen und dem Schrammen von Stuhlbeinen, als die Stühle möglichst weit weg voneinander gezogen wurden.
Henrik Holme schätzte stets den Respekt, den die Polizei dem Opfer bei einem Mordfall erwies. In alten Fernsehserien hatte es den Anschein, als ob Galgenhumor und lockere Sprüche zum Alltag unter Mordermittlern gehörten. Das war jedoch vollkommen falsch. Die Osloer Polizei hielt Ordnung in ihren Angelegenheiten und ihrer Moral, und hier war Anstand angesagt. Vom Leichenfund bis zu dem Augenblick, in dem möglicherweise ein rechtskräftiges Urteil ergangen war.
Sicher lag es an all den ungewohnten Umständen, die die Sache mit der gesichtslosen Frau zu einer Ausnahme machten. Henrik konnte jedenfalls keine andere Erklärung dafür finden, dass zwei Kollegen ungestraft Bemerkungen über das Aussehen der Toten hatten machen dürfen. Dass sie nackt aufgefunden worden war. Dass sie kein Gesicht mehr hatte. Dass ihre Haare aussahen wie die einer Hexe in einem Märchen der Brüder Grimm.
Henrik hatte das zwar nur wenige Tage zuvor selbst gedacht, aber es war doch ein Unterschied, etwas zu denken und etwas ganz offen auszusprechen.
Normalerweise hätte dieser spektakuläre Leichenfund ein gewaltiges Medieninteresse erregt. Die Tote war in Skøyen von einem zweiundachtzig Jahre alten Mann entdeckt worden. Er hatte eine Woche in seiner Hütte in Trysil verbracht und war am vergangenen Donnerstag in seinem Mercedes W202 Baujahr 1999 wieder nach Hause gefahren. Da er normalerweise in der Hütte mehr Zeit verbrachte als zu Hause, hatte er nur eine kleine Tasche bei sich gehabt. Die lag vorn auf dem Beifahrersitz. Normalerweise konnten Tage und Wochen vergehen, ohne dass er den Kofferraum öffnete. Doch an diesem Tag hatte er seine Hausschlüssel vergessen. Und unter der Matte im Kofferraum hatte er ein Reservebund versteckt.
Als die Klappe aufging, erlitt der Mann einen Herzinfarkt.
Kein Wunder, dachte Henrik Holme.
Die Tote lag in unnatürlich verrenkter Position da, außerdem war sie nackt und gesichtslos. Eine Nachbarin hatte gerade das Parkhaus betreten, als der alte Mann in die Knie gesunken war. Sie hatte geistesgegenwärtig Rettungswagen und Polizei alarmiert, ehe sie dem Mann durch eine resolute Herzmassage das Leben gerettet hatte.
Obwohl er natürlich umfassender befragt werden müsste, wenn er erst wieder zu Kräften gekommen wäre, hielt kein Mensch im ganzen Polizeigebäude ihn für etwas anderes als einen unschuldigen und ahnungslosen Autofahrer. Irgendjemand musste ihm die Leiche in den Kofferraum gelegt haben. Das Schloss war manipuliert worden, wie der Mann es selbst schon angenommen hatte. Wenn er selbst die Leiche dort versteckt hatte, dann hätte er wohl kaum in seiner Tiefgarage den Kofferraum geöffnet. Natürlich konnte der Infarkt ein Zufall gewesen sein, der Mann war schließlich über achtzig, aber alles in allem hielten sie ihn für unschuldig. Was der Polizei normalerweise einen Ausgangspunkt für die Ermittlungen geliefert hätte: die Hütte des Mannes und ihre Umgebung.
Oder die Kätnerstelle, die sie streng genommen war.
Zwischen diesem kleinen Hof und der Wohnung in Skøyen lagen etwas mehr als zweieinhalb Autostunden. Der Mann hatte fast eine Stunde länger gebraucht. Viel zu oft musste er anhalten, um sich von ein paar Tropfen Urin zu befreien, eine quälende Folge einer vergrößerten Prostata, die eigentlich in zwei Wochen im Ullevål-Krankenhaus hätte entfernt werden sollen. So weit würde es jetzt wohl kaum kommen, aufgrund der Pandemie und wegen des Herzinfarktes. Henrik war einen Tag nach dem Leichenfund im Krankenhaus gewesen und hatte mit dem Mann gesprochen. Der Alte hatte mitgenommen und schwach gewirkt, aber er war über den Berg. In der kurzen Zeit, die dem Polizisten für die Befragung bewilligt worden war, hatte er zumindest ungefähr ermitteln können, welche Strecke der Mann gefahren war.
Zwei der vielen unbedingt notwendigen Pausen hatte er an Tankstellen eingelegt. Beide waren mit Überwachungskameras ausgestattet. Die Filme lagen bereits vor. Bei der einen Tankstelle hatte er gut sichtbar für zwei Kameras gehalten. Der Wagen war innerhalb der sechs Minuten, in denen der Besitzer beschäftigt gewesen war, nicht angerührt worden. Bei Shell in Skedsmovollen, seinem letzten Halt, ehe der Alte das restliche Stück bis nach Hause zurückgelegt hatte, konnte man in einem Film nur die hintere Hälfte des Autos sehen. Diesmal hatte es fast zehn Minuten gedauert, bis der Mann weitergefahren war, aber auch dort hatte sich niemand dem Kofferraum des Fahrzeugs genähert.
Das Problem waren die vielen anderen Pausen, die er außerdem noch eingelegt hatte. Auf Rastplätzen und, nachdem er von der Hauptstraße abgefahren war, in Nebenstraßen, wo er sein Auto an Bushaltestellen und anderen passenden Orten abgestellt hatte, während er sich erleichterte. Und es machte ihm Probleme, die alle zu nennen. Wenn der Mercedes jüngeren Datums gewesen wäre, hätte es keine Probleme gegeben, dann hätte der Wagen ein GPS-System und ein elektronisches Logbuch gehabt.
Aber das Auto war einundzwanzig Jahre alt. Ein Prachtfahrzeug, eigentlich, aber mit sehr viel mehr Mechanik als Elektronik unter der Motorhaube.
Ein Besuch in der Hütte in Trysil wies ebenfalls darauf hin, dass der Fahrzeughalter die Wahrheit gesagt hatte. Es hatte vier Tage lang heftig geschneit, ehe er es für sinnvoll erachtet hatte, nach Hause zu fahren, um einige Dinge des täglichen Bedarfs zu holen und sich dann wieder im Wald zu verkriechen, bis dieses verflixte Virus in einigen Wochen verschwunden sein würde. Der schwere Frühjahrsschnee verriet nur, dass der Hüttenbesitzer und sein Wagen innerhalb des Zaunes gewesen waren, wo der Wagen auch abgestellt gewesen war.
Henrik Holme seufzte und schaute aus dem Fenster. Er hatte es einen Spaltbreit geöffnet, als er gekommen war, und die Vorhänge, die seine Mutter trotz seiner zaghaften Proteste aufgehängt hatte, bewegten sich ein wenig. Er griff nach dem vorläufigen Obduktionsbericht, und sein Blick fiel ganz unwillkürlich auf die klinische Beschreibung des verstümmelten Gesichts.
Die Verletzungen waren der Frau erst nach ihrem Tod zugefügt worden, davon war der Pathologe überzeugt.
Doch es war zu früh, noch konnten keine Schlussfolgerungen gezogen werden. Dennoch wies fast alles darauf hin, dass die Frau zuerst getötet worden war. Danach war ihr Gesicht zermalmt worden, und schließlich war sie in irgendein beliebiges Auto gelegt worden, um dann an einem ganz anderen Ort gefunden zu werden.
Henrik Holme googelte eine Landkarte von Ostnorwegen.
Er gab die Adressen des Mannes in Trysil und in Oslo ins Suchfeld ein, und dazwischen erschien eine dicke blaue Linie.
An mehreren Stellen entlang dieser Route war der Mann von der Hauptstraße abgefahren, hatte sich eine ruhige Stelle ein Stück vom Auto entfernt gesucht und sich Zeit dabei gelassen, seine Blase zu entleeren. Es sei schmerzhaft gewesen, hatte er murmelnd erklärt, er habe sich konzentrieren müssen, und es sei gut möglich, dass er das Auto einige Male fünf oder sechs Minuten lang nicht im Blick gehabt habe.
Ein plötzlicher Windstoß wehte die Vorhänge ins Zimmer. Drei Blätter, die an den Rand des Schreibtisches gelegt worden waren, segelten zu Boden. Henrik stand auf, schloss das Fenster und hob sie wieder auf.
Das Gesicht des Opfers zu zerschlagen, konnte von der Absicht des Täters zeugen, diese Person unkenntlich zu machen. Aber wenn man eine Identität wirklich verwischen wollte, mussten auch die Fingerspitzen zerstört und die Zähne entfernt werden. Beides war hier nicht geschehen. Die Schneidezähne waren eingeschlagen worden, aber die Backenzähne glänzten noch immer grauweiß und deutlich zwischen Fleischfasern und Sehnen.
Dass eine Schulter gebrochen war, auch das allem Anschein nach post mortem, hatte offenbar dafür sorgen sollen, dass die Leiche irgendwo verstaut werden konnte. Der Täter oder die Täterin hatte es zwangsläufig eilig gehabt und bestimmt keine besondere Vorsicht walten lassen.
Henrik starrte die blaue Linie auf der Karte so lange an, bis sie schließlich vor seinen Augen verschwamm. Das alles hier war gar nicht seine Aufgabe. Sein Auftrag bestand darin, die Fakten über die Tote mit den Vermisstenmeldungen abzugleichen. Die Frau war offenbar ein oder zwei Tage vor dem Leichenfund getötet worden, und Henrik Holme würde mit den letzten drei Monaten beginnen. Um sich dann, wenn nötig, noch weiter zurückzuarbeiten. Er würde sich zunächst Norwegen und Schweden vornehmen, denn er wollte die genauere DNA-Analyse abwarten, um die ethnische und vermutlich nationale Zugehörigkeit der Toten bestimmen zu können, und sich dann gegebenenfalls weiter nach Europa vorarbeiten.
Langweilige Arbeit.
Die wirklich jeder Büroangestellte hätte erledigen können.
Er klickte die Landkarte zu und holte das Foto der Frau wieder auf den Schirm. Eine Großaufnahme von Oberkörper und Kopf.
Die Brüste waren klein und von unterschiedlicher Größe. Aus dem Bericht der Pathologie ging hervor, dass die Frau nicht geboren hatte. Die Brustwarzen saßen ein wenig tief. Nicht, dass er in seinem Leben so viele Brustwarzen gesehen hatte, zumindest nicht an lebenden Menschen, aber diese hatten tatsächlich eine eher ungewöhnliche Position. Die Vorhöfe waren groß, sie bedeckten gewissermaßen zu viel von der kleinen Brust, und sie waren so dunkelbraun, dass sie auf dem Foto fast schwarz wirkten. Die Warzen an sich saßen ebenfalls ein wenig schief. Er zoomte sie ein. Die Brüste schienen zu schielen, jeder Augapfel starrte zu einer anderen Seite. Er ertappte sich dabei, das ein bisschen komisch zu finden, aber diese entblößten, außergewöhnlichen Brüste brachten ihn zum Nachdenken.
Irgendwer hatte die Frau sicher auch geliebt.
Er seufzte laut, obwohl er ganz allein war. Seine Finger jagten über die Tastatur, und Sekunden später hatte er die Liste der in den letzten drei Monaten in Norwegen vermissten Personen vor sich liegen.
Diese Liste war so kurz, dass er nur fünf Minuten brauchte, um festzustellen, dass die Tote von niemandem im Land gesucht wurde. Er probierte es mit Schweden. Auch dort war nichts zu finden. Er weitete die Suche auf ein halbes Jahr aus. Dann auf ein ganzes. Nahm schließlich Dänemark und Deutschland dazu.
Dort fand er zwei Frauen, die von Alter und Aussehen her infrage kommen könnten. Bei genauerem Hinsehen stellte sich heraus, dass die eine zwei Tage zuvor gefunden worden war, in einem Hafenbecken in Hamburg. Die andere war eine Transperson, wie er nachlesen konnte. Im Bericht der Pathologie wäre eine geschlechtsangleichende Operation zweifellos erwähnt worden, also loggte Henrik sich aus dem System aus, ließ sich im Sessel zurücksinken und schaute zur Decke.
Sie würden sich an Interpol wenden. Nur mussten sie vorher ein bisschen mehr wissen, eine fundiertere Grundlage haben. Interpol hatte Datenbanken, die eine viel effektivere Suche ermöglichten, als ihm das von seinem Schreibtisch im Polizeigebäude aus möglich war. Für ihn gab es streng genommen nun nicht viel mehr, was er tun konnte.
Der Gedanke an die Tote hatte ihn zusehends fester im Griff.
Es war möglich, dass er auf das scheinbar mangelnde Interesse an dem Fall unter seinen Kollegen reagierte. Er begriff das nicht. Dieses Virus hatte im Prinzip alles zum Stillstand gebracht, aber für Henrik Holme gab es nicht den geringsten Grund, nicht jedem Mordfall mit dem größten Engagement und Ernst zu begegnen. Im Moment schien die Ermittlung mit angezogener Bremse zu verlaufen. Bei der Besprechung hatte er für einen Moment gedacht, es könne das Abstoßende an der Leiche sein, das seine Wirkung auf die anderen hatte. Die Haare, deren Farbe eigenartig war und die nicht so ganz zu dem mageren, sehnigen Körper zu passen schienen.
Holmes Blick blieb an einem Fleck an der Decke hängen. Er sah feucht aus, konnte das aber wohl kaum sein. Über ihm lag nur ein weiteres Büro, ohne Wasserleitungen. Der Fleck sah aus wie ein Komodowaran, der den Rachen aufreißt. Jedenfalls, wenn Henrik die Augen ein wenig zusammenkniff, sodass die Umrisse konturloser wurden.
Die Tote war ein Mensch gewesen. Er war es ihr schuldig, seine Arbeit zu tun, die darin bestand, ihren Mörder zu ermitteln.
Und das Tatmotiv.
Hanne Wilhelmsen, glaubte er zu denken. Aber er sagte es laut:
»Hanne Wilhelmsen.«
Jäh setzte er sich gerade auf. Merkte, wie sich sein Puls beschleunigte. Eine Art Angst vielleicht; nicht vor Hanne, aber davor, ein weiteres Mal abgewiesen zu werden. Einen Moment lang zögerte er, aber danach überkam ihn eine ungewohnte Entschlossenheit.
Er griff zum Telefon und wählte ihre Nummer, die er auswendig wusste.
II
Es war der seltsamste Zeitpunkt, zu dem Ebba Braut sich jemals verabredet hatte.
Nachts um halb zwei.
Sie war ein wenig zu früh gekommen und saß jetzt fröstelnd auf einer Bank im Hydropark, der kleinen Grünfläche zwischen der Universitätsbibliothek und einem hohen Bürogebäude. Sie war zu Fuß von Sankthanshaugen hergekommen, nachdem sie um neun Uhr schlafen gegangen war und vorher den Wecker gestellt hatte.
Oslo hatte sich in seinen eigenen Schatten zusammengekauert. Es fuhren noch immer Straßenbahnen, die Frognerbahn war auf ihrer letzten Runde in dieser Nacht vorübergescheppert, als Ebba den Solli plass überquert hatte. Ein einsamer Fahrgast hatte sie durch die schmutzige Fensterscheibe angestarrt. Er sah erschrocken aus, als ob sie sich in Lebensgefahr brächte, weil sie während der Pandemie mitten in der Nacht unterwegs war. Sie selbst fühlte sich sicherer als jemals zuvor in ihrem Leben, kaum eine Menschenseele war unterwegs. In den Straßen waren mehr Streifenwagen zu sehen als Menschen.
Dass Hanne Wilhelmsen vor Jahren angeschossen worden war, wusste Ebba bereits. Dass sie im Rollstuhl saß, ging ihr erst auf, als sie begriff, dass die mögliche Debütantin des Verlagshauses Storkhøj von links auf sie zugerollt kam. Eine Suche bei Google hatte Ebba nicht sehr viel klüger gemacht, die ehemalige Polizistin hatte den Höhepunkt ihrer Karriere offenbar in der zarten Jugend des Internets erreicht.
»Ebba Braut?«, fragte Hanne Wilhelmsen und hielt an.
Ebba lächelte und hoffte, dass das im Halbdunkel zu sehen war. Sie erhob sich und ging mit ausgestreckter Hand auf die andere zu.
»Das ist jetzt verboten«, sagte die Gelähmte kurz, rollte einen halben Meter zurück und verriegelte die Räder.
Ebba ließ die Hand sinken und wich ebenfalls zurück. Ließ sich wieder auf die Bank sinken und merkte, dass ihr der Schweiß ausbrach.
»Entschuldigung.«
»Keine Ursache.«
Die Frau lächelte tatsächlich! Sie war sehr schlank. Auf dem jüngsten Bild, das Ebba im Netz gefunden hatte, hatte sie viel gesünder gewirkt, leicht übergewichtig sogar. Aber das Bild stammte aus der Jahrtausendwende, der Zeit, bevor sie angeschossen worden war.
»Schön, dass Sie gekommen sind. Es ist ja nicht mehr ratsam, sich im Haus zu treffen.«
Ihr Lächeln erstarb. Eine Laterne schräg hinter Ebba erhellte das Gesicht der Frau, die nun gute zwei Meter von ihr entfernt saß. Ihre Augen waren ausgesprochen hellblau, fast wie ein Gletscher im Frühjahr, aber mit einem markanten schwarzen Ring um die Iris. Ihr Blick hielt dem von Ebba stand, das war ein bisschen unbehaglich. Ebba rutschte unruhig auf der Bank hin und her und nestelte an ihrer Schultertasche.
»Wir möchten Ihr Buch gern veröffentlichen«, sagte sie und räusperte sich kurz. »Wie ich schon am Telefon gesagt habe. Wir sind sehr begeistert. Überaus begeistert. Wir finden das Manuskript unglaublich gut. Eine gewisse redaktionelle Bearbeitung steht natürlich noch aus, aber es ist ein bemerkenswert vollständiges Stück Literatur.«
»Wer ist wir?«
»Was?«
»Wer sind diese wir, die so überaus begeistert sind und das Manuskript so unglaublich gut finden?«
»Äh … ich, natürlich. Ich bin also Lektorin. Für norwegische Belletristik. Zusammen mit David Eriksen, er ist der Cheflektor. Er hat das Manuskript am Wochenende gelesen und ist ebenso hingerissen wie ich.«
Das stimmte nicht so ganz. David hatte allerlei Einwände vorgebracht, die Ebba verwirrt und ihr fast den Mut genommen hatten. Sie begriff diese Einwände nicht, auch nicht, nachdem sie mehrere Stunden über seine Kritik nachgedacht hatte. Erst nachdem am späten Sonntagabend eine SMS von Marion Kovig eingegangen war, die aus drei erhobenen Daumen und der Mitteilung »Wir setzen schon auf diesen Herbst!« bestand, hatte sie sich wieder beruhigt.
»Sogar unsere Programmdirektorin ist begeistert. Und sie ist wirklich anspruchsvoll. Vor allem, wenn es um kommerzie- … wenn es um Genreliteratur geht.«
Niemals das Wort kommerziell verwenden, rief sie sich in Erinnerung. Lebensgefährlich. Jemand könnte beleidigt sein. Andere könnten sich Hoffnungen machen, die sich aller Wahrscheinlichkeit nach nicht erfüllen würden.
»Was gefällt Ihnen denn? An meinem Manuskript?«
Die Frau im Rollstuhl saß fast reglos da. Ihre Hände ruhten auf ihrem Schoß. Sie steckten in riesigen Filzfäustlingen, die nicht so recht zu ihrer übrigen Garderobe passten. Ferner trug sie eine schwarze Herrenjacke, die Ebba sofort erkannte: eine Jacke von Serac, die mindestens zwanzigtausend Kronen kostete. Das feminine, schmale Gesicht wurde in gewisser Weise von der weißen Innenseite des Kragens beleuchtet. Hanne Wilhelmsen musste sehr schmale Hüften haben, um diese Jacke tragen zu können. Ihre Haare mochten grau sein, das war bei diesem Licht schwer zu sagen. An den Füßen trug sie schwarze Doc Martens, die ebenfalls nagelneu aussahen.
»Alles!«, sagte Ebba mit Nachdruck. »Mir gefällt die Geschichte an sich. Sie ist spannend, sie ist interessant, sie ist … relevant. Wir reden so oft darüber, dass Autorinnen und Autoren ganz nah an ihren Stoff herangehen müssen …«
Sie hob die bloßen Hände und legte die Handflächen aneinander.
»… aber Sie behalten eine bewundernswerte und faszinierende … Distanz? Obwohl Sie immer wieder die Erzählperspektive wechseln, scheint die Handlung von einer allwissenden Erzählerin vorgetragen zu werden. Ungewöhnlich. Ein bisschen … altmodisch, obwohl das Thema ja hochmodern ist. Ich meine …«
Sie schwitzte noch immer und versuchte, Worte für das zu finden, was sie eigentlich meinte. Sie hätte sich besser vorbereiten sollen. Das hier konnte ihre allererste Veröffentlichung werden, und der bloße Gedanke daran hatte sie zu optimistisch werden lassen.
Und zu nervös.
»Die Protagonistin«, sagte sie schließlich. »Die Hauptperson. Alva Heimdal gefällt mir. Sie ist erfrischend normal und irgendwie genau richtig. Tüchtig, aber nicht genial. Intuitiv, aber es wirkt nicht übernatürlich. Sie hat keine Schattenseiten, sie wird nicht von inneren Dämonen gejagt. Dass in ihr so viel Normales zusammenkommt, macht sie in gewisser Weise außergewöhnlich. Sie sieht aus wie andere, isst und trinkt wie andere, hat Freunde und eine sympathische kleine Familie … und ja, es gefällt mir, dass sie in gewisser Weise …«
»Sie haben soeben so ungefähr die Hälfte aller Polizeibeamten hierzulande beschrieben«, sagte Hanne Wilhelmsen ruhig, als Ebba Atem holte.
»Genau!«
Ebba rutschte an den Rand der Bank und fing an zu gestikulieren.
»Das Ganze wirkt so … echt! So gelebt, irgendwie! Obwohl wir mit der Redaktion noch nicht einmal angefangen haben, sind wir ganz sicher, dass das hier ein Buch ist, auf das wir setzen wollen. Wenn Sie nichts dagegen haben, schicken wir Ihnen gleich morgen einen Vertrag. Dann können wir weitersehen. Ich habe auch schon angefangen, das Manuskript gründlich durchzugehen, und ich würde Ihnen dann meine Überlegungen und Änderungsvorschläge durchgeben. Sie können sich meine Vorschläge ansehen, und dann sprechen wir darüber, oder wenn Sie …«
»Worauf läuft so eine Redaktionsarbeit eigentlich hinaus?«
Ebba sah die andere ein wenig verwirrt an.
»Redaktionsarbeit? Also, in jedem Manuskript gibt es Formulierungen, die ein wenig umgestellt, geändert oder gestrichen werden können. Ich als Ihre Lektorin …«
Sie legte die Hände auf die Brust und verbeugte sich im Sitzen, um zu unterstreichen, dass dieses Buchprojekt eine große Ehre für sie war.
»… werde also darauf hinweisen, wo Ihre Geschichte noch etwas besser werden kann. Kürzungen und Ergänzungen und …«
»Das kommt überhaupt nicht infrage«, sagte Hanne Wilhelmsen ruhig und streifte ihre riesigen Fäustlinge ab.
Sie warf einen Blick auf die Rolex an ihrem rechten Handgelenk.
»Take it or leave it«,sagte sie gelassen mit einer Miene, die mit einem gewissen Wohlwollen als Lächeln gedeutet werden konnte. »Ich habe wirklich keine Lust, noch mehr Zeit mit diesem Buch zu verbringen. Es ist fertig. Ich sitze ja schon am Folgeband.«
Ebbas Puls stieg, und sie schluckte.
»Alle Manuskripte werden redigiert«, sagte sie kleinlaut. »So ungefähr geht das eben. So ungefähr.«
»Mag sein. Aber in meinem Fall nicht. Dann muss ich mir einen anderen Verlag suchen.«
»Und was ist mit Korrektorat?«, fragte Ebba eilig.
»Was ist das?«
»Da liest jemand das Manuskript, um Orthografiefehler zu korrigieren. Und logische Fehler, aber einige Korrektoren schaffen es auch …«
»Logische Fehler? Wie ist das zu verstehen?«
»Wenn Sie den 22. Juli zum Beispiel auf einen Montag verlegt hätten …«
»Ich erwähne den 22. Juli gar nicht.«
»Das war doch nur ein Beispiel. Aber wichtiger ist, dass dabei auch sprachliche Fehler bereinigt werden. Grammatische und inhaltliche. Wenn Sie in einem Abschnitt zu oft dasselbe Wort verwenden, etwa. Wenn Sie einen idiomatischen Ausdruck falsch verwenden. Umständliche Sätze. Stilblüten. Solche Dinge.«
Die ältere Frau wiegte den Kopf langsam hin und her, während sie den Ärmel über ihre Armbanduhr zog und die Hände in ihre Fäustlinge zurückschob.
»Das klingt vernünftig. Das nehme ich dankend an.«
Ebba verspürte einen Moment der Irritation. Solche Korrekturdurchgänge waren nichts, zu dem eine Autorin Ja oder Nein sagen konnte. Sie waren eine Selbstverständlichkeit. Die Frau hatte keinerlei Erfahrung als Autorin. Das Manuskript war überaus vielversprechend, aber es würde natürlich nicht zu einem fertigen Buch werden können, solange sich die Autorin nicht wenigstens ein Minimum an Redaktion gefallen lassen wollte.
»Und jetzt muss ich Sie fast bitten zu gehen«, sagte Hanne Wilhelmsen energisch und machte damit jeder weiteren Diskussion ein Ende.
Ebba sprang auf und ertappte sich dabei, wie sie eine Haltung annahm, die durchaus einer Habachtstellung ähnelte.
»Na gut«, sagte sie. »Dann schicke ich Ihnen morgen den Vertrag zu. Sie können elektronisch unterzeichnen. Ist das in Ordnung?«
Als Hanne Wilhelmsen keine Antwort gab, wagte Ebba noch einen Vorstoß:
»Sind wir uns einig? Dass wir Ihr Buch veröffentlichen werden?«
»Was können Sie eigentlich?«
»Wie meinen Sie das?«
»Was können Sie, von dem Sie glauben, dass es mein Buch besser machen wird?«
»Äh … Literatur? Erzählkunst? Lektorinnenstellungen sind sehr umworben, und ich …«
Grundgütiger!
Sie schloss die Augen, um sich gegen ihre eigene Dummheit zu schützen.
»Ich weiß, wie man ein gutes Manuskript noch besser macht«, sagte sie laut und entschieden und öffnete die Augen wieder.
»Okay«, sagte Hanne Wilhelmsen.
Ob sie lächelte oder nicht, war schwer zu sagen. Jedenfalls hatte der Blick, mit dem sie Ebbas nun wieder in Schach hielt, etwas Belustigtes, als sie fragte:
»Und was haben Sie für eine Ausbildung?«
Ebba zögerte. Hätte gern gelogen, was sie sonst fast nie tat. Sie wurde wütend, und deshalb sagte sie wahrheitsgemäß:
»Ich bin Theologin. Ich bin sogar ordinierte Geistliche.«
Hanne Wilhelmsen lachte. Ihr Lachen war leise und klirrend und wirkte echt. Genau das hatte Ebba befürchtet. In der Woche, in er sie nun bei Storkhøj angestellt war, hatte es an Reaktionen nicht gemangelt:
Bist du wirklich Pastorin?
Wieso hast du denn die Jagdgründe gewechselt?
Wie spannend, eine Bibelkundige mit an Bord zu haben!
Das ist aber auch das beste Buch der Welt!
»Und wie lange sind Sie schon im Verlag?«
Jetzt war Ebba sicher. Sie wurde aufgezogen. Um nicht zu sagen, schikaniert, diese Person war vom ersten Moment an schroff, spöttisch und alles andere als entgegenkommend gewesen. Das hier würde nie im Leben gut gehen.
»Seit ziemlich genau einer Woche«, sagte sie rasch und schob sich den Riemen ihrer Tasche über die Schulter. »Seit einer Woche und einem Tag. Ich habe am vergangenen Montag angefangen. Davor war ich vier Monate lang arbeitslos. Davor wiederum habe ich eine Vertretung bei der Zeitung Nordlys gemacht. Ein knappes Jahr lang. Davor war ich als eine Art Koordinatorin beim Hålogaland Teater. Um die Stelle zu bekommen, die ich jetzt habe, musste ich allerdings bei zwei Bewerbungsgesprächen und einer praktischen Aufgabe reichlich anspruchsvolle Menschen überzeugen. Das war eine ziemliche Herausforderung.«
Sie deutete ein Nicken an und trat zwei Schritte zurück, in Richtung Drammensvei.
»Ich schicke Ihnen morgen den Vertrag. Wir müssen uns aber an den Standardvertrag halten, da kann ich leider nichts machen.«
Ehe sie sich umdrehte, hielt sie für einen Moment inne:
»Take it or leave it, wie Sie selbst gesagt haben. Ich werde dafür sorgen, dass Sie eine erfahrenere Redakteurin bekommen.«
»Schön«, sagte Hanne Wilhelmsen, die offenbar das Interesse an Ebba Braut bereits verloren hatte.
Stattdessen winkte sie jemandem zu, der langsam von der Bygdøy allé her auf sie zukam. Ein Mann, glaubte Ebba, ein junger, schmalschultriger Bursche mit einem ungewöhnlich großen Kopf und einem viel zu langen Hals. Er zog die Hände aus den Taschen, als Ebba sich in Bewegung setzte. Als sie glaubte, weit genug entfernt zu sein, dass die beiden sich nicht mehr die Mühe machen würden, hinter ihr herzuschauen, sah sie sich um.
Der junge Mann hatte sich über den Rollstuhl gebeugt. Er umarmte Hanne Wilhelmsen. Seine Umarmung wurde erwidert, beobachtete Ebba. Die ehemalige Polizistin hatte die Arme so fest um den schmalen Rücken geschlungen, dass es aussah, als wollte sie nie wieder loslassen.
III
Eli Schwartz war auf eigenen Wunsch an ihrem fünfundsechzigsten Geburtstag in den Ruhestand getreten, was viele sehr bedauerten.
Vor allem waren ihre Autorinnen und Autoren verzweifelt. Eli Schwartz hatte mit neunundzwanzig bei Storkhøj als Lektorin angefangen, und dreizehn der größten Namen auf der Verlagsliste waren ihr Verdienst. Die meisten von diesen hatten ein ganzes Lebenswerk geschaffen und noch immer Meisterwerke im Ärmel; sie machten den eigentlichen Stamm des robusten, erfolgreichen Verlagshauses Storkhøj aus. Seit der Verlagsgründung vor dreiundneunzig Jahren hatte die Buchbranche Höhen und Tiefen erlebt. Vor allem Tiefen in den letzten zehn Jahren, aber da Storkhøj den Großteil der besten und meistverkauften Autorinnen und Autoren des Landes verlegte, hatte es niemals ganz finster ausgesehen.
Viele der großen Namen waren wegen Eli Schwartz bei diesem Verlag geblieben.
Eli war eine zurückhaltende und ziemlich introvertierte Frau, die bis zu dem Tag, an dem sie in den Ruhestand getreten war, stets auf Papier gearbeitet hatte. Sie arbeitete mit Bleistift, einem von der allerweichsten Sorte. Immer standen sieben oder acht davon in einem Keramikbecher in ihrem Büro. Sie berührte beim Schreiben nur ganz behutsam das Papier. Der stärkste Ausdruck von Unzufriedenheit war ein leicht gewellter Strich am Rand. Wenn sie wirklich durch und durch zufrieden war, zeichnete sie eine winzige, fast unsichtbare Blume.
Die Autorinnen und Autoren liebten Eli Schwartzens hellgraues Vergissmeinnicht, und es kam vor, dass sie untereinander damit prahlten. Zum Scherz, behaupteten sie zwar, aber alle nahmen Elis Blümchen todernst. Während ihre Krimischreiber sich oft mit drei oder vier Blumen im ganzen Manuskript begnügen mussten, konnten andere, erfahrenere bei einem dünnen Buch einen ganzen Strauß zusammenbringen.
Sie war vielleicht die angesehenste Lektorin des Landes, aber das Publikum hatte nur selten von ihr gehört. Nie hatte sie versucht, sich in den Vordergrund zu drängen. Sie blieb bei ihren Autorinnen und Autoren und ihren Papiermanuskripten bis zu dem Tag, an dem ihre Zeit im Verlag zu Ende ging.
Dieser Tag war der vergangene Montag gewesen.
Ebba Braut blieb vor der Adresse stehen, die ihr genannt worden war. Eli Schwartz wohnte allein in einer hinter einem privaten Rasenfleck gelegenen Wohnung in Ullevål Hageby. Sie war seit drei Jahren Witwe, was vermutlich ausschlaggebend für ihren Beschluss gewesen war, früher als streng genommen notwendig in den Ruhestand zu treten. Ihre Kinder waren längst zu Hause ausgezogen. Drei Enkelkinder wohnten in der Nähe. Über ihre Wohnung machten die ungeheuerlichsten Gerüchte die Runde, und Ebba hoffte, jene irgendwann einmal betreten zu dürfen, aber nun war im Garten für zwei gedeckt.
»Komm rein«, rief Eli, als die beiden einander über die Hecke hinweg entdeckt hatten.
Sie war der genaue Gegensatz von Hanne Wilhelmsen. Erst vor zwölf Stunden war Ebba von der verdammten Frau im Rollstuhl regelrecht heruntergemacht worden. Eli Schwartz empfing sie mit herzlicher Körpersprache und freundlichem Blick.
Und zu einer anständigen Tageszeit.
»Gut, dass es schon ein bisschen frühlingshaft ist«, sagte sie und bat Ebba, sich auf eine Bank zu setzen. »Ich habe sicherheitshalber Decken bereitgelegt. Der Lockdown ist beängstigend, aber bei diesem Wetter immerhin einigermaßen zu ertragen. Stell dir vor, wenn wir uns auch im Herbst noch isolieren müssen! Im November!«
Sie schnitt eine Grimasse und setzte sich. Schweigend füllte sie zwei Becher mit Tee und schob Ebba den einen hin.
»Die Pandemie soll bis zum Sommer ja angeblich vorüber sein.«
Auch das Desinfektionsmittel Antibac und eine Rolle Küchenpapier lagen bereit.
»Du kannst gern den Becher abwischen.«
Auf den Gedanken war Ebba noch gar nicht gekommen, aber sie tat, wie ihr geheißen. Der Tee schmeckte danach ein bisschen wie widerlicher Fusel, aber sie ließ sich nichts anmerken.
»Wie geht’s dir denn so?«, fragte Eli Schwartz und lächelte.
»Nicht so gut«, antwortete Ebba, ohne zu überlegen. »Also, klar geht es gut, es ist alles unglaublich spannend, eine riesengroße Herausforderung für mich, und die Leute im Verlag sind total sympathisch, und …«
Sie verstummte und wusste nicht recht, was sie sagen sollte.
»Das ist ja der schlimmste Einstieg, den man sich überhaupt vorstellen kann«, sagte Eli gelassen und hob ihren Becher. »Vier Tage im Verlag, und dann das hier.«
Sie hob den Blick und schaute sich mit großen Augen um, als liege überall das Virus auf der Lauer.
»Mittlerweile hast du vermutlich alle kennenlernen können«, sagte sie dann und stellte den Becher ab. »Die Leute im Verlag. Die Autorinnen und Autoren. Und die Arbeit, die sicher ganz anders ist als das, was du bisher gemacht hast.«
Ebba Braut ahnte eine gewisse Skepsis in der Stimme der anderen, eine kaum hörbare Spitze, die so schnell wieder verschwunden war, dass sie nicht sicher sein konnte. Als sie einige Wochen zuvor im Verlag herumgeführt worden war, war Eli Schwartz ein wenig zögerlich gewesen, als sie damit an die Reihe kam, Ebba zur Einstellung zu gratulieren. Dieser Gedanke war Ebba auch gekommen, als sie am vorigen Montag Elis Manuskriptstapel übernommen hatte. Zwar waren viele der profiliertesten Namen bereits an erfahrenere Verlagsleute weitergereicht worden, aber der Stapel war ihr dennoch überwältigend vorgekommen.
Vielleicht waren die Erlebnisse der vergangenen Nacht schuld an ihrer Reaktion.
»Bei Theologie geht es vor allem um Textauslegung«, sagte sie fast trotzig. »Darum, Verständnis zu erlangen. Auch durch Sprache. Es geht um Subtext und verborgene Botschaften, um die allerfeinsten sprachlichen Nuancen. Und in Bezug auf narrative Effektivität sind religiöse Schriften ziemlich unübertroffen. Oder wie siehst du das?«
Ihre Stimme war zu harsch, das wusste sie.
Oder vielleicht gerade aggressiv genug. Jedenfalls lächelte Eli Schwartz strahlend und sagte:
»Da hast du allerdings recht.«
Sie machte eine leichte Handbewegung.
»Aber am Telefon hast du besorgt geklungen. Ein Problem, hast du gesagt. Wie kann ich dir behilflich sein?«
Es lag Ebba Braut nicht, sich über irgendwelche Dinge das Hirn zu zermartern. Ein vertrauter Jähzorn war in ihr aufgelodert, als ihre Kompetenz ein weiteres Mal angezweifelt wurde. Und diesmal von einer Literaturkennerin.
Da Eli Schwartz aussah, als habe sie Ebbas impulsiven Ausbruch schon vergessen, wollte Ebba die Sache nicht unnötig kompliziert machen.
»In deinem Stapel lag ein Manuskript«, sagte sie.
»Da lagen viele.«
»Ja, aber ich meine den Kriminalroman, geschrieben von einer ehemaligen Polizistin.«
»Hanne Wilhelmsen! Das kam wenige Tage, bevor ich aufgehört habe. Von ihr war ziemlich oft die Rede, früher, also von Hanne Wilhelmsen. Ich habe ein bisschen darin geblättert, und es schien mir so vielversprechend, dass ich dachte, es könnte ein schöner Anfang für dich sein.«
»Das schon.« Ebba nickte. »So war das auch. Ein überaus verheißungsvolles Manuskript. So verheißungsvoll, dass ich David und Marion zum Lesen überreden konnte. David hatte einige Einwände, war im Grunde aber aufgeschlossen. Marion war total begeistert.«
Eli Schwartz lachte. Ihr Lachen war ebenso zart wie ihre Gestalt.
»Die Chefin ist immer total begeistert«, sagte sie. »Andere Gefühle liegen außerhalb ihres Registers. Ich nehme an, sie hat dir drei erhobene Daumen und eine SMS geschickt.«
Ebba nickte perplex.
»Und wo liegt das Problem?«, fragte Eli.
»Die Autorin. Hanne Wilhelmsen. Sie wollte sich mit mir treffen, aber nur, wenn ich um halb zwei Uhr nachts in den Hydropark kommen würde.«
Eli schien diesen Zeitpunkt keineswegs seltsam zu finden.
»Vielleicht hat es ihr eher nicht gepasst?«, fragte sie und schob den Teller mit den Keksen über den kleinen Tisch. »Ich habe gebacken. Du bekommst einen eigenen Teller.«
»Sie war richtig unangenehm«, sagte Ebba, ohne zuzugreifen. »Absolut arrogant.«
»Arroganz ist in der Regel ein Zeichen von Unsicherheit.«
Es überraschte Ebba, dass Eli Schwartz solche Klischees bemühte, und sie verzichtete auf eine Antwort. Stattdessen sagte sie:
»Sie wollte jedenfalls kein Lektorat.«
»Was?«
Eli Schwartz ließ den Becher sinken und sah zum ersten Mal leicht empört aus. Oder jedenfalls verdutzt.
»Wie soll ich das verstehen?«
»So, wie ich es gesagt habe. Hanne Wilhelmsen will nicht, dass ihr Manuskript lektoriert wird. Hat keinesfalls vor, irgendetwas zu verändern, sagt sie. Ich habe sie mit Mühe und Not überreden können, einen Korrekturgang zu akzeptieren. So was kann ich mir doch nicht bieten lassen?«