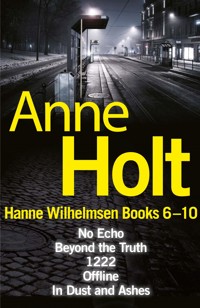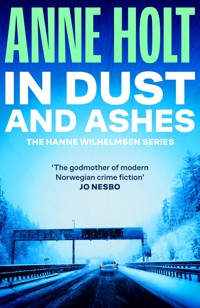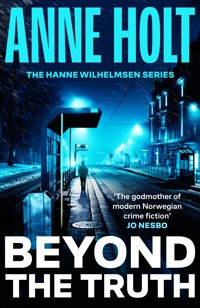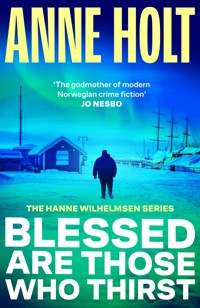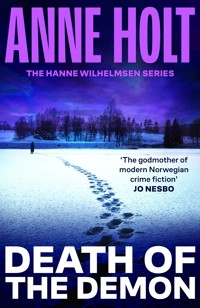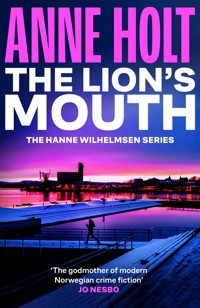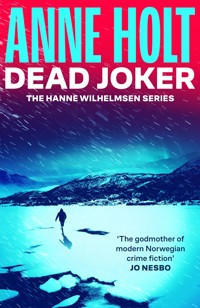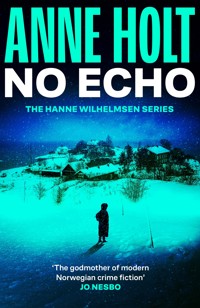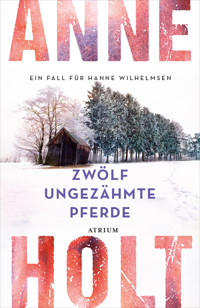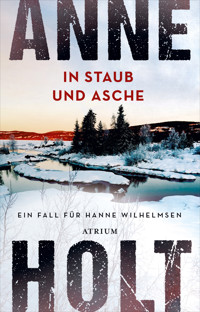11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atrium Verlag AG
- Kategorie: Krimi
- Serie: Hanne-Wilhelmsen-Reihe
- Sprache: Deutsch
Im Spannungsfeld von Politik, Macht und Intrigen Die norwegische Ministerpräsidentin wird tot in ihrem Büro aufgefunden – erschossen. Doch es fehlt jedes Motiv, und Hanne Wilhelmsen sieht sich gezwungen, frühzeitig aus ihrem Sabbatical zurückzukehren, um die Ermittlungen begleiten zu können. Kurz darauf nimmt sich ein Richter, der die Politikerin zuletzt lebend gesehen haben soll, das Leben. Als schließlich eine Spur zu mysteriösen Todesfällen aus dem Jahr 1965 führt, scheint sich die Büchse der Pandora zu öffnen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 476
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Anne Holt
Im Zeichen des Löwen
Hanne Wilhelmsens vierter Fall
Aus dem Norwegischen von Gabriele Haefs
Die deutsche Erstausgabe erschien 1999 im Piper Verlag, München.
This translation has originally been published with the financial support of NORLA, Norwegian Literature Abroad
© Atrium Verlag AG, Zürich, 2024
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © Anne Holt und Berit Reiss-Andersen 1997
Die Originalausgabe erschien 1997 unter dem Titel Løvens gap
bei Cappelens Forlag, Oslo.
Für die vorliegende Ausgabe wurde die deutsche Übersetzung
von der Übersetzerin überarbeitet.
Published by agreement with Salomonsson Agency
Covergestaltung: zero-media.net, München
Covermotiv: Stocksy/Guille Faingold
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
ISBN978-3-03792-213-2
www.atrium-verlag.com
www.facebook.com/atriumverlag
www.instagram.com/atriumverlag
Für unsere Freunde
Dr. Glück, den Schafzüchter, und
Arnold, den Ritter der Schwafelrunde
»Es hilft nichts, Zoologie studiert zu haben,
wenn man im Rachen des Löwen steckt.«
Gunnar Reiss-Andersen
Freitag, 4. April 1997
18.47, Büro der Ministerpräsidentin
Die Frau, die im Vorzimmer der Ministerpräsidentin saß, starrte abwechselnd ihr Telefon und die Doppeltür an und wurde dabei von steigender Unruhe erfüllt. Sie trug ein blaues Kostüm, einen adretten kleinen, klassisch geschnittenen Blazer mit passendem Rock und ein etwas zu buntes Halstuch. Obwohl ein langer Arbeitstag hinter ihr lag, hatte sich keine Haarsträhne aus ihrer eleganten, wenn auch ein wenig unmodernen Frisur gelöst. Die Frisur ließ die Frau älter wirken, als sie tatsächlich war. Vielleicht wollte sie es so, vielleicht sollte sie ihr eine Würde verleihen, die ihr die vierzig Jahre nicht liefern konnten.
Sie hatte genug zu tun, aber anders als sonst schaffte sie nichts. Sie saß einfach nur da. Den einzigen Hinweis auf ihre steigende Befürchtung, dass hier etwas nicht stimmen könnte, boten ihre langen, gepflegten Finger mit den tiefroten Nägeln und zwei Goldringen an jeder Hand. Immer wieder fuhren sie an ihre Schläfe, um unsichtbare Haare glatt zu streichen, und schlugen danach mit einem dumpfen Geräusch auf der Schreibtischunterlage auf, wie eine mit Schalldämpfer abgefeuerte Serie von Schüssen. Plötzlich sprang die Frau auf und lief zum Fenster.
Draußen dämmerte es. Fünfzehn Stockwerke tiefer sah sie fröstelnde Menschen durch die Akersgate eilen, manche liefen irritiert im Kreis und warteten auf einen Bus, der vielleicht niemals eintreffen würde. Hinter den Fenstern des Büros der Kulturministerin brannte noch immer Licht. Trotz der Entfernung konnte die Frau im blauen Kostüm sehen, wie die Sekretärin das Vorzimmer verließ, um ihrer Chefin einen Stapel Papiere zu bringen. Die junge Ministerin lachte die ältere Frau an und warf ihre blonden Haare nach hinten. Sie war zu jung für eine Kulturministerin. Und sie war nicht groß genug. Ein langes Abendkleid machte sich einfach nicht gut an einer Frau von knapp eins sechzig. Zu allem Überfluss steckte die junge Dame sich auch noch eine Zigarette an und stellte den Aschenbecher auf den Papierstapel.
Sie sollte in diesem Büro nicht rauchen, dachte die Frau in Blau. Da hängen schließlich wahre Kulturschätze. Das kann doch nicht gut sein für die Bilder.
Dankbar klammerte sie sich an dieses Gefühl der Irritation. Für einen Moment ließ sich dadurch die Unruhe verdrängen, die inzwischen in eine unbekannte, besorgte Angst umzukippen drohte.
Vor zwei Stunden hatte Ministerpräsidentin Birgitte Volter sehr energisch und fast unfreundlich erklärt, sie wolle nicht gestört werden, auf gar keinen Fall. Genau das hatte sie gesagt: »Egal wie.«
Gro Harlem Brundtland hätte niemals »egal wie« gesagt. Sie hätte gesagt: »Ganz gleichgültig, worum es geht«, vielleicht hätte sie sich auch einfach mit der Anweisung begnügt, nicht gestört werden zu wollen. Selbst wenn sämtliche sechzehn Etagen des Regierungsgebäudes in Flammen gestanden hätten, Gro Harlem Brundtland wäre in Ruhe gelassen worden, wenn sie darum gebeten hätte. Doch Gro war am fünfundzwanzigsten Oktober des Vorjahres zurückgetreten, und nun waren neue Zeiten angebrochen, neue Gewohnheiten und eine neue Sprache waren angesagt, und Wenche Andersen behielt ihre Gefühle für sich. Sie machte wie immer ihre Arbeit, effektiv und diskret.
Vor einer guten Stunde hatte Benjamin Grinde, Richter am Obersten Gericht, das Büro der Ministerpräsidentin verlassen. Er hatte einen anthrazitgrauen italienischen Anzug getragen, in der Doppeltür genickt und sie dann hinter sich geschlossen. Mit einem leisen Lächeln hatte er sich ein Kompliment über ihr neues Kostüm erlaubt, dann hatte er sich seine weinrote Lederaktentasche unter den Arm geklemmt und war die Treppe zum Fahrstuhl im vierzehnten Stock hinuntergegangen. Wenche Andersen war ganz mechanisch aufgestanden, um Birgitte Volter eine Tasse Kaffee zu bringen, hatte sich jedoch in letzter Sekunde auf die Anweisung ihrer Chefin besonnen, sie nicht zu stören. Doch allmählich wurde es wirklich spät.
Staatssekretäre und politische Berater waren schon gegangen, wie auch das übrige Büropersonal. Wenche Andersen saß an einem Freitagabend allein im fünfzehnten Stock eines Hochhauses im Regierungsviertel und wusste nicht, was sie machen sollte. Im Büro der Ministerpräsidentin herrschte tödliche Stille. Aber das war vielleicht kein Wunder. Es waren schließlich Doppeltüren.
19.02, Odins gate 3
Irgendetwas stimmte nicht mit dem Inhalt des schlichten tulpenförmigen Glases, das er hochhielt, um zu sehen, wie das Licht sich in der roten Flüssigkeit brach. Er horchte auf den Wein, versuchte, sich zu entspannen und ihn so zu genießen, wie ein schwerer Bordeaux es nun einmal verdiente. Angeblich sollte der Jahrgang 1983 eine offene und weiche Note haben. Bei diesem hier aber war die Kopfnote zu herb, und der Mann verzog voller Abscheu den Mund, als er erkannte, dass der Wein auch im Abgang in keinem Verhältnis zu dem Preis stand, den die Flasche gekostet hatte. Brüsk stellte er das Glas hin und griff zur Fernbedienung seines Fernsehers. Die Nachrichten hatten bereits angefangen. Die Sendung interessierte ihn nicht, und die Bilder flimmerten an ihm vorbei, während der Mann nichts registrierte, außer dass der Nachrichtensprecher einen unglaublich geschmacklosen Anzug trug. Ein Mann von Welt durfte einfach keine gelben Jacketts tragen.
Er hatte es tun müssen. Es hatte keine Alternative gegeben. Jetzt, da alles vorüber war, empfand er überhaupt nichts. Er hatte ein Gefühl der Befreiung erwartet, die Möglichkeit, nach all diesen Jahren aufzuatmen.
Er hätte sich so gern erleichtert gefühlt. Stattdessen überkam ihn eine ungewohnte Einsamkeit. Die Möbel kamen ihm plötzlich fremd vor. Das alte, schwere Eichenbüfett, auf dem er schon als Kind herumgeklettert war und das jetzt in seiner ganzen Pracht sein Wohnzimmer beherrschte, mit Traubenreliefs und der exklusiven Sammlung japanischer Netsuke-Miniaturen hinter den geschliffenen Glastüren, schien ihm jetzt nur noch düster und bedrohlich.
Auf dem Tisch zwischen ihm und dem Fernseher lag ein Gegenstand. Warum er ihn mitgenommen hatte, war ihm völlig unklar. Er schüttelte sich und ließ den Nachrichtensprecher mit einem Tastendruck verschwinden. Es war der Abend vor seinem fünfzigsten Geburtstag. Er kam sich viel älter vor, als er sich steif vom Chesterfieldsofa erhob, um in die Küche zu gehen. Die Pastete würde er am besten schon an diesem Abend machen. Erst nach vierundzwanzig Stunden im Kühlschrank entfaltete sie ihren vollen Geschmack.
Für einen kurzen Moment spielte er mit dem Gedanken, eine weitere Flasche von dem teuren Bordeaux zu öffnen. Er entschied sich jedoch dagegen und begnügte sich mit einem Cognac, den er sich großzügig in ein neues Glas einschenkte.
Doch auch die Küche bot ihm keine Ablenkung.
19.35, Büro der Ministerpräsidentin
Die Frisur saß nun nicht mehr so perfekt. Eine starre, blondierte Locke fiel ihr in die Augen, und sie spürte die Schweißperlen auf der Oberlippe. Nervös griff sie zu ihrer Handtasche, öffnete sie und zog ein frisch gebügeltes Taschentuch heraus, das sie sich zuerst an den Mund und dann an die Stirn hielt.
Jetzt würde sie hineingehen. Vielleicht war etwas passiert. Birgitte Volter hatte das Telefon ausgestöpselt, sie musste also anklopfen. Vielleicht war die Ministerpräsidentin krank. In den letzten Tagen hatte sie gestresst gewirkt. Obwohl Wenche Andersen an dem lässigen und ungewohnten Stil der Ministerpräsidentin allerlei auszusetzen hatte, musste sie zugeben, dass sie normalerweise sehr freundlich war. In der vergangenen Woche jedoch war sie fast abweisend gewesen, übellaunig und leicht reizbar. Ob sie krank war? Jetzt würde sie zu ihr gehen. Jetzt.
Statt die Ministerpräsidentin zu stören, ging sie auf die Toilette. Vor dem Spiegel ließ sie sich viel Zeit. Sie wusch sich ausgiebig die Hände und holte dann eine kleine Tube Handcreme aus dem Schränkchen unter dem Waschbecken. Gründlich massierte sie ihre Finger und spürte, wie die Creme in die Haut einzog. Unbewusst schaute sie auf die Uhr und atmete schwer. Es waren erst viereinhalb Minuten vergangen. Die kleinen Goldzeiger schienen fast stillzustehen. Ängstlich und resigniert ging sie zurück zu ihrem Schreibtisch; sogar das Geräusch der Toilettentür, die hinter ihr ins Schloss fiel, hatte ihr Angst gemacht.
Jetzt musste sie hineingehen. Wenche Andersen erhob sich halbwegs, zögerte und setzte sich wieder. Die Anweisung war eindeutig gewesen. Birgitte Volter wollte nicht gestört werden. »Egal wie.« Doch sie hatte auch nicht gesagt, dass Wenche Andersen Feierabend machen dürfe, und es wäre unerhört gewesen, ohne Erlaubnis das Büro zu verlassen. Jetzt würde sie hineingehen. Sie musste hineingehen.
Sie legte eine Hand auf die Klinke und horchte an der Tür. Alles still. Vorsichtig tippte sie mit dem Mittelfinger gegen das Holz. Noch immer war alles still. Sie öffnete die äußere Tür und tippte gegen die nächste. Keine Reaktion. Wenche Andersen schwitzte jetzt nicht nur an der Oberlippe. Vorsichtig und zögernd, mit der Option, sie schnell wieder zu schließen, wenn die Ministerpräsidentin in irgendeine wichtige Arbeit vertieft wäre, öffnete sie die Tür einen Spaltbreit. Doch sie konnte nur das Ende der Sitzgruppe mit dem runden Tisch sehen.
Plötzlich wurde Wenche Andersen von einer Entschlossenheit erfasst, die ihr seit mehreren Stunden ganz fremd gewesen war. Sie riss die Tür sperrangelweit auf. »Entschuldigung«, sagte sie laut. »Ich möchte nicht stören, aber …«
Mehr brauchte sie nicht zu sagen.
Ministerpräsidentin Birgitte Volter saß in ihrem Schreibtischsessel, ihr Oberkörper war über den Schreibtisch gebeugt. Sie erinnerte an eine Studentin, die in einem luxuriösen Lesesaal für ihr Examen büffelte; eine, die nur kurz eingenickt war, die eine kleine Ruhepause brauchte. Wenche Andersen stand einige Meter von ihr entfernt in der Türöffnung, konnte es aber trotzdem sehen: Das Blut, das auf den Überlegungen zum Schengener Abkommen eine große, stillstehende Lache gebildet hatte, war ausgesprochen gut sichtbar. So sichtbar, dass Wenche Andersen nicht einmal nachsah, ob sie ihrer Chefin noch helfen, ihr ein Glas Wasser holen oder ihr ein Taschentuch geben könnte, um die Schweinerei wegzuwischen.
Sie schloss vorsichtig, aber äußerst entschlossen die Türen zum Büro der Ministerpräsidentin, umrundete ihren eigenen Schreibtisch, griff zum Telefon und wählte die Direktdurchwahl zur Osloer Polizei. Schon nach dem ersten Klingelzeichen meldete sich am anderen Ende eine Männerstimme.
»Sie müssen sofort kommen«, sagte Wenche Andersen, und ihre Stimme zitterte nur ganz leicht. »Die Ministerpräsidentin ist tot. Erschossen. Birgitte Volter ist ermordet worden. Sie müssen herkommen.«
Dann legte sie auf, griff zu einem anderen Telefon und hatte die Wachzentrale am Apparat.
»Hier ist das Büro der Ministerpräsidentin«, sagte sie, jetzt ruhiger. »Riegelt das Haus ab. Niemand darf rein, niemand raus. Nur die Polizei. Und vergesst die Garage nicht.«
Ohne eine Antwort abzuwarten, legte sie auf und wählte dann eine andere vierstellige Nummer.
»Vierzehnter Stock«, sagte der Mann, der im Stockwerk unter ihr in seinem Kasten aus kugelsicherem Glas saß, der Schleuse zum Allerheiligsten, dem Büro der Regierungschefin des Königreiches Norwegen.
»Hier ist das Büro der Ministerpräsidentin«, sagte sie noch einmal. »Die Ministerpräsidentin ist tot. Veranlasst die Durchführung des Krisenplans.«
So tat Wenche Andersen ihre Pflicht, wie sie immer ihre Arbeit tat: systematisch und tadellos. Die einzigen Hinweise darauf, dass es kein normaler Freitagabend für sie war, lieferten zwei lila Flecken auf ihren Wangen, die immer größer wurden und bald ihr ganzes Gesicht bedeckten.
19.50, Redaktion der Aftenavisen
Als Liten Lettviks Eltern ihr blondes Püppchen damals Lise Annette tauften, obwohl es doch eine ein Jahr ältere Schwester gab, die diesen Namen unweigerlich zu »Liten«, also der Kleinen, zusammenziehen würde, ahnten sie wohl kaum, dass Lise Annette vierundfünfzig Jahre später zweiundneunzig Kilo wiegen, pro Tag zwanzig Zigarillos rauchen und jeden Tag Whisky trinken würde, haarscharf an der Grenze dessen, was eine erschöpfte Leber ertragen kann. Ihr gesamtes Erscheinungsbild mit den grauen, struppigen Haaren und einem Gesicht, das von fast dreißig Jahren in der Osloer Zeitungsstraße Akersgate zeugte, sowie die Tatsache, dass sie noch immer das in den siebziger Jahren erkämpfte Recht für sich geltend machte, keinen BH zu tragen, hätten zu Spötteleien eingeladen. Aber niemand riss über Liten Lettvik Witze. Jedenfalls nicht in ihrer Anwesenheit.
»Was zum Henker will ein Richter vom Obersten Gericht an einem späten Freitagnachmittag bei der Ministerpräsidentin?«, murmelte sie vor sich hin.
»Was hast du gesagt?«
Der Knabe vor ihr war ihr Hündchen. Er war klapperdürr, eins sechsundneunzig und hatte immer noch Pickel. Liten Lettvik verachtete Leute wie Knut Fagerborg, Rotzbengel mit einer auf sechs Monate befristeten Vertretungsstelle bei der Abendzeitung. Aber Knut war nützlich. Wie alle anderen bewunderte er sie grenzenlos. Er glaubte, sie werde für eine Verlängerung seiner Stelle sorgen. Da irrte er sich. Aber bis dahin galt: Er war nützlich.
»Komisch«, murmelte sie jetzt, eigentlich mehr an sich selbst gerichtet als an Knut Fagerborg. »Ich habe heute Nachmittag versucht, Grinde beim Obersten Gericht anzurufen. Es ist gar nicht so leicht, herauszufinden, was seine Kommission eigentlich so treibt. Die Tussi im Vorzimmer hat gezwitschert, er sei bei der Ministerpräsidentin. Aber was zum Teufel wollte er von ihr?«
Sie hob die Arme und streckte sich. Knut registrierte den Geruch von POISON. Vor nicht allzu langer Zeit hatte er sich beim Notarzt mit Antihistaminen behandeln lassen müssen, weil er die Nacht mit einer Frau verbracht hatte, die in dieser Hinsicht denselben Geschmack hatte wie Liten Lettvik.
»Was willst du?«, fragte sie plötzlich, als habe sie ihn gerade erst entdeckt.
»Also, irgendwas ist los. Erst läuft der Polizeifunk Amok, und jetzt herrscht Totenstille. So was hab ich noch nie erlebt.«
Nun hatte der nicht einmal zwanzig Jahre alte Knut Fagerborg ohnehin noch nicht viel erlebt, aber Liten musste ihm beipflichten. Das war wirklich seltsam.
»Leute!« Ein Mann um die vierzig in grauer Tweedjacke betrat mit schlurfenden Schritten die Redaktion.
»Irgendwas ist im Hochhaus los. Jede Menge Menschen und Autos, und jetzt wird die Straße abgesperrt. Erwartet die Ministerpräsidentin irgendein hohes Tier aus dem Ausland?«
»Abends? An einem Freitagabend?«
Liten Lettvik tat das linke Knie weh.
Zwei Stunden, bevor die Bohrinsel Alexander L. Kielland gekentert war, hatte ihr das linke Knie weh getan. Am Tag vor dem Mord an Olof Palme hatte es wie besessen geschmerzt. Ganz zu schweigen davon, wie sie am ersten Abend des Golfkriegs zum Notarzt gehumpelt war und sich darüber gewundert hatte, dass die Schmerzen so spät eingesetzt hatten. Später in der Nacht hatte sie dann erfahren, dass König Olav gestorben war.
»Geh mal rüber und sieh nach.«
Knut machte sich auf den Weg.
»Kennt ihr eigentlich Leute, die 1965 ein Kind bekommen haben?«
Liten Lettvik rieb sich das Knie, was nicht ganz einfach war; sie keuchte und quetschte ihren Bauch gegen die Tischkante.
»Ich bin Jahrgang 1965«, rief eine elegante Frau in fliederfarbenem Kostüm, die zwei Ordner aus dem Archiv brachte.
»Das hilft uns nicht weiter«, sagte Liten Lettvik. »Du lebst ja noch.«
20.15, Büro der Ministerpräsidentin
Billy T. hatte ein Gefühl, das er als Sehnsucht interpretierte. Es hatte ihn irgendwo im Zwerchfell gepackt, und er musste mehrere Male tief Luft holen, um einen klaren Kopf zu bekommen.
Das Büro der norwegischen Ministerpräsidentin wäre recht geschmackvoll gewesen, wenn sie nicht mit dem Kopf auf den Papieren tot dagelegen hätte; das war eine im wahrsten Sinne des Wortes blutige Beleidigung des Innenarchitekten, der sich nach sorgfältigen Erwägungen für einen großen Schreibtisch mit geschwungener Kante entschieden hatte. Die schwungvollen, welligen Formen wiederholten sich bei einem Bücherregal, das zwar recht dekorativ war, aus Mangel an geraden Linien jedoch restlos unbrauchbar schien. Es enthielt deshalb auch nicht viele Bücher. Das Zimmer war rechteckig, auf der einen Seite befand sich eine Sitzgruppe, auf der anderen stand der Schreibtisch mit den beiden Besuchersesseln. Nichts in diesem Raum hätte als luxuriös bezeichnet werden können. Anderswo im Land hatte Billy T. bereits wesentlich exklusivere Büros gesehen. Dies war ein ganz und gar sozialdemokratischer Raum, ein nüchternes Ministerpräsidentinnenbüro, über das norwegische Gäste anerkennend nickten, während Staatsoberhäupter aus manchen anderen Ländern es vielleicht als zu schlicht auffassen würden. An den beiden Enden des Zimmers befand sich jeweils eine Tür; durch die eine war Billy T. eben hereingekommen, die andere führte in einen Aufenthaltsraum mit Dusche und Toilette.
Der Arzt war blass und hatte Blutflecken an seiner grauen Jacke. Er kämpfte mit seinen Latexhandschuhen, die sich nicht abstreifen lassen wollten, und Billy T. hörte aus seiner angespannten Stimme einen Hauch von Feierlichkeit heraus.
»Ich nehme an, dass die Ministerpräsidentin vor zwei bis drei Stunden gestorben ist. Aber das ist nur eine vorläufige Annahme. Äußerst vorläufig. Ich gehe davon aus, dass die Temperatur in diesem Zimmer konstant gewesen ist, jedenfalls bis zu unserem Eintreffen.«
Endlich gaben die Handschuhe nach, mit einem saugenden Geräusch verabschiedeten sie sich von den Fingern und wurden in die Tasche der Tweedjacke gestopft. Der Arzt richtete sich auf.
»Kopfschuss.«
»Seh ich doch selber«, murmelte Billy T.
Der Abteilungsleiter bedachte ihn mit einem warnenden Blick.
Billy T. hatte verstanden. Er wandte sich den drei Männern von der Technik zu, die bereits ihrer Pflicht nachkamen: Sie fotografierten, maßen aus, pinselten Fingerabdruckpuder aus und bewegten sich in diesem Büro mit einer Eleganz, die alle überrascht hätte, die das noch nie gesehen hatten. Sie gaben vor, diese Arbeit gewohnt zu sein, alles als reine Routine zu betrachten. Aber im Zimmer herrschte eine beinahe sakrale Stimmung, nichts war zu bemerken vom üblichen Galgenhumor, und die gedrückte Stimmung wurde dadurch verstärkt, dass die Temperatur zu steigen begann. Eine tote Ministerpräsidentin lud einfach nicht zu lockeren Sprüchen ein.
Wie immer, wenn er vor einer Leiche stand, dachte Billy T., dass nichts so nackt war wie der Tod. Diese Frau zu sehen, die bis vor drei Stunden das Land regiert hatte, diese Frau, die ihm nie begegnet war und die er doch Tag für Tag im Fernsehen und in den Zeitungen gesehen und im Radio gehört hatte; Birgitte Volter zu sehen, diesen Inbegriff einer öffentlichen Person, die jetzt tot über ihrem eigenen Schreibtisch hing – das war schlimmer, peinlicher, als hätte er sie ohne Kleider überrascht.
»Irgendwelche Waffen?«, erkundigte er sich bei einem jungen Polizisten, der sich für einen Moment Richtung Tür zurückgezogen hatte, er trank Wasser aus einem Plastikbecher, den er dann an eine uniformierte Kollegin im Vorzimmer weiterreichte. Der junge Mann schüttelte den Kopf.
»Nein.«
»Nein?«
»Noch nicht. Keine Waffen.«
Er wischte sich mit dem Jackenärmel den Mund ab.
»Die finden wir schon noch«, sagte er dann. »Wir haben noch längst nicht überall gesucht. Das Gebäude ist ja der reinste Irrgarten. Aber hier drinnen ist die Waffe wahrscheinlich nicht.«
Billy T. fluchte leise.
»In dieser Bude gibt es doch mindestens vierhundert Büros. Dürfte ich vielleicht anregen, dass wir Verstärkung bekommen?«
Letzteres sagte er mit einem angestrengten Lächeln und fuhr sich über seinen glatt rasierten Schädel.
»Sicher«, sagte der Abteilungsleiter. »Die Waffe müssen wir finden, das ist klar.«
»Ist doch wohl selbstverständlich«, sagte Billy T. gerade so leise, dass niemand von den anderen es hören konnte.
Er wollte weg hier. Er wurde hier nicht gebraucht. Er wusste, dass die Tage, Wochen, ja vielleicht auch Monate, die vor ihnen lagen, die reine Hölle sein würden. Es würde für lange Zeit Ausnahmezustand herrschen. Keine freien Tage, an längeren Urlaub war gar nicht zu denken. Keine Zeit für die Jungen. Für vier Kinder, die doch zumindest am Wochenende Anspruch auf ihn hatten. Aber im Moment wurde er nicht gebraucht, nicht hier, nicht in diesem rechteckigen Büro mit dem wunderbaren Blick auf das abendlich beleuchtete Oslo und mit einer Frau, die tot über dem Schreibtisch lag.
Wieder packte ihn das Gefühl von Einsamkeit und von Sehnsucht nach ihr, seiner einzigen Vertrauten. Sie hätte jetzt da sein müssen, zusammen waren sie unbesiegbar, allein hatte er das Gefühl, dass seine zwei Meter zwei und das Petruskreuz im Ohr nichts nützten. Zum letzten Mal wich sein Blick der Blutlache unter dem Frauenkopf aus.
Er wandte sich um und fasste sich an die Brust. Hanne Wilhelmsen war in den USA und würde erst zu Weihnachten zurückkehren.
»O verdammt, Billy T.«, flüsterte der Polizist, der vorhin Wasser getrunken hatte. »Mir ist wirklich speiübel. Das ist mir noch nie passiert. Nicht am Tatort, meine ich. Nicht seit meiner Anfangszeit.«
Billy T. sagte nichts dazu, er blickte den Mann nur kurz an und bedachte ihn mit einer blitzschnellen Grimasse, die sich mit einigem Wohlwollen als Lächeln deuten ließ.
Ihm selbst war auch ziemlich schlecht.
20.30, Redaktion der Aftenavisen
»Da scheint echt was los zu sein«, keuchte Knut Fagerborg. »Jede Menge Leute, jede Menge Autos, überall Sperren, und dabei ist es so still! Verdammt, sind die alle toternst!«
Er ließ sich in einen viel zu niedrigen Bürosessel fallen und streckte ausgiebig die Beine aus, was ihm das Aussehen einer Spinne verlieh.
Liten Lettviks linkes Knie schmerzte unglaublich. Sie erhob sich und stellte behutsam den Fuß auf den Boden, während sie vorsichtig die Belastung des Knies erhöhte.
»Das will ich selber sehen«, sagte sie und zog eine Schachtel Zigarillos aus der Tasche.
Vorsichtig und langsam, während Knut Fagerborg von einem Fuß auf den anderen trat und viel lieber vor ihr her zum Hochhaus gerannt wäre, zündete sie sich ein Zigarillo an.
»Ich glaube, du hast recht«, sagte sie lächelnd. »Da ist wohl wirklich eine große Sache im Gange.«
20.34, Schloss Skaugum in Asker
Die schwarze Regierungslimousine hielt vor dem Eingang zum Landsitz des Königs in Asker, eine halbe Stunde Fahrzeit von der Stadt entfernt. Ein hochgewachsener, schlanker Mann in dunklem Anzug öffnete die rechte Hintertür, noch ehe der Wagen richtig gehalten hatte, und stieg aus. Er zog seinen Mantel fest um sich und steuerte mit großen Schritten auf die Eingangstür zu.
Ein Uniformierter öffnete und führte ihn in einen Raum, der Ähnlichkeit mit einer Bibliothek hatte. Mit leiser Stimme wurde er gebeten zu warten. Der Mann, der ihn empfangen hatte, hatte erstaunt die Augenbrauen hochgezogen, als der Besucher die ausgestreckte Hand abwehrte, die seinen Mantel an den dafür vorgesehenen Platz hängen wollte. Jetzt saß der schlaksige Außenminister in einem unbequemen Barocksessel und kam sich fehl am Platze vor. Er zog seinen Mantel noch fester zusammen, obwohl ihm wirklich nicht kalt war.
Der König stand in der Tür. Er trug Alltagskleidung, eine graue Hose, ein Hemd, das am Hals offen war. Sein Gesicht sah noch besorgter aus als sonst, seine Augen, deren obere Hälfte von schweren Lidern bedeckt war, flackerten unruhig. Der Außenminister sprang auf und streckte ihm die Hand hin.
»Ich habe leider sehr schlechte Neuigkeiten, Eure Majestät«, sagte er leise und hustete hinter vorgehaltener Faust.
Die Königin war ihrem Gemahl gefolgt. Sie stand einige Meter von der Tür entfernt und hielt ein Glas mit Eiswürfeln in der Hand. Es klirrte freundlich, als sie das Zimmer betrat, wie eine Einladung zu einem gemütlichen Abend. Sie trug eine damenhafte Jeans und einen bunten, mit schwarzen und roten Kühen bestickten Pullover. Ihre professionelle Miene konnte eine gewisse Neugier über diesen Besuch nicht verhehlen.
Der Außenminister fühlte sich nicht wohl in seiner Haut. Das Königspaar schien einen seiner seltenen ruhigen Abende zu Hause zu genießen.
Er nickte der Königin zu, dann blickte er wieder dem König in die Augen und sagte: »Ministerpräsidentin Volter ist tot, Eure Majestät. Sie wurde heute Abend erschossen aufgefunden.«
Die beiden Majestäten tauschten einen Blick, der König rieb sich nachdenklich die Nasenwurzel. Schweigen.
»Ich glaube, Sie sollten sich setzen«, sagte der König schließlich und zeigte auf den Sessel, den der hochgewachsene, dunkelhaarige Mann eben erst verlassen hatte. »Nehmen Sie Platz und erzählen Sie weiter. Und geben Sie mir doch Ihren Mantel.«
Der Außenminister schaute mit einer Miene an sich hinunter, die den Eindruck erweckte, er wüsste nicht einmal, dass er diesen Mantel trug. Mit zitternden Fingern knöpfte er ihn auf, brachte es aber nicht über sich, ihn dem König zu reichen, sondern hängte ihn über die Sessellehne und setzte sich wieder.
Die Königin berührte mit der Hand seine Schulter, als sie an ihm vorüberging, um sich einige Meter von ihm entfernt in einem Sessel niederzulassen: die tröstende Geste einer Frau, die hinter den dicken, dunklen Brillengläsern des Außenministers Tränen erahnt hatte.
»Möchten Sie etwas trinken?«, fragte sie leise, doch der Mann schüttelte nur kurz den Kopf und räusperte sich dann ausgiebig. »Nein, ich glaube nicht. Ich habe eine sehr lange Nacht vor mir.«
20.50, Ole Brumms vei 212
»Mein herzliches Beileid«, sagte der Bischof von Oslo und versuchte, den Blick seines Gegenübers einzufangen.
Das gelang ihm nicht. Roy Hansen war zweiunddreißig Jahre mit Birgitte Volter verheiratet gewesen. Bei ihrer Hochzeit waren sie beide blutjung gewesen, und gewissen turbulenten Phasen zum Trotz hatten sie in einer Zeit zusammengehalten, als alle Welt ihnen zu beweisen versuchte, dass eine lebenslange Ehe in einem hektischen, urbanen Milieu ein Ding der Unmöglichkeit sei. Birgitte war nicht nur ein wichtiger Teil seines Lebens gewesen, in vieler Hinsicht war sie sein Leben. Das hatte sich aus der Tatsache ergeben, dass sie sich beide für Birgittes Karriere engagiert hatten. Jetzt saß er auf dem Sofa und starrte einen Punkt an, den es gar nicht gab.
Die Parteisekretärin der Sozialdemokraten stand neben der Verandatür und schien sich in Anwesenheit des Bischofs nicht wohl in ihrer Haut zu fühlen.
»Bitte, gehen Sie«, flüsterte der Mann auf dem Sofa.
Das Gesicht des Bischofs zeigte Ungläubigkeit, jedoch nur für einen kurzen Moment; dann riss er sich zusammen und gewann seine Bischofswürde zurück.
»Es ist ein sehr schwerer Moment für Sie«, sagte er. »Selbstverständlich respektiere ich Ihren Wunsch, allein gelassen zu werden. Gibt es vielleicht jemand anderen, den Sie sehen möchten? Vielleicht jemanden aus Ihrer Familie?«
Roy Hansen starrte noch immer auf einen Punkt, den die anderen nicht sehen konnten. Er schluchzte nicht, sondern atmete leicht und gleichmäßig, doch aus seinen blassblauen Augen floss ein stiller Tränenstrom, ein kleiner Bach, den er schon längst nicht mehr wegzuwischen versuchte.
»Sie kann bleiben«, sagte er, ohne die Parteisekretärin anzusehen.
»Dann empfehle ich mich«, sagte der Bischof, stand aber noch immer nicht auf. »Ich werde für Sie und Ihre Familie beten. Und bitte, rufen Sie an, wenn ich oder jemand anders irgendetwas für Sie tun kann.«
Er stand noch immer nicht auf. Die Parteisekretärin wartete neben der Tür und hätte sie gern geöffnet, um den Abmarsch des Bischofs zu beschleunigen, aber irgendetwas an dieser ganzen Situation ließ sie wie angewurzelt stehen bleiben. Die Minuten vergingen, und nur das Ticken einer Tischuhr in ihrem Eichengehäuse war zu hören. Plötzlich schlug sie neunmal, schwere, angestrengte, zögernde Schläge, so als wäre es ihr lieber, wenn dieser Abend nicht weiterginge.
»Ja ja«, sagte der Bischof mit einem tiefen Seufzer. »Ich empfehle mich also.«
Als er endlich gegangen war und die Parteisekretärin die Tür hinter ihm abgeschlossen hatte, kehrte sie ins Wohnzimmer zurück. Roy Hansen sah sie zum ersten Mal an, mit einem verzweifelten Blick, der in einer Grimasse verschwand, als er endlich in Tränen ausbrach. Die Parteisekretärin setzte sich neben ihn, und er ließ zu, dass sie seinen Kopf auf ihren Schoß legte, während er um Atem rang.
»Jemand muss mit Per sprechen«, schluchzte er. »Ich bringe es nicht über mich, mit Per zu sprechen.«
21.03, Odins gate 3
Die Leber war von prima Qualität. Er hielt sie sich unter die Nase und berührte das helle Fleischstück ganz leicht mit der Zunge. Der Schlachter in Torshov war der einzige, zu dem er wirklich Vertrauen hatte, wenn es um Kalbsleber ging, und obwohl die Schlachterei nicht gerade verkehrsgünstig lag, lohnte sich der Umweg.
Die Trüffeln hatte er drei Tage zuvor in Frankreich gekauft. Normalerweise begnügte er sich mit Konserven, aber wenn sich die Gelegenheit bot – was relativ oft der Fall war –, konnte sich doch nichts mit der frischen Variante messen.
Ding-dong.
Er musste etwas mit der Türklingel machen. Ihr Geräusch war so unharmonisch und atonal, dass er jedes Mal zusammenfuhr, wenn sie erklang.
Rasch schaute er auf seine Armbanduhr. Er erwartete keinen Besuch. Es war Freitag, und sein Fest war für Samstag angesetzt.
Auf dem Weg zur Wohnungstür blieb er plötzlich stehen und zögerte einen kurzen Moment. Dann ging er mit resoluten Schritten zum Couchtisch und packte den darauf liegenden Gegenstand. Ohne weiter darüber nachzudenken, öffnete er eine der mit Trauben verzierten Büfetttüren und schob den Gegenstand hinter die Leinenwäsche. Dann wischte er sich die Hände an seiner Flanellhose ab und öffnete die Wohnungstür.
»Benjamin Grinde?«
Vor der Tür stand eine Polizistin zusammen mit einem Kollegen. Bei ihrer Frage blickte sie ihm nicht in die Augen, sondern starrte einen Punkt zehn Zentimeter oberhalb seines Kopfes an. Neben ihr stand ein etwas jüngerer Mann mit Brille und einem dichten, gepflegten Bart.
»Ja«, antwortete Benjamin Grinde und trat beiseite, wobei er die Tür weit öffnete, als einladende Geste für die Polizistin und ihren Kollegen.
Die beiden tauschten einen raschen Blick. Dann folgten sie dem Richter vom Obersten Gericht in sein Wohnzimmer.
»Ich nehme an, Sie werden mir gleich erzählen, worum es geht«, sagte er und zeigte aufs Sofa.
Er selbst setzte sich in einen tiefen Ohrensessel. Die Uniformierten blieben stehen, der Polizist trat hinter das Ledersofa. Verlegen machte er sich dort an einer Naht zu schaffen und senkte den Blick.
»Wir möchten Sie bitten, uns auf die Wache zu begleiten«, sagte die Frau, nachdem sie sich geräuspert hatte. Offenbar fühlte sie sich zunehmend unwohl. »Wir, also die Juristen bei uns, hätten Sie gern zu einem … einem Gespräch eingeladen, könnte man sagen.«
»Zu einem Gespräch?«
»Zu einer Vernehmung.«
Der Bärtige schaute auf und fügte hinzu:
»Wir wollen Sie vernehmen.«
»Mich vernehmen? Weshalb denn?«
»Das werden Sie dort erfahren. Auf der Wache.«
Benjamin Grinde, Richter beim Obersten Gericht, sah zuerst die Frau an, dann den Mann. Dann lachte er. Ein leises, freundliches Lachen, er schien sich in diesem Moment köstlich zu amüsieren.
»Sie wissen vermutlich, dass ich die Vorschriften kenne«, sagte er schmunzelnd. »Im Grunde brauche ich Sie überhaupt nicht zu begleiten. Natürlich stehe ich gern zu Diensten, aber dann will ich auch wissen, worum es geht.«
Er erhob sich, und wie um seine eigene Sicherheit zu betonen, verließ er seine Gäste und verschwand in der Küche. Gleich darauf war er wieder da, mit dem Cognacglas in der Hand. Er trank ihnen mit einer eleganten Handbewegung zu und schien seine Geburtstagsfeier damit bereits eröffnet zu haben.
»Sie trinken sicher nicht, wenn Sie im Dienst sind«, sagte er lächelnd und machte es sich dann wieder in seinem Sessel bequem, nachdem er eine Zeitung vorn Fußboden aufgehoben hatte.
Die Polizistin nieste.
»Gesundheit«, murmelte Benjamin Grinde und machte sich an der Wirtschaftszeitung zu schaffen, deren rosa Papier auf seltsame Weise mit den Möbeln harmonierte.
»Ich glaube, Sie sollten uns begleiten«, sagte die Frau, jetzt in energischerem Tonfall. »Wir haben einen Haftbefehl, für alle Fälle …«
»Einen Haftbefehl? Aber weswegen denn, wenn ich fragen darf?«
Die Zeitung lag wieder auf dem Boden, und Grinde saß, ein wenig vorgebeugt, in seinem Sessel.
»Ehrlich gesagt«, meinte die Frau und ging zum Sofa, um Platz zu nehmen. »Wäre es nicht besser, wenn Sie uns einfach begleiteten? Sie haben es ja selber gesagt: Sie kennen das System, und es gibt nur Ärger und Probleme, wenn wir Sie festnehmen. Denken Sie nur an die Zeitungen. Es ist doch viel besser, wenn Sie einfach mitkommen.«
»Zeigen Sie den Haftbefehl.«
Grindes Stimme war kalt, hart und unerschütterlich.
Der jüngere Mann machte sich am Reißverschluss seiner Innentasche zu schaffen und zog dann einen blauen Zettel hervor. Zögernd blieb er stehen und schaute seine ältere Kollegin Rat suchend an. Sie nickte kurz, und Benjamin Grinde nahm das Stück Papier in Empfang. Er faltete es auseinander und strich es glatt.
Zu allem Überfluss hatten sie seine gesamten Titel aufgeführt: »Dr. jur., Dr. med. Benjamin Grinde, Richter beim Obersten Gericht. Anklage: Übertretung von Paragraf 233 des Strafgesetzbuches, vergleiche Paragraf 232 …«
Als er die den Paragrafen folgende Tatbeschreibung las, wurde er nicht nur blass. Seine leicht sonnengebräunte Haut färbte sich grau, und wie durch Zauberhand war sein Gesicht jetzt schweißnass.
»Ist sie tot?«, flüsterte er ins Leere. »Ist Birgitte tot?«
Seine Gäste wechselten wieder einen raschen Blick und wussten, dass sie beide dasselbe dachten: Entweder hatte dieser Mann keine Ahnung davon, was passiert war, oder er hätte seiner ohnehin schon äußerst imponierenden Meritenliste noch den Titel »königlicher Schauspieler« hinzufügen können.
»Ja. Sie ist tot.«
Für einen Moment befürchtete die Frau, Benjamin Grinde könne in Ohnmacht fallen. Seine Gesichtsfarbe war erschreckend, und wenn er nicht in so unverschämt guter körperlicher Verfassung gewesen wäre, hätte sie Angst um sein Herz gehabt.
»Wie denn?«
Benjamin Grinde war aufgestanden. Seine Schultern hingen herab. Das Cognacglas hatte er brutal vor sich auf den Tisch gepflanzt; die goldene Flüssigkeit schwappte und glitzerte im Licht des Kronleuchters über dem Esstisch.
»Das dürfen wir Ihnen nicht sagen. Wie Sie sicher wissen …«, sagte die Frau, und in ihrer Stimme lag jetzt etwas Weiches, was ihren Kollegen ärgerte und ihn dazu veranlasste, ihr brüsk ins Wort zu fallen:
»Also, kommen Sie mit?«
Wortlos faltete Benjamin Grinde den blauen Zettel zusammen, vorsichtig und pedantisch, ehe er ihn, ohne zu zögern, in seine eigene Tasche steckte.
»Natürlich komme ich mit«, murmelte er. »Eine Festnahme ist wirklich nicht nötig.«
Vor dem alten, ehrwürdigen Haus in Frogner standen fünf Streifenwagen. Als er sich auf den Rücksitz des einen setzte, sah er zwei Polizisten in seinem eigenen Treppenhaus verschwinden.
Die sollen sicher vor meiner Wohnung Wache halten, dachte er. Vielleicht warten sie auf einen Durchsuchungsbefehl. Dann legte er den Sicherheitsgurt an.
Dabei merkte er, dass seine Hände zitterten, und das sogar ziemlich heftig.
21.30, Kirkevei 129
Das Telefon hatte keine Ruhe gegeben. Am Ende hatte sie den Stecker herausgezogen. Es war Freitagabend, und sie wollte frei haben. Richtig frei. Das war doch wohl das Mindeste. Jeden Tag rannte sie zwischen Büro und Parlament hin und her, da wollte sie sich nicht auch noch ihren sauer verdienten Freitagabend verderben lassen. Die Kinder waren beide ausgegangen, und halbwüchsig, wie sie waren, sah sie sie ohnehin nur selten. Im Moment war ihr das nur recht. Sie war erschöpft und fühlte sich ein wenig krank, und sie hatte den Europieper bewusst ganz hinten im Kleiderschrank verstaut, obwohl sie eigentlich jederzeit erreichbar sein musste. Vor einer halben Stunde hatte sie gehört, dass im Schlafzimmer ein Fax eingegangen war, doch sie hatte keine Lust gehabt, es zu lesen. Sie mixte sich einen Campari mit ein wenig Tonic und vielen Eiswürfeln, legte die Füße auf den Tisch und hoffte, dass sie im Gewirr der vielen Fernsehsender, mit denen sie sich noch immer nicht so ganz auskannte, einen Krimi finden würde.
Der Norwegische Rundfunk erschien ihr am verheißungsvollsten.
Gerade begann eine Nachrichtensendung. Um halb zehn? Sicher die Spätnachrichten. Aber so früh schon? Sie stand auf, um sich eine Zeitung zu holen.
Da fiel ihr der Text am rechten Bildrand auf: »Sondersendung«. Eine Sondersendung? Sie blieb mit dem Campariglas in der Hand stehen. Der Mann mit den schütteren hellen Haaren und müden Augen schien mit den Tränen zu kämpfen. Er räusperte sich, ehe er sagte:
»Ministerpräsidentin Birgitte Volter ist tot. Im Alter von nur knapp einundfünfzig Jahren wurde sie im Laufe des Nachmittags oder des frühen Abends in ihrem Büro im Regierungshochhaus erschossen.«
Das Campariglas landete auf dem Boden. Sie hörte am Geräusch, dass es nicht zerbrochen war, aber der flauschige helle Teppich würde wohl für immer verdorben sein. Langsam ließ sie sich wieder aufs Sofa sinken.
»Tot«, flüsterte sie. »Birgitte? Tot … erschossen?«
»Wir schalten ins Regierungsgebäude.«
Ein junger, aufgeregter Mann, der in seiner viel zu weiten Windjacke klein wirkte, starrte aus weit aufgerissenen Augen in die Kamera.
»Ja, ich stehe hier vor dem Hochhaus, und soeben wurde bestätigt, dass Birgitte Volter wirklich …«
Er konnte offenbar nicht die passenden Worte finden, er hatte nicht einmal Zeit gehabt, sich einen dunklen Anzug anzuziehen, was dem Sprecher im Studio doch immerhin gelungen war, und er stotterte und hüstelte.
»… verschieden ist. Wir wissen nun, dass sie durch einen Kopfschuss getötet wurde, und alles weist darauf hin, dass sie sofort tot war.«
Dann fiel ihm nichts mehr ein. Er schluckte und schluckte, und der Kameramann schien nicht zu wissen, ob er ihn weiterhin in Großaufnahme zeigen sollte. Das Bild wanderte zwischen dem Reporter – der ein wenig zu hell angestrahlt wurde – und der leisen Geschäftigkeit im Hintergrund hin und her, wo die Polizei sich alle Mühe gab, Gaffer und Journalisten hinter die rot-weißen Absperrungsbänder zu drängen.
Birgitte war tot. Die Nachrichtenstimmen schienen sehr weit weg, und sie merkte, dass ihr schwindlig war. Sie steckte den Kopf zwischen die Knie und streckte die Hand nach einem Eiswürfel aus, der auf dem Teppich lag. Der Eiswürfel war mit Fusseln besetzt, aber sie hielt ihn sich an die Stirn, das sorgte für einen etwas klareren Kopf.
Der Sprecher im Studio setzte zu einem heldenhaften Rettungseinsatz für seinen jüngeren und unerfahrenen Kollegen vor dem Regierungsgebäude an.
»Wissen Sie, ob schon jemand verhaftet worden ist?«
»Nein, dafür gibt es keine Anzeichen.«
»Wissen wir etwas darüber, um was für eine Waffe es sich handelt?«
»Nein, wir wissen nur, dass Birgitte Volter tot ist und dass sie erschossen wurde.«
»Was passiert jetzt gerade im Hochhaus?«
Und so ging es ewig weiter, zumindest kam es der Gesundheitsministerin Ruth-Dorthe Nordgarden so vor. Nach einer Weile wurde ins Parlament geschaltet, wo eine ernste Versammlung von Fraktionsvorsitzenden vor laufender Kamera atemlos in den Sitzungssaal eilte.
Das Telefon!
Sie stöpselte den Stecker wieder ein, und schon nach wenigen Sekunden klingelte es.
Als sie auflegte, war ihr einziger Gedanke:
Bin ich jetzt meinen Job los?
Danach ging sie zum Kleiderschrank im Schlafzimmer, fischte den Europieper heraus und suchte nach passender Kleidung. Am besten Schwarz. Andererseits war sie der kalten Jahreszeit entsprechend blass, und da war Schwarz nicht gerade vorteilhaft.
Der Schock hatte sich gelegt, und sie empfand stattdessen eine steigende Irritation.
Es war wirklich ein ungeheuer unpassender Zeitpunkt zum Sterben. Ihr passte es jedenfalls überhaupt nicht. Das braune Velourskleid war da ja wohl gut genug.
Samstag, 5. April 1997
0.50, vor der Odins gate 3
Der Redakteur würde zwar stocksauer darauf reagieren, dass sie gegangen war, aber das spielte keine Rolle. Sie wollte nicht verraten, was sie sich bei der ganzen Sache dachte. Das war ihre Angelegenheit. Ihr Fall. Falls es denn ein Fall war.
»Something in the way he moves, tells me na-na-nana-na-na-na«, summte sie leise und zufrieden vor sich hin.
In Benjamin Grindes Wohnung brannte jedenfalls kein Licht. Natürlich konnte das auch bedeuten, dass er schlief. Andererseits schlief jetzt im Königreich Norwegen vermutlich kaum jemand, es war Freitagnacht, und der Mord an Ministerpräsidentin Birgitte Volter hatte wie eine Atombombe eingeschlagen. Im Fernsehen liefen stündliche Sondersendungen, obwohl es im Grunde nur wenig zu berichten gab. Die Sendungen bestanden vor allem aus nichtssagenden Kommentaren und Nachrufen, denen anzumerken war, dass Birgitte Volter ihr Amt erst vor sechs Monaten angetreten hatte, weshalb das Material nicht abrufbereit in den Redaktionen lag.
Sie schaute sich nach allen Seiten um und überquerte die Straße. Die Wagen standen am Bürgersteig so dicht hintereinander, dass sie sich nicht zwischen einem Volvo und einem BMW hindurchquetschen konnte und schließlich kehrtmachen musste, um anderswo eine etwas größere Lücke zu suchen.
Irgendetwas stimmte nicht mit dem Schloss der Haustür in der Odins gate 3. Oder mit der Tür, die sich nicht richtig schließen ließ; das Türblatt schien sich verzogen zu haben. Hervorragend. Dann würde sie nirgendwo klingeln müssen. Vorsichtig öffnete sie die schwere, massive Holztür und betrat das Haus.
Im überraschend großen Hausflur roch es nach Mörtel und Putzmitteln, ein Fahrrad war vor der Kellertür am Treppengeländer angeschlossen. Das Treppenhaus war gut in Schuss und elegant, mit gelben Wänden und einer grünen Zierleiste, und die ursprünglichen Bleiglasfenster über den Treppenabsätzen waren noch erhalten.
Auf halber Höhe der zweiten Treppe blieb sie stehen. Stimmen. Leise Stimmen, die einen Dialog führten. Leises Lachen.
Erstaunlich schnell zog sie sich zur Wand zurück und segnete das Schicksal, das ihr gerade an diesem Abend lautlose Ecco-Schuhe beschert hatte. Sie ging weiter nach oben, drückte sich dabei jedoch so dicht wie möglich an der Wand entlang.
Auf der Treppe saßen zwei Männer. Zwei uniformierte Polizisten. Sie saßen genau vor Benjamin Grindes Wohnung.
Sie hatte recht gehabt.
So vorsichtig, wie sie gekommen war, schlich sie wieder nach unten. Vor der defekten Haustür zog sie ein Mobiltelefon aus ihrem Mantel. Sie wählte eine der wertvolleren Nummern aus ihrer Liste. Die Nummer von Hauptkommissar Konrad Storskog, einem durch und durch unsympathischen Streber von fünfunddreißig Jahren. Sie wusste als Einzige, dass er mit zweiundzwanzig Jahren den Wagen seiner Eltern zu Schrott gefahren hatte, mit einem Alkoholpegel, der nie gemessen worden war, jedoch zweifellos knapp unter drei Promille gelegen hatte. Sie hatte in dem Auto hinter seinem gesessen, es war dunkel gewesen und die Straße menschenleer, und sie hatte die Eltern informiert, die auf bemerkenswerte Weise die Situation und die Karriere des jungen Polizisten gerettet hatten. Liten Lettvik hatte das alles zur späteren Verwendung archiviert und niemals bereut, damals vor dreizehn Jahren ihre Pflichten als Staatsbürgerin vernachlässigt zu haben.
»Storskog«, meldete sich am anderen Ende eine harte Stimme; auch Storskog benutzte ein Mobiltelefon.
»Hallo, Konrad, altes Haus«, sagte Liten Lettvik grinsend. »Viel zu tun heute Nacht?«
Schweigen.
»Hallo? Hörst du mich?«
Es rauschte nicht, und sie wusste, dass er am anderen Ende war.
»Konrad, Konrad«, sagte sie nachsichtig. »Spiel jetzt nicht den Spröden.«
»Was willst du?«
»Nur die Antwort auf eine winzig kleine Frage.«
»Und die wäre? Ich hab verdammt viel zu tun.«
»Ist Richter Benjamin Grinde zurzeit bei euch?« Abermals Schweigen.
»Ich habe keine Ahnung«, sagte er nach einer langen Pause.
»Unsinn. Natürlich hast du eine Ahnung. Sag einfach Ja oder Nein, Konrad. Ja oder Nein.«
»Warum sollte er hier sein?«
»Wenn er nicht bei euch ist, handelt es sich um ein grobes Dienstvergehen.«
Sie lächelte und fügte hinzu:
»Denn er muss der Letzte gewesen sein, der Birgitte Volter lebend gesehen hat. Er war am späten Nachmittag in ihrem Büro. Natürlich müsst ihr mit dem Mann sprechen. Kannst du nicht einfach Ja oder Nein sagen, Konrad, dann kannst du dich wieder an deine wichtige Arbeit machen.«
Wieder wurde es ganz still.
»Dieses Gespräch hat niemals stattgefunden«, sagte er dann hart und entschieden.
Und legte auf.
Liten Lettvik hatte die Bestätigung, die sie gebraucht hatte.
»Something in the way he moves«, summte sie zufrieden, als sie zum Frognervei ging, um dort ein Taxi anzuhalten.
Denn jetzt eilte die Sache.
0.57, Hauptwache Oslo
Selbst Billy T., der dafür eigentlich kein Auge hatte, musste zugeben, dass Benjamin Grinde ein ungewöhnlich gut aussehender Mann war. Er war athletisch gebaut, nicht besonders groß, hatte breite Schultern und schmale Hüften. Seine Kleidung war ausgesprochen geschmackvoll, sogar die Socken, die zu sehen waren, wenn er die Beine übereinanderschlug, passten zu seinem Schlips, den er nur ganz wenig gelockert hatte. Den dunklen Haarkranz um seinen Kopf hatte er kurz geschoren, was seine fast kahle Schädelspitze beinahe erwünscht erscheinen ließ; sie zeugte von Potenz und großen Mengen Testosteron. Seine Augen waren dunkelbraun, der Mund wohlgeformt. Die Zähne waren überraschend weiß, immerhin war der Mann schon fünfzig.
»Sie haben morgen Geburtstag«, sagte Billy T., der in den Unterlagen blätterte.
Ein junger Polizeianwärter hatte Grindes Personalien aufgenommen, während Billy T. etwas Privates erledigen musste. Etwas sehr Privates. Er hatte Hanne Wilhelmsen ein zweiseitiges handgeschriebenes Fax geschickt. Danach hatte er geduscht. Beides hatte geholfen.
»Ja«, sagte Benjamin Grinde und schaute auf seine Armbanduhr. »Oder eigentlich heute. Genau genommen.«
Er lächelte müde.
»Fünfzig Jahre oder nicht«, sagte Billy T. »Lassen Sie uns das hier so schnell wie möglich über die Bühne bringen, damit Ihr Fest nicht ruiniert wird.«
Benjamin Grinde machte zum ersten Mal ein erstauntes Gesicht, bisher hatte sein Gesicht fast leer gewirkt, müde und nahezu apathisch.
»Über die Bühne bringen? Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass mir vor wenigen Stunden ein Haftbefehl vorgelegt worden ist. Und jetzt wollen Sie die Sache schnell erledigen?«
Billy T. wandte sich von der Schreibmaschine ab und musterte den Richter. Er presste die Handflächen auf den Tisch und legte den Kopf schräg.
»Hören Sie«, seufzte er, »ich bin nicht blöd. Und auch Sie sind definitiv nicht blöd. Sie und ich wissen beide, dass Birgitte Volters Mörder nicht deren Sekretärin freundlich anlächeln und brav in seine Küche nach Hause gehen würde, um dort …«
Er blätterte in den Unterlagen.
»… Pastete herzustellen. Waren Sie nicht gerade damit beschäftigt?«
»Doch.«
Jetzt sah der Mann ehrlich überrascht aus. Die Polizei war doch gar nicht in der Küche gewesen?
»Sie wären ein so perfekter und leicht zu überführender Mörder, dass Sie es unmöglich gewesen sein können.«
Billy T. lachte kurz auf und rieb sich so heftig das Ohrläppchen, dass das Petruskreuz tanzte.
»Ich lese Kriminalromane, müssen Sie wissen. Und der Mörder ist nie derjenige, der auf den ersten Blick so wirkt. Und Mörder gehen danach nicht nach Hause. Um ganz ehrlich zu sein, Grinde: Dieser Haftbefehl war ein verdammter Blödsinn. Es war nur richtig, dass Sie den an sich genommen haben. Werfen Sie ihn weg. Verbrennen Sie ihn. Typische Panikhandlung unserer verdammten Juristen …«
Er wandte sich wieder seiner Schreibmaschine zu und ließ die Finger vier Sätze hämmern, dann legte er ein neues Blatt ein. Wieder wandte er sich Benjamin Grinde zu und schien zu zögern, ehe er seine sehr langen Beine mit Stiefeln in Größe 47 auf die Tischkante legte.
»Warum waren Sie dort?«
»Im Büro? Bei Birgitte?«
»Birgitte? Haben Sie sie gekannt? Persönlich, meine ich?«
Die Füße knallten auf den Boden, und Billy T. beugte sich über den Schreibtisch.
»Birgitte Volter und ich kennen uns schon seit unserer Kindheit«, erwiderte Benjamin Grinde und starrte den Polizisten an. »Sie ist ein Jahr älter als ich, und das bedeutet ja viel, wenn man noch jung ist. Aber in Nesodden lief man sich eben dauernd über den Weg. Damals waren wir befreundet.«
»Damals. Und heute, sind Sie noch immer befreundet?«
Benjamin Grinde setzte sich anders hin und legte das linke Bein über das rechte.
»Nein, das kann ich wirklich nicht behaupten. Im Laufe der Jahre hatten wir nur ganz sporadischen Kontakt. Das hat sich so ergeben, könnte man sagen, weil unsere Eltern weiterhin Nachbarn waren, auch als wir beide schon längst von zu Hause ausgezogen waren. Nein. Ich würde nicht sagen, dass wir befreundet sind. Befreundet waren, meine ich.«
»Aber Sie duzen sich?«
Grinde lächelte kurz.
»Wenn man sich schon als Kinder gekannt hat, wirkt es doch etwas krampfhaft, auf das Sie umzusteigen. Auch wenn man zwischendurch den Kontakt verloren hat. Oder geht es Ihnen da anders?«
»Ich glaube nicht.«
»Gut. Sie wollen wissen, warum ich bei ihr war. Das steht sicher in ihrem Terminkalender. Vielleicht kann auch ihre Sekretärin das bestätigen. Ich wollte über die Notwendigkeit sprechen, die Kommission, der ich vorstehe, mit zusätzlichen Mitteln auszustatten. Eine von der Regierung eingesetzte Kommission.«
»Die Grinde-Kommission, natürlich«, sagte Billy T. und legte abermals die Füße auf den Tisch.
Benjamin Grinde starrte die Stiefelspitzen des Riesen auf der anderen Schreibtischseite an und fragte sich, ob hier ein Polizist seine Macht vorführen wollte, da er endlich einen der höchsten Richter des Landes in seiner Hand hatte.
Billy T. lächelte. Seine Augen waren so intensiv eisblau wie die eines Husky, und der Richter schlug seine nieder und betrachtete seine Knie.
»Halten Sie meine Füße bitte nicht für den Ausdruck mangelnden Respekts«, sagte Billy T. und schwenkte seine stahlbeschlagenen Stiefelspitzen. »Es ist einfach unbequem, wenn man lange Beine hat. Schauen Sie! Unter dem Tisch ist einfach nicht genug Platz.«
Er führte das ausführlich vor und legte die Füße dann wieder auf den Tisch.
»Sie wollten also über … zusätzliche Mittel sprechen?« Grinde nickte.
»Warum haben Sie sich denn nicht an die Gesundheitsministerin gewandt? Wäre das nicht näherliegend gewesen?«
Der Richter hob den Blick.
»Im Grunde schon. Aber ich wusste, dass Birgitte unserer Arbeit ganz besonderes Interesse entgegenbrachte. Außerdem … außerdem wollte ich die Gelegenheit wahrnehmen, sie zu treffen. Wir hatten seit vielen Jahren nicht mehr miteinander gesprochen. Ich wollte ihr gratulieren. Zum neuen Job, meine ich.«
»Warum wollten Sie mit Frau Volter darüber sprechen, dass Sie für Ihr Komitee mehr Geld brauchen?«
»Kommission.«
»Ist doch egal. Warum?«
»Die Arbeit wird viel mehr Zeit in Anspruch nehmen, als wir anfangs angenommen hatten. Wir müssen ausführliche Gespräche mit fünfhundert Elternpaaren führen, die im Jahre 1965 ihr Baby verloren haben. Das ist eine ziemliche Arbeit. Und wir müssen … auch im Ausland müssen einige Untersuchungen angestellt werden.«
Er schaute sich um, und sein Blick ruhte auf dem Fenster, das plötzlich vom pulsierenden Blaulicht eines Streifenwagens getroffen wurde. Dann erlosch das Licht wieder.
»Wie lange waren Sie bei ihr?«
Der Richter überlegte und starrte seine Armbanduhr an, als könne diese die Antwort wissen.
»Schwer zu sagen. Ich nehme an, eine halbe Stunde. Ich war um Viertel vor fünf bei ihr. Nein, es war wohl ziemlich genau eine Dreiviertelstunde. Bis halb sechs. Dann bin ich gegangen. Das weiß ich, weil ich überlegt habe, ob ich eine bestimmte Straßenbahn erwischen könnte oder ob ich mir lieber ein Taxi nehmen sollte. Eine Dreiviertelstunde.«
»Na gut.«
Billy T. sprang auf.
»Kaffee? Tee? Cola? Zigarette?«
»Eine Tasse Kaffee, bitte. Nein, ich rauche nicht.«
Billy T. ging zur Tür und öffnete sie. Leise sprach er mit einer Person, die offenbar direkt vor der Tür gestanden hatte. Dann schloss er die Tür und setzte sich wieder, diesmal auf die Fensterbank. Der Richter verspürte eine beginnende Gereiztheit.
Es mochte noch angehen, dass dieser Mann sich den Kopf glatt rasiert hatte und Jeans trug, deren beste Zeiten schon längst vorüber waren. Auch die beschlagenen Stiefel hätte er zur Not hinnehmen können, es war sicher schwer, für diese riesigen Füße das passende Schuhwerk zu finden. Das Petruskreuz jedoch war die pure Provokation, vor allem heutzutage, wo Rechtsextremisten und Satanisten fast täglich neue Verbrechen begingen. Und es musste diesem Mann doch wohl möglich sein, während eines Verhörs ruhig sitzen zu bleiben.
»Tut mir leid, wenn Sie finden, dass ich wie ein Nazischwein aussehe«, sagte Billy T.
Konnte der Mann Gedanken lesen?
»Ich wurde jahrelang bei Straßenunruhen eingesetzt«, fügte der Polizist hinzu. »Und ich hab mir noch nicht abgewöhnen können, wie ein Schläger auszusehen. In der Regel ist das auch ziemlich effektiv. Die Kriminellen behandeln einen wie einen Kumpel, wissen Sie. Sonst hat es nichts zu bedeuten.«
Es klopfte, und eine junge Frau in einem abgenutzten roten Samtkleid und Schnürschuhen brachte zwei Tassen Kaffee, ohne auf ein »Herein« zu warten.
»Engel!« Billy T. grinste. »Vielen Dank.«
Der Kaffee war glühend heiß und stark wie Schießpulver, es war unmöglich, ihn zu trinken, ohne zu schlürfen. Der gewachste Pappbecher wurde zu heiß, weichte auf und ließ sich nur mit Mühe halten.
»Ist bei Ihrem Gespräch etwas Besonderes vorgefallen?«, fragte Billy T
Der Richter schien zu zögern, er bekleckerte seine Hose mit Kaffee und wischte sich dann mit harten, wütenden Bewegungen den Oberschenkel ab.
»Nein«, sagte er dann, ohne sein Gegenüber anzusehen. »Das würde ich nicht behaupten.«
»Ihre Sekretärin meint, Frau Volter habe in den letzten Tagen verstört gewirkt. Ist Ihnen das auch aufgefallen?«
»Ich kenne Birgitte Volter ja eigentlich gar nicht mehr. Mir ist sie sehr korrekt vorgekommen. Nein, ich kann nicht behaupten, dass mir irgendetwas aufgefallen wäre.«
Benjamin Grinde lebte von der und für die Suche nach Wahrheit und Gerechtigkeit. Er sagte sonst immer die Wahrheit. Das Lügen war er überhaupt nicht gewohnt. Sein Unbehagen machte ihm zu schaffen, und ihm wurde schlecht. Vorsichtig stellte er die Tasse auf die Schreibtischkante. Dann schaute er dem Polizisten in die Augen.
»Nichts an ihrem Verhalten hat bei mir einen Verdacht erregt, es könnte etwas nicht stimmen«, sagte er mit fester Stimme.
Das Schlimmste an allem war, dass der Polizist ihn zu durchschauen schien, bis hin zu der Lüge, die sich in seinem Brustkorb ausgerollt hatte wie eine Giftschlange.
»Mir ist nichts Unnormales aufgefallen«, fügte er hinzu und schaute wieder aus dem Fenster.
Jetzt war das Blaulicht wieder da, immer wieder traf es auf die dunkle, matte Fensterscheibe.
2.23 norwegische Zeit, Berkeley, Kalifornien
Lieber Billy T.!
Es ist nicht zu fassen. Ich stand gerade am Herd, als Dein Fax kam. Es ist einfach nicht zu fassen! Ich habe sofort Cecilie angerufen, und so schnell ist sie noch nie aus der Uni zurückgekommen. Auch hier wird ausgiebig über den Mord berichtet, und wir hängen vor der Mattscheibe. Aber eigentlich erfahren wir nichts, immer wieder wird dasselbe erzählt. Ich habe schlimmeres Heimweh denn je!
Seht zu, dass Ihr Euch nicht durch Theorien alles verbaut. Wir müssen von den Schweden lernen, die sich ja anscheinend auf einer »offenkundigen« Spur nach der anderen restlos verirren. Wie sehen Eure ersten Theorien aus? Terrorismus? Rechtsextremisten? Und vergesst auf keinen Fall die nächstliegenden Lösungen: Verrückte, Verwandtschaft, verschmähte Liebhaber (damit kennst Du Dich doch aus …). Wie organisiert Ihr die Arbeit? Ich habe tausend Fragen, die Du im Moment sicher nicht beantworten kannst. Aber BITTE: Melde Dich, ich schreibe Dir auch bald mehr.
Das hier ist nur meine erste Reaktion, ich hoffe, Du kannst das Fax noch lesen, ehe Du schlafen gehst. Obwohl Du in der nächsten Zeit wohl kaum viel zum Schlafen kommen wirst. Ich schick Dir das Fax nach Hause, die Jungs ärgern sich sonst vielleicht, dass eine Hauptkommissarin im Exil sich in Dinge einmischt, die sie streng genommen nichts angehen.
Cecilie lässt Dich ganz herzlich grüßen. Typischerweise macht sie sich vor allem Sorgen um Dich. Ich denke eher an die Heimat, an meine Heimat Norwegen. Das ist doch der pure Wahnwitz. Melde Dich!
Deine Hanne
2.49, Redaktion der Aftenavisen
»Kommt nicht infrage, Liten. Das geht einfach nicht.«
Der Redakteur beugte sich über den Tisch und sah sich einen Entwurf für die Titelseite an. Seit der ersten Sondernummer, die schon um Mitternacht auf der Straße verkauft worden war, hatte sie sich radikal geändert. Vor ihm lag eine Titelseite, die von einem großen Bild von Benjamin Grinde dominiert wurde, begleitet von der dramatischen Schlagzeile: »Richter vom Obersten Gericht festgenommen«, darunter, kleiner: »Der Mann, der Volter als Letzter lebend sah.«
»Wir haben nicht genug Beweise«, sagte der Mann, kniff sich in die Nase und rückte seine Brille zurecht. »Er wird Schadenersatz verlangen. In Millionenhöhe.«
Liten Lettvik fiel es nicht weiter schwer, totale Verzweiflung zu zeigen. Sie stand breitbeinig da, fuchtelte mit den Armen, schüttelte den Kopf und verdrehte wild die Augen.
»Also wirklich!!!«
Sie brüllte dermaßen, dass für einen kurzen Moment in der ganzen Redaktion das Stimmengewirr verstummte. Als die anderen feststellten, wer so gebrüllt hatte, machten sie sich wieder an ihre Arbeit. Liten Lettvik neigte zu dramatischen Szenen, auch dann, wenn sie eigentlich unangebracht waren.
»Ich habe zwei Quellen«, fauchte sie durch zusammengebissene Zähne. »Zwei Quellen!«
»Beruhige dich«, sagte der Redakteur und hob und senkte die Hände in einer Bewegung, die vermutlich beschwichtigend wirken sollte, die Liten Lettvik aber reichlich herablassend fand. In seinem Büro ließen sie sich in die Sessel fallen.
»Welche Quellen sind das?«, fragte er und sah sie an.
»Sag ich nicht.«
»Gut. Dann gibt’s auch keinen Artikel.«
Er griff zum Telefon und schaute zur Tür hinüber, um ihr zu bedeuten, dass sie gehen sollte. Liten Lettvik schien kurz zu zögern, doch dann verließ sie den Raum und verzog sich in ihre Höhle. Ihr Arbeitszimmer war ein grandioses Chaos, überall lagen Bücher, Zeitungen, amtliche Dokumente, Butterbrotpapier und alte Apfelbutzen herum. Sie wühlte auf ihrem überfüllten Schreibtisch und fand mit bewundernswerter Sicherheit zwischen einem Pizzakarton mit zwei schlappen Pepperonistücken und einer alten Zeitung den Ordner, den sie gesucht hatte.
Sie fischte ein Zigarillo aus der Schachtel. Ihre Mappe über Benjamin Grinde war ziemlich umfangreich. Sie hatte wochenlang daran gearbeitet. Sie enthielt alles, was über seine Kommission in der Presse gestanden hatte, angefangen mit dem allerersten Interview mit Frode Fredriksen, dem Anwalt, der den Anstoß zur Einrichtung der Kommission gegeben hatte, die die merkwürdige Häufung von Todesfällen bei Babys im Jahre 1965 untersuchen sollte.
Das Interview hatte ihm eine Menge Aufträge eingebracht. Erstaunlich kurze Zeit nach dem Interview hatte er im Namen von hundertneunzehn Elternpaaren beim Parlament einen Antrag auf Schmerzensgeld eingereicht. Alle waren davon überzeugt, dass sich der Tod gerade ihres kleinen Lieblings hätte vermeiden lassen. Allen Fällen war gemeinsam, dass nichts auf einen ärztlichen Kunstfehler hindeutete. Auf den meisten Totenscheinen stand »plötzlicher Kindstod«. Die Aufregung wollte kein Ende nehmen. Die parlamentarische Opposition hatte am zehnten November 1996 die Regierung zur Einrichtung einer Untersuchungskommission gezwungen. Es hatte sich nicht umgehen lassen, denn auf Knopfdruck hatte das Statistische Zentralbüro bestätigen können, dass im Jahr 1965 weitaus mehr Kinder gestorben waren als vorher oder nachher. Benjamin Grinde war der perfekte Kommissionsleiter, er galt als Spitzenjurist und konnte neben seinen anderen beträchtlichen Meriten auch noch ein medizinisches Staatsexamen in die Waagschale werfen.
Liten Lettvik war müde.
Genau genommen wusste sie wirklich nicht, warum sie wenige Stunden nach dem Mord an der Ministerpräsidentin alte Zeitungsausschnitte über eine Untersuchung las, von der niemand mehr sprach und deren Ergebnis niemand vorhersagen konnte. Vielleicht lag es daran, dass sie sich zu sehr damit beschäftigt hatte. Während der letzten Wochen hatte sie keinen einzigen Artikel geschrieben, und nur ihrer Position als unangefochtene Doyenne der Redaktion war zu verdanken, dass das keine negativen Folgen für sie hatte. Die Sache mit den toten Kindern interessierte sie. Vielleicht machte dieses Interesse sie blind. Dafür war jetzt keine Zeit. Sie musste sich auf den Mord konzentrieren.
Jetzt interessierte sie sich für Benjamin Grinde. Seit Wochen hatte sie versucht, herauszufinden, was die Grinde-Kommission eigentlich trieb, aber sie war immer nur mit allgemeinen Informationen abgespeist worden. Und da war ausgerechnet der Kommissionsleiter vermutlich der Letzte, der die Ministerpräsidentin lebend gesehen hatte.
»Jetzt mach dich verdammt noch mal an die Arbeit, Liten.«
Das war der Redakteur. Wie immer ließ er einen angeekelten Blick durch das Büro wandern, dann wandte er sich ab und sagte:
»Jetzt leg gefälligst los. Du hast ja wohl schon mehr als genug zusammen.«