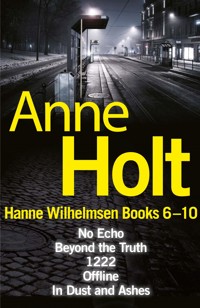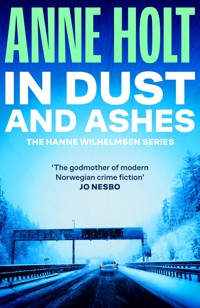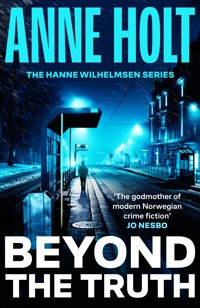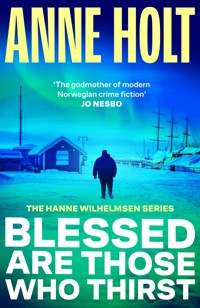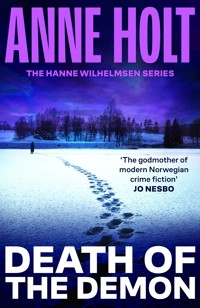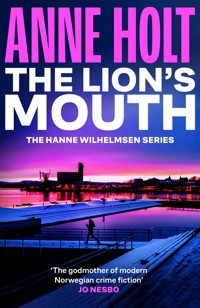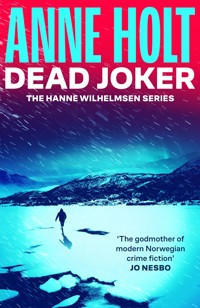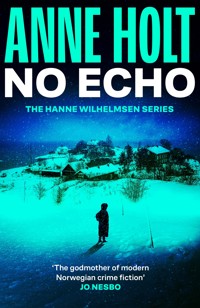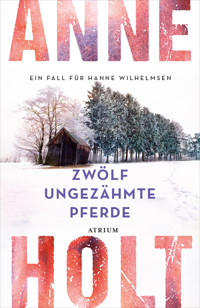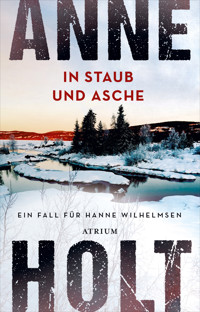11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atrium Verlag AG
- Kategorie: Krimi
- Serie: Hanne-Wilhelmsen-Reihe
- Sprache: Deutsch
Ein grausamer Vierfachmord Hanne Wilhelmsen muss ihren wohlverdienten Weihnachtsurlaub abbrechen – ein grausamer Mord an einer Reedereifamilie hält die norwegische Öffentlichkeit in Atem. Motive scheint es viele zu geben, doch die Tat bleibt rätselhaft. Und in welcher Verbindung steht der unbekannte Tote zu der ermordeten Familie? Hanne lehnt bei ihren Ermittlungen die klassischen Denkmuster ihrer Kollegen ab und kommt schließlich auf eine völlig überraschende Lösung …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 493
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Anne Holt
Die Wahrheit dahinter
Hanne Wilhelmsens siebter Fall
Aus dem Norwegischen von Gabriele Haefs
Die deutsche Erstausgabe erschien 2005 im Piper Verlag, München.
This translation has originally been published with the financial support of NORLA, Norwegian Literature Abroad
© Atrium Verlag AG, Zürich, 2024
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © Anne Holt 2003
Die Originalausgabe erschien 2003 unter dem Titel Sannheten bortenfor bei Cappelens Forlag, Oslo.
Für die vorliegende Ausgabe wurde die deutsche Übersetzung von der Übersetzerin überarbeitet.
Published by agreement with Salomonsson Agency
Covergestaltung: zero-media.net, München
Covermotiv: GettyImages, Shabby vintage grain Struktur: FinePic®, München
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
ISBN978-3-03792-216-3
www.atrium-verlag.com
www.facebook.com/atriumverlag
www.instagram.com/atriumverlag
Donnerstag, 19. Dezember
Der Hund war alt. Seine Hüften waren durch Verkalkungen steif und ungelenk geworden. Durch die Krankheit ähnelte das Tier fast einer Hyäne, mit kräftiger Brust und einer gewaltigen Nackenpartie, die zu dem mageren Hinterteil hin jählings schmaler wurde. Der Schwanz krümmte sich um die Hoden.
Das räudige Tier kam und ging. Niemand konnte sich daran erinnern, wann es zuerst aufgetaucht war. Es gehörte in gewisser Weise zu dieser Gegend dazu; eine Unannehmlichkeit, die man nicht vermeiden konnte, wie das Scheppern der Straßenbahnen, die falsch geparkten Wagen und die bei Glatteis nicht gestreuten Wege. Man musste sich eben vorsehen. Die Kellertüren verschlossen halten. Die Katze über Nacht ins Haus holen. Im Hinterhof sorgfältig die Deckel auf die Mülltonnen legen. Manchmal beschwerte jemand sich bei der Gesundheitsbehörde, wenn an drei Morgen hintereinander Essensreste und andere Abfälle bei den Fahrradständern herumlagen. Eine Reaktion kam nur selten, und nie wurde auch nur der Versuch unternommen, das Tier zu fangen.
Wenn sich jemand die Frage gestellt hätte, wie dieser Hund eigentlich lebte, dann wäre die Antwort gewesen, dass er sich nach einem gewissen Muster durch den Stadtteil bewegte, einem Muster, das unregelmäßig und deshalb nicht so leicht zu durchschauen war. Wenn jemand sich dafür interessiert hätte, hätte dieser Jemand erkennen können, dass der Hund nie weit weg war, dass er selten sein Revier verließ und dass dieses Revier nur fünfzehn oder sechzehn Häuserblocks umfasste.
So lebte der Hund seit fast acht Jahren.
Er kannte sein Revier und machte um andere Tiere einen großen Bogen. Er wich Schoßhunden an bunten Nylonleinen aus und wusste schon längst, dass Rassekatzen mit einer Glocke am Hals eine Versuchung darstellten, der er besser nicht erlag. Er war ein herrenloser Bastard in Oslos nobelstem Westend und blieb deshalb lieber in Deckung.
Die unerwartet hohen Temperaturen vor Weihnachten lagen hinter ihnen. Ein eiskalter Frost hatte den Asphalt überzogen. In der Luft lag ein Hauch von Schnee. Der Hund kratzte mit seinen Krallen über das Eis, und er zog ein Hinterbein nach. An der linken Seite seines Hinterteils leuchtete im Laternenlicht eine Schramme, sie schimmerte im spärlichen Fell violett und war verschmiert mit gelbem Eiter. Er war am Vorabend an einem Nagel hängen geblieben, auf der Suche nach einem Schlafplatz.
Der Wohnblock lag ein Stück abseits der Straße. Ein Plattenweg durchschnitt den Vorgarten. Feuchtes, totes Gras und ein von einer Plane bedecktes Blumenbeet lagen in einem auf Kniehöhe von einer schwarz angestrichenen Kette abgegrenzten Bereich. Rechts und links des Eingangs stand je ein mit elektrischen Kerzen geschmückter Weihnachtsbaum.
Der Hund unternahm an diesem Abend schon den zweiten Versuch, in ein Haus zu gelangen. In der Regel gab es immer irgendeinen Weg. Natürlich war es bei unverschlossener Tür am einfachsten. Ein leichter Sprung, ein Pfotenhieb gegen die Klinke. Ob die Tür sich nach außen oder nach innen öffnete, spielte normalerweise keine Rolle, unverschlossene Türen waren sowieso eine Kleinigkeit. Sie waren aber auch selten. In der Regel musste er nach angelehnten Kellerfenstern suchen, nach lockeren Brettern an Mauern, die renoviert werden sollten, nach Luken unter morschen Kellertreppen. Nach Eingängen, die außer ihm alle vergessen hatten. Es gab nicht überall welche, und manchmal waren die Luken repariert worden, die Fensterblenden festgenagelt und die Mauern neu verputzt. Oft war alles dicht und undurchdringlich. Dann zog er weiter. Es konnte Stunden dauern, bis er einen Unterschlupf für die Nacht gefunden hatte.
In diesem Haus gab es einen Zugang. Er kannte ihn, der Weg war einfach, aber er musste vorsichtig bleiben. Er schlief immer nur eine Nacht am selben Ort. Bei seinem ersten Versuch an diesem Abend war jemand gekommen. Das konnte durchaus passieren. Dann lief er ganz schnell davon, zwei oder drei Blocks weiter. Legte sich unter einen Busch, einen Fahrradständer, versteckt für alle, die nicht so genau hinsahen. Später machte er noch einen Versuch. Ein brauchbarer Zugang war schon zwei Versuche wert.
Aber in der letzten Stunde war der Frost stärker geworden. Und es schneite jetzt wirklich; trockene, leichte Flocken, die den Boden mit Weiß bedeckten. Er zitterte, und er hatte seit mehr als vierundzwanzig Stunden nichts mehr zu fressen gefunden.
Jetzt lag das Haus ganz still vor ihm.
Die Lichter zogen ihn an und machten ihm zugleich Angst.
Licht barg stets die Gefahr, dass man gesehen wurde. Und dann war es eine Bedrohung. Aber Licht bedeutete auch Wärme. Das Blut pochte schmerzhaft in der entzündeten Schramme. Zögernd stieg er über die niedrig hängende Kette. Er wimmerte, als er sein Hinterbein hob. Sein Durchgang, der Weg in den Verschlag mit dem achtlos in eine Ecke geworfenen alten Schlafsack, lag hinten im Haus, zwischen der Kellertreppe und zwei nie benutzten Fahrrädern.
Aber die Haustür war heute auch nur angelehnt.
Haustüren waren gefährlich. Er könnte eingesperrt werden. Aber ein warmes Licht lockte ihn trotzdem an. Treppenhäuser waren besser als Keller. Ganz oben, wo nur selten jemand vorbeikam, war es warm.
Mit gesenktem Kopf näherte er sich der Steintreppe. Er blieb mit erhobener Vorderpfote stehen, dann trat er langsam in den Lichtkegel hinein, der aus dem Treppenhaus herausfiel. Nirgendwo war auch nur eine Bewegung zu sehen, kein bedrohliches Geräusch war zu hören, nur das ferne, vertraute Rauschen der Stadt.
Und dann war er im Haus.
Wo es noch eine offene Tür gab.
Es roch nach Essen, und es war ganz still.
Es roch so sehr nach Essen, dass er nicht mehr zögerte. So schnell er konnte, humpelte er in die Wohnung hinein, blieb in der Diele aber stehen. Er knurrte tief in der Kehle und fletschte die Zähne, als er den Mann auf dem Boden sah. Nichts passierte. Der Hund ging weiter, neugierig jetzt, eher neugierig als ängstlich. Vorsichtig näherte seine Schnauze sich dem bewegungslosen Körper. Behutsam leckte er an der Blutlache, die den Kopf des Mannes umgab. Seine Zunge wurde schneller, schrappte über den Boden, befreite die Wange des Mannes von der geronnenen Masse, bohrte sich ins Loch gleich neben der Schläfe: Der ausgehungerte Hund leckte alles, was er aus dem Schädel nur herausholen konnte, ehe ihm aufging, dass er für seine Nahrung gar nicht so hart zu arbeiten brauchte.
In der Wohnung lagen drei Körper. Sein Schwanz peitschte vor Begeisterung.
»Hier gibt’s nichts zu diskutieren. Nefis muss sich verdammt noch mal an unsere Sitten halten.«
Marry knallte die Tür zu.
»Eins, zwei, drei, vier«, zählte Hanne Wilhelmsen, und bei vier stand Marry wieder im Zimmer.
»Wenn ich zu Weihnachten zu diesen Muslimisten fahren müsste, dann würde ich auch essen, was sie mir vorsetzen. Das ist doch eine Frage der Höflichkeit, wenn du mich fragst. Sie ist ja nicht mal fromm. Das hat sie mir schon ganz oft gesagt. Heiligabend gibt’s in Norwegen eben Schweinerippe. Und damit basta!«
»Aber Marry!« Hanne setzte resigniert zu einem neuen Versuch an. »Können wir nicht geräuchertes Hammelfleisch essen? Damit wäre das ganze Problem gelöst. Wir hatten doch letztes Jahr schon Rippe.«
»Das Problem?«
Marry Samuelsen hatte früher einmal als Harrymarry gelebt, Oslos älteste Straßennutte. Hanne war drei Jahre zuvor in Verbindung mit einem Mordfall über sie gestolpert. Marry war damals arg verkommen gewesen, Drogen und Großstadtkälte hatten ihre Spuren hinterlassen. Jetzt lebte sie als Haushälterin bei Hanne und Nefis in deren Siebenzimmerwohnung in der Kruses gate. Marry fuhr sich eifrig mit ihren gichtig geplagten Händen über die Schürze.
»Das Problem, beste Hanne Wilhelmsen, ist, dass die einzige Weihnachtsrippe, die ich je in mein zahnloses Maul schieben konnte, als ich dich und Nefis noch nicht kannte, wässrig und kalt war und auf einem Pappteller der Heilsarmee lag.«
»Das weiß ich, Marry. Wir können doch auch zwei Gerichte einplanen? Wir können uns das leisten, das weißt du.«
Hanne Wilhelmsen sah sich mit resignierter Miene im Zimmer um. Das einzige Möbelstück aus der Wohnung in Lille Tøyen, wo Hanne mehr als fünfzehn Jahre gelebt hatte, war ein antiquarischer Sekretär, der in einer Ecke am Ausgang zu einem riesigen Balkon fast verschwand.
»Weihnachten ist kein Platz für Kompromisse«, erklärte Marry feierlich. »Wenn du so wie ich Jahr für Jahr, einen Heiligabend nach dem anderen, an einem Speckstück gelutscht hättest, das zu zäh zum Essen war, und wenn du dabei einsam und vergessen in einer Ecke gesessen hättest, dann wüsstest du, dass es hier darum geht, dass wir auf unsere Träume aufpassen müssen. Heiligabend mit Kristall und Silber, einem Baum in der Ecke und einer dicken, fetten Rippe mitten auf dem Tisch mit einer so knusprigen Schwarte, dass sie kracht. In all den Jahren hab ich davon geträumt. Und so machen wir das jetzt endlich. So viel Respekt könnt ihr einer armen Alten, die vielleicht nicht mehr lange zu leben hat, ja wohl entgegenbringen.«
»Hör doch auf, Marry. Du bist doch wunderbar in Form. Und besonders alt bist du auch nicht.«
Marry machte abermals auf dem Absatz kehrt, sagte kein Wort mehr und marschierte davon. Sie zog das eine Bein heftig nach. Mit rhythmischem Hinken verschwand sie in der Küche. Hanne hatte beim Einzug gemessen, war die Entfernung abgeschritten, als sie sich ungesehen geglaubt hatte: sechzehn Meter vom Sofa zur Küchentür. Vom Esszimmer bis ins größere Badezimmer waren es elf Meter. Vom Schlafzimmer bis zur Haustür sechseinhalb. Die Wohnung schien sozusagen aus Entfernungen zu bestehen.
Sie goss sich aus einer stählernen Thermoskanne neuen Kaffee ein und schaltete den Fernseher ein.
Zum allerersten Mal hatte sie sich über Weihnachten freigenommen. Ganze zwei Wochen. Nefis und Marry hatten alle Welt zu einem ausgiebigen Frühstück am ersten Weihnachtstag eingeladen, und zwischen den Jahren hatten sie allerlei Mittagessen geplant, zu Silvester dann ein großes Fest. Am Heiligen Abend selbst aber würden sie unter sich sein. Glaubte Hanne. Man wusste ja nie.
Hanne Wilhelmsen fürchtete sich vor diesem Fest, und zugleich freute sie sich darauf.
Das Fernsehen brachte eine Verfilmung der Weihnachtsgeschichte. Das Jesuskind hatte seltsamerweise blaue Augen. Maria war stark geschminkt und hatte blutrote Lippen. Hanne schloss die Augen und stellte den Ton leiser.
Sie versuchte, nicht an ihren Vater zu denken. In letzter Zeit kostete das immer zu viel Kraft.
Der Brief hatte sie zu spät erreicht. Es war jetzt drei Wochen her. Hanne ging davon aus, dass ihre Mutter ihn ganz bewusst mit der Post geschickt hatte. Alle wussten schließlich, dass auf die Post kein Verlass mehr war. Die Todesanzeige war sechs Tage unterwegs gewesen. Und als der Brief ankam, hatte die Beerdigung schon stattgefunden. Was im Grunde ja keine Rolle spielte. Hanne wäre doch nicht hingegangen. Sie konnte sich alles lebhaft vorstellen: die Familie in der ersten Reihe. Der Bruder. Die Hand der Mutter in seiner, eine abstoßende Kralle, überwuchert von Ekzemen, sodass Hautschuppen über die dunkle Hose des Sohnes rieselten. Die Schwester trug eine teure Kreation, sie schluchzte immer wieder laut auf, war aber doch nicht so gebrochen, dass sie nicht auf alle Trauergäste einen überaus eleganten Eindruck gemacht hätte; die Kollegen des Vaters aus dem In- und Ausland, die eine oder andere akademische Berühmtheit, betagte Damen, die ihre Morgentoilette nicht mehr ganz im Griff hatten und deshalb in den Bankreihen den unerträglichen Geruch altmodischen Parfüms verströmten.
Das Telefon klingelte mit einem arabischen Tanz. Marry hatte mit dem Tonmenü experimentiert und gedacht, Nefis werde sich darüber freuen. Hanne nahm ab, damit Marry ihr nicht zuvorkam.
»Billy T. hier«, hörte sie, noch ehe sie etwas sagen konnte. »Du solltest mal hier vorbeischauen.«
»Jetzt? Es ist schon nach elf.«
»Trotzdem. Riesensache.«
»Morgen ist mein letzter Arbeitstag vor den Ferien, Billy T. Das bringt ja wohl nichts, dass ich mich an einen Fall mache, wo ich dann wirklich nur noch den Anfang mitkriege.«
»Die Ferien kannst du dir abschminken, Hanne.«
»Spinn hier nicht rum. Bis dann. Ruf jemand anders an. Ruf die Polizei an.«
»Sehr komisch. Komm schon. Vier Leichen, Hanne. Mutter, Vater, Sohn. Und dann noch einer, von dem wir nichts wissen.«
»Vier … vier Leichen? Vier Ermordete?«
»Yep. Und das ganz in deiner Nähe. Wenn du willst, sehen wir uns da.«
»Quadrupelmord …«
»Hä?«
»Soll das heißen, dass wir es mit einem vierfachen Mord zu tun haben?«
Aus dem Hörer kam ein demonstratives Seufzen.
»Wie oft muss ich das denn noch wiederholen?«, fragte Billy T. wütend. »Vier Tote. In einer Wohnung in der Eckersbergs gate. Allesamt erschossen. Grauenhafter Anblick. Die Leichen sind nicht nur durchsiebt, sondern … es war … danach war noch irgendetwas hier. Ein Tier. Oder so …«
»Herrgott …«
Auf dem Bildschirm klopfte Josef jetzt in der Abenddämmerung an Türen. In einer kurzen Großaufnahme seiner Hand, die an eine rustikale Tür in Bethlehem pochte, stellte Hanne fest, dass der Schauspieler vergessen hatte, seine Uhr abzulegen.
»Absurd«, murmelte sie. »Ein Tier?«
»Ein Hund, nehmen wir an. Er hat … sich bedient, könnte man wohl sagen.«
»Eckersbergs gate, hast du gesagt?«
»Nummer fünf.«
»Bin in zehn Minuten da.«
»Bei mir kann es etwas länger dauern.«
Sie legten gleichzeitig auf, Hanne trank den letzten Schluck Kaffee und erhob sich.
»Willst du noch weg?«
Marry stand breitbeinig in der Tür und stemmte die Hände in die Hüften. Ihr Blick zwang Hanne dazu, sich wieder zu setzen. Sie hob abwehrend die Hände.
»Das ist wirklich ein sehr wichtiger Fall«, sagte sie.
»Du kannst mich mal mit deinem Wichtig«, bellte Marry. »Nefis kommt in einer halben Stunde nach Hause. Sie ist schon unterwegs vom Flugplatz. Jetzt war sie eine ganze Woche weg, und ich stehe seit sieben in der Küche. Du bleibst hier!«
»Ich muss dahin.«
Marry biss sich auf die Lippen. Für einen Moment schien sie an etwas ganz anderes zu denken.
»Dann musst du was zu essen mitnehmen. Triffst du dich mit diesem Grobian?«
»Mmm.«
Zehn Minuten später war Hanne fertig. In ihrer Schultertasche lagen zwei Plastikdosen mit Rentierbraten, ein halbes, in Scheiben geschnittenes Brot mit einer dicken Schicht Butter, zwei Äpfel, anderthalb Liter Cola, eine große Tafel Schokolade, eine Packung Servietten, zwei Plastikbecher und außerdem Silberbesteck. Sie versuchte zu protestieren.
»Es ist doch mitten in der Nacht, Marry. So viel brauch ich wirklich nicht.«
»Aber sicher doch. Wir wissen schließlich nie, wann wir dich wieder sehen«, murmelte Marry. »Und vergiss nicht, das Silberbesteck wieder mitzubringen.«
Dann schloss sie sorgfältig hinter Hanne die Tür ab, alle drei Schlösser.
Sie würde sich wohl nie an diese Straßen gewöhnen. Die großen Lücken zwischen den prachtvollen Mietshäusern und den abweisenden, dunklen Villen schufen eine Atmosphäre der Angst, des drohenden Unheils. Ab und zu überquerte ein Fußgänger mit niedergeschlagenem Blick die Straße und bemühte sich, mit niemandem Blickkontakt aufzunehmen. Dass Marry sich einschloss, war nur natürlich. Nach fast einem halben Jahrhundert Drogenkonsum brauchte sie einfach eine gewisse Isolation. Warum alle anderen in dieser Gegend sich aber genauso einigelten, war unbegreiflich. Vielleicht waren sie immer verreist. Vielleicht wohnte hier in Wirklichkeit kein Mensch. Ganz Frogner ist eine Kulisse, dachte Hanne. Sie zog ihre Winterjacke fester um sich.
Doch bei dem Steinhaus Eckersbergs gate 5 war der Bär los. Rot-weißes Absperrband hielt eine kleine neugierige Zuschauergruppe zurück, doch innerhalb des abgegrenzten Gebietes wimmelte es nur so von Uniformen. Hanne erkannte mehrere Presseleute, die immer die jüngsten und unerfahrensten Polizisten ansprachen, geschockte Bereitschaftsleute, unerfahren, erregt, leicht zum Reden zu bringen. Es kamen immer neue Presseleute dazu, unerklärlich schnell, als ob sie alle in der Gegend wohnten. Als sie Hanne Wilhelmsen sahen, zogen sie in der Kälte einfach nur die Schultern hoch oder hoben kurz den Kopf zu einem gleichgültigen Gruß.
»Hanne. Wie schön!«
Oberwachtmeisterin Silje Sørensen riss sich von einer Gruppe eifrig gestikulierender Kollegen los.
»Himmel«, sagte Hanne und musterte die andere von Kopf bis Fuß. »Du trägst Uniform? Hier scheint ja wirklich was los zu sein.«
»Hatte eine Sonderschicht. Aber stimmt, hier ist wirklich was los. Komm mit rein.«
»Ich warte noch. Billy T. kommt gleich.«
Die provisorische Beleuchtung, die die Polizei schon aufgebaut hatte, blendete die Augen und machte es fast unmöglich, sich von der Straße einen allgemeinen Eindruck zu verschaffen. Hanne trat einige Meter zurück und hielt sich die Hand wie einen Schirm über die Augen. Das half ein wenig, und sie ging auf die andere Seite hinüber.
»Was suchst du denn?«, fragte Silje Sørensen, die ihr gefolgt war.
Silje fragte immer irgendwas. Nervte. Was suchst du? Was tust du? Was denkst du? Wie ein Kind. Wie ein aufgewecktes, aber ein wenig anstrengendes Kind.
»Nichts. Ich seh mich einfach nur um.«
Das Haus war in Altrosa gestrichen und hatte breite Gesimse. Über jedem Fenster kämpfte eine Männergestalt mit einem entsetzlichen Fabeltier. Der Vorgarten war klein und von Steinfliesen durchzogen, und ein breiter Gehweg, der um die westliche Hausecke herumführte, ließ auf einen beeindruckenderen Hinterhof schließen. Im Haus schien es nur vier Wohnungen zu geben. In der oben links gelegenen brannte kein Licht. Aus dem Erdgeschoss und dem ersten Stock rechts fiel sparsames Lampenlicht. Damit stand fast schon fest, wo das Verbrechen sich abgespielt hatte. Hinter drei Fenstern unten links sah Hanne Menschen in weißen Overalls und mit Haarnetzen, die sich hin und her bewegten, energisch und offenbar zielstrebig. Jemand zog einen Vorhang vor.
Hanne wurde von hinten umarmt und hochgehoben. »Ja, scheiße«, grölte Billy T., »du hast zugenommen!« Sie versetzte ihm mit dem Stiefelabsatz einen Tritt gegen das Schienbein.
»Au! Du hättest ja wohl was sagen können.«
»Und du brauchst mich nicht immer hochzuheben. Darum hab ich dich schon tausend Mal gebeten.«
»Das sagst du nur, weil du immer fetter wirst«, grinste er und schlug ihr freundschaftlich auf die Schultern. »Früher hast du dich nie beklagt. Nie. Da hat es dir gefallen.«
Der Schnee fiel jetzt dichter, in leichten, lockeren Flocken.
»Ich finde nicht, dass du dicker geworden bist«, sagte Silje rasch, aber Hanne stand schon fast auf der anderen Straßenseite.
»Gehen wir rein«, murmelte sie und merkte, dass ihr vor Angst schlecht geworden war.
Der Älteste der vier Ermordeten erinnerte an das berühmte Bild von Albert Einstein. Die Leiche lag im Flur, mit einer Hand unter dem Kopf, als habe sie es sich richtig gemütlich machen wollen. Die Haare umgaben den kahlen Schädel als üppiger Kranz. Mitten auf dem Kopf ragte ein einzelnes Büschel auf. Und die Zunge hing aus dem Mund, ganz unnatürlich weit sogar. Er hatte die Augen weit aufgerissen.
»Das sieht ja aus, als ob der Bursche einen Schock erlitten hätte. Einen Elektroschock!«
Billy T. beugte sich neugierig über den alten Mann.
»Aber da ist ja auch noch das hier.«
Er zog einen Kugelschreiber hervor und wies auf ein Einschussloch unter dem linken Auge. Es war nicht gerade groß und eher schwarz als blutrot.
»Und das. Und das.«
Der Arzt, der offenbar das Hemd des Toten behutsam zur Seite geschoben hatte, winkte Billy T. fort. Hanne konnte zwischen der spärlichen grauen Körperbehaarung zwei weitere Wunden erkennen.
»Wie viele Schüsse waren es eigentlich?«, fragte sie.
»Kann ich noch nicht sagen«, erwiderte der Arzt kurz. »Viele. Wenn ihr mich fragt, dann brauchen wir hier einen Pathologen. Wird höchste Zeit, dass ihr mit der Rechtsmedizin einen brauchbaren Dienstplan abmacht. Ich kann nur sagen, dass diese Leute hier tot sind. Ich glaube, den da hat es am schlimmsten getroffen.«
Hanne Wilhelmsen wollte »den da« eigentlich nicht ansehen. Sie musste sich dazu zwingen, um den alten Mann herumzugehen und die mit einem Mantel bekleidete Leiche genauer zu betrachten. Einer von der Spurensicherung stieß ein verstimmtes Grunzen aus, er konnte es nicht ertragen, wenn die Ermittler am Tatort herumtrampelten.
Hanne achtete nicht auf ihn. Als sie sich über die der Wohnungstür am nächsten liegende Leiche beugte und sah, dass von der Wunde in der Schläfe alles ausgetretene Blut abgeleckt worden war, verstärkte sich ihre Übelkeit. Rasch richtete sie sich auf, schluckte und zeigte auf den dritten Toten. Sie schätzte sein Alter auf vielleicht vierzig.
»Preben«, stellte Billy T. vor. »Der Älteste von Papa Hermann da hinten. Soweit wir wissen, zumindest.«
Die Arme lagen eng und gerade am Körper an, als habe der Sohn des Hauses vor dem Aufprall auf den Boden noch zu einem militärischen Salut ansetzen wollen. Sein Hemd war hellblau und wies in Höhe der Brusttasche zwei kleine Einschusslöcher auf. An der Schulter waren dunkle, fleischige Wunden erkennbar.
Der Arzt nickte fast unmerklich.
»Ich habe ihn mir noch nicht näher ansehen können. Der Hund hat da wirklich kräftig zugelangt … falls es sich um einen Hund handelt.«
»Komm!«
Billy T. winkte sie zur Küche, die hinten in der großen, dunklen Diele lag. Er sah komisch aus in dem weißen Overall, den grünen, über die Schuhe gezogenen Socken und dem viel zu engen Papiernetz auf dem Kopf.
Am Spülbecken lehnte eine Frauenleiche. Sie war kahl. Neben ihr auf dem Boden lag eine Perücke. Der Schädel der Frau war bleich und mit Narben übersät. Sie trug ein elegantes rosafarbenes Kleid, und ihre Augen waren weit geöffnet, scharf und fast vorwurfsvoll. Ein verwirrter junger Polizist machte einen unbeholfenen Versuch, ihr die Perücke wieder überzustülpen, und wurde von Billy T. zurückgehalten.
»Spinnst du, oder was? Nicht anfassen! Verdammt, was hast du hier überhaupt zu suchen? Dieser Ort ist wirklich überbevölkert!«
Gereizt machte er sich daran, die Spreu vom Weizen zu trennen. Hanne blieb stehen und versuchte, den Anblick zu begreifen, der sich ihr hier bot.
Die Frau stand wirklich und wahrhaftig aufrecht da.
Ihr Gesicht ließ kaum auf ihr Geschlecht schließen. Das musste daran liegen, dass ihr die Haare fehlten. Als Hanne näher trat, sah sie, dass die Augenbrauen der Frau unnatürlich aussahen, sie waren aufgemalt, saßen etwas zu hoch, waren zu kräftig. Über dem linken Auge beschrieb die gezeichnete Braue einen Bogen zum Nasenrücken, was den skeptischen Ausdruck noch verstärkte. Die Augen standen offen. Sie waren blassblau, klein und wimpernlos. Der Mund dagegen war wohlgeformt, und die Lippen waren füllig. Der Mund sah jünger aus als das restliche Gesicht, frisch repariert, sozusagen.
»Turid Stahlberg«, sagte Billy T., er hatte die Hälfte der Anwesenden aus der Wohnung geschickt, was die Stimmung beträchtlich beruhigt hatte. »Sie heißt Turid, wird aber in der Familie Tutta genannt.«
»Stahlberg«, sagte Hanne leicht verwirrt und schaute sich in der gediegenen Küche um. »Doch nicht die Familie Stahlberg?«
»Doch. Hermann, der Vater des Hauses, ist auch der Älteste der drei in der Diele. Preben habe ich dir ja schon vorgestellt. Er ist zweiundvierzig. Wieso fällt die Frau da eigentlich nicht um?«
Billy T. beugte sich vor und versuchte, hinter die stehende Frau zu schauen. Ihr breites Hinterteil lehnte gegen das Spülbecken. Ihre Füße standen breitbeinig auf dem Boden, als sei sie dem Mörder mit gespreizten Beinen entgegengetreten.
»Sie stützt sich hier ein wenig auf«, murmelte Billy T. »Mit dem Hintern. Aber der Oberkörper … warum fällt sie nicht?«
Ein schwaches, reißendes Geräusch hätte ihn warnen sollen, als er sich über die Leiche beugte und nach einer Erklärung suchte. Die Frau, die mindestens siebzig Kilo wog, brach über ihm zusammen und brachte ihn aus dem Gleichgewicht. Zuerst fiel er auf die Knie. Der Boden war vom Tee aus einer zerbrochenen Thermoskanne und von etwas wie Honig oder Sirup verklebt. Billy T.s Knie glitt blitzschnell zur Seite.
»Hanne! Verdammt! Hilfe!«
Billy T. lag zappelnd unter einer rosa gekleideten, kahlköpfigen Frauenleiche.
»Was zum …«
Die Verwünschungen von zwei Kollegen von der Spurensicherung hallten von den Wänden wider.
»Bleib still liegen. Bleib ganz still liegen!«
Fünf Minuten später durfte Billy T. dann endlich aufstehen, und er wirkte kleinlauter, als Hanne ihn seit einer Ewigkeit erlebt hatte.
»Tut mir leid, Jungs«, murmelte er und wollte ihnen dabei helfen, die Tote auf eine Bahre zu legen.
»Verschwinde hier«, fauchte der eine Kollege. »Du hast schon genug Unheil angerichtet.«
Erst jetzt fiel Hanne im Spülbecken, vor dem die Frau gestanden hatte, eine sauber geleckte Kuchenschüssel auf. In Resten fetter Sahne waren die Spuren einer Tierzunge zu ahnen. Struppige graue Haare klebten an den Rändern.
»Tutta ist immerhin vom Hund verschont geblieben«, sagte sie trocken. »Gerettet von der Sahnetorte.«
»Ich glaube, sie wollten etwas feiern«, sagte Billy T. »Im Wohnzimmer steht eine geöffnete, aber unangetastete Champagnerflasche. Vier Gläser. Ja, ja, ich geh ja schon. Ich hau ab, hab ich gesagt!«
Die Spurensicherung brachte gerade die Bahre aus der Küche hinüber in das Wohnzimmer.
»Vier Gläser«, wiederholte Hanne und folgte ihm in das große, üppig möblierte Zimmer.
»Und Schnittchen. Oder Butterbrote.«
Die Schnittchenplatte stand auf dem Esstisch. Sie wies nur noch ein Salatblatt und drei Gurkenscheiben auf, von denen die Mayonnaise abgeleckt worden war.
»Hatten sie einen Hund?«, fragte Hanne zerstreut.
»Nein«, sagte Silje Sørensen, und Hanne fiel zum ersten Mal auf, dass sie sich hereingeschlichen hatte. »Hier im Haus waren Hunde verboten. Genauer gesagt, die Eigentümerversammlung hatte beschlossen, dass niemand ein Tier halten darf:«
»Woher weißt du das jetzt schon?«
»Die Nachbarin«, sagte Silje und zeigte vage in Richtung Straße. »Ich habe mit einer Frau gesprochen, die hier genau gegenüber wohnt.«
»Was hast du sonst noch erfahren?«
»Nicht viel.«
Silje Sørensen feuchtete die Fingerspitzen an und blätterte in einem Spiralblock. An ihrer rechten Hand funkelte ein gediegener Diamantring.
»Die Leute von oben«, sie zeigte zur Decke, »sind verreist. Sie haben ein Ferienhaus in Spanien und sind seit November dort.«
»Und kümmert sich niemand um die Wohnung?«
»Diese Frau von gegenüber, Aslaug Kvalheim, sagt, dass die Tochter ab und zu vorbeischaut. Sie war seit ein paar Tagen nicht mehr hier, behauptet Frau Kvalheim. Und um ehrlich zu sein …«
Silje lächelte kurz.
»… glaube ich, dass Frau Kvalheim so ungefähr alles weiß, was hier in der Straße passiert. So eine richtig aufmerksame Nachbarin mit großem Interesse an ihren Mitmenschen.«
»Schön für uns«, sagte Hanne. »Was hat sie heute Abend gesehen?«
»Leider gar nichts. Sie ist um sieben zum Bingo gegangen und vor einer Stunde zurückgekommen. Und da waren wir ja schon hier.«
Hanne schnitt eine Grimasse.
»Und die anderen Wohnungen?«
»Gegenüber«, Silje hob den Daumen, dann blätterte sie weiter in ihrem Block, »da wohnt ein gewisser Henrik Backe. Alter, übellauniger Mann. Ich habe mit ihm gesprochen, und er war reichlich angetrunken. Stocksauer, weil wir so viel Lärm machten. Er hat mich nicht reingelassen.«
»Er hat dich nicht reingelassen? Du hast gar nicht mit ihm geredet und ihn einfach in Ruhe gelassen?«
»Nicht doch, Hanne. Reg dich nicht so auf. Jetzt gerade sind zwei Beamte bei ihm. Bisher weiß ich nur, dass er behauptet, den ganzen Abend zu Hause gewesen zu sein und nichts gehört zu haben.«
»Das kann doch nicht sein«, rief Billy T. »Schau dich doch um. Das muss ja wie die Hölle geknallt haben!«
»Ob das sein kann oder nicht, wissen wir ja wohl noch nicht«, sagte Silje leicht gereizt. »Der Typ kann schließlich einen Schalldämpfer benutzt haben. Und auf jeden Fall holen die Jungs Henrik Backe heute Nacht noch zur Vernehmung, da kann er protestieren, so viel er will. Dann werden wir ja sehen.«
»Wer hat uns eigentlich informiert?«
»Ein Typ, der ganz zufällig vorbeikam. Den werden wir natürlich auch noch überprüfen, aber das war ein jüngerer Mann, der einfach nur …«
»Schon gut. Alles klar.«
Hanne ertappte sich bei der Überlegung, wie groß die Wohnung wohl war. Das Wohnzimmer musste über siebzig Quadratmeter messen, auf jeden Fall, wenn man den nach hinten gelegenen Wintergarten dazuzählte. Die Möbel hatten etwas Erdrückendes, aber sie waren schön, wenn sie jedes Stück gesondert betrachtete. Vor einer Längswand thronte ein Büfett aus schwarzem Eichenholz mit geschnitzten Spiegeltüren und Glasfenstern vor den oberen Fächern. Um den Esstisch herum stand ein Kreis von zwölf Armsesseln. Neben der Manilagruppe im Wintergarten fanden hier noch drei weitere Sitzgruppen Platz. Nur eine schien häufiger benutzt worden zu sein. Die Polster der Möbel vor dem Fernseher waren sichtlich abgenutzt. Die Gemälde an den Wänden schienen alle echt zu sein, und alle zeigten nationalromantische oder maritime Motive. Vor allem ein unmittelbar bevorstehender Schiffbruch an der Wand zur Küche fiel Hanne auf. Sie trat näher.
»Peder Balke«, sagte sie halblaut. »Meine Güte.«
Die Eiswürfel im Sektkühler waren schon längst geschmolzen. Hanne studierte das Etikett, ohne die Flasche zu berühren.
»Das ist doch was für dich«, sagte Billy T. »Sauteuer.«
»Wissen wir eigentlich irgendetwas Wichtiges?«, fragte Hanne, ohne ihren Blick von der Flasche zu lösen. »Zum Beispiel, was sie feiern wollten?«
»Vielleicht wollten sie einfach nur gemütlich zusammen sein«, sagte Silje Sørensen. »Es ist doch bald …«
»Bis Weihnachten sind es noch fünf Tage«, fiel Hanne ihr ins Wort. »Das hier ist ein ganz normaler Donnerstag. Diese Flasche da kostet im Laden achthundertfünfzig Kronen. Das ist zu viel bloß für einen netten Abend. Die wollten etwas feiern. Und zwar irgendwas Großes.«
»Wir wissen doch nicht …«
»Schau mal her, Silje.«
Hanne zeigte auf den Fernseher. Der Schirm war zur Hälfte von Holzlamellen verdeckt, der ganze Apparat war ein schweres Möbelstück aus Mahagoni oder Teak.
»Der Fernseher ist mindestens dreißig Jahre alt. Das Sofa ist so abgenutzt, dass du die Kettfäden sehen kannst. Die Bilder … das da jedenfalls …«
Sie zeigte auf den Peder Balke.
»Das ist ziemlich wertvoll. Im Kühlschrank gibt es nur drei Sorten Brotbelag: Käse, Leberwurst und Marmelade. In der Vitrine da hinten stehen dagegen Gläser, die ein Vermögen wert sind. Diese Wohnung hier muss ihre sieben, acht Millionen wert sein. Mindestens. Sein Pullover …«
Sie drehte sich um und schaute kurz zur Diele hinüber, wo Hermann Stahlberg gerade auf eine Bahre gelegt wurde.
»… stammt von irgendwann aus den Siebzigerjahren. Sauber, ordentlich und doch an den Ellbogen gestopft. Was sagt dir das alles?«
»Geizkragen«, sagte Billy T., ehe Silje Zeit zum Nachdenken finden konnte. »Knauserig. Aber reich. Komm, wir gehen.«
Hanne blieb stehen.
»Weiß wirklich niemand, wer der Mann in der Diele ist?«
»Den haben sie jetzt weggetragen«, murmelte Silje.
»Dem Teufel sei Dank dafür«, rief Billy T. »Aber wissen wir etwas über ihn?!«
»Nix.«
Silje Sørensen blätterte ziellos in ihren Notizen.
»Keine Brieftasche. Kein Ausweis. Aber schön angezogen. Anzug. Feiner Mantel.«
»An dem Typen ist nichts schön«, sagte Billy T. mit einem Schaudern. »Dieser Köter hat …«
»Mantel«, fiel Hanne Wilhelmsen ihm ins Wort. »Er trug einen Mantel. War er gerade gekommen, oder wollte er gerade gehen?«
»Gekommen«, schlug Silje vor. »Sie hatten den Champagner doch noch nicht angerührt. Und bei all den Männern im Flur …«
»In der Diele«, korrigierte Billy T. »Groß genug für drei Leichen, pfui Spinne.«
»In der Diele, von mir aus. Sieht aus wie ein Willkommenskomitee. Ich wette, dass der Fremde eben erst gekommen war.«
Hanne ließ ein letztes Mal ihren Blick durch das Zimmer schweifen. Sie beschloss, sich den Rest der Wohnung später anzusehen. Hier waren einfach zu viele Leute. Auf kurzen Trittleitern balancierten Fotografen. Techniker von der Spurensicherung bewegten sich mit ihren Stahlkoffern leise durch die Räume, mit Plastikhandschuhen und voller Zielbewusstsein. Der Arzt, grau, verhärmt und sichtlich verstimmt, wollte die Wohnung gerade verlassen. Die Stille, mit der die Techniker sich umgaben, wurde nur durch kurze, einsilbige Befehle unterbrochen. Etwas von Effektivität lag darin, von guter Kooperation, aber auch ein schlecht verborgenes Missvergnügen darüber, dass die Ermittler sich überhaupt hergewagt hatten. Später, dachte Hanne, den Rest sehe ich mir später an. Auf diesen Gedanken folgte unmittelbar eine widerwillige Erleichterung darüber, dass auch dieses Jahr nichts aus ihrem Weihnachtsurlaub werden würde. Sie ertappte sich bei einem Lächeln.
»Was ist los?«, fragte Billy T.
»Gar nichts. Gehen wir.«
In der Diele begegnete Hanne ihrem eigenen Spiegelbild. Für einen Moment blieb sie stehen. Billy T. hatte recht. Sie hatte zugenommen. Ihr Kinn war runder geworden, ihr Gesicht eine Spur breiter, ein fremder Zug über der Nasenwurzel ließ sie den Blick abwenden. Bestimmt war an allem der vor Alter schwarz gesprenkelte Spiegel schuld.
Die Leiche einer übel zugerichteten und bisher nicht identifizierten männlichen Person von Mitte fünfzig war inzwischen entfernt worden. Das Markierungsband hob sich leuchtend vom Parkett ab.
»Verdammt, der hat nicht mal eine Blutspur hinterlassen«, sagte Billy T. und ging in die Hocke. »Der Köter hat sich ja köstlich amüsiert.«
»Hör jetzt auf«, sagte Hanne. »Mir ist schlecht.«
»Ich hab Hunger«, sagte Billy T. und folgte ihr aus der Wohnung.
Beiden fiel das Türschild auf, als sie die Tür hinter sich zuzogen. Gediegen, fast beängstigend, aus altersmattem Messing mit schwarzen Buchstaben.
Hermann Stahlberg.
Kein Wort von Tutta. Oder Turid. Und von den Kindern, obwohl das Schild offenbar schon lange dort befestigt gewesen war, ehe sie das Elternhaus verlassen hatten.
»Hier hat Hermann Stahlberg gewohnt«, sagte Billy T. »Der König auf dem Hügel.«
Sie saßen vor Hannes Wohnung in der Kruses gate auf der Treppe. Sie hatte zum Sitzen Zeitungen aus dem Papiercontainer geholt.
»Picknick mitten im bittersten Winter«, sagte Billy T. mit vollem Mund. »Können wir nicht doch hochgehen? Verdammt, ich erfrier hier noch.«
Hanne versuchte, einer einzelnen Schneeflocke mit Blicken zu folgen. Es war jetzt noch kälter geworden. Die Kristalle wirbelten. Sie fing eines in der Handfläche auf. Das fünfeckige symmetrische Gebilde funkelte auf und war dann verschwunden.
»Lass uns die anderen nicht wecken.«
»Was glaubst du?«, fragte er und nahm sich noch ein Brot.
»Dass sie aufwachen, wenn wir hochgehen.«
»Dumme Nuss. Über den Fall, meine ich. Da war nichts gestohlen.«
»Das wissen wir noch nicht.«
»So sah es aber aus«, sagte er ungeduldig. »Das Silber war noch da. Die Bilder … du hast selbst gesagt, dass sie teuer sind. Für mich sieht es aus, als ob nichts verschwunden wäre. Also kein Raubmord.«
»Das wissen wir nicht, Billy T. Don’t jump …«
»… to conclusions«, beendete er den Satz resigniert und erhob sich.
»Danke für das Essen«, sagte er und wischte sich Schnee ab. »Geht’s gut mit Marry?«
»Wie du siehst«, sagte Hanne und nickte zu den Essensresten hinüber. »Methadon, Isolation und Hausarbeit wirken Wunder. Und Nefis und sie sind zusammen so.«
Sie kreuzte in der Luft zwei Finger, und Billy T. lachte laut.
»Aber es ist trotzdem manchmal ein bisschen hart«, sagte Hanne. »Für mich. Es stehen im Alltag zwei gegen eine.«
»Pah. Das findest du doch toll. Hab dich seit Jahren nicht mehr so glücklich gesehen. Nicht seit … den alten Zeiten, sozusagen. Fast kommt mir alles so vor wie früher.«
Sie räumten schweigend auf. Es war jetzt kurz nach zwei. Wind war aufgekommen, ein messerscharfer, abrupt einsetzender Wind. Ihre Spuren auf dem Hof waren verweht. Aus den Wohnungen fiel kein Licht mehr. Nur die Straßenlaternen vor der Gartenmauer machten den Schnee sichtbar, der jetzt überall lag. Hanne schaute aus zusammengekniffenen Augen ins Nichts.
»Nichts ist wie früher«, sagte sie leise. »Sag das nie wieder. Jetzt ist jetzt. Alles ist anders. Cecilie ist tot. Nefis ist gekommen. Du und ich sind … wir sind älter. Nichts ist wie früher. Das wäre unmöglich.«
Er war schon losgegangen, unsicher im Schneegestöber, die Hände tief in den Taschen. Sie schaute ihm hinterher.
»Geh nicht«, rief sie hinter ihm her. »Ich meinte doch nur …«
Billy T. wollte nichts hören. Als er das Tor erreicht hatte, schaute er sich rasch um. Seine Miene machte ihr Angst. Zuerst begriff sie nicht. Dann wollte sie nicht begreifen. Sie wollte nicht hören, was er murmelte, bestimmt hatte sie sich verhört. Er war schon zu weit weg. Der Schnee machte die Konturen unscharf und die Geräusche vage.
Sie griff nach ihrer Tasche, zog mit Mühe die Schlüssel heraus und schloss die Tür auf.
»Verdammt«, sagte sie mit zusammengebissenen Zähnen. Sie ließ den Fahrstuhl stehen und ging langsam die Treppen hoch.
Freitag, 20. Dezember
Die Stille weckte sie in aller Frühe. Morgens hatte sie schon immer einen leichten Schlaf gehabt, und ohne den vertrauten, freundlichen Lärm der Oststadt und die Lkws in Tøyen brauchte sie keinen Wecker mehr. Nicht einmal sicherheitshalber. Obwohl sie erst vor zwei Stunden eingeschlafen war, wusste sie, dass es keinen Zweck hätte, sich noch einmal umzudrehen. Ein offenes Fenster wäre ihr natürlich eine Hilfe gewesen. Mit etwas mehr Geräuschen hätte Hanne noch eine Stunde oder sogar zwei schlafen können. Schweißnass schlug sie die Decke beiseite und stand auf. Nefis murmelte im Schlaf, unter ihrer dünnen Decke ragten Teile ihres Körpers hervor. Neben dem dunkelblauen orientalischen Muster sah ihre Haut bleicher aus, als sie war. Sie sah kindlich aus, wie sie so dalag, mit aufgerissenem Mund und über dem Kopf verschränkten Armen. Ein dünner Speichelfaden hatte einen Fleck auf dem Kissen hinterlassen. Im Zimmer waren es über zwanzig Grad. Hanne hatte schrecklichen Durst.
Die Zeitung war bereits gekommen. Es duftete nach frisch aufgebrühtem Kaffee, als sie in die Küche kam und leise die Tür hinter sich schloss. Wie immer hatte Marry die Kaffeemaschine auf halb sechs programmiert. In der Küche wimmelte es nur so von absurden Hilfsmitteln, von Uhren und Regulatoren für alle denkbaren und undenkbaren Zwecke. Nefis wollte sie haben, Nefis konnte sie sich leisten. Nefis hatte Geld für alles Mögliche. Nefis hatte im Alter von achtunddreißig Jahren ihr erstes wirkliches Zuhause gegründet und füllte es nun entzückt mit überflüssigen Dingen, die Marry begeistert und überraschend geschickt in Gebrauch nahm, obwohl sie kaum imstande war, sich durch eine Gebrauchsanweisung hindurchzuquälen.
Hanne füllte einen Becher mit Kaffee und gab Milch dazu. Dann trank sie einen halben Liter Saft aus dem Karton und merkte, dass sie keinen Hunger hatte. Morgens sehnte sie sich immer schrecklich nach einer Zigarette. Das überraschte sie. Als sie ein gutes Jahr zuvor endlich mit Rauchen aufgehört hatte, hatte sie sich vor allem vor den Abenden gefürchtet. Vor dem Alkohol. Vor dem Zusammensein mit anderen. Vielleicht auch vor dem Stress bei der Arbeit. Aber dann hatten die Morgen sich als das wirkliche Problem erwiesen. Sie lugte zum Schrank über dem Herd hinüber, wo Marry ihren Drehtabak deponierte, den Nefis einmal im Monat kaufte und den Marry, die sich sogar mit Nefis’ Befehl abfand, nur in ihrem eigenen kleinen Bereich der Wohnung zu rauchen, in Plastikdosen versiegelte.
Die Zeitung brachte gewaltige Schlagzeilen. Fast die ganze erste Seite war den Morden in der Eckersbergs gate gewidmet. Das Foto lief über sechs Spalten; die Fassade des Wohnhauses diente im Layout als Hintergrund für drei Privatfotos von Mutter, Vater und ältestem Sohn Stahlberg. Hermann Stahlberg war offenbar an Bord eines Bootes aufgenommen worden; er stand in einem feschen Blazer mit Goldknöpfen und dem Emblem der Reederei an der Reling. Er lächelte ein wenig, schob das Kinn vor und sah an der Kamera vorbei. Seine Frau lächelte etwas strahlender auf einem im Haus aufgenommenen Bild. Sie zerschnitt eine Sahnetorte mit mehr Kerzen, als Hanne zählen mochte, das Blitzlicht spiegelte sich in ihren Brillengläsern und gab der Frau etwas leicht Hysterisches. Prebens Bild war unscharf. Er wirkte viel jünger als seine über vierzig Jahre. Er hatte halblange Haare, und sein Hemd stand offen. Das Bild musste schon etliche Jahre alt sein.
Woher nehmen die das?, dachte Hanne und ertränkte ihre Tabaksucht im Kaffee. Zwei, drei Stunden nach dem Mord, und schon schütteln sie private Bilder aus dem Ärmel. Wie machen sie das? Welche Fragen stellen sie, wenn sie sich an Bekannte und Verwandte wenden, noch ehe am Tatort das Blut geronnen ist? Und wer rückt solche Bilder heraus?
»Meine Hanna«, sagte Nefis mit sanfter Stimme.
Hanne fuhr zusammen und drehte sich um. Eine splitternackte Nefis breitete die Arme aus.
»Du bist immer so schreckhaft. Was soll ich denn dagegen tun, dass ich dich immer erschrecke? Mir eine Klingel um den Hals binden?«
»Glocke«, sagte Hanne. »Um den Hals trägt man Glocken. Kühe und Schafe und so. Du brauchst eine Glocke. Guten Morgen.«
Sie tauschten einen leichten Kuss. Nefis roch nach Nacht und bekam eine Gänsehaut, als Hanne ihren Rücken streichelte.
»Lauf nicht so hier rum. Marry kann doch hereinkommen.«
»Marry verlässt ihre Gemächer nie vor acht Uhr«, sagte Nefis, nahm aber dennoch einen riesigen Wollpullover von einer Stuhllehne und zog ihn über den Kopf. »So. Bin ich jetzt … anständig genug?«
Nefis hatte sich mit derselben Begeisterung wie für fast alles Norwegische auf die neue Sprache gestürzt. Obwohl sie noch immer kein Schweinefleisch essen wollte und auf einem unerträglich warmen Schlafzimmer bestand, strickte sie jetzt voller Hingabe, war eine durchaus passable Skiläuferin geworden und zeigte ein unbegreifliches Interesse an der Osloer Straßenbahn. Sie schrieb wütende Leserinnenbriefe, um gegen die dauernden Einsparungen im öffentlichen Nahverkehr zu protestieren. Wenn Hanne ein seltenes Mal an ihre erste Begegnung zurückdachte, 1999 auf einer Piazza in Verona, dann hatte sie dabei eine ganz andere Frau vor Augen, es war eine fast unwirkliche Erinnerung. Die Nefis von damals war für Hanne ein einziges großes Geheimnis gewesen. Bei ihrer Begegnung mit Norwegen schien sie es eilig zu haben, als wolle sie etwas aufholen, das sie nicht ganz durchschauen konnte, das ihr aber immer verwehrt geblieben war, solange sie ihrer beeindruckenden akademischen Karriere zum Trotz vor allem die geliebte Tochter einer schwerreichen türkischen Familie gewesen war.
Nefis konnte Wörter wie Paradigmenwechsel benutzen. Aber den Namen ihrer Lebensgefährtin lernte sie einfach nicht.
»Hanna«, sagte sie entzückt und wirbelte in dem knielangen Pullover herum. »Das kratzt. Komm, wir gehen wieder ins Bett.«
Hanne schüttelte den Kopf. Sie leerte die Tasse und goss nach.
»Ist das dein Fall?«
Nefis nickte zur Zeitung hinüber.
»Ja.«
»Wir haben heute Nacht die Nachrichten gehört. Marry und ich. Grau-en-haft.«
Sie dehnte dieses Wort so lang, dass Hanne lächeln musste. »Geh wieder schlafen. Ich dusch nur schnell, und dann fahr ich ins Büro.«
Aber Nefis zog einen Stuhl an den Tisch und setzte sich. »Erzähl«, sagte sie. »Ist das eine berühmte Familie? Das klang so in den Nachrichten.«
»Berühmt …«
Hanne zögerte.
»Das nicht gerade. Aber wer rosa Zeitungen liest, kennt den Namen schon.«
»Rosa Zeitungen«, wiederholte Nefis unsicher, dann fiel es ihr ein. »Wirtschaftszeitungen!«
»Ja. Ich weiß das alles noch nicht so genau. Aber die Familie … also, der Vater, glaube ich«, sie zeigte auf Hermann Stahlberg, »besaß eine mittelgroße Reederei. Nicht wirklich groß, aber ziemlich lukrativ. Er war clever genug, um immer rechtzeitig vor den Konjunkturschwankungen in andere Tonnageklassen zu wechseln. Aber besonders prominent war er wohl nie. Nicht außerhalb der Branche. Ich hatte weder von ihm noch von der Reederei je gehört. Als der Streit losging. In der Familie, meine ich. Das muss so …«
Sie überlegte.
»Zwei Jahre her sein? Eins? Schwer zu sagen. Ich weiß die Details nicht. Absolut nicht. Ich gehe davon aus, dass ich im Laufe des Tages sehr viel mehr erfahren werde. Aber wenn ich mich nicht sehr irre, dann geht es darum, dass der eine Sohn dem anderen vorgezogen wurde.«
»Die alte Geschichte also.«
»Ach, hier sitzt ihr?«
Marry schlurfte zur Kaffeemaschine. Ihr gesteppter rosa Morgenrock löste sich an der Brust auf und wurde um ihre Taille mit einer altmodischen seidenen Gardinenschnur zusammengehalten. Die Puschel schlugen bei jedem ihrer hinkenden Schritte gegen ihre Oberschenkel. Sie sah aus wie ein lustiger Luftballon.
»Hallo, Marry«, sagte Nefis lachend. »Du bist aber früh dran.«
»Weißt du überhaupt, was ich vor Heiligabend noch alles erledigen muss?«
Wütend zählte sie an ihren mageren Fingern ab.
»Erstens: Es fehlen noch immer zwei Sorten. Zimtsterne und Kokosmakronen. Zweitens: Der Christbaumschmuck vom letzten Jahr muss gesäubert und vielleicht repariert werden. Zu Silvester ist es ja hoch hergegangen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Außerdem muss ich noch allerhand neuen Kram testen. Drittens: Ich muss …«
»Ich gehe jetzt jedenfalls«, sagte Hanne und erhob sich.
»Das hab ich mir gedacht, ja. Und wann kommst du zurück, wenn ich die Dame fragen darf?«
»Ich rufe an«, sagte Hanne kurz und steuerte das Wohnzimmer an.
»Du, Hanne«, sagte Marry und packte ihren Arm. »Soll das heißen …«
Sie wies mit einem gekrümmten Zeigefinger auf die Zeitung.
»Bedeutet das, dass wir von deinem Weihnachtsurlaub nur noch träumen können?«
Hanne lächelte kleinlaut und schwieg.
»Also wirklich, Hanna.«
Nefis sprang auf und stand nun neben Marry, mit ihr eine Art Mauer bildend. Diese anklagende Haltung, in der sich die beiden immer einig waren, kannte sie nur allzu gut.
»Ich rufe an«, sagte Hanne mürrisch und ging.
Als sie zwanzig Minuten darauf im Auto saß, spürte sie noch immer den matten Schlafgeschmack aus Nefis’ Mund auf der Zunge.
Sie hätte sich am liebsten krankgemeldet. Vielleicht sollte sie das einfach tun. Nichts leichter als das. Sie würde diesen Tag abwarten und sich dann nachher entscheiden. Nachmittags, vielleicht.
Oder nach dem Wochenende.
In einer Wohnung im Blindernvei saß eine ältere Frau und weinte. Neben ihr auf einem harten Sofa saß eine Pastorin und versuchte, sie zu trösten.
»Ihr Sohn wird bald hier sein«, sagte die Pastorin, eine Frau, die noch keine dreißig war. »Sein Flugzeug ist jetzt schon gelandet.«
Viel mehr gab es nicht zu sagen.
»Aber, aber«, sagte sie hilflos und streichelte die Hand der Frau.
»Auf jeden Fall ist er glücklich gestorben«, sagte die Witwe plötzlich.
Die Pastorin setzte sich erleichtert auf.
»Er starb in meinen Armen«, sagte die ältere Frau, und ihr verweintes Gesicht zeigte ein Lächeln.
Die Pastorin starrte in das verweinte Gesicht, ein wenig schockiert, mehr noch verlegen, und fragte:
»Wie wäre es mit einer Tasse Kaffee? Jetzt wird Ihr Sohn bald hier sein.«
»Darüber kann ich doch nicht mit ihm reden. Das wäre einfach nur peinlich. Für uns beide. Dass sein Vater und ich noch immer Freude an den körperlichen Seiten einer Beziehung hatten, geht meinen Sohn nun wirklich nichts an. Um Himmels willen! Welchen Tag haben wir heute?«
Die Pastorin dachte kurz nach, wagte diesmal aber nicht, ihre Erleichterung zu zeigen.
»Den 20. Ja, der 20. Dezember. Bald ist Heiliger Abend.« Sie hätte sich die Zunge abbeißen können. Die Witwe brach wieder in Tränen aus.
»Das erste Weihnachtsfest ohne Karl-Oskar. Das erste, nach so vielen …«
Der Rest ging in ihrem heftigen Schluchzen unter. Wenn sie nur weinen könnte, dachte die Pastorin. Wenn sie nur weinen könnte. Und wenn ihr Sohn doch nur bald hier wäre!
»Wir feiern sonst immer in Duvamåla«, sagte endlich die Witwe. »Ja, das ist unser Ferienhaus, wissen Sie. Ich heiße Kristina und mein Mann Karl-Oskar, und da fanden wir das sehr witzig. Duvamåla.«
Die Pastorin verstand gar nichts, griff dieses Thema aber begeistert auf.
»Unser Ferienhaus heißt Friedlich«, stammelte sie.
»Warum das?«, fragte die alte Frau.
»Na ja …«
»Immerhin ist er glücklich gestorben«, sagte die Witwe noch einmal mit bedrohlichem Unterton.
Sie duftete nach einem leichten, sommerlichen Parfüm und wirkte bemerkenswert gefasst dafür, dass sie vor zwölf Stunden ihren Mann verloren hatte. Die Pastorin nahm ihren eigenen Stressschweiß wahr und presste die Arme an den Leib, um die Schweißringe zu verbergen.
»Ist es hier zu warm?«, fragte Kristina Wetterland. »Sie könnten vielleicht die Balkontür öffnen. Wann landet mein Sohn?«
»Er ist schon längst gelandet«, sagte die Pastorin, die jetzt ziemlich verzweifelt war. »Wie ich vorhin schon gesagt habe, sollte seine Maschine um …«
»Sie sind doch wirklich Pastorin, ja?«
Die Stimme klang jetzt ein wenig schärfer. Aber konzentriert.
»Ja, Vikarin.«
»Sie sind jung. Sie haben noch viel zu lernen.«
»Ja«, piepste die Pastorin.
Kristina Wetterland, die Witwe von Karl-Oskar Wetterland, Anwalt beim Obersten Gericht, putzte sich mit einem sauberen, gebügelten Taschentuch energisch die Nase. Danach faltete sie es sorgfältig zusammen, schob es in den Ärmel ihrer Golfjacke und holte tief Atem.
Jetzt hörten sie das Klirren von Schlüsseln. Jemand betrat die Wohnung. Gleich darauf erschien ein Mann mittleren Alters in der Wohnungstür. Er war hochgewachsen, gut angezogen und zutiefst erregt.
»Mama«, rief er. »Meine Mama. Wie geht es dir jetzt?«
Er lief auf sie zu, fiel vor seinerMutter auf die Knie und umarmte sie.
»Wann ist das passiert? Und wie … ich habe es heute früh erfahren. Warum hast du nicht angerufen?«
»Herzchen«, sagte die Frau und streichelte den Kopf des Mannes, der doppelt so groß war wie sie. »Dein Vater ist gestern schon gestorben. Gegen sieben. Er ist im Schlaf gestorben, mein Schatz. Wollte nur ein Nickerchen machen. Er hatte um acht noch einen Termin. Wir wollten uns nur ein wenig ausruhen, wie wir das oft gemacht haben, weißt du. Nach dem Essen. Ich glaube nicht, dass er leiden musste. Und damit müssen wir uns wohl trösten, Lieber. Damit müssen wir uns trösten.«
Plötzlich fiel ihr Blick auf die Pastorin.
»Jetzt können Sie gehen, Frau Pastorin. Danke für Ihren Besuch.«
Die junge Frau schlich davon und zog leise die Wohnungstür hinter sich zu. Sie hatte den Sohn nicht einmal begrüßt. Sie unterdrückte das Weinen, bis sie die Straße erreicht hatte.
Dichter Schnee fiel, und in vier Tagen war Jesu Geburtstag.
»Das ist doch einfach unfassbar«, sagte Hanne Wilhelmsen gereizt und schaute auf die Armbanduhr. »Der Mann sieht norwegisch, gepflegt und wohlhabend aus. Hier ist nicht die Rede von irgendeinem verirrten Ausländer oder einem armen, obdachlosen Penner. Wieso ist es so verdammt schwierig, in Norwegen einen Norweger zu identifizieren?«
Billy T. zuckte resigniert mit den Schultern und fuhr sich mit der Hand über den Schädel.
»Wir arbeiten ja daran. Wir haben hier ganz schön viel zu tun, Hanne.«
»Ja, das kannst du wohl sagen. Aber offenbar hat die ganze Truppe vergessen, dass es nun mal vier Tote waren. Da sollte man doch meinen, es sei das Wichtigste, festzustellen, wer dieser vierte Tote ist.«
Staatsanwalt Håkon Sand schnitt eine Grimasse, ehe er die Brille abnahm und mit seinem Hemdzipfel polierte. Er saß zurückgelehnt in einem überdimensionalen Schreibtischsessel hinter einem mit Papieren übersäten Schreibtisch. Ein Telefon klingelte. Er wühlte verwirrt zwischen den Mappen. Das Telefon verstummte, ehe er den Apparat gefunden hatte.
»Wir kommen schon noch dazu«, sagte er müde. »Reg dich ab, Hanne. Wie viele arbeiten jetzt eigentlich an dem Fall?«
»Bisher insgesamt vierzehn«, antwortete Billy T. »Aber heute im Laufe des Tages werden noch welche dazukommen. Der Abteilungschef streicht wie besessen Urlaub und verbietet es, Überstunden abzubummeln. Mit anderen Worten, im Haus herrscht Bombenstimmung.«
»Na gut«, sagte Håkon Sand und starrte aus zusammengekniffenen Augen durch seine Brille, die noch nicht viel sauberer geworden war. »Und wann werdet ihr unseren vierten Mann identifiziert haben, was glaubt ihr?«
»Ziemlich bald«, sagte Silje Sørensen in der Absicht, die gereizte Stimmung ein wenig zu entschärfen. »Irgendwer muss ihn doch vermissen.«
Hanne Wilhelmsen ließ den Blick auf ihrem Spiegelbild im Fenster ruhen. Draußen war es noch dämmerig, obwohl es schon ziemlich spät war. Das Licht drang einfach nicht richtig durch. Ein schwerer Kältedeckel drückte auf die Stadt. Auspuffgase durchzogen die Straßen, allerlei Dreck lag grau am Straßenrand, und sogar die Schneeflocken, die hinter der Glasscheibe mit Hannes Spiegelbild tanzten, wirkten schmutzig.
»Streng genommen ist wohl dieser Unbekannte nicht gerade das Wichtigste für unsere Ermittlungen«, sagte Billy T. »Hier sind ein paar Informationen über die Familie. Und dabei handelt es sich nur um Zeitungsausschnitte. Außerdem sammeln wir gerade alle Korrespondenz und alle anderen Informationen, die wir auftreiben können. Die Anwälte beider Seiten haben sich natürlich auf die Hinterbeine gesetzt. Der alte Spruch von der Schweigepflicht. Aber am Ende werden wir gewinnen. Und das hier sind jedenfalls öffentlich zugängliche Auskünfte.«
Er warf einen inhaltsreichen Ordner auf Håkon Sands Schreibtisch. Håkon rührte ihn nicht an, sondern gähnte laut.
»Wir wissen alle, dass es in dieser Familie Streit gegeben hat«, sagte er endlich, noch immer, ohne den roten Ordner anzurühren. »Das kommt in den besten Familien vor. Aber deshalb begeht man doch noch keinen Mord.«
Alles schwieg. Silje Sørensen machte sich an ihrem Ring zu schaffen und starrte verlegen zu Boden. Billy T. grinste. Hanne Wilhelmsen starrte Håkon Sand an. Håkon spuckte Tabak in einen Papierkorb. Dann setzte er sich gerade, zog den Sessel an den Tisch heran und seufzte laut.
»Ich spreche nachher mit Kriminalchef Puntvold«, sagte er und fuhr sich mit den Fingern durch die Haare. »Dieser Fall ist so ungeheuer… die Medien haben uns ja schon oft gequält, aber ich glaube, so schlimm war es noch nie. Sie sind jetzt überall. Der Chef meint, wir brauchten ein koordiniertes Vorgehen, das auch die Staatsanwaltschaft und den Polizeibezirk Oslo einbezieht. Schon von Anfang an, meine ich.«
»Und wenn ich mich nicht total irre, wird Jens Puntvold die Kiste wohl schmeißen.«
Hanne lächelte säuerlich. Nach einer Karriere, die bei der Polizei von Bergen begonnen und ihn dann über das Justizministerium ins im Januar 2001 eingerichtete Polizeidirektorat geführt hatte, hatte der stellvertretende Polizeichef und Kriminalchef Jens Puntvold sieben Monate zuvor sein Amt als zweithöchster Polizeibeamter Oslos angetreten. Er war Mitte vierzig, überaus selbstsicher, blond und kinderlos. Zu allem Überfluss lebte er mit der elegantesten Meteorologin des Senders TV2 zusammen und trat mit oder ohne Freundin bereitwillig zu jeder Art von Interview an.
Wieder seufzte Håkon, fast demonstrativ. Hanne wusste nicht so recht, ob dieser Seufzer ihr oder Puntvold galt.
»Er spricht immer lobend über die Truppe«, sagte er in tadelndem Tonfall. »Immer, Hanne. Er ist vielleicht zu oft in den Medien zu sehen, na gut, aber die Polizei wurde bisher mit positiver Berichterstattung nicht gerade verwöhnt. Puntvold allein hat es geschafft …«
»Er ist tüchtig«, fiel Hanne ihm ins Wort. »Mich stören nur diese ewigen Aktionen, die er in Gang setzt. Viele sind doch einfach das pure Werben ums Publikum.«
»Das Publikum bestimmt schließlich darüber, welche Mittel uns zur Verfügung stehen«, sagte Håkon. »Aber hören wir auf damit. Ich möchte nur mit euch dreien reden, ehe ich mich mit ihm treffe. Auf jeden Fall wird Annmari Skar als verantwortliche Juristin den Fall begleiten. Ich werde wohl enger mit ihr zusammenarbeiten als sonst, und es wäre mir auch lieb, wenn ihr anruft, sobald sich etwas ergibt. Dieser Fall … o verdammt.«
Er schüttelte den Kopf und schob einen neuen Priem ein.
»Ich würde gern mal einen Blick in den Ordner werfen«, sagte Silje Sørensen, während Håkon an seiner Oberlippe herumfummelte; der Tabak war trocken und haftete nicht richtig. »Einiges habe ich ja mitgekriegt, hier und da so ein bisschen, aber ich …«
»Ich fasse das gerade mal zusammen«, sagte Billy T. »Da geht es um eine mittelgroße Reederei, Norne Norway Shipping. Hermann Stahlberg ist der Gründer. Hat von 1961 bis heute die ganze Sache aufgebaut. Tüchtiger Mann. Steinhart. Zyniker, falls man den Zeitungskommentaren glauben darf.«
Sein blutig gebissener Finger tippte auf den roten Ordner.
»Der Mann hat drei Kinder. Der Älteste, Preben, ist 1981 zur See gegangen. Hatte sich mit dem Vater gestritten und wollte nicht auf Papas Schiffen anheuern. Einige Jahre darauf geht er dann in Singapur an Land. Macht seinen eigenen Laden auf. Als Schiffsmakler. Das Ganze läuft hervorragend. Hier zu Hause ist er total abgeschrieben. Ein jüngerer Sohn, Carl-Christian, tritt nach und nach an den für den Bruder reservierten Platz in der Reederei. Er ist offenbar umgänglicher als der andere. Aber nicht so vielversprechend.«
»Nicht so stark«, warf Hanne dazwischen. »Eher bereit, sich dem Vater unterzuordnen, mit anderen Worten.«
»Kann schon sein«, sagte Billy T. ungeduldig. »Aber jedenfalls passiert dann Folgendes: Carl-Christian schuftet und schuftet für Hermann. Er macht seine Sache auch gut, zeichnet sich aber nie besonders dabei aus. Der Vater wird langsam ungeduldig. Er weigert sich, dem Sohn die Reederei zu überschreiben, solange er nicht von dessen Fähigkeiten überzeugt ist.«
»Aber Preben«, fragte Håkon. »Wann ist der nach Hause gekommen?«
»Vor zwei Jahren.«
Billy T. packte den Ordner mit den Zeitungsausschnitten und fing an zu blättern.
»Da hatte er den Laden in Asien verkauft und kam mit reichlich Kohle in der Tasche nach Hause. Der Alte war natürlich noch immer stocksauer und abweisend, bis der verlorene Sohn dann plötzlich eine ziemliche Summe ins Familienunternehmen reinpustete und sich geradezu als Reinkarnation des Vaters entpuppte. Er kriegt eine Chance in der Reederei, und nach zwei oder drei geglückten Transaktionen sonnt er sich wieder in der Gunst des alten Herrn. Der kleine Bruder wird mehr und mehr zur Seite geschoben.«
»Und dann geht der Spaß los«, seufzte Silje.
»Genau. Es hagelt Anklagen. Derzeit laufen zwei Prozesse, weitere könnten bevorstehen.«
»Aber die bleiben uns jetzt ja erspart«, sagte Hanne trocken und gähnte.
»Aber wer ist Nr. 3?«, fragte Silje.
»Nr. 3?«
»Du hast gesagt, dass Hermann und Tutta Stahlberg drei Kinder hatten. Welche Rolle spielt das dritte in der ganzen Geschichte?«
»Ach, die … das ist ein Mädchen. Nachkömmling. Eine strahlende Schönheit, soweit ich weiß. Sie ist die Rose der Familie, wird von allen geliebt. Und von niemandem respektiert. Scheint sich wohl als Vermittlerin versucht zu haben, das aber vergeblich. Nach allem, was ich heute Nacht herausgefunden habe, scheint sie ihre Zeit vor allem damit zu verbringen, ein gewaltiges Vermögen aus dem Fenster zu schmeißen, das ihr Alter ihr zum zwanzigsten Geburtstag geschenkt hat. Hier steht ein bisschen was über sie.«
Wieder war irgendwo in dem Chaos auf dem Schreibtisch ein Klingeln zu hören.
»Sand«, sagte Håkon knapp, als er den Hörer endlich gefunden hatte.
Dann lauschte er drei Minuten lang wortlos. Seine Stirn runzelte sich unter der dicken Brillenfassung. Er fischte einen Kugelschreiber hervor und kritzelte etwas auf seinen Handrücken. Hanne kam es vor wie ein Name.
»Knut Sidensvans«, sagte er langsam, als das Gespräch beendet war. »Das vierte Opfer. Er heißt Knut Sidensvans.«
»Komischer Name«, sagte Billy T. »Und wer ist er?«
»Bisher wissen sie noch nicht viel. Er ist dreiundsechzig und arbeitete als eine Art Verlagslektor. Und Schriftsteller. Ist eigentlich Elektriker.«
Håkon schüttelte verwirrt den Kopf und sagte dann:
»Dass er nicht als vermisst gemeldet worden ist, ist vielleicht kein Wunder. Er lebt allein. Keine Kinder. Stilles, ruhiges Leben, also hätten Tage vergehen können, ehe jemand sich fragt, wo er wohl stecken mag. Aber er hätte heute Morgen beim Verlag etwas abliefern sollen, etwas Wichtiges, und deshalb haben sie einen Boten geschickt, als er nicht verabredungsgemäß auftauchte. Und da er nicht aufmachte, dachte der Bote, der Mann sei vielleicht krank, und danach dauerte es nur noch zwei Stunden, bis die Sache aufgeklärt war. Knut Sidensvans ist also das vierte Mordopfer in der Eckersbergs gate.«
»Aufgeklärt«, sagte Billy T. »Von aufgeklärt kann hier ja wohl kaum die Rede sein …«
»Nein. Aber es ist doch ein klarer Fortschritt zu wissen, wer die Opfer überhaupt sind. Findest du nicht?«
Hanne sprang auf.
»Drei Reiche aus dem besten Westend und ein Elektriker, der in einem Verlag arbeitet. Ich freu mich schon darauf zu erfahren, was diese Menschen verbunden hat. Ich fahre jetzt zurück auf die Wache. Falls das alles war, Håkon?«
»Ja. Halt mich auf dem Laufenden. Und du … ich freue mich auf den Heiligen Abend. Toll von euch, uns alle einzuladen. Die Kinder freuen sich wie besessen.«
»Tja, dumm gelaufen«, grinste Billy T. »Das sollte doch eine Surprise-Party für Hanne werden. Du hättest nichts verraten dürfen!«
Håkon Sand ließ seinen verwirrten Blick von Hanne zu Billy T. wandern.
»Aber ich … Karen hat nichts gesagt … tut mir leid. Tut mir wirklich leid.«
»Ist schon gut«, sagte Hanne, ohne eine Miene zu verziehen. »Ich wusste das doch längst. Ist schon gut. Natürlich wusste ich das.«
Sie fuhr herum und verließ das Büro des Staatsanwalts. Ehe Billy T. Unterlagen, Schlüssel und Mobiltelefon zusammengerafft hatte, war Hanne schon verschwunden, gefolgt von Silje. Auf der Straße stellte er fest, dass sie den Dienstwagen genommen hatten.
Es war der letzte Freitag vor Weihnachten, und kein Taxi ließ sich auftreiben. Als er endlich den Versuch aufgab, eins anzuhalten, war er durchgefroren.
»Blöde Kuh«, fauchte er und stapfte missmutig los.
Der junge Mann, der soeben das Büro von Kommissar Erik Henriksen verließ, als Hanne Wilhelmsen den zweiten Stock des Polizeigebäudes erreichte, kaute Kaugummi, als ginge es um sein Leben. Seine Hose war drei Nummern zu groß. Sein Pullover löste sich am Hals auf, das Bündchen war zur Hälfte losgerissen. Die Baseballmütze saß umgedreht auf bleichen Haarstoppeln. Er sah aus wie ein Bengel in der Pubertät, aber sein Gesicht ließ vermuten, dass er mindestens fünfundzwanzig war. Sein Nasenrücken war scharf gezeichnet. Unter den Augen hatte er bläulich leuchtende Ringe, und um seinen Mund spielte ein gewohnheitsmäßiges, verärgertes Grinsen, das er sich sicher in jahrelanger Mühe erarbeitet hatte. Er bedachte Hanne mit einem unergründlichen Blick, dann schlurfte er zur Treppe, ohne Erik Henriksens ausgestreckte Hand zu schütteln. Der Kommissar verdrehte die Augen und winkte Hanne zu sich hinein.