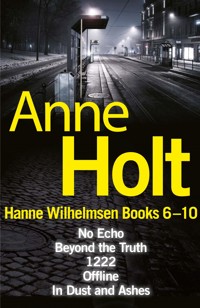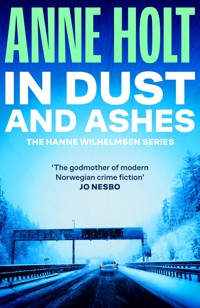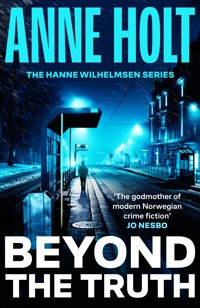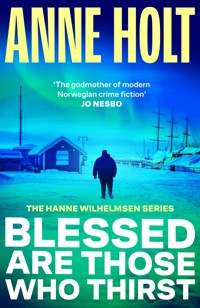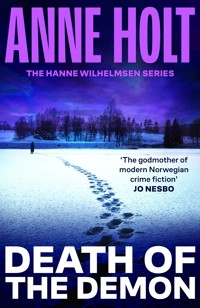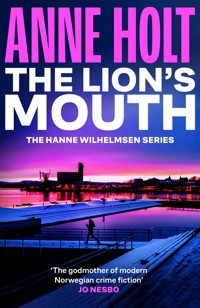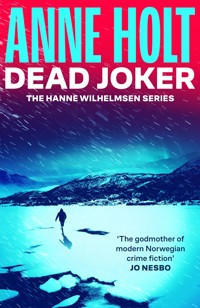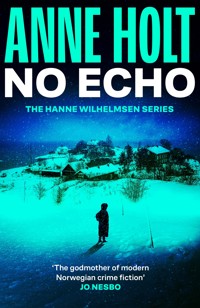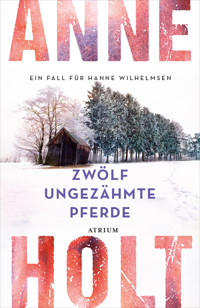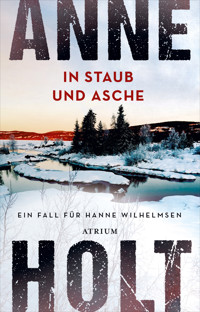
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atrium Verlag AG
- Kategorie: Krimi
- Serie: Hanne-Wilhelmsen-Reihe
- Sprache: Deutsch
Unrecht, Gier und Rachsucht Jonas Abrahamsen hat zwölf Jahre für den Mord an seiner Frau verbüßt. Doch Kommissar Henrik Holme ist überzeugt, dass er unschuldig ist. Zusammen mit Hanne Wilhelmsen ermittelt er in diesem alten Fall, als eine neue Leiche auftaucht. Es handelt sich um eine prominente Rechtsradikale, die Selbstmord begangen haben soll. Aber die beiden Zweifeln an dieser Theorie und decken schließlich eine Verbindung zu Jonas Abrahamsen auf. Die Zeit drängt, denn der zu Unrecht Verurteilte ist inzwischen auf Rache aus und hat ein kleines Kind entführt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 499
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Anne Holt
In Staub und Asche
Hanne Wilhelmsens zehnter Fall
Aus dem Norwegischen von Gabriele Haefs
Die deutsche Erstausgabe erschien 2018 im Piper Verlag, München.
This translation has originally been published with the financial support of NORLA, Norwegian Literature Abroad
© Atrium Verlag AG, Zürich, 2024
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © Anne Holt 2016
Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel I støv og aske bei Vigmostad & Bjørke, Oslo.
Für die vorliegende Ausgabe wurde die deutsche Übersetzung von der Übersetzerin überarbeitet.
Published by agreement with Salomonsson Agency
Covergestaltung: zero-media.net, München
Covermotiv: Stocksy / VISUALSPECTRUM, Shabby vintage grain Struktur: FinePic®, München
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
ISBN978-3-03792-219-4
www.atrium-verlag.com
www.facebook.com/atriumverlag
www.instagram.com/atriumverlag
Deshalb spreche ich mich schuldig
und tue Buße in Staub und Asche.
Buch Hiob, 42:6
Freitag, 1. Januar 2016
Noch knappe zwei Wochen, dann würde alles vorüber sein.
Und alles könnte beginnen.
Das neue Leben. Seine Frau und er in der Provence. Sie hatte auf diesem Umzug bestanden. Er sprach kein Französisch und trank auch keinen Wein, aber das Klima dort unten war jedenfalls angenehm. Seit er 1978 an der Polizeischule aufgenommen worden war, arbeitete er als Polizist, und es wurde höchste Zeit, sich eine neue Beschäftigung zu suchen. Hundezucht, darauf hatten er und seine Frau sich geeinigt.
Das Ende der Siebzigerjahre lag ein ganzes Leben zurück; zwei Generationen von Norwegern und neununddreißig Jahrgänge von Dienstanwärtern. Oder Polizeistudierenden, wie es neuerdings so vornehm hieß. Als er selbst bei der Polizei angefangen hatte, verwendeten sie noch Kugelschreiber und Papier und hier und da eine Kugelkopfmaschine von IBM, und die jüngsten Kollegen hießen Wachtmeister, womit sie vollauf zufrieden waren. Nun war er vor wenigen Monaten noch zum Hauptkommissar befördert worden, nur ein knappes halbes Jahr vor seiner Pensionierung. Mitte Februar wurde er achtundfünfzig, und dann konnte er seine Habseligkeiten im Büro zusammenpacken und zum allerletzten Mal aus der Tür der Wache von Stovner gehen.
Kjell Bonsaksen war in den meisten Lebensbereichen ein zufriedener Mann. Er würde nicht zurückblicken, und selbst da unten in der Provence musste es doch möglich sein, ein anständiges Bier aufzutreiben. Da er nur einen Sohn hatte und die Enkel zur Hälfte Franzosen waren, ließ sich Kjell Bonsaksen überreden, in ihre Nähe zu ziehen. Das Reihenhaus in Korsvoll war nach einer wilden Auktion für eine Summe verkauft worden, die ihm die Schamesröte ins Gesicht trieb. Auch nachdem das kleine Haus mit dem großen überwucherten Garten bei Aix vollständig abbezahlt war, blieb ihnen noch eine Stange Geld übrig.
Allerdings würde er dort unten wohl nicht sehr viele Würstchen essen können, wenn seine Frau die ganze Zeit auf ihn aufpasste.
Er legte einen Fünfziger auf den Tresen, nahm das Wechselgeld entgegen und steckte es in die Tasche. Großzügig zog er eine Ketchuplinie im Zickzack über die Wurst und schüttelte kurz den Kopf, als der Verkäufer ihm die Senfflasche hinschob.
Sein Blick wanderte durch die großen Fenster zu den Zapfsäulen hinüber. Seit Weihnachten war das Wetter erbärmlich. Feuchte Schneeflocken schmolzen, noch ehe sie den Boden erreichten, und man sah eigentlich nur grau in grau. Ein Lastzug war stehen geblieben und versperrte Kjell Bonsaksen den Blick auf die E18. Vermutlich war der Wagen unter all dem Schmutz rot.
Ein Mann kam auf die automatischen Türen zu. Er war groß und hatte vielleicht irgendwann einmal gut ausgesehen. Kjell Bonsaksen war da kein Kenner, aber der große Mund und die sehr gerade, symmetrische Nase deuteten darauf hin. Als der Mann durch die Tür trat, hob er den Blick und schaute Kjell Bonsaksen direkt ins Gesicht.
Der erstarrte mitten im Kauen.
Der Mann blieb für einen Moment stehen, so kurz, dass er eigentlich nur mitten in einer Bewegung etwas langsamer geworden war, dann ging er in seinem ursprünglichen Tempo weiter. In der Hand hielt er einen blanken Becher mit dem Statoil-Logo, den er an einem Automaten am Fenster auffüllte, ohne ein Wort an den Mann hinter dem Tresen zu richten.
Kjell Bonsaksen war ein besonnener Polizist. Niemals außergewöhnlich, und die letzte Beförderung war wohl eher ein Dank für lange und treue Dienste denn eine wirkliche Anerkennung dafür, dass er auch zum Chef taugte. Seine Stärke war es, hart und nach den Vorschriften zu arbeiten, ehrlich und genau zu sein und sich niemals auf krumme Wege locken zu lassen. Er war ein Arbeitstier. Polizisten wie ihn gab es immer seltener. Lange hatte ihm das zu schaffen gemacht, jetzt war es ihm egal. Es blieben ihm nur noch neunzehn Tage einer soliden, wenn auch etwas grauen Laufbahn.
Als Polizist mit fast vierzig Jahren Dienstzeit war er vor allem auf seine Erinnerung stolz. Denn ein Polizist musste sich erinnern. An Namen und Fälle. An Verwandtschaftsverhältnisse und Gesichter. An Tatorte, Verbrecher und Opfer. Man benötigte ein Gedächtnis, in dem einfach alles haften blieb.
Obwohl der Mann am Kaffeeautomaten jetzt fast kahl war und zudem viel dünner als bei ihrer letzten Begegnung, erkannte Kjell Bonsaksen ihn gleich beim ersten Blickwechsel. Die Augen waren groß und saßen ungewöhnlich tief in dem mageren, fast hohlen Gesicht.
Aber sie strahlten nichts aus.
Keine Neugier, keine Bosheit. Keine Freude, nicht einmal ein Anzeichen dafür, dass der Fremde Kjell Bonsaksen ebenfalls erkannt hatte. Es lag auch kein Hauch von Vorwurf in diesen Augen, als der Mann den Deckel auf den Becher setzte und mit ruhigen Schritten auf den Würstchen essenden Polizisten zuging. Einen Meter vor ihm blieb er stehen.
»Du hast gewusst, dass ich unschuldig war«, sagte er leise.
Kjell Bonsaksen gab keine Antwort, er war vollauf damit beschäftigt, ein zu großes Stück Wurst mit Brot und Ketchup hinunterzuschlucken.
»Du hast es gewusst«, wiederholte der Mann. »Und trotzdem hast du nichts unternommen.«
Er ließ den Blick für eine Sekunde auf seinem Gegenüber ruhen, ehe er fast unmerklich mit den Schultern zuckte, sich umdrehte und auf die Tür zuging.
Kjell Bonsaksen blieb stehen, mit einer halb gegessenen Wurst in der Hand, bis der Fremde sich in den möglicherweise roten Lastwagen gesetzt hatte und in Richtung Oslo auf die Europastraße gefahren war.
Montag, 3. Dezember 2001
Der Verzicht auf eine zusätzliche Tasse Kaffee hatte ihm alles genommen.
Hätte er sie sich nur gegönnt! Dann wäre der Tag wie alle anderen Tage im Dezember verlaufen, und sie hätten am folgenden Wochenende Dinas dritten Geburtstag feiern können. Oder aber, wenn sie früher losgekommen wären … Doch er hatte sich den Daumen an einer Konservenbüchse mit Makrelen geschnitten, und Dina wollte unbedingt die Krankenschwester spielen. Sie verbrauchte eine ganze Rolle Verbandszeug und befestigte es locker mit einem Donald-Pflaster. Er hätte sich selbst verarzten sollen. Das hätte die nötigen Sekunden eingespart, und der Tag hätte seinen gewohnten, sicheren Gang gehen können.
Es hätte auch etwas ganz anderes sein können, irgendeine dieser Bagatellen, die sich an jenem ganz normalen, verregneten Adventsmorgen häuften, gab den Ausschlag. Zum Beispiel, dass er nicht verschlafen hatte. Dass er keine dritte Tasse Kaffee getrunken hatte oder die zweite sofort leerte. Zwei weitere Schlucke hätten gereicht, um sie später auf die Straße hinauskommen zu lassen, und vielleicht hätte er auch nicht mehr im Briefkasten nachgesehen, denn sie hätten noch weniger Zeit gehabt.
Er hatte es ausgerechnet, später, als sich sein Haus mit Betrachtungen über Zeitabläufe füllte, und er hatte einen ganzen Tag auf der hohen Tanne im Garten der Nachbarn verbracht. Sie stand gleich neben dem Briefkasten, den er noch am selben Morgen heruntergerissen und mit einem Hammer zerschlagen hatte. Dann saß er, kurz vor Weihnachten, auf einem dicken Ast in der Tanne, hoch oben und unsichtbar für die Vorübergehenden, und zählte die Autos, die an der kleinen Ausfahrt vorbeifuhren, von sieben Uhr morgens bis sieben Uhr abends. Er kam auf sechzehn. Und wenn er fünf Sekunden für jedes ansetzte, fünf Sekunden, in denen eine möglicherweise gefährliche Situation entstehen konnte, in der ein fast drei Jahre altes Kind auf die Straße hinauslief, während der Vater den Briefkasten öffnete und irritiert Werbung sortierte, kamen doch nicht mehr als achtzig Sekunden dabei heraus. Zwölf Stunden, eben jene zwölf Stunden, in denen es überhaupt vorstellbar war, dass Dina sich draußen beim Briefkasten aufhielt, während ihr Vater abgelenkt war und sie für einen winzigen Moment nicht im Auge behielt, ergaben 43200 Sekunden. In achtzig davon war alles möglich.
In weniger als zwei Promille der Zeit.
0,185185185 Prozent, das würde er sich in alle Ewigkeit einprägen.
Wenn er sich nur die Zeit gelassen hätte, den Milchkarton zurück in den Kühlschrank zu stellen, wäre nichts passiert.
Wer schrie, war Jonas. Von Dina kam kein Laut.
Aber Jonas schrie in dem Augenblick auf, als das Leben noch nicht in Stücke gebrochen war, als er Dina jedoch stolpern sah. Er brüllte so laut, dass der Fahrer wütend auf die Bremse trat. Dann versuchte Jonas verzweifelt, das Auto weiterzuschieben, weg von Dina, die unter dem linken Vorderrad eingeklemmt lag. Jonas schrie, bis der verdutzte Fahrer das Fenster herunterkurbelte, ohne zu begreifen, was passiert war, und endlich den BMW einen Meter weiterrollen ließ.
In den folgenden Jahren ließ ihn dieses Bild nie wieder los. Dinas Sturz vor dem Winterreifen. Der Blick, den sie ihm noch zuwerfen konnte, während die geöffneten Lippen unter dem trüben Licht der Straßenlaterne bleich wurden. Die Sekunden, in denen er mit Dina in den Armen dastand und sah, was geschehen war, ohne es jedoch fassen zu können. Bild für Bild setzte sich zu einem Horrorfilm zusammen, der ihn wachhielt, wenn er schlafen müsste, und ihn so erschöpfte, dass er einschlief, wenn es nicht angebracht war.
Er würde sich immer an dieses Bild erinnern. Den blauen Overall und die rosa Mütze, die er zurechtzurücken versucht hatte, ehe die Polizei kam. Dinas Augen, die durch ihn hindurchstarrten. Den Rucksack mit den Sachen für den Kindergarten. Das Donald-Pflaster und den blutigen Verbandsfetzen, der hinuntergefallen war, als er sie aufhob. Den Gestank von Exkrementen, der sich aus Dinas Windel verbreitete, ehe die Blaulichter sich näherten. Niemals würde Jonas den Fahrer vergessen, der telefonierte und telefonierte, während er selbst dastand und weinte und weinte.
»Es war meine Schuld«, rief Jonas dem Fahrer zu, wieder und wieder. »Es war meine Schuld.«
Das war das Einzige, was er an jenem Morgen sagte, an dem er sein einziges Kind verloren hatte.
»Es war meine Schuld.«
Donnerstag, 7. Januar 2016
Seine Hand wärmte ihre Schulter durch den dünnen Pullover.
Hanne Wilhelmsen konnte es nicht ertragen, von anderen Menschen berührt zu werden als denen, mit denen sie zusammenlebte. Ihrer Tochter und ihrer Frau, die sie als ihre Familie bezeichnen würde, wenn sie jemals mit anderen über sie spräche. Diese Hand, schmal und behutsam, fühlte sich dennoch seltsam willkommen an. Eine Rettungsleine, dachte sie, etwas Bekanntes und Stabiles in einer Situation, in die sie hineingezwungen worden war und vor der ihr seit Tagen gegraut hatte.
Sie kniff die Augen in dem wütenden Blitzlicht zusammen. Die Fotografen waren so aufdringlich, dass es ihr ohnehin schwerfiel, ihren Rollstuhl zu manövrieren, und blind war es nicht leichter.
»Weg da«, forderte sie mit scharfer Stimme und spürte, dass der Mann hinter ihr seine Hand zurückzog und stattdessen die Griffe des Rollstuhls packte.
»Lass dich ausnahmsweise mal von mir schieben«, sagte Henrik Holme über ihr Ohr gebeugt, »wir müssen hier weg.«
»Werden sie verurteilt?«, rief ein Journalist. »Allesamt, meine ich.«
»Was sagen Sie zu dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft?«, fragte ein anderer und hielt Hanne ein iPhone vors Gesicht.
»Weg da!«
Henrik Holmes Stimme schlug ins Falsett um, während er ihre Forderung wiederholte und dabei energisch den Rollstuhl durch die Menschenmenge schob. Als sie die großen Türen des Gerichtsgebäudes fast erreicht hatten, schien es, als greife Moses ein. Die Presseleute, sicher zwanzig an der Zahl, wichen zur Seite und waren plötzlich gewaltig damit beschäftigt, ihre Handys zu überprüfen. Die Fotografen, einige jedenfalls, waren verwirrt von dem plötzlichen Stimmungswechsel und ließen ihre Kameras sinken. Henrik Holme hielt für einen Moment inne, überrascht, weil plötzlich freie Bahn zur Tür und zum draußen wartenden Einsatzwagen war.
»Was ist los?«, fragte Hanne Wilhelmsen und griff selbst in die Räder.
»Weiß nicht. Machen wir, dass wir fortkommen.«
Draußen schlug ihnen das Winterwetter entgegen. Nach einem dunklen Weihnachtsfest hatte es endlich angefangen zu schneien. Es war zwar noch nicht kalt genug, um die Stadt in Weiß zu hüllen, aber jetzt fielen feuchte Flocken und zwangen Hanne, die Augen zusammenzukneifen.
»Meine Güte«, sagte Henrik und blieb wieder stehen.
Der Einsatzwagen, der einige Meter entfernt gestanden hatte, rollte langsam auf die Treppe zu. Eine uniformierte Frau stieg aus.
»Was ist los?«, fragte Hanne übellaunig und zog die Jacke enger um sich zusammen.
»Iselin Havørn ist tot.«
Hanne sah Henrik an. Er hielt sich das Handy so dicht ans Gesicht, dass seine feuchten Wangen ein vages blaues Licht reflektierten.
»Wenn du mir erzählen willst, dass sie ermordet worden ist, nachdem wir endlich zweiundzwanzig Rechtsextremisten hinter Schloss und Riegel bringen konnten, dann …«
Die Polizistin kam näher. Sie schien plötzlich nicht zu wissen, wie sie Hanne in den Wagen schaffen sollte.
»Es sieht nicht gerade nach Mord aus.« Henrik wischte mit dem Daumen über das Display. »Sie schreiben nicht wortwörtlich von Selbstmord«, fügte er hinzu. »Aber offenbar hat sie freiwillig den Löffel abgegeben.«
Er steckte das Handy in die Tasche und ging halb um den Rollstuhl herum.
»Gestattest du?«, fragte er lächelnd und breitete die Arme aus. »Leichter so, weißt du.«
»Dieses eine Mal muss ich es wohl hinnehmen«, murmelte Hanne und hob langsam die Arme wie ein widerwilliges Kind.
Er trug sie zum Auto. Für einen ungewöhnlich schmächtig gebauten Mann war er stark, das merkte Hanne, obwohl ihr fast schlecht vor Unbehagen darüber wurde, dass sie getragen werden musste.
»Nimmst du den Stuhl?«, fragte Henrik die uniformierte Frau, die bereits angefangen hatte, den Rollstuhl zusammenzuklappen.
Er setzte Hanne auf den Rücksitz.
»Iselin Havørn«, sagte Hanne leise. »Was für ein blöder Name. Aber um ganz ehrlich zu sein …«
Henrik rückte vorsichtig ihre Beine zurecht.
»… gibt es wohl kaum einen Menschen in diesem Land, der mehr Grund hätte, sich zu schämen als …«
Sie schob ihn mit beiden Händen weg und griff nach dem Sicherheitsgurt.
»… Iselin Havørn. Was für ein Name. Und was für eine grauenhafte Frau.«
Während die Polizei wortkarg und zurückhaltend versuchte, Iselin Havørns Tod nicht als Drama erscheinen zu lassen, drehten die Medien richtig auf. Sogar an dem Tag, an dem das Urteil im größten Prozess gegen rechtsextreme Terroristen in der norwegischen Geschichte erwartet wurde, war der Selbstmord der Zweiundsechzigjährigen überall das Hauptthema.
»Vor drei Wochen kannte sie so gut wie niemand«, sagte Henrik Holme und griff nach der Fernbedienung, um den Fernseher leiser zu stellen. »Und jetzt geht es ihretwegen hier zu wie in Hollywood.«
»Tja«, antwortete Hanne. »Viele haben allerdings ihr Pseudonym gekannt. Dem konnte man ja auch kaum entgehen. Irgendwann wird aber jeder Tarnname geknackt. Bei ihr hat es nur ungewöhnlich lange gedauert.«
»Ich dachte, die Presseethik verlangt, dass über einen Selbstmord zunächst nicht berichtet wird?«
»Gilt offenbar nicht mehr, vermutlich weil sie in den letzten Wochen dauernd über sie berichtet haben. So gesehen ist es ein Paradox, dass die Presse sie verfolgt hat und sich jetzt in einem Selbstmord suhlen kann.«
»Du findest, sie wurde verfolgt?«
Hanne zuckte vage mit den Schultern.
»Streng genommen wurde sie das doch. Nachdem ihr Name bekannt geworden war, hat sie ihre Wohnung kaum noch verlassen, habe ich gelesen. Und das Haus wurde ja regelrecht belagert.«
»Das schon, aber verfolgt? Es ist ja wohl ihre Schuld, dass …«
»Willst du hier einziehen?«, fiel ihm Hanne ins Wort und schaute demonstrativ auf die Uhr.
Henrik errötete und fuhr sich nervös mit den Fingern über die Nase.
»Das nicht. Das nicht. Aber verfolgt? Wie meinst du das?«
Hanne gab keine Antwort. Sie schaltete den Fernseher aus und nickte in Richtung Tür.
»Iselin Havørn war nicht dumm. Also war sie ein schlechter Mensch. Ich vergieße keine Träne über ihren Tod, das tun vielleicht andere. Aber was sie in den letzten Wochen durchmachen musste, würde sicher auch die größte Stoikerin in Depressionen und Selbstmordgedanken verfallen lassen. Und du musst jetzt gehen und brauchst nicht wiederzukommen oder dich zu melden, ehe nicht ein neuer cold case auftaucht.«
»Auch nicht, wenn das Urteil bekannt gegeben wird?«
»Unnötig. Die werden verurteilt, alle, wie sie dort sitzen.«
»Glaubst du?«
Er war aufgestanden und ging auf die Tür zu, während Hanne in Richtung Küche losfuhr. Doch plötzlich blieb sie stehen und sah ihn über die Schulter an.
»Das ist unser Verdienst. Oder eigentlich …«
Fast unmerklich huschte ein Lächeln über ihr Gesicht.
»Dein Verdienst, Henrik. Dein Verdienst.«
Henrik hatte ein eigenes Büro bekommen.
Es war nicht groß, aber es gehörte ihm. Jahrelang war er in unpersönliche Kämmerchen verbannt gewesen, die er einige Tage, einige Wochen oder einmal anderthalb Monate behalten durfte. Dieses Zimmer hatte er nun kurz nach dem 17. Mai 2014 erhalten. Sechzehn Menschen waren während der Zweihundertjahrfeier für das norwegische Grundgesetz durch in einer Tuba und vier Trommeln versteckte selbst gebaute Bomben getötet worden. Und ohne seinen und Hanne Wilhelmsens Einsatz hätte es noch viel mehr Opfer gegeben. Sie kamen zwar zu spät, um den Angriff zu verhindern, aber rechtzeitig, um das Ausmaß zu beschränken und zuerst zwei Täter und danach zwanzig weitere festzunehmen, ein beängstigendes Netzwerk, das ihm lange den Schlaf geraubt hatte. Nachdem Hanne sich strikt weigerte, während der darauffolgenden intensiven Ermittlungen im Polizeigebäude zu arbeiten, wurde er zu einer Art Stellvertreter befördert. Und zu einem Boten, was er ja schon seit einer Weile gewesen war.
Er liebte sein Büro.
Seine Mutter war einige Tage nach seinem Einzug zu Besuch gekommen. Da er die Vorhänge hasste, die seiner Meinung nach an eine Anstalt erinnerten, hatte sie ihm mit der Post neue geschickt. Zuerst hatte er mit dem Aufhängen gezögert, vielleicht gab es irgendeine Vorschrift, nach der es untersagt war, öffentlichen Räumlichkeiten eine private Prägung zu geben. Doch als eine der älteren Beamtinnen den Stoffstapel auf dem Besucherstuhl entdeckte, half sie ihm beim Anbringen. Zusammen mit zwei bei IKEA gekauften Postern und einer Topfblume, die er jeden Montag und Donnerstag gewissenhaft goss, auf der Fensterbank machten die Vorhänge sein Büro nun geradezu gemütlich.
Henrik Holme kam jeden Morgen um Viertel nach sieben zur Arbeit und ging selten vor zehn Uhr abends nach Hause. Er fuhr zu Hanne, wenn sie ihn dazu aufforderte, und kehrte zurück auf das Revier, wenn sie ihn aus ihrer Wohnung in der Kruses gate hinauskommandierte. Im ersten halben Jahr nach den Terroranschlägen hatte er fast jedes Wochenende an dem Fall gearbeitet. Als die Unterlagen für die Staatsanwaltschaft vorbereitet waren, hatte man ihnen zwei andere ungelöste Fälle übertragen. Dem einen waren sie nie auf den Grund gekommen. Den zweiten, einen uralten Mordfall, konnten sie nur zwei Monate nach Ende der Verjährungsfrist aufklären. Der Mörder war seit sechzehn Jahren tot, aber die betagte Mutter des Opfers kam immerhin ein wenig zur Ruhe, da sie nun wusste, was wirklich geschehen war.
Jetzt war es halb neun Uhr abends, und Henrik Holme starrte verdrossen den leeren Korb für eingehende Post auf seinem Schreibtisch an.
Sie hatten keine Fälle mehr.
Nichts zu tun. Keinen Vorwand, um Hanne aufzusuchen.
Eigentlich müsste er sich bei seiner Vorgesetzten, der Polizeidirektorin Silje Sørensen, melden, wenn er Kapazitäten frei hatte.
»Hast du einen Moment Zeit?«
Ein korpulenter Mann mit einem breiten Lächeln stand in der Türöffnung und klopfte leise an den Rahmen. Über der rechten Schulter trug er einen kleinen Rucksack.
»Mehr als nur einen«, antwortete Henrik. »Komm rein.«
»Bonsaksen«, sagte der Mann und streckte ihm seine Pranke hin. »Hauptkommissar Bonsaksen. Dienststelle Stovner.«
Seine Knubbelfinger berührten die Polizeiplakette, die an einer blauen Schnur um seinen Hals hing.
»Henrik Holme«, entgegnete Henrik und versuchte, bei dem allzu festen Händedruck keine Grimasse zu schneiden. »Aber das weißt du sicher, da du …«
Er lächelte verlegen, schlug sich kurz mit der Faust gegen die Schläfe und setzte sich.
»Da ich dich aufsuche«, beendete Bonsaksen den Satz, nickte und nahm auf dem freien Stuhl Platz.
»Ja.«
»Du machst dir ja langsam einen Namen, Holme.«
Henrik gab keine Antwort. Er hatte mehr als genug damit zu tun, sein aufsteigendes Erröten zu bekämpfen und seine Hände unter seinen Oberschenkeln in Sicherheit zu bringen.
»Es wird über dich geredet. Voll Respekt. So, wie früher einmal über Hanne Wilhelmsen gesprochen wurde.«
Er lächelte wieder.
»Obwohl … so weit bist du doch noch nicht. Ich war damals in den harten Tagen hier, deshalb weiß ich, wovon ich rede. Wir haben niemals zusammengearbeitet, Wilhelmsen und ich, aber meine Güte, was hatte diese Frau für einen Ruf. Am Ende wie eine Königin. Ehe … ehe sie angeschossen wurde und ein wenig …«
Der Zeigefinger rotierte langsam an seiner Schläfe.
Dann war es ganz still im Raum. Eine Sirene im Hinterhof durchbrach endlich Wände und Boden.
»Viel zu tun?«
Bonsaksen ließ seinen Blick über die fast leere Tischplatte wandern, bis er an dem inhaltslosen Postkorb haften blieb.
»Im Moment gerade nicht.«
»Schön. Ich würde mich nämlich freuen …«
Der ältere Polizist hob den Rucksack von seinen Knien und zog einen Ordner heraus, blau und so voll, dass der von selbst aufsprang. Mit einem dumpfen Knall legte Bonsaksen ihn auf den Schreibtisch.
»Ich würde mich wirklich freuen, wenn du hierauf einen Blick werfen könntest …«
»Wir … Die Polizeidirektorin teilt uns die Fälle zu. Wir können nicht einfach …«
»Ich weiß, ich weiß.«
Kjell Bonsaksen fuhr sich nachdenklich mit dem Zeigefinger über den Nasenrücken.
»Du bist erst seit drei Jahren hier?«
»Im Sommer sind es fünf.«
»Fünf.«
Bonsaksen nickte.
»Ich gehe in genau einer Woche in Rente«, sagte er dann. »Werde am 14. Januar achtundfünfzig. Dann war ich fast neununddreißig Jahre bei der Polizei.«
Henrik starrte den abgegriffenen blauen Ordner an.
»Und wenn man so viele Jahre im Dienst ist, lässt es sich ja nicht vermeiden, dass man ab und zu einen Fehler macht«, fügte Bonsaksen hinzu. »Selbst wenn es bei mir wohl weniger sind als bei den meisten anderen. Aber wie gesagt …«
Er schaute sich um und entdeckte Henriks Moccamaster auf einem Beistelltisch in der Ecke.
»Kann ich eine Tasse haben?«
»Der steht schon eine Weile, fürchte ich.«
»Ach, egal«, sagte Bonsaksen und erhob sich.
Er ging zu dem Tisch in der Ecke, nahm sich eine saubere Tasse und goss sich ein. Ehe er trank, schnupperte er kurz an dem Kaffee.
»Sehr gut«, sagte er und setzte sich wieder.
»Wie gesagt?«, fragte Henrik. »Du wolltest eben …«
»Wie gesagt«, unterbrach ihn Bonsaksen und hob abermals die Tasse an den Mund, überlegte sich die Sache dann aber anders und stellte sie wieder hin, »… natürlich hat man den einen oder anderen Fehler gemacht. Leute zu einfach davonkommen lassen. Sich bei irgendeinem Fall vielleicht nicht ausreichend in die Riemen gelegt. In einzelnen Fällen konnte man vielleicht auch nicht ganz so objektiv bleiben, wie die Regeln es vorschreiben. Die Sache ist die, Holme, dass ich trotzdem …«
Er schniefte ein wenig und fuhr sich mit dem Finger unter der Nase entlang.
»Es gibt nichts, womit ich nicht leben könnte. Nichts, das mich quälen wird, wenn ich in einer Woche meinen Kram in einen Karton packe und aus dem Büro trotte, um mich ins erste Flugzeug nach Frankreich zu setzen. Es gibt nichts, was ich in all diesen Jahren getan oder unterlassen habe, das mich in den kommenden Jahren eine Minute Schlaf kosten wird. Rein gar nichts.«
Das betonte er, indem er mit der Hand auf den Tisch schlug.
»Mit einer Ausnahme«, fügte er hinzu und berührte den blauen Ordner. »Das hier liegt seit 2004 wie ein Stein in meinem Schuh.«
»Na gut. Es kann schon eine Belastung sein, wenn der Schurke ungeschoren davonkommt.«
»Der hier ist nicht ungeschoren davongekommen.«
»Was?«
»Er ist nicht ungeschoren davongekommen. Er wurde angeklagt, vor Gericht gestellt und verurteilt.«
»Dann … dann verstehe ich nicht ganz …«
Henrik schluckte. Noch immer war die Umgebung seines Kehlkopfes empfindlich, nachdem er Anfang Dezember seinen Adamsapfel hatte verkleinern lassen. Um einiges. Jetzt trug er Rollkragenpullover oder Schals und fürchtete den Frühling, wenn es wärmer werden würde. Der Operationsschnitt lag zwar so exakt zwischen Hals und Kinn, dass er kaum noch zu sehen war, aber alle würden die große Veränderung an seinem Hals bemerken. Was ja auch der Sinn der Sache gewesen war, wie er zugeben musste.
Er nestelte am Kragen seines militärgrünen Pullovers herum.
»Hanne Wilhelmsen und ich arbeiten an ungelösten Fällen«, sagte er und versuchte, energisch zu klingen. »Cold cases. Ich fürchte, wir können nicht … Und außerdem, wie schon gesagt, wir sind der Polizeidirektorin unterstellt, und zwar nur ihr.«
»Ich verstehe«, sagte Kjell Bonsaksen. »Es gibt ja wenig andere hier im Haus, die hoffen könnten, mit Wilhelmsen fertigzuwerden, was? Aber dieser Fall …«
Er legte die Pranke auf den Ordner und schob ihn auffordernd zu Henrik hinüber. Der seinerseits wich zurück, als ob die Ansammlung an Unterlagen ihm Angst machte.
»Es geht hier um einen Fehler«, erklärte der ältere Kollege jetzt. »Einen Justizirrtum. Oder …«
Plötzlich ließ sich Kjell Bonsaksen in den Stuhl zurücksinken, dann fischte er eine halb gerauchte Zigarre aus der Brusttasche und schob sie in den Mund.
»Ich saug nur daran«, murmelte er beruhigend. »Gib mir kein Feuer.«
»Justizirrtum«, wiederholte Henrik tonlos. »Wenn du meinst, dass ein Fehlurteil gefällt wurde, dann gibt es die Kommission zur Wiederaufnahme, an die man sich wenden kann.«
»Klar doch. Wenn der Bursche daran Interesse hätte. Das Problem ist …«
Kjell Bonsaksen erhob sich mit einem leisen Stöhnen, die Zigarre im Mundwinkel. Er hatte mindestens zwanzig Kilo Übergewicht. Henrik fand, die Zigarre habe Ähnlichkeit mit eingetrocknetem Hundekot, und er schlug die Augen nieder.
»Ich habe mich damit getröstet, dass er nie gekämpft hat«, sagte der bald in Rente gehende Polizist und starrte vor sich hin. »Seit fast zwölf Jahren versuche ich jetzt, mich damit zu beruhigen, dass er niemals kämpfen wollte. Also kann er doch nicht unschuldig sein, oder?«
Henrik gab keine Antwort.
»Ich meine …«
Bonsaksen spuckte unsichtbare Tabakkrümel aus, ohne die Zigarre von den Lippen zu nehmen.
»Alle Beweise deuteten auf ihn. Er hat nachweislich gelogen. Zwei Rechtsinstanzen haben ihn für schuldig befunden. Verdammt, nicht einmal sein Anwalt hat dem armen Teufel geglaubt!«
Er drehte sich zu Henrik um und hob die Arme.
»Verstehst du?«
Henrik hätte gern Nein gesagt. Stattdessen starrte er den Ordner an.
»Eigentlich war ich der Einzige, der Zweifel hatte«, fuhr Kjell Bonsaksen fort. »Ich war der Hauptermittler in diesem Fall. Es hätte für den Burschen natürlich ein verdammt großer Vorteil sein können, dass ich mir nicht vollkommen sicher war, ob wirklich er seine Frau umgebracht hatte, aber …«
»Seine Frau umgebracht?«
Henrik schaute auf.
»Ja. Er wurde wegen des Mordes an seiner Frau zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt.«
»Dann ist er also …« Henrik rechnete rasch im Kopf. »Sicher hat er nicht die ganze Zeit abgesessen. Er ist jetzt also frei?«
Bonsaksen nickte und setzte sich wieder.
»Er kam nach acht Jahren raus, wie ich mittlerweile weiß. Ich habe mich kundig gemacht, nachdem ich ihm neulich über den Weg gelaufen bin. Am Neujahrstag, genauer gesagt, an einer Tankstelle draußen an der E 18. Es war purer Zufall. Er hat sich nicht gut gehalten, um es gelinde auszudrücken. Er ist klapperdürr und fast kahl. Die paar Strähnen, die er noch auf dem Kopf hat, sind grau. Früher war er wirklich ansehnlich. Fescher Kerl mit Superjob bei Statoil. Jetzt fährt er Lkw zwischen Norwegen und Schweden und sieht auch so aus. Bleich und verhärmt und derart mit Kaffee vollgepumpt, dass man vor Schreck wach wird, wenn man ihn nur anschaut. Einfach nicht mehr wiederzuerkennen. Aber die Augen, Holme …«
Er legte seine beiden Pranken auf den Tisch und beugte sich plötzlich vor.
»Die waren genau wie damals. Haargenau!«
»Klar«, sagte Henrik kleinlaut. »Augen verändern sich in zwölf Jahren ja auch nicht so sehr.«
»Manchmal schon. Diese aber nicht.«
Henrik nahm den sauren, widerlichen Geruch der kalten Zigarre wahr und wich mit seinem Bürostuhl ein wenig zurück.
»Weißt du, was meine Frau sagt, was nach all diesen Jahren bei der Polizei das Schlimmste an mir ist?«, fragte Kjell Bonsaksen todernst.
»Nein.«
»Dass ich so verdammt zynisch geworden bin. Dass ich an niemanden zu glauben scheine. Dass ich immer Einwände habe und alles überprüfen muss. Da hat sie sicher recht. Ich bin milieugeschädigt.«
Endlich nahm er die Zigarre aus dem Mundwinkel und steckte sie wieder in die Brusttasche.
»Aber weiß du, was Bjørg-Eva als meine beste Fähigkeit nach all diesen Jahren bezeichnet?«
Henrik schüttelte heftig den Kopf.
»Dass ich Leuten an den Augen ansehen kann, ob sie lügen.«
Henrik saß mäuschenstill da.
»Das kann ich natürlich nicht«, beschwichtigte Bonsaksen. »Aber fast. Doch das Problem damals war, dass ich in seinen Augen nicht die Spur einer Lüge erkannte, als er sagte, er habe es nicht getan. Aber es lag auch keine Wut über die ungerechte Behandlung darin. Nur …«
Er packte den Ordner mit beiden Händen und stellte ihn hochkant. Henrik konnte sehen, dass der Trauring fast in den rechten Ringfinger eingewachsen zu sein schien, und er erkannte an der anderen Hand einen ebenso engen Ring der Odd Fellows.
»Resignation«, sagte nun Bonsaksen. »Der Typ war einfach total resigniert. Hatte keinen Zunder mehr, um das mal so zu sagen. Also habe ich versucht, mich damit zu beruhigen, dass schon alles seine Richtigkeit hätte. Wie gesagt, der Fall war nur ein Stein in meinem Schuh. Unangenehm, aber nicht gefährlich. Lästig, doch ich konnte damit leben.«
Er legte den prallvollen Ordner wieder hin und schob ihn abermals zu Henrik Holme hinüber.
»Das ist heute anders«, fügte er hinzu und seufzte tief. »Der Blick, mit dem er mich da draußen bei der Tanke angesehen hat …«
»Wie heißt der Mann?«, fragte Henrik, mehr, um irgendetwas zu sagen, als aus wirklichem Interesse.
»Dieser Blick sagte die Wahrheit, Holme. Und da …«
Kjell Bonsaksen erhob sich, packte den fast leeren Rucksack und warf ihn sich über die rechte Schulter, dann ging er auf die Tür zu. Den Ordner ließ er auf Henrik Holmes Schreibtisch liegen.
»… da hat er sich für den Titel der meistgequälten Seele im Land qualifiziert. Dieser Mann hat alles verloren. Absolut alles, und zwar innerhalb kürzester Zeit. Werft einen Blick auf den Fall, bitte. Gebt dem Mann die Chance, die ich ihm vor zwölf Jahren hätte geben müssen.«
»Wie heißt er?«, wiederholte Henrik.
»Er heißt Jonas«, antwortete Kjell Bonsaksen und öffnete die Tür. »Jonas Abrahamsen, und ich hoffe bei Gott, dass ihr ihm helfen könnt.«
Freitag, 8. Januar 2016
»Das ist doch ein Geschenk. Trotz allem. Ein Geschenk.«
Der Geschäftsführer der Gesundheitskostfirma VitaeBrass AS, Halvor Stenskar, seufzte tief und legte seine Hand auf die ihre. Sie zog ihre Hand zurück, langsam genug, um abweisend, aber nicht direkt unhöflich zu erscheinen.
»Ich meine …«
Er erhob sich und ging zum Fenster. Das verdammte Wetter färbte den Fjord unter dem düsteren Himmel dunkelgrau. Nesoddlandet lag wie ein geducktes Raubtier auf dem anderen Ufer und war unter der tief hängenden Wolkendecke über Oslo gerade noch zu erkennen.
Novemberwetter im Januar.
»Selbstmord ist natürlich eine Tragödie«, sagte er.
Sicher zum fünften Mal seit seinem Eintreffen, wie ihm aufging. Er räusperte sich leise und versuchte einen neuen Anfang.
»Dennoch ist Selbstmord eine bewusst gewählte Handlung. Ich bin sicher, dass er niemandem leichtfällt. Niemandem. Auch Iselin nicht. Aber es ist dennoch ein gewählter Tod.«
Er drehte sich wieder zum Wohnzimmer um. Obwohl die Wohnung in einer unglaublich teuren Gegend auf Tjuvholmen lag, war sie nicht beeindruckend groß. Außerdem gab es hier zu viele Möbel, wodurch sie beengt wirkte. Möbel, allerlei Gegenstände und kräftige Farben, der vollkommene Gegensatz zu dem strengen Minimalismus, den seine Frau so liebte. Ein gigantisches Gemälde über dem Kamin, das einen fliegenden Seeadler zeigte, war das einzige Bild im ganzen Raum. Im Übrigen gab es nur Gegenstände. Aus Ton und Holz. Aus Kupfer und Schmiedeeisen. Und aus Messing. Überall standen Messinggegenstände herum. Das hellgoldene Metall war zwar der Schlüssel zum Erfolg der Firma, aber es musste ja wohl Grenzen geben. Halvor hatte die Leuchter gezählt und war auf vierzehn gekommen, ehe er aufgegeben hatte. Das Zimmer erinnerte ihn an ein Boudoir, mit seinen tiefroten Sofas, zahllosen weichen Kissen und dem Duft einer Räuchermischung, von dem ihm ein wenig schlecht wurde. Aber Boudoir passte ja auch gut, schließlich hatten hier zwei alternde Lesben gelebt.
Andererseits hatte er noch nie einen Fuß in ein Boudoir gesetzt, hatte im Grunde also keine Ahnung.
Er ertappte sich dabei, dass er Maria anstarrte.
Das Sofa, auf dem sie saß, war so niedrig, dass ihre Beine fast auf dem Boden lagen, wenn sie sie ausstreckte. Trotz ihres Alters war sie schlank, gesund und ziemlich durchtrainiert. Sie hielt ein Kissen auf ihren Bauch gepresst, wirkte jedoch weder verweint noch sonderlich erschüttert.
»Am wichtigsten ist es jetzt, die Gemüter zu beruhigen«, sagte er. »Die letzten Wochen waren für uns alle unangenehm. Nicht gerade günstig für die Firma, all dieses …«
Seine Hand bewegte sich unschlüssig durch die Luft, als ob er ein Insekt verscheuchen wollte.
»… Gerede in den Medien.«
Endlich schaute Maria auf. Sie hatten einander niemals nahegestanden, dazu waren sie zu verschieden, und er wurde nicht schlau aus ihr. Für ihn war BrassCure lediglich eine Geschäftsidee. Zwar eine überaus einträgliche, aber er hatte sich niemals versucht gefühlt, auch nur eine einzige der Pillen zu schlucken, die sie so teuer verkauften. Iselin hingegen hatte an dieses Produkt geglaubt. Mit ihrer Darstellung der großartigen Wirkung von BrassCure auf den menschlichen Körper hatte sie ganze Versammlungen von Agenten und Vertretern fesseln können. Einer medizinischen Überprüfung hätten ihre Theorien kaum standgehalten, aber sie hatten für Iselin und noch einige andere den Grundstein zu einem kleinen Vermögen gelegt.
Wo Maria bei all dem stand, war ihm nicht so klar.
Sie hatte Iselin gegenüber immer loyal gewirkt, und einige Male hatte diese Loyalität an Selbstverleugnung gegrenzt. Während Iselin einen Raum durch ihre bloße Anwesenheit dominieren konnte, wurde Maria zur großäugigen Bewunderin, die kaum den Mund aufbrachte, wenn ihre Ehefrau in der Nähe war.
Er hatte Maria gewarnt, ehe sie ihre Geliebte in die Firma aufnahm. Iselin einfach die Hälfte von Marias Anteilen zur Hochzeit zu schenken, ganz ohne Bedingungen, war der pure Wahnsinn. Halvor Stenskar sagte seine Meinung, erst indirekt, dann immer direkter und ungehobelter, aber es half alles nichts. Nur Monate nach ihrer ersten Begegnung waren die beiden Turteltauben registrierte Lebenspartnerinnen. Und heute musste Halvor Stenskar zugeben, dass VitaeBrass erst mit Iselins Eintritt in die Firma wirklich erfolgreich wurde.
Maria war offenbar in Iselin vollkommen aufgegangen. Zu jeder Zeit.
»Das Gerede in den Medien«, wiederholte er, vor allem, um das peinliche Schweigen zu brechen.
»Du behauptest doch immer, jede PR sei gute PR.«
»Damit meine ich relevante PR.«
Er betonte »relevant« auf übertriebene Weise.
»Wie Artikel darüber, dass wir mehr versprechen, als wir halten?«, fragte sie. »Dass wir keine wissenschaftlichen Belege dafür hätten, dass BrassCure überhaupt wirkt? Dass die Verbraucherzentrale unsere Werbung immer wieder vernichtend kritisiert hat?«
»Wenn jemand so etwas schreibt, können wir sofort ein Dutzend Patienten aus dem Ärmel schütteln, die das Gegenteil behaupten. Und das Einspruchsrecht, Maria, sollte man nicht so einfach abtun. Das Einspruchsrecht hat uns im Laufe der Jahre eine Menge Gratisreklame beschert. Für VitaeBrass als Firma und für BrassCure als Produkt. Dass Iselin entlarvt wurde als …«
Er wusste nicht so recht, wie er sich ausdrücken sollte. Trotz allem stand er einer frischgebackenen Witwe gegenüber.
»Extremistin«, kam sie ihm zu Hilfe. »So nennen sie das. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass du je behauptet hättest, anderer Meinung zu sein als Iselin.«
»In Gesellschaft, nein! Wir sind uns doch alle einig, dass die Sache mit den Zuwanderern einfach zu weit geht und drastische Maßnahmen ergriffen werden müssen, um zu verhindern, dass …«
Er fuhr sich mit den Fingern durch die dichte graue Mähne. Dann wischte er sich diskret ein paar Schuppen von den Schultern seines Jacketts und setzte sich auf die Armlehne des einen Sessels.
»Gesunde Skepsis angesichts dieser Flut von dysfunktionalen Analphabeten und zukünftigen Sozialhilfebeziehern ist das eine. Etwas ganz anderes sind jedoch diese Predigten, triefend von purem …«
»Rassismus«, schlug sie hilfsbereit vor, als er zögerte.
Er blinzelte hektisch, entgegnete aber nichts.
»Iselin, oder genauer gesagt Tyrfing, war keine Rassistin im Sinne der Boulevardpresse. Sie war eher eine moderne Nationalistin. Sie wollte unser Land von seinem multikulturellen Joch befreien. Rassismus baut darauf auf, dass die einen den anderen unterlegen sind. Iselin wollte keine Rangordnung der Rassen aufstellen. Sie war der Meinung, dass unsere Ethnizität, Eigenart und Kultur zu wichtig sind, um sie weiter der Infiltrierung durch den Islam auszusetzen. Dem hast du bisher immer zugestimmt.«
»Nein. In diesem verdammten Blog hat sie ganz andere Dinge geschrieben als jene, die sie zu gesellschaftlichen Anlässen gesagt hat.«
»Aber du hast nie Einwände gegen ihre Äußerungen gehabt. Ich auch nicht, aber das kommt daher, dass ich mich eigentlich kaum für Politik interessiere.«
»Du interessierst dich kaum dafür?«
Er starrte sie ungläubig an.
»Du fischst dir Iselin aus dem Nichts heraus«, sagte er viel zu laut. »Du hast alles finanziert …«
Er begann, mit den Händen in der Luft zu fuchteln, als würde er von einem ganzen Insektenschwarm angegriffen.
»… ihre Aktivität als Bloggerin, meine ich. Du hast diesen Kreuzzug ermöglicht. Du hast ihr die Hälfte deiner Anteile überschrieben, und du hast …«
»Du scheinst zu vergessen, dass die Firma in den zehn Monaten, seit Iselin in die Geschäftsführung eingetreten ist, ihren Umsatz verdoppelt hat. Außerdem hätte Iselin auch ohne mich Tyrfing sein können. Ein Blog kostet zwei Kronen fünfzig. Aber vergiss es. Ich habe keinen Nerv für solche Diskussionen.«
Maria Kvam erhob sich. Schwerfälliger als sonst, so kam es ihm jedenfalls vor. Als trüge sie eine kaum erträgliche Last. Der hitzige, fast aggressive Blick war verschwunden. Vielleicht war das ihre Art zu trauern.
»Es ist trotz allem ein Geschenk«, sagte Halvor Stenskar und hob sein Hinterteil von der weichen Armlehne. »Wie gesagt. Bei allem Respekt, Maria, aber wenn es schon so schlimm kommen musste, dass Iselin dermaßen vernichtet und aller Ehre beraubt wird, ist es trotz allem das Beste für …«
Er zögerte, gerade so lange, dass sie ihn mit einem Lächeln bedenken konnte, das er noch nie gesehen hatte.
»Für die Firma«, beendete sie seinen Satz. »Dass sich der Sturm um Iselin gelegt hat, ist gut für die Firma. Und das ist natürlich das Wichtigste. Das Allerwichtigste.«
»Deine Firma«, korrigierte er. »Vor allem jetzt. Jetzt, nachdem das passiert ist, meine ich …«
Seine Hand schweifte ziellos durch den Raum, als ob Iselins Selbstmord sich irgendwo zwischen Samtkissen und Krimskrams versteckte.
»Meine«, sie nickte. »Jetzt gehört sie beinahe nur mir.«
Jetzt weinte sie. Ganz still und fast unmerklich, nur die laufenden Tränen machten Halvor klar, dass es höchste Zeit war zu gehen.
Henrik Holme hatte starke Zweifel, ob er es überhaupt wagen könnte, Hanne aufzusuchen. Der Abschied am Vortag war so abrupt und gebieterisch gewesen wie immer, und streng genommen hatte er ja keinen neuen Fall unter dem Arm.
Im Grunde war es überhaupt kein Fall.
Die Unterlagen in dem abgegriffenen blauen Ordner enthielten kein Rätsel. Es gab keine unbekannten Täter, keine Blindspuren wie in den Fällen, die sie bisher bearbeitet hatten. Im Gegenteil. Henrik hatte den Tag damit verbracht, die meisten Unterlagen durchzusehen, und das Urteil gegen Jonas Abrahamsen wirkte alles andere als ungerecht. Zu allem Überfluss hatte der arme Tropf es sofort nach der Verkündung angenommen. Allerdings mit einem auffälligen und eher seltenen Vorbehalt: Als dem Verurteilten das Wort erteilt wurde, hatte er seine Unschuldsbehauptung wiederholt – und dann seine lange Freiheitsstrafe akzeptiert. Es kam zwar durchaus vor, dass jemand Vorbehalte anmeldete, wenn es um einen Vergleich oder eine geringe Strafe ging, aber zwölf Jahre Gefängnis anzunehmen, ohne sich schuldig zu bekennen, war außergewöhnlich. Der Anwalt hatte auch sofort eingegriffen und seinen Mandanten dazu überreden wollen, um Bedenkzeit zu bitten.
Aber das hatte nicht geholfen.
»Offenbar ist das Urteil korrekt«, sagte Hanne Wilhelmsen und schlug den Ordner mit einem Knall zu, nachdem sie weniger als eine Viertelstunde lang schweigend darin geblättert hatte. »Dieser Hauptkommissar Bonsaksen leidet vermutlich nur an einem Anfall von Ruhestandsblues. Es ist immer schwer für diese Alten, wenn ihre Zeit bei der Polizei zu Ende geht.«
Henrik verspürte einen gewissen Drang zu erwähnen, dass Hanne nur zwei oder drei Jahre jünger war als der Hauptkommissar. Doch er hielt sich zurück.
»Bonsaksen kam mir ziemlich überzeugt vor«, sagte er stattdessen.
»Sicher.«
»Und er verfügt über große Erfahrung.«
»Sicher.«
»Er hat gesagt, es sei der einzige Fall in fast vierzig Jahren, bei dem ihm Zweifel zu schaffen machen.«
»Dann ist er ein Idiot. Ich hatte bei jedem zweiten Fall Zweifel. Warum läufst du eigentlich nur noch in Rollkragen durch die Gegend? Und sehe ich eine Andeutung von Bart, Henrik? Machst du neuerdings auf Hipster, oder was?«
Er griff sich an den Hals, zögerte kurz und fragte dann: »Ist es dir nicht aufgefallen?«
»Doch. Dein Adamsapfel ist kleiner geworden. Das sieht man auch durch den Pullover. Ich gratuliere. Tut es noch immer weh?«
»Nein. Ist nur ein bisschen empfindlich.«
»Das legt sich sicher. Und es war höchste Zeit, diesen schrecklichen Knubbel zu operieren. Und da die Narbe …« Sie legte den Kopf schräg und musterte seinen Hals aus zusammengekniffenen Augen. »… so sauber und ordentlich oben in der Falte unter dem Kinn sitzt, begreife ich nicht, was der Pullover soll.«
Henrik gab keine Antwort, sondern umklammerte die Esstischplatte, um den heftigen Drang zu bezwingen, seinen Nasenflügel zu berühren.
»Es ist zwölf«, sagte Hanne. »Zeit zum Mittagessen. Wenn du keinen Hunger hast, kannst du gehen.«
Henrik saß noch immer ganz still da. Sein Blick war starr auf den Ordner zwischen ihnen gerichtet, und er klammerte sich weiterhin an den Tisch. Aber sein linkes Bein, das vor Sekunden noch so heftig gezittert hatte, dass der Absatz dumpfe Trommelwirbel auf das Parkett schlug, erstarrte.
»Henrik?«
Es war etwas, das er in der Nacht gesehen hatte. Etwas, das er nicht ganz zu fassen bekommen hatte, vielleicht, weil es schon nach zwei gewesen war und die Unterlagen so umfangreich waren. So überzeugend. So voller vernichtender Belege.
»Es gibt da etwas an diesem Fall«, sagte er plötzlich und laut. »Etwas, das vielleicht nicht ganz stimmt.«
»Was denn?«
Hannes Stimmlage war ein wenig höher als sonst, wie immer, wenn sie ungeduldig wurde. Henrik hob den Blick und schaute aus den großen Fenstern in den tristen Tag hinaus. Regen lief die Fensterscheibe hinab, in der sich eine brennende Stehlampe neben dem Sofa spiegelte.
Genau das hatte er gebraucht.
Etwas Seltsames fiel ihm ein. Ein Detail. Es musste natürlich keine Bedeutung haben.
Aber es konnte.
»Nichts«, sagte er, nachdem er kurz überlegt hatte, lächelte abwehrend, nahm den Ordner unter den Arm und ging.
Wenn er ein seltenes Mal gefragt wurde, wie es ihm ginge, gab er immer dieselbe Antwort: »Kann nicht klagen.«
Jonas Abrahamsen konnte nicht klagen.
Er hatte sein einziges Kind verloren, weil er nicht gut genug aufgepasst hatte.
Seine Ehe war schon zerrüttet gewesen, als Anna zwei Jahre später gestorben war, und er hatte acht Jahre wegen einer Tat im Gefängnis gesessen, die er nicht begangen hatte. Die Stelle bei Statoil war mit Verkündung des Urteils verloren gewesen. Da er und Anna in Gütertrennung gelebt hatten und die Scheidung schon eingeleitet gewesen war, verlor er das Haus und fast alles andere.
Freunde hatte er auch keine mehr.
Zwar hatten ihn überraschend viele während der Gerichtsverhandlung unterstützt, aber die meisten zogen sich zurück, nachdem er schuldig gesprochen worden war. Ein Vetter, ein Kollege und zwei Kumpel von früher hatten ihn im ersten Jahr im Gefängnis besucht, dann waren alle bis auf den Vetter weggeblieben. Er ermunterte auch kaum zu weiteren Besuchen, wenn er ungepflegt in Kleidern dasaß, die ihn immer mehr umschlotterten.
Aber er konnte nicht klagen.
Er hätte auf Dina aufpassen müssen, aber er hatte sich von der Werbung im Briefkasten ablenken lassen. Er allein war schuld daran, dass Dina nicht mehr lebte und seine Welt zerbrochen war.
Er klagte nicht.
Es war kalt in dem spartanisch eingerichteten Wohnzimmer. Jonas warf zwei Holzscheite in den Eisenofen in der Ecke, dann fiel ihm ein, dass er seit dem Frühstück nichts mehr gegessen hatte. Sein Körper sagte schon seit vielen Jahren nicht mehr Bescheid, wenn er Nahrung brauchte. Er sagte eigentlich so gut wie nie mehr Bescheid. Das Einzige, worauf Jonas nicht verzichten konnte, war Kaffee, zwischen zwei Tassen verging selten mehr als eine halbe Stunde. Tagsüber und auch abends. Ab und zu erwachte er gegen drei Uhr nachts und musste sich ein oder zwei Tassen zubereiten. Wenn er Glück hatte, konnte er danach vielleicht noch ein Stündchen weiterschlafen.
In der Regel hatte er kein Glück.
Aber müde war er auch nie.
Das war auch gut so, da er ja Fernfahrer war. Meistens ging es nur nach Schweden, aber es gab auch ab und zu eine Tour nach Deutschland. Sein Vetter hatte ihm den Job besorgt, ein halbes Jahr nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis. Guttorm hatte ihm sogar den Lkw-Führerschein finanziert. Als Darlehen, darauf hatte Jonas bestanden, und inzwischen war das Geld zurückgezahlt.
Er verdiente einigermaßen und brauchte nicht viel.
Das Haus, das er in Maridalen gemietet hatte, war winzig klein. Die Grundfläche betrug knapp vierzig Quadratmeter, und der Keller war so feucht, dass er zu gar nichts zu gebrauchen war. Jonas hatte die Tür von innen mit Isopor abgedichtet und sie abgeschlossen. Der Dachboden war so niedrig, dass er ihn ebenfalls abgesperrt und die enge Treppe nach oben vernagelt hatte, um Heizung zu sparen. Übrig war das Erdgeschoss mit einer alten Speisekammer, die er mit einfachen Mitteln in eine Art Badezimmer umfunktioniert hatte, einem fast zehn Quadratmeter großen Schlafzimmer, das unnötig viel Platz raubte, und einer Kochecke im Wohnzimmer. Das Haus wurde möbliert vermietet und sah im Grunde noch immer so aus wie in den Fünfzigerjahren. Die auffälligste Neuerung war ein großer Fernsehbildschirm. Um ihn unterzubringen, hatte Jonas ein Fenster abdichten müssen. Das Haus im Wald hatte keinen Breitbandanschluss, aber er hatte sich ein Abonnement bei RiksTV gegönnt. Auf diese Weise hatte er immerhin über eine Dachantenne sechs Kanäle.
Jonas Abrahamsen sah viel fern.
Trank Kaffee und sah fern. Zudem war er eine Stunde pro Tag im Internet, jedoch niemals länger. Er musste sich über 3G einloggen, und das war teuer.
Die meiste Zeit über dachte er an Dina. Sie wäre jetzt gerade siebzehn geworden. Er stellte sich vor, wie sie jetzt aussehen würde. Fragte sich, ob ihre Haare, die feinen hellen Haare, die durch die Winterkleidung elektrisch aufgeladen wurden, noch immer so blond wären. Er träumte nachts von ihr, und immer häufiger ertappte er sich dabei, dass er mit ihr sprach. Sie wäre jetzt fast erwachsen und würde in einem Jahr Abitur machen. Natürlich konnte man unmöglich wissen, welche Ausbildung ein Kind, das nicht einmal drei Jahre alt geworden war, absolviert hätte, aber Jonas hatte sich für Landwirtschaft entschieden. Dina wäre auf die Landbauschule gegangen und hätte vielleicht einen Hoferben geheiratet.
Dina hatte Blumen so geliebt.
Ab und zu, aber immer seltener, dachte er auch an den Tag, an dem Anna gestorben war. Bei seiner Festnahme hatte er dermaßen unter Schock gestanden, dass er zwei Tage nicht hatte sprechen können. Wortwörtlich, seine Stimmbänder hatten gestreikt. Selbst als dieser Ermittler, der sich als Kjell Bonsaksen vorgestellt hatte, ihm ziemlich freundlich erklärte, dass er seine Lage verschärfte, wenn er keine Fragen beantwortete, konnte er kaum den Mund öffnen. Seine Kiefer verklemmten sich, Hände und Füße wurden taub, und er konnte achtundvierzig Stunden lang nicht schlafen. Schließlich bekam er Medikamente und war zu einer Aussage fähig, aber da war es zu spät.
Vermutlich hatten diese beiden Tage ihm acht Jahre Gefängnis eingebracht.
Sie schienen sich schon entschieden zu haben. Bonsaksen hatte die Zeit gut genutzt, während Jonas in Embryostellung in einer kahlen Zelle im Polizeigebäude gelegen hatte. Das begriff er dann bereits nach einer halben Stunde Vernehmung, als ihm ein kompromittierendes Indiz nach dem anderen vorgelegt wurde.
Nichts, was er sagte, konnte da noch etwas ändern.
Außerdem war das Erste, was aus seinem Mund kam, eine Lüge.
Er würde verurteilt werden, also gab er auf. Niemals würde er etwas zugeben, was er nicht getan hatte, aber sich für nicht schuldig erklären, das konnte er.
Die Tage und Wochen in Untersuchungshaft wurden schließlich durchaus angenehm. Vorhersagbar und vollständig ohne jegliche Verantwortung. Er konnte jede Nacht von Dina träumen und tagsüber leise mit ihr reden, damals noch immer mit der aufgesetzt kindlichen Stimme, die Dinas Großmutter für die sprachliche Entwicklung des Kindes für abträglich befunden hatte.
Heute sprach er zu ihr wie zu einer Erwachsenen.
Er könnte eine erwachsene Tochter haben, und die Sehnsucht nach ihr und die Trauer über ihren Tod hatten niemals nachgelassen. Ein Psychiater, den sie ihm aufgedrängt hatten, als der Tag seiner Entlassung näher rückte, fand seine Trauerreaktionen pathologisch. Allerdings sagte der Arzt ihm das nicht direkt, sondern starrte ihn in Grund und Boden, einen Kugelschreiber in der Hand, mit dem er nie etwas auf seinen leeren Block schrieb.
Zwei Jahre später hatte Jonas, ohne darum gebeten zu haben, per Post eine Kopie des Berichts erhalten. Dort stand schwarz auf weiß, dass Jonas nicht ganz gesund sei. Dass er gequält werde von »unkontrollierten, aufdringlichen Erinnerungen an die Tote, noch zehn Jahre nach dem Unfall«. Er lege einen »auffälligen Mangel an Interesse für anderes abgesehen von seiner Trauer« an den Tag, hieß es dort, neben einer Menge anderem Unfug, weshalb Jonas die Unterlagen sofort in den Ofen geworfen hatte.
Der Psychiater hatte garantiert keine Kinder. Bestimmt hatte er niemals jenes Glück empfunden, wenn man zum ersten Mal ein Neugeborenes in die Arme nahm, nur Sekunden alt und so schön, dass die Welt nie wieder dieselbe sein würde. Er konnte niemals den Duft eines frisch gebadeten einjährigen Kindes im Schlafanzug wahrgenommen haben. Und dieser verdammte Arzt hatte nie seinen allerliebsten Menschen in den Armen gehalten, als dessen Blick erlosch.
Der Arzt irrte. Die Schuldgefühle wegen Dinas Tod hinderten Jonas nicht am Leben.
Die Trauer um Dina war das Einzige, wofür es sich zu leben lohnte.
Die Trauer und die winzigen Augenblicke, in denen er sich segensreich schuldlos fühlte. Sie gaben Jonas Abrahamsen die Kraft, noch einen weiteren Tag zu leben, noch einen Monat und vielleicht noch ein Jahr: ewige Trauer und ein seltenes Aufflackern von glühendem Hass.
Samstag, 9. Januar 2016
Der Mord an Anna Abrahamsen, geborene Hansen, war von Polizei, Anklagebehörden und Gericht vorbildlich behandelt worden. Das hatte Henrik Holme schon zwei Nächte zuvor bei der ersten Durchsicht der Unterlagen sofort erkannt. Der scharfe Reflex auf Hanne Wilhelmsens Wohnzimmerfenster hatte ihn dennoch auf einen Gedanken gebracht, der ihn dazu veranlasste, den dicken Ordner übers Wochenende aus dem Büro mit nach Hause zu nehmen.
Jetzt war es vier Uhr nachmittags, und er hatte die fast fünfhundert Seiten abermals durchgesehen. Diesmal allerdings bedeutend gründlicher. Dabei schien alles auf der Hand zu liegen, das Verfahren hatte auch nur drei Tage gedauert und war beeindruckend gut dokumentiert worden.
Anna war zu Silvester 2003 ermordet worden.
Ob sie vor oder nach Mitternacht gestorben war, ließ sich nicht genau feststellen, denn sie war erst gegen Mittag am Neujahrstag gefunden worden. Die Rechtsmedizin hatte dennoch ermittelt, dass sie das neue Jahr wohl kaum noch erlebt hatte. Mit anderen Worten, der Todeszeitpunkt war wohl der spätere Abend, und da viele schon vor Mitternacht Feuerwerk zündeten, war es nicht verwunderlich, dass der Knall des Pistolenschusses hinter verschlossenen Türen nicht bemerkt worden war.
Die Tatwaffe hatte offenbar ihr gehört. Anna Abrahamsen hatte begeistert an Schießwettbewerben teilgenommen, ehe ihre einzige Tochter bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen war. Das Unglück hatte sich fast auf den Tag genau zwei Jahre vor dem Mord an Anna zugetragen. Das hatte Henrik am Donnerstag gar nicht registriert, da der Unfall in den Unterlagen nur am Rande erwähnt wurde, und zwar bei einer Aussage des Osloer Pistolenclubs. Dort hieß es, dass Anna dem Verein schon als Jugendliche beigetreten war und auch zwei Perioden im Vorstand gesessen hatte. Nach dem Tod ihrer Tochter hatte sie sich dann von allen Aktivitäten zurückgezogen. Erst vier Monate vor ihrem eigenen Tod tauchte Anna ab und zu wieder für eine Trainingsrunde auf.
An Wettbewerben nahm sie gar nicht mehr teil.
Das Kind wurde dann in der Urteilsbegründung noch einmal erwähnt. Der Verteidiger wollte den tragischen Todesfall als mildernden Umstand anführen, doch der Richter lehnte ab.
Anna Abrahamsen war durch einen Kopfschuss getötet worden.
Der Schuss war aus nächster Nähe abgegeben worden, hatte sie aber nicht sofort umgebracht. Die Munition war eine der weltweit am meisten verbreiteten, eine 9 mm Parabellum. Anna selbst hatte vier Schachteln dieser Patronen gehabt. Sie gehörten zu einer Glock 17, die sie neben drei weiteren Pistolen und einem Salongewehr besaß. Alle Waffen befanden sich in einem vorschriftsmäßig gestalteten und verschlossenen Schrank. Abgesehen von der Glock, die verschwunden war und niemals wiedergefunden wurde.
Die Polizei versuchte auf dem Schießgelände, das Anna am selben Tag besucht hatte, aus dieser Waffe abgeschossene Patronen zu finden, um einen ballistischen Vergleich vornehmen zu können. Das erwies sich jedoch aus mehreren Gründen als unmöglich. Es stand also nicht fest, dass Anna mit ihrer eigenen Glock 17 getötet worden war, schien jedoch wahrscheinlich.
Nur zwei Personen wussten, wo die Schlüssel zum Waffenschrank und zur verschlossenen Munitionsschublade aufbewahrt wurden.
Anna selbst – und Jonas.
Henrik nahm alle Unterlagen aus dem Ordner und sortierte sie nach seinem eigenen System. Die Urteile der beiden untersten Instanzen lagen ganz rechts auf dem Couchtisch. Daneben stapelten sich alle Vernehmungen, die in diesem Fall durchgeführt worden waren. Jonas Abrahamsen war fünfmal befragt worden, und zwar von dem damaligen Hauptkommissar Kjell Bonsaksen. Insgesamt elf Freunde, Nachbarn und Kollegen des Ehepaares waren in den Wochen und Monaten nach dem Mord ebenfalls vernommen worden, wie auch Annas Schwester Benedicte. Annas Eltern waren tot, andere Verwandtschaft gab es nicht. Dazu kamen die Aussagen von weiteren Nachbarn, darunter eine Gruppe von Gästen, die gleich nebenan Silvester gefeiert hatte. Die Party hatte angedauert, bis der erste Wiener Walzer des Neujahrskonzertes die schwankenden Gäste nach Hause getrieben hatte. Ein Besucher des Festes konnte einen äußerst interessanten Beweis liefern.
Dieser Beweis lag ganz oben auf einem Stapel neben den Vernehmungen, und Henrik Holme hielt den Ausdruck auf Armeslänge vor sich.
Die Gäste in Annas Nachbarhaus waren von der ungeduldigen Sorte gewesen und bereits eine gute Stunde vor Mitternacht auf die Terrasse geströmt. Ein junger Mann, der später in der Notaufnahme des Krankenhauses landete, nachdem er sich bei einem Sturz von ebenjener Terrasse den Arm gebrochen hatte, konnte am nächsten Tag und in nüchternerem Zustand der Polizei ein Foto zeigen, das er mit seinem Handy gemacht hatte.
Um 22.58 Uhr, wie das Display verriet.
Das Bild war ziemlich unscharf. Zum einen war das Wetter mit Nieselregen und Nebel nicht gerade optimal gewesen. Zum anderen schwenkte eine junge Frau mitten im Bild eine riesige Wunderkerze, weshalb der Rest der Aufnahme fast vollständig im Dunkeln lag. Zudem war der Fotograf sturzbetrunken gewesen.
Auf dem somit nicht ganz optimalen Foto konnte man dennoch gleich hinter der rechten Schulter der Frau eine Gartenlaterne sehen. Diese wurde später als Teil der Beleuchtung an der Auffahrt zu Anna Abrahamsens Villa identifiziert. Da die Frau auf dem Bild den Kopf zur Seite neigte und wirkte, als werde sie gleich stürzen, war unter der Laterne eine Gestalt zu erkennen. Ein Mann, wie es schien, auf dem Weg von dem Klinkerhaus über das kurze Straßenstück in Nordberg.
Das war Jonas Abrahamsen, wie eine genauere Analyse des Bildes dann ergab.
Schade, dass der Mann seine allererste Aussage bei der Polizei mit einer Lüge begonnen hatte, dachte Henrik und legte das Foto zurück auf den Tisch. Bonsaksen hatte gerade erst die Formalitäten hinter sich gebracht, als Jonas auch schon behauptete, zuletzt vier Tage nach Weihnachten einen Fuß in die Nähe des Stugguvei 2B gesetzt zu haben.
Neben allen Dokumenten von 2004 hatte Kjell Bonsaksen noch eine Zusammenfassung des Falles beigelegt, die seine Sicht der Dinge bot. Henrik hatte sie schon zweimal gelesen, griff aber dennoch zu dem Stapel ganz links auf dem Couchtisch und ging damit in die Küche. Er arbeitete lieber an dem kleinen Esstisch unter dem Fenster mit Blick auf die Straße unten, aber der Tisch war zu klein für so viele Unterlagen. Jetzt goss er Tee in eine große Tasse, die bereits dort stand, ehe er die Kerze in einem Weihnachtsleuchter anzündete, den seine Mutter ihm einige Wochen zuvor mitgebracht hatte. Er hätte den Leuchter am vergangenen Wochenende wegpacken müssen, aber ihm gefiel der muntere Weihnachtswichtel auf dem Schlitten. Er leistete ihm in gewisser Weise Gesellschaft.
Henrik las die Unterlagen zum dritten Mal.
Die Ehe von Anna und Jonas war vor dem Mord eigentlich schon beendet gewesen. Nur drei Tage zuvor hatte Jonas seine letzten Habseligkeiten abgeholt. Der Scheidungsantrag war im Herbst eingereicht worden, und in den letzten zwei Monaten hatte Jonas in einem gemieteten Zimmer in Grünerløkka gehaust.
Eine zerrüttete Ehe.
»Check«, murmelte Henrik.
Anna Abrahamsen hatte in Gütertrennung das Haus, eine Hütte in Hemsedal und einen Anteil an einem kleinen Bauernhof bei Arendal besessen, den sie als Sommerhaus benutzten.
Fast alles in Gütertrennung. Das Haus war ihr Elternhaus, und die Eltern hatten Anna und ihrer Schwester nach dem Verkauf des Familienunternehmens eine runde Summe überlassen. Allerdings mit Bedingungen. Gütertrennung war vorgeschrieben. Bei einer Scheidung würde Jonas mit leeren Händen dastehen. Dass er auch im Falle von Annas Tod alles verlieren würde, hatte er nicht wissen können.
Das Scheidungsgesuch war bereits am 28. Dezember bewilligt worden. Diese Mitteilung war Anna zugestellt worden und wurde im Laufe der Ermittlungen in einer Küchenschublade gefunden. Der nachgesandte Brief an Jonas war dagegen in der langsamen Weihnachtspost verschollen und tauchte erst wieder auf, als Jonas bereits in Untersuchungshaft saß. Das Motiv wirkte daher überzeugend, es ging um Geld, und dieses Motiv war schließlich so alt wie die Welt.
»Check«, sagte Henrik.
Lauter diesmal.
Nur wenige Tage nach dem Mord, als die Finanzen des Ehepaares überprüft wurden, entdeckte die Polizei, dass Jonas mehrmals Geld von dem gemeinsamen Sparkonto abgehoben hatte. Insgesamt hatte er während der vergangenen zwei Monate fast zweihunderttausend Kronen an eine lokale Bank in Westnorwegen überführt, an einen Ort, in den weder er noch Anna jemals einen Fuß gesetzt hatten.
Es bestand kaum Grund zu der Annahme, dass Anna von den Transaktionen gewusst hatte. DnB NOR, die eigentliche Bank des Paares, bedauerte, dass aus den Unterlagen nicht hervorging, ob die Überweisungen mit Annas Einverständnis getätigt worden waren, was eigentlich der Vorschrift entsprochen hätte.
Jonas hatte Geld seiner Frau unterschlagen.
Zudem hatte er die Polizei belogen, sowie er den Mund aufgemacht hatte.
»Check und check und doppelcheck«, seufzte Henrik resigniert.
Jonas Abrahamsen hatte nicht nur Grund genug gehabt, seiner Frau den Tod zu wünschen, er war zudem ein Dieb. Obendrein war er zur Tatzeit am Tatort gewesen und hatte das erst zugegeben, als der Beweis vor ihm auf den Tisch geknallt wurde.
Der Verteidiger hatte wirklich vor einer Herausforderung gestanden.
Henrik trank einen Schluck von dem glühend heißen Tee. Draußen war es bereits dunkel geworden. Henrik mochte den Winter nicht besonders, jedenfalls nicht hier in der Großstadt. Weniger wegen der Dunkelheit, die konnte durchaus gemütlich sein, sondern weil der ewige Matsch und der Regen das Gehen unbehaglicher machten.
Denn Henrik Holme war ein Wanderer. Er ging, um anzukommen und um zu denken. Vor allem jedoch ging er, weil er gern ging. Um seinen Körper zu benutzen. Ballspiele hatte er nie gemocht, und beim Joggen taten ihm die Knie weh. Seine schmale Gestalt, die herabhängenden Schultern und die selbst im Sommerhalbjahr blasse Haut vermittelten den Eindruck eines Mannes, der kaum je vor seine Tür trat. Weshalb die meisten nicht sahen, wie fit Henrik Holme war, so wie sie sich auch sonst häufig in der Einschätzung seiner Person irrten. Dabei war er hervorragend in Form und sehr sorgfältig bei der Verwendung von Sonnencreme, weil seine Mutter immer sagte, er habe zarte Haut.
Er ging auch im Winter, aber der Frühling war doch die beste Zeit, die er ausnutzte. Er liebte den Frühling. Dann würde er auch die Fenster putzen, dachte er, wie seine Mutter es immer getan hatte, sowie die tief stehende Märzsonne die Schmutzspuren entlarvte. Er ärgerte sich über seine Fenster, die sogar im Dunkeln sichtlich verschmiert waren. Im Winter wurden sie nie sauber, egal, wie sehr er rieb und polierte.