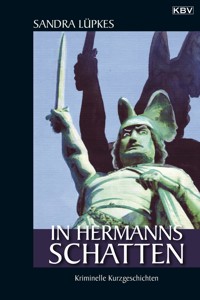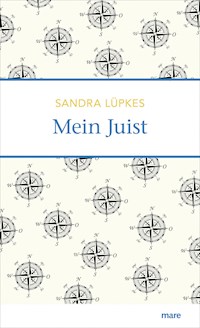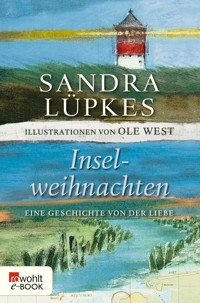9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein groß angelegter Gesellschafts- und Familienroman über die Revolution der Fotografie im 20. Jahrhundert. Bestsellerautorin Sandra Lüpkes erzählt die Geschichte der Leica, von der Zeit des geduldigen Tüftelns Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts bis zu ihrem Siegeszug um die Welt. Und davon, wie diese bahnbrechende Erfindung das Schicksal zweier Familien prägte, die bereit sind, alles zu riskieren. Ernst Leitz, der Sohn des Werkgründers, erkennt das Potenzial der Kamera – und treibt die Produktion der Leica gegen alle Widerstände voran. Die nächste Generation steht schon in den Startlöchern: Tochter Elsie hat das Zeug, die Firma zu übernehmen – aber die Brüder werden ihr vorgezogen. Als die Enteignung der Leitz-Werke durch die Nazis droht, bietet Elsie dem Unrechtssystem die Stirn. Auch Dana und Milan stehen vor dem Nichts: Als Kinder eines jüdischen Ladenbesitzers ist ihnen ein Studium verwehrt, das familiengeführte Geschäft wird geplündert. Aber die Kamera taugt auch als Waffe der Nazis im Krieg und als Währung der Juden im Exil. Und sie besiegelt das Schicksal von zwei Familien: Der Roman verbindet die Lebenswege der Industriellenfamilie Leitz aus Wetzlar mit denen einer fiktiven jüdischen Familie. Eine Geschichte von Mut und Scheitern, Leidenschaft und Missgunst, von Träumen und Verrat – hervorragend recherchiert und packend erzählt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 557
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Sandra Lüpkes
Das Licht im Rücken
Roman
Über dieses Buch
Niemand beachtet ihn. Ein schmächtiger Mann mit welligem Haar. Seinen Hut hat er in der Aufregung vergessen. Jetzt hebt er das Metallkästchen feierlich auf Augenhöhe, schaut durch den Sucher, zwingt sich zur Ruhe. Ein Knopfdruck, gefolgt von einem trockenen Klacken. Es ist das Geräusch, mit dem er den Augenblick einfängt. Keiner hat etwas bemerkt. Und doch ist nichts wie zuvor.
Sandra Lüpkes erzählt die Geschichte der Leica, von der Zeit des geduldigen Tüftelns Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts bis zu ihrem Siegeszug um die Welt. Und davon, wie diese bahnbrechende Erfindung das Schicksal zweier Familien prägte.
Ein Roman über mutige Visionen und bittere Enttäuschungen – zu einer Zeit, als Lüge und Wahrheit zu einer Frage der Perspektive wurden.
Vita
Sandra Lüpkes, Autorin zahlreicher Romane, Sachbücher und Drehbücher, verwebt leichthändig Authentisches und Fiktives zu großen Geschichten. Die Idee für diesen Roman ergab sich bereits bei ihren Recherchen zu dem Spiegel-Bestseller «Die Schule am Meer». Denn der Enkel des Firmengründers besuchte in den 1920er-Jahren das Inselinternat und verteilte die ersten Exemplare der Leica an Lehrer und Schüler. Fasziniert von der Sogwirkung der lebensnahen Fotografien, vertiefte sich Lüpkes in die Historie der Leitz-Werke – und die menschlichen Schicksale dahinter.
Impressum
Hinweis: Die Weltkarten in den einzelnen Kapiteln versinnbildlichen die Ausbreitung der Leica und erheben keinen Anspruch auf Präzision.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Juni 2023
Copyright © 2023 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Redaktion Susann Rehlein
Covergestaltung Cordula Schmidt Design, Hamburg
Coverabbildung Bernd Lohse/bpk
ISBN 978-3-644-01030-7
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Sara
Das Licht können wir nicht begreifen, und die Finsternis sollen wir nicht begreifen, da ist den Menschen die Offenbarung gegeben, und die Farben sind in die Welt gekommen, das ist: Blau und Rot und Gelb.
Philipp Otto Runge, Maler, 1777–1810
Wetzlar, Eisenmarkt, Frühjahr 1914
Die enge Gasse riecht muffig, weil die Märzsonne es nur selten bis in die letzte Ritze schafft und feuchte Flechten die Hausmauern violett tapezieren. Ein Klima, das Oskar auf die Lungen schlägt. Die Luft ist wie Kleister, zu zäh, um sie ohne Anstrengung wieder auszuhusten, Oskars Brustkorb bläht sich und schmerzt. Hoffentlich fangen seine Finger jetzt nicht das Zittern an. Das könnte er gerade gar nicht gebrauchen.
Niemand beachtet ihn. Ein schmächtiger, nervöser Mann mit großen runden Augen, einem schmalen Oberlippenbart und welligem Haar, das man sehen kann, da er als Einziger ohne Hut unterwegs ist. Den hat er tatsächlich vergessen in der Aufregung. Dafür hat er das Metallkästchen dabei, natürlich, er hebt es just in diesem Moment feierlich auf Augenhöhe und schaut durch den Sucher. Vom Dunklen ins Helle, so hat er es berechnet, bis auf die Zehntelsekunde genau. Um den optimalen Blickwinkel zu haben, macht Oskar einen Schritt nach links und übersieht das Mädchen im Schürzenkleid. Es springt zur Seite, Bündel von Krokussen verrutschen im Korb. «Entschuldige bitte», sagt Oskar, und das Kind dreht sich um, schaut ihn verwundert an. Ein Erwachsener, der um Verzeihung bittet.
«Möchten Sie ein Sträußchen kaufen? Zehn Pfennig das Stück. Ich sammle für Not leidende Kinder.»
Was soll er damit? Im Garten haben sie genug Blumen, und Emma bevorzugt sie im ungepflückten Zustand. Nun, vielleicht für die emsige Elsie, die Tochter vom Chef. Verdient hätte sie’s. Und er wird sie vermutlich gleich sehen bei der Präsentation im Haus Rosenburg. Also greift Oskar in die Jackentasche, wo er immer ein paar Münzen parat hält. Und dorthin steckt er dann auch die Krokusse.
«Nicht so lange dadrinnen lassen, sonst werden sie schlapp», warnt das Mädchen, bevor es weitergeht. Ein Frühlingslied summend. Unsre Wiesen grünen wieder … mmmhmmm … hell wie Gold und Purpur strahlet lichter Maienwölkchen Schaum …
Grün. Gold. Purpur. Dabei ist dies bloß der schwarz-weiße Eisenmarkt am Nachmittag. Ringsum der übliche Lärm, ausgelassenes Kinderspiel und ein mit Altmetallen vollgepackter Leiterwagen, der von zwei Kerlen mühsam über das ansteigende Kopfsteinpflaster gezogen wird. Ein Märznachmittag mit langen Schatten, die tief stehende Sonne scheint auf das Fachwerk der Alten Münz, streichelt den getünchten Putz, hebt schroff die dunkle Maserung der Eichenpfosten hervor, und am Giebel leuchtet matt das abblätternde Gold der Wappen.
Es heißt, im Sommer soll dort im Erdgeschoss eine Konditorei eröffnen, Eis und Kuchen. Als gäbe es nicht genug davon in dieser Stadt, wer soll denn bloß die ganzen Torten essen?
Oskar zwingt sich zur Ruhe. Was passiert schon groß? Ein Knopfdruck, gefolgt von einem trockenen Klacken, das er in den letzten Monaten schon oft gehört hat. Es ist ihm vertrauter als das «Guten Morgen» seiner Emma oder das «Der Vater ist wieder zu Hause» von Hanna und Conrad. Erst ein leises Schaben, dann ein metallenes Geräusch, eigentlich mehr klick als klack. Alles zusammen nur einen Wimpernschlag lang. Es ist das Geräusch, mit dem er den Augenblick ins Metallkästchen sperrt. Die auf dem Rücken baumelnden Zöpfe des Mädchens mit der Schürze und dem Korb voller Frühlingsblumen, die schnaufenden Männer mit dem Leiterwagen, den kleinen Jungen, der sich eben von der Hand des Kindermädchens losreißen will, um mit den anderen zu spielen. Hab euch! Für immer! Und keiner hat etwas bemerkt. Sie gehen weiter, reden weiter, spielen weiter, jemand ruft nach Herrn Gabriel, er solle schnell nach Hause kommen, seine Frau, es gehe los. Der Herr, der eben aus der Rasierstube getreten ist und zum Zeitpunkt des Klickgeräuschs entspannt an der Ecke gestanden hat, nimmt jetzt die Beine in die Hand und hastet Richtung Lahnstraße. Und schon ist das Bild ein ganz anderes, niemand ist mehr am selben Ort.
Oskar schiebt den Deckel zurück auf das Objektiv. Dreht am Transportknopf. Soll er es wagen und noch eine Aufnahme machen? Ach, warum nicht. Diese Menschen vor ihm auf dem Platz haben keine Ahnung, dass er sie gerade photographiert hat. Wie auch? Das Krokus-Mädchen wird nicht besonders wohlhabend sein, warum sonst würde es Blumen pflücken und feilbieten, es ist also womöglich noch niemals abgelichtet worden. Und die anderen, die vielleicht doch schon einmal eine Kamera gesehen haben, die Herren an der Ecke zum Beispiel, sie haben einen Photoapparat als klobigen Holzkasten in Erinnerung, wie der Photograph Trapp ihn benutzt, mit ziehharmonikaartigem Balg, vor dem man still halten muss, solange es geht.
Eine diebische Freude erfüllt Oskar ob dieser Heimlichkeit. Eigentlich ist das nicht seine Art. Oskar ist stets zurückhaltend. Wenn er doch mal das Wort erhebt, muss er erst die Peinlichkeit wegräuspern, den Berliner Dialekt, den eingeschränkten Wortschatz eines Bauernsohnes. Und auch die Atemnot, die seine Sätze gegen Ende hin leiser und monotoner werden lässt, als schliefe er beim Reden ein.
All das Gute, was ihm in den letzten Jahren widerfahren ist – dass es ihn in die Goethestadt Wetzlar verschlagen hat, er zum Leiter der Versuchsabteilung ernannt wurde, mit Dutzenden Untergebenen, die seinen Anweisungen folgen, mit einer Dienstvilla samt eigener Werkstatt und Garten in sonniger Hanglage –, das ist auf Zufall und Glück zurückzuführen und beileibe keinem forschen Ehrgeiz geschuldet.
Falls sie etwas geworden ist, die Photographie, dann wird dieser Märznachmittag am Eisenmarkt in Wetzlar darauf zu sehen sein, vielleicht noch in hundert Jahren. Und die Menschen werden sich fragen, was den Leuten wohl gerade durch den Kopf gegangen ist, wonach es roch, was man hörte, ob es warm war oder kalt.
Als Oskar sich zum Gehen wendet, blickt er nach unten, bemerkt, dass er auf einem Kanaldeckel gestanden hat. Wie gut. Sollte ihn mal jemand fragen, wo genau er an jenem Tag auf den Auslöser gedrückt hat, er würde Auskunft geben können. Das gefällt Oskar. Er mag es gern bis ins Klitzekleinste genau.
Wetzlar, Haus der Präsente, derselbe Tag
Die Mutter oben schreit.
Sie liegt in den Wehen. Milan hat keine Ahnung, was genau das bedeutet, aber er hat sich erkundigt: Bei ihm hat die Mutter auch drin gelegen, er war sogar eine sehr lange und schwere Geburt. Etwas ganz Besonderes.
Je größer Sachen sind und je mehr sie wiegen, desto teurer kann man sie verkaufen. Das weiß Milan, weil er oft im Laden hilft. Die silbernen Kerzenhalter in der Tischdekorationsabteilung drüben beim Schaufenster beispielsweise sind länger als sein Arm und massiv, er kann sie gerade mal anheben. Sie haben die Form nackter Frauen, die Teller auf dem Kopf tragen, und weil sie bereits eine Weile in der Auslage stehen, den Kunden aber offenbar zu teuer sind, laufen ihre Körper bräunlich an. Milan soll sie einmal in der Woche mit dem Tuch polieren, hat der Vater gesagt, doch er drückt sich davor. Mit Patina sehen die Damen wenigstens etwas angezogen aus.
Oben schreit wieder die Mutter. Aber das ist normal, hat Alma ihm erklärt. Die Schmerzen gehören dazu.
«Wünschst du dir ein Brüderchen oder ein Schwesterchen?», stellt ihm Alma die Frage, die ihm seit Wochen jeder Kunde gestellt hat, kaum tauchte die Mutter mit ihrem dicken Bauch hinter der Kasse auf. Alma müsste also die Antwort kennen, sie räumt als Aushilfe die oberen Regalfächer ein, seit die Mutter nicht mehr auf die Leiter steigen und schwere Sachen heben soll.
«Einen Kanarienvogel.»
Alma kreischt. Dann hat sie es wohl vorher doch noch nicht mitbekommen. Den Witz reißt Milan jedes Mal. Nein, der Junge, so ein Clown, und die Leute streicheln ihm begeistert über die hellbraunen Haare oder kneifen ihm in die Wange, was man eben so macht, wenn man ein Kind drollig findet.
«Du mit deinen Scherzen», sagt die Mutter. «Bist der beste Kundenmagnet, den man sich wünschen kann.»
So erntet Milan ein paar Lacher und kann sich gleichzeitig vor der Antwort drücken. Er lebt schließlich im Haus der Präsente. Der Laden ist zwar klein und sehr schmal, aber von oben bis unten zugestellt mit Dingen, die bei anderen Menschen auf der Wunschliste stehen.
Hier hat er tolle Sachen gelernt, beispielsweise wie man Seife herstellt. Seine Mutter siedet sie einmal im Monat in der Waschküche hinten im Hof neben dem Lahnpförtchen, durch das die Wetzlarer Kutscher ihre Gäule führen, um sie im Fluss trinken zu lassen. Weshalb es immer einen Wettkampf der Gerüche gibt: Pferdeäpfel gegen Gabriels schmeichelnde Blütenseife in den Sorten Veilchen, Rose und Flieder. Manchmal auch Lavendel, doch die sind schnell ausverkauft. Der Vater hat ihm beigebracht, Passepartouts zu schneiden für die Photographien, die es einzurahmen gilt, man muss aufpassen, das Messer ist rasierklingenscharf, und wenn man sich schneidet, versaut man das teure Papier. Außerdem kann Milan schon ein bisschen polstern und Gardinen drapieren, zumindest die wichtigsten Handgriffe beherrscht er ganz ordentlich. Aber am allerbesten sind seine Päckchen. Was die Kunden zum Verschenken gekauft haben, schlägt er in Seidenpapier ein und bindet eine schmucke Schleife drum rum. «Ein Künstler», sagt die Mutter stets. So vieles hat Milan im Geschäft seiner Eltern gelernt, obwohl er erst zehn Jahre alt ist. Doch was man ihm nie beigebracht hat, nie beibringen musste: das Wünschen. Warum auch? Ist ja alles da!
Die Ladenglocke geht. Der Vater stürmt herein.
Alma steigt aufgeregt von der Leiter. «Endlich! Hat mein Ulli Sie gefunden, Herr Gabriel?»
Der Vater antwortet mit einem knappen Nicken und stürmt zur Treppe, die hinter der Kasse steil nach oben führt. Die Mutter schreit. Man kann die Uhr danach stellen. Immer, wenn der kleine Zeiger einmal rum ist, geht’s los.
«Das Kind soll jeden Moment kommen, hat die Hebamme gemeint. Deshalb hab ich den Ulli gebeten, Sie zu suchen, Herr Gabriel. Ich wusste ja zum Glück noch, dass Sie zur Rasierstube gegangen sind», ruft Alma dem Vater hinterher. Fast ein bisschen beleidigt klingt das, und sie verschränkt die Arme unter ihrem mächtigen Busen, wahrscheinlich, weil sie kein besonderes Lob für den geistreichen Einfall bekommen hat, ihren arbeitslosen Verlobten zu schicken. «Wer hätte das gedacht, Herr Gabriel. Diesmal scheint es eine leichte Geburt zu sein.»
Nur eine leichte Geburt, denkt Milan. Was soll da schon Großartiges bei herauskommen.
Wenn Alma sich aufregt, kriegt sie feuchte Hände. Prompt rutscht ihr eine der teuren Kristallflaschen, die sie aus der Kiste voller Holzspäne holen und ins Regal räumen soll, durch die Finger, fällt zu Boden und kullert bis zur Ladentür.
«Pass doch auf!», schimpft Milan, denn solange Vater und Mutter dort oben mit der leichten Geburt beschäftigt sind, ist schließlich er hier unten der Chef.
«Ist nichts passiert.» Alma bückt sich ächzend, hebt die Flasche auf und schaut sich den Gegenstand wohl das erste Mal in vollem Bewusstsein an. «Noch nicht mal ein Sprung oder so. Ganz dickes Glas. Wozu sind die Dinger überhaupt da?»
«Das ist eine Vase siphoïde», erklärt Milan und rollt dazu noch ein bisschen die Augen, weil man das ja nun wirklich wissen sollte, wenn man hier arbeitet, davon geht sicher einmal die Woche ein Exemplar über den Ladentisch. Er zeigt auf das kleine Ventil, das am Flaschenhals sitzt. «Oben schraubt man so eine Patrone rein, die muss man aber extra kaufen, und dann sprudelt man das Wasser auf. Damit es beim Trinken auf der Zunge prickelt.»
«Wer braucht denn so was?» Alma schnaubt und erklimmt wieder die Leiter.
«Leitz der Zweite hat neulich auch eine davon gekauft.»
Alma kippt fast von der oberen Sprosse. «Ach, war er wieder hier?» Sie ist immer ganz von Sinnen, wenn Dr. Leitz erwähnt wird. Die Mutter sagt, Dr. Leitz sei der begehrteste Mann im Oberen Lahntal, reich und höflich. Für den würde Alma selbst ihrem Ulli den Laufpass geben. «Dabei hat er doch ein neues Hausmädchen», sagt sie. «Die Rosi könnte für ihn die Einkäufe erledigen.»
«Vielleicht kommt er ja deinetwegen», scherzt Milan, und Alma muss sich Luft zufächeln. «Oder Leitz stöbert einfach nur gern herum. Außerdem kennt er meinen Vater. Sie besprechen wichtige Sachen. Politik zum Beispiel!»
«Politik!», stöhnt Alma. «Damit kommt mir mein Ulli auch andauernd: im Westen die Franzosen, im Osten die Russen, und wir dazwischen eingequetscht wie in einer Schraubzwinge. Ich weiß nicht, was das soll. Wenn ich bloß drüber nachdenke, bekomme ich schlechte Laune.»
«Vater meint, solange wir friedlich und fleißig unserer Arbeit nachgehen, müssen wir uns nicht sorgen.»
«Soso, das meint Dr. Leitz wahrscheinlich auch. Soll ja ein Linker sein», macht Alma sich wichtig.
«Nun, wenn er hier bei uns zu Besuch ist, sitzt Leitz der Zweite mal links und mal rechts. Ich glaub, der kann beides.»
Alma kreischt wieder. Obwohl das ja eigentlich kein Witz gewesen ist. Eher eine Tatsache.
Die Mutter schreit. Besonders laut, aber nicht ganz so lange. Und dann schreit noch jemand.
Alma klatscht in die Hände. «Es ist da!»
Milan dreht sich um. Er muss noch die Eierschneider auspacken und einen davon ins Schaufenster neben der Tür legen, in dem die Küchenutensilien ausgestellt sind. Endlich mal eine sinnvolle Erfindung. Ein Gegenstand, von dem man gar nicht weiß, dass man ihn dringend benötigt, bis man ihn gesehen hat. Man legt ein hart gekochtes, gepelltes Ei in eine Kuhle, dann klappt man einen mit scharfen Drähten bestückten Metallrahmen herunter und erhält auf einen Schlag zehn schön schmal geschnittene Scheiben für ein Eibrot. Wenn man das Ei dann noch mal um ein Viertel dreht, schneidet man Würfel. Hoffentlich kommt ganz bald jemand herein und fragt, was denn das für ein Ding ist, dann kann Milan es dem Kunden erklären und verkaufen und …
«Milan!», ruft der Vater von oben. «Komm schnell rauf!»
Milan streicht über die Drähte. So ein toller Eierschneider, man kann sogar Musik damit machen, er klingt fast wie eine Harfe.
«Milan, nun komm. Schau dir deine kleine Schwester an.»
Alma nickt aufmunternd Richtung Treppe. «Na los, geh schon, Bruder.»
Ihm fällt auf, dass er heute noch gar nicht an der frischen Luft gewesen ist. Also schnappt Milan sich seine Kappe, die am Haken neben der Kasse hängt, und geht nach draußen.
Oben schreit die leichte Geburt.
«Wo willst du denn hin?», ruft ihm Alma hinterher.
Wetzlar, Haus Rosenburg, derselbe Tag
Da auf dem blank polierten Mahagonitisch, direkt vor Ernst Leitz dem Zweiten, in ein purpurnes Samtfutteral gebettet, liegt es wie ein Juwel: die Nummer 161.643, das erste Binokularmikroskop der Welt! Oder zumindest das erste, mit dem sich uneingeschränkt arbeiten lässt. Zum Verlieben schön ist es, findet er und lockert den obersten Hemdknopf. Die Rädchen und Röhren sind aus glänzendem Messing, poliert und zaponiert, der Korpus ist aus schwarz lackiertem Metall, an einer Seite sanft geschwungen, der Fuß stabil, in Hufeisenform. Man sieht der Mechanik an, dass sie funktionieren wird, dass das Verstellen von Höhe und Schärfe und Neigung reibungslos gelingt. Wie geschmiert, dennoch ganz ohne Vaseline, sondern einzig das Verdienst detailversessener Konstrukteure und penibler Feinmechaniker. Das Gehäuse ist perfekt. Der wahre Wert jedoch verbirgt sich im Inneren und ist seine Idee gewesen. Deswegen klopft ihm in diesem Moment das Herz.
Obwohl, genau genommen ist doch alles so wie immer, stellt er mit einem leisen Stich der Entzauberung fest. Die Sitzordnung im Saal von Haus Rosenburg wird stoisch eingehalten: Rechts am Tisch schielen die geladenen Wissenschaftler bereits nach den Brezeln, die nach altem Familienrezept gebacken werden und denen der Ruf vorauseilt, allein schon eine Reise nach Wetzlar wert zu sein. Links an der Fensterseite richten die Abteilungsleiter Jacketts, Stehkragen und Krawatten, die Uniform der Leitzianer, von niemandem vorgeschrieben, doch von allen selbstverständlich getragen.
Meister Barnack kommt auf den letzten Drücker, was sonst gar nicht seine Art ist, mit entschuldigendem Nicken zieht er einen freien Stuhl heraus und setzt sich. Seine Hände zittern leicht, sein Atem rasselt. Alles gut, signalisiert Barnacks Blick, kein asthmatischer Anfall, und der Zweite ist beruhigt. Rechenkünstler Max Berek und Zahlenjongleur Henri Dumur schieben noch ein paar Papiere hin und her, der eine ist der Herr über die technischen, der andere über die kaufmännischen Formeln. Heute bringen sie alles auf einen Nenner und werden die Anwesenden überzeugen, dass unterm Strich ein dickes Plus herauskommt. Für die Firma Leitz. Und für die Wissenschaft. Ein Vertreter der Universität Gießen, der die letzten Monate in unentwegtem Austausch mit Leitz dem Zweiten gestanden hat, zwirbelt angespannt die Enden seines nicht allzu üppigen Kaiserbarts. Daneben harren zwei Dozenten aus Frankfurt der Dinge, außerdem ein Gesandter der Charité in Berlin, dazu etliche Chemiker, Physiker und Biologen. Das geballte akademische Wissen aus den Hörsälen der Nation hat Platz genommen und wendet sich nun Ernst Leitz dem Ersten zu, der seinem Sohn am langen Besprechungstisch gegenübersitzt.
Leitz der Erste steht auf, begrüßt die Anwesenden und erhebt das Glas. Der Senior ist ein imposanter Mann. Leitz der Zweite ahnt, er wird sich immer ein Stück kleiner fühlen als der Vater, selbst wenn dieser irgendwann einmal krumm und schief am Stock gehen sollte. Nur ein einziger Mensch ist dem Vater je auf Augenhöhe begegnet. Und das war dessen Frau Anna. Vor sechs Jahren zu Grabe getragen.
Genau wie sein Vater ist auch Leitz der Zweite Witwer, mit seinen vierzig Jahren viel zu früh, nach dem Tod seiner … er mag nicht daran denken. Nicht heute, vor allem nicht hier, im Haus Rosenburg, wo das geschehen ist, was seither in Wetzlar als tragisches Unglück betitelt wird. Zumindest, wenn er zugegen ist. Was die Leute reden, sobald er ihnen den Rücken kehrt, mag er sich nicht ausmalen. Vielleicht sprechen sie von Schuld. Vielleicht haben sie auch Mitleid. Zumindest mit seinen drei kleinen Kindern – einer Tochter und zwei Söhnen –, deren Poltern oben in den Kinderzimmern bei mancher Sitzung deutlich hörbar ist; die nicht selten wichtige Termine unterbrechen, weil sie sich so schlimm gestoßen haben, dass ein Kindermädchen zum Trösten nicht reicht und nur das väterliche Taschentuch die Tränen trocknen kann. Ganz selten sind Irritation oder Vorwurf in den Blicken der Geschäftspartner auszumachen. Wer mit der Firma Leitz kooperiert, weiß, worauf er sich einlässt: ein Familienunternehmen, bei dem das Wort «Familie» mehr ist als Zierde. Er drückt den Rücken durch. Jetzt nicht. Gefühle sind heute fehl am Platz. Außer Stolz: der gesunde, warme, uneitle Stolz darauf, weltweit erfolgreichster Hersteller von Mikroskopen zu sein.
Die Gäste nippen schon am Glas, da ergreift Leitz der Erste wieder das Wort: «Auf dass durch dieses neuartige Mikroskop Welten entdeckt werden können, die der Menschheit bislang nicht zugänglich waren.» Die Anwesenden lassen die Gläser wieder sinken. Das könnte länger dauern. Der Erste holt gern ein bisschen aus, erinnert ausführlich an die Gründerjahre, seine Zeit am Reformierten Treppchen, später dann außerhalb der Stadtmauer im kleinen Häuschen am Kalsmunttor, Obstbäume ringsherum und vis-à-vis der Schützengarten, in dem es schon immer den besten Äppelwoi gegeben hat.
Für den Zweiten sind dies Kindheitsorte, verbunden mit Erinnerungen an seinen Bruder Ludwig, der eine Lücke hinterlassen hat, die für immer schmerzen wird. Im Geschäft und in der Familie. Trauer setzt sich einem schwer ins Genick. Eventuell sind sein Vater und er durch die Verluste, die sie erlitten haben, doch beide ein wenig geschrumpft, denkt Leitz der Zweite und nestelt an der Krawatte. Schluss jetzt! Dies ist doch sein Tag! Sein erster großer Triumph!
Der Vater macht gerade einen verbalen Ausflug in die einzelnen Werkstätten, dankt jedem Schreiner und Metallgießer und Lackierer und sogar dem Koch in der Kantine, weil ja ein solches Produkt nur zustande kommt, wenn alle an einem Strang ziehen. Deshalb tue man alles für das Wohlergehen der Arbeiterschaft. «Als Henry Ford Anfang des Jahres großspurig verkündete, in seinen Automobilwerken den Achtstundentag einzuführen, da haben die Zeitungen weltweit über den großen Mann im noch größeren Amerika geschrieben, dabei jedoch unterschlagen, dass wir es hier im kleinen Wetzlar schon seit acht Jahren so handhaben.»
Rosi, das erfreulich zuverlässige neue Hausmädchen, stellt die Tabletts mit den heiß ersehnten Brezeln auf den Konferenztisch. Er nickt ihr zu. Sie fängt seinen Blick auf und tritt zu ihm. «Ich hoffe, es reicht», flüstert sie. «Wir scheinen mal wieder ‹Mäuse› in der Speisekammer zu haben.»
Der Zweite unterdrückt ein Grinsen. Diese Kinder … «Was backen Sie auch immer so verlockend duftende Brezeln, verehrte Rosi. Selbst ich musste mich vorhin schon am Riemen reißen.»
Jetzt freut sie sich. Gott und die Welt kann Rosi loben, das perlt an ihr ab. Doch ein Kompliment vom Zweiten treibt ihr einen entzückend roten Hauch auf die Wangen. Wenn er wollte … Doch er will nicht. Zu gut weiß er, wohin das führen kann.
«Greifen Sie zu, greifen Sie zu!», fordert Leitz der Erste die Anwesenden auf. «Dann habe ich noch Gelegenheit, Ihnen zu erzählen …» Der Vater bekommt feuchte Augen, als er daran erinnert, wie er damals das tausendste Leitz-Mikroskop an den frisch Nobelpreis-geehrten Robert Koch aushändigte und fünf Jahre später dann Nummer tausendfünfhundert an Paul Ehrlich …
Einige nutzen den Moment, endlich wieder die Gläser zu erheben. «Auf die Firma Leitz!»
«Gut, gut, ich habe verstanden, meine Rede ist lang und trocken – und Sie haben Durst.» Allgemeines Lachen und Nicken und Gläserklingen. «Dennoch ist es mir ein besonderes Anliegen, auch meinem Sohn Ludwig zu danken. Wäre er vor zwanzig Jahren nicht so unsanft aus dem Arbeitsleben gerissen worden, gäbe es dieses binokulare System vielleicht schon längst.»
Betroffenheit in allen Gesichtern. Auch der Zweite senkt den Blick. Vier Jahre lang war der Bruder nach seinem Reitunfall dahingesiecht, sein Tod im Grunde eine Erlösung. Seitdem muss der Zweite allein die Erwartungen erfüllen, die ein Vater nun mal an seine Söhne hat.
Doch das ist viel zu lange her, um sich davon herunterziehen zu lassen. Also erhebt der Zweite sich und ergreift das Wort: «Aber nun steht es ja vor uns: ein Mikroskop, durch das Sie mit beiden Augen gleichzeitig schauen können, ohne Unschärfen und unterschiedliche Lichtverhältnisse. In den kommenden Wochen werde ich nach Übersee reisen, um unsere dortigen Geschäftsfreunde mit dem neuen Produkt vertraut zu machen.» Ein Raunen geht durch den Saal, wie immer, wenn der Begriff Übersee fällt. «Ein wichtiger Schritt in die Zukunft! Und diese Zukunft liegt – weil es ja bereits einen Ernst den Dritten gibt – Gott sei Dank sicher in den Händen der Familie Leitz.»
Der Zweite hält das Glas in den Händen. Er hebt es an.
Jemand flüstert: «Und einen Ernst den Dreieinhalbten gibt es auch schon.» Unterdrücktes Lachen. Aber vielleicht hat der Zweite sich das auch nur eingebildet.
Er atmet tief durch, setzt das Glas an die Lippen und nimmt einen großen Schluck. Und dann noch einen.
Wetzlar, Schleusenbrücke, derselbe Tag
Elsie hat die Speisekammer geplündert. Wacholderschinken, Heidelbeerkompott, eine Flasche Milch und eine mit saurer Limonade. Zudem konnte sie nicht widerstehen, drei frisch gebackene Brezeln mitzunehmen. Zwei für sich und eine zum Abgeben.
«Wie lange genau bleibst du weg?», fragt Julie nach einem skeptischen Blick auf den Proviant.
«Das weiß ich noch nicht.» Elsie will gerade die karierte Decke auf dem Rasen ausbreiten, doch dann stellt sie fest, dass die Stelle viel zu gut einsehbar ist. Sollte ihr Vater die Suchtrupps losschicken, brauchen die nur einmal über die Brüstung der Schleusenbrücke zu schauen, und schon haben sich alle Pläne zerschlagen.
Dazu müsste der Vater jedoch erst einmal ihr Fehlen bemerken. Heute ist das Haus voller großer Männer mit lauten Stimmen und breiten Rücken. Die keilen den Vater ein und vernebeln mit ihrem Zigarrenqualm auch noch die Sicht. Normalerweise schleicht sich Elsie trotzdem in den Saal und gibt ihrem Vater einen Gutenachtkuss. Ob der das überhaupt mitbekommt?
Vielleicht wird sie auch erst morgen beim Frühstück vermisst. Doch da toben Elsies Brüder über Tische und Bänke, zerbröseln das Brot, kleckern mit Kakao, verschmieren die Konfitüre. Sobald die Jungen zur Schule aufgebrochen sind, könnte auffallen, dass niemand das Chaos beseitigt. Der Vater wird nach Rosi rufen – und die putzt schnell alles sauber, ohne zu erwähnen, dass normalerweise Elsie allmorgendlich diese Aufgabe übernimmt. Es kann also dauern, bis irgendjemand gewahr wird, dass sie fortgelaufen ist.
Elsie entscheidet sich für einen Platz unter dem steinernen Bogen und breitet dort die Decke aus. Es ist klamm und deutlich kühler als auf der von der späten Märzsonne beschienenen Wiese am Kanal, aber das hier ist schließlich kein Picknick. «Vielleicht ist es ein Abschied für immer.»
«Dann esse ich lieber nichts davon», verkündet Julie. «Mit dem bisschen überlebst du allerhöchstens zwei Tage.»
Elsie seufzt. «Mehr ging nicht, sonst wäre mein Rucksack zu voll gewesen, und Rosi hätte mich gefragt, was drin ist, und dann …»
«Ich verstehe», sagt Julie. Das ist das Wunderbare an ihrer neuen Freundin: Sie hört zu, sie versteht, sie macht einem keine Vorwürfe, und vor allem erteilt sie keine klugen Ratschläge. Einziger Nachteil: An ihrer Seite wird Elsie noch unsichtbarer als ohnehin schon. Denn Julie ist nicht nur älter, sondern außerdem besonders hübsch mit ihren honigblonden Zöpfen, den hellgrünen Augen, den Sommersprossen, die sich jetzt im März noch nicht zeigen, aber ein paar sonnige Wochen später um ihre Nasenspitze tanzen werden. Elsie hingegen hat Haare wie Stroh, sowohl in Farbe als auch Beschaffenheit. Blassblaue Augen. Blassrosa Haut. Wäre Elsie nicht die mit Abstand Klassenbeste, würde selbst die Lehrerin sie beim Morgenappell glatt übersehen. Ach ja, und wäre Elsie nicht die Tochter von Leitz dem Zweiten. Das allein reicht in Wetzlar aus, um von allen Seiten begafft zu werden wie ein Menschenaffenjunges im Frankfurter Zoo.
Elsie schaut sich um. Etwas weiter hinten, direkt am Brückenpfeiler, liegt ein einzelner ausgetretener Schuh neben einer Weinflasche. Es riecht eklig. Sie ist anscheinend nicht die Erste, die hier ihr Nachtlager aufschlagen will.
Julie schaudert. «Du bleibst dabei?»
Elsie nickt.
«Aber es sieht nach Regen aus.»
Elsie winkt ab. Es gibt keinen anderen Ausweg. Der Vater hat es ihr einfach so hingeklatscht. Er und Hedwig werden für mehrere Wochen nach Amerika reisen, und wenn sie zurückkommen, ziehen sie alle bald um in eine Villa, die er gerade bauen lässt, weil es einen Neuanfang geben soll nach den traurigen Jahren und weil doch Haus Rosenburg zu sehr an die Mutter erinnert, die ja Hedwigs beste Freundin gewesen ist, außerdem wünsche Hedwig, die gern Klavier spielt, sich ein Musikzimmer. So viele Gemeinheiten in nur einem einzigen Satz. Elsie jedenfalls holte mehrfach Luft, um etwas zu erwidern. «Aber Paps …» Sie war nicht gegen ihn angekommen, konnte nicht fragen, ob das wirklich nötig sei, mit der langen Reise und dem neuen Haus und der Klavier spielenden Hedwig. Aber die Sätze kamen erst nicht an Vaters Bandwurmsatz vorbei und dann nicht am Kloß in Elsies Hals. Schließlich endete der Vater mit: «… bald gehst du ja sowieso auf die höhere Schule, Elsie. Ich hörte von einem Landschulheim in Thüringen, in Wickersdorf, in dem du tanzen und singen kannst. Dort wirst du dich wohlfühlen, versprochen.»
Wickersdorf? Nach einer scheußlich langen Minute des Schweigens hat Elsie viel zu piepsig gefragt: «Aber Ernst der Dritte und der Ludi dürfen bleiben?»
«Sie übernehmen doch später die Firma, da müssen Sie lernen, wie es läuft.»
«Ich könnte die Firma übernehmen.»
«Du?» Der Vater hat sie angeschaut. Ganz ohne ein Lächeln. «Das kannst du sicher, Elsie. Daran habe ich nicht den geringsten Zweifel. Allein, es würde dich nicht glücklich machen.»
Von Mikroskopen versteht er vielleicht etwas, der Vater, von Linsen und Okularen. Aber vom Glück seiner Tochter hat er keinen blassen Schimmer. Jedenfalls hat Elsie am Abend nach ein bisschen Rumgeheule (für das sie sich genierte, obwohl es keiner mitbekam) entschieden, ihr Glück selbst in die Hand zu nehmen. Sie ist zehn Jahre und drei Monate alt. Manche mögen denken, ein bisschen zu jung. Aber sie hat in allen Schulfächern ein Sehr Gut. Und hat ihr Sparschwein geschlachtet. Nur den Familiennamen wird sie verschweigen müssen auf ihrer Reise ins Ungewisse. Die Menschen wüssten sofort, wohin sie zurückzuschicken wäre.
Elsie setzt sich. Der Boden ist hart, aber das wird sie überleben. Julie bleibt lieber stehen. Sie zieht einen kleinen Stoffbeutel hervor, den sie Elsie mit feierlicher Geste reicht. «Ich habe was für dich.»
Es klimpert im Beutel, Elsies Finger ertasten ein paar Münzen. «Geld?»
Julie nickt. «Unser Garten steht voller Krokusse. Die hab ich gepflückt, gebunden und am Nachmittag auf dem Eisenmarkt verkauft. Fast zwei Mark sind dabei herausgekommen.»
Elsie klopft auf den Platz neben sich, und als Julie sich gesetzt hat, legt Elsie den Arm um ihre neue, ihre beste, ihre allerbeste Freundin. «Danke!»
«Ich mach mir Sorgen um dich.» Julie wischt sich die Augen mit dem Zipfel ihrer Schürze trocken. «Wenn mich jemand fragt, wo du steckst, Elsie, soll ich dann lügen?»
«Nein, dazu mag ich dich nicht auffordern. Sag ihnen, du hast beim Grab meiner Mutter schwören müssen, nichts zu verraten.»
«Beim Grab deiner Mutter?» Julie verzieht das Gesicht. «Das ist ja scheußlich!»
Das stimmt. Das Grab ihrer Mutter ist scheußlich. Auf dem Friedhof oberhalb der Stadt liegt ihr Sarg neben denen vom Onkel und der Großmutter. Zwei verhüllte Steingestalten beweinen die Namen, die unter ihnen eingraviert sind. Wenn sie dort ist, hat Elsie jedes Mal Angst, dass es vielleicht doch etwas Ansteckendes gewesen ist, was ihr die Mutter nahm, so plötzlich, von einem Tag auf den anderen, und alle haben sich weggedreht, sobald Elsie Fragen gestellt hat. Es muss eine furchtbare Krankheit gewesen sein, sonst hätte die Mutter doch darum gekämpft, am Leben zu bleiben, bei ihren Kindern, bei Elsie. Wenn sie nun selbst auch an dieser Krankheit sterben würde, würde man auch ihren Namen in den Stein unter den weinenden Gestalten meißeln.
«Du musst es mir schwören, Julie. Bis morgen Mittag hältst du dicht!»
«Warum bis morgen Mittag?»
«Bis dahin bin ich über alle Berge.»
«Wo willst du denn hin?»
Elsie zuckt mit den Schultern. Vielleicht wird das Schicksal sie in ein Kloster führen, wo sie als Nonne den Armen und Kranken in ihrer Not hilft. Vielleicht wird sie auch von einem Bauernehepaar aufgenommen und sich auf dem Feld die Hände blutig arbeiten für ein karges Lager im Heu und eine wässrige Suppe. Oder an Bord eines Atlantikdampfers als Küchenmädchen … Elsie schluckt die Tränen runter. Jedenfalls wird es besser sein, als mit dem Vater und den kleinen Brüdern in diese neue Villa zu ziehen, in der Hedwig ständig Klavier spielt.
«Geh bloß nicht nach Frankfurt. Dort herrscht das Verbrechen», warnt Julie und bricht sich nun doch ein Stück von der Brezel ab. Man kann es ihr nicht verübeln, Rosi backt sie mit Laugenkruste. Sie sind noch lauwarm und duften.
Beide kauen an ihren Brezeln und schweigen. Eine Sonnenspiegelung tanzt auf den Wellen des Schleusenkanals, dann schieben sich Wolken dazwischen. Die letzten Strahlen blinken auf wie eine Glühbirne, kurz bevor sie durchbrennt. Der letzte Tag in ihrer Heimat, denkt Elsie, er fängt an, zu Ende zu gehen.
Plötzlich hören sie eilige Schritte wie von einem, dem jemand auf den Fersen ist. Elsie versucht, sich nicht anmerken zu lassen, wie beängstigend sie das findet. Das Keuchen, das Hasten, vor allem das Näherkommen.
«Was machen wir jetzt?», fragt Julie ängstlich.
«Verkriechen wir uns erst mal in die dunkle Ecke.»
«Dahin, wo der Schuh liegt?»
«Da sieht uns keiner.»
«Es sei denn, der Besitzer des Schuhs kommt, ihn zu holen.»
«Red keinen Unsinn, das würde man hören, wenn er auf einer Seite barfuß liefe.»
Sie ducken sich unter die Brücke. Der Uringestank verschlägt ihnen den Atem. Das Leben auf der Straße stellt sich gerade in seiner ganzen Unbarmherzigkeit vor.
Die Schritte werden langsamer. Eine Gestalt tritt vom Hellen in die Dämmerung unter der Brücke. Glücklicherweise keine besonders große Gestalt und auch nicht bucklig wie der Bösewicht aus dem Groschenroman über Mädchenhändler, aus dem Hausmädchen Rosi neulich in der Mittagspause einen Absatz vorgelesen hat. Der Vampir von Montecarlo, da hat ein Eindringling der schlafenden Frau eine mit Chloral gefüllte Spritze … aber nein, hier ist nicht Montecarlo, sondern Wetzlar, und Vampire gibt es nicht.
«Elsie?» Ein Ruf hallt von den Wänden wider.
Julies Hand krallt sich in Elsie Arm. «Die suchen dich schon!»
Das kann nicht sein, denkt Elsie. Das ist viel zu früh. Die Domuhr hat noch nicht einmal sechs geschlagen. Der Großvater hält bestimmt noch eine seiner ewig langen Reden, und danach stoßen sie erst mal an. Auf das neue Binokularmikroskop. Ein Wort, das man auswendig lernen muss. Der Vater hat versucht, ihr zu erklären, wie es funktioniert, irgendetwas mit Prismen und Strahlenteilung, was immer das auch sein mag. Das Ding werden sie jedenfalls gerade alle ausgiebig bestaunen. Deswegen hat Elsie ja genau diesen Abend zum Ausbüxen gewählt.
«Elsie, bist du hier?» Der Stimmlage nach handelt es sich eher um einen Jungen in Elsies Alter. Womöglich hat er den Rucksack erkannt, der noch auf der Decke liegt, rot-blau kariert, den hat sie manchmal bei Ausflügen dabei. Das war dumm, alles vor der Brücke liegen zu lassen. Zwecklos, sich länger zu verstecken. Vielleicht hat sie Glück und Wer-immer-das-auch-sein-mag verpetzt sie nicht. Also tritt sie aus dem Schatten. «Hier bin ich.»
Es ist bloß Milan Gabriel. Ihre Väter kennen sich durch die Politik, die Gabriels waren öfter zu Besuch, als die Mutter noch lebte. Da waren Elsie und Milan aber noch klein gewesen und hatten zusammen Blinde Kuh gespielt. Wenn er lacht, hat er niedliche Grübchen links und rechts. Und er lacht oft. Vielleicht war sie damals sogar ein bisschen verliebt in ihn. Inzwischen ist Elsie aber zu alt für so was und findet Julies Bruder Gustav viel interessanter, weil der so musikalisch ist. Ehrlich gesagt ist Gustav sogar der Anlass gewesen, sich mit Julie anzufreunden. Nun, wo sie fortgehen wird, macht das natürlich keinen Sinn mehr, und die Liebe zu Gustav Schlemm wird für immer unerfüllt bleiben.
«Was machst du hier?», will Milan wissen.
«Könnte ich dich auch fragen», sagt Elsie.
Sie stehen voreinander, wer zuerst blinzelt, verliert. Und Elsie hat heute alle Zeit der Welt.
Wetzlar, Haus Rosenburg, derselbe Tag
Draußen geht gerade ein ordentlicher Guss runter, der Regen klatscht gegen die Scheiben. Es ist schon nach neun, und Oskar würde wirklich gern gehen. Nachdem jeder der Anwesenden einmal durch die Okulare geschaut hat, ist man längst zum feuchtfröhlichen Teil übergegangen. Das Mikroskop ist inzwischen umzingelt von geöffneten Sektflaschen und übervollen Aschenbechern. Zigarrenqualm stößt gegen den Stuck an der Decke, mäandert die vergoldeten Bilderrahmen und samtenen Vorhänge entlang, dringt in jede Ritze, in Oskars Mund und Nase, in Oskars Bronchien. Es ist nicht zum Aushalten.
Die Brezeln reichen vorn und hinten nicht. Das Hausmädchen muss improvisieren, kredenzt notgedrungen hart gekochte Eier mit Senf und saure Gürkchen. Leitz der Zweite hilft aus, gerade trägt er eilig ein leeres Tablett Richtung Küche. «Haben Sie zufällig meine kleine Elsie gesehen?», fragt er Oskar im Vorbeigehen. «Sie schleicht sich normalerweise immer kurz rein und gibt mir einen Gutenachtkuss.»
Oskar schüttelt den Kopf. «Sie wird sich nicht in den Saal getraut haben. So viele fremde Leute.»
«Da kennen Sie Elsie aber schlecht», lacht Leitz der Zweite. «Wir hatten einen kleinen Streit, müssen Sie wissen. Meine Tochter ist nicht ganz einverstanden, dass ich mit meiner zweiten Frau nach Amerika reisen werde. Und Elsie neigt zu einer gewissen Theatralik.»
Oskar will die Gelegenheit nutzen und dem Junior folgen, aber einer der Wissenschaftler verstellt ihm den Weg und fragt, ob das neue Mikroskop mit einer Photokamera gekoppelt werden könne, damit Forschungsergebnisse nicht mehr mühselig von Hand abgezeichnet und nachkoloriert werden müssen. In Oskars Hirn bringt diese Frage die übliche Kaskade an Ideen zum Sprudeln, doch mit konkreten Ausführungen würde er seinen leicht angetrunkenen Gesprächspartner wohl überfordern, also sagt er nur: «Wir arbeiten daran» – und entschuldigt sich. Im Flur lehnt er sich gegen das geöffnete Fenster. Endlich frische, regensatte Luft!
Feiern können die Leitzianer, dafür sind sie mindestens genauso bekannt wie für ihre Mikroskope. Veranstaltungen wie diese sind jedoch nicht Oskars Sache, und seine Emma wird ihm Vorwürfe machen, weil er sich zu wenig schont. Gerade jetzt im Frühjahr, wo es immer schlimm wird mit seinem Asthma, ist Zigarrenqualm Gift für ihn. Seit sieben Uhr früh tüftelt er in der Werkstatt, unterbrochen nur von dem kleinen Ausflug zum Eisenmarkt. Gegessen hat er auch kaum etwas. So gut kann ein Arbeitgeber gar nicht sein, dass man seine eigenen Bedürfnisse dermaßen hintanstellt. Das alles wird Emma ihm heute Abend freundlich, aber bestimmt mitteilen. Oskar wird ihr hoch und heilig versprechen müssen, dass er sein unvernünftiges Verhalten in Zukunft ändert – und sich keinen einzigen Tag lang daran halten. Es ist nicht die Zeit, sich zu schonen. Und das mit der Entspannung ist unmöglich, nachdem er vorhin die Photographien in den Händen hielt, die er mit dem Metallkästchen in der Gasse aufgenommen hat. So lange hat er davon geträumt, hat es sich zigmal vorgestellt und hart dafür gearbeitet. Aber dann haut ihn das Ergebnis beinahe aus den Schuhen, und er wünscht, er könnte sich selbst vor zehn Jahren etwas zurufen, dem jungen Feinmechaniker-Gesellen, der sich am Hang einer Hochebene den Schweiß von der Stirn wischte, auf die Scherben einer Glasplatte starrte, frustriert schnaufte und glaubte, den Abstieg nicht mehr zu schaffen.
Damals hatte er tatsächlich da gestanden, der weiße Hirsch, trinkend im Schatten der Buchen. Ein prachtvoller Zwölfender, jede Sehne unter dem übernatürlich hellen Fell zeugte von Kraft und Beweglichkeit. Mit schnellem, fast elektrisch anmutendem Zucken verscheuchte er die Mücken. Spinnweben, in denen sich die Morgensonne verfangen hatte, funkelten in seinem Geweih. Oskar war so nah dran, dass er den Geruch des wilden Tieres in der Nase hatte. Der legendäre weiße Hirsch der Wöllmisse, den wie durch Zauberei jede Gewehrkugel bislang verfehlt hatte. Genau der stand zehn Armlängen entfernt. Vor Oskars Kamera.
Er war an seinem freien Tag ganz früh von Jena aus aufgebrochen, um die gesunde Luft bei Sonnenaufgang einzuatmen und auf der Hochebene seinem liebsten Steckenpferd zu frönen: der Photographie. Die Arbeit bei Zeiss hatte ihn darauf gebracht. Und obwohl der Spaß eigentlich viel zu teuer und die Ausrüstung viel zu schwer für einen kurzatmigen Asthmatiker wie ihn war: Längst konnte er nicht mehr anders, als die Schönheit der Welt in zwei Dimensionen einzufangen. Nicht ahnend, dass er gleich dem sagenhaftesten aller Motive gegenübertreten würde, hatte Oskar an diesem Morgen bereits fünf seiner Glasplatten belichtet. Mit belanglosen Muschelkalkformationen, Sommerwurzblüten und einem im Brombeerstrauch brütenden Zilpzalp. Nun war nur noch eine Platte übrig, und dann das! Er japste. Der Aufstieg den Steilhang entlang mit dem ganzen schweren Kram im Rucksack war eine Tortur gewesen. Seine Hände zitterten, als er nach der letzten Glasplatte griff. Eine falsche Bewegung, und der Hirsch hätte ihn bemerkt. Doch stets, wenn Oskar sich besonders fest vornahm, keinen Anfall zu bekommen, traf es ihn besonders hart. Und so wurde sein Hals immer enger, die Brust wie von einer brutalen Faust zerquetscht, das Herz schlug in höchster Frequenz um Hilfe. Bis ein befreiender Husten aus ihm herausbrach. Die Platte fiel herunter, ihr Zerschellen echote bis zur nächsten Felswand und zurück. Und der weiße Hirsch war verschwunden. Wenn er überhaupt je da gewesen war. Glauben würde man ihm diese Begegnung jedenfalls nie ohne Beweisbild.
Man müsste, dachte Oskar damals – Mechanikern liegt es im Blut, ständig an Dinge zu denken, die es noch nicht gibt –, man müsste eine Kamera haben, die leicht ist und klein, die man in Momenten wie diesem einfach aus der Tasche zieht, um dann auf einen Knopf zu drücken, einmal, zweimal, zigmal hintereinander, und dann hat man den weißen Hirsch im Kasten. Das wäre was!
Auf dem Rückweg hatte Oskar schon über jenes Material nachgedacht, mit dem derzeit Filme gedreht wurden, beschichtetes Zelluloid, hauchdünn und leicht, lediglich fünfunddreißig Millimeter breit, doch mit dem richtigen Projektor ergaben sich durchaus passable Bilder auf den riesigen Kinoleinwänden. Da müsste man mal …
Leitz der Zweite balanciert einen voll beladenen Teller Mettwürste aus der Küche, und Oskar nutzt die Gelegenheit: «Haben Sie eventuell einen Moment für mich?»
«Aber immer doch», sagt der Zweite, stellt das Tablett auf der kleinen Nussbaumkommode ab, nimmt zwei Würste und reicht Oskar eine davon. «Sie haben noch keinen Happen gegessen, Meister Barnack. Glauben Sie nicht, das bliebe unbemerkt, wenn unsere besten Leute kurz vorm Verhungern sind.»
Oskar beißt artig in die Wurst, auch wenn er lieber gleich zur Sache gekommen wäre.
«Eine gelungene Präsentation, finden Sie nicht?», fragt Leitz der Zweite kauend.
Oskar nickt. Er hat nicht den Mut, mit vollem Mund zu sprechen, die Mettwurst klebt ihm unangenehm zwischen den Schneidezähnen.
«Doch ein bisschen enttäuscht bin ich schon», fährt der Zweite fort und lehnt sich gegen die Kommode. «Verraten Sie es bitte niemandem, Meister Barnack. Aber ich hatte eigentlich ein Triumphgefühl erwartet. Endlich ein erfolgreiches Projekt, das auf meinem Mist gewachsen ist. Doch dann, während der Rede meines Vaters, wurde mir klar, dass die Firma Leitz auf dem Gebiet der Mikroskopie bereits alles geleistet hat und diese Nummer 161.643 eigentlich nur eine logische Folge ist, mehr nicht.»
Oskar hält sich verschämt die Hand vor den Mund, als er sagt: «Stellen Sie Ihr Licht nicht unter den Scheffel. Die Idee mit den Prismen und der Strahlenteilung …»
«Sie können ruhig ehrlich sein, Meister Barnack. Sie sind Mechaniker durch und durch, Sie wissen um die logischen Abläufe in einem funktionierenden System. Ihre unerbittliche Intelligenz war schließlich der Grund, weshalb mein Vater Sie damals bei Zeiss abgeworben hat.»
Oskar mag es nicht, wenn man ihn lobt. Er ist doch bloß ein kränklicher Mann, in dessen Werkstatt sich Hunderte nahezu unleserlicher Notizzettel stapeln, bevor sich kleine Dinge zu einem großen Ganzen zusammenfügen lassen. Also räuspert er sich nur und hofft, der Zweite würde endlich Ruhe geben.
Doch der hat sich gerade erst warmgeredet. «Sie, Meister Barnack, durchschauen doch, dass meine soeben gefeierte Erfindung nicht mehr ist als die konsequente Weiterführung der Berechnungen, die von meinem Vater und meinem Bruder längst angestellt wurden.»
Was soll Oskar darauf entgegnen? Es ist schon was Wahres dran.
Der Zweite seufzt. «Könnte ich doch nur etwas wirklich Neues, Eigenes, Großartiges …»
Der Moment ist so haargenau der richtige, eine Steilvorlage, dass Oskar sich nicht mehr beherrschen kann und dem Zweiten gnadenlos ins Wort fällt: «Eine Kleinfilmkamera!»
«Ich weiß, Barnack, daran tüfteln Sie schon eine ganze Weile, aber …»
Oskar holt das Bild aus der Brusttasche und legt es neben das Wursttablett. Der Zweite wischt seine Finger an der Hose ab, greift vorsichtig nach der Photographie und hält sie ins Licht. «Der Eisenmarkt. Sehr schöne Aufnahme. So lebendig! Ach, schauen Sie, dahinten, ist das nicht mein Freund Anton Gabriel? Wie ich hörte, ist er heute zum zweiten Mal Vater geworden, wussten Sie das? Ein gesundes Töchterchen …»
«Herr Leitz, dieses Bild ist …»
«Apropos Töchterchen, da vorn, das Mädchen mit den Zöpfen, ich könnte schwören, es ist Julie Schlemm, Elsies neue Freundin, ein bildhübsches Kind. Was hat sie da im Korb? Das sind Blumen! Man kann alles ganz hervorragend erkennen. Als wäre man mittendrin.»
«Also, Herr Leitz, was ich Ihnen eigentlich erklären will …»
Der Zweite dreht und wendet das Bild. «Verraten Sie mir, wie Sie diese Menschen dazu bekommen haben, derart natürlich zu posieren? Niemand schaut in die Kamera oder lächelt übertrieben. Es hat doch bestimmt eine Ewigkeit gedauert, bis Sie den Auslöser drücken konnten.»
«Höchstens eine Sekunde!»
Der Zweite lässt die Photographie sinken. «Sie scherzen.»
Oskar holt das Metallkästchen aus seiner Jackentasche. «Ich nenne sie Liliput.» Leider kleben die verendeten Krokusse an der Unterseite, was diesen Moment, der durchaus hätte feierlich sein können, etwas verdirbt. «Oje, die hatte ich eigentlich für Elsie mitgebracht», sagt Oskar und legt die schlappen Blümchen neben das Tablett. Er will die Kamera wieder einstecken, doch der Zweite nimmt sie ihm ab.
«Wirklich? Damit haben Sie dieses hervorragende Bild gemacht?»
«Eigentlich wollte ich einen Apparat zur Belichtungsmessung für Kinokameras entwickeln und war bass erstaunt über die Brillanz, die Schärfe der Details auf kleinster Fläche. Die grobe Körnung des Films lässt zu wünschen übrig, und für die Graustufen müsste man noch eine Lösung finden, die sind viel zu verwaschen, besonders bei den blauen Tönen. Aber fürs Erste ist das ausreichend, denke ich. Wenn Sie sogar das Mädchen mit den Blumen erkennen konnten. Und Herrn Gabriel, der im Hintergrund steht. Wenn man bedenkt, dass das Negativ lediglich 24 mal 36 Millimeter klein ist.»
«Warum ausgerechnet dieses Maß?»
Oskar zuckt mit den Schultern. «Ein kostengünstiger Kinofilm, nur eben quer gelegt.»
Normalerweise ist der Zweite die Ausgeglichenheit in Person, kein Wunder, schließlich hat er Feinmechaniker gelernt und ist obendrein Geschäftsmann, eine Kombination, bei der man in jeder Lebenslage ruhiges Blut bewahren muss. Doch jetzt wippt er nervös von den Zehenspitzen auf die Hacken und wieder zurück. «Das ist genau das, was ich suche: etwas Neues! Etwas Einzigartiges! Wissen Sie was, ich werde Ihre Liliput mit nach Amerika nehmen, wenn Sie sie eine Weile entbehren können.»
«Das ist kein Problem.»
«Dann kann ich unterwegs ein wenig damit experimentierten. Und wenn ich zurück bin …»
Die Haustür öffnet sich einen Spalt, ganz langsam schiebt sich ein klitschnasser Arm nach drinnen, danach ein Bein. Als das tropfende Kind bemerkt, dass es mit dem Hineinschleichen nicht geklappt hat, erstarrt es zu Stein.
«Elsie!», ruft der Zweite aus.
Sie presst trotzig die bibbernden Lippen aufeinander. Als der Vater herbeieilt, sich hinkniet und sie fest umarmt, bricht ein Schluchzen aus Elsie hervor.
«Wo warst du so lange, mein lieber Wulewatz? Bei dem schlimmen Wetter? Du bist ja nass bis auf die Knochen!»
Das Mädchen bleibt stocksteif in seinen Armen. «Was meinen die Leute mit Revolverburg?»
Der Zweite zuckt zusammen. «Ich weiß nicht, wovon du sprichst.»
«Die Leute in Wetzlar nennen unser Haus nicht Rosenburg. Sie sagen Revolverburg.»
Der Zweite schluckt. «Wer sagt das?»
«Milan Gabriel. Er behauptet, sie nennen es so wegen Mutter. Wir haben uns richtig gestritten deshalb.»
«Was bedeutet: richtig gestritten?»
«Ich hab ihn sogar …» Sie ist ungewohnt kleinlaut: «… sogar ganz kurz gehauen deswegen.»
«Was? Elsie! Komm, wir ziehen dir jetzt erst einmal was Trockenes an, damit du dich nicht erkältest.» Leitz den Zweiten kümmert es nicht, dass er sich das Hemd versaut, als er seine Tochter auf den Arm nimmt, um sie die Treppe nach oben zu tragen. Kurz schaut er sich zu Oskar um: «Entschuldigen Sie, Meister Barnack, wir setzen uns ein anderes Mal zusammen, versprochen! Dann überlegen wir, was mit Ihrer grandiosen Erfindung angestellt wird. Einverstanden?»
Oskar nickt. Was soll er sonst tun? Er will dem Zweiten noch hinterherrufen, dass er ihm vor der Reise nach Übersee unbedingt eine kleine Einweisung geben muss, denn das Einlegen des Films ist leider nach wie vor etwas mühselig, und das Weiterspulen muss in einer bestimmten Reihenfolge passieren, sonst ist alles verdorben. Doch Oskar hört oben das Mädchen weinen und den Vater trösten. Revolverburg! In der Haut seines Chefs möchte er nicht stecken.
Dann öffnet sich die Tür zum Saal, und der Vertreter der Charité stolpert heraus. Der Wissenschaftler sieht das Tablett, lallt, endlich gebe es Nachschub, man müsse dem Magen eine Grundlage bieten – und verschlingt ein paar Würstchen samt den Krokussen, ohne groß zu kauen.
Es ist wirklich allerhöchste Zeit. Oskar nimmt seinen Mantel von der Garderobe und setzt den Hut auf.
Nun, dann eben Amerika. Gibt es nicht diesen Spruch? Wenn du es dort schaffst, dann schaffst du es überall.
Atlantik, April 1914
Eine Möwe verfehlt haarscharf seinen Hut, der gelbweiße Fleck klatscht stattdessen auf den Rettungsring, der in Griffweite an der Reling hängt, direkt über dem zweiten i-Punkt von Kronprinzessin Cecilie. Das Federvieh verabschiedet sich lachend und kratzt die Kurve.
Leitz der Zweite ist zwar sauber geblieben, doch klamm bis auf die Haut, obwohl er unter dem Vordach steht. Die Feuchtigkeit dringt nicht nur von oben in seine Kleidung, sie kommt von vorn, von unten, von den Seiten. Dabei regnet es noch nicht einmal. Der Zweite klammert sich an den Handlauf, bis seine Fingerknöchel weiß hervortreten. Die Haut drum herum zeigt wegen der Kälte ein ähnliches Muster wie die Marmorfliesen, die er vor der Abreise gemeinsam mit Hedwig und den Architekten für die neue Villa ausgesucht hat. Äderchen schimmern durch. Er lässt die Reling los, haucht auf seine Hände, reibt sie warm. Wann sind sie endlich, endlich da?
Eine Woche wie Kautschuk liegt hinter ihm. Gepflegte Langeweile zwischen Bug und Heck der Kronprinzessin Cecilie, allenfalls von mäßig spannenden Schach- oder Shuffleboardpartien, Rundgängen auf dem Promenadendeck sowie Konversation mit Mitreisenden über die politische Lage in Serbien unterbrochen. Wobei er hier an Bord anscheinend einer der wenigen ist, der an die Vernunft der Machthabenden und eine friedliche Lösung glaubt. Einzig das Essen ist ein Thema, über das sich harmonisch parlieren lässt, denn das spielt an Bord die entscheidende Rolle, teilen die Mahlzeiten doch die Ödnis der Tage in erträgliche Etappen. Zwischendurch schaukeln die Atlantikwellen einem den Mageninhalt gründlich durcheinander. Die Erinnerung an das opulente Frühstück, das aus Pampelmuse, einem Club-Sandwich und russischen Eiern bestanden hat, steigt ihm uncharmant die Kehle hinauf. Dies ist erst die Hinreise, doch Leitz der Zweite sehnt sich schon jetzt nach Rosis Hausmannskost, ein Kaiserreich für eine Linsensuppe mit Kartoffeln. Obwohl, wenn er bloß daran denkt, wird ihm wieder ganz anders.
Gegen die ewige Übelkeit hilft nur frische Luft, deswegen trotzt er an Deck den Naturgewalten, den Blick stoisch auf den Horizont gerichtet, die diffuse Trennlinie zwischen graublauem Meer und blaugrauem Himmel. Es sei denn, ein Walfisch kreuzt, doch dann wird ihm die Sicht versperrt, weil die Mitreisenden hektisch auf eine Seite drängen, dass man Angst bekommen muss, der Ozeanriese könnte kentern und wie jüngst die Titanic versinken. Bloß wegen dieses einen Meeressäugers, der sich nicht selten bei genauerem Hinsehen als Treibholz entpuppt. Der Zweite hat den Atlantik gründlich satt. Zum Glück hat Kapitän Polack bei seiner Morgenansprache verkündet, dass alles nach Plan verläuft, in spätestens vierundzwanzig Stunden erreichen sie Amerika.
Das Schiff dreht schräg gegen den Wind, das Auf und Ab wird sanfter, und der Zweite schafft es, sich umzuwenden. Weiter hinten, im Schutze der Rettungsboote, hat Hedwig es sich auf einem der Liegestühle bequem gemacht und liest. Einen halben Koffer nehmen die Erziehungsratgeber, die der Buchhändler der Schnitzlerschen ihr empfohlen hat, in Beschlag. Gerade schmökert sie in Schule und Jugendkultur, der Autor – Wyneken – ist Leiter des reformpädagogischen Internats, das für Elsie infrage käme. Und später eventuell auch für die Jungs. Ganz vertieft ist Hedwig in die Lektüre, den Leib eingeschlagen in eine Wolldecke wie in ein Omelett. Omelett? Oh nein, nicht schon wieder. Der Zweite stöhnt.
Hedwig schaut amüsiert vom Buch auf. «Eigentlich bin ich diejenige, der ständig übel sein müsste.»
Ihre Schwangerschaft hat Hedwig erst kurz vor der Abreise verkündet, obwohl sie schon im vierten Monat ist. Sie kennt ihn, sie weiß, dass er an derlei Neuigkeiten lange zu knabbern hat. Und hier auf der Kronprinzessin Cecilie bleibt ihm Zeit genug, sich an den Gedanken zu gewöhnen, erneut Vater zu werden. Zum vierten Mal, wie Hedwig denkt. Er lässt sie in dem Glauben.
Natürlich freut er sich auf das Kind. Allein, er hat nicht damit gerechnet. Hedwig ist nicht mehr die Jüngste, und besonders oft hat er ihr noch nicht beigewohnt. Es wird wahrscheinlich in der Silvesternacht passiert sein. Das Leben hatte sich dank Sekt, Musik und zahlreicher Zigarren ausnahmsweise leicht angefühlt, sodass es ihm möglich gewesen war, sich Hedwig auf diese Weise zu nähern. Hedwig, mit der er seit nunmehr zwei Jahren verheiratet ist, die so wunderbar Klavier spielt, die Freundin der Familie, die beste Kameradin seiner verstorbenen Frau, die in der schweren Zeit nach deren Tod treu an seiner Seite gestanden hat. Dass sie ihm nie die Schuld an diesem Unglück gegeben hat, rechnet er Hedwig hoch an.
«Wenn du Langeweile hast, Ernst, dann probier doch mal diesen Apparat aus, den dein Werkstattleiter dir mitgegeben hat.»
«Barnacks Liliput?»
«Das Ding liegt in unserer Kabine auf der Hutablage. Und wer weiß, ob du in New York je dazu kommst.»
«Aber was soll ich denn photographieren? Hier gibt es nichts zu sehen.»
Hedwig legt die Stirn in Falten und schaut den Zweiten mit gespielter Entrüstung an. «Hab ich richtig gehört? Du findest, dass deine Gattin kein geeignetes Motiv abgibt?»
«Du hast recht. Ich hole die Kamera. Aber bleib, wo du bist! Nicht, dass ich gleich einen verlassenen Stuhl ablichten muss.»
Sie verspricht es, und der Zweite verschwindet durch die Schiebetür nach drinnen, folgt der schmalen Treppe aufwärts zum schnurgeraden Gang, an dessen Wänden sich eine Tür an die nächste reiht, feines Tropenholz und auf Messingschildern gravierte Kabinennummern. Ganz im hinteren Eck befindet sich ihre Suite. Sie haben zwar in der ersten Klasse gebucht – mit separaten Schlafzimmern, angenehm eingerichtet, seidenbespannte Wände, Sekretär, Kristallleuchter – aber nicht die De-luxe-Variante. Der Zweite mag es komfortabel, doch Verschwendungssucht ist ihm zuwider. Insbesondere, seit er sich am zweiten Seetag interessehalber die Betten im Zwischendeck hat zeigen lassen, quält ihn das soziale Gewissen. Dort liegen sie dicht an dicht in Doppelstockbetten, die wegen der Enge nur über das Fußende zu erreichen sind, und müssen die Koffer auch noch irgendwo verstauen. Da bleibt kaum Platz zum Stehen, und die Ausdünstungen der Mitreisenden verschlagen einem den Atem. Oft sind es Menschen, die ehrlicher Arbeit nachgehen, Handwerker und Landwirte, die Deutschland für immer den Rücken kehren und in Amerika ihr Glück versuchen wollen. Hab und Gut wurden verscherbelt, um das Geld für die Überfahrt aufzubringen, auch wenn es nur ein Hundertstel von dem ist, was der Zweite hingeblättert hat. Oder vielmehr die Firma, denn diese Reise gilt weniger dem Privatvergnügen, das bestenfalls aus vereinzelten Theaterbesuchen, Stadtbesichtigungen und einem Ausflug zum Strand und zu den Niagarafällen bestehen wird. Die meiste Zeit wird der Zweite in ihrer New Yorker Niederlassung in der Nähe des Central Park verbringen, wo diverse Treffen mit Wissenschaftlern und Geschäftspartnern geplant sind, denen er das neue Mikroskop vorstellen darf.
Der Blick ins Zwischendeck hat dem Zweiten die Schiffsreise verdorben, er mag sich gar nicht ausmalen, wie bescheiden erst die Mannschaft untergebracht sein muss. Die unzähligen Matrosen und Heizer und Köche und Stewards, die sich alle den Rücken krumm buckeln, damit Menschen wie er, die schon mit goldenem Löffel im Munde geboren wurden, sich in aller Ruhe langweilen können.
In ihrer Kabine duftet es etwas zu intensiv nach Veilchenparfüm. Der Steward scheint schon da gewesen zu sein, die Betten sind gemacht, die Blumen haben frisches Wasser, auf dem Beistelltisch neben dem Kanapee steht eine Schale mit Obst. Die Kamera befindet sich tatsächlich auf der Hutablage. Vielleicht hätte man das gute Stück besser verstecken müssen, Kapitän Polack hat davor gewarnt, Wertgegenstände offen herumliegen zu lassen. Aber handelt es sich überhaupt um einen solchen? Das Ding könnte alles Mögliche sein. Ein unförmiges Zigarettenetui oder ein Flachmann mit Rum, bei dem man die Öffnung zum Trinken aus unerfindlichen Gründen an der Seite angebracht hat. Es ist aus schwarz lackiertem Metall und liegt angenehm in der Hand. Was die einzelnen Drehknöpfe zu bedeuten haben, hat Meister Barnack mehrfach erklärt und zudem noch mal auf einen seiner berühmt-berüchtigten Notizzettel geschrieben, welchen der Zweite nun hervorkramt. GANZ WICHTIG! steht oben in Versalien, ZUSCHNEIDEN UND EINLEGEN DES FILMS NUR BEI VOLLSTÄNDIGER DUNKELHEIT. Wie zum Hohn blinzelt genau in diesem Moment ein Sonnenstrahl durch das Bullauge. Der Zweite schaut sich um. Wo ist vollständige Dunkelheit, wenn man sie mal braucht? Der Schrank wäre zu eng, und unter der Bettdecke würde er ersticken. Doch im kleinen Waschraum müsste es zur Not gehen, der hat kein Fenster und eine ausreichend große Ablagefläche, denn laut den Instruktionen, die er sich nun genauer durchliest, scheint man mit einer Menge Utensilien hantieren zu müssen, bevor das erste Bild im Kasten ist. Nachdem er die Zeilen überflogen und halbwegs auswendig gelernt hat, zieht er sich mitsamt Kamera und Zubehör in die Finsternis der Nasszelle zurück und setzt sich dort auf den Toilettendeckel.
Er meint, Meister Barnacks geduldige Stimme zu hören: Zuerst wird der Film zugeschnitten und auf die Spule gewickelt. Er fischt den bereits von Barnack zugeschnittenen Rollfilm vorsichtig aus einer Dose, dieser wippt wie ein junges Küken in seiner Hand. Niemals auf die Emulsionsschicht fassen! Leichter gesagt als getan. Er tastet nach der Schere. Eine Armlänge beschichtetes Zelluloid muss an beiden Enden zu einer schmalen Lasche gestutzt werden … Das umgeklappte Ende unter die gespannte Metalllasche der Filmspule schieben und drehen, bis das andere Filmende gerade noch lang genug ist, um an der schmalen Aufwickelspule befestigt werden zu können … So langsam wird er nervös und fängt an zu schwitzen, trotz seiner von vielen Jahren als Feinmechaniker geschulten Finger. Nun die Bodenplatte der Kamera entfernen und die Filmspule mit dem aufgewickelten Film links … Oje, ist es links von vorn oder von hinten gesehen? Meister Barnack hat es bestimmt erwähnt, aber jetzt, so allein und von Schwärze umgeben, ist es dem Zweiten entfallen. … zum Einrasten der Aufwickelspule den Aufzugknopf ein wenig drehen. Wer, denkt er, soll sich jemals für diesen Apparat begeistern, wenn schon in der Vorbereitung derlei Präzisionsarbeit zu verrichten ist? Zweimal glaubt er, es sei ihm endlich gelungen, doch wenn er den Aufzugknopf betätigt, hört man ein schabendes Geräusch. Wenn es nicht ratscht, sondern stattdessen quietscht oder knistert oder schabt, ist es verkehrt! Warum nur wird er das Gefühl nicht los, Meister Barnack säße auf der Badewannenkante und beobachtete ihn tadelnd? Endlich hat er es geschafft, der Film sitzt stramm in der Kamera, und wenn er ihn weitertransportiert, macht es eindeutig «Ratsch!». In seiner Begeisterung hätte er beinahe die Tür wieder geöffnet, ohne zuvor die Klappe vor die Linse geschoben zu haben. Davor hatte Meister Barnack ihn mehrfach gewarnt, wenn das passiere, könne er die Aufnahmen wegschmeißen.
Wie ein Held fühlt er sich nun, als er aus dem Waschraum tritt und – nachdem sich seine Augen wieder an das Licht gewöhnt haben – die Kabine verlässt, um zurück aufs Promenadendeck zu gelangen. Wie ein Arzt, dem eine schwere Operation geglückt ist.
Doch er wird nicht besonders heroisch empfangen. Hedwig hat in der Zwischenzeit noch weitere Wolldecken über sich gehäuft und liegt wie eine Mumie auf ihrem Deckchair. «Ernst! Ich wäre hier draußen fast erfroren. Was hast du bloß so lange gemacht?»
Er entschuldigt sich, zückt die Kamera, bittet Hedwig, noch ein letztes Mal so zu tun, als wäre sie in eine genüssliche Lektüre vertieft. Dann drückt er endlich den Auslöser.
«Aber ist das richtig, dass die Linse abgedeckt ist?», fragt Hedwig ungnädig.