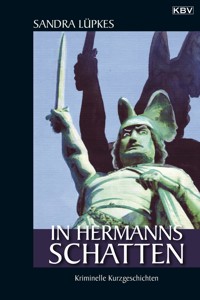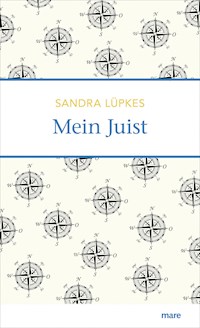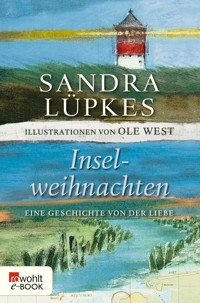Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Die Liste der Mordopfer, die auf Sandra Lüpkes' Konto gehen, ist lang und umfassend - und trotzdem läuft die Frau noch frei herum und freut sich des Lebens. Warum? Weil sie eine Auftragskillerin der literarischen Sorte ist. Wenn Städte und Gemeinden, Tourismusverbände oder Firmen fragen, ob sie ihnen nicht einen Mordfall auf den Leib schreiben will, ist sie dabei. Bewaffnet mit Phantasie, Sprachwitz und Neugierde wird sie zur professionellen Jägerin nach den Leichen in den Kellern der Bundesrepublik - und darüber hinaus: sogar bis nach Argentinien zieht sich ihre Spur. Fingerabdrücke hinterlässt sie übrigens haufenweise, denn Lüpkes' Kurzkrimis sind einfach unverwechselbar. Die besten Auftragsmorde sind in diesem Buch zusammengefasst - wer würde dieser Frau da noch ernsthaft das Handwerk legen wollen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 276
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sandra Lüpkes
Die Auftragskillerin
Von der Autorin bisher bei KBV erschienen:
Wer tötete Fischers Fritz? (Hg.)
Mörderisches Münsterland (Hg.)
In Hermanns Schatten
Die Auftragskillerin
Sandra Lüpkes, geboren 1971 in Göttingen, verbrachte die längste Zeit ihres Lebens auf der Nordseeinsel Juist und wohnt nun in Münster und Ostfriesland, wo sie als freie Autorin und Sängerin arbeitet. Mit ihren sieben bereits erschienenen Kriminalromanen und einer Kurzgeschichtensammlung hat sie bereits eine Gesamtauflage von knapp 200.000 Exemplaren erreicht und ist weit über den norddeutschen Tellerrand hinaus bekannt.
2005 war sie für den Friedrich-Glauser-Preis und 2004 für den VS-Preis »Das neue Buch« nominiert. Neuere Kriminalromane: 2006 »Die Wacholderteufel«, 2007 »Das Sonnentau-Kind«, 2008 »Die Blütenfrau« (alle bei rororo).
Als Referendarin leitet sie verschiedene Krimiseminare für Jugendliche und Erwachsene, unter anderem an der Bundesakademie in Wolfenbüttel. Sie ist Mitglied im »Syndikat« und bei den »Mörderischen Schwestern«.
www.sandraluepkes.de
Sandra Lüpkes
DieAuftragskillerin
Auftragsmorde von Borkum bis zum Bodensee
Originalausgabe
© 2011 KBV Verlags- und Mediengesellschaft mbH, Hillesheim
www.kbv-verlag.de
E-Mail: [email protected]
Telefon: 0 65 93 - 998 96-0
Fax: 0 65 93 - 998 96-20
Umschlagillustration: Ralf Kramp
Druck: Aalexx Buchproduktion GmbH, Großburgwedel
Printed in Germany
Print-ISBN 978-3-942446-30-3
E-Book-ISBN 978-3-95441-082-8
Inhalt
VorwortSANDRA LÜPKES
Abertausend AugenNordsee
007 überm WattOstfriesische Inseln
Manchmal, aber nur manchmalBorkum
NatterngiftJuist
Sein letzter FlugNorderney – GEMEINSAM MIT JÜRGEN ALBERTS
Zum alten EisenOstfriesland
Back to Bad OldesloeBad Oldesloe
Antje muss malDelmenhorst
Durru guMünster
Sammeln Sie Herzen?Berlin
O-Töne aus GemündEifel
Gehörnt in LambrechtPfalz
Der FeuerraumSchönbuch/Schwabenländle
Berchtesgadener BlutnovelleBerchtesgadener Land
Honig und FeigeGrenzgebiet Bodensee
Buenos Dias Argentina!Córdoba/Argentinien
Der Rest ist SchweigenMünster – GEMEINSAM MIT JÜRGEN KEHRER
Vorwort
Wollen wir mal ehrlich sein: Ich bin im Grunde nichts anderes als eine Auftragskillerin. Ich verdiene meine Brötchen damit, finstere Verbrechen auszuklügeln, von denen andere profitieren.
Mehrfach im Jahr erreichen mich E-mails, Anrufe oder Briefe, in denen ich von den unterschiedlichsten Personen gebeten werde, doch in ihrem näheren Umfeld mal einen Mord zu begehen. Oft sind auch schon nähere Regieanweisungen dabei: Wer das Opfer sein soll, wer der Verdächtige – und vor allem, welche Eigenarten unbedingt beachtet werden müssen.
Dass ich immer noch als freier Mensch herumlaufe, liegt natürlich daran, dass ich lediglich Schreibtischtäterin bin und Mord und Totschlag ausschließlich auf dem Papier – oder Computerbildschirm – stattfinden.
Auftraggeber sind mitunter Gemeinden, Tourismusverbände, Hotels oder auch Privatpersonen. Sie laden mich ein, mich in ihrem Ort umzusehen, die Leichen in ihren Kellern aufzuspüren und dann zur Tat zu schreiten. Sie glauben gar nicht, wie viel Spaß diese Recherche macht. Nicht nur mir, sondern vor allem den Menschen, in deren Umgebung ich mein Unwesen treiben soll. Viele sagen mir, nachdem wir Museen geplündert, Archive zerfleddert, Zeitzeugen gelöchert und Bürgermeister in die Mangel genommen haben, sie hätten jetzt eine ganz neue Sicht auf ihre Stadt. Und ob ich nicht nächste Woche wiederkommen könne ...
Das ist das Schöne am Krimi: Man nähert sich dem Altbekannten aus einer anderen Perspektive, durchleuchtet Traditionen nach ihrem Konfliktpotential und treibt dann eine scheinbare Dorfidylle spannungsmäßig an den Rand des Erträglichen. Danach ist jeder heilfroh, dass es in der Realität doch vergleichsweise harmlos abläuft.
In dieser Kurzkrimisammlung habe ich fünfzehn solcher Auftragsmorde zusammengestellt. Bei zwei Geschichten habe ich mir mit Jürgen Alberts und Jürgen Kehrer sogar Komplizen genommen. Die Storys spielen an den unterschiedlichsten Orten, einer sogar in Argentinien. Sie haben oft merkwürdige Bräuche oder historische Anspielungen zum Thema, genau das macht die Geschichten unverwechselbar, sie könnten nicht woanders spielen als eben genau dort.
In Borkum werden einmal im Jahr die Frauen verprügelt, in der Pfalz wird ein Ziegenbock zum Dreh- und Angelpunkt einer ganzen Gemeinde, am Bodensee führt ein im Grenzwald Erhängter zu einem »negativen Kompetenzkonflikt«.
So ist dieser Krimiband vielleicht auch ein bisschen Geografieunterricht oder sogar eine Lektion in Geschichte, denn einige Mordfälle basieren auf wahren Begebenheiten.
Aber nun wollen wir nicht über das Ziel hinausschießen, in erster Linie geht es doch darum, Sie mit diesem Buch in jeder Hinsicht vielseitig zu unterhalten.
Also, ich habe das nötige Werkzeug dazu gepackt – in einen unauffälligen, schwarzen, länglichen Koffer ...
Sandra Lüpkes
Münster 2011
Abertausend Augen
Eine Insel im Winter hat abertausend Augen und Ohren. Selbst hier am Strand, der im Dezember ein ganz anderes Gesicht hat als das, welches er den vielen Touristen in der Hochsaison zeigt. Selbst hier auf dieser grauen Platte, über die der dünne Schnee weht wie weiße Asche. Selbst hier, wo der Blick Richtung Meer an nichts anderem hängen bleibt als an dem vielfältigen Strandgut, an zerrissenen Fischernetzen in grün und orange, an zersplitterten Planken und Möwenkadavern, halb beerdigt vom Flugsand.
Selbst hier fühlte Hella sich beobachtet.
Das Wissen um die abertausend Augen beeinträchtigte ihre sonst so ungezwungene Art. Sie stolperte an seiner Seite, sie gab sich einsilbig, und vor allem zuckte sie zusammen, sobald er sie versehentlich oder mit Absicht berührte.
»Hier ist es doch schön«, sagte er und blieb abrupt stehen. Seine Nase war rot, ebenso seine Ohren. Er trug einen Hut. Mein Gott, war das lächerlich, im Winter auf der Insel mit einem Hut herumzulaufen. Ein Harlekinkostüm hätte ihn nicht auffälliger machen können.
Der Mann mit Hut, tuschelten die Menschen. Was macht der im Winter hier? Ein Künstler soll er sein. Ein Architekt, ein ganz großer, der in der Hauptstadt diesen modernen Platz entworfen hat, mit viel Glas und Brimborium. Gebäudekunst, schrieben die bunten Magazine.
Dies mochte zutreffen, doch Berlin war eine völlig andere Welt. Die Insulaner hofften nur, dass er nicht dieselben Ambitionen hatte, wenn er das neue Hotel am Ortseingang entwerfen sollte. Sie fürchteten sich vor mehr als drei Stockwerken.
»Die Dünen oder das Meer im Rücken, was bevorzugen Sie?« Er stellte sich einmal in die eine und einmal in die andere Richtung, die Enden seines Schals wehten in sein Gesicht und verdeckten den spöttischen Blick. »Oder soll ich Spuren hinterlassen? Spuren im Sand? So etwas mögt ihr Journalisten doch immer gern.«
»So ist es schon gut«, sagte Hella, hob die Kamera und blickte halbherzig durch den Sucher. Spuren im Sand, was glaubte er denn? Dachte er wirklich, er könnte hier etwas Bleibendes hinterlassen? Die nächste Flut würde in einer halben Stunde einsetzen, seine Fußabdrücke wären in kürzester Zeit verschwunden.
Ihre Digitalkamera gab ein künstliches Klicken von sich, sie kontrollierte auf dem Display die Aufnahme, man könnte die roten Ohren vielleicht retuschieren.
»Was ist denn los mit Ihnen, Hella? Ist Ihnen der lange Abend gestern in der Woge nicht bekommen?«
»Doch, doch.«
»Sie sind heute irgendwie wortkarg.«
»Der Wind ist so kalt.«
Er lachte. »Einem Inselkind dürfte ein bisschen frische Luft eigentlich nicht die Sprache verschlagen.«
Natürlich hatte er Recht. Es gab einen anderen Grund. Sie konnte nichts erwidern. Hier war kein Mensch, doch sie fürchtete sich auszusprechen, was ihr die ganze Zeit so schwer auf der Zunge lag. Der Abend gestern mit ihm in der Woge, der als Interviewtermin begonnen hatte und im endlosen Gespräch über Gott und die kleine Welt hier ausgeartet war, hatte ihr sehr gut getan. Er war witzig gewesen, unterhaltsam und inspirierend. Das hätte sie ihm alles gern gesagt. Doch dieser Wind war in der Lage, selbst ein Flüstern kilometerweit mit sich fortzutragen. Und irgendwo würde es sicher ein Ohr treffen.
Sie steckte die Kamera in die Tasche ihrer Daunenjacke.
Er trat dicht an sie heran. Sein Körper schützte sie vor den nächsten Böen, ihr wurde augenblicklich warm, nein, heiß. Seine Hand lag unter ihrem Kinn, sanft rieb er mit seinen Fingern über ihre Haut, hob ihr Gesicht. »Hella ...«
Irgendjemand wird es sehen, dachte Hella. Hinter den Dünen oder dort im Osten bei den aufgetürmten Zweigbündeln konnte man sie unbemerkt beobachten. Seine Lippen waren rau, er schmeckte nach seiner Pfeife, die er gestern Abend in der Woge auch gepafft hatte. Hella erinnerte sich, da hatte sie auf seinen Mund gestarrt und war sich das erste Mal bewusst gewesen, wie unbedingt sie ihn küssen wollte.
»Jeden Abend Sitzung!«, schimpfte Meinhard. Er stand im Flur vor dem Ganzkörperspiegel, und Hella konnte durch den Türspalt ihres Arbeitszimmers erkennen, dass er sich eines seiner besten Hemden anzog. Meinhard schimpfte oft und gern. Es war sein Favoritenlaut, den er wesentlich öfter von sich gab, als ein fröhliches Lachen oder zufriedenes Irgendwas.
Im Sommer klagte er über die Menschenmassen, die scheinbar mit Scheuklappen ausgestattet auf den autofreien Straßen liefen. Im Winter, wenn der Rest der Welt glaubte, auf den Inseln würde nur gefeiert und geruht, musste er auf Sitzungen. Kommunalpolitik hat in der Vorweihnachtszeit Hochsaison. Meinhard war Mitglied der Diekkant. Eine recht laute Truppe, die ihrem plattdeutschen Namen, der übersetzt Deichkante hieß, alle Ehre machte. Die Ausmaße des grünen Bollwerks im Visier lehnten sie alles ab, was an Einflüssen vom Festland herüberwehen könnte. Sogar gegen den »Weihnachtszirkus« wehrte man sich seit Jahren mit Erfolg, der große Weihnachtsbaum im Kurpark wurde erst aufgestellt, wenn die ersten Gäste zum Silvesterfeiern anreisten – ansonsten gab sich das Eiland im Wattenmeer bescheiden und schmucklos wie im ganzen Inselwinter. Hella sah es anders und ihr erschien der Deich, der sich hier so weit vor den Horizont schob, eher als eine Mauer, die das Inselvolk zu einer Enklave machte. Es war sinnlos, mit Meinhard darüber zu streiten.
»Eine Insel ist ein Mikrokosmos, der leicht aus dem Gleichgewicht geraten kann. Wenn ich mir nur vorstelle, dass dieser durchgeknallte Architektenarsch sein Monsterhotel baut – er wird alle infizieren, Hella. Wenn der Erste in die Höhe mauert, so will das der Nächste auch. Und dann wuchert es auf unserem Eiland.«
Er trat an den Schreibtisch und reichte ihr mit hilflosem Grinsen die beiden Enden seiner ungebundenen Krawatte. Zu Weihnachten würde sie ihm einen neuen Schlips schenken, ihr war irgendwie nichts Besseres eingefallen, und auf der Insel gab es ohnehin nur ein sehr eingeschränktes Angebot, wenn man seine Weihnachtseinkäufe erledigen wollte.
»Heute kommt dieser Supermann aus Berlin und stellt der Öffentlichkeit seine Pläne vor. Komm doch mit, Hella. Es wäre wichtig für uns, dass du einen Pressebericht schreibst. Wenn in den Zeitungen nichts steht, können wir die Bevölkerung kaum für unseren aktiven Kampf gewinnen.«
Sie zog die Schlaufe um seinen Kragen enger. »Ich rufe morgen im Rathaus an und lasse mir die Unterlagen geben. Heute Abend hab ich schon genug zu tun.«
»Die Story über den Mann mit Hut, oder was? Warum ausgerechnet meine Frau eine PR-Kampagne für diesen Typen schreibt ...«
»Es bringt das Dreifache wie ein Bericht im Ostfriesischen Tageblatt!«
»Geld ist doch Nebensache. Hier geht es um unsere Insel. Der Kerl muss dir irgendwie den Kopf verdreht haben. Eigentlich wolltest du doch ein kritisches Interview mit ihm führen.«
Ihr Hals wurde trocken. Es klang misstrauisch, wie er die letzten Worte aussprach. Hatte ihm jemand etwas erzählt? Natürlich war die kleine Kellerkneipe mitten im Inseldorf nicht gerade menschenleer gewesen, als sie gestern am runden Tischchen hinten beim Durchgang zum Billardtisch gesessen hatte. Zum Glück war die Musik zu laut, um sich vor Lauschangriffen fürchten zu müssen. Aber was hatten die anderen Besucher bemerkt? Die kleine Apothekerin mit der dicken Brille hatte ständig in ihre Richtung geblickt. Der Gruß der Fährticketkontrolleurin war freundlicher als sonst ausgefallen. Der dicke Glatzkopf vom Ordnungsamt, der eigentlich mit dem Rücken zu ihr gesessen hatte, hatte die Spiegelwand genutzt und mehr als einmal herübergestiert. Und einer von ihnen würde Meinhard bereits erzählt haben, was seine Frau gestern in der Woge getrieben hatte.
»Ich verstehe dich nicht, Hella. Jetzt kannst du mal einen wirklich großen Bericht schreiben, und dann verschanzt du dich hinter dieser komischen Story. Heute Abend wird es richtig Ärger geben im Dorfhaus. Diekkant ist gut gerüstet gegen die Großstadtparasiten. Aber die rasende Reporterin ist leider nicht dabei, weil sie für den Feind arbeitet ...«
»Du hast es erfasst«, gab sie sich einsilbig.
Meinhard verließ ihr Arbeitszimmer, kurz darauf hörte sie die Haustür ins Schloss fallen. Verabschiedet hatte er sich mit keiner Silbe.
Hella tippte die überschrift: Außerirdischer mit Hut landet im Mikrokosmos. Sie lachte, ausgerechnet Meinhard hatte sie auf dieses Wortspiel gebracht. Der Artikel schrieb sich fast wie von selbst. Hella wusste, das kam daher, weil sie die Worte und Gedanken des Mannes, über den sie schrieb, teilte, es hätten genau so gut ihre eigenen sein können.
Wie klein die Backsteinhäuser doch sind, wie herausgeputzt die Fensterbankblumen zwischen den Spitzengardinen, hinter denen immer jemand auf Beobachtungsposten sitzt. Die ungeteerten Straßen, im Winter mit gefrorenem Pferdemist bedeckt und so schmal und schnurgerade, dass man kein Verstecken spielen kann, und jeder Ruf zwischen den Mauern unendlich widerhallt. Hier kann man die Zeit wahrnehmen, wie sie wirklich ist. Ebbe und Flut geben den Takt vor, Tag und Nacht sind Dank der sparsamen Dorfbeleuchtung endlich wieder voneinander zu unterscheiden.
Wie gut Hella ihn verstehen konnte.
»Und warum planen Sie dann dieses gigantische Hotel am Deich?« hatte sie ihn gefragt. »Zerstören Sie dann nicht gerade das, was Sie hier auf der Insel so schätzen?«
»Wer hat gesagt, dass ich es schätze?«, hatte er lachend geantwortet. »Seien Sie doch ehrlich, Hella: Ihnen ist die Insel doch auch viel zu klein.« An dieser Stelle war ihre Unterhaltung dann unweigerlich ins Private abgedriftet.
Hella speicherte ihren Text ab und fuhr den PC runter. Es eilte nicht mit der Geschichte, in Wirklichkeit hatte sie die Arbeit heute Abend nur vorgeschoben, um sich vor der Sitzung zu drücken. Besser als Meinhards Schimpftiraden waren jetzt ein Becher Tee, das Sofa und die Wolldecke um ihre Beine. Und endlich Zeit und Ruhe, um diesen Strandspaziergang Revue passieren zu lassen.
Nein, sie bereute den Kuss nicht. Sie hatte eher das Gefühl, sich einen kleinen, unerhörten Luxus gegönnt zu haben. Am Strand hatten sie gestanden und sich eine ganze Weile einander den warmen Atem ins Gesicht gehaucht.
Auf dem gemeinsamen Rückweg hatte Hella sich anstrengen müssen, um nicht, trotz des gebührlichen Abstand zwischen ihnen, glücklich und verliebt vor sich hin zu lächeln. Wem waren sie eigentlich begegnet? Der Bäcker hatte sie mit dem Handkarren auf seinem Weg von der Backstube zur Filiale überholt, grußlos wie immer. Die Schulkinder waren mit ihren Fahrrädern den Dünenweg hinuntergesaust und hatten geklingelt. Und sonst?
Am ersten Schluck aus der Tasse verbrühte Hella sich fast die Lippen. Nicht, weil sie hastig getrunken hatte, sondern weil sie plötzlich von einem kalten Schauer erfasst wurde, der sie unwillkürlich zusammenzucken ließ. Hatte Meinhard zum Lüften die Terrassentür auf Kipp gelassen? Sie wandte sich um, alle Fenster waren fest verschlossen. Sie zog die Wolldecke bis zum Hals.
Natürlich war ihm nicht entgangen, wie ängstlich sie sich umgeschaut hatte, in der Kneipe, am Strand, auf der Straße. Doch er hatte sie verstanden, er war der erste Mensch, der dieses Grauen der abertausend Augen nachvollziehen konnte. »Du bist anders als die anderen hier. Du denkst anders, du fühlst anders, und das macht dich zur Außenseiterin. Natürlich haben sie dich alle im Visier und geifern danach, dass du einen Fehler machst und scheiterst. Aber ich bin nicht dein Fehler, Hella, ich bin vielmehr deine Chance.«
Und meine Gefahr, hatte sie gedacht, es aber unausgesprochen gelassen.
Hellas Haare stellten sich auf, sie schaute sich um, woher kam diese Kälte? Durch die Terrassentür blickte sie in die Dunkelheit. Die Dünen, an die ihr Grundstück grenzte, waren schemenhaft zu erkennen, weil die feinweiße Schneedecke das letzte bisschen Restlicht reflektierte. Hellas Herzschlag beschleunigte sich, obwohl sie die Einsamkeit ihres Hauses am Rande des Ostdorfes eigentlich schätzte und ihr die Tatsache, dass sie bei einem solchen Eiswetter niemand freiwillig besuchen würde, eher das Gefühl der Geborgenheit denn der Einsamkeit bescherte. Doch in diesem Moment war es anders. Sie fühlte sich beobachtet. Auch wenn nichts zu sehen war, kein Schatten und keine Bewegung hinter dem Haus, sie fühlte Blicke auf sich ruhen und wusste ganz sicher, jemand schaute zu ihr herein.
Es kostete Kraft, sich selbst zu beruhigen und gelassen aufzustehen, um zum Fenster zu gehen. Wenn sie die schweren, karierten Vorhänge zuzog, würde das Gefühl sicher nachlassen. Es musste Einbildung sein, dieser verdammte Verfolgungswahn begann ihr das Leben schwer zu machen. Sie zwang sich, ganz bewusst und forsch durch die Scheibe zu blicken, während ihre zitternden Finger den Stoffsaum umfassten. Wer ist da?, fragte Hella stumm. Wer schaut mir dabei zu, wie ich meinen Tee trinke?
Fast hatte sie den letzten Spalt zwischen den Gardinen geschlossen, da sah sie den Hut im Schnee. Kleine weiße Punkte auf dem schwarzen Filz zeigten, dass er schon länger dort auf dem Boden liegen musste. Obwohl es nur ganz leicht schneite, hatte sich bereit eine dünne Schneedecke darauf gebildet. Ringsherum war nichts zu erkennen. Keine Spuren. Der kleine Garten machte einen verwaisten Eindruck.
Hella zog die Vorhänge vollständig zu. Ihr war übel vor Angst. Wovor fürchtete sie sich eigentlich? Gut, wahrscheinlich war er hier gewesen, hatte sich in ihrem Garten aufgehalten, vielleicht wollte er ihr nahe sein. Das war doch eigentlich schön, oder nicht? Dann war er wohl gegangen – bestimmt, als er Meinhard gesehen hatte – und als Andenken hatte er seinen Hut auf den vereisten Rasen gelegt. Das war eine halbwegs plausible Erklärung. Kein Grund zur Aufregung. Trotzdem musste Hella heftig an ihrer Panik schlucken. Warum war sie so sicher, nicht allein zu sein?
Warm war ihr immer noch nicht. Ein kühler Hauch zog vom seitlichen Fenster neben der Vitrine her, hier waren die Vorhänge noch offen. Hella beeilte sich, wenn sie die Aussicht nach draußen ganz verdeckte, dann würde auch kein Blick mehr zu ihr hineindringen können. Dann würde ihr Puls wieder zur Ruhe kommen. Zum Glück war es nur ein kleiner Schritt zur Wand. Es würde ...
»Mein Gott«, entfuhr es ihr. Er stand da. Draußen am Fenster, so nah, dass sich rings um seinen Mund der Atemnebel auf die Scheibe legte. Ohne Hut sah sein Kopf ganz anders aus, seltsam deformiert. Seine Hände klatschten flach auf das Glas und rutschten hinab, die Augen starrten zu ihr hinein. Das Gesicht presste sich an die durchsichtige Fläche, die Lippen wurden hellrosa bis weiß, es sah aus, als saugte er an etwas, ja, als küsse er die Scheibe. Etwas Dunkles sickerte zäh zwischen seinen Zähnen hindurch. Wie ein Wahnsinniger stemmte er sich gegen das Fenster. Wollte er es mit seinem Körper zerdrücken? Musste er mit Gewalt zu ihr kommen? Er hätte doch klopfen können, sie hätte ihm gern die Tür geöffnet.
Erst, als er mit kurzem Rucken hinuntersackte und sein offener Mund auf dem Fenster eine dunkle Spur zog, bemerkte Hella, wie blicklos die Augen waren. Er hätte sie schon längst bemerken müssen, schließlich stand sie direkt vor dem Fenster und schaute ihn an. Aber er fixierte mit seinen seltsam starren Pupillen einen Punkt im Nirgendwo. Bis er vollends zu Boden ging.
Hella schrie. Wahrscheinlich hatte sie diesen ganzen unendlichen Schreckensmoment hindurch geschrieen, doch erst jetzt bemerkte sie es. Augenblicklich war sie still, zur Sicherheit legte sie noch die Hand auf den Mund und biss sich mit den Zähnen in den Zeigefinger. Nach Luft schnappen schien ihr auf einmal wichtig zu sein, immer wieder, in hektischen Stößen, her mit dem Sauerstoff, denn der Schock wollte sie ersticken. Luft. Hellas Finger kribbelten.
Er war tot. Hier direkt von Angesicht zu Angesicht war er gestorben. Er muss ermordet worden sein, woher sollte sonst das ganze Blut kommen, welches nun an ihrem Fenster klebte. Einatmen, einatmen, o Gott, sie wurde verrückt. Die Zeit zerfranste. Ihr Brustkorb begann zu schmerzen, denn er war aufgebläht bis zum Anschlag, trotzdem brauchte sie noch mehr Luft. Wahnsinn. Sein Kopf war zerschmettert gewesen. Sie haben ihn getötet, direkt in ihrem Garten. Ein Mord so nah. Luft ... Schwindel ... Meinhard muss es gewesen sein ... Luft ... Übelkeit ... Diekkant und der Kampf, den sie heute angekündigt haben … Meinhard, ihr Mann … direkt hier vor ihren Augen … Luft … Dunkelheit.
»Hella, was machst du denn für Sachen?« Meinhard tauchte so unverhofft in ihrem Blickfeld auf, dass sie am liebsten wieder abgetaucht wäre in diese seltsame Mischung aus Schlaf und Bewusstlosigkeit. Er lächelte schief und seine alte Krawatte hing ihm albern über die Schulter. Ständig drückte er ihr mit unruhigen Händen einen kühlen Lappen auf die Stirn und hinderte sie daran, wieder ohnmächtig zu werden.
Erst nach und nach erkannte Hella hinter ihm in den Schattenbildern besorgte Gesichter, das verquere Murmeln im Raum ordnete sich in verschiedene Stimmen.
Die Apothekerin mit der dicken Brille hielt Meinhard ein braunes Döschen hin und sagte: »Zehn Kügelchen unter die Zunge. Hilft, den Säurehaushalt im Blut nach dem Hyperventilieren wieder auszugleichen. Rein pflanzlich.«
»Soll ich nicht lieber einen Arzt holen?«, fragte Meinhard und verabreichte das Medikament.
Hella schüttelte leicht den Kopf. »Geht schon wieder.«
»Sie kam mir gestern in der Woge schon so zerstreut vor«, sagte eine männliche Person aus einer anderen Ecke des Zimmers. Es könnte der Stimme nach der Glatzkopf aus dem Ordnungsamt sein, aber Hella war zu kraftlos, sich umzublicken. Dazu hätte sie sich bewegen müssen, doch sie brauchte die Energie für etwas anderes. Sie musste herausfinden, was geschehen war.
»Du fragst dich sicher, was die hier alle machen, oder?« sagte Meinhard so leise und sanft, wie man mit einer Schwerverletzten oder Geistigumnachteten spricht. »Tut mir leid, wenn ich gewusst hätte, dass du bewusstlos auf dem Wohnzimmerboden liegst, hätte ich natürlich nicht die halbe Insel zum Feiern eingeladen.«
»Zum Feiern?« kam es über Hellas Lippen. Sie schaffte es nicht, die anderen Worte auszusprechen: Was verdammt noch mal gibt es hier zu feiern? Im Garten liegt ein toter Mann, der Mann, den ihr alle so hasst, während ich dabei war, mich in ihn zu verlieben. Hat ihn denn keiner bemerkt?
»Ja, wir wollen ein paar Flaschen Sekt aus dem Kühlschrank holen. Der Architekt hat kapituliert. Das ganze Mammuthotel am Hafen, es wird nie gebaut. Das ist das schönste Weihnachtsgeschenk, Hella, der Spuk ist Gott sei Dank vorbei!«
Endlich wurde sie klarer im Kopf, langsam richtete sie sich auf. Meinhard schob seinen Arm stützend hinter ihren Rücken.
»Weil ihr ihn ermordet habt!«
»Was sagst du da?« fragte Meinhard, nur kurz erstaunt, dann lachte er schallend und rief in die Runde: »Meine Frau meint, wir hätten kurzen Prozess gemacht! Wie sollen wir ihn denn gekillt haben? Wurde er mit der Pferdekutsche überrollt? Haben wir ihn mit einbetonierten Füßen im Hafenbecken schwimmen geschickt, oder was?«
Die anderen schienen sich ebenfalls zu amüsieren. Hella nahm das Geräusch eines aus der Flasche springenden Sektkorkens wahr.
»Zugegeben, Lust hätte ich schon gehabt, ihm sein überhebliches Grinsen mit Gewalt aus dem Gesicht zu schlagen. Aber wir haben es auch ohne Blutvergießen geschafft. Ist doch auch besser so, erspart uns lebenslängliches Zuchthaus.«
Ein allgemeines Prosit füllte den Raum, Gläser klirrten aneinander.
»Nein, wir haben ihn natürlich mit legalen Mitteln in die Flucht geschlagen. Ich sagte doch: Diekkant ist gut gerüstet. Peter vom Ordnungsamt hat im Rathaus ein paar Unterlagen gefunden, die belegen, dass damals, als der Hafen noch weiter östlich lag, auf dem Grundstück Altöl gelagert wurde und vor jeglichen Baumaßnahmen erst einmal bis zu zehn Metern tief der kontaminierte Sand entsorgt werden muss. Da schluckte der feine Herr aus Berlin erst einmal tüchtig. Die Pläne für das Hotel hat er dann gar nicht erst ausgepackt.«
»Er ist tot«, sagte Hella. »Ich wollte die Gardinen schließen, da sah ich ihn ... am Fenster neben der Vitrine ...«
»Was redest du da? Hella, kann es sein, dass du irgendwie durcheinander bist?« Hella entging nicht der fragende Blick, den ihr Mann Richtung Apothekerin schickte.
»Seht doch nach. Er muss dort liegen.«
Zwei oder drei Gäste gingen zum Fenster, reckten die Hälse, legten die Hände ans Glas und spähten hinaus. »Keiner da«, sagte einer.
»Er ist genau dort zusammengebrochen!«
»Liebling, der Kerl ist bestimmt zusammengebrochen, aber wahrscheinlich erst in seinem Hotelzimmer, wo er jetzt gerade wahrscheinlich vor lauter Frust die Minibar leer trinkt.«
Hella spürte wieder Leben in ihrem Körper, also stand sie auf und lief mit wackeligen Beinen zur Terrassentür. »Sein Hut liegt im Schnee!«
Sie zeigte hinaus in den Garten. Die Leute kamen und folgten mit den Augen ihrem Finger, dann schüttelten sie die Köpfe, die meisten sahen besorgt von ihr zu Meinhard. Endlich blickte Hella selbst zum Rasen. Da war nichts. Keine Erhebung, keine Spur und erst recht kein Hut. Glatt und eben glänzte der Schneeteppich unter dem Nachthimmel.
»Ich habe ihn gesehen. Erst dachte ich, sein Kopf sieht seltsam aus, jetzt weiß ich, ihr habt ihm den Schädel eingeschlagen. überall war Blut.«
Hella ging zum Seitenfenster. Wo waren die dunklen Schlieren? Die Scheibe war sauber, von innen und außen. Als sie sich schließlich traute, zu Boden zu blicken, lag dort kein Körper, sondern nur unberührter Schnee, der sich bis zur handbreiten Taukante an die Hausmauer gelegt hatte.
Langsam drehte Hella sich um. Jeder im Raum starrte sie an, jeder Blick schien sie festnageln zu wollen. Da waren sie, die abertausend Augen. Die Apothekerin, der Glatzkopf vom Ordnungsamt, die Fährticketkontrolleurin, der Bäcker, ihr Mann, sie waren alle da. »Wie habt ihr das gemacht?«
»Wir haben nichts gemacht!« versuchte es Meinhard, doch seine Worte klangen alles andere als fest. Er kam auf sie zu und wollte ihre Hand nehmen, doch sie schüttelte ihn ab.
»Ihr habt uns doch gesehen. Gestern in der Woge. Wie wir geredet haben. Wie wir gelacht haben. Da wusstet ihr, dass ihr mich nicht auf eure Seite kriegt. Deswegen habt ihr euch nun gegen mich verschworen.« Hella schaute die Fährticketkontrolleurin direkt an. »Du hast uns noch so überschwänglich gegrüßt.«
Die Frau blickte verlegen zu Boden. »Ich habe dich gegrüßt, Hella. Dich. Da war sonst niemand.«
»Was?«
Es kam keine Antwort, keine Erklärung. Irgendjemand sagte nur leise: »Um Himmels Willen.«
»Das könnt ihr nicht mit mir machen. Nur weil ich diesen Mann mit Hut nicht zum Teufel gejagt habe? Nur weil ich nicht Amok laufe, wenn jemand auf unserer Insel ein kleines bisschen verändern will? Deswegen tut ihr jetzt alle zusammen so, als wäre ich nicht mehr ganz dicht?« Hella schaute sich wild um, doch niemand hielt ihrem Blick stand. Was war mit dem Bäcker? »Mensch, du bist doch heute morgen mit deinem Anhänger an uns vorbei gelaufen. Weißt du das auch nicht mehr?«
Er druckste. »Ja, dich habe ich gesehen. Aber warst du nicht allein unterwegs?«
»Wie bitte? Ich kam mit ihm vom Strand, er ging direkt an meiner Seite, das wird dir doch nicht entgangen sein ...«
Meinhard nahm Hella fest in den Arm, und obwohl sie sich wehrte, ließ er nicht mehr von ihr ab. »Der Architekt ist erst heute Nachmittag mit dem Schiff angekommen.«
»Das stimmt!«, bestätigte die Fährticketkontrolleurin ungefragt.
Das Luftholen fing wieder an. Zwanghaft hob und senkte sich Hellas Brustkorb im schnellen Rhythmus. Sie konnte nichts dagegen tun.
»Okay, ich bin anders als ihr, ich bin keine von euch, alles klar.« Es war verdammt schwer, zu sprechen. Die Worte fanden kaum eine Lücke zwischen den Atemzügen. »Aber warum tut ihr mir das an?«
»Sie hyperventiliert wieder«, sagte die Apothekerin mit beherrschter Stimme. »Holt eine Plastiktüte.«
»Nein!«, schrie Hella. »Die Fotos! Gebt mir meinen Fotoapparat. Ich habe ihn geknipst. Das ist der Beweis. Das Bild. Er hatte rote Ohren.«
Irgendjemand reichte ihr nach unendlichen Sekunden die Kamera. Hella fühlte sich trotz des Staccatoatmens ruhiger, gleich würden sie sehen, dass sie die Wahrheit sagte. Mit zitternden Fingern drückte sie die Knöpfe, die den Bilddurchlauf starteten. Das Display leuchtete auf. »Da!« sagte Hella, denn mehr ging nicht mehr. »Da ... Bilder … vom Strand ...«
Ihre Hände wurden taub, im Kopf schien alles in sich zusammenzusinken. Ich sterbe, dachte Hella, ich ersticke, ich brauche Luft. Irgendjemand kam auf sie zu mit einer schwarzen Kunststofftüte in der Hand, sie blickte in die ausgebreitete Öffnung.
»Nein!«, sagte Hella. »Nein!«
Es wurde dunkel um sie herum. Feucht und warm blieb der Atem zwischen Lippen und Plastik stehen.
»Die Aufnahme hat sie heute gemacht«, hörte sie nur noch dumpf die Stimme ihres Mannes sagen. »Am Strand, schaut euch das an. Nur ein Bild. Viel ist nicht darauf zu erkennen. Lediglich ein paar Spuren im Sand.«
007 überm Watt
Ich nehme lieber die Fähren. Auch wenn es irrsinnig Stunden kostet; in der Zeit, in der man von Borkum nach Juist kommt, fährt man mit dem Auto von Hamburg nach Frankfurt. Wohlgemerkt, die beiden Nachbarinseln liegen nur sechs Kilometer auseinander. Trotzdem hocke ich ganz gern auf den weißen Passagierschiffen und esse Bockwurst mit Kartoffelsalat, während ich von Insel zu Festland und dann wieder zur Insel übersetze. Ich kann in der Zeit am Laptop arbeiten, ich kann Zeitung lesen, kann Musik hören, kann so vieles. Aber im April schaffe ich das einfach nicht.
Meine Nordsee-Apotheken-Filialen auf den sieben ostfriesischen Inseln öffnen alle zu Beginn der Osterferien, alle innerhalb einer Woche. Und da muss ich mich als Geschäftsführerin blicken lassen, um mit den Angestellten die neuen Produkte und Medikamente durchzugehen. Im Frühjahr drängt die Zeit, also mache ich dann eine Ausnahme und nehme den Flieger. Aber nicht Linienflug, so etwas findet leider nicht statt zwischen Borkum und Wangerooge. Es gibt nur einen, der die einzelnen flachen Sandbänke täglich von der Luft aus miteinander verbindet, und das ist der Kinoflieger: Ole Feddersen Luftverkehrs GmbH Mariensiel bei Wilhelmshaven.
Feddersen, ein alter Haudegen, fliegt selbst nicht mehr. Aber er hat eine kleine Staffel abgebrannter Kamikazepiloten um sich geschart, die mit insgesamt zwei altersschwachen einmotorigen Cessnas die Kinofilmrollen der Lichtspielhäuser auf den Inseln austauschen. Dirk ist zum Beispiel der Sohn von Feddersen und hat eigentlich keine große Meinung vom Fliegen, macht es aber seinem Vater zuliebe, übrigens mehr schlecht als recht. Manfred war lang bei der Luftwaffe in Wittmund, jetzt leidet er an schweren Depressionen, hat er mir mal während eines Fluges erzählt. Am merkwürdigsten in diesem ohnehin schon merkwürdigen Unternehmen ist Pekinese, dessen richtigen Namen keiner kennt. Der aber seinem falschen Namen alle Ehre macht, denn seine Nase ist ebenso platt wie die des Zuchthundes, nur dass sie nicht gewollt, sondern Ergebnis einer Schlägerei gewesen ist. Seine Augen stehen unheimlich weit heraus. Ich als Pharmazeutin habe lange vermutet, dass er an einer Schilddrüsenüberfunktion leiden könnte, damit ließe sich auch sein jähzorniges Verhalten erklären. Heute weiß ich es besser.
Keiner weiß, warum Ole Feddersen es sich leisten kann, drei Piloten anzustellen. Auch wenn Dirk, Manfred und Pekinese nicht zur Eliteeinheit der Fliegerzunft gehören, niemand glaubt, dass man mit dem Herumfliegen von Kinofilmen so viel Geld verdienen kann. Einige glauben an einen Lottogewinn und Feddersens gutes Herz.
Ich glaube nicht daran. Schon lange nicht mehr. Genau genommen seit letztem April.
Wir hatten die Tour von Osten aus begonnen. Wangerooge bis Baltrum hatte ich an einem Tag geschafft und die Nacht schon auf Norderney verbracht. Seitdem die Krankenkassen noch knauseriger beim übernehmen der Arztrezepte waren, hatte ich alle Hände voll zu tun, die Mitarbeiter in meinen Nordsee-Apotheken für die kommende Saison zu motivieren. Die Geschäfte liefen nicht wirklich gut; ich dachte über die Schließung unserer Filialen auf Baltrum und Spiekeroog nach.
Ich wusste, dass der Flieger um 11 Uhr auf dem Flugplatz hinten beim Leuchtturm zum Weiterflug nach Juist abhob. Zugegeben, alles war ein wenig hektisch an diesem Morgen, ich hatte nicht genügend Zeit, mein graues Kostüm gegen etwas Bequemeres zu tauschen, doch die Taxe lieferte mich immerhin pünktlich ab. Nicht ohne Kommentar, denn der Wind hatte ordentlich zugelegt und die kleinen Propellermaschinen waren alles andere als komfortabel.
»Hals und Beinbruch«, wünschte der Fahrer und blieb etwas länger als gewöhnlich beim Tower stehen, wahrscheinlich weil er neugierig war, ob ich mit meinen Lederschuhen, meinem Wollmantel und dem engen Rock tatsächlich in die winzige, nicht wirklich stabil wirkende Maschine stieg.
Ausgerechnet Pekinese hatte Dienst und saß schon im Cockpit. Er grinste breit und seine platte Nase zog eigenartige Falten über das ganze Gesicht. Er stand nicht auf, um mir beim Einsteigen zu helfen, er kontrollierte auch nicht, ob meine Tür korrekt geschlossen war. Er sagte nur: »Könnte ungemütlich werden.« Dann warf er den Propeller an, und es war zu laut für mich, um großartig nachzufragen, wie ungemütlich denn. Ich wusste nur, er meinte weder die zerschlissenen Pilotensitze, das klapprige, undichte Seitenfenster, noch die geringe Beinfreiheit. Wir rollten los. Nun war es eh zu spät, um noch irgendwelche Prioritäten zu setzten, Job oder Leben oder so etwas in der Art. Wir wurden schneller.
Ich schob meine kleine Aktentasche zwischen den engen Sitzen hindurch nach hinten. Dann hörte man einen zerhackstückten Funkspruch aus dem Tower, und wir hoben ab. Obwohl wir keinen Bodenkontakt mehr hatten, rumpelte es, als quälten wir uns über mittelalterliches Kopfsteinpflaster. Ich bekam eine Ahnung von ungemütlich und hielt mich an der Sitzkante fest, während ich stur geradeaus blickte.
»Nordwind«, sagte Pekinese. »Stärke 5 bis 6.«
»Aha.«
»Wird gleich besser. Das sind nur die Luftverwirbelungen durch die Dünen. Sobald wir oben sind …« Er zog am Steuer und wir stiegen im steilen Winkel höher. Ich hätte gern eines meiner Reisekaugummis aus dem Medikamentenkoffer gezogen. Doch die Tasche lag hinter mir, und wenn ich mich umgedreht hätte, wäre mir sicher im selben Moment so übel geworden, dass es für medizinische Hilfe ohnehin zu spät gewesen wäre. Also blieb ich regungslos sitzen und schluckte meinen vermehrt auftretenden Speichel hinunter.
»… sobald wir oben sind, wird es ruhiger«, führte der Pilot den Satz zu Ende.
Tatsächlich stoppte das Poltern, und ich atmete das erste Mal seit einigen Minuten durch. Langsam löste ich meine verkrampften Hände und blickte Pekinese von der Seite an. »Das war wirklich ungemütlich!«