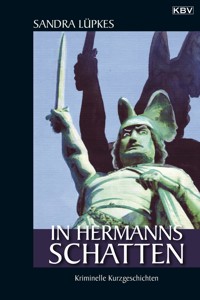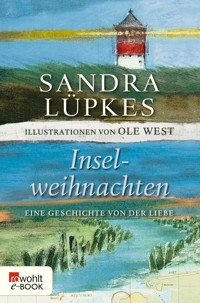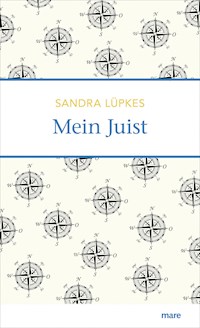
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: mareverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Um an der salzigen Nordseeluft ihr Asthma zu lindern, zog Sandra Lüpkes 1977 nach Juist, aufs »Töwerland«, wo sie im »riesigen Pfarrhaus in der Wilhelmstraße gegenüber vom Komposthaufen des Kirchfriedhofs« ihre Kindheit verbrachte. Mit fünfzehn wechselte sie aufs Festland, doch schon bald brachte die Liebe sie zurück auf die Insel, auf der sie eine Rockband namens Strandgut gründete, eine Ferienpension führte, Mutter, Schriftstellerin und Mitbegründerin eines Stipendiums für Krimiautor*innen wurde, bevor sie Juist erneut verließ. Aus der liebevoll-kritischen Distanz des Berliner Exils berichtet Sandra Lüpkes nun von Bräuchen wie Maibaum-Raub und »Sünnerklaas«, Delikatessen wie »Sniertjebraa« und (hochprozentiger) »Bohntjesopp« und dem Leben in einer Gemeinschaft, in der man während der Hochsaison weder Kinder bekommen noch sterben sollte, wenn man seinen guten Ruf nicht ruinieren will.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 205
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sandra Lüpkes
Mein Juist
© 2022 by mareverlag, Hamburg
Karte Peter Palm, Berlin
Covergestaltung Nadja Zobel, Petra Koßmann / mareverlag
Coverabbildung © Seamartini / Dreamstime.com
Datenkonvertierung E-Book Bookwire
ISBN E-Book: 978-3-86648-808-3
ISBN Hardcover-Ausgabe: 978-3-86648-675-1
www.mare.de
Inhalt
Davor-Wort
Zauber & Realität
Ebbe & Flut
Norden & Süden & Westen & Osten
Land & Meer
Erlaubt & Verboten
Sommer & Winter
Arbeit & Urlaub
Laut & Leise
Flora & Fauna
Zwischen & Drin
Kommen & Gehen
Leib & Seele
Danach-Wort
Dank
Quellen
Davor-Wort
Juist – siebzehn Kilometer lang, je nach Wasserstand etwas mehr oder etwas weniger als einen Kilometer breit, an der höchsten Stelle stolze zweiundzwanzig Meter über dem Meeresspiegel, autofrei und ziemlich kompliziert zu erreichen – ist meine Heimat. Ich habe dort sowohl meine Kindheit als auch die prägende Zeit des Erwachsenwerdens verbracht und kenne jeden sandigen Quadratmeter (es gibt ja nicht so viele).
Schuld daran sind meine Lungen. Bevor ich zum Inselkind wurde, lebte ich mit meinen Eltern und meinen beiden Brüdern in einem Dorf in der Nähe von Göttingen und war das Sorgenkind der Familie, da ich unter schwerem Asthma litt und die Ärzte prophezeiten, ich würde nicht alt werden, es sei denn, ich zöge an die Nordsee, am besten sogar auf eine Insel. Damals gab es etliche Kinderheime an der Küste, in denen Fälle wie ich langfristig untergebracht werden konnten, doch meine Eltern hatten von anderen betroffenen Kindern gehört, die nach diesem Kuraufenthalt nach Hause kamen und Vater und Mutter fortan siezten. Deshalb entschieden sie sich, wennschon, dennschon umzuziehen. Dass es uns nach Juist verschlug, war Zufall, es hätte auch Langeoog werden können, denn diese Insel kannten meine Eltern bereits. Doch weil eben auf Juist eine Pfarrstelle frei wurde – mein Vater war Pastor, meine Mutter Krankenschwester –, setzten wir im Februar 1977 dorthin über.
Dieses Buch wird Geschichten aus meiner Kindheit erzählen, als ich in diesem riesigen Pfarrhaus in der Wilhelmstraße gegenüber vom Komposthaufen des Kirchfriedhofs aufwuchs. Obwohl das nach Idylle und Bullerbü klingen mag, erwarten Sie bitte keine Erzählungen von kerngesunden Frischluftmenschen mit Blondhaar und roten Wangen. Ich machte niemals einen Segelschein und hatte auch kein eigenes Pony. Die aufregenden Orte meiner Kindheit und frühen Jugend waren die Postschließfächer hinter dem Rathaus, die Bunker in den Dünen, der Backstagebereich im Haus des Kurgastes.
Das schlimme Asthma verflog dank der gesunden Aerosole tatsächlich vollständig, und als mir mit fünfzehn die Insel zu klein wurde, wechselte ich ins Internatsgymnasium nach Esens. Mein Abitur machte ich schließlich am Ulrichsgymnasium in Norden, weil meine Eltern und Brüder inzwischen ebenfalls die Insel verlassen hatten und dort lebten. Danach absolvierte ich eine Ausbildung zur Schauwerbegestalterin in Hannover, um dann – zum Erstaunen aller, selbst zu meinem eigenen – wieder nach Juist zu ziehen.
Die Liebe war der Grund. Gemeinsam mit meinem ersten Mann kaufte ich ein ziemlich heruntergekommenes Haus im Ortskern, baute es zu einem Gästehaus um, half ab und zu im Fahrradverleih, der in der hölzernen Veranda untergebracht war, bekam zwei wunderbare Töchter, machte mich selbstständig als Werbegestalterin, schrieb Artikel für den Strandlooper (das ist die Veranstaltungsbroschüre auf Juist) oder den Ostfriesischen Kurier, engagierte mich für die Jugendarbeit und in der Kommunalpolitik, gründete eine Rockband …
Die zweite Juist-Phase in meinem Leben war also ebenfalls von Atemlosigkeit geprägt, jedoch nicht krankheitsbedingt, sondern eher meiner Suche nach dem für mich richtigen Weg geschuldet. Als ich ihn schließlich fand, führte er mich fort von Juist. Entließ mich in eine neue Perspektive, machte mich zu einer Beobachterin aus der Ferne.
So richtig dazugehörig fühlte ich mich dieser eingeschworenen Inselwelt nie. An den Einheimischen lag es nicht, die sind Neuem gegenüber größtenteils aufgeschlossen. Die in Filmen und Büchern gern zitierte Szene – feindselige Mienen und verstummende Gespräche, sobald Fremde die Kneipe betreten – ist ein Klischee. Den insularen Prototyp gibt es ohnehin nicht, die Menschen leben aus unterschiedlichen Gründen auf Juist, und die meisten sehr gerne. Viele von ihnen haben mich zur Vorbereitung für dieses Buch die Insel aus einem anderen Blickwinkel sehen lassen, durch sie hat das, was ich erzählen möchte, an Farbe und Tiefe gewonnen. Wenn jedoch alle rund 1500 mit erstem Wohnsitz auf Juist Gemeldeten ein Buch mit dem Titel Mein Juist schreiben sollten, kämen 1500 verschiedene Werke dabei heraus. Das Fünffache wäre es, wenn plötzlich jeder Gast zur Feder griffe. Mein Juist ist nicht dein Juist.
Ich bin stolz und glücklich, dass der mareverlag am Ende mich ausgesucht hat, dieses subjektive Inselporträt zu schreiben. Denn ich bin – und war es im Grunde wohl schon immer – Schriftstellerin. Und eins der herausstechenden Talente, die man für diesen Beruf mitbringen muss, ist die richtige Sehstärke (wäre ich, wie früher, noch in der Werbung tätig, könnte ich mir das Wortspiel »Seestärke« an dieser Stelle nicht verkneifen, aber zum Glück bin ich inzwischen rein literarisch unterwegs). Einerseits braucht es Weitsicht, um Dinge, die ringsherum geschehen, in den großen, bedeutenden Zusammenhang zu stellen. Andererseits schaue ich auf kurze Distanz wie unter einem Brennglas ganz genau hin und versuche, mir nichts vorzumachen. Meine Sichtweise auf die Insel Juist zeigt entsprechend andere Ausschnitte als die, die man in Prospekten, auf Websites oder Postkarten präsentiert bekommt. Wenn ich von den insgesamt dreiundzwanzig Jahren, die ich auf Juist lebte, erzähle, blicke ich oft in enttäuschte Gesichter, denn ich beschönige nichts. Das sollten Sie wissen, bevor Sie sich an die Lektüre wagen. Es ist eine wahrhaftige Liebeserklärung an die Insel Juist. Aber eben eine für Fortgeschrittene.
Ich bin froh, inzwischen im großen Berlin zu Hause zu sein. Diese Stadt hat wie ich eine Inselvergangenheit, nach der sich keiner zurücksehnt. Heimweh habe ich nämlich nie. Muss ich auch nicht haben. Denn das, was ich an Juist liebe, trage ich für immer in mir. Juist hat mir einen inneren Kompass eingepflanzt, mit dem ich mich überall auf der Welt zurechtfinden kann. Die Insel hat mich das Navigieren gelehrt zwischen Gegensätzen, denen ich auf so engem Raum nicht ausweichen konnte. Ich habe gelernt, damit zu leben, daran zu wachsen, und festgestellt, dass es eigentlich keine Grenzen mehr gibt, an denen ich mich noch stoßen könnte. Die Zeit auf Juist war meine Ausbildung zur Mikrokosmonautin.
Diejenigen, die den »Juister Kompass« ebenso in sich tragen, werden verstehen, was ich meine. Und an die Lesenden, die Angst davor haben, das Buch zuzuschlagen und komplett des-illusioniert zu sein: Keine Sorge! Nicht umsonst trägt die Insel den Beinamen »Töwerland« (= Zauberland). Diese Bezeichnung ist keine moderne Marketingerfindung, sondern schon viele Generationen alt. Töwerland, die kleine Insel, auf der sich die große Welt erklären lässt, wo die Uhren anders ticken und wo Norden im Süden liegt.
Zauber & Realität
An den Rand von de Welt vör Ostfreeslands Küst
liggt verdrömt in de Sünn uns Töwerland Juist
Maakt dat Hart uns so riek, voll Freid un vull Lüst
denn uns Lev is so grot to uns Eiland, uns Juist
Juister Dün’n, Juister Strand un de solten See
Plattdütsk Taal, oll Maneern un de Klottjeree
Fast as Isen dit Band an de Insel uns holt
denn uns Lev is so grot to uns Eiland, uns Stolt
Stritt sick Ström ut Nordwest mit de blanke Hans
üm de Strand un de wittgröne Dünenkranz
denn bewohr uns, o Herr, vör Skaad un Verlüst
hol in Gnaden din hillige Hand över Juist
Das Schiff legt an, ich gehe von Bord und finde mich wieder im vertrauten Tumult des kleinen Hafens. Manche warten bereits an der Gangway und rufen »Oh, wie blass!« und »Hut ab! Hut ab!«, denn so werden Ankömmlinge begrüßt von jenen, die bereits länger auf Juist weilen, im Sand geerdet und von der Sonne geküsst worden sind. Das war schon vor hundert Jahren so, als der Juister Werbeprospekt ein »vornehmes Familienbad« und »gesellige Fröhlichkeit« sowie »natürliche Heilkräfte der Natur« anpries. Eine Weile ist dieser Willkommensbrauch zum Erliegen gekommen, doch man wusste stets, dass es ihn gab, und irgendwann hat wieder jemand damit angefangen. Vermutlich um zu verdeutlichen: Seht her, wir sind vertraut, die Insel und ich! Wir haben viele gemeinsame Jahre auf dem Buckel, wie ein altes Ehepaar, und lieb gewonnene Gewohnheiten pflegen wir, auch wenn sie manchem, der keine Ahnung hat von den Juister Eigenarten, seltsam vorkommen mögen. Aber uns ist nichts mehr peinlich voreinander, am Hafen rufen wir ungeniert Wildfremden etwas zu und schwenken unsere Kopfbedeckung: »Oh, wie blass! Hut ab!«
Im Hafengebäude entwerte ich mein Fährticket, trete nach draußen und laufe durch das Spalier der Kofferfahrer, die mir zunicken wie einer alten Bekannten, doch sicher bin ich nicht, ob sie sich meiner wirklich erinnern. Zu lange schon lebe ich nicht mehr hier. Und die Zeiten ändern sich, selbst auf Juist. Das weiße Seezeichen am Ende der Seebrücke, filigran und doch massiv, in der Vertikalen schräg, in den Horizontalen gerade, gab es zu meiner Zeit noch nicht. Heute ist es eine etablierte Sehenswürdigkeit mit gut besuchter Aussichtsplattform, lohnendes Ziel für einen kleinen Spaziergang und das Logo der Kurverwaltung. Es gleicht einer Boje, die im strömungsreichen Meer treibt. Welch passendes Bild. Ich mag es sehr.
Mein Ankommen fühlt sich an wie ein Wiedersehen mit einem Verflossenen, an dessen Seite ich viele Jahre glücklich gewesen bin, mit dem ich mich dann aber auseinandergelebt habe. Einerseits grundvertraut, andererseits verändert, fast fremd, dass ich nicht glauben mag, jemals dort zu Hause gewesen zu sein. Früher schwer verliebt, dann verflog der erste Zauber und heute … Ja, was ist es heute für mich? Mein Juist?
»Achtung! Vorsicht! Platz da!«, brüllt es von allen Seiten und ich muss auf dem Weg zu den Gepäckcontainern gleich mehrfach ausweichen, den radelnden Inselmenschen, den Hafenbetriebsfahrzeugen oder Planwagenkutschen. Oje, wieder einmal habe ich die Nummer des Anhängers vergessen, in dem ich meinen Koffer verstaut habe. War es die Nummer 36? Oder 71? War es die Seite A oder B? Habe ich ihn ganz unten, in der Mitte oder oben platziert? Früher war das einfacher, da hatten die Gepäckcontainer bunte Farben, das konnte ich mir besser merken. Ich muss lange suchen, doch ich bin nicht die Einzige, ein Gewimmel an Menschen wie am Gepäckband im Flughafen auf Mallorca. Alle haben es furchtbar eilig mit dem Beginn der Erholung. Dies sind die letzten Minuten hektischer Betriebsamkeit zum Abgewöhnen und Runterfahren. Spätestens wenn ich durch die Deichscharte getreten bin, herrscht Ruhe.
Dann liegt das Festland hinter und die Insel in ihrer ganzen Breite vor mir. Rechts das Ostdorf, links die Billstraße, geradeaus das Dorf, der Kurplatz, die Inselkirche, der Wasserturm. Die Nordsee dahinter, das weiß ich, ohne sie zu sehen. Die kleine Welt erklärt sich immer wieder neu und immer wieder gleich.
Wer die Insel das erste Mal betritt, entscheidet sich wahrscheinlich genau jetzt und an dieser Stelle, ob mehr daraus werden wird. Innerhalb einer unbewussten Zehntelsekunde, denn so lange dauert nach wissenschaftlichen Kenntnissen die sagenhafte »Liebe auf den ersten Blick«. Die blitzartige Erkenntnis, dass mir gefällt, was ich sehe, rieche, höre, schmecke und fühle. Dass ich mehr davon möchte, und zwar sofort und vielleicht sogar für den Rest meines Lebens.
Ist die Suche nach der großen Liebe nicht der beste Grund, das vertraute Nest zu verlassen und eine beschwerliche Reise mit ungewissem Ausgang zu unternehmen? Denn irgendwo – und vielleicht eben konkret an der Juister Deichscharte, zwischen der roten und der grünen Leuchttonne, die den Ortseingang markieren – wartet das Glück. Endlich dort angekommen, lassen wir die zehrende Sehnsucht hinter uns und werden eins mit dem Moment.
»Verliebt in Juist«, so lautete der Werbeslogan, der als Aufkleber in den 1980er-Jahren manchen Koffer und Kofferraumdeckel zierte. Das dazugehörige Logo zeigte zwei sich küssende Fische, zwischen deren Mündern herzförmige Blasen emporstiegen. Verliebt in Juist – wen es erwischt hat, dem flattern Möwen statt Schmetterlinge im Bauch.
Juist hat schon unzähligen Menschen das Herz gebrochen, die nach der ersten Begegnung fiebrig auf die nächste warten, die das Internet durchforsten nach jedem Schnipsel über die Geliebte und alles, einfach alles wunderbar finden, selbst wenn die Angebetete sich von ihrer anspruchsvollen und komplizierten Seite zeigt. Da duften die Pferdeäpfel wunderbar würzig und obwohl der Sand zwischen den Zehen reibt, ist kein Weg zu weit. Die von Amors Pfeil Getroffenen liefern sich Nordseewind und Frieslandregen schutzlos aus, wenn sie nur bei ihr, auf ihr, mit ihr sein dürfen.
Doch vielleicht ist es auch bloß eine Liebelei, ein klassischer Urlaubsflirt, befeuert durch die sorglose Ferienzeit, gefärbt durch den rosaroten Schimmer einer über dem Meer untergehenden Sonne? Wird dieser Zauber auch dann noch wirken, wenn man das zweite, dritte oder x-te Mal nach Juist fährt?
Irgendetwas muss sie an sich haben, diese Insel, dass die sie Verehrenden ihr treu bleiben, und zwar über viele Jahre hinweg. Jeder zehnte Gast ist schon mehr als dreißig Mal da gewesen und führt so etwas wie eine Fernbeziehung. Eine Liebe also, die mehr von Vorfreude und Erinnerungen gespeist wird als vom eigentlichen, dann aber umso intensiveren Beisammensein. Die Stammgäste buchen bereits am Tag der Abreise den Urlaub für das nächste Jahr, damit sich die Sehnsucht dazwischen aushalten lässt.
Wie sieht er aus, der typische Gast, dem die Insel den Kopf verdreht hat? Erst einmal: Er ist eine Sie. Genauer: eine Frau aus Nordrhein-Westfalen, Mitte fünfzig, Akademikerin, gut situiert, belesen, eine pflicht- und umweltbewusste Genießerin, die auch offen ist für neue Impulse. Nein, dieser Text wurde keiner Kontaktanzeige eines Datingportals mit Niveau entnommen, sondern ist die Zusammenfassung einer statistischen Erhebung, die im Auftrag der Kurverwaltung durchgeführt wurde. Ihre Hobbys sind Spazierengehen und Radfahren und sie ist auf der Suche nach Ruhe, Natur und dem nötigen Abstand zum Alltag. Ich habe sie direkt vor Augen, diese statistische Dame aus Westfalen, nur erweckt sie nicht den Eindruck, sich allzu leicht verzaubern zu lassen.
Siebzig Prozent der Juist-Gäste nennen die Insel ihr »zweites Zuhause«. Aber nehmen wir mal an, die verzauberte Mittfünfzigerin aus Nordrhein-Westfalen beschließt nun eines schönen Tages, dass es ihr nicht mehr reicht mit den kurzen Episoden zwischen Vorfreude und Erinnerung, sie will mit ihrer großen Liebe zusammenziehen, um aus dem zweiten ein erstes Zuhause werden zu lassen, und packt nicht nur die Koffer, sondern gleich den Möbelwagen. Das passiert nicht selten. Bei der Inselschule bewerben sich beispielsweise regelmäßig Lehrerinnen – es sind wirklich bislang immer Frauen gewesen –, die davon träumen, ihre letzten Berufsjahre vor der Pension an einem Ort zu verbringen, wo andere Urlaub machen. Klassen mit höchstens zehn Kindern, eine Dienstwohnung im abgelegenen Dünental, stundenlange Strandspaziergänge nach der sechsten Stunde – das muss doch paradiesisch sein. Andere träumen von einem Bioladen im Ostdorf oder heuern als Servicekraft in der Teestube an.
In Buchhandlungen sind ganze Regale gefüllt mit Romanen, in denen Frauen auf »ihre« Insel ziehen, um dort ein neues, um dort das richtige Leben zu beginnen. Ich weiß, wovon ich schreibe, eine dieser Romanreihen stammt aus meiner eigenen Feder und handelt von einer Schlagersängerin, die es nach dem Karriereknick auf eine Nordseeinsel verschlägt, wo sie ein heruntergekommenes Leuchtturmwärterhaus zum Hotel umbaut. Zwischen anderen Buchdeckeln reisen Standesbeamtinnen nach Usedom, Ärztinnen nach Pellworm, Journalistinnen nach Borkum und Buchhändlerinnen nach Föhr. Diese Romane enden meist, wenn die Heldin Wurzeln in die Dünen geschlagen, den ersten Sturm überstanden und sich in den Briefträger (alternativ Reetdachdecker, Schwimmmeister, Fischer oder Pensionsbesitzer) verliebt hat.
Im wahren Leben geht die Beziehung zwischen Zugezogenen und dem Töwerland nun in die wahrscheinlich schwierigste Phase: Man verbringt den Alltag zusammen. Auf einer abgeschiedenen Nordseeinsel wie Juist bedeutet das: Man wacht morgens zwischen Deich und Dünen auf und schläft abends zwischen Deich und Dünen ein. Am Vormittag trifft man Jan und Grete beim Einkaufen, am Nachmittag trifft man Jan und Grete beim Sportmachen, und wenn man am Tagesende ins Kino geht, wer sitzt da neben einem? Jan und Grete. Die ambitionierten Lehrerinnen haben ihren Traum vom Inselleben jedenfalls nach überschaubarer Zeit sämtlich wieder aufgegeben und sind an Land zurückgekehrt. Denn wenn Jan und Grete nun auch noch deine Schule besuchen oder die Eltern deiner Schulkinder sind oder aus deinem Kollegium stammen und dann noch im Winter das Schiff nicht fährt und bis zu den nächsten Ferien ist es noch lange hin – spätestens dann wird es anstrengend. Man kann sich eben nicht einfach eine kleine Auszeit von der Insel nehmen, wie es gerade passt. Da muss schon Hochwasser sein.
Wenn die Schiffe nicht fahr’n, weil der Wind stark aus Ost bläst
und du lieber im Haus bleibst, weil du sonst ganz zur Bill wehst
wenn die Salatköpfe kahl sind und die Milch wird sauer
dann fange ich an, dass ich mich selber bedauer
dann gibt es den allergrößten Verdruss
das nennt man Inselwinterblues
Ich krieg nicht die Kurve und bleib lieber im Bett
lese dort das Telefonbuch, kenn’ es schon von A bis Z
und weil das Juister so kurz ist, studier ich gleich die gelben Seiten
sonst fange ich noch an mich mit mir selber zu streiten
bloß weil ich irgendetwas tun muss
gegen den Inselwinterblues
Wenn man sich endlich dran gewöhnt hat, ja, dann ist es
schon vorüber
dann ist auf einmal Ostern und die Insel, die quillt über
du stehst ’ne Stunde an, um dir ’ne Leberwurst zu kaufen
du kannst nicht mehr in Ruhe abends weggehen und einen saufen
dann ist mit der Langeweile Schluss
und du vermisst den Inselwinterblues
Im Sommer ist der Schiffsverkehr das kleinere Problem, dafür muss aber alles auf Hochtouren laufen. Freizeit wird zum Fremdwort, selbst wer nicht direkt im Tourismusbereich arbeitet, kann sich der allgemeinen Anspannung kaum entziehen.
Alles rauft sich zusammen. Weicht sich aus, wo es möglich ist. Arrangiert sich, wenn es sein muss. Schaut weg, wenn man etwas lieber nicht ganz so genau wissen will. Überlegt dreimal, was wirklich ausgesprochen werden muss. Das Zusammenleben auf der Insel gleicht einer ständigen Quarantäne.
Es gibt die These, dass sich der Begriff »Töwerland« auch aus dieser besonderen Form der isolierten Gemeinschaft heraus entwickelt haben könnte, weil das eigenbrötlerische Dasein ein Nährboden für Schauergeschichten und Aberglauben ist. »Spökenkieker« soll es hier geben, also Menschen, die in die Zukunft schauen und Unheil vorhersehen können, der Schimmelreiter lässt grüßen.
Verständlich, dass unserer Mittfünfzigerin aus NRW irgendwann doch etwas mulmig wird. Wird sie je dazugehören und die Mechanismen dieser Gemeinschaft durchschauen? Und will sie das überhaupt?
Seit einiger Zeit unterstützt auf Juist eine mit Landesmitteln geförderte Lotsin die Zugezogenen beim Manövrieren in neuen Fahrwassern. Schließlich gleicht die Inselgemeinde einer Bootsmannschaft, von der Brücke bis in den Maschinenraum wird an allen Ecken gearbeitet, jede Hand ist wichtig für das Weiterkommen. Das Vereinsleben ist rege, man kann in Trachten tanzen, Schützenkönigswürden erlangen, singen, musizieren, boßeln, segeln (auf dem Wasser und auf dem Strand), surfen, Theater, Tennis, Volleyball, Fußball, Badminton spielen, sich beim Roten Kreuz, bei der Freiwilligen Feuerwehr, in den Kirchengemeinden oder für den Klimaschutz engagieren.
Doch viele Inselneulinge und Arbeitskräfte auf Zeit holt man mit diesem Angebot nicht ab. Die fühlen sich mitunter orientierungslos und finden nicht so leicht Anschluss. Auch, weil einige nur ungern den Kurs ändern und es so nur selten zu Begegnungen außerhalb der eigenen Mannschaft kommt.
Klingt fast, als drohe die Inselgemeinde zu kentern. Tatsächlich wird der Standort Insel als sozial benachteiligt angesehen, obwohl es dort keine heruntergekommenen Wohnblocks, keine Arbeitslosigkeit, keine alarmierende Armut gibt.
Dafür spielt der Alkohol eine wesentliche Rolle. Wer das Glas nicht hebt, hat vordergründig ein Problem. Trinkfreudigkeit wird von einigen mit Geselligkeit verwechselt, in der Kneipe so lange Bier gebracht, bis man es explizit abbestellt. Ein paar Piccolöchen und Schnäpschen sind die legitime Methode, sich nach getaner Arbeit – und davon gibt es reichlich – zu belohnen. Entzugskliniken werden verharmlosend »Trockendock« genannt, der Aufenthalt dort als Erholungskur deklariert, die man sich einmal im Jahr gönnt.
Die Insellotsin weist hoffnungsvoll in eine andere Richtung. Auf zu neuen Ufern, die Insel bietet ein ganz besonderes Miteinander, solange sich nur genügend Menschen zusammenfinden, um das Ruder ab und zu herumzureißen.
Meinen Töchtern habe ich immer erzählt: Du gehörst erst richtig zur Insel, wenn du barfuß über Muschelbänke laufen kannst, ohne einmal »Aua« zu sagen. Eigentlich war das ein Trick, damit sie sich auf dem Weg zum Bade nicht zu zimperlich anstellten. Doch heute weiß ich: Da ist was Wahres dran. Du gehörst erst richtig zur Insel, wenn du aushältst, dass es auch mal unangenehm werden kann.
Das fängt bei der Wohnungssuche an, die oft vergeblich ist, denn auf der schönsten Sandbank der Welt (ein weiterer gern genutzter Slogan) gibt es zwar jede Menge Gästebetten – insgesamt knapp sechstausend –, aber kaum Unterkünfte für Einheimische und das dringend benötigte Saisonpersonal. Vor allem keine, die aus einem Otto-Normal-Verdiener-Portemonnaie gezahlt werden können.
Trotzdem gibt es immer wieder Menschen, die die Herausforderung bewältigen und ganz lange oder sogar für immer bleiben. Scholle zum Beispiel. Stammt aus dem Ruhrgebiet und ist mit seinen Eltern schon immer nach Juist in den Urlaub gefahren. Als Jugendlicher hat er es wild getrieben, mit fremden Autos rumgurken war eines seiner Hobbys, da war er noch keine sechzehn. Nach einer eher holprigen Schulkarriere war ihm dann selbst klar: Jetzt kommt es drauf an, nicht ganz aus dem Ruder zu laufen. Und Scholle entschied sich für Juist. Dort fühlte er sich wohl und sicher, dort konnte er nicht unbemerkt irgendwelchen Mist verzapfen, dort gab es – ein schlagendes Argument – keine Autos. Er machte eine Ausbildung zum Bäcker, jobbte auf dem Bau und in der Gastronomie, lernte seine jetzige Frau kennen, wurde Vater und führt seit einigen Jahren eine schnuckelige, etwas versteckt am Bootshafen liegende Open-Air-Bier- und Cocktailbar. Woanders wäre es vermutlich böse für ihn ausgegangen, hier auf der Insel hat er einen Ankerplatz gefunden. Zwischen Scholle und Juist, das war am Anfang vielleicht eine Zweckgemeinschaft, heute ist es … tatsächlich Liebe.
Inzwischen habe ich meinen Weg ins Inseldorf gefunden, mein Koffer rollt laut über das unebene Pflaster, vor dem Haus wartet bereits meine Gastgeberfamilie und heißt mich willkommen. »Moin, Sandra, schön, dass du wieder mal da bist!« Sie schenken Tee ein. Wir setzen uns an den Küchentisch. Wie es den Kindern geht, fragen wir gegenseitig, so groß sind die schon? Und dann lachen wir über Anekdoten, die früher mal passiert sind. Und über Anekdoten, die in der Zwischenzeit passiert sind. Bei der dritten Tasse schließlich über Gott und die Welt.
Juist und ich hatten eine gute Zeit und sind in beiderseitigem Einverständnis auseinandergegangen. Ich weiß genau, warum ich viele Jahre so gerne hier gelebt habe. Und ich erinnere mich ebenso an die Gründe, weshalb der Abschied nicht schmerzte.
Umso mehr freue ich mich über den Slogan, mit dem der Juist-Prospekt heute um die Gunst der Reisenden wirbt: »Juist – Freundschaft fürs Leben!«
Ebbe & Flut
Um die Gezeiten zu erklären, wage ich mal so etwas Ähnliches wie eine Familienaufstellung. Denn für mich sind Ebbe und Flut zwei gegensätzliche Schwestern: gemeinsame Kinder von Sonne und Mond – die sich permanent aus dem Weg gehen.
Die eine, die Flut, wahrscheinlich die Erstgeborene, gibt sich extrovertiert, stellt sich gern in den Mittelpunkt, sprudelt vor Energie, ist schön, verspielt und spektakulär. Doch auch ein wenig oberflächlich und versierte Meisterin darin, alles zu verdecken und abzulenken von dem, was unter dem Wasserspiegel liegt.
Die Ebbe steht seit Anbeginn im Schatten der Flut. Sie ist die ewig Zweite, der alles fehlt, was die Schwester hat, deswegen zieht sie sich zurück – und ist in ihrer Scheu tausendmal sinnlicher, weil sie duftet und atmet und flüsternde Laute von sich gibt. Die Ebbe zeigt viel Haut, schonungslos, mit ihren Adern und Poren und Narben.
Ohneeinander wären beide nichts. Und gefährlich sind sie jeweils auf ihre Art. Bei der Flut droht das Zuviel, die Stürme zerreißen das Land, überfluten die Wege, ertränken das Leben. Doch darf man die Ebbe nicht unterschätzen, denn ihr Zuwenig fordert ein, zieht die Badenden hinaus, bis sie den Boden unter den Füßen verlieren, oder lässt Treibsände entstehen, die das, was sie einmal zu fassen kriegen, nie mehr loslassen.
Schuld an diesem Dilemma sind wie immer die Eltern, die sich Monat für Monat nicht einig werden, wie sie ihre bipolaren Töchter in den Griff bekommen, und zudem ein Problem mit Nähe und Distanz haben. Ausgerechnet dann, wenn beide an einem Strang ziehen, wenn also Mond und Sonne in einer Linie stehen und ihre magnetischen Kräfte gleichzeitig auf die Erde einwirken, geht es besonders hoch her zwischen Ebbe und Flut. Dieses Phänomen wird Springtide genannt. Bei der Nipptide hingegen bildet die Anziehungskraft zwischen den Himmelskörpern einen rechten Winkel, dann nähern sich Hoch- und Niedrigwasser an und es geht etwas gemächlicher zu.