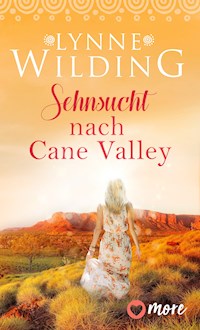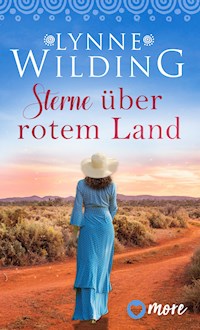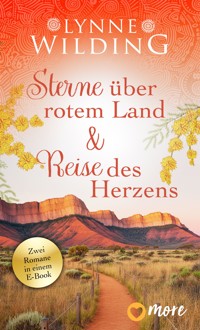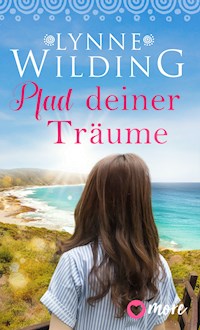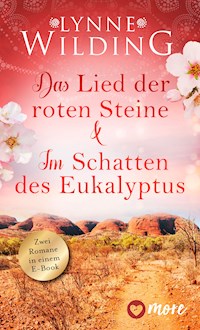
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwei großartige Australienromane von Lynne Wilding in einem E-Book. Das Lied der roten Steine. Eine große Liebe, ein altes Geheimnis und die Schatten der Vergangenheit. Jessica hat alles, was das Herz begehrt: Erfolg im Beruf, einen liebevollen Ehemann und einen kleinen Sohn, der ihr ganzen Glück ist. Doch dann stirbt der kleine Damian und Jessicas Welt gerät komplett aus den Fugen. Überstürzt und voller Trauer flüchtet sie aus ihrem alten Leben, um Ruhe auf Norfolk Island zu finden. Doch als sie in der Vergangenheit der ehemaligen Gefangeneninsel stöbert, stößt sie auf eine dramatische Geschichte, nicht ahnend, dass sie damit die Schatten der Vergangenheit heraufbeschwört ... Im Schatten des Eukalyptus. Rote Erde, weites Land ... Für Jason und Brooke d’Winters erfüllt sich ein Lebenstraum: Sie ziehen aus der Großstadt in das kleine Outback-Dorf Bindi Creek im Westen von New South Wales. Jasons Landarztpraxis floriert und auch Brooke liebt ihr neues Zuhause - bis das Schicksal unbarmherzig zuschlägt. Auf einmal steht Brook vor den Scherben ihres Lebens und erkennt: egal, wie weit man wegzieht, die Schatten der Vergangenheit holen einen immer wieder ein ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1199
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Informationen zum Buch
Zwei großartige Australienromane von Lynne Wilding in einem E-Book!
Das Lied der roten Steine.
Eine große Liebe, ein altes Geheimnis und die Schatten der Vergangenheit. Jessica hat alles, was das Herz begehrt: Erfolg im Beruf, einen liebevollen Ehemann und einen kleinen Sohn, der ihr ganzen Glück ist. Doch dann stirbt der kleine Damian und Jessicas Welt gerät komplett aus den Fugen. Überstürzt und voller Trauer flüchtet sie aus ihrem alten Leben, um Ruhe auf Norfolk Island zu finden. Doch als sie in der Vergangenheit der ehemaligen Gefangeneninsel stöbert, stößt sie auf eine dramatische Geschichte, nicht ahnend, dass sie damit die Schatten der Vergangenheit heraufbeschwört ...
Im Schatten des Eukalyptus.
Rote Erde, weites Land ... Für Jason und Brooke d’Winters erfüllt sich ein Lebenstraum: Sie ziehen aus der Großstadt in das kleine Outback-Dorf Bindi Creek im Westen von New South Wales. Jasons Landarztpraxis floriert und auch Brooke liebt ihr neues Zuhause - bis das Schicksal unbarmherzig zuschlägt. Auf einmal steht Brook vor den Scherben ihres Lebens und erkennt: egal, wie weit man wegzieht, die Schatten der Vergangenheit holen einen immer wieder ein....
Über Lynne Wilding
Lynne Wilding ist in Australien längst als die Königin der großen Australien-Sagas bekannt und erhielt viele Preise für ihre Romane. Lynne Wilding lebt mit ihrer Familie in Arncliff bei Sydney.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Lynne Wilding
Das Lied der roten Steine&Im Schatten des Eukalyptus
Zwei großartige Australienromane von Lynne Wilding in einem E-Book!
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Informationen zur Autorin
Newsletter
Das Lied der roten Steine
Vorwort
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Epilog
Danksagung
Im Schatten des Eukalyptus
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Danksagung
Impressum
Lynne Wilding
Das Lied derroten Steine
Australien-Saga
Aus dem Englischenvon Tanja Ohlsen
Für meinen Sohn Brett Gambley,in Liebe
Vorwort
Geologen behaupten, dass Norfolk Island bei einem Vulkanausbruch auf dem Grund des Pazifiks entstand, der Gestein bis zu einer Höhe von 318 m über dem Meeresspiegel auftürmte.
Die acht Mal fünf Kilometer große Insel liegt etwa 1700 Kilometer nordöstlich von Sydney. Über drei Millionen Jahre lang war die namenlose Insel von nichts anderem als der dort entstandenen Flora und Fauna besiedelt. Eine Reihe von Bananenstauden, die man bei der Gründung der ersten Niederlassungen fand, ließ eine frühere Besiedelung durch Polynesier vermuten. Weitere Hinweise haben diesen Verdacht bestätigt.
1774 entdeckte Captain James Cook die Insel auf dem Weg von New Caledonia nach Neuseeland mit der Resolution und taufte sie »Norfolk«, nach der damaligen Herzogin von Norfolk.
Sechs Wochen nach der Landung der First Fleet in Sydney Cove 1788 wurde die erste Niederlassung auf Norfolk Island mit neun männlichen und sechs weiblichen Sträflingen, sieben freien Männern und einer Kompanie Soldaten gegründet. In dieser Siedlung sollten Produkte für die Menschen in Sydney Town erzeugt werden. Man sollte einen Weg finden, den auf der Insel vorgefundenen Flachs zu kultivieren und, wenn möglich, die Norfolk-Pinien zum Bau von Schiffsmasten zu fällen. Sowohl die Bemühungen um den Flachs als auch die um die Schiffsmasten schlugen fehl, und Anfang des 19. Jahrhunderts benötigte Sydney Town keine Erzeugnisse mehr von der Insel. Daher wurde die Siedlung 1814 vollständig aufgegeben.
Erst 1825 entschloss sich die britische Krone, auf Norfolk Island ein Gefängnis zu errichten, das die Gefangenen aufnehmen sollte, die während ihrer Haft in den Strafkolonien von New South Wales und Van Diemen’s Land erneut straffällig geworden waren. Diese Entscheidung machte Norfolk Island zum berüchtigtsten Ort für britische Gefangene im 19. Jahrhundert. Die Bedingungen, unter denen die Sträflinge untergebracht waren, und die Grausamkeit derjenigen, die das Sagen hatten, waren so entsetzlich, dass die Insel bald als ein Ort der Niedertracht und des Schreckens bekannt wurde.
Der größte Erfolg der Kommandos, die einander von 1825 bis 1855 ablösten, war der Bau vieler schöner Gebäude, denn mit den Gefangenen stand ihnen eine schier unerschöpfliche Menge an Arbeitskräften zur Verfügung. Die Gebäude sind noch heute gut erhalten oder sorgfältig renoviert und stellen Paradebeispiele der georgianischen Architektur dar: das Vorarbeiterhaus, das Arzthaus, das Ingenieurbüro, der Laden der Intendantur, die alten und neuen Militärbaracken und das stattliche Gouverneurshaus sowie verschiedene andere Unterkünfte an der Quality Row sind alles großartige Bauten, die immer noch bewohnt sind und Zeugnis vom Können jener ablegen, die sie einst errichteten.
1847 entschied die britische Regierung, dass die Strafgefangenensiedlung aufgelöst werden sollte. Mitte der 50er-Jahre des 19. Jahrhunderts hatten die meisten Bewohner die Insel verlassen.
Am 8. Juni 1856 begann die dritte und einzige dauerhafte Besiedelung von Norfolk Island, als die Insel den Nachfahren der Meuterer von der Bounty, die bis dahin auf Pitcairn gelebt hatten, als neue Heimat zugewiesen wurde. Bis heute noch behauptet die Hälfte der rund 1500 ständigen Einwohner stolz, von den »Meuterern« abzustammen.
Heute zeugen neben den von den Gefangenen gebauten Häusern nur noch die pittoresken Ruinen des Gefängnisses und des Hospitals von der brutalen Zeit der Strafgefangenenkolonie. Zurzeit erfreuen sich die Einwohner von Norfolk Island eines beneidenswerten Lebensstils. Praktisch ohne nennenswerte Arbeitslosigkeit und mit einem ausgeglichenen Haushalt exportiert die Insel die dort wachsende Norfolk-Pinie und die Kentia-Palme (die ursprünglich von der Lord-Howe-Insel kommt) in die ganze Welt. Die Lebensmittelproduktion macht sie fast unabhängig von Importen, und die Einwohner zahlen keine Einkommensteuer, obwohl Steuern erhoben werden, mit denen die Insel zu Einnahmen in Höhe von jährlich über 10 Millionen Dollar kommt.
Eine eigenständige Regierung sorgte dafür, dass die Insel viele sowohl landschaftliche als auch geschichtliche Attraktionen bietet, und der zollfreie Einkauf macht sie zu einem beliebten Ziel für Besucher aus Australien und Neuseeland.
Wie ein echter Norfolker sagt: Si yorli morla – Wir sehen uns morgen.
Lynne Wilding
Prolog
Regenschwer jagten die Wolken über den Himmel, und in der Ferne grollte der Donner.
Sie blickte von ihrer Betrachtung der vom unaufhörlich rollenden Ozean im Laufe der Zeit glatt gewaschenen Steine auf, als ein greller Blitz in die kochende See einschlug. Das Wetter spiegelte ihre Gefühle wider, denn ihr Zorn glich dem des nahenden Sturms, und die grollenden Geräusche der Natur in übelster Stimmung passten zu ihrer eigenen düsteren Laune.
Ihr Blick streifte über die Bucht und registrierte, wie sich haushohe Wellen gegen die Felsen warfen. Der Wind hatte ihre Spitzen zu schäumenden Kämmen geformt, die ein paar Sekunden auf ihrem Gipfel thronten, nur um sich dann einzurollen und zusammenzufallen, immer wieder, bis nur noch kleine Kräuselwellen übrig blieben.
Der Ozean war genauso ruhelos wie sie selbst, ständig in Bewegung. Hatte sie solche Szenen nicht schon so lange beobachtet? Wartend…? Zu lange. Wartend auf eine Veränderung in ihrem Dasein, die sie befreien würde. Endlich.
Ihre Hände ballten sich zu Fäusten, und die Nägel, von denen einige abgebrochen und andere lang waren, gruben sich so fest in die Handflächen, dass sie die Haut durchdrangen. Als sie die Finger wieder öffnete, betrachtete sie den Schaden, den sie auf der Haut angerichtet hatte, und stellte sich die gleiche Frage wie jeden Tag: Wie lange soll ich das noch ertragen? Ich habe schon eine Ewigkeit gewartet – so zumindest kam es ihr vor. Lieber Gott, erbarme Dich meiner…
Sie stand auf, breitbeinig, um dem böigen Wind standzuhalten, und hob in einer flehenden Geste beide Arme über den Kopf zum Himmel empor. Bitte, lieber Gott, mach, dass es ein Ende hat mit dieser… dieser Leere, diesem Nichts. Nur der Wind gab ihr Antwort. Wie ein lebendiges Wesen zupfte er an ihrer Kleidung und ließ sie um ihre Glieder flattern, breitete ihr langes Haar fächerartig über ihrem Gesicht aus und verschleierte so ihren schmerzverzerrten Gesichtsausdruck. Er flüsterte und pfiff und versagte ihr doch die Antwort, die sie ersehnte.
Ihre Kehle schnürte sich zusammen, und von ihren Lippen löste sich ein Schrei, unmenschlich in seiner Verzweiflung. »Helft mir! Bitte, so hilf mir doch jemand!«
Einen Kilometer von der Küste entfernt, in einem Pinienhain, hielt ein verwittertes Holzhaus dem Sturm stand, wie es das seit über achtzig Jahren getan hatte. Hinter dem Haus stand ein im Vergleich dazu überdimensional großer Schuppen.
Im Inneren des Schuppens waren drei Wände mit Regalen verstellt, auf denen Keramiken in unterschiedlichen Fertigungszuständen standen. An der Töpferscheibe saß eine Frau mit nassen, lehmigen Händen und begann, einen Lehmklumpen zu einer breiten, niedrigen Obstschale zu formen.
Der Pony von Nan Duncans kurzen, einstmals blonden, mittlerweile aber mit Grau durchzogenen Haaren, fiel ihr ins Gesicht. Ungeduldig schob sie die Strähnen zurück, wobei sie einen Lehmstreifen über ihre Stirn zog. Nan wurde in viereinhalb Monaten fünfzig und hatte vier ungezogene Kinder großgezogen, die mittlerweile alle erwachsen waren und zwischen Australien und Neuseeland verstreut lebten. Die Tatsache, dass sie früh Witwe geworden war und gelegentlich hart für ihr Auskommen arbeiten musste, obwohl sie eine talentierte Töpferin war, stand ihr ins Gesicht geschrieben. Es war ein Leben mit Höhen und Tiefen gewesen. Kräftige Furchen zogen sich über ihr Gesicht und ihren Hals, doch minderten sie irgendwie nicht die frische, vom Leben im Freien geprägte Anziehungskraft ihres Gesichtes. Hinter der Bifokalbrille glänzten graue Augen, und ihr ein wenig zu breiter Mund schien immer zu lächeln, trotz ihres schweren Lebens. Sie war so schlank, dass es schon fast dürr schien. Ihre Arbeitskleidung bestand aus einem alten Pullover mit Jeansflicken an den Ellbogen und ausgefransten Ärmeln, einem Schottenrock, rotgestreiften Socken und lehmverschmierten Turnschuhen.
Ein plötzlicher Windstoß bog einen hohen Busch so weit um, dass seine Äste auf dem Sprossenfenster des Schuppens, den ihre Familie augenzwinkernd als ihr Atelier bezeichnet hatte, einen lauten Trommelwirbel schlugen. Doch das Stakkato der Zweige wurde von einem schrillen Heulen übertönt.
Nans Hände hielten in ihrer rastlosen Bewegung inne. Das Lächeln gefror. Die Finger, die in letzter Zeit die ersten Anzeichen einer rheumatischen Arthritis zeigten, versteiften sich. Ihr Kopf flog empor, ihr Körper erstarrte, und ihr Herzschlag beschleunigte sich, während das durchdringende Geräusch sich ihr ins Gehirn, dann in ihr Herz und schließlich in ihre Seele bohrte. Ihr Fuß löste sich vom Pedal, als der unheimliche Laut ihre Konzentration durchbrach und sie von ihrer Aufgabe ablenkte.
Stirnrunzelnd saß sie still wie eine Statue im Licht der starken Neonlampe. Das Geräusch war ihr nicht unbekannt, sie hatte es schon oft zuvor gehört – eigentlich so lange sie denken konnte. Es erklang immer, wenn der Wind aus Süden blies und sich ein Sturm ankündigte. Auch daran erinnerte sie sich. Ihre Mutter – Gott hab sie selig – hatte ihr, als sie noch klein war, erklärt, dass das Geräusch auftrat, wenn der Wind um die Felsen der Cresswell Bay fegte. Eine logische Erklärung, musste Nan zugeben, aber dennoch kratzte das schrille Pfeifen an ihren Nerven. Das war auch schon immer so gewesen.
Ein weiterer Windstoß ließ die alte Wand erzittern, dass die Holzbalken an den Ecken knackten und das dünne Dach klapperte. Dann wurde das Kreischen innerhalb weniger Sekunden plötzlich schwächer und verstummte schließlich völlig.
Nan legte den Kopf schief, während sie einen Moment lang nachdachte. Vielleicht würde ihr Bruder Marcus eines Tages die Ursache für dieses nervtötende Geräusch finden. Zweimal hatte er es schon versucht, doch das schlechte Wetter hatte ihn jedes Mal daran gehindert, ganz so, als ob die Natur versuchte, ihr Geheimnis für ewig zu bewahren. Bald würde er hier sein, wenn das Semester an der Universität von Auckland zu Ende war. Wieder legte ein Lächeln ihre Wangen in Falten. Sie freute sich auf das Wiedersehen.
Langsam entspannten sich ihre Finger. Sie tauchte ihre Hände in die Schüssel Wasser auf dem Seitentisch neben der Drehscheibe und presste ihren Fuß erneut auf das Pedal. Die Töpferscheibe begann sich zu drehen, zuerst langsam, dann immer schneller, als das Pedal, das es antrieb, sich zunehmend schneller hob und senkte. Die Finger bearbeiteten den Lehm liebevoll, nach außen und oben, außen und oben, glättend, formend, schaffend… Das unnatürliche Kreischen des Windes wurde ganz weit hinten in ihrem Gedächtnis gespeichert, als sie sich wieder hingebungsvoll ihrer Aufgabe widmete.
1
Ein spitzer Finger mit gefeiltem und poliertem Nagel drückte auf den Etagen-Knopf des Aufzugs. Sechs. Sie sah auf die Uhr. Fünfundzwanzig Minuten nach acht am Morgen. Da sie sich allein im Aufzug befand, konnte sie überprüfen, ob ihre graue Kostümjacke richtig zugeknöpft war, der Rock exakt saß und jede einzelne Strähne des kastanienbraunen Haars anständig lag und nicht wie so oft störrische Locken aus dem glatten Knoten rutschten. Während sie zum sechsten Stock emporschwebte, arbeitete sie an ihrem Gesichtsausdruck. Ruhig. Gelassen. Akzeptierend. Ja, ganz besonders Letzteres. Als sich die Tür öffnete, holte sie tief Luft, fasste die Aktentasche fester und ging zuversichtlich durch das Foyer zur Rezeption von Greiner, Lowe und Pearce.
»Jessica!« Faith Wollinskis Gesichtsausdruck verriet Überraschung, als sie ihre Chefin erkannte. »Ich habe… wir haben Sie heute nicht erwartet. Ahm… noch nicht.« Sie biss sich verlegen auf ihre frisch bemalten Lippen, unsicher, was sie sagen sollte, außer »Es tut mir Leid… Ihr Verlust.« Mit einem Seufzen gestand sie sich ein, dass dieser Satz inadäquat war.
Jessica Pearce hob die Hand. »Bitte, Faith, ich sehe es Ihrem Gesicht an. Mir geht es gut. Die Familie ist einverstanden. Die beste Medizin für mich ist Arbeit, und zwar jede Menge Arbeit.«
Sie verzog den Mund zu einer Art Lächeln und versuchte, nonchalant zu wirken, als sie sich an den Tresen lehnte und einen Stapel Akten durchblätterte. »David sagt, davon gäbe es hier reichlich.«
»Damit haben Sie nicht mal Unrecht«, warf Mandy, die zwanzigjährige Rezeptionistin mit ihrer piepsigen Stimme ein. »Mr. Greiner und Mr. Lowe haben Sie die letzten Wochen wirklich sehr vermisst.«
»Nun, jetzt muss mich niemand mehr vermissen«, erklärte Jessica energisch. Sie nahm ihre Aktentasche und ging den Korridor zu ihrem Büro entlang. Über die Schulter hinweg bat sie: »Darf ich Sie um einen Gefallen bitten, Faith? Eine Tasse Kaffee, schwarz… in zehn Minuten, wenn ich die Post durchgegangen bin.«
»Zwei Stück Zucker«, bestätigte Faith. »Ich habe nicht vergessen, wie Sie Ihren Kaffee trinken.« Sie knirschte mit den Zähnen ob der Belanglosigkeit ihrer Bemerkung und war sich bewusst, mit der peinlichen Situation nicht gut fertig zu werden. Sie bekam Jessicas müdes Lächeln mit, an dem ihre Augen keinen Teil hatten. Nachdenklich sah sie ihrer Chefin nach, als sie die acht Meter zu ihrer Bürotür zurücklegte. Die Schultern angespannt, der Rücken steif wie ein Brett. Sie reißt sich zusammen, vermutete sie.
»Hast du ihre Augen gesehen – die waren doch merkwürdig«, sagte Mandy halb flüsternd. »Glaubst du, dass es ihr gut geht, Faith?«
Acht Jahre Loyalität ließen die Antwort der Frau im mittleren Alter positiv klingen. »Natürlich. Jessica hat ein furchtbares Trauma durchlitten, aber sie ist stark. Sie wird es überleben.« Faith sah die jüngere Frau an und fügte in autoritärem Tonfall hinzu: »Ich bin mir sicher, das Letzte, was sie jetzt will, sind Leute, die um sie herumglucken und besorgte Gesichter ziehen. Ruf David und Max an. Sag ihnen, dass sie hier ist.«
Jessica war sich bewusst, dass sie den Atem anhielt, als sie von den beiden Frauen wegging, und stieß ihn kraftvoll aus, als sie leise die Tür hinter sich zumachte. Sie schloss die Augen. Die erste Prüfung – die Kontaktaufnahme – war vorüber. Sie lehnte ihren Körper an das Holz der Tür, als ob ihr das solide Material Kraft geben könnte.
Mit immer noch geschlossenen Augen lauschte sie dem Summen der Klimaanlage und stellte fest, dass sie unverändert lästig rasselte. Vor dem Fenster erklangen gedämpft die Geräusche der Fahrzeuge, die während der Rushhour die St.-George-Terrace entlangkrochen, ohne aufdringlich laut zu sein. Durch die geschlossenen Augenlider nahm sie das Licht wahr, das durch die auf Hüfthöhe ansetzenden Fenster einfiel, die einen großartigen Blick über den Swan River und einen Teil der Skyline von Perth boten. Ansonsten herrschte Stille, vollkommene Ruhe, abgesehen vom lächerlich schnellen Schlag ihres Herzens.
Langsam öffnete sie die Lider und sah sich in dem Büro um, das ihr für so viele Jahre fast ein zweites Zuhause gewesen war.
Es sah alles genauso aus wie noch vor drei Wochen. Die zedernholzgetäfelte Wand hinter ihrem Schreibtisch. An der linken Wand hing ein Bild des australischen Landschaftsmalers Pro Hart – weit weg von ihrem eigenen Aquarell einer Buschszene, die sie bei New Norcia gemalt hatte und die bei einem staatlichen Kunstwettbewerb den zweiten Platz gemacht hatte, als sie fünfundzwanzig gewesen war. Die beiden Aktenschränke aus Teakholz, der Schreibtisch mit der Glasplatte, dank Faiths fast krankhafter Aufräumsucht sehr ordentlich, und auf der Fensterbank stand eine einsame Bromelie, kurz vor der Blüte. Fotos von ihr und Simon in der Pinnacle-Wüste waren die einzigen Ornamente auf den Aktenschränken. An der gegenüberliegenden Wand stand ein Bücherschrank mit Gesetzesbüchern. Der beigefarbene Teppichboden, weich und flauschig, passte zu den gedeckten Farben des Raumes. Vertraut. Gemütlich. Derselbe…
Ja, der Raum war wohl derselbe, nur sie selbst war anders, verändert. Für immer.
Plötzlich fühlten sich ihre Glieder sehr schwer an, und es bedurfte einer bewussten Willensentscheidung, zum Schreibtisch hinüberzugehen. Sie hängte ihre Jacke und die Handtasche an den Hutständer hinter dem Tisch und setzte sich in den gepolsterten Drehstuhl. Einatmen, ausatmen. Kontrolle, sagte sie sich. Denk nicht an ihn. Arbeit, harte Arbeit ist die einzige Medizin für dich, das weißt du. Es wird den Schmerz lindern, die Erinnerungen, so sagte ihr der gesunde Menschenverstand, so sagten ihr alle, aber sie war sich da nicht so sicher.
Sie betrachtete ihren Posteingangskorb. Mehrere von pinkfarbenen Bändern zusammengehaltene Akten warteten auf ihre Bearbeitung. Ein leerer Notizblock lag bereit, unter der rechten Ecke des ledergebundenen Tagesordners. An einer anderen Ecke lag ein sauberer Stapel Nachrichten. Rechts vom Kalender lagen ungeöffnete Briefe. Als sie danach griff, stellte sie fest, dass ihre Hand spürbar zitterte. Mehrere Sekunden lang ballte sie die Hand zur Faust, nahm dann den obersten Brief und schlitzte den Umschlag auf. Es war ein handgeschriebener Kondolenzbrief…
Obwohl die Raumtemperatur angenehme zx° Celsius betrug, bildeten sich auf Jessicas Stirn und auf ihrer Oberlippe Schweißperlen. Sie zuckte zusammen, als die Nervenenden unter ihrer Haut zu pulsieren begannen. Gerne hätte sie sich gekratzt, um sie zu beruhigen. Nicht, befahl sie sich. Geh an die Arbeit. Sie schob den Briefstapel beiseite und griff nach einer Akte, legte sie vor sich und öffnete sie. Der Text verschwamm. Lesebrille, Dummchen! Sie nahm die Goldrandbrille aus ihrer Aktentasche und setzte sie auf. Dann begann sie zu lesen. Smithers gegen Smithers…
Innerhalb der Kanzlei Greiner, Lowe und Pearce hatte sich Jessica auf Familienrecht spezialisiert und war erst im letzten Jahr zur Juniorpartnerin geworden. Während der letzten fünf Jahre hatte sie sich bei den Gerichtshöfen von Perth einen Namen als erfolgreiche und faire Anwältin gemacht. Traurigerweise gab es keinen Mangel an Fällen. Scheidungen, Eigentumsklärungen, Streitfälle über das Besuchsrecht von Kindern. Diese Fälle und der emotionale Stress, den die Klienten mit sich brachten, nahmen kein Ende.
Sie zwang sich, die ersten drei Seiten der Smithers-Akte zu lesen, dann durchbrach ein aufmüpfiger Gedanke ihre Konzentration.
Ruckartig hob sie den Kopf. Ihr Blick wanderte durch das Zimmer, durchsuchte jeden Winkel und jede Ecke. Da stimmte etwas nicht. Es fehlte etwas Wichtiges in diesem Zimmer, von der Ecke ihres Schreibtischs. Mit einem panikartigen, krampfhaften Herzschlag verschlang sie die Hände ineinander und zog an ihrem Verlobungs- und Ehering, während sie nach dem fehlenden Stück suchte. Sie stand auf, ging zu den Aktenschränken und öffnete jede einzelne Schublade. Nichts. Dann überprüfte sie die Schubladen ihres Schreibtisches. Auch nichts.
Die Tür öffnete sich, und Faith trat mit ihrem Kaffee ein.
Jessica verengte misstrauisch ihre Augen zu Schlitzen und fragte geradeheraus: »Wo haben Sie es hingetan?«
»Was denn, meine Liebe?«
Mit Verzweiflung in der Stimme zischte sie: »Das wissen Sie ganz genau! Haben die anderen Ihnen befohlen, es zu verstecken?« Sie sah Faiths ausdrucksloses Gesicht, und ihre Niedergeschlagenheit und ihr Ärger wuchsen. Die Nervenenden unter ihrer Haut machten sie fast wahnsinnig, es fühlte sich an, als ob unter der obersten Schicht etwas lebendig war. Unbewusst rieb sie die Innenseite ihrer Unterarme. »Das Foto, Faith! Wo ist das Foto?«
»Oh!« Verständnis. »Ja. Die Partner und ich«, Faith bemerkte Jessicas zunehmende Erregung und sagte schnell, »wir hielten es für besser, es eine Zeit lang wegzustellen, bis Sie… bis… genug Zeit vergangen ist und…«
»Holen Sie es. Sofort.« Jessica hatte nicht schreien wollen, aber so kam es heraus, gellend, unkontrolliert. Sie bereute ihren Fehler sofort.
Faith stellte die Kaffeetasse auf den Schreibtisch und ging zum Aktenschrank. Sie öffnete die unterste Schublade und nahm ganz hinten das in braunes Papier gewickelte Foto heraus.
»Stellen Sie es auf den Schreibtisch.«
»Sind Sie sicher, dass Sie das wollen, Jessica?«, fragte Faith, während sie das Foto des vierzehn Monate alten Damian Pearce an die Stelle auf dem Schreibtisch stellte, an der es die letzten drei Monate gestanden hatte. »Es wird Sie ständig an ihn erinnern. Sie werden es sehen, sein Gesicht, jedes Mal, wenn…«
In Jessicas blauen Augen schwammen Tränen. »Glauben Sie, dass ich sein Gesicht nicht jeden Tag vor mir sehe, Tag und Nacht, jede verdammte Sekunde seine Stimme höre? Glauben Sie das?« Wieder dieses Kreischen. Sie seufzte. Zu hoch. Keine Kontrolle. Sie wischte sich mit der Hand über die Augen, um die Tränen zurückzuhalten. Tief holte sie Luft, kämpfte um das Gleichgewicht, das sie zu verlieren drohte. »Es tut mir Leid…« Selbst in ihren eigenen Augen klang die Entschuldigung lahm.
»Geht es Ihnen gut, Jessica?« Faith runzelte die Brauen.
Jessica fühlte, dass Faith beobachtete, wie sie um ihre Fassung rang. Die Frau wusste, dass Selbstbeherrschung stets eine ihrer Stärken gewesen war. In der Vergangenheit hatte ihr diese Stärke oftmals geholfen, einen Fall zu gewinnen. Was mochte Faith denken?, fragte sie sich. Dass Jessica kurz vor einem Ausbruch stand von… Sie wusste selbst nicht von was. Oder schimpfte sie im Geiste mit Simon, dass er sie ins Büro gehen ließ, obwohl sie noch nicht dazu in der Lage war? Verdammt, was spielte das für eine Rolle! Sie riss sich aus ihren Gedankenspielen und blickte ihre Sekretärin an.
»Nein, es geht mir nicht gut.« Jessica nahm einen tiefen, beruhigenden Atemzug. »Aber das wird schon wieder.« Sie betrachtete die Akte, die sie gelesen hatte. »Würden Sie bitte Max fragen, ob er in einer halben Stunde Zeit hat? Ich würde mich gerne mit dem Smithers-Fall vertraut machen und ihn mit ihm besprechen, da er die Vorbereitungen dazu durchgeführt hat.«
»Ich bin sicher, er hat bis um zwölf keine Termine. Er arbeitet an einer Präsentation für das Gericht morgen. Ich sage ihm zehn Uhr, ist das in Ordnung?«
Jessica nickte. Sie hielt die Lider gesenkt, bis Faith gegangen war. Dann wandte sie sich ganz langsam, fast unwillkürlich, zur goldgerahmten Fotografie ihres Sohnes. Blaue Augen, ihren eigenen sehr ähnlich, sahen ihr aus dem zweidimensionalen Bild entgegen. Er hatte Simons – seines Vaters – blonde Haare und dunkle Haut, und auch sein Lächeln. Damians Lächeln. Fest schloss sie die Augen, als sie der Schmerz wie mit Tentakeln ergriff. Sie zerrten an jedem Muskel, jeder Faser ihres Körpers. Sie konnte es nicht ertragen … Es gab kein Entrinnen vor diesem Schmerz, diesem Gefühl des Verlusts. Es nagte innerlich an ihr, zerstörte ihre Muskeln, ihr Gewebe, ihre Energie und lahmte ihre Fähigkeit, zu denken. Ihrer Kehle entrang sich ein dunkler, schluchzender Ton, den sie herunterschluckte, unerlöst. Sie musste es ertragen.
Fort, ihr Sohn. Und mit ihm jeder Funken Freude, alles zukünftige Glück, selbst ihr Lebenswille.
Leben. Sie schaukelte vor und zurück, schlang die Arme um den Oberkörper, als wollte sie den Schmerz umarmen, innen behalten, unter Kontrolle bringen. Das war doch kein Leben. Das war Überleben, und auch das nur gerade so. Und wozu? Ohne ihn war alles so sinnlos. Sie blinzelte schnell, als ihr dieser Gedanke kam. Wozu die Mühe?
Sie holte erneut tief Luft, und vor ihrem gequälten Geist stieg der süße Duft seiner Babyhaut auf, die Frische seines gewaschenen Haars. Hör auf, dir das anzutun!, sagte eine Stimme in ihrem Inneren. Diese Quälerei bringt dir nichts, wird zu nichts Nennenswertem führen!
Aber es gibt nichts Nennenswertes mehr, widersprach eine andere Stimme. Auf was sollte sie sich denn noch freuen können ohne Damian? Mit achtunddreißig, fast neununddreißig, würde sie keine weiteren Kinder mehr bekommen. Nach elf kinderlosen Ehejahren und drei Fehlgeburten war Damian für sie und Simon ein kleines Wunder gewesen. Außerdem würde niemand Damian ersetzen können. Er war etwas… Besonderes gewesen – ihr kleiner Sohn war es wert gewesen, so lange auf die Mutterfreuden zu warten. Mit einem erneuten tiefen Atemzug zwang sie sich, sich zu beruhigen…
Sie setzte die Brille wieder auf und las weiter. Mehrere Minuten lang konnte sie die Konzentration aufrechterhalten, doch als eine einzelne Träne über ihre Wange lief und auf das Papier tropfte, gab sie sich geschlagen und nahm die Brille ab. Ihre Hand griff nach dem Foto, das sie an die Brust presste, wo der Schmerz wohnte. Die Kühle des Glases und des Metallrahmens drang durch den dünnen Stoff ihrer Bluse an ihre Haut. Sie erinnerte sich daran, wie warm er sich angefühlt hatte, wie gerne er mit ihr gekuschelt hatte. Tränen strömten ihr über das Gesicht und fielen auf die Bluse.
Erinnerungen…
Lachen. Sein unsicherer Gang, seine paar Worte: »Dadda«, »da«, »Mama«. Wie anbetungswürdig er ausgesehen hatte, wenn er schlief oder sich völlig auf etwas konzentrierte, das ihn interessierte… Jessica schloss die Augen, während Myriaden von Bildern in ihr aufstiegen.
Der Schmerz wurde stärker, ihr Atem presste sich durch die von den Gefühlen verkrampften Lungenmuskeln. Mehr Schmerz. Vielleicht hatte sie einen Herzanfall. Gut. Dann würde der Schmerz ein Ende haben. Doch dann dachte sie an Simon, und ihre Trauer wurde noch größer, während sein Bild undeutlich vor ihren geschlossenen Augenlidern auftauchte. Simon. Was nutzte sie ihm denn noch? Sie funktionierte ja kaum noch, wollte es auch gar nicht. Sie wollte mit diesem Elend nicht leben. Wieder wiegte sie ihren Körper im Stuhl vor und zurück, während sich kleine Seufzer ihren Lippen entrangen und im Nichts verklangen. Schließ den Schmerz aus, schließ den Schmerz aus, intonierte sie ihr Mantra immer wieder. Schließ ihn aus. Für alle Ewigkeit.
Plötzlich riss etwas in ihrem Inneren, und ihr Körper erschlaffte…
Sekunden, vielleicht auch Minuten später öffnete Jessica wieder die Augen. Ihr Blick ging ins Leere, richtete sich auf nichts Bestimmtes. Ihr Atem wurde gleichmäßiger, und eine gespenstische Ruhe überkam sie wie eine weiche Decke. Sie wusste, was sie tun musste. Damian, denk an Damian.
Sie stellte das Foto ihres Sohnes auf den Tischkalender, löste den Knoten, zu dem sie am Morgen ihre Haare aufgesteckt hatte, und legte die Haarnadeln fein säuberlich nebeneinander auf den Schreibtisch. Sie fuhr sich mit den Fingern durch die kastanienbraunen Haare, deren Spitzen sich aufrollten, besonders bei feuchtem Wetter. Ihre Lippen bewegten sich, während sie ein Schlaflied vor sich hin sang, eines von denen, die Damian am liebsten gehabt hatte… »Hush, little baby, don’t you cry, Mamma’s gonna sing you a lullaby…«
Mit ruckhaften, automatischen Bewegungen zog sie die Schublade rechts oben an ihrem Schreibtisch auf und nahm eine Schere heraus. In tranceartiger Genauigkeit schnitt sie sich Haarsträhnen ab und drapierte sie als Hommage um Damians Foto herum. In der Schublade entdeckte sie einen Lippenstift, und nach wie vor leise singend und den Blick ganz auf das Foto gerichtet, öffnete sie ihn und begann, ihre Augen und ihren Mund mit großen roten Kreisen zu umfahren. Nachdem sie das zu ihrer Zufriedenheit bewerkstelligt hatte, zog sie die Lippenstiftkreise auch auf ihrer reinen weißen Bluse. Doch das war noch nicht genug. Daher nahm sie die Schere, zog die Bluse aus dem Rock und schnitt Stücke davon ab, die sie ebenfalls vor dem Foto niederlegte. Das Jucken unter ihrer Haut wurde stärker. Sie kratzte und kratzte, bis sich hässliche Schwellungen zeigten.
»They’re changing guards…«, summ, summ, »at Buckingham Palace…«
Die Sprechanlage am Telefon piepte. Sie ignorierte sie, wischte jedoch mit einer einzigen, zornigen Handbewegung mit ausgestrecktem Arm den Schreibtisch leer. Akten, Telefon, Stifte, Büroklammern fielen zu Boden. Alles, bis nur noch der Tischkalender und Damians Foto übrig blieben.
Zufällig piekste sie das spitze Ende der Schere in den Unterarm, sodass sie blutete. Augenscheinlich fasziniert davon, wie das Blut über ihre weiße Haut lief, beobachtete sie, wie es einen kleinen Bach auf ihrer Haut bildete. Blut war Leben. Natürlich. Sie kicherte irre, sie wusste es. Jessica starrte Damians Foto an, dann hielt sie den Arm darüber und stach sich erneut in die Haut, sodass die Tropfen auf das Foto fielen. Dann legte sie vorsichtig die Schere weg und wartete. Damians Bildnis erwachte nicht zum Leben, und ihren Lippen entsprang ein dumpfer Klagelaut. Wieder begann sie zu schaukeln, vor und zurück, vor und zurück, immer schneller, immer schneller.
Max Lowe, der Seniorpartner der Kanzlei, erhob sich aus seinem Bürostuhl, schaute auf die Uhr und ging nach draußen auf den Gang. Jessica war nicht zur verabredeten Zeit gekommen, um mit ihm über den Smithers-Fall zu reden, was ihm seltsam vorkam. Normalerweise war sie sehr pünktlich. Er würde nachsehen, was sie aufgehalten hatte…
Als er ein merkwürdiges Geräusch aus ihrem Büro hörte, runzelte er die Stirn. Hatte sie sich verletzt? Seine Hand ergriff die Klinke und zog die Tür auf.
Als erfahrenen Anwalt in den Fünfzigern konnte Max so schnell nichts schockieren, doch beim Anblick seiner Juniorpartnerin blieb ihm der Mund offen stehen. Jessica sah aus wie eine Verrückte. Ihr kastanienbraunes Haar stand in wirren Büscheln vom Kopf ab – sie hatte gnadenlos daran herumgeschnitten. Auf ihrem Gesicht waren rote Flecken, ihre Bluse an mehreren Stellen zerrissen. Und, fast erst nachträglich, bemerkte er die grässliche Schweinerei auf und um ihren Schreibtisch.
Doch was ihm noch mehr als das bis ins Mark fuhr, war ihr starrer Blick, die Abwesenheit in ihren Augen. Mein Gott, sie hat den Verstand verloren!
Max zog sich von der offenen Tür zurück, wandte den Kopf und erhaschte einen Blick auf Mandy, die Rezeptionistin, die durch das Foyer ging. »Mandy!«, kläffte er. »Holen Sie Faith! Schnell!«
2
Am Fuß des Bettes im Licht der Wandlampe über dem Bett der Patientin stand ein Mann. Er war groß, trug einen maßgeschneiderten Nadelstreifenanzug, ein weißes Hemd, eine dezent gemusterte Krawatte und italienische Schuhe und wirkte wie ein Mann, der einen gewissen Grad von Macht und Respekt gewohnt war.
Mit geübtem Blick betrachtete er die Patientin. Das Haar war so gut wie möglich gekämmt worden, sodass es nicht allzu schlimm aussah. Dennoch zuckten seine Finger, als er daran dachte, wie dicht und glänzend es war, dass es in einem bestimmten Licht wie poliertes Kupfer schimmern konnte und wie gerne er mit seinen Fingern hindurchfuhr. Er tröstete sich mit dem Gedanken, dass es wieder wachsen würde. Die Reste des Lippenstifts waren entfernt worden, doch die Haut war gerötet und fleckig. Das schlecht sitzende Krankenhausnachthemd verhüllte ihre perfekte Figur, und tief sediert atmete sie ruhig und gleichmäßig. Doch obwohl sie fest schlief, zuckten gelegentlich ihre Glieder, ein Zeichen für ihren verstörten Geist.
Dr. Simon Pearce nahm das Klemmbrett vom Fußende des Bettes, zog seine Brille aus der Brusttasche und sah sich das Krankenblatt an. Das Licht reichte nicht aus, um die Anspannung um seine Mundwinkel erkennen zu lassen, die seine Verzweiflung andeutete. Seine wunderbare, fähige Frau, die sich bislang jeder Herausforderung im Leben gestellt und sie gemeistert hatte, war, wie das Krankenblatt es andeutete, ein emotionales Wrack. Ein Muskel in seinem Kiefer zuckte, und sein Adamsapfel hüpfte, als sich ihm die Kehle zuschnürte. Jessica hatte einen völligen Nervenzusammenbruch erlitten – davon musste er zumindest ausgehen, solange Nikko ihm nicht etwas anderes sagte. Schnell verbannte er die Worte aus seinen Gedanken, unfähig, sich zu diesem Zeitpunkt damit zu befassen.
Er legte das Krankenblatt zurück und blieb stehen, abwartend. Seine Kiefernmuskeln spannten sich, während er vor seinem geistigen Auge die Ereignisse Revue passieren ließ, die dazu geführt hatten, dass seine Frau in einem Krankenhausbett eines Privatsanatoriums für geistig und psychisch labile Menschen lag.
Damian… tot. Daran ließ sich nicht zweifeln, doch er musste die Augen fest schließen, um nicht in Tränen auszubrechen. Sein Sohn. So klein, so kostbar. Und er hatte nichts tun können, um es zu verhindern, trotz all seiner ausgezeichneten medizinischen Examen, seiner FRCS-Qualifikation und seiner langjährigen Erfahrung.
Der Tod war nachts im Schutz der Dunkelheit gekommen und hatte sein Opfer schmerzlos zu sich genommen… Dafür zumindest konnte er wenigstens ein bisschen dankbar sein. Doch nie würde er Jessicas Schrei vergessen – er war ihm nicht aus dem Kopf gegangen, bis er ihn im Unterbewusstsein vergraben hatte. Sonst hätte er nicht weitermachen können. Sie hatte ihn ausgestoßen, als sie ihn in der frühen Morgendämmerung ins Kinderzimmer gerufen hatte.
Gott, wie hatte er gearbeitet. Panisch. Er hatte Jess angebrüllt, ihm seine Tasche zu bringen. Sich das Stethoskop in die Ohren gerammt und versucht, einen Herzschlag zu finden. Nichts. Den Puls an dem kleinen Hals gesucht. Seine Finger in den Hals des Kindes gesteckt, um sich zu vergewissern, dass die Atemwege frei waren. Er hatte ihm den Frotteeschlafanzug ausgezogen, den kleinen Körper auf den Wickeltisch gelegt und trotz des bläulichen Schimmers der Haut mit Mund-zu-Mund-Beatmung und Herzmassage begonnen. Er erinnerte sich daran, Jess mit hohler Stimme befohlen zu haben, den Notruf zu wählen und die Wiederbelebungsmaßnahme fortgesetzt zu haben, bis der Krankenwagen gekommen war.
Später, an einem schönen, sonnigen Tag, hatte er den mit weißen Rosen bedeckten, weißlackierten kleinen Sarg getragen und ihn neben das klaffende Loch in der Erde gestellt… Er schluckte den Kloß in seinem Hals herunter, und die Muskeln in seinem Kiefer arbeiteten erregt, bis er sich langsam beruhigte.
Simons Finger krampften sich um das Geländer am Fußende des Bettes, die Knöchel spannten sich weiß um die Muskeln, Knochen und das Gewebe. Plötzlicher Kindstod, der latente Albtraum aller Eltern. Und kein einziges verdammtes Warnzeichen, bis es zu spät war. Mit der Rechten zwickte er sich in den Nasenrücken, während ihm die Gedanken durch den Kopf flogen. Hatte es vielleicht kleine Anzeichen gegeben, die er übersehen hatte? War das Babyphon angeschaltet gewesen? Hatten sie beide den Alarm überhört? Wie oft war er jedes einzelne Detail bereits durchgegangen, hatte sich gefragt…, sich gewünscht… Jesus Christus, es war sein Sohn, ihr gemeinsamer Sohn. Es war einfach nicht fair.
»Dr. Pearce?«, fragte die Nachtschwester von der Tür her.
Simon wandte sich um. »Ja, bitte?«
»Dr. Stavrianos wird in ein paar Minuten bei Ihnen sein. Möchten Sie vielleicht lieber in seinem Büro auf ihn warten? Es ist am Ende des Flurs.«
Simon nickte kurz zur Bestätigung. Nikko, sein alter Kumpel von der Universität, der Mann, der ihn mit Jessica zusammengebracht hatte, war wie üblich außerordentlich gewissenhaft. »Danke, das werde ich.« Er trat an die Seite des Bettes, beugte sich nieder, küsste seine Frau auf die Stirn und strich ihr das Haar zurück, bevor er sich umwandte und das Zimmer verließ.
Erst als er allein in Nikko Stavrianos’ engem Büro saß, wo Akten auf jedem freien Platz verstreut lagen, erlaubte sich Simon, etwas locker zu lassen, und ließ den Kopf in die Hände sinken. Schockwellen durchliefen ihn, während er sich an die Sekunden erinnerte, die zwischen dem Telefonanruf von Max Lowe – der ihn, da er im Operationssaal gewesen war, verspätet erreicht hatte – und jetzt vergangen waren. Er hatte darauf bestanden, dass der Krankenwagen Jess ins Sanatorium Belvedere brachte, wo sie die beste Pflege bekommen würde. Er selbst war hierher gejagt, sobald er dem Assistenzarzt Anweisungen gegeben hatte, wie er seinen Patienten versorgen sollte.
Es hatte ihn fast alle Kraftreserven gekostet, mit Damians Tod fertig zu werden, besonders, da er sich selbst zum Teil die Schuld daran gab, dass er seinen kleinen Sohn nicht hatte retten können – auch wenn die Autopsie einen klaren Fall von plötzlichem Kindstod belegte. Tief im Inneren würde er immer glauben, dass er etwas hätte tun müssen. Plötzlich hob er den Kopf: Dachte Jess das etwa auch?
Jetzt war sie völlig zusammengebrochen. Gott, er war Arzt – warum hatte er die Anzeichen nicht bemerkt, dass sie nicht damit fertig wurde?
War er zu sehr mit seiner eigenen Trauer beschäftigt gewesen, um zu sehen, dass sie in tiefe Depressionen verfiel, was schließlich zu diesem totalen emotionalen Zusammenbruch führte? Jessica, die immer so stark gewesen war! Es war schwer zu verstehen, obwohl er nur zu gut wusste, dass der Tod eines Kindes auch die Intelligentesten und Willensstärksten aus der Bahn werfen konnte, und… in Jess’ Fall musste man zudem die Vererbung in der Familie berücksichtigen. Er seufzte auf. Himmel, noch eine Sorge mehr.
Er hörte, wie sich die Tür öffnete, und erhob sich, um Nikko die Hand zu schütteln.
»Wie schade, dass wir uns unter solchen Umständen treffen müssen, alter Kumpel«, begrüßte Nikko Simon und nahm hinter seinem Schreibtisch Platz. Dunkelhäutig, mit schwarzen Haaren und einem verknitterten, schlecht sitzenden Anzug erschien Nikko wie das genaue Gegenteil seines Gegenübers. Geschäftig schob er Akten von einem Stapel auf den anderen, zog schließlich eine Mappe hervor und legte sie offen vor sich. Während er den Inhalt überflog, wechselte er ein paar Mal den Gesichtsausdruck. Schließlich blickte er Simon an.
Simon wartete darauf, dass Nikko sprach. Er wusste, dass es sinnlos war, der Diagnose des angesehenen Psychiaters vorzugreifen.
»Wegen Jessica. Ich habe mich bislang nur kurz damit befassen können, für tiefer gehende Untersuchungen war sie viel zu aufgeregt.«
Da Nikko nur wenig sagte, füllte Simon die Lücken selbst aus. Wahrscheinlich hatte sie unzusammenhängendes Zeug geredet, war dann in Tränen ausgebrochen und in hilfloses, unkontrolliertes Gelächter, das eher wie das Gackern einer alten Frau klang als wie ein bewusstes, intelligentes Lachen. O ja, es war ohne Zweifel so schlimm gewesen.
Nikko sah Simon prüfend in das ausdruckslose Gesicht, bevor er fortfuhr: »Sie braucht Ruhe, Simon. Ich nehme an, dass sie nur sehr wenig therapeutischen Schlaf bekommen hat, seit… Damian gestorben ist. Ich habe ihr ein Sedativum verschrieben, das sie für etwa sechsunddreißig Stunden in Tief schlaf versetzt. Das gibt ihrem Körper und ihrem Geist die Gelegenheit, sich zu entspannen. Dann werden wir weitersehen.«
»Verdammt noch mal, Nikko, geht es nicht ein bisschen genauer?«
»Ich fürchte, nein.« Nikko blickte auf, als er den angespannten Tonfall vernahm. Doch er konnte die Befürchtungen seines Freundes verstehen, zuckte mit den Schultern und kratzte sich die schwarzen Bartstoppeln am Kinn. »Ich kann dir keine Prognose geben, bevor ich nicht mit ihr gesprochen und festgestellt habe, wie tief ihr Schmerz sitzt. Das weißt du.«
»Also…?«
»Warten wir ab. Ich werde ihr eine Trauerberaterin zur Seite stellen, Penny Matheson. Sie ist die Beste. Sie wird mit Jessica arbeiten, wenn sie ruhig genug ist, um sich mit den schmerzhaften Aspekten von Damians Tod auseinanderzusetzen. Bis dahin können allerdings noch Wochen vergehen.« Er musterte seinen Freund – Jessica und Simon Pearce waren die Paten seiner Tochter – und schien plötzlich Mitleid mit ihm zu haben. »Simon, was Jessica durchmacht, ist nicht ungewöhnlich. Viele Frauen sind unter der Trauer über den Tod eines Kindes zusammengebrochen. Manchmal trifft es die Stärksten am härtesten…«
»Das weiß ich, aber ich mache mir ein wenig Sorgen wegen … nun, du weißt schon, ich habe doch ihren Großvater erwähnt. Viel weiß ich nicht von ihm, außer, dass der alte Henry Ahearne die letzen vier Jahre seines Lebens in einer Nervenheilanstalt verbrachte. Jessica war zwölf Jahre alt, als sie mit ansah, wie die Angestellten kamen und ihn in einer Zwangsjacke fortbrachten, sabbernd und schimpfend wie ein Irrer, was er ja auch war. Das Ereignis hat einen bleibenden Eindruck bei ihr hinterlassen, und ich glaube, dass tief im Innersten – auch wenn sie es selbst mir gegenüber nie zugeben würde – sowohl sie als auch ihre Schwester Alison Angst haben, dass sie Henrys Schwäche geerbt haben könnten.«
»Es gibt keinen endgültigen Beweis dafür, dass Geisteskrankheit, oder genauer gesagt Schizophrenie, erblich ist, auch wenn es gelegentlich in manchen Familien eine Neigung zu geistiger Instabilität gibt. Ich werde mich mit den Einzelheiten von Henrys Fall vertraut machen. Aber bitte bedenke, dass das fast dreißig Jahre her ist. Die Psychiatrie hat seitdem große Fortschritte gemacht.«
Simons Mund verzog sich zu einem Lächeln. »Gott sei Dank.« Erregt fuhr er sich durch die blonden Haare, die an den Schläfen langsam dünner wurden. »Himmel, ich wünschte, ich hätte das Rauchen nicht vor drei Jahren aufgegeben, ich könnte jetzt gut eine Zigarette brauchen.«
Nikko grinste ihn mitleidig an. »Du siehst ziemlich fertig aus, mein Junge. Warum gehst du nicht nach Hause? Du kannst hier sowieso nichts weiter tun. Geh nach Hause und schlaf dich erst mal aus. Die Oberschwester wird dich morgen anrufen und dir sagen, wie Jessica die Nacht verbracht hat, in Ordnung?«
Simon seufzte tief. Im Moment konnte er nichts tun, um Jessica zu helfen, doch der Gedanke, alleine in ihrem Stadthaus oder ihrem geräumigen Heim in Mandurah zu bleiben, behagte ihm überhaupt nicht. Dort lauerten jetzt viel zu viele unglückliche Erinnerungen. Mühsam erhob er sich vom Sessel.
»Du hast Recht. Wie immer. Wir werden morgen weiterreden. Gute Nacht.«
Rührei, Bohnen und Toast, hinuntergespült mit einer Dose Fosters. Nicht gerade eine kulinarische Spezialität, musste er zugeben. Jessica wäre entsetzt gewesen. Sie hatte das Talent, in der Küche aus praktisch nichts etwas Schmackhaftes zu zaubern. Derartige Fähigkeiten gingen ihm völlig ab, stellte er fest, als er sich mit einem verdrießlichen Kichern im Wohnzimmer in den Ledersessel sinken ließ, bevor er die Fernbedienung für den Fernseher betätigte, um sich die Abendnachrichten anzusehen.
Es fiel ihm schwer, die Stille im Haus nicht zu bemerken. Und die Einsamkeit. Viel zu groß, hatte er oft gedacht. Er kippte den letzten Rest Bier hinunter. Ganz anders als das Holzhaus mit den zwei Zimmern zehn Kilometer östlich von York, in dem er bei seinen Eltern aufgewachsen war. Mittlerweile waren beide tot.
Delia und Don Pearce waren Weizenfarmer gewesen, die es oft schwer gehabt hatten, je nachdem, ob es viel regnete – oder gar nicht. Er erinnerte sich noch daran, wie enttäuscht sie gewesen waren, als sie feststellen mussten, dass er ihre Liebe zum Land nicht geerbt hatte. Seine Leidenschaft waren von frühester Jugend an Bücher gewesen, Bücher jeder Art über alles und besonders alle Geschichten, die mit Medizin zu tun hatten. Nach Art der Kinder hatte er seine schlummernden medizinischen Fähigkeiten am gebrochenen Flügel einer Amsel ausprobiert und hatte ein Kalb mit einem gebrochenen Bein gesund gepflegt. Als sein Vater es schlachten wollte, hatte er verbissen um sein Leben gekämpft.
Sie hatten nicht genügend Geld, um sein Studium zu finanzieren, also hatte er die ganze Zeit nebenher gearbeitet, sich eine Wohnung mit anderen Studenten geteilt und drei Teilzeitjobs gleichzeitig gemacht, um die Studiengebühren, seine Bücher und seinen Unterhalt bezahlen zu können. Das war ein weiterer Grund, warum er große Häuser nicht gewohnt war, bis sie das in Mandurah bauten. Wieder kicherte er vor sich hin. Daher konnte er auch Rührei mit Bohnen kochen. Gelegentlich waren das seine Grundnahrungsmittel gewesen.
Nachdenklich wanderte sein Blick vom weichen Licht der Messinglampe auf dem Tisch durch den ganzen Raum. Die weiße Ledersitzgruppe war sehr stilvoll, der Marmorfußboden mit dem türkischen Teppich, der die Fußbodenheizung verdeckte, war teuer gewesen. Gemälde – Originale – ein Heyse, eine Bleistiftskizze von Brett Whiteley – hingen an der Wand und ergänzten die Schränke, in denen eine ganze Reihe Elektrogeräte untergebracht waren: Fernseher, Stereoanlage, CD-Spieler – alles von Jessica ausgewählt.
Seine Kollegen in der Medizin behaupteten, er habe alles Zubehör, das einen erfolgreichen Arzt ausmachte, was ihn insgeheim enorm befriedigte. Er hatte hart dafür gearbeitet, tat es immer noch, aber… vor seinem Auge tauchte Jessica auf, wie sie still und schweigend in ihrem Krankenhausbett lag. Er stieß einen langen, gequälten Seufzer aus. Der Erfolg, das elegante Heim, die Aktienpakete, all das war keinen Pfifferling wert, wenn er daran dachte, wie sie so verletzlich dalag. Er musste den Tod seines Sohnes verschmerzen, und das würde er auch schaffen, aber gleichzeitig Jessica zu verlieren… Dann wäre er wirklich alleine, und… er wollte nicht alleine sein. Schon der Gedanke daran ließ ihn erschaudern.
Sie sollte hier bei ihm sein, dachte er plötzlich bitter. Sie hatten sich die Spätnachrichten immer zusammen angesehen. Und auch wenn es vielleicht egoistisch klang, für ihn kam Jessicas Zusammenbruch zu diesem Zeitpunkt äußerst ungelegen. Er wollte gerade in ein aufregendes Projekt einsteigen, ein Geriatrieprojekt für das 21. Jahrhundert, das sie bis an ihr Lebensende finanziell absichern würde. Niedergeschlagen grollte er in den leeren Raum. Das würde nun warten müssen, bis es Jessica wieder gut ging.
Während er mit halbem Ohr den Nachrichten lauschte, wanderten seine Gedanken zehn Jahre in die Vergangenheit, zu einer Silvesterparty in einer kleinen Wohnung in Chelsea…
Fast wäre er nicht zu Nikkos Party gegangen, doch nach einer sträflich langen Schicht in Sankt Pancras allein in London zu bleiben, war keine vergnügliche Aussicht gewesen, ebenso wenig wie ein Abend in der Schachtel jener Pension zwei Blöcke nördlich des Krankenhauses, die er sein Zimmer nannte. Nikkos muffiges Bettsofa war voll besetzt, dicht an dicht drängten sich die Menschen in der Wohnung. Aus dem verkratzten Plattenspieler, den Nikko für zehn Mäuse auf dem nächsten Flohmarkt ergattert hatte, ertönte die Musik der späten Achtzigerjahre. Zusammen mit dem Lärm, den die vielen Leute machten, klang es wie in einem Bienenkorb.
Er sah auf die Uhr. 23:15 Uhr. Noch eine Stunde, dann würde er abhauen; wenn er Glück hatte, konnte er noch sechs Stunden schlafen, bevor er wieder zum Dienst musste. Unterdrückt gähnend hielt er sein lauwarmes Bier hoch und versuchte herauszufinden, ob es sich lohnte, sich für ein neues Glas zu der provisorischen Bar auf der anderen Seite des Zimmers durchzukämpfen.
In diesem Moment sah er sie, als ein Pärchen zur Seite trat. Sie lachte, das Gesicht dem Licht zugewandt. Sie wirkte so lebendig und durch ihre Sonnenbräune so gesund! Ganz offensichtlich kam sie nicht aus London. Nicht schön im eigentlichen Sinne des Wortes, aber ihre Lebendigkeit zog seine Aufmerksamkeit auf sich. Durch den ständig dichter werdenden Dunstschleier, der seiner Meinung nach zu gleichen Teilen aus Zigarettenqualm und Hasch bestand, beobachtete er ihren Gesichtsausdruck, besonders aber ihre Augen. Er wünschte, er wüsste, welche Farbe sie hatten. Sie glänzten, während sie einem großen, rothaarigen Typen zuhörte. Wahrscheinlich erzählte er ihr irgendeinen Mist, um sie ins Bett zu kriegen.
Vorsichtig bahnte er sich mit den Ellbogen den Weg zu ihr. Aus der Nähe sah sie noch besser aus. Hohe Wangenknochen, hübsche Nase, auf jeden Fall nicht aristokratisch, da sie an der Spitze nach oben wies. Sie lächelte viel, stellte er fest. Irgendetwas – wahrscheinlich die Muskeln, die um ein lebenswichtiges Organ, sein Herz, lagen – verkrampfte sich. In seiner Kehle bildete sich ein Klumpen. Er atmete tief ein, hustete den Klumpen aus, nahm seinen Mut zusammen und sagte zu ihr: »Ich gehe gerade zur Bar, soll ich Ihnen etwas mitbringen?« Ihre Augen waren blau, so blau wie Kornblumen. Wunderschön.
Jessica Ahearne starrte den blonden Mann zu ihrer Linken an. Durch seinen intensiven Blick verwirrt, blinzelte sie. »Ja, danke. Wein. Weiß oder rot, ist egal.«
»Kommt sofort.«
Aus irgendeinem Grund fasziniert, blickte sie ihm nach, als er sich durch die Menge schob. Er war einen halben Kopf größer als alle anderen Partygäste. Nikko, der Gastgeber und einer ihrer Freunde seit der High School, versuchte, sich vorbeizudrängeln. »Wer ist der blonde Typ?«, fragte sie ihn und wies mit dem Finger in Richtung Bar. »Der da.«
»Simon Pearce, Arzt in St. Pancras«, informierte sie Nikko grinsend. »Kein Geld, keine Verbindungen, meine Liebe. Simon ist ein Junge vom Land irgendwo östlich von Perth. Lebt vom Geruch eines öligen Lumpens, wie man hört.«
»Du weißt ganz genau, dass ich daran nicht interessiert bin!«, empörte sich Jessica. Wäre er nicht ein so guter alter Freund gewesen, hätte sie ihn zum Teufel geschickt.
»Weiß ich doch«, erwiderte Nikko ungerührt und riet ihr dann: »Und du willst auch nicht jedem Knaben von deinem Geld erzählen, stimmt’s?«
Die siebenundzwanzigjährige Jessica seufzte und nickte widerstrebend. Gelegentlich war ihre Erbschaft mehr der sprichwörtliche Stachel in ihrem Fleisch als ein Segen. Bei seinem Tod hatte James Ahearne, einer der erfolgreichsten Bauunternehmer von Perth, seinen beiden Kindern, ihr und ihrer Schwester Alison, ein kleines Vermögen zu gleichen Teilen hinterlassen. Immerhin war es so viel, dass es durch die geschickte Anlage durch den Finanzberater der Familie dazu ausreichte, dass sie eigentlich nicht mehr für ihren Unterhalt hätte arbeiten müssen. Doch sie hatte Jura studiert und arbeitete, weil sie beweisen wollte, dass sie es konnte, auch wenn sie es nicht musste.
Jessicas Interesse an dem jungen Arzt wurde nicht geringer. Sie heftete den Blick auf seinen Kopf und bemerkte, wie sein feines Haar wippte, als er sich entschlossen zur Bar durchkämpfte.
»In der Medizin soll er sehr gut sein, wie ich gehört habe. Der geborene Chirurg. Einige, die es wissen sollten, meinen, dass er eine große Karriere vor sich hat«, meinte Nikko im Weitergehen.
Der rothaarige Mann, der entschieden zu viel getrunken hatte, zupfte sie am Jackenärmel. »Willst du einen Joint, Jess? Ziemlich guter Stoff. Der beste.«
Jessica schüttelte den Kopf und schob seine Hand von ihrem Arm. Wie sollte sie ihn loswerden? Sie drehte sich halb um und prallte fast gegen Simons Brust.
»Ich bin Simon«, stellte er sich vor. »Kommen Sie, da drüben ist ein Balkon, auf dem wir unseren Drink in Ruhe genießen können.«
»Jessica Ahearne«, erwiderte sie und nahm das Weinglas. Obwohl sie insgeheim froh war, den Trottel losgeworden zu sein, hob Jessica bei der Einladung die Augenbrauen und tat, als ob sie zitterte. »Da draußen ist es unter null Grad. Ich werde mir den Tod holen.«
Simon lächelte zuversichtlich. Da sie nach wie vor ihren Mantel anhatte, bezweifelte er, dass sie wirklich frieren würde. »Machen Sie sich keine Sorgen, ich bin Arzt. Wenn Sie krank werden, mache ich Sie wieder gesund.«
Jessica lachte, und ihr kam der Gedanke, dass Doktorspiele mit Simon Spaß machen müssten. Wow! Das war ein ziemlich abwegiger Gedanke, doch sie war ehrlich genug, zuzugeben, dass er der erste Mann war, den sie anziehend fand, seit sie sich von Greg La Salle getrennt hatte.
Sie nahmen ihre Drinks auf dem Balkon und redeten über ihre Heimat Australien und ihre Herkunft. Sie über ihre kürzlich beendete Beziehung zu Greg La Salle, einem Börsenmakler aus Adelaide, er über seine medizinische Laufbahn. Als sie um Mitternacht Big Ben schlagen hörten und staunend zusahen, wie dicke Schneeflocken fielen – er sah zum ersten Mal im Leben Schnee – dämmerte in Simon eine erstaunliche Wahrheit auf. Er hatte sich im lächerlich kurzen Zeitraum von weniger als einer Stunde heftig und unwiderruflich in Jessica Ahearne, Rechtsanwältin, verliebt, die nach England gekommen war, um ihr angeblich gebrochenes Herz zu kurieren und einen Monat Ferien zu machen, bevor sie ihre neue Stelle in einer angesehenen Kanzlei in Perth antrat.
Bei ihrer dritten Verabredung schliefen sie in Jessicas Fünf-Sterne-Hotel miteinander, danach flog sie für eine Woche nach Edinburgh zu entfernten Verwandten. Es war die einsamste Woche in Simons Leben gewesen. Als er sie in Heathrow wieder traf, wäre er am liebsten sofort aufs Knie gesunken und hätte sie gebeten, ihn zu heiraten. Doch er schaffte es, sich zusammenzureißen und seine Gefühle unter Kontrolle zu bringen. Stattdessen bat er sie, in London zu bleiben und zu ihm zu ziehen. Sie stimmte zu. Zwei Wochen lang irrten sie auf der Suche nach einer geeigneten Wohnung kreuz und quer durch London. Schließlich fanden sie eine Einzimmerwohnung in Islington zu einer völlig überhöhten Miete, und Jessica rief die Kanzlei in Perth an, um ihnen mitzuteilen, dass sie die angebotene Stelle nicht antreten konnte. Dann bekam sie einen Job bei einer Kanzlei im Süden von London.
Sechs Monate später hatten sie geheiratet, und als Simons Auslandsaufenthalt endete, kehrten sie nach Perth zurück, wo er sich innerhalb von sechs Jahren mit seiner eigenen Praxis zu einem der führenden Chirurgen Australiens entwickelte.
Simon riss sich von seinen Erinnerungen über den Beginn ihrer Beziehung los. Liebste Jess! Er musste dafür sorgen, dass sie so schnell wie möglich wieder gesund wurde.
Aus der Besinnungslosigkeit wieder aufzutauchen war, als ob man sich seinen Weg aus einer dunklen, glattwandigen Grube zu einem stecknadelkopfgroßen Lichtschimmer kämpfen musste. Ihr Körper fühlte sich an wie Blei, ihr Atem ging flach, ihr Kopf war unfähig, einen Gedanken für mehr als eine Sekunde festzuhalten. Alles schien ihr zu entgleiten. Sie zwang sich, die Lider einen Spaltbreit zu öffnen – was an sich schon anstrengend war, da sie sich anfühlten, als ob ein Gewicht darauf lastete – und überprüfte durch die Sehschlitze ihre Umgebung.
Wo war sie? Nichts kam ihr bekannt vor. Grell weiße Wände und Decke, ein pastellfarbener, langweiliger Druck in einem Rahmen an der Wand. Vertikale Jalousien vor einem vergitterten Fenster. Gitter! Sie versuchte, die Hände zu bewegen, doch irgendetwas hielt sie fest. Sie kämpfte gegen die Fesseln an, verwirrt, und öffnete die Augen weiter, als sie weit oben an der Wand einen Fernsehbildschirm erkannte.
Was zum… Wo war sie?
Fast gegen ihren Willen senkten sich Jessicas Augenlider wieder und schlossen sich. Sie war so müde, so verdammt müde. Kann nicht denken, kann nicht fühlen. Der Anflug eines Lächelns umspielte ihre Lippen. Damian. Erinnerung. Eine Träne rollte aus ihrem linken Augenwinkel. Will nicht denken. Dankbar überließ sie sich erneut der Dunkelheit.
Alison Marcelle, in Begleitung ihres Mannes Keith, starrte ihren Schwager ungläubig an, während David Greiner und Max Lowe, Jessicas Geschäftspartner, versuchten, im Wohnzimmer des Pearce-Hauses am Hauptkanal von Mandurah möglichst unauffällig zu wirken.
»Das ist nicht dein Ernst, Simon. Ich kann nicht glauben, dass du Jessica wegbringen willst. Das ergibt doch gar keinen Sinn!«, stieß Alison hervor. Mühsam beherrschte sie ihr berüchtigtes Temperament, das zu ihrem feuerroten Haar passte.
Simon warf einen Blick auf Jessicas Schwester, die einen modisch gemusterten Hosenanzug trug. Für ihr Alter von dreiundvierzig hielt sie sich sehr gut, auch wenn sie ein paar Kilo zu viel hatte. Er hatte gewusst, dass er bei Alison einiges an Überzeugungsarbeit würde leisten müssen. Seit Jessica ins Sanatorium gekommen war, wachte Alison über sie wie die sprichwörtliche Glucke über ihr Küken. Regelmäßig besuchte sie das Krankenhaus, versuchte, Informationen über Jessicas Geisteszustand zu bekommen, stellte Fragen, ob ihre Krankheit irgendwie mit Schizophrenie in Verbindung stand, unter der ihr Großvater gelitten hatte, und wurde so langsam zu einer Plage. Alles natürlich aus Sorge um ihre Schwester. Er bezweifelte nicht, dass sie sich nahestanden, doch ihr Getue war eine Belastung – für alle.
Zusätzliche Sorge bereitete es ihm, dass Nikko bislang nicht in der Lage gewesen war, die Möglichkeit auszuschließen, dass Jessica oder auch Alison in Zukunft die Krankheit ihres Großvaters bekommen konnten. Schizophrenie war eine Krankheit, die sich nicht vorherbestimmen ließ, und trotz aller medizinischer Forschung wusste man noch nicht alles darüber. Man hatte ihm gesagt, er solle einfach abwarten, was ihn absolut nicht befriedigte. Doch er würde Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um seine Frau wieder gesund zu machen, und wenn das hieß, sein Projekt auf Eis zu legen, dann würde er genau das tun.
»Eigentlich ergibt das schon einen Sinn.« Simon blieb ruhig, im Gegensatz zu Alison. »Jessica ist jetzt seit fast drei Monaten im Sanatorium. Nikko ist mit ihren Fortschritten zufrieden, wie ihr wisst, und sie ist fast so weit, nach Hause zu kommen.« Er machte eine Pause, um die verschiedenen Möbelstücke zu betrachten, die seine Frau für den Raum ausgesucht hatte. »Ich glaube nicht, dass es ihr gut tut, hierher zurückzukommen.«
»Dann kaufein anderes Haus in einer anderen Vorstadt«, empfahl ihm Alison. »Lass sie es selbst einrichten – das wäre doch eine Hilfe, oder? Dann wäre sie beschäftigt.« Ihr Blick folgte Simons, und sie bemerkte die fehlenden Fotos. Früher hatten im ganzen Haus verteilt Fotos von dem kleinen Damian gestanden, Fotos von seiner Taufe, beim Krabbeln, als er seinen ersten Zahn bekommen hatte, laufend, einen Ball tretend. Sie erinnerte sich daran, dass sie ihre Schwester damit aufgezogen hatte, dass sie wahrscheinlich ständig Staub wischen würde.
»Ja, aber sie wäre nach wie vor in Perth. Nah genug am Friedhof«, erwiderte Simon. »Das ist eines, was Nikko bei seinen Therapiesitzungen mit ihr herausgefunden hat. Jessica war jeden Tag auf dem Friedhof. Stundenlang hat sie weinend an Damians Grab gesessen und sich gewünscht, auch tot zu sein, damit sie bei ihm sein kann.« Er sah Max an. »An dem Tag, als Sie sie im Büro gefunden haben, das hätten doch Anzeichen für einen Selbstmordversuch sein können, nicht wahr?« Er sah Max zustimmend nicken.
»Scheiße«, stieß Keith Marcelle halb unterdrückt hervor. Der große Mann schüttelte den Kopf. »Das haben wir nicht gewusst. Al hat versucht, ihr so gut wie möglich zu helfen, aber sie musste schließlich die Kinder zur Schule bringen und wieder abholen und so. Sie konnte ja nicht den ganzen Tag bei ihr sein.«
»Natürlich nicht«, gab David knapp zu und wandte sich an Simon. »Glauben Sie, dass sie gesund genug ist, um entlassen zu werden?«
»Nikko glaubt, ja. Jessica ist immer noch labil, emotional gesehen. Sie wird einige Monate lang leichte Antidepressiva nehmen, bis sie wieder normal ist, und ich werde die Dosierung überwachen.« Er stellte plötzlich fest, dass sie zum ersten Mal seit Damians Beerdigung wieder alle in einem Raum waren. Er hatte sie eingeladen, um sie von seinen Plänen zu unterrichten, da seine Entscheidung sie alle betreffen würde.
»Aber sie gleich tausend Kilometer von allem fortzubringen, was sie gewohnt ist. Freunde, Verwandte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr das gut tun soll. Heißt das nicht, sie ohne Rettungsleine ins Wasser zu werfen?«, beharrte Alison, in der üblichen Kampfhaltung, die Hände in die Hüften gestemmt. Sie liebte ihre jüngere Schwester, litt mit ihr für das, was sie durchmachen musste, und wollte es Simon nicht erlauben, sie einfach für sechs Monate auf eine gottverlassene Insel zu verschleppen. Zumindest nicht kampflos.
Simon blieb geduldig. »Nikko, Jessica und ich haben das besprochen. Sie ist ebenfalls der Meinung, dass eine vollständige Veränderung ihr gut tun würde.«
»Nimm sie auf eine Kreuzfahrt mit, eine Fernreise, irgend so etwas«, schlug Alison vor, die als Einzige dagegen war.
»Nein.« Sein Tonfall ließ keine Widerrede zu. »Ich habe das mit Nikko besprochen. Er ist der Meinung, dass Jessica in ein normales Umfeld zurück muss und nicht den Touristen spielen sollte.« Er zuckte die Schultern. »Außerdem ist das schon entschieden. Ich habe mich als Assistenzarzt am Norfolk Island Hospital beworben, und sie haben angenommen. Sie wollten eigentlich einen Zwei-Jahres-Vertrag, aber als ich sagte, dass ich nicht länger als sechs Monate bleiben könnte, haben sie überraschenderweise zugestimmt.« Was er nicht sagte, war, dass der Aufsichtsrat hocherfreut gewesen war, einen Chirurgen seines Kalibers zu bekommen. »Wir werden nächste Woche abreisen.«
»Norfolk Island!« Alison lachte höhnisch. »Was ist das überhaupt? Irgendein gottverlassener Fleck im Pazifik. Eine blöde Steueroase für Leute und Gesellschaften, die ihre Steuerausgaben senken wollen. Es wird Jessica wahrscheinlich schon nach einem Monat zu Tode langweilen. Und was dich angeht.« Sie wies mit dem Finger auf Simon. »Welche Herausforderungen erwarten einen Chirurgen mit deinen Fähigkeiten an so einem Ort?«
»Oh, das ist gar nicht so schlimm«, meinte Simon. »Das Krankenhaus hat dreißig Betten und verfügt über eine Geburtsstation und eine Station für Geriatriepatienten. Insgesamt über vierzig Leute arbeiten dort. Außerdem kommen Spezialisten von außerhalb, mit denen man medizinische Probleme besprechen kann.« Seine Augenbrauen hoben sich zuversichtlich und senkten sich dann wieder. »Ich bezweifle, dass ich in den sechs Monaten sehr einroste. Außerdem kann ich in dieser Zeit an meinem Bauprojekt arbeiten, dem Geriatriezentrum.«
»Aber vor Weihnachten wegzugehen! Wir haben diese Zeit immer zusammen verbracht! Weihnachten ist ein Familienfest«, wandte Alison ein. Sie verzog das Gesicht, als sie den flehenden Tonfall in ihrer Stimme bemerkte, doch sie konnte sie nicht kontrollieren.
»Mein Vertrag am Krankenhaus beginnt am fünfzehnten Dezember. Darauf hatte ich keinen Einfluss und bin verpflichtet, dann auch tatsächlich dort anzufangen.«
»Waren Sie jemals da, Alison?«, fragte Max Lowe. »Auf Norfolk Island?«
»Natürlich nicht«, grollte Alison, »es gibt wohl interessantere Orte, an denen man Ferien machen kann.«