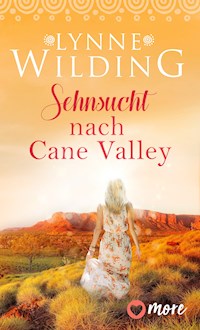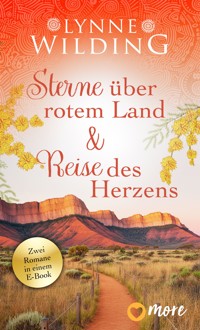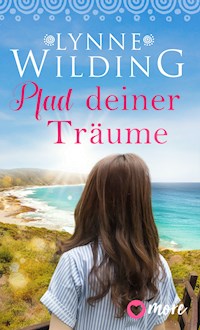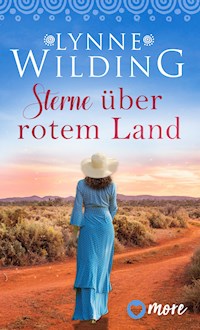
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Große Liebe, rotes Land
- Sprache: Deutsch
Australien, 1920: endlich ist der erste Weltkrieg vorbei und die junge Krankenschwester Amy Carmichael kann in ihre Heimat zurückkehren. In der Kleinstadt Gindaroo am Rande des Outbacks trifft sie den Farmer Danny McLean, der mit seinem Bruder Randall dort eine Farm führt. Amy und Danny verlieben sich und schon bald findet eine Verlobung statt. Aber mit der Zeit erkennt Amy, dass ihr Herz für Dannys Bruder Randall schlägt. Auch Randall erwiedert ihre Gefühle, aber er ist ebenfalls verlobt...
Wird es unter der Sonne Australiens zu einer Katastrophe kommen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 650
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über Lynne Wilding
Lynne Wilding ist in Australien längst als die Königin der großen Australien-Sagas bekannt und erhielt viele Preise für ihre Romane. Lynne Wilding lebt mit ihrer Familie in Arncliff bei Sydney.
Informationen zum Buch
Australien, 1920: endlich ist der erste Weltkrieg vorbei und die junge Krankenschwester Amy Carmichael kann in ihre Heimat zurückkehren. In der Kleinstadt Gindaroo am Rande des Outbacks trifft sie den Farmer Danny McLean, der mit seinem Bruder Randall dort eine Farm führt. Amy und Danny verlieben sich und schon bald findet eine Verlobung statt. Aber mit der Zeit erkennt Amy, dass ihr Herz für Dannys Bruder Randall schlägt. Auch Randall erwiedert ihre Gefühle, aber er ist ebenfalls verlobt...
Wird es unter der Sonne Australiens zu einer Katastrophe kommen?
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Übersicht
Cover
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Über Lynne Wilding
Informationen zum Buch
Newsletter
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Danksagung
Impressum
Lynne Wilding
Sterne über rotem Land
Australien-Saga
Aus dem Englischenvon Gertrud Wittich
Inhaltsübersicht
Über Lynne Wilding
Informationen zum Buch
Newsletter
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Danksagung
Impressum
Den Schwestern und Pflegern desSt. George Privat Hospital, Kogarah, Sydney,in Dankbarkeit gewidmet.
KAPITEL 1
30. April 1874
DIE SONNE BRANNTE schon am frühen Vormittag. Der Mann zügelte sein Pferd, lüftete blinzelnd seinen abgewetzten, breit-krempigen Hut und wischte sich mit dem Handrücken den Schweiß von der Stirn.
»Affenhitze«, murmelte er überflüssigerweise und ließ die Rinderherde herankommen. Eine feine rote Staubwolke hüllte ihn ein und er musste husten.
Eine solche Hitze hatte er nicht erwartet – und schon gar nicht im April. Daheim in Glasgow, wo er Frau und drei Kinder zurückgelassen hatte, war es jetzt Frühling und noch bitterkalt.
Aber nun befand er sich auf der anderen Seite der Erdkugel, in den Flinders Ranges, in Südaustralien, eine halbe Weltreise weit weg von der alten Heimat. Er war gekommen, um sich das Land anzusehen, das er vor nun fast einem Jahr unbesehen gekauft hatte.
Als gebürtiger Schotte, der von Natur aus eher vorsichtig war, lag Howard McLean jede Impulsivität fern. Und doch hatte er impulsiv gehandelt, als er an jenem Tag die Anzeige, in der erstklassiges Land in der Kolonie Australien zum Kauf angeboten wurde, gelesen hatte. Frustriert über die mangelnden Perspektiven, die ihm seine kleine Farm in Braemar bot, die Farm, die seine Familie nun seit zwei Generationen bewirtschaftete und die zwei Tagesreisen mit dem Pferdewagen von Glasgow entfernt lag, hatte er die Sache sofort in Betracht gezogen. Der kleine Hof warf kaum genug ab, um seine Familie zu ernähren, zu kleiden und seine Kinder zur Schule zu schicken.
Daheim hatte er die Sache in aller Ruhe mit seiner Frau Mary durchgesprochen und danach genug zusammengekratzt, dass es für eine Anzahlung reichte.
Und damit hatte er eine Kette von Ereignissen in Gang gesetzt, die ihrer aller Leben von Grund auf verändern würde, in einem Land, das vollkommen außerhalb ihres Erfahrungsbereichs lag.
Ja, dieses Land hier war ganz anders als die Täler und Berge Schottlands. Interessiert schaute er sich um, doch wurde sein Blick von einem Reiter abgelenkt, der die hundert Köpfe zählende Herde von Hereford-Rindern vor sich her trieb. Howard mochte gar nicht daran denken, wie lange sie nun schon mit all den Tieren unterwegs waren. Vor Wochen waren sie von Adelaide aufgebrochen, immer in nordwestlicher Richtung, auf dem Weg zu den zehntausend Acres unberührten Buschlands, die er, unweit des Weilers Gindaroo, erworben hatte.
Der Reiter, sein Neffe Angus Scotten, fühlte sich im Sattel offenbar pudelwohl. Das freie Leben eines Viehtreibers gefiel ihm außerordentlich. Der schlaksige Fünfzehnjährige hatte die Schule nur zu gern an den Nagel gehängt und war seinen Eltern, Mutter Heather und Vater Hamish, mit Freuden in dieses Abenteuer gefolgt.
Abenteuer! Howard gab ein verächtliches Schnauben von sich und musste prompt niesen. Für Angus mochte das alles ja ein wundervolles Abenteuer sein, für ihn jedoch war es ein Glücksspiel, das größte Risiko, auf das er sich je eingelassen hatte.
Und ein Spiel, das er um jeden Preis gewinnen musste.
Deshalb konnte er es auch kaum abwarten, sein Land mit eigenen Augen zu sehen. Erst dann würde er wissen, ob er einen Fehler gemacht hatte oder nicht.
Weit hinter der Herde kutschierte seine Schwester Heather den Planwagen mit dem Proviant, der Ausrüstung und den Werkzeugen, die sie brauchten, um sich ein Haus zu bauen. Hinter ihr folgte ihr Mann mit der fünfzigköpfigen Schafherde: Lämmer, Schafe und zwei Schafböcke.
Howards nussbraune Augen suchten forschend den Horizont ab, auf der Suche nach den »Wegweisern«, die in der Besitzurkunde aufgeführt wurden. Er hatte sie auswendig gelernt, um nicht jedes Mal die Urkunde hervorziehen zu müssen, wenn er glaubte, sich dem Land zu nähern.
Gestern waren sie, kurz bevor sie ihr Nachtlager aufschlugen, durch den Weiler Gindaroo gekommen, und wenn seine Berechnungen stimmten, dann konnte sein Land jetzt nicht mehr weit weg sein. Er gab seinem Pferd die Sporen und griff gleichzeitig in die Tasche, holte einen alten Armeekompass heraus. Ein kurzer Blick überzeugte ihn, dass die Richtung stimmte: Der Boolcunda Creek musste irgendwo vor ihnen liegen.
Eine plötzliche Bewegung an der Spitze der Herde erregte seine Aufmerksamkeit. Der Leitstier war ausgebrochen und trabte nun nach rechts von der Herde weg. Der Rest der Kühe muhte laut und wandte sich ebenfalls nach rechts. Was war da los? Howard runzelte seine sonnenverbrannte, mit frischen Sommersprossen übersäte Stirn. Ah ja! Das musste der Fluss sein! Die Herde hatte Wasser gerochen.
Er grinste. Wasser! Der Boolcunda Creek. Mit den Händen einen Trichter bildend, rief er seinem Neffen Angus, der Anstalten machte, die Herde auf Kurs zurückzutreiben, zu: »Lass sie, Junge, ich glaube, die haben den Fluss gefunden.«
Und tatsächlich: Da waren sie, seine »Wegweiser«. Howard erkannte sie, sobald er das Wasser durch die Bäume schimmern sah: Zu seiner Linken ragte ein zerfurchter, rotbrauner Hügel mit drei Buckeln auf, und nachdem er den Fluss durchquert hatte, der kaum einen Fuß tief war, und die jenseitige Uferbank hochgeritten war, wo er eine bessere Aussicht hatte, fiel sein Blick auf ein weites, sanft gewelltes Tal mit dichten Waldstücken und einer Ansammlung rötlicher Felsbrocken auf der Ostseite.
Genau wie es in der Landurkunde beschrieben war.
Kein schlechtes Weideland, dachte Howard bei sich, auch wenn das Gras reichlich hoch stand und von der Sonne gelb ausgebleicht war. Er stieg ab und grub seine Finger durch die Grassoden in die Erde darunter. Mit einer Faust voll kam er wieder hoch. Er hielt sie an seine Nase, schnupperte, begutachtete sie. Ja, es war gute Erde, ertragreiche Erde – wenn der jährliche Niederschlag ausreichte.
Sein Grinsen wurde breiter.
Da er jedoch ein guter Methodist war, sprach er sogleich ein inbrünstiges Dankgebet.
Das Risiko hatte sich gelohnt. Die McLeans hatten ein neues Zuhause … und wenn Mary mit den Kindern – Dougal, Helen und dem vierjährigen Colin – eintraf, würde das Haus bereits stehen. Zunächst mal nichts Großartiges, natürlich, aber es wäre ein Anfang – ein Neuanfang für sie alle.
»Onkel Howard.« Angus zügelte sein Pferd neben dem seines Onkels. Aufgeregt sagte er: »Sind wir da? Ist das unser Land, Onkel?«
»Ja, das ist es, Junge. Genau da« – er deutete auf einen Hügel unweit des Flusses – »werden wir unser Lager aufschlagen. Und morgen werden wir den Grund für die Hütte abstecken. Hier gibt’s genug Holz und Steine, gutes Baumaterial.«
Das Haus für den Winter und die Versorgung der Herden, das war im Moment das Allerwichtigste, denn Howard hatte Mary versprochen, dass sie bei ihrer Ankunft eine anständige Unterkunft vorfinden würde.
»Da wird sich Mary aber freuen. Sie schläft nicht gern auf der harten Erde.«
Howard nickte. »Ich weiß.«
»Onkel«, sagte Angus nachdenklich, »das Land sollte einen Namen haben. Hast du dir schon überlegt, wie du die Farm nennen willst?«
»Nein«, gestand Howard. Er verzog den Mund zu einem schiefen Lächeln. »Vielleicht irgendwas mit McLean. McLean Downs. McLean’s Crossing. McLean’s Way. Was hältst du davon?«
»Hm.« Angus verzog seine lange spitze Nase. »McLean’s Crossing ist noch am besten, aber weißt du, wir haben die Herde jetzt fast drei Wochen lang von Adelaide bis hierher getrieben, und wenn wir Vieh verkaufen wollen, müssen wir es über weite Strecken bis zur nächsten größeren Stadt treiben. Und dann der Wechsel zwischen den unterschiedlichen Weiden. Darf ich einen Vorschlag machen?«
»Klar.« Howard hatte nur mit halbem Ohr zugehört. Im Geiste machte er bereits Pläne für die Urbarmachung des Landes: Er würde einen Teil der Wälder abholzen, um mehr Weideflächen für Rinder und Schafe zu schaffen, einen Gemüsegarten anlegen, vielleicht auch ein Weizenfeld.
»Wie wär’s mit Drovers Way?«
»Drovers Way.« Howard kratzte sich den Bart, den er seit ihrer Ankunft hatte wachsen lassen. »Nicht übel. Ich werde darüber nachdenken! Mal sehen, was dein Pa und deine Ma dazu sagen. Aber jetzt hören wir besser auf zu schwatzen und sehen zu, dass wir die Herde aus dem Fluss kriegen. Der Wagen und die Schafe werden bald da sein.«
Angus schwang sich wieder in den Sattel. »Aye, Onkel, sofort.«
KAPITEL 2
15. November 1918
IM GRAUEN LICHT einer trüben Morgendämmerung ging Schwester Amy Carmichael über den Hof auf die Hospitalgebäude zu. Nachdem sie eines betreten hatte, blieb sie kurz vor der Glastür, dem Eingang zu Station 20, stehen und wappnete sich vor den Gerüchen, die sie drinnen erwarteten. Sie hatte sich noch immer nicht an den Gestank gewöhnt, selbst nach vier Jahren Kriegsdienst nicht und würde es auch wahrscheinlich nie. Da war der moderige, schimmelige Geruch der Gebäude, der Gestank von Erbrochenem, Schweiß, Blut und, in einigen Fällen, der süßliche Geruch von Wundfäule. Die hastig errichteten Gebäude des Militärkrankenhauses außerhalb von Dover waren wenig mehr als Baracken – auf ästhetische Gesichtspunkte hatte man keine Rücksicht nehmen können. Wände und Decken bestanden aus unbehandelten Balken, den Boden bedeckte ein robuster Linoleumbelag. Und der offene Kamin in der Mitte der Westwand spendete jenen, die an den Enden des Saals lagen, kaum Wärme.
Dies war die harte Wirklichkeit ihres Arbeitsalltags, ihrer Bemühungen, Soldaten, die die Hölle des Weltkriegs überstanden hatten, wenn schon nicht gesund, so doch wieder einigermaßen auf die Beine zu bekommen, damit sie in ihre Heimat Australien zurückkehren konnten. Dennoch – sie tat ihre Arbeit, so hart sie auch war, gern, ja mit Enthusiasmus. Der Krieg war vor vier Tagen – zur übergroßen Freude aller, des Pflegepersonals bis hinab zum kränksten Soldaten – als beendet erklärt worden.
Sie tastete unwillkürlich nach dem Brief in der Tasche ihrer gestärkten Schwesternschürze und unterdrückte ein gereiztes Seufzen. Der Brief war von Miles aus Südaustralien. Miles, der sich für so was wie ihren Verlobten hielt, eine Meinung, die sie nicht teilen konnte. Man brauchte nicht viel Fantasie, um zu wissen, was in dem Brief stehen würde: Wie geht es dir? Wann kommst du nach Hause? Du fehlst mir. Es war immer dasselbe. Und vor einiger Zeit hatte sie zu ihrem Schrecken festgestellt, dass sie sich weder an sein Gesicht noch an seine Stimme erinnern konnte.
Der Brief war vor drei Monaten aufgegeben worden; sie würde ihn lesen, wenn sie Zeit dazu hatte, in ihrer Teepause, vielleicht. Aber da sie heute zwei Ausfälle hatten – zwei Lernschwestern hatten sich erkältet und waren, da man fürchtete, es könne die Spanische Grippe sein, isoliert worden –, bestand kaum Aussicht auf eine schöne, stärkende Tasse Tee.
Miles und Australien – Adelaide, ihr Vater, der Arzt war –, dies alles erschien ihr so weit weg, fast wie ein anderes Leben. Nach allem, was sie in ihrer Zeit als Militärkrankenschwester erlebt hatte, kam es ihr fast vor, als wäre sie ein ganz anderer Mensch. Sie erschauderte. All die Toten, Verletzten, Verstümmelten. So viele junge Leben ausgelöscht oder für immer gezeichnet.
Aber es hatte auch Wunder gegeben, Soldaten, die allen medizinischen Prognosen zum Trotz dem Tod ein Schnippchen geschlagen und wieder gesund geworden waren.
Dr. David Carmichael war vehement dagegen gewesen, dass sie ihre Stelle am Royal Adelaide Hospital aufgab und sich freiwillig zum Kriegsdienst meldete. Er fürchtete, sie auch noch zu verlieren, nachdem er schon ihren Bruder Anthony in Gallipoli verloren hatte. Amy dagegen war fest entschlossen gewesen, das, was sie für ihre Pflicht hielt, zu tun und hatte sich gegen ihn durchgesetzt.
Sie griff nach der Türklinke und fragte sich dabei, ob Korporal Peters wohl die Nacht überlebt hatte. Er hatte eine fürchterliche Bauchwunde und litt Höllenqualen. Und dann war da dieser nette Gefreite, Daniel McLean, ihr einziger Patient, der nicht aus der Arbeiterschicht stammte. Er hatte Schrapnellwunden davongetragen und hielt sich unglaublich tapfer. Außerdem war da noch dieser Soldat von den Royal Engineers, Jim Allen, siebzehn, und somit vier Jahre jünger als sie, Amy. Er war Maurer gewesen, doch eine deutsche Granate hatte ihm die linke Hand weggerissen. Jim litt unter einer tiefen Depression. Es fiel ihm schwer, mit dem Verlust seiner Hand fertig zu werden und sich damit abzufinden, dass seine Tage als Maurer vorbei waren.
Amy holte tief Luft, setzte eine gelassene Miene auf und öffnete die Tür. Der Patient im ersten Bett stieß sogleich einen anerkennenden Pfiff aus. »Ja, wen haben wir denn da? Ein wenig australischen Sonnenschein im trüben Mutter England.« Robbie, so hieß er, grinste spitzbübisch. »G’day, Schwester Carmichael«, sagte er im breitesten australischen Dialekt.
»Ich nehme das als Kompliment, Sappeur Bruce«, entgegnete Amy mit gouvernantenhafter Strenge. Sie zog seine Bettdecke glatt, maß seinen Puls und schob ihm ein Thermometer zwischen die Lippen. »Wenn Sie kein Fieber mehr haben, Sappeur, erlaubt Ihnen die Oberschwester heute vielleicht, kurz draußen zu sitzen und das trübe englische Wetter zu genießen.«
»Also, wenn Sie sich zu mir setzen würden, Mädel, dann ginge bei mir die Sonne auf, egal wie’s Wetter draußen ist.«
»Zügle dein Mundwerk, Robbie, oder du landest auf der schwarzen Liste der netten Schwester«, brummte ein Sergeant, einer von zwei Unteroffizieren, die auf der Station lagen.
Einige Männer lachten und riefen: »Hört, hört.«
Mit Ausnahme des armen Jim Allen waren die Augen sämtlicher Soldaten verstohlen auf die braunhaarige, zierliche Schwester gerichtet. Bei Korporal Peters hielt sie sich länger als eigentlich nötig auf, da sie sich Sorgen um seinen Zustand machte.
Auch ein ganz bestimmtes Paar brauner Augen verfolgte aufmerksam Schwester Carmichaels Näherkommen. Danny McLean saß halb aufgerichtet, auf einen Ellbogen gestützt und an zwei Kissen gelehnt, in seinem Bett und konnte kaum die Augen von der attraktiven Schwester lösen. Bis vor kurzem war er noch zu krank gewesen, um sich um das Aussehen der Schwestern zu kümmern, aber nun, da es mit ihm aufwärts ging, übte Schwester Amy Carmichael eine immer größere Faszination auf ihn aus. Er wusste, wie blöd das von ihm war, schließlich hatte sie, wie man sich erzählte, einen Freund namens Miles in Südaustralien, der bei irgendeiner Bank arbeitete.
Sein großer Bruder Randall würde ihn schön auslachen – sich in seine Krankenschwester zu verlieben! Doch Randall war schon immer der härtere von ihnen beiden gewesen. Aber obwohl seine Chancen praktisch null waren, konnte er sich von seinen Gefühlen für Amy Carmichael einfach nicht befreien.
Außerdem – und er zuckte die Schulter, was er sofort bereute – hatte er auf diese Weise wenigstens was anderes, an das er denken konnte, außer an den Krieg und Drovers Way, die große Farm, die die McLeans nun bereits in der dritten Generation bewirtschafteten. Und jetzt, wo der Krieg endlich vorbei war, konnte er auch ans Heimkehren denken. Sobald seine Wunden einigermaßen verheilt waren, würde man ihn ausmustern und auf ein Schiff nach Australien setzen. Sein Traum, der Traum, der ihn die Schützengräben, den Dreck, die Feuchtigkeit, die Krankheiten hatte überstehen lassen, dieser Traum war in Erfüllung gegangen: Er hatte überlebt. Und weil er überlebt hatte, wollte er nun etwas aus seinem Leben machen.
Trotzdem hatte er oft Angst gehabt – ja, Angst gehabt –, dass es ihm wie seinem ältesten Bruder Edward ergehen könnte, der nach dem frühen Tod ihres Vaters die Rolle des Familienoberhaupts übernommen hatte. Colin McLean war vom Pferd gefallen und hatte sich das Genick gebrochen – ein schwerer Schicksalsschlag für seine drei Söhne. Und dann war Edward dem tückischen Senfgas zum Opfer gefallen, irgendwo an der Somme. Weder Danny noch Randall wussten, wo genau ihr Bruder begraben lag – wie so viele alliierte Soldaten hatte er einen anonymen Tod in einem Massengrab gefunden.
»Guten Morgen, Gefreiter McLean«, riss ihn Amys klare Stimme aus seinen Gedanken. Sie stand am Fuß seines Bettes und schaute ihn freundlich an. »Na, wie geht’s uns denn heute?«
Viel besser, jetzt wo Sie da sind, lag es Danny auf der Zunge. Aber da er von Natur aus eher schüchtern war, sagte er stattdessen nur: »Ganz gut, schätze ich.«
»Haben Sie gut geschlafen?« Sie trat zu ihm, legte ihm die Hand auf die Stirn, fühlte seinen Puls und maß seine Temperatur.
»So gut, wie’s eben ging bei Harrys Geschnarche und Jim, der im Schlaf gejammert und gestöhnt hat, der arme Kerl.« Weiß Gott, wie Jim mit der Tatsache fertig werden sollte, dass er den Rest seines Lebens mit nur einer Hand zurechtkommen musste. Was konnte ein Einhändiger ohne Schulbildung schon anfangen? Da gab es wenig. Und noch schlimmer: Mit dieser vergleichsweise kleinen Behinderung würde er wohl kaum eine anständige Versehrtenrente kriegen.
»Ihre Temperatur ist in Ordnung, Gefreiter, aber Ihr Puls scheint mir ein bisschen hoch.«
Harry, im Bett gegenüber, der sich für die Bemerkung über sein Schnarchen rächen wollte, lachte meckernd. »Das kommt, weil Sie die hübscheste Schwester im ganzen Krankenhaus sind. Ich wette, dass jedem der Puls hochschnellt, wenn Sie auf Station kommen!«
Ohne auf diese Bemerkung einzugehen, sagte sie zu Danny: »Ihre Verbände müssen heute gewechselt werden. Irgendwann am späten Vormittag, schätze ich.« Sie schenkte ihm ihr professionelles Krankenschwesterlächeln. »Ich selbst werde der Oberschwester assistieren.«
Er war ihr dankbar für die Vorwarnung. Auch freute er sich, dass sie dabei sein würde, denn sie hatte sanfte, geschickte Hände und war nicht so grob wie manch andere Krankenschwester. Die Verbände auf seiner Brust, seiner Schulter und dem rechten Oberschenkel zu wechseln und die Wunden frisch zu desinfizieren, war nun mal eine schmerzhafte und unangenehme Notwendigkeit. Aber immerhin heilten die Schrapnellwunden gut, und wenn er Glück hatte, würde man ihn kurz nach Weihnachten entlassen.
»Na, ich hab wenigstens einen Puls, Harry, im Gegensatz zu dir, du Zombie.« Danny riskierte ein Grinsen in Richtung Amy.
»Meine Herren«, rügte diese milde.
Sie konnte gut mit den Jungs umgehen, das war Danny schon aufgefallen, obwohl sie noch so jung war. Sein Alter etwa, schätzte er, einundzwanzig also. Seine Blicke folgten ihr, wie sie mit unter dem Arm geklemmtem Patientenberichtsbuch den Gang entlang zurückging. Jünger war sie bestimmt nicht, denn sie war examinierte Krankenschwester. Bewundernd verfolgte er ihren anmutigen Hüftschwung, der feminin, aber unauffällig war. Auch gefiel ihm, wie sich einzelne widerspenstige braune Locken manchmal aus ihrer Schwesternhaube lösten und ihr ins Gesicht fielen. Was er jedoch am meisten mochte, waren ihre klaren blauen Augen und die Art, wie sie ihn direkt ansahen, wenn sie mit ihm sprach. Sie blieb beim Hinausgehen noch einmal an Jims Bett stehen und zog erneut seine Decke glatt. Sie hatte ein gutes Herz, das war offensichtlich.
Er lehnte sich in die Kissen zurück und zündete sich eine Zigarette an, sah dem Rauch nach, der in Kringeln zur Decke stieg. Wenn die Jungs nicht zu laut waren, konnte er vor dem Frühstück ja vielleicht noch ein Nickerchen machen.
KAPITEL 3
AMY HATTE SICH, dem kalten Dezemberfreitag zum Trotz, in ihren robusten Armeemantel und einen dicken Schal gehüllt, auf die Veranda des Schwesternheims gesetzt, um nun endlich die längst fällige Antwort auf Miles’ Brief zu schreiben, den sie vor zwei Wochen bekommen hatte. Da ihr der Federhalter immer aus der Hand rutschte, hatte sie den rechten Handschuh zum Schreiben ausgezogen. Sie tauchte die Feder ins Tintenfass und setzte die Schilderung ihres Alltags fort: die Patienten, das miese Essen, das noch miesere Wetter. Sie blickte auf: Ein feiner Nieselregen hatte eingesetzt. Sie seufzte. Wie sehr sie die Sonne vermisste – selbst die brütende Hitze des australischen Sommers war besser als diese ewig trübe Nässe und Kälte des englischen Winters.
Erschauernd kuschelte sie sich tiefer in ihren Mantel, beugte sich übers Blatt und schrieb: Jetzt, wo der Krieg vorbei ist und die Soldaten nach und nach in ihre Heimat zurückgeschickt werden, hoffe ich auch bald wieder in Adelaide zu sein – vielleicht Ende März, Anfang Juni. Das einzige, was meine Heimreise aufschieben könnte, ist die Spanische Grippe, die sich zu einer Epidemie auszuweiten droht und, wie man hört, schon viele Opfer in Spanien und anderen Teilen Europas gefordert hat.
Zunehmend beunruhigende Zeitungsartikel landeten in den Aufenthaltsräumen und Kaffeestuben des Klinikpersonals, worin über die verheerenden Folgen der Spanischen Grippe zu lesen war. Konservativen Schätzungen zufolge sollten bereits Millionen von Menschen in ganz Europa, darunter Soldaten in den Schützengräben, und auch in Asien und Nordamerika dem Virus zum Opfer gefallen und einen schnellen aber schrecklichen Tod gestorben sein.
Ein diskretes männliches Räuspern ließ sie zusammenzucken. Sie hatte sich so darauf konzentriert, etwas zu schreiben, was Miles interessieren könnte, dass sie nichts weiter gehört hatte als das leise Kratzen ihrer Feder auf dem Papier. In diesem Moment fuhr ein plötzlicher Windstoß in ihre Blätter und wirbelte zwei davon. Sie flatterten übers Holzgeländer und landeten im Matsch.
»Scheiße«, murmelte sie reichlich undamenhaft.
»Allerdings«, sagte eine kühle, maskuline Stimme. »Warten Sie, ich hole sie Ihnen.«
Es war ein Soldat, ein Offizier sogar. Verärgert über die verlorenen Seiten, die sie jetzt natürlich neu schreiben musste, verfolgte sie, wie der Offizier von der Veranda sprang, die Papiere aufhob und zu ihr zurückkam. Seine Schulterstücke verrieten ihr, dass er Leutnant war.
Er war groß und breitschultrig und seine glatten, schwarzen Haare, die unter seiner Mütze hervorschauten, waren ganz nass. Seine Augen waren von einem so dunklen Braun, dass sie beinahe schwarz wirkten, große, weit auseinanderstehende Augen, wie sie bemerkte, als er ihr die feuchten Briefseiten aushändigte. In ihren dunklen Tiefen tanzte ein amüsiertes Funkeln, aber auch etwas anderes, etwas Düsteres, Trauriges.
Amy hielt sich für eine recht gute Menschenkennerin. Ihr Beruf hatte sie gelehrt, einen Menschen in wenigen Augenblicken einzuschätzen und hier hatte sie einen Mann vor sich, der Dinge gesehen und getan hatte, die seiner Natur zuwiderliefen. Nein, sie irrte sich nicht. Aber – und das war noch seltsamer – er kam ihr irgendwie bekannt vor. An wen erinnerte er sie bloß?
Und dann fiel es ihr ein: Er war eine größere, ernstere Ausgabe des Gefreiten Danny McLean.
»Danke«, sagte sie steif.
»Tut mir leid, dass sie nass geworden sind … Ja, äh, also ich kenne mich hier nicht aus und …«
Ihre Höflichkeit veranlasste sie, sofort zu sagen: »Das macht doch nichts. Sie möchten sicher Ihren Bruder besuchen, den Gefreiten McLean?«
»Genau. Station 20, glaube ich.« Seine dunkelbraunen Augen funkelten belustigt. »Ich schätze, wir sehen uns ein bisschen ähnlich, Danny und ich.«
Amy warf einen Blick auf ihre Armbanduhr – ein Abschiedsgeschenk ihres Vaters, um das sie die anderen Schwestern glühend beneideten – und schraubte dann entschlossen das Tintenfass zu. Sie erhob sich. »Ich muss ohnehin meinen Dienst antreten. Wenn Sie kurz warten, räume ich das hier schnell weg und bringe Sie dann hin.«
Natürlich hätte sie ihm einfach den Weg dorthin erklären können, doch eine ungewohnte Neugier hielt sie davon ab. Sie wollte zu gerne sehen, wie der Gefreite McLean auf den Besuch seines Bruders reagierte. Es geschah nicht oft, dass ein Soldat Familienbesuch bekam.
Er hob überrascht eine dunkle Augenbraue. »Das ist aber nett von Ihnen. Danke, ich warte.«
»Wer ist denn das?«, zischte Jessie Mills, mit der Amy das Zimmer teilte, als Amy eintrat und ihre Schreibutensilien auf die Kommode legte.
»Hat er nicht gesagt. Er will jemanden auf Station 20 besuchen.« Amy setzte ihr Schwesternhäubchen auf und steckte es mit ein paar Haarnadeln fest. Amy mochte Jessie, die sich in kürzester Zeit den Ruf der Flirtkönigin erworben hatte. Wie sie selbst allen Kolleginnen erzählte, war es ihr erklärtes Lebensziel, sich einen Arzt oder einen Offizier zu angeln, sich heftig in ihn zu verlieben und zu heiraten.
»Scheint sehr nett zu sein«, spekulierte Jessie und zwinkerte Amy vielsagend zu.
»Ach ja? Ist mir noch gar nicht aufgefallen«, antwortete Amy und bohrte spitzbübisch ihre Zunge in die Wange. Sie streifte ihre Handschuhe über, nahm ihre Tasche und ging zur Tür. Natürlich hatte sie es bemerkt, man hätte schon blind sein müssen, um es nicht zu merken. Ja, er war attraktiv, auf ernste, düstere Weise. Wahrscheinlich der No-Nonsens-Typ, der erwartete, dass man ihm aufs Wort gehorchte, dachte sie mit einem trockenen Lächeln. Zweifellos der Grund, warum er Offizier geworden war.
»Du musst versuchen rauszukriegen, ob er verheiratet ist oder nicht«, zischelte Jessie.
»Jessie, er ist doch bloß auf Besuch hier«, sagte Amy auf ihre sachliche Art, »da bleibt keine Zeit für dich oder eine andere, ihn euch zu ›angeln‹.«
Jessie schnaubte enttäuscht. »Hast ja Recht. Trotzdem«, seufzte sie, »ich finde ihn richtig appetitlich.«
Kopfschüttelnd machte sich Amy auf den Weg. Jessie Mills war unverbesserlich, wenn es um ihre Mission ging: die Jagd nach einem Ehemann. Amy konnte das nicht verstehen. Sie selbst war mit ihren einundzwanzig noch längst nicht bereit, zu heiraten, eine Familie zu gründen und sich aufs Kochen und Kindererziehen zu beschränken.
Während sie auf Leutnant McLean zuging, fragte sie sich neugierig – und neugierig war sie von Natur aus –, welche Horrorszenarien er wohl erlebt, wie viele deutsche Soldaten er wohl getötet hatte. War er deshalb so ernst? Sie selbst war nach ihren Kriegserfahrungen der festen Meinung, dass keiner emotional unversehrt aus den Grabenkämpfen hervorkommen konnte. Sie schnaubte leise. Nicht, dass sich die Armee groß darum scherte. Denen da oben war bloß wichtig, dass man die Männer einigermaßen zusammenflickte, damit sie weiterkämpfen konnten.
Nebeneinander schritten sie über den mit zerstoßenen Muscheln gepflasterten Pfad, der zwischen den Lazarettbaracken hindurchführte. Der Nieselregen hatte sich mittlerweile in einen feinen Eisregen verwandelt und Amy bibberte in ihrem Armeemantel. Wenn es noch kälter wurde – was wahrscheinlich war –, dann würde die Oberschwester für die Nacht Extradecken ausgeben müssen. Ein solcher Kälteeinbruch bedeutete immer, dass ein, zwei Patienten die Nacht nicht überleben würden.
»Ich freue mich jetzt schon auf die heimische australische Sonne«, bemerkte der Leutnant. »Von Schlamm und Schnee und Matsch hab ich für mein Leben genug.«
»Nun, Schnee ist sehr schön«, sagte sie und warf ihm einen verstohlenen Seitenblick zu. Sein mürrischer Ton bestätigte ihre Ansicht, dass er Schlimmes erlebt haben musste. »Jedenfalls bis er zu schmelzen anfängt.«
»Allerdings«, stimmte er ihr inbrünstig zu. »Sie sind auch aus Australien. Von woher kommen Sie? Wie lange sind Sie schon hier stationiert?«
»In England? Im Januar werden es zwei Jahre, seit ich aus Adelaide fortging. Ich wollte ursprünglich an die Front, aber man hat abgelehnt. Ich sei zu unerfahren, meinten sie. Pah! In Wirklichkeit hielten sie mich für zu jung. Ich weiß, wie die denken! Die denken, dass Frauen nichts an der Front zu suchen haben.«
»Seien Sie doch froh!«, sagte er barsch. »Glauben Sie mir, in einem Frontlazarett haben Frauen wirklich nichts zu suchen. Soweit ich es sehen konnte, war es schon für die Ärzte und Krankenpfleger schlimm genug.«
Etwas in seinem Ton, in seiner Haltung reizte Amy. Sie hätte zwar inzwischen längst an männlichen Chauvinismus gewöhnt sein müssen, gab es ihn doch überreichlich, sowohl hier als auch daheim in Australien, aber sie wusste, dass sie sich nie damit abfinden würde. Dafür hatte schon ihre freidenkende, den Suffragetten nahestehende Mutter – möge Amelia Carmichael in Frieden ruhen – gesorgt. Frauen waren keineswegs weniger wert als Männer, davon war Amy fest überzeugt. Und was bildeten sich diese Militärs überhaupt ein – und was bildete er sich ein? –, glaubten zu wissen, wo Frauen hingehörten und wo nicht, was sie aushalten konnten und was nicht! Wer sagte, dass Frauen nicht genauso hart und zäh sein konnten wie Männer? Natürlich war sie eine Frau, aber sie war vor allem eine verdammt gute Krankenschwester und hätte dort eingesetzt werden sollen, wo man sie am nötigsten brauchte.
»Es sind Einstellungen wie die Ihre, Leutnant, die zur Gründung der Suffragettenbewegung in Südaustralien und anderswo geführt haben. Die Kolonialregierung unseres Staates hat den Frauen 1894 das Wahlrecht gewährt – bevor ich geboren wurde.« Amy geriet jetzt richtig in Fahrt. »Die meisten Frauen, die ich kenne, wollen sich nicht auf ein Podest stellen lassen. Sie möchten zwar respektiert werden, aber sie scheuen nicht davor zurück, sich auch mal die Hände schmutzig zu machen, wenn es nötig ist.«
Die Schritte des Leutnants stockten unwillkürlich, als wäre er es nicht gewohnt, für solche Äußerungen gerügt zu werden. »Ach du meine Güte, was haben wir denn hier: eine Pankhurst-Anhängerin?«
»Nein. Nur eine Frau, die sich nicht den Kopf tätscheln und sagen lässt, sie soll sich schön brav in die Ecke setzen und den Mund halten. Immerhin hat die britische Regierung jetzt endlich eine kleine Erleuchtung gehabt und bestimmten Frauen heuer das Wahlrecht gegeben.« Sie merkte, dass sie schon selbst wie eine Suffragette klang, aber sein Sarkasmus erzürnte sie noch mehr und so sprach sie weiter: »Der Krieg hat vieles auf den Kopf gestellt, hat Gutes und Schlechtes gebracht, aber was die Frauen betrifft, war er eher von Vorteil. Viele Frauen mussten die Arbeit von Männern verrichten, weil diese an der Front waren.«
Randall McLean gab sich vor diesen bestechenden Argumenten geschlagen. Er lachte. »Nun, da kann ich Ihnen nicht widersprechen. Die Frauen haben die Lücken, die durch den Kriegsdienst der Männer gerissen wurden, bewundernswert ausgefüllt. Trotzdem: mein Beileid an den Herrn, den Sie einmal heiraten werden. Ich denke, der wird’s nicht leicht mit Ihnen haben!« Seine braunen Augen funkelten vergnügt, so als hätte er eine diebische Freude an ihrem verbalen Schlagabtausch.
»Nicht, wenn er meine Ansichten teilt!«, antwortete sie, schärfer als beabsichtigt. Erst gestern hatte sie einen Zusammenstoß mit einem Arzt wegen der Behandlung eines Patienten gehabt. Es waren scharfe Worte gefallen, denn die arrogante, herablassende Art, mit der er auf ihre Anregungen reagiert hatte, hatte sie auf die Palme gebracht.
Sie standen nun vorm Eingang zu Station 20.
»Da wären wir, Herr Leutnant«, sagte Amy und machte Anstalten, weiterzugehen.
»Wollten Sie nicht Ihren Dienst antreten?«
Sie musste daran denken, wie gerne sie das Gesicht des Gefreiten McLean gesehen hätte, aber man hatte sie für die erste Hälfte ihrer Schicht auf Station 16 eingeteilt und sie war ohnehin schon spät dran. »Schon, aber erst später. Ich wünsche einen Guten Tag, Leutnant McLean. Ihrem Bruder geht es besser. Er wird sich freuen, Sie zu sehen.« Und damit ging sie.
»Randall!« Danny riss erstaunt die Augen auf und blickte seinem Bruder, der forschen Schritts zwischen den Betten auf ihn zukam, entzückt entgegen. Er wollte aufstehen, um ihn zu begrüßen, sank aber mit einem Zischen wieder aufs Bett zurück. Stattdessen setzte er sich auf und erwartete seinen Bruder mit einem breiten Grinsen.
»Dachte, ich schau mal rein, um zu sehen, ob du hier nicht nur krank spielst.« Randall warf seinem Bruder ein paar Päckchen Zigaretten in den Schoß.
Danny schüttelte den Kopf. »Mensch, ich freu mich, dich zu sehen!« Sie schüttelten sich die Hände. »Danke für die Kippen. Wenn ich hier raus bin, höre ich wieder auf. Ich rauche nur, weil’s hier so langweilig ist.«
»Was haben wir denn da?« Randall deutete auf Dannys hellbraunen Schnauzer.
Danny zuckte die Achseln. »Lässt mich älter aussehen, oder? Und ich spare mir Zeit beim Rasieren.«
Randall lachte. »Wusste ich’s doch, dass du ein fauler Sack bist.« Er wurde ernst. »Aber wie geht’s dir nun wirklich?«
»Och, jeden Tag besser – behaupten zumindest die Ärzte.« Er musterte seinen Bruder. »Kein Kratzer. Bist ein verdammter Glückspilz.«
»Ja. Ein Glückspilz.« Aber Randall wusste, dass er sehr wohl Narben davongetragen hatte, nur sah man die nicht. Keiner, der in den Gräben war, kam ohne psychische Narben davon. Er wandte seinen Blick von Danny ab und ließ ihn durch die Station schweifen, musterte die anderen Patienten, alles Soldaten in den verschiedensten Stadien der Genesung.
Da entdeckte Danny die Verdienstmedaille mit dem roten Band, die an Randalls linker Brust prangte. »Und ein Held obendrein.« Mit einem traurigen Unterton fügte er hinzu: »Dad wäre stolz auf dich gewesen.«
Randall zuckte die Achseln, als ob ihm seine Medaille egal wäre. »Wenn’s nach mir ginge, würde das Ding schön brav in der Samtschachtel stecken, aber Colonel Lindner sagt, ich kriege Ausgangssperre, wenn ich sie nicht die ganze Zeit trage. Meint, es sei gut für die öffentliche Moral. Was immer das sein mag.«
»Wie hast du sie gekriegt?«, wollte Danny wissen.
Randall antwortete nicht sogleich. Mit einem entrückten, glasigen Ausdruck in den dunkelbraunen Augen dachte er an den Vorfall zurück. »Nichts Besonderes«, sagte er mit einem Schulterzucken. »Hab bloß zwei Maschinengewehrnester mit einem halben Dutzend Deutscher ausgehoben.«
»Wie hast du das geschafft?«, meldete sich nun Harry von gegenüber, scheinbar ohne sich darum zu bekümmern, dass er schamlos gelauscht hatte.
»Na, wie schon? Ducken, rennen, Kugeln ausweichen«, sagte Randall, ohne den Mann anzusehen. Er musterte seinen Bruder. »Das hättest du auch gekonnt. Jeder hätte das gekonnt.«
Harry schnaubte laut, seine typische Art, seinem Unglauben Ausdruck zu geben. »Bestimmt nicht, mate. Sir, meine ich.«
Danny schaute sich daraufhin seinen Bruder genauer an. Beide hatten sich zwar gleichzeitig gemeldet und waren auch dem gleichen Regiment zugeteilt worden, doch hatten sie sich in der ganzen Zeit nur einmal gesehen, während eines zweitägigen Kurzurlaubs, in einer Taverne, in einem halb ausgebombten Dorf unweit von Reims. Randall sah älter aus als vierundzwanzig. Und wenn er seinen Kopf ins Licht hielt, konnte man ein paar vorzeitige graue Haare in seinem ansonsten rabenschwarzen Schöpf entdecken. Aber es war mehr seine Art, die Danny beunruhigte, dazu dieser stets wachsame, vorsichtige Ausdruck in seinen Augen, als müsse er immer auf der Hut sein. Nun, eigentlich nicht überraschend, wenn man bedachte, was er hatte durchmachen müssen. Danny hatte mehr als einen Schützengraben-Veteran mit diesem beinahe wilden, unzivilisierten Ausdruck in den Augen gesehen.
»Hast du was über Edward herausfinden können?«, fragte er. »Wo er begraben sein könnte?« Er war sich nicht sicher, ob er es überhaupt wissen wollte, denn wenn er es wusste, würde das den Tod ihres Bruders endgültig bestätigen.
»Noch nicht. Bei den entsprechenden Behörden herrscht immer noch Chaos. Ich vermute, dass er in irgendeinem Massengrab in der Gegend um Ypern begraben liegt.«
»Aber wir werden doch trotzdem einen Grabstein für ihn auf dem Familienfriedhof aufstellen, oder?«, fragte Danny.
»Natürlich.«
Beide schwiegen eine Weile und hingen ihren Gedanken, ihren Erinnerungen an Edward nach.
»Apropos Drovers Way«, begann Randall, »ich werde eine Woche vor Weihnachten entlassen. Ich glaube also nicht, dass ich dich noch mal besuchen kann, bevor sich mein Regiment Richtung Heimat einschifft.«
Danny warf ihm einen neidischen Blick zu. »Hast du ein Glück! Ich glaube, ich werde noch mindestens einen Monat hier bleiben müssen, sagen die Ärzte. Gott, wie ich mich darauf freue, heimzukommen, nach Drovers und mal wieder in den Sattel zu steigen. Die Stille dort.« Er klang sehnsüchtig. »Darauf freu ich mich.«
Die Brüder waren gerade in ein Gespräch über die Zukunft der Farm vertieft, als Amy die Station betrat, um nach ihren Patienten zu sehen und Medikamente für die Nacht auszugeben.
Beide Brüder beobachteten die hübsche Schwester, während sie sich unterhielten. Randall entging der verklärte Ausdruck seines kleinen Bruders nicht; er war noch zu jung und zu naiv, um seine Gefühle verbergen zu können. Trocken bemerkte er: »Scheint, als ob’s nicht nur am Geschick der Ärzte, sondern auch an einer gewissen Krankenschwester liegt, dass du dich so gut erholst.«
Danny grinste und widersprach nicht. »Amy ist was Besonderes. Nicht nur, dass sie eine verdammt gute Krankenschwester ist, sie ist außerdem ein warmherziger, mitfühlender Mensch. Das sind nicht alle, verstehst du.«
»Wärst nicht der Erste, der sich in seine Krankenschwester verliebt.«
»Ich – ich bin nicht verliebt«, stotterte Danny und wurde glühend rot. »Ich … bewundere sie nur. Außerdem hat sie so was wie einen Verlobten in Adelaide. Arbeitet bei einer Bank.« Er starrte seinen Bruder an. »Welchen Sinn hätte es also, mich in sie zu verlieben?«
Bevor Randall antworten konnte, trat Amy an Dannys Bett. »Wie geht’s uns heute, Gefreiter? Brauchen Sie was für die Nacht? Gegen die Schmerzen?«
»Nein, danke, Schwester Carmichael.« Danny deutete auf Randall. »Das ist mein Bruder …«
»Ja, wir kennen uns bereits. Ich habe ihm den Weg zur Station gezeigt«, unterbrach Amy, und ohne den Leutnant dabei anzusehen, fugte sie hinzu, »Gefreiter McLean braucht jetzt wirklich Ruhe, Herr Leutnant.«
»Wollen Sie mir damit durch die Blume sagen, dass ich verschwinden soll?«
Mit einem etwas gezwungenen Lächeln erwiderte sie: »So ungefähr.«
»Bitte, Schwester, nur noch ein paar Minuten«, bettelte Danny. »Wir haben uns seit mehr als einem Jahr nicht mehr gesehen und er wird in ein, zwei Wochen nach Hause verschifft.«
Amy gab nach. »Zwei Minuten«, sagte sie streng und sah dabei zuerst Danny, dann seinem Bruder in die Augen, bevor sie sich zum Gehen wandte.
»Jawoll, Ma’am«, erwiderte Randall, erhob sich und salutierte zackig. »Zwei Minuten. Keine Sekunde mehr, keine Sekunde weniger.«
»Also, wir sehen uns dann in ein paar Monaten auf Drovers, hoffentlich mit einem hübschen Bündel Scheine. Aber ob’s viel sein wird, bezweifle ich. Mit sechs Mücken pro Tag, dazu ein, zwei Mal Fronturlaub, bleibt nicht viel vom Sold übrig«, sagte Danny mit erzwungener Munterkeit. Er konnte es kaum abwarten, nach Hause, nach Drovers zu kommen, ja wäre am liebsten schon dort gewesen, aber er musste vernünftig sein, Geduld haben und warten, bis sein Körper sich erholt hatte.
Ihm war Amys Reaktion auf Randall aufgefallen. Offenbar hatte er sie mit seiner schneidigen Uniform und der Tapferkeitsmedaille nicht beeindrucken können. Komisch, dachte Danny, sie ist doch sonst immer so freundlich.
Als ihre zwei Minuten um waren, umarmten sich die Brüder verlegen und Randall ging.
Das monotone Rütteln der Eisenbahn versetzte Randall in eine Art Trance, aber einzuschlafen gelang ihm nicht. Ihm fiel eine Last von der Seele, jetzt, wo er Danny gesehen und sich mit eigenen Augen davon hatte überzeugen können, dass er bald wieder wohlauf sein würde. Er hatte schon das Schlimmste befürchtet, kein Wunder, nach allem, was er in den Gräben erlebt hatte: Männer mit entsetzlichen Verwundungen, Männer, die von Granaten in Stücke gerissen worden waren oder von Bajonetten aufgespießt. Diese Bilder verfolgten ihn Tag und Nacht und er wusste, dass er lernen musste, mit ihnen fertig zu werden oder sie zumindest irgendwo tief zu begraben, oder … ja, was? Er würde verrückt werden.
Und dieser Gedanke belastete ihn am meisten. Seine verstorbene Mutter, Lorna McLean, hatte unter einer ererbten Geisteskrankheit gelitten, die sich mit zunehmendem Alter immer deutlicher bemerkbar gemacht hatte. Er, Danny und Edward hatten sich öfters Gedanken darüber gemacht, ob einer von ihnen diese Krankheit wohl ebenfalls geerbt haben könnte.
Er zwang sich, an etwas anderes zu denken. An Drovers Way. Sein Zuhause. Er schloss die Lider und dachte an das große Sandsteingebäude mit seinen hübschen weißen Fensterläden und den dunkel gebeizten Holzrahmen, das sein Vater erbaut hatte, als die Farm schwarze Zahlen schrieb und sie ein paar gute Jahre gehabt hatten. Schwer, sich vorzustellen, nach dem Krieg wieder ein ganz normales Farmerleben führen zu können. Schafe und Rinder zu züchten, Weizenfelder anzulegen und seinen Traum von einer Pferdezucht zu verwirklichen. Aber all dies hatte ihn im Schützengraben davor bewahrt, den Verstand zu verlieren. Das Leben eines Farmers und Viehzüchters, so glaubte er – hoffte er –, würde ihn das abnormale Leben der vergangenen vier Jahre vergessen machen – den täglichen Überlebenskampf, die Bombardements, das Senfgas, die Vernichtung von Haus, Hof und Leben – oder doch zumindest wie einen fernen, bösen Traum erscheinen lassen.
Plötzlich musste er – er wusste selbst nicht, warum – an diese Krankenschwester denken. Wie hieß sie noch gleich? Amy. Dannys Schwärm. Attraktiv, zugegeben, mit ihren klaren blauen Augen und den vereinzelten Sommersprossen auf der Nase. Nicht hübsch im herkömmlichen Sinne, dafür waren ihre Züge zu ausgeprägt. Aber etwas an ihr – wie sie sprach, ihr Gang – ließ ihn an ein Füllen denken, voller Energie und Lebensfreude. Danny hatte sich sehr wohl in Amy Carmichael verliebt, das erkannte Randall schon an seiner Stimme, dem Ausdruck in seinen Augen. Sein Mund verzog sich zur Parodie eines Lächelns. Es war bloß eine Schwärmerei und würde vergehen, wenn Danny erst wieder daheim auf Drovers war.
Er rutschte unruhig auf dem Ledersitz hin und her, schlug die Augen auf und warf einen Blick auf seine Uhr: noch eine Stunde bis zur Victoria Station. Er gähnte und machte die Augen wieder zu, lenkte seine Gedanken auf die Farm, das Land, für das er, als der Älteste, nun verantwortlich war.
KAPITEL 4
ES WAR EIN bitterkalter Tag. Gefreiter Danny McLean stand trotzdem vor der Lazarettbaracke und beäugte wild entschlossen die Hecke am anderen Ende des Pfads. Nur zehn Meter, das war alles; zehn Meter und dann kam die Bank, auf die er sich setzen und verschnaufen konnte. Ein Muskel in seinem Kiefer zuckte. Er schaffte das. Den Spazierstock fest in der Hand, schwang er sein verletztes rechtes Bein einen Schritt vorwärts, begann auf sein Ziel zuzuhinken.
Nach Randalls Besuch hatte er sich geschworen, seine Muskeln zu trainieren, um so weit zu kommen, dass er den Fitnesstest, den die Ärzte einer Entlassung voranstellten, bestehen würde. Denn nur dann wäre die Army bereit, ihm eine Koje auf dem nächsten Schiff nach Australien zu buchen.
Auch andere Soldaten hegten denselben Wunsch und quälten sich, mehr oder weniger mühsam, damit ab, verletzte Muskeln, angegriffene Sehnen und geschwächte Körper wieder auf Vordermann zu bringen.
Ein paar Meter vor Danny half Schwester Carmichael gerade Korporal Peters bei seinen täglichen Gehversuchen. Sie hatte die Hand unter seinen Ellbogen gelegt und unterstützte den an einer Krücke hoppelnden Mann nicht nur mit der Kraft ihres Armes, sondern auch mit ermunternden Worten.
Dannys Zustand war leider nicht schlecht genug, um eine solche Hilfe von Amy zu rechtfertigen. Das hätte ihm schon gefallen: ihre Hand an seinem Ellbogen, ihre leisen, aufmunternden Worte. Ihre sanfte Berührung. Kopfschüttelnd hoppelte er weiter. Wie erbärmlich du bist, schalt er sich. Willst haben, was du nicht haben kannst. Er holte tief Luft und konzentrierte sich wieder auf seine Aufgabe.
Korporal Peters ließ sich in diesem Moment erschöpft auf die Bank sacken. Schwester Carmichael überzeugte sich davon, dass er bequem saß und sagte dann: »Das haben Sie gut gemacht, Korporal. Sie werden jeden Tag stärker. Nicht mehr lange und Sie können nach Hause gehen.« Sie blickte auf, sah Danny und lächelte. Mit frischer Kraft humpelte er heran.
»Aaah, Gefreiter McLean, gut gemacht! Wenn ihr so weitermacht, verliere ich ja bald all meine besten Patienten.«
Danny starrte sehnsüchtig auf die besetzte Bank. Er hätte sich zu gerne darauf sinken lassen, aber Stolz und Entschlossenheit hielten ihn davon ab und ließen ihn die höllischen Schmerzen im verwundeten Bein aushalten.
»Freut mich, das zu hören, Schwester. Obwohl, einerseits tut’s mir leid, von hier weg zu gehen – es ist schön, wenn man umsorgt wird. Andererseits kann ich’s kaum abwarten, nach Hause zu kommen.« Er schaute ihr in die Augen. »Sie freuen sich sicher auch schon darauf, bald wieder nach Hause zu kommen, jetzt wo der Krieg vorbei ist und die verwundeten Soldaten auf dem Wege der Besserung sind.«
»Ich werde nicht heimfahren«, teilte Amy Danny und dem Korporal mit. »Sie haben sicher von dieser schrecklichen Grippewelle gehört, der Spanischen Grippe?« Beide nickten. »Der Medical Commander hat um Freiwillige gebeten, Schwestern, Ärzte, eigentlich alle, die pflegerische und medizinische Kenntnisse haben, noch in England zu bleiben und bei der Bekämpfung der Epidemie zu helfen. Ich habe mich freiwillig gemeldet. Viele andere Schwestern auch.«
»Ich hab gelesen, dass diese Grippe nicht nur in Europa wütet, sondern mittlerweile auch in Nordamerika, Asien, Afrika und dem Südpazifik«, sagte Korporal Peters. Er blickte zu Amy auf. »Die Menschen sterben innerhalb von vierundzwanzig Stunden daran.«
»Na, lieber stelle ich mich einer Horde anstürmender Deutscher als der Spanischen Grippe«, sagte Danny mit Inbrunst. Insgeheim bewunderte er zwar Amys Mut und Unabhängigkeit, andererseits machte er sich große Sorgen um sie. Wenn sie nun auch …? Ärzte und Krankenschwestern waren schließlich nicht immun gegen die Grippe, auch sie starben an ihr.
»Ihr Freund daheim ist sicher nicht begeistert über Ihren Entschluss, kann ich mir denken.«
Sie schaute ihm ein, zwei Sekunden lang in die Augen. »Nein. Aber wenn ich sehe, dass ich gebraucht werde, dann kann ich doch nicht weggehen. Ich denke, ich werde irgendwann in den nächsten vierzehn Tagen ins Guy’s Hospital nach London versetzt werden.«
Korporal Peters hievte sich mithilfe seiner Krücke hoch. Amy trat vor, um ihm zu helfen.
»Nein, Schwester. Den Rückweg will ich allein schaffen.«
»Sind Sie sicher?«
Sein entschlossener Gesichtsausdruck war Antwort genug. Wankend, zögernd, machte er seine ersten Schritte.
Als der Korporal außer Hörweite gehinkt war, sagte Danny leise: »Sie werden doch aber gut auf sich aufpassen, Schwester?« Er wollte mehr sagen, viel mehr, hatte aber kein Recht dazu. So beiläufig, wie es ihm möglich war, sagte er stattdessen: »Hätten Sie was dagegen, wenn ich Ihnen ab und zu schreiben würde, wenn ich wieder daheim bin? Als Freunde.« Er holte tief Luft und fuhr fort: »Ich … ich denke, ich hätte es nie so schnell so weit geschafft, wenn Sie nicht gewesen wären, Schwester. Ihre gute Pflege und Fürsorge sind zum Großteil dafür verantwortlich.«
Danny sah, wie überrascht Amy über seine Worte war und wie sie diese Überraschung sogleich zu verbergen versuchte. Ihre ausdrucksvollen Augen gaben ihm zu verstehen, dass sie seine Dankbarkeit zu schätzen wusste. Dennoch war er fast sicher, dass sie irgendeinen Vorwand finden würde, ihm seinen Wunsch abzuschlagen … aber das tat sie nicht, und dies wiederum verriet ihm, dass sie sich über eine solche Korrespondenz freuen würde – und außerdem, was konnte es schaden, wenn er ihr gelegentlich schrieb? Immerhin stammten sie beide aus Südaustralien.
»Das wäre …«, sie zögerte, »nett. Dann könnten Sie mir alles über die Farm erzählen, die Sie mit Ihrem Bruder zusammen bewirtschaften. Ich möchte Sie nur darauf hinweisen, dass ich ein ziemlich fauler Briefschreiber bin. Miles und mein Vater beklagen sich dauernd, dass ich ihrer Meinung nach nicht schnell genug auf ihre Briefe antworte.«
»Ach, von mir würden Sie keine solchen Klagen zu hören kriegen«, entgegnete Danny mit einem glücklichen Grinsen. Er machte sich auf den Rückweg und Schwester Amy Carmichael schloss sich ihm an. Hatte sie ihm damit sagen wollen, dass er sich keine … Hoffnungen machen sollte? Das tat er ja nicht, wie er sich sofort versicherte. Aber aus Gründen, die zu untersuchen er sich scheute, musste er einfach wissen, wie es ihr ging, ob sie wohlauf war. Nun könnten sie zumindest brieflich in Verbindung bleiben und er würde sie nicht ganz aus den Augen verlieren, auch wenn sie Tausende von Meilen voneinander getrennt wären.
Für den Moment genügte das.
Wie schön, wieder auf einem Pferd zu sitzen, den Wind auf dem Gesicht zu spüren, den Duft der Gummibäume einzuatmen, dachte sich Randall. Er ritt auf einem Gaul, den er sich in Gindaroos einzigem Mietstall organisiert hatte, nach Drovers Way, in der Tasche seine Entlassungspapiere und den Rest seines Solds.
Frei! Er war ein freier Mann. Die Sonne brannte heiß auf seine Schultern, und auch das war schön, nach der Kälte in Europa. Sein Blick schweifte über das weite Land, auf dem hoch das Gras stand. Gelb und von der Sonne ausgedörrt, wogte es sanft in der Mittagsbrise.
Er runzelte leicht die Stirn: Er hatte es nicht geschafft, seinen Manager, Tom Williams, zu erreichen, um ihm zu sagen, dass er heimkam. Wahrscheinlich irgendwo draußen auf den Weiden unterwegs, überlegte er. In ein, zwei Monaten würde auch Danny wieder nach Hause kommen und dann wäre alles wieder wie früher – fast wie früher, denn Edward wäre ja nicht mehr da, um die Zügel in die Hand zu nehmen. Das müsste er, Randall, jetzt tun. Edward, der große, ernste, rothaarige Edward. Einen besseren ältesten Bruder hätte man nicht haben können. Die drei Brüder hatten einander sehr nahegestanden, so, wie es sein soll, wenn man zusammen auf dem Lande aufwächst, ohne unmittelbare Nachbarschaft. Er musste daran denken, was sie alles zusammen erlebt hatten, wie oft der eine oder andere in Schwierigkeiten geraten und dann von seinen Brüdern wieder herausgeholt worden war. Ein Kiefermuskel zuckte. Eine freie, wilde Kindheit hatten sie gehabt.
Als er das Eingangstor zu Drovers Way erblickte, zügelte er sein Pferd. Das Gatter stand offen. Das durfte eigentlich nicht sein, da das Vieh abwandern konnte. Mit zusammengekniffenen Augen schaute er sich um. Weit und breit kein Vieh zu sehen. Hmmm. Wahrscheinlich weideten die Tiere weiter weg, jenseits des Hauses, dessen Dach er in der Ferne, zwischen Baumwipfeln, erblicken konnte.
Eine weitere halbe Stunde später stand fest, dass die Unterkünfte der Knechte verlassen waren und Haupthaus, Garten und Hof im Ganzen einen öden, vernachlässigten Eindruck machten. Randalls Stirnrunzeln vertiefte sich. Was zum Teufel war bloß los? Wo war Williams, wo waren die anderen Farmarbeiter, die Viehknechte? Die Unterkunft des Managers war geräumt, Kleidung und persönliche Habseligkeiten fehlten und die Speisekammer im Großen Haus war so leer wie die Taschen eines Soldaten nach einem feuchtfröhlichen Fronturlaub.
Er ging in die Bibliothek des Hauses, die Edward in ein Büro umgewandelt hatte, und schlug das Verwaltungsbuch auf. Der letzte Eintrag war vor fast zwei Monaten gemacht worden!
Hier stimmte etwas nicht, hier stimmte etwas ganz und gar nicht. Er hatte ein ganz ungutes Gefühl im Bauch.
Da die Farm zu den wenigen gehörte, die über eine eigene Telefonleitung verfügten, griff er nun zum Hörer und wählte, nach einem Blick in das schwarzlederne Adressbuch, die Nummer des Familienanwalts, Byron Ellis, in Gindaroo. Byrons Kanzlei kümmerte sich um die rechtlichen und finanziellen Angelegenheiten der Farm.
»Byron. Randall McLean hier.«
»Ah, du bist wieder daheim! Das ist schön, Randall.«
»So schön nun auch wieder nicht, wie’s scheint.«
Randall machte sich keine Mühe, seinen Zorn zu verbergen. »Williams und die anderen sind weg. Das Vieh scheint auch verschwunden zu sein. Haus und Hofsehen aus, als hätte sich seit mindestens zwei Monaten niemand mehr darum gekümmert.«
»Was?!« Byron schnappte entsetzt nach Luft.
»Hast schon richtig gehört, Byron. Was um Himmels willen ist hier los?«
»Randall, ehrlich, ich hab keine Ahnung. Obwohl …« Byron schwieg einige Sekunden lang. »Ist schon eine Weile her, seit ich Tom zum letzten Mal gesehen habe. Ja, es könnte zwei Monate her sein. Du kommst am besten gleich in meine Kanzlei. Wir werden der Sache schon auf den Grund gehen.«
»Okay. Bin in etwa einer Stunde bei dir. Und ich erwarte Antworten, wenn ich da bin!« Erzürnt knallte er den Hörer auf und starrte ins Leere. Eine schöne Heimkehr!
Randall klopfte kurz an die Glastür und trat dann ohne weiteres in Byron Ellis’ Büro. Wieder einmal fragte er sich, wie der Anwalt bloß in einer solchen Unordnung arbeiten konnte. Auf Byrons Schreibtisch stapelten sich die Aktenbündel, mit verschiedenfarbigen Bändern verschnürt. Eine ganze Wand wurde von einem wuchtigen Bücherschrank eingenommen, der bis obenhin vollgestopft war mit dicken Gesetzbüchern. Auf dem Boden türmten sich wackelige Bücher- und Aktenstapel, die offenbar keinen Platz im Bücherregal oder im Aktenschrank gefunden hatten. Nach welchem Ordnungssystem Byron arbeitete – wenn es denn überhaupt eines gab –, war Randall ein Rätsel. Es roch staubig und muffig und nach abgestandenem Tabak. Randall rümpfte diskret die Nase, während Byron von seinem Sessel aufsprang und ihm mit ausgestreckter Hand entgegeneilte.
Byron Ellis war ein kleiner, untersetzter Mann von mittleren Jahren, mit schütterem Haar und einer runden, goldgeränderten Brille. Ein Mundwinkel zuckte – ein nervöser Tick des kleinen Mannes, der nach einem Unfall als Kind ein steifes Bein zurückbehalten hatte und merklich hinkte.
»Randall, mein Junge! Freue mich so, dich zu sehen. Und keinen Kratzer abgekriegt, wie ich sehe! Freut mich, freut mich. Aber setz dich doch.« Er wies auf einen schäbigen Ledersessel, der schon bessere Tage gesehen hatte.
Randall, dem Byrons aufgedrehter Ton und seine uncharakteristische Nervosität nicht entgingen, nahm misstrauisch Platz. Obwohl nicht gerade für seine Geduld berühmt, wartete er, bis Byron den Mund aufmachte.
»Tut mir so leid, das mit Edward. Ein so vielversprechender junger Mann! Und Danny …?«
»Danke, gut.« Randall rang sich ein Lächeln ab. »Danny erholt sich gut von seiner Verletzung. Er wird auch bald nach Hause kommen.«
Nun, da der Form genüge getan war, räusperte sich Byron, setzte sich wieder, stützte die Ellbogen auf den Tisch und verschränkte seine kleinen, pummeligen Hände. »Gut, gut. Also, zu Tom Williams. Ich muss leider sagen, was ich gehört habe, ist… beunruhigend.«
»Beunruhigend?«, wiederholte Randall, den Blick durchdringend auf sein sichtlich unbehagliches Gegenüber gerichtet.
»Ich habe sofort nach deinem Anruf ein paar Erkundigungen eingezogen: bei der Bank, im Kaufladen, beim Viehagenten. Es scheint, als sei Williams schon seit ein paar Monaten nirgends mehr gesehen worden. Jack McTaggert, der Viehagent, meint, er habe gesehen, wie Williams zusammen mit zwei anderen vor etwa zweieinhalb Monaten etwas südöstlich der Stadt eine Rinderherde vorbeigetrieben hätte. Ich habe daraufhin den Bankmanager gebeten, einen Blick auf dein Konto zu werfen. Es sind noch …« Er hielt inne, nestelte nervös an seiner Krawatte herum, richtete sich dann mit einem sichtlichen Ruck auf und fuhr tonlos fort: »Noch genau zwei Pfund, zehn Schilling und Sixpence auf dem Drovers Way-Konto.«
Er warf einen Blick auf Randall, sah, wie diesem die Zornesröte ins Gesicht stieg, und fuhr hastig fort. »Offenbar hat Williams das Farmkonto leergeräumt und ist mit dem Viehbestand auf und davon.«
Randall schwieg schockiert. Er hatte zwar schon so etwas vermutet, aber es ausgesprochen zu hören, war schlimm.
»Sollte er nicht einmal im Monat mit den Büchern bei dir vorbeischauen und Rechenschaft ablegen?«
»J-aa, das stimmt, aber ich habe ihn schon seit einer Weile nicht mehr gesehen. Und weil ich so viel zu tun hatte, ist mir wohl einfach nicht aufgefallen, dass er sich schon seit längerer Zeit nicht mehr hat blicken lassen.«
»Kreuzkruzifix!«, explodierte Randall. »Zweieinhalb Monate, das war ungefähr um die Zeit, als der Große Krieg zu Ende ging. Der könnte jetzt überall sein.«
»Da muss ich dir recht geben«, gestand Byron kleinlaut. »Ich war auch bei Constable Wallace. Er vermutet, dass Tom die Herde wahrscheinlich nach Broken Hill getrieben, dort verkauft und sich weiter nach Norden abgesetzt hat. Der Constable hat im Royal Hotel Erkundigungen eingezogen und erfahren, dass Tom dort offenbar ein, zwei Leuten gegenüber erwähnt hat, er würde wohl nach Queensland gehen, wenn die McLean-Brüder zurückkämen.«
Byron musste sich ganz schön angestrengt haben, wenn er in so kurzer Zeit so viel herausgefunden hatte.
»Queensland ist unser zweitgrößter Staat«, sagte Randall zornig. »Das ist, als würde man nach einer Nadel in einem Heuhaufen suchen.« Mürrisch fügte er hinzu: »Und selbst wenn wir ihn fänden – wie sollen wir je unser Geld zurückbekommen?«
Das Vieh futsch, das Geld futsch. Gottverflucht! Vier Jahre lang hatte er sich in den dunkelsten Stunden des Kriegs nur mit dem Gedanken an Drovers Way und an seine Rückkehr in das gewohnte Leben aufrecht gehalten. Byron Ellis hatte ihn im Stich gelassen, aber das mochte sein, wie es wollte: Was sollte er nun tun?
Der Rechtsanwalt schien eine Antwort parat zu haben: »Du könntest verkaufen. Der Markt ist im Moment gar nicht so schlecht. Viele Frauen, deren Männer oder Söhne im Krieg gefallen sind und die ihre Farmen nicht allein bewirtschaften können, verkaufen nun und ziehen fort.« Seine Stimme wurde leise und vertraulich, als er erklärte: »Bill Walpole kauft alles auf, was er in die Finger kriegen kann. Hat sich ein neues Haus gebaut, einen wahren Palast, nennt ihn Ingleside Downs.«
»Walpole.« Randall konnte seine Wut nur mit Mühe im Zaum halten. Seine Oberlippe kräuselte sich verächtlich. »Als ob der noch mehr Land brauchte. Gehört ihm nicht sowieso schon der halbe Distrikt?«
Byron zuckte die Achseln. »Nun, noch nicht ganz. Aber manche können eben nie genug kriegen. Und da ein Teil von Drovers an Ingleside grenzt, würde er dir sicher einen fairen Preis bieten.«
»Da müsste schon die Hölle zufrieren, bevor ich Drovers aufgäbe. Und schon gar nicht, damit sich Walpole noch mehr Land in seinen Rachen stopfen kann«, stieß Randall zornig hervor. Er nahm seinen Hut vom Schreibtisch und erhob sich.
Mit einem stählernen Unterton sagte er: »Wenn das alles ist, was du mir raten kannst, dann kann ich dir nur noch einen guten Tag wünschen.«
KAPITEL 5
WANN WAR ES endlich vorbei? Amy wusste nicht mehr, wie oft sie sich dies schon im Stillen gefragt hatte, auf dem Weg zu und von ihrer Bude, die sie sich mit drei anderen Schwestern, Jessie Mills, Sara Brinkman und Genevieve Todd, teilte und von der aus man das Guy’s Hospital in zehn Minuten zu Fuß erreichen konnte.
Es war ein sonniger Junitag, aber nicht einmal die herrlich blühenden Rosen und die farbenprächtigen Geranien, die Häuser und Vorgärten zierten, konnten Amy aufheitern. Sie war total erschöpft, physisch und psychisch.
So viel Leid, so viel Leid und Tod musste sie mit ansehen, seit sie vor sechs Monaten zum Guy’s Hospital gewechselt hatte. Die Spanische Grippe hatte London fest im Griff – und nicht nur London, die ganze Insel. Die Schwestern und Pfleger, das Krankenhauspersonal, sie alle waren sich einig in der Ansicht, dass die Ärzte und Spezialisten trotz eifrigsten Forschens kein wirkliches Rezept dagegen gefunden hatten. Die Zeitungen behaupteten, dass die Grippe ganze Völker in Europa und sonst wo auf der Welt dezimierte, mehr sogar, als den großen Pestepidemien im Mittelalter zum Opfer gefallen waren.
Die Hälfte jener Soldaten, die noch kurz vor Ende des Großen Kriegs gestorben waren, waren der Spanischen Grippe zum Opfer gefallen – in beiden Lagern, sowohl bei den Deutschen als auch den Alliierten. Und doch war es nach wie vor ein Rätsel, woher diese Krankheit eigentlich kam, wie sie entstanden war. Einige Wissenschaftler und hohe Militärs glaubten, es handle sich um eine besonders tückische Form biologischer Kriegsführung, die sich die Deutschen hatten einfallen lassen. Andere meinten, es sei eine direkte Folge der Grabenkämpfe, es komme vom Senfgas und anderen Dämpfen und Dünsten, und nichts anderes als der Krieg selbst sei daran Schuld. Wieder andere glaubten, der Virus sei in China entstanden, eine besonders gefährliche Abart des Influenza-Virus.
Es wurde so viel geschrieben, die Zeitungen waren derart voll von Horrormeldungen, dass Amy schließlich beschlossen hatte, keine mehr aufzuschlagen.