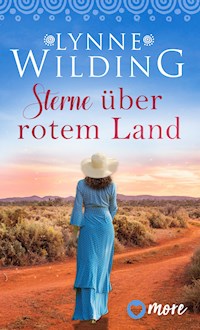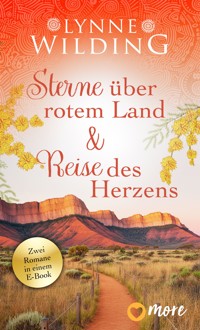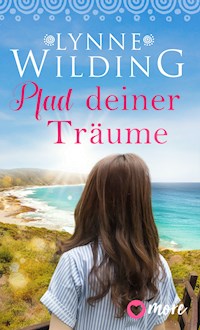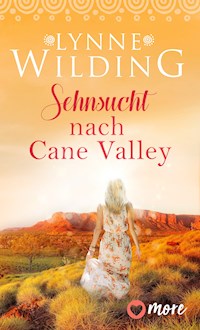
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Große Liebe, rotes Land
- Sprache: Deutsch
Nach dem Tod ihrer Mutter ist die junge Rani gezwungen ihre Heimat in Bombay zu verlassen und zu ihrem Vater nach Südafrika ziehen. Als sie dort den attraktiven Holländer Willem Dewar trifft, verliebt sie sich Hals über Kopf in ihn. Doch Willem ist verheiratet und wird seine Familie niemals für Rani verlassen. In ihrer Not verschweigt Rani Willem ihre Schwangerschaft und nimmt den Heiratsantrag des liebenswerten Graeme Carruthers an, der sie in seine Heimat Australien mitnimmt und dort ein neues Leben mit ihr beginnen will. Doch am Horizont der wilden australischen Landschaft ziehen bald dunkle Wolken auf. Werden Rani und ihr Sohn in Australien glücklich werden oder holen sie die Schatten ihrer Vergangenheit unerbittlich ein?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 711
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über Lynne Wilding
Lynne Wilding ist in Australien längst als die Königin der großen Australien-Sagas bekannt und erhielt viele Preise für ihre Romane. Lynne Wilding lebt mit ihrer Familie in Arncliff bei Sydney.
Informationen zum Buch
Nach dem Tod ihrer Mutter ist die junge Rani gezwungen ihre Heimat in Bombay zu verlassen und zu ihrem Vater nach Südafrika ziehen. Als sie dort den attraktiven Holländer Willem Dewar trifft, verliebt sie sich Hals über Kopf in ihn. Doch Willem ist verheiratet und wird seine Familie niemals für Rani verlassen. in ihrer Not verschweigt Rani Willem ihre Schwangerschaft und nimmt den Heiratsantrag des liebenswerten Graeme Carruthers an, der sie in seine Heimat Australien mitnimmt und dort ein neues Leben mit ihr beginnen will. Doch am Horizontder wilden australischen Landschaft ziehen bald dunkle Wolken auf. Werden Rani und ihr Sohn in Australien glücklich werden oder holen sie die Schatten ihrer Vergangenheit unerbittlich ein?
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Übersicht
Cover
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Über Lynne Wilding
Informationen zum Buch
Newsletter
Erster Teil
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Zweiter Teil
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Dritter Teil
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Danksagung
Impressum
Darf es noch ein bisschen more sein?
Lynne Wilding
Sehnsucht nachCane Valley
Australien-Saga
Deutsch von Franka Reinhartund Violetta Topalova
Inhaltsübersicht
Über Lynne Wilding
Informationen zum Buch
Newsletter
Erster Teil
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Zweiter Teil
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Dritter Teil
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Danksagung
Impressum
Für meine beiden wunderbaren EnkelLiah und Tara DavisIn Liebe
ERSTER TEIL
KAPITEL 1
Holland, 1889
»JETZT PASS AUF. Weiter als ich wirfst du nie im Leben!«, spottete Gert Frober und warf den flachen Stein aus dem Handgelenk so stark er konnte.
Die beiden Jungen beobachteten, wie er durch die Luft pfiff und dann fast bis in die Mitte des spiegelglatten Teiches hüpfte, wo er mit einem leisen, plätschernden Geräusch versank.
Willem Dewar, der jüngste von sechs Brüdern, war dank seiner älteren Geschwister ein Veteran, was Hänseleien, Grobheiten, Streiche und Spott betraf, und stellte sich der Herausforderung seines Freundes. Er suchte sich in aller Ruhe einen glatten Kiesel aus den Steinen heraus, die um die Uferlinie des Teiches herum verstreut lagen. Dann grinste er Gert an und schleuderte mühelos sein Wurfgeschoss. Es tanzte und hüpfte über das Wasser und versank schließlich mehr als einen Meter hinter Gerts Vorlage.
»Nicht schlecht, Willem.« Der etwas kleinere Gert klopfte dem anderen Jungen auf die Schulter und zerzauste ihm das blonde Haar, das sich vorwitzig über seinem kragenlosen Hemd und der groben Wolljacke lockte.
Willem nickte und akzeptierte den Beifall, aber das Lob seines Freundes bedeutete ihm heute nicht viel. Er hatte wichtigere Dinge im Kopf, und die konnte er einzig und allein mit Gert besprechen. Mit seinen Brüdern darüber zu reden wäre sinnlos, sie würden ihn entweder auslachen, verspotten oder kräftig knuffen. Oder ihn einfach ignorieren. Nur weil er der Jüngste war, behandelten sie ihn wie einen greinenden Säugling! Willem war nicht besonders groß, aber für seine vierzehn Jahre recht stämmig und breitschultrig. Er half schon seit Jahren bei der Hofarbeit und in der familieneigenen Bürstenfabrik, die den Dewars ihren Lebensunterhalt sicherte. Dank der Gulden, die die Fabrik einbrachte, hatten sie immer genug zu essen auf dem Tisch, das sie mit Gemüse und den Hühnern ihres kleinen Bauernhofes beim Kanal ergänzten. Sie besaßen auch gute Kleidung, obwohl Willem nur dann ein neues Kleidungsstück erwarten durfte, wenn es für den Kirchgang bestimmt war. Und Willems Eltern Willem senior und Frieda hatten dafür gesorgt, dass alle ihre Söhne bis zur sechsten Klasse in die Schule gingen, bevor sie anfingen, in der Fabrik zu arbeiten.
Willen stöhnte leise auf. Die Fabrik! Er hasste den Ort mit einer Leidenschaft, die genauso stark brannte wie sein Verlangen danach, der Arbeit in ihren Räumen zu entfliehen. Der Gestank des Lackes und der auf Bleigrundlage angerührten Farbe führten dazu, dass seine Nase ständig entweder verstopft war oder lief. Die Pferde- und Schweineborsten, aus denen die Besen und Bürsten gefertigt wurden, verursachten roten, entzündeten Ausschlag bei ihm, ebenso das Stroh. Aber am schlimmsten war, dass seine Brüder ihn ununterbrochen herumkommandierten, besonders Hans. Als ältester Sohn glaubte der, die Fabrik gehöre bereits ihm, und das ließ er jeden spüren, besonders seinen jüngsten Bruder.
Willem sah Gert an und traf eine Entscheidung. »Am Sonntag gehe ich nach Rotterdam. Kommst du mit?«
Gerts schlichtes Gesicht leuchtete auf, sein breites Grinsen enthüllte zwei Reihen weißer Zähne, die Schneidezähne standen schief. Er kratzte sich am Kopf, während er über die Einladung nachdachte. »Rotterdam ist beinahe dreißig Kilometer von hier entfernt. Warum willst du da hin?«
Achselzuckend sah Willem in Richtung Westen. Die Sonne stand bereits tief. Er musste nach Hause und die Kühe melken, sonst würde er Ärger mit seiner Mutter kriegen. Sein Blick streifte über das umliegende Land. Eine endlose Ebene, so weit sein Auge reichte, kaum eine Bodenwelle oder Anhöhe. Ach, gäbe es nur einen Berg, dachte er sehnsüchtig, oder wenigstens einen kleinen Hügel, der diese monotone Fläche beleben würde. Gras wuchs wie ein üppiger grüner Teppich zwischen den braunen Feldern, die erst kürzlich gepflügt worden waren, um sie für die Aussaat vorzubereiten. Am Rand des Weges, der vom Bauernhof der Dewars zu dem Teich führte, hatten die wilden Tulpen ihre Blütezeit überschritten und welkten dahin, denn die Tage wurden wärmer. Er seufzte. Sein Leben und seine Zukunft waren so vorhersehbar wie die Jahreszeiten, alles war bereits geplant, und das war … langweilig.
»Ich will mir Arbeit suchen«, antwortete er und wendete sich wieder seinem Freund zu.
Gert starrte Willem an und blinzelte wie eine Eule. Er schüttelte den Kopf. »Auf dich wartet doch schon eine Anstellung in der Fabrik. Du hast doch Glück, Willem. Ich bin derjenige, der sich Arbeit suchen muss, wenn die Schule vorbei ist, wahrscheinlich in der Stadt. Papa kennt dort einen Stiefelmacher, und er sagt, er kann mich bei ihm als Lehrling unterbringen.« Er verzog das Gesicht und versuchte, enthusiastisch zu klingen. »Es wäre ja immerhin ganz schön, wenn ich endlich einmal Stiefel tragen könnte, statt dieser Dinger hier.« Er zeigte auf seine schlammigen Holzschuhe und die dicken Wollstrümpfe, und auf die Strohhalme, die im Winter für mehr Wärme dazwischen gestopft wurden und aus den Schuhen staken.
»Ich werde auf keinen Fall in der Fabrik arbeiten«, sagte Willem mit Nachdruck. »Wenn es sein muss, dann laufe ich lieber weg. Alles ist besser, als dort zu versauern.«
Willem las gut und gern und verschlang die Bücher, die sein Lehrer ihm auslieh. All die erfundenen Geschichten und Tatsachenberichte ließen vor seinem inneren Auge aufregende Bilder von weit entfernten Ländern erscheinen, von fremden Menschen, Städten und Bräuchen. Er kniff seinen jungen Mund, auf dessen Oberlippe sich bereits deutlich der erste, vorpubertäre Flaum zeigte, entschlossen zusammen und dachte an die wundersamen Orte, von denen er gelesen hatte. Er sehnte sich danach, sie selbst zu erforschen und mit eigenen Augen zu sehen, ob das, was darüber geschrieben worden war, auch der Wirklichkeit entsprach.
»Na gut. Ich komme mit.«
»Gut! Aber das bleibt unser Geheimnis, okay?« Willem sah, wie Gert zustimmend nickte. Abgemacht.
Die beiden Jungen wischten sich die schmutzigen Hände an ihren Hosen ab und rannten um die Wette zurück zu dem Bauernhof der Dewars.
Von zu Hause ausreißen mussten Willem und Gert dann schließlich doch nicht. Ihr Ausflug nach Rotterdam hätte zu keinem besseren Zeitpunkt stattfinden können. Einige der Schiffe heuerten gerade neue Mannschaften an, und die Jungen verbrachten den Tag damit, durch den Hafen zu streifen und die unzähligen Schiffe zu betrachten, die die Flaggen der unterschiedlichsten Länder gehisst hatten. Und zu ihrem Glück wurde ihnen beiden Arbeit auf dem gleichen Schiff angeboten, einem Frachtschiff der Stenmark-Linie – die Andover Lady, die aus Dänemark kam und zwei Tage später mit der abendlichen Flut Richtung Amerika auslaufen würde. Gert unterzeichnete einen Vertrag als Kabinensteward und Willem, weil er größer und kräftiger war, als Kombüsenjunge. Genau darum hatte Willem gebetet: eine Chance, der eintönigen Existenz in der Bürstenfabrik zu entfliehen. Er traf ansonsten eigentlich keine übereilten Entscheidungen, aber dieses Angebot akzeptierte er innerhalb von fünf Minuten. Dann machten sie sich wieder auf den Weg nach Hause, um ihren Familien zu beichten…
Als Willem seine Entscheidung beim Abendessen verkündete, blieb der Familienfrieden nicht lange erhalten. Mutter brach prompt in Tränen aus und Hans prophezeite mit hämischem Grinsen: »Du warst noch nie auf dem Meer. Du wirst wahrscheinlich die halbe Reise lang seekrank sein!«
»Genau! Du wirst das ganze Schiff voll kotzen«, stimmte ihm Samuel, der Zweitälteste, zu. »Du segelst ja noch nicht einmal gerne im Sommer auf unserem Teich.«
»Glaub bloß nicht, dass Papa dir einen Platz in der Fabrik freihalten wird, wenn du irgendwann merkst, dass dir das Seemannsleben doch nicht gefällt«, fügte Kurt, der Drittälteste, hinzu.
»Genug jetzt«, befahl Willems Vater vom Kopfende der Tafel, wobei nicht ganz klar war, ob es eine Aufforderung an seine Frau war, endlich mit dem Weinen aufzuhören, oder an seine lärmenden Sprösslinge, endlich still zu sein. »Bist du sicher, dass du das wirklich willst, Willem? Du warst noch nie von zu Hause fort, außer bei deinen Großeltern in Medemblik.«
»Ja, Papa.« Willems Stimme wurde kräftiger und tiefer. »Ich bin mir sicher.«
»Er ist doch erst vierzehn«, klagte Frieda zwischen zwei Schluchzern. »Noch ein kleiner Junge. Und wer soll mir bei der Hofarbeit helfen, wenn Willem fort ist?«
»Wir werden alle helfen, Mama.« Dieses Versprechen brachte Hans böse Blicke von seinen Brüdern ein, die alle die eintönige Arbeit auf dem Bauernhof verabscheuten und sie bislang nur zu gerne dem jungen Willem überlassen hatten. »Und wenn ich in diesem Sommer Erica heirate, wird sie bei uns einziehen und kann dann den größten Teil der Hofarbeit übernehmen.«
Diese Worte lösten einige respektlose Kommentare seiner jüngeren Brüder über seine bevorstehende Ehe aus, und dann meldete sich einer der jüngeren Brüder zu Wort.
»Willem sieht aber nicht mehr wie ein Junge aus, Mama. Er rasiert sich schon – jeden dritten Tag. Das stimmt doch, Willem, oder?«
Arndt stand ihm altersmäßig am nächsten und teilte sich mit ihm und Stefan, dem vierten Sohn, eine Schlafkammer. Es klang so, als bewundere er die Entschlossenheit seines Bruders.
Willem nickte. In der ganzen Aufregung angesichts des ihm bevorstehenden Abenteuers war ihm überhaupt nicht in den Sinn gekommen, wie schwer sein Fortgehen seine Mutter treffen würde. Er war der Jüngste, ihr Baby, wie sie ihn oft unter vier Augen nannte, zu seiner nicht geringen Verlegenheit. Er kämpfte darum, seine nächsten Worte möglichst sachlich klingen zu lassen, denn jeden Gefühlsüberschwang hätten seine Brüder sofort mitleidlos verspottet.
»Das ist eine wirklich gute Gelegenheit für mich, Mama. So kann ich etwas von der Welt sehen und es zu was bringen.« Schon lange diskutierten er und seine Mutter darüber, wie wenige Wahlmöglichkeiten ihm für sein Leben blieben. In der Dewar-Fabrik würde es ihm aufgrund der Tatsache, dass seine Brüder alle älter waren, sehr schwer fallen aufzusteigen und selbst Verantwortung zu übernehmen. »Ich werde dir aus jedem Hafen schreiben, den wir anlaufen, Mama. Das verspreche ich.«
Frieda wischte sich die Tränen von den Wangen und schenkte ihrem jüngsten Sohn ein trauriges Lächeln. Mit einem Seufzer fügte sie sich in das Unvermeidliche. »Bitte tu das, Willem.«
Sie stand auf und begann den Tisch abzuräumen. Sie war eine viel beschäftigte Frau, die ständig kochte, putzte, nähte, strickte und sich körperlich und geistig auf Trab hielt.
»Morgen Abend backe ich dir deinen Lieblingsnachtisch für dein Abschiedsessen. Apfelstrudel.«
Später an diesem Abend stand Willem senior vor der großen Feuerstelle in dem Raum, der der ganzen Familie als Küche und Wohnzimmer diente, und überreichte seinem Sohn einen schwarzen Ledergürtel mit einer geschwungenen Silberschnalle. »Für dich, Willem. Pass gut auf diesen Gürtel auf.«
»Das werde ich, Papa.«
Willem löste seinen abgetragenen Stoffgürtel, der zusammen mit Hosenträgern seine Kniehosen hochhielt, und fädelte den neuen Gürtel durch die Schlaufen an seiner Hose. Er sah zu seinem Vater auf, der einen Kopf größer war als er. »Er ist zu weit!« Das Lederband reichte anderthalb Mal um seine Taille.
Willem senior, der die meiste Zeit sehr ernst war, schmunzelte. »Du wirst schon noch hineinwachsen, mein Sohn. Das ist ein besonderer Gürtel. Schau her.«
Er löste die Schnalle, nahm den Gürtel ab und zeigte Willem, was er gemeint hatte. In das Futter des Gürtels waren mit feinem Stich versteckte Taschen eingenäht. »In diesen Taschen sind fünf goldene Gulden.«
Er betrachtete das überraschte Gesicht seines Sohnes, der, wie er wusste, noch nie in seinem Leben so viel Geld besessen hatte. »Weil du ja, wie es aussieht, nicht ins Familiengeschäft einsteigen wirst, betrachte diesen Gürtel als dein Erbe.« Er schwieg einen Moment lang. »Mehr können deine Mutter und ich dir leider nicht geben. Pass gut auf die Münzen auf und benutze sie nur im Notfall. Bitte halte dich daran, Willem.«
»Das werde ich, Papa. Ich danke dir.«
Willem senior blickte auf seinen jüngsten Sohn herunter. Ein trauriger Ausdruck huschte über sein Gesicht, verschwand aber sofort wieder. Er streckte die Hand aus und Willem reagierte sofort. Seine Hand war zwar kleiner als die seines Vaters, aber sein Griff war ebenso fest.
»Versuche, uns an Weihnachten zu besuchen. Deine Mutter würde das sehr freuen.«
Südafrika, 1896
Der junge Mann mit den zerzausten Haaren stand an einem der Bleiglasfenster im oberen Stockwerk des Hafengasthofes von Durban und beobachtete das Treiben unter ihm. Er war ein gewohnheitsmäßiger Frühaufsteher, egal, zu welch später Stunde er zu Bett ging, aber heute waren seine blauen Augen unverkennbar blutunterlaufen, denn letzte Nacht war er durch ein Dutzend Hafenkneipen gezogen und hatte danach mehrere Stunden im Liebesspiel mit einer jungen, hübschen Hure verbracht. Die exotische Hure, die sich Esmeralda nannte, hatte sein Zimmer schon längst wieder verlassen und ging nun anderswo ihren Geschäften nach.
Es war zwei Tage nach Weihnachten und Willem Dewar fühlte sich nicht nur verkatert, sondern auch melancholisch. Wieder einmal hatte er Weihnachten nicht zu Hause verbracht. Er hatte es nur ein einziges Mal während der vielen Jahre, die er bereits zur See fuhr, geschafft, die Feiertage mit seiner Familie zu verbringen, obwohl er sie im Laufe der Jahre öfters besucht hatte. Wie schön es beim letzten Mal, vor drei Jahren, gewesen war, seine Familie wieder zu treffen. Seine Brüder, die inzwischen verheiratet waren und Kinder hatten, hänselten ihn nicht mehr, aber am schönsten war es jedes Mal, seine Mutter und seinen Vater zu sehen. Mama verwöhnte ihn nach Strich und Faden und Papa betrachtete ihn als Mann, der ihm ebenbürtig war. Leider fühlte Willem nach jedem Besuch erneut, wie sehr die Distanz zwischen ihnen gewachsen war, wie sehr er sich Amsterdam, dem Hof und der Bürstenfabrik entfremdet hatte.
Zuhause, dachte er versonnen. Im Moment hatte er eigentlich kein wirkliches Zuhause. Das einzig Beständige in seinem Leben war seine Koje, und was war das schon für ein Zuhause – ein Bett, eine Truhe und sein Seesack. Es wäre schön, eines Tages ein richtiges Haus zu haben, mit Wänden, einer Decke und richtigen Möbeln…
Zwischen den Schüben von Melancholie dachte er an andere Dinge, zum Beispiel an das Geraune in den Bars und den Docks über einen kürzlich aufgetretenen Diamantenfund nordwestlich von Kimberley. Dem Tratsch zufolge desertierten die Seeleute scharenweise von ihren Schiffen und machten sich auf den Weg ins Hinterland in der Hoffnung auf schnellen Reichtum.
Willem gefiel der Gedanke an die Möglichkeit, ein paar Monate in der Erde zu wühlen und dann so viel Geld beisammenzuhaben, das er bis an sein Lebensende ausgesorgt hätte, ausnehmend gut. Denn leider hatte er in all den Jahren, die er jetzt zur See fuhr, noch immer nicht das erkleckliche Häuflein Geld angespart, das er für seinen bescheidenen Traum vom Wohlstand brauchte. Seeleute verdienten nicht besonders viel. Und der Landurlaub verschlang regelmäßig einen großen Teil seines Verdienstes.
In seiner Zeit auf der Andover Lady hatte er auf jeden Fall viel gelernt. Dass die Arbeit auf und unter Deck sehr hart war, die Wachen lang, sein Bett nie wirklich bequem und die Bezahlung nicht viel mehr als ein Hungerlohn. Die harte Arbeit störte Willem allerdings nicht, schon seit seiner Jugend hatte er daran Freude. Aber die finanzielle Belohnung am Ende der langen Monate auf See ließ in jeder Hinsicht zu wünschen übrig.
Er beobachtete, wie sich die Straße unten langsam belebte. Karren mit Waren für den Export wurden zu den Schiffen gebracht. Grüppchen dunkelhäutiger Einheimischer mit nackten Oberkörpern fingen an, Kisten und Körbe in die Laderäume zu schleppen. Fahrende Händler verscherbelten Essen und Getränke an die Arbeitenden, und vor den Schiffen warteten einige Pferdekutschen mit Passagieren. Sie alle sorgten dafür, dass die Docks überfüllt waren und die übliche Konfusion herrschte, bevor die Schiffe in See stachen. Über alledem wallten vor dem klaren, blauen Himmel dicke, graue Rauchschwaden aus den metallenen Schloten. Weiter hinten, am Ende des Hafengeländes, schaukelten einige ältere Segelschiffe mit eingerollten Segeln in der herannahenden Flut.
Willem hob eine Hand und befühlte sein Kinn. Gestern hatte er sich den Bartwuchs von fünf Monaten abrasiert, und seine Haut fühlte sich leicht gereizt an. Er fuhr sich mit der anderen Hand durch das Haar und schob sich die blonden, von der Sonne gebleichten Locken aus der Stirn. Was er jetzt brauchte, war ein herzhaftes Frühstück, um das flaue Gefühl zu verscheuchen, das ein Übermaß an Rum, Bier und Frauen hinterlassen hatte. Er trank zwar normalerweise nicht besonders viel, aber den größten Teil des gestrigen Abends hatte er von seinem Freund Gert Abschied genommen, der schon bei Sonnenaufgang mit der Morgenflut in See gestochen war, als zweiter Ingenieur auf einem Schiff der White-Star-Linie, unterwegs in den Südpazifik.
Ein Muskel in Willems Kiefer zuckte. Er würde Gert vermissen. Es konnte Jahre dauern, bis ihre Wege sich wieder kreuzten. Sie hatten sich ein wenig auseinander entwickelt. Gert liebte die Seefahrt und träumte davon, eines Tages selbst ein Schiff zu kommandieren, aber Willem hatte eigentlich alles, was er sich vorgenommen hatte, als er sein Zuhause verließ, bereits erreicht. Während er darüber nachsann, suchte er in seinem leinenen Seesack nach sauberen Kleidern und einem Stück Seife.
Willem hatte so viel von der Welt gesehen, wie er sich immer vorgestellt hatte. Wunder, Schrecken, das Unerklärliche und das Außergewöhnliche. Er grinste, als er sich einige seiner eindrücklichsten Erfahrungen ins Gedächtnis rief. Das geheimnisvolle Schanghai. Ihr vorübergehender Aufenthalt in einem karibischen Gefängnis, als ein Polizist auf verdächtige Weise zu Tode gekommen war – damals hatten sie wirklich unverschämtes Glück gehabt. Er musste unwillkürlich lächeln. Dann waren da noch die willigen, samthäutigen Frauen von Tahiti. Wie könnte er jemals die leidenschaftliche, melancholische Liana vergessen? Die Erinnerung an sie und ihre gemeinsame Zeit hatte ihn viele Monate lang in seiner einsamen Koje gewärmt. Dann dachte er an die Wunder von Rio de Janeiro. So viele unterschiedliche Orte und Kulturen … aber seine Zeit als Seemann war vorbei, das wusste er jetzt.
Er hatte genug von schlingernden Schiffen, von Stürmen, die ihn bis auf die Haut durchnässten, und von monatelangen Aufenthalten an Bord, nur zu selten mit Kameraden, die seinem Intellekt gewachsen waren oder seine Interessen teilten. Und jetzt, wo Gert fort war und seinem eigenen Traum folgte, gab es nichts mehr, was ihn an ein Leben auf See fesselte.
In Gedanken versunken schritt Willem durch den kleinen Raum zu dem Tisch, auf dem ein Krug mit Wasser, eine angestoßene Emailleschüssel und ein gefaltetes Handtuch bereitlagen. Die Seefahrt hatte ihren Zweck erfüllt, es wurde Zeit, dass er sich nach anderen Herausforderungen umsah. Er war jetzt einundzwanzig, er musste sich langsam über die Zukunft Gedanken machen. Er wollte sich allerdings noch nicht, wie drei seiner Brüder, mit einer Frau niederlassen und eine Horde Enkel für seine Eltern produzieren. Die Zeit war reif für ein neues Unternehmen.
Gewaschen und mit frischen Kleidern, die nicht nach Bier und dem billigen Parfüm der Hure stanken, fühlte er sich gleich ein bisschen besser. Er nahm seinen Gürtel und fädelte ihn durch die Schlaufen der hellen Baumwollhose, die er sich voriges Jahr in Hongkong gekauft hatte. Sie war für diese Hitze perfekt, genau wie sein weißes Seidenhemd.
Er hielt kurz im Einfädeln inne und befühlte seine Gulden. Sie waren alle noch da. Einige Male war er bereits in Versuchung geraten, sie auszugeben, aber irgendetwas hatte ihn immer davon abgehalten. Vielleicht die Tatsache, dass sie ihn an zu Hause erinnerten und sein Vater ihm gesagt hatte, er solle sie nur im äußersten Notfall ausgeben. Er grinste. Gert hatte mehr als einmal gesagt, die Gulden seien ein Symbol seiner Selbstgenügsamkeit, aber er selbst betrachtete sie eher als ein Band zwischen ihm und seinen Eltern. Also blieben sie weiterhin sicher verwahrt im Futter des Gürtels.
Unten, im rauchigen Speisesaal des Gasthofes, folgte er seiner Nase zu einem Büfett, auf dem einige Speisen angerichtet waren: gebratene und gekochte Eier, Speckstreifen, dünne, scharf gewürzte Würstchen, knusprige Brotstücke, eine Schale voller Früchte und eine große Kanne mit schwarzem Tee. Die Sonne war erst vor einer Stunde aufgegangen, aber Durbans feuchtwarmer Sommer hatte den Raum bereits erobert und verstärkte die Mischung aus schalem Bierdunst, Essensgeruch und dem Mief der dicht gedrängten Frühaufsteher, die sich ihr Frühstück so schnell sie nur konnten in den Mund schaufelten. Beinahe drehte es ihm den Magen um, verkatert wie er war.
Er fand einen einzelnen Tisch am Ende des Raums und setzte sich dort mit seinem Teller voll Essen und seiner Teetasse hin. Eine leicht bekleidete, halbblütige Kellnerin brachte ihm sauberes Besteck. Sie lächelte ihn aufreizend an, aber als Willem nicht reagierte, schniefte sie, drehte sich auf dem Absatz um und stapfte mit wackelndem Hintern zu den für ihre Reize empfänglicheren Gästen.
Willem lächelte. Nach der letzten Liebesnacht würde es eine Weile dauern, bis sich seine Energie in diesem Bereich wieder regte. Während der vielen Monate auf See – eine lange Überfahrt nach Australien und wieder zurück – hatte sich eine ungeheure sexuelle Energie in ihm aufgestaut, die er fast vollständig auf den Liebesmarathon mit Esmeralda verwendet hatte. Außerdem hatte er heute Wichtigeres im Kopf als Frauen. Er wollte schauen, welche Möglichkeiten ihm der Diamantenfund, der in aller Munde zu sein schien, bieten konnte.
Er schob sich eine Gabel voller Ei und Schinken in den Mund und fragte sich, wie schwer es wohl sein mochte, nach Diamanten zu schürfen. Schwieriger als die Arbeit auf See? Ob er viel Geld in die Sache stecken musste? Er hoffte nicht, denn schon jetzt, nach einem Einkaufsbummel, der Kneipentour von gestern Nacht und den Kosten der Hure war sein Geldsack zusehends leichter geworden. Er wünschte, Gert wäre hier, damit er sich mit ihm beraten konnte. Willem war der impulsivere von beiden und Gert der Denker, der alles immer erst gründlich durchanalysierte, bevor er eine Entscheidung traf.
Was würde sein Freund davon halten, dass er die Seefahrt aufgab, um dem Traum, vielleicht nur dem Hirngespinst, vom Reichtum im Dschungel Afrikas zu folgen? Gestern war nicht der richtige Zeitpunkt gewesen, dieses Thema Gert gegenüber anzuschneiden, aber Willem hatte vor, ihm zu schreiben, bevor er Durban verließ. Er würde Gert von seinen Plänen erzählen. Beide hatten sich am Abend vorher in der Gewissheit voneinander verabschiedet, dass sie nur noch selten die Gelegenheit haben würden, einander zu sehen. Dieses Wissen hatte ihren Abschiedshandschlag emotional aufgeladen.
Willem sah zwei jungen Männern zu, die mit vollgeladenen Tellern an einem Tisch in seiner Nähe Platz nahmen. Einer bat ihn um den Salzstreuer, und Willem reichte ihn rüber. Während er aß, hörte er sie über den Diamantenfund reden, über die Ausrüstung, die sie für ihre Reise dorthin brauchten, und über die Transportmöglichkeiten zur Fundstelle. Ihrem Akzent nach zu schließen waren sie Engländer.
»Onkel Percy ist schon dort«, sagte der Dunklere voller Selbstvertrauen. »Wir können in seinem Zelt unterkommen und ihm mit seinem Claim helfen, bis wir wissen, wie der Hase läuft.«
»Ja.« Der kleinere Mann mit dem Schnurrbart nickte. »Das kann doch nicht so schwer sein, was, Bertie? Erinnerst du dich noch an den Artikel in der Times, den ich dir gezeigt habe? Über diesen Burenjungen? Der hob auf der Farm seiner Eltern einen seltsam aussehenden Stein auf. Seine Mutter fand ihn in seiner Hosentasche, war entzückt und legte ihn auf die Anrichte in der Küche. Später überließ sie ihn einem vorbeiziehenden Handelsreisenden.« Er machte eine Pause und trank einen Schluck Tee. »Der zeigte ihn einem Juwelier, der ihn als Diamanten identifizierte. Und ein Jahr später fand ein Schafhirte in der gleichen Gegend einen ähnlichen Stein. Nur war der noch größer.«
»Und dann hieß es, man brauche sich in Südafrika nur zu bücken, um Diamanten zu finden!« Bertie nickte seinem Freund zu. »Ja, ja, so fing alles an, Donald, keine dreißig Jahre ist das jetzt her.«
»Ich erinnere mich noch gut daran. Das Problem ist nur, dass jetzt jeder Abenteurer auf der Suche nach dem schnellen Geld denkt, er könnte sein Glück mit Diamanten machen. Der Weg zu den Minen soll überfüllt sein, und zwar in beide Richtungen.« Donald schüttelte den Kopf und prophezeite: »Glaub bloß nicht, dass das ein Kinderspiel wird, alter Junge. Das war es vielleicht früher, aber jetzt … das Diamantenfieber hat inzwischen viel zu viele erfasst.«
Willem konnte sein Interesse an der Unterhaltung nicht länger unterdrücken und sprach den Mann namens Bertie an.
»Entschuldigen Sie, mein Name ist Willem Dewar. Ich habe unfreiwillig Ihr Gespräch mit angehört. Ich selbst spiele auch mit dem Gedanken, mich zu den Diamantenminen aufzumachen. Sie scheinen sehr gut darüber Bescheid zu wissen, vielleicht könnten Sie mir raten, wie ich die Sache am besten anstellen sollte.«
Der Mann blinzelte überrascht und sagte dann mit einem ansteckenden Grinsen: »Ich bin Bertie und das ist Donald. Uns hat man gesagt, dass ausreichend finanzielle Mittel das Unternehmen sehr erleichtern würden.«
»Ja. Man muss Ausrüstung kaufen und irgendwie zur Mine kommen. Berties Onkel hat uns gesagt, wir brauchten außerdem Geld für unsere Verpflegung, bis wir mit den Diamanten handeln können, die wir finden werden.«
Willem nickte verständnisvoll.
»Außerdem sollte man die politische Situation bedenken. Sie wissen sicher, dass die Lage im Augenblick nicht gerade stabil ist. Die Buren agitieren wieder mal für vollständige Unabhängigkeit, das Übliche eben«, fügte Bertie mit nonchalantem Schulterzucken hinzu. »Aber wo wir nun schon mal hier sind, sollten wir es versuchen, meine ich.«
»Der Gastwirt hat mir erzählt, dass sich die zukünftigen Schürfer an einem Platz in der Stadt treffen, dem Square. Dort werden die Ladungen ausgespannt.«
»Was bedeutet das?«, fragte Willem neugierig.
»In dieser Gegend laden und entladen die Händler ihre Waren. Dort bekommen wir Ausrüstung und können den Transport zur Mine organisieren«, erklärte Donald.
»Wir sollten gleich nach dem Frühstück dorthin gehen, bevor diese infernalische Hitze völlig unerträglich wird«, warf Bertie ein. Er fächelte sich mit einer Stoffserviette Luft zu und sah Willem an. »Kommen Sie doch einfach mit.«
Willem sah sich die Engländer genauer an. Beide waren nach der neuesten Londoner Mode gekleidet: dreiteilige Anzüge, hohe, steife Kragen mit Krawatten, in denen Ziernadeln steckten. Blankpolierte Schuhe. Er sah sich auch ihre Hände an. Sie waren weiß und weich, nicht die Spur einer einzigen Schwiele. Beide Männer sahen aus, als hätten sie in ihrem Leben noch keinen Tag gearbeitet. Willems Mund zuckte. Er musste sich gehörig zusammenreißen, um nicht über diese Möchtegern-Diamantensucher zu lachen. Wenn Bertie und Donald seine typischen Konkurrenten in den Minen repräsentierten – Männer, die keine Ahnung von harter Arbeit hatten, von der Hitze und der geistigen Stärke, die man brauchte, um unter solchen Bedingungen zu überleben –, dann dürfte er selbst ganz gut zurechtkommen.
Bertie und Donald waren schon auf den Füßen und erwarteten, dass er sich ihnen anschloss. »Ich kann nicht sofort mitkommen«, erklärte Willem. »Ich muss erst noch meine Stelle auf dem Schiff kündigen und meine Sachen holen.«
»Die Gegend, in der ausgespannt wird, liegt westlich von hier, etwa zwei Häuserblocks hinter dem Hafen«, erläuterte Donald und zwirbelte die Enden seines eingewachsten Schnurrbarts. »Trödeln Sie nicht zu lange herum, wir haben gehört, dass die Transportmöglichkeiten zu den Minen begrenzt sind.«
Die zwei Engländer verabschiedeten sich mit Handschlag. Auf ihrem Weg zur Tür drehte sich Bertie noch einmal um und sagte: »Viel Glück, Willem. Wir sehen uns bestimmt in ein, zwei Wochen in Johan’s Glen.«
Willem lächelte in sich hinein. Er war zwar wieder allein, aber das Wissen um seine eigenen Fähigkeiten erfüllte ihn mit Zuversicht. Er wischte seinen Teller mit seinem letzten Stück Brot sauber und trank die Überreste seines Tees aus. Im Laufe des Vormittags – nachdem er auf der Andover Lady alles geklärt hatte – würde er sich den Square genauer ansehen und sich über die Ausgaben informieren, die auf ihn zukamen. Sein Stuhl quietschte laut auf den Bodendielen, als er ihn zurückschob und aufstand. Die Luft war fürchterlich abgestanden. Er brauchte unbedingt einen Spaziergang am Ufer des Ozeans, um seinen Kopf und seine Lungen durchzupusten.
Die Andover Lady lag am hinteren Ende des Hafengeländes vertäut. Willem musste sich seinen Weg durch eine immer dichter werdende Menschenmenge bahnen, die sich zwischen Kisten, Ballen, Gepäck und anderen für den Transport bestimmten Waren drängte. Als er die Gangway hinaufschritt, sah er bereits den Kapitän. Ivan Sorensen würde nicht gerade begeistert sein, aber sein Entschluss stand fest. Die einzige Seereise, die er noch vorhatte, war die Fahrt nach Hause nach Amsterdam, mit all den Reichtümern, die er auf den Diamantenfeldern finden würde.
Sorensens Geschimpfe und der Hohn, den er für Willems Unternehmung übrig gehabt hatte, klangen ihm immer noch in den Ohren, als er zehn Minuten später den Inhalt seiner Seekiste in den verschlissenen Leinensack stopfte. Er schüttelte den Kopf. Wie sollte Sorensen Verständnis für den Traum eines jungen Mannes von Reichtum und Abenteuern aufbringen. In all seinen Jahren auf See hatte der Kapitän seine Träume entweder bereits verwirklicht oder sie schon vor langer Zeit über Bord geworfen. Er warf sich den Sack über die Schulter und kletterte geschmeidig hoch aufs Deck. Er warf einen letzten Blick auf das, was während der letzten sieben Jahre sein Zuhause gewesen war. Er kannte jede Planke, jedes Bullauge, jeden Belegnagel, jedes Seil und jedes Geländer in- und auswendig.
Er musste zugeben, dass ihm der bärbeißige Sorensen auch so einiges beigebracht hatte. Selbstdisziplin und Partnerschaft, Unabhängigkeit und Selbstvertrauen. Er grüßte die Flagge des Schiffs und den Kapitän, der ihm prompt den Rücken zukehrte, bevor er über die Gangway zum Hafen hinunterschritt. Sofort fühlte er sich wie von einer Last befreit, und ein Gefühl der Vorfreude und Aufregung erfasste ihn. Vor seinem geistigen Auge sah er einen Haufen glitzernder Diamanten, die ihm gehörten, ihm schöne Augen machten, ihn verführten. Ihre Farben – er hatte bei einem Juwelier in der Stadt einige gesehen – faszinierten ihn. Die meisten waren so klar wie Glas – aber wie sie funkelten! Es gab aber auch bernsteinfarbene, gelbe, hellblaue.
Er schritt kräftig aus und entschied, dass er sich unbedingt ein Buch über Diamanten kaufen musste, denn er wollte lernen, wie man sie abbaute, wie man einen wertvollen Stein von einem wertlosen unterschied, und wie hoch der aktuelle Marktwert pro Karat war. Er war sicher, dass ihm dieses Wissen nützen würde.
Er zog eine Grimasse, während er sich seinen Weg zurück zum Gasthaus bahnte. Er musste noch einiges lernen, aber seine Wissenslücken auf diesem Gebiet schüchterten ihn überhaupt nicht ein. Willem war ein Mensch, der Herausforderungen freudig ergriff und jede Chance nutzte, etwas Neues zu lernen. Er hob sein Gesicht in die Sonne. Ihm lief bereits der Schweiß über den Rücken und die Stirn. Er würde seine Habseligkeiten in seinem Zimmer abladen, dann zum Square gehen … und ein Buch über Diamanten kaufen.
Als er an einer engen Gasse vorbeilief, ließen ein Grunzen und ein deutlich hörbarer Schmerzensschrei Willem innehalten. Mit zusammengekniffenen Augen starrte er in die düstere Passage, die kaum so breit war, dass zwei Männer nebeneinander laufen konnten. In der Mitte der Gasse sah er drei Männer, raubeinige Typen, zwei von ihnen mit nacktem Oberkörper. Das Trio schlug abwechselnd auf einen schlanken, gut gekleideten Mann ein, der sich, wenn man seine unterlegene Position berücksichtigte, gar nicht schlecht verteidigte. Der gesunde Menschenverstand, mit dem Willem Dewar reichlich ausgestattet war, riet ihm, weiterzugehen. Was auch immer in dieser Gasse geschah, ging ihn nichts an.
Aber er zögerte. Drei gegen einen. Das war weder gut noch fair. Er traf seine Entscheidung und rannte, weil er den Wert eines Überraschungsangriffs kannte, auf die Rauferei zu. Er brachte den Sack über seiner Schulter so in Position, dass er ihn wie eine Keule einsetzen konnte.
Weil der Sack einige schwere Sachen enthielt – Bücher, eine kleine Jadestatue aus Peking und andere Souvenirs, die für seine Familie bestimmt waren –, erhielt der Schlag eine ungeheure Wucht. Der Mann, den Willem traf, taumelte und fiel hin. Dabei stieß er sich den Kopf an der Wand und blieb liegen. Die anderen beiden hielten verblüfft in ihren Schlägen auf den Mann inne, den sie inzwischen auf die Knie gezwungen hatten.
Der eine, ein gut gebauter Mulatte, starrte Willem zornig an und lächelte dann seltsamerweise. Seine höhnisch funkelnden Augen reizten Willem, den Kampf mit ihm aufzunehmen, aber als er seine Position veränderte, bückte sich der Mulatte und zog aus seinem Stiefel ein Messer. Es war nicht groß, aber schmal und leicht gebogen. Ein Messer, mit dem man Fische ausnahm. Er wirbelte die blitzende Klinge herum und demonstrierte, wie vertraut er mit der Waffe war. Immer noch lächelte er Willem an.
Aus dem Augenwinkel sah Willem, wie der andere Mann zur Seite wich, um seinem Kumpan mehr Bewegungsfreiheit zu geben, und sich sprungbereit auf den Boden kauerte. Willem versuchte, die Situation doch noch mit Diplomatie zu lösen.
»Ihr habt euren Spaß gehabt, lasst es sein«, sagte er. »Verschwindet, bevor die Hafenpolizei hier auftaucht, dann sage ich ihnen nichts.«
»Du wirst ihnen bestimmt nichts sagen, weil du dazu gar nicht mehr fähig sein wirst. Ich schneide dir nämlich gleich die Kehle durch«, drohte der Mulatte, seine tiefe Stimme vibrierte vor Blutgier. »Und danach mache ich dieses … dieses Stück Scheiße fertig.« Er unterstrich seine Worte damit, dass er seinem Opfer einen Tritt versetzte, der diesen auf den Bauch schleuderte. Stöhnend lag der Mann da und rang nach Atem. »Kein Mann, ob Gentleman oder nicht, legt sich mit Herrn Domikan und seinen Leuten an.«
Mit Diplomatie war da nichts zu machen, gestand sich Willem ergeben seufzend ein und warf seinen Leinensack beiseite. Er ließ den Mulatten nicht aus den Augen, löste seinen Gürtel mit der geschwungenen Silberschnalle und wickelte ihn um die rechte Hand, die er dann zur Faust ballte, so gut es ging. Er hatte seinen Gürtel schon früher bei Kämpfen eingesetzt, und er hatte ihm immer gute Dienste erwiesen. Willem wusste, dass er zuerst den kauernden Mann außer Gefecht setzen musste, aber er bezweifelte, dass der Messer schwingende Mulatte dabei tatenlos zusehen würde. Dann sah er seine Chance. Der kauernde Mann bewegte sich langsam zu ihm hin, bereit, ihn anzuspringen.
Willem winkelte sein linkes Bein an und trat mit dem rechten Bein zu. Die Spitze seines Stiefels traf den Mann mit enormer Wucht unter dem Kinn und riss ihm den Kopf zurück. Willem verlagerte sein Gewicht auf das andere Bein und trat noch einmal zu. Diesmal traf er den Mann in die Rippen. Dies war eine Kampftechnik, die ihm Kim Chang, der chinesische Smutje der Andover Lady, beigebracht hatte – und er hatte Changs Lektion gut gelernt.
Während sein Partner zu Boden sackte, stürzte sich der Mulatte vor Wut schäumend mit glitzernder Klinge auf Willem…
KAPITEL 2
WILLEM WICH DEM ANGRIFF in letzter Sekunde aus und die Klinge schlitzte nur sein Hemd auf. Sie schien höllisch scharf zu sein. Der Mulatte schlug mit seiner freien Hand nach Willems Kopf. Der Schlag streifte nur seinen Backenknochen, aber er war so stark, dass Willem aufstöhnte. Die Bewegung brachte den Mulatten allerdings aus dem Gleichgewicht, und bevor er sich wieder fangen konnte, holte Willem mit seiner mit dem Gürtel umwickelten Faust aus und traf ihn am Kiefer. Sein Gegner reagierte mit einem ungezielten Schwinger, der glücklicherweise nur in Willems kräftige Schulter krachte.
Bevor der Mulatte noch einmal mit dem Messer ausholen konnte, rammte ihm Willem die Linke in den Bauch. Der Schlag zeigte jedoch kaum Wirkung, der Mann war wirklich durchtrainiert. Willem war klar, dass er in einem fairen Kampf gegen diesen Mann kaum eine Chance hatte, aber … wer hatte gesagt, dass dieser Kampf fair sein musste? Er ging in die Hocke und tastete nach dem Holzkloben, den er vorher gesehen hatte. Seine Finger fanden ihn. Er hob ihn auf, packte ihn so fest mit beiden Händen, wie das seine Rechte, die immer noch von dem Gürtel umwickelt war, zuließ, und schlug zu.
Das Holz traf den Mulatten an der Schläfe. Er taumelte, und Willem schlug noch einmal zu. Der Mulatte ging in die Knie und Willem setzte ihn mit einem kräftigen Schlag auf den Hinterkopf vollends außer Gefecht. Der Mann sackte mit dem Gesicht voran auf die Pflastersteine. Sofort kauerte sich Willem neben ihn und rollte ihn auf den Rücken. Erleichtert stellte er fest, dass der Mann noch atmete.
Im gleichen Augenblick hallte ein seltsames Geräusch in der dunklen Gasse wider: jemand applaudierte langsam. Willem drehte sich um und begutachtete den verletzten Mann. Sein Gesicht war übel zugerichtet, ein Auge war bereits zugeschwollen und seine Wangen, seine Stirn und sein Hals waren von Blutergüssen und Schrammen bedeckt. Seine Kleider waren an mehreren Stellen zerrissen. Er saß mit überkreuzten Beinen auf dem Kopfsteinpflaster und applaudierte weiter.
»Vielen Dank, junger Mann. Gut gemacht.«
Willem massierte die aufgeschürften Knöchel seiner rechten Hand. Er erkannte den Akzent des Mannes, ein Bure. Er ging auf ihn zu und streckte die linke Hand aus, um ihm auf die Beine zu helfen. Der Mann stand mühsam auf und stützte sich an der Wand ab, um nicht wieder hinzufallen.
»Diese Bestien hätten mich wahrscheinlich umgebracht.«
Willem nickte. Das hatten die Männer offensichtlich vorgehabt, und ohne sein Eingreifen wäre die Tat längst vollbracht gewesen. Er fuhr herum, als einer der am Boden liegenden Männer stöhnte. »Wir sollten schnell von hier verschwinden. Der wacht bald auf und wird nicht besonders glücklich über diesen Ausgang sein.«
»Sie haben Recht.«
Der Mann streckte die rechte Hand in einer Geste der Freundschaft aus: »Mein Name ist Louis Van Leyden. Ich bin Ihnen wirklich sehr dankbar. Sie haben mir das Leben gerettet.«
Willem zuckte mit den Achseln und stellte sich seinerseits vor. »Willem Dewar. Ich hatte einfach Glück.«
Er begutachtete Louis unauffällig, aber gründlich, dann starrte er auf die Männer, die bewegungslos am Boden lagen, und fädelte seinen Gürtel wieder durch die Schlaufen an seiner Hose.
»Wir hatten beide Glück! Bringen wir ein bisschen Abstand zwischen sie und uns.«
Louis stützte sich schwer auf Willem, und sie traten aus der engen Gasse hinaus und befanden sich wieder im Hafen, wo das Leben pulsierte, als sei nichts geschehen. Sie hätten beide ermordet werden können, und niemand hätte etwas gemerkt, bis man ihre Leichen entdeckt hätte. So war es eben auf dem Hafengelände, der gefährlichsten Gegend von Durban, wo genauso viele illegale wie legale Geschäfte getätigt wurden.
»Ich wohne in einem Gasthaus ganz in der Nähe. Kommen Sie mit, dann suche ich jemand, der Ihre Wunden versorgt.«
Louis schüttelte den Kopf. »Leider geht das nicht.« Er zog eine Uhr aus der Innentasche seiner Jacke. »Ich muss innerhalb der nächsten Stunde mit meinem Vater etwas Geschäftliches erledigen. Würden Sie mir dabei helfen, eine Kutsche anzuhalten?«
»Natürlich.«
Kutschen und Einspänner verkehrten hier ständig, luden Passagiere ab und Neuankömmlinge ein. Im Sonnenlicht konnte Willem Louis deutlicher sehen. Er mochte Ende zwanzig sein und war nach der neuesten Mode gekleidet, dennoch waren die Kleider für diese Hitze wesentlich passender als der Aufzug der Engländer im Gasthof. Ein großer Rubinring schmückte seine rechte Hand, mit Juwelen besetzte Manschettenknöpfe hielten seine Hemdsärmel zusammen, und in seiner Krawatte steckte eine goldene Krawattennadel.
Plötzlich überkam Willem die Neugier und er fragte: »Herr Van Leyden, was haben Sie angestellt, um diese Männer so gegen sich aufzubringen?«
Louis’ gebräunte Wangen erröteten. »Nennen Sie mich Louis. Herr Domikan, der Mann, den die Schläger erwähnten, betreibt ein erstklassiges Bordell. Ich hatte für eine ganz spezielle Lady bezahlt, aber in mein Zimmer kam eine andere, die weniger attraktiv war. Nachdem sie und ich das Geschäftliche erledigt hatten, beschwerte ich mich beim Herrn des Hauses und weigerte mich, den vollen Betrag zu zahlen, weil ich der Ansicht war, ich sei in diesem Etablissement nicht anständig behandelt worden. Ich gab ihm einen, wie ich meinte, fairen Betrag und ging. Dabei schwor ich mir, dieses Haus nie wieder zu betreten.«
Seine linke Augenbraue hob sich dramatisch. »Offenbar war Herr Domikan nicht besonders erfreut. Er schickte mir diese Schläger auf den Hals, um mir eine Lektion zu erteilen. Ich dachte, ich hätte sie im Hafen abgehängt, aber sie waren zu gerissen für mich.«
Nur Willems gute Manieren hielten ihn davon ab, über die Geschichte des Mannes zu lächeln. Louis Van Leyden war wirklich ein Narr. Sogar er, der im Vergleich zu ihm nur ein bescheidener Seemann war, wusste, dass man Bordellbesitzer besser nicht herausforderte. Sie waren auf der ganzen Welt dafür bekannt, unerbittlich zu sein. Sowohl den Huren gegenüber als auch im Umgang mit zahlungsunwilligen Kunden.
»Stechen Sie bald wieder in See?«
Jetzt war es Louis, der seine Neugier befriedigen wollte. Ihm hatte ein Blick auf Willems Kleidung und Körperbau genügt, um in ihm einen Seemann zu vermuten.
»Nein. Bis heute Morgen war ich dritter Maat auf der Andover Lady. Aber ich habe genug von der Seefahrt«, gab Willem zu. »In jedem Gasthaus und jeder Kneipe dieser Stadt kursieren die wildesten Gerüchte über einen neuen Diamantenfund. Ich will dort hingehen und mein Glück versuchen.«
Louis sah Willem fragend an und öffnete den Mund, als wolle er etwas sagen. Dann schüttelte er den Kopf und sagte stattdessen: »Ich habe gehört, dass das Leben bei den Minen ziemlich hart sein soll, aber nach Ihrem Verhalten heute in der Gasse zu urteilen, können Sie ganz gut auf sich selbst aufpassen.«
Willem nickte. »Das habe ich auf See gelernt.«
»Woher stammen Sie, Willem?«
»Amsterdam, Holland. Ich fahre zur See, seit ich vierzehn bin.«
»Wie wunderbar, dass Sie sich das Leben wählen konnten, das Sie führen wollten«, kommentierte Louis, in seiner Stimme schwang Neid mit.
Willem zog ein Gesicht. »Ich weiß nicht, ob man das Glück nennen kann. Es lag hauptsächlich daran, dass ich der jüngste von sechs Brüdern bin und keine Lust hatte, als Schuhabtreter in der Bürstenfabrik meines Vaters zu enden.«
Er sah, dass Louis verständnisvoll lächelte, und dann ertappte er sich dabei, wie er ihm, einem völlig Fremden, die Gründe für sein neues Unternehmen mitteilte: »Ich wollte die Welt sehen, und das habe ich auch getan. Jetzt ist es Zeit, etwas Neues auszuprobieren.«
»Nun, mein Freund, das Diamantensuchen wird mit Sicherheit ganz anders als das Segeln auf den sieben Weltmeeren.« Louis Stimme troff vor Zynismus, was Willem allerdings überhaupt nicht auffiel.
Innerhalb weniger Minuten gelang es Willem, einen zweirädrigen Einspänner anzuhalten. Er half Louis auf den Sitz.
Louis griff in seine Tasche und reichte Willem eine Karte. »Hier, Willem, falls Sie jemals in meiner Gegend sind, dann besuchen Sie mich bitte. Meine Familie wird Ihnen sicher persönlich für den Dienst danken wollen, den Sie ihr erwiesen haben. Ich wünsche Ihnen viel Glück in den Minen.«
Louis’ gab dem Fahrer eine Adresse, und die kleine Kutsche schwankte davon und fuhr in Richtung Innenstadt.
Willem sah sich die Karte an: Louis Van Leyden, Kraaldorf Zuckerplantage & Mühle, Saringal via Esbawe. Lächelnd steckte er sie in seine Hosentasche und machte sich auf den Weg zurück zum Gasthof. Dort deponierte er seinen Seesack und erkundigte sich nach dem Weg zum Square.
Zum dritten Mal in ebenso vielen Minuten zog Ella Van Leyden die Spitzenvorhänge des Salons zurück und spähte zum Eingangstor und dem Pfad, der zu dem bescheidenen, einstöckigen Bungalow der Familie führte. In diesem Moment schlug die Standuhr im Flur elf Mal. Papa würde sehr ärgerlich auf Louis sein, dachte sie und klopfte mit dem Fuß ungeduldig auf den blank polierten Holzboden. Sie war es jedenfalls! Es war wirklich ermüdend, dass Louis seinen Vater so häufig in Rage brachte, denn wenn Papa gereizt war, dann bekamen alle Mitglieder des Haushalts seine schlechte Laune und scharfe Zunge zu spüren.
Jeder wusste, dass es nicht leicht war, mit Henri Van Leyden zusammenzuleben. Er war anspruchsvoll, herrschsüchtig und suchte, besonders bei Louis, immer nach Fehlern – und fand sie leider nur zu häufig. Alle, die Henri gut kannten, wussten, dass sein einziger Sohn, der Erbe des Van-Leyden-Vermögens, seinen Erwartungen nicht genügte.
Von ihrem Beobachtungsposten aus sah Ella, wie ein Einspänner vor dem Eingangstor hielt. Louis stieg langsam aus, bezahlte den Fahrer und hinkte den Pfad entlang zur Eingangstür. Ella betrachtete ihren Bruder und schnalzte voller Abscheu mit der Zunge. Er war in eine Rauferei geraten – und so, wie er aussah, hatte er nicht gewonnen. Papa würde vor Wut schäumen. Aber wenn sie es schaffte, Louis in sein Zimmer zu verfrachten und präsentabel herzurichten, bevor Papa merkte, dass er zu Hause war, dann ließ sich ein Streit vielleicht noch vermeiden.
Die fünfundzwanzigjährige, immer um Harmonie bemühte Ella war körperlich eine unauffällige Frau, der man, bei ihrem Alter, eine Zukunft als alte Jungfer prophezeite. Sie war vom Charakter her ihrer verstorbenen Mutter Alfreda ähnlich, die das genaue Gegenteil ihres Ehemanns gewesen war: gütig, stoisch und friedfertig. Ellas langer Rock raschelte über ihren Baumwollunterhosen, als sie zur Eingangstür eilte, um Louis einzulassen, bevor er klopfte.
Louis starrte seine Schwester an und ergriff das Wort, bevor sie etwas sagen konnte. »Stell mir bloß keine Fragen, Ella. Ich bin total erledigt.«
Sie schürzte die Lippen und flüsterte streng: »Erledigt? Louis, du siehst aus, als hätte dich jemand zusammengeschlagen, nicht, als seiest du müde. Ich bin sicher, dass Papa dich auch liebend gerne mal vertrimmen würde, wenn er auch nur die geringste Chance sähe, dir damit etwas Verstand einprügeln zu können. Jetzt geh in dein Zimmer, ich hole Wasser, damit du dich waschen kannst. Umziehen musst du dich auch. Hast du etwa vergessen, dass du Papa um elf Uhr dreißig zu Brown und French begleiten sollst?«
»Ich weiß«, seufzte Louis. »Wo ist er denn?«
»Er ist hinten im Garten und sagt Phillip, welche Pflanzen er für die Ernte im späten Frühling setzen soll.« Sie ergriff ihn am Ärmel. »Komm! Wir haben nicht viel Zeit. Er wird in ein paar Minuten sicher nach dir rufen!«
Was Ella und ihr Dienstmädchen Laurika in dieser Zeit erreichten, grenzte an ein Wunder. Das blaue Auge konnten sie zwar nicht verbergen, aber die Blutergüsse schwächten sie mit einer hautgetönten Gesichtscreme ab – trotz Louis’ empörtem Aufschrei und seiner Klage, dass diese Tarnung bei der Hitze nicht lange halten würde. Er wurde gewaschen und in saubere Kleider gesteckt, sein braunes, welliges Haar – auf das er unheimlich stolz war – ordentlich gekämmt. Wenn man von dem blauen Auge einmal absah, hatten die beiden Frauen es geschafft, dass er wieder ganz passabel aussah.
Als Henri Van Leyden das blaue Auge seines Sohnes sah, glich sein Gesichtsausdruck einem Vulkan kurz vor dem Ausbruch. Aber er sagte nur: »Du wirst mir das später erklären« und zeigte auf Louis’ Auge. »Erst erledigen wir das Geschäftliche.«
Mit einem Seufzer der Erleichterung sah Ella ihrem Vater und ihrem Bruder hinterher und genoss den Frieden, der sich über das Haus senkte. Der Bungalow war für Durbans Verhältnisse nicht besonders groß und ließ in keiner Weise den wahren Status der Familie erkennen, aber er lag in einer guten Gegend, und man konnte zu Fuß in die Stadt gelangen. Und Durban hatte sich, wie Vater ihr jedes Mal klar machte, wenn sie in die Stadt kamen, in den letzten zehn Jahren zu einem der wichtigsten Häfen an der Ostküste Südafrikas entwickelt. Ella war seit ihrer Kindheit regelmäßig hier, aber obwohl sie ihre Aufenthalte immer genoss, vermisste sie doch Kraaldorf, das Gut ihrer Familie.
Laurika brachte ihrer Herrin ein Glas Eistee und ein paar Kekse für ein leichtes, zweites Frühstück. Sie stellte das Tablett auf einem niedrigen Tisch im Salon ab. »Glauben Sie, Massa Louis wird Schwierigkeiten bekommen, Miss Ella?«
Ella lächelte dem dunkelhäutigen Dienstmädchen zu. »Bestimmt. Aber Louis wird sich das nicht übermäßig zu Herzen nehmen. Er ist daran gewöhnt, dass Papa ärgerlich auf ihn ist.«
Sie war vier Jahre jünger als Louis, und seit sie denken konnte, hatten er und ihr Vater sich nicht gut verstanden. Ihre Persönlichkeiten waren einfach zu unterschiedlich, und seit dem Tod ihrer Mutter vor sieben Jahren traten ihre Differenzen noch deutlicher zutage. Alfreda Van Leyden war immer eine Art Puffer zwischen Vater und Sohn gewesen. In dieser Hinsicht war Ella in die Fußstapfen ihrer Mutter getreten, und sie konnte es sogar noch besser, weil sie auch die Gerissenheit ihres Vaters geerbt hatte.
»Werden Sie Mrs. Vogel besuchen, heute?«
»Natürlich.«
Ella hatte für heute ein Treffen mit ihrer alten Schulfreundin Angelique Vogel geplant; allerdings hatte sie, ehrlich gesagt, keine besonders große Lust dazu. Es lag keinesfalls daran, dass sie Angelique nicht mochte, das tat sie – sie waren schließlich schon seit Ewigkeiten miteinander befreundet. Es war nur so, dass Angelique sie mit ihren drei Kindern, die allesamt bezaubernd waren, ihrer Residenz im vornehmsten Viertel Durbans und ihrem Ehemann Wilfred, der bei der De Beers Mining Company arbeitete, zu sehr an ihre eigene Situation erinnerte. In letzter Zeit hatte sie sehr häufig über ihre Situation nachgedacht: Sie war unverheiratet und würde es aller Wahrscheinlichkeit nach auch bleiben. Alle ihre engen Freundinnen in Saringal und Durban waren bereits verheiratet und hatten eigene Familien gegründet.
Nicht dass sie sich über einen Mangel an Verehrern hätte beklagen können. Als sie das heiratsfähige Alter erreicht hatte, war sie von einigen Männern umworben worden. Und sie war sogar einmal verlobt gewesen, mit Rudolph Grunwald, dem Zweitältesten Sohn eines reichen Durbaner Handelsbankiers. Anfangs hatten ihr Rudolphs Aufmerksamkeiten sehr geschmeichelt. Er war ein attraktiver Mann: groß, dunkel und gut aussehend. Seine Umgangsformen waren geschliffen, und wenn er wollte, konnte er sogar amüsant sein. Dass er sie, die sich selbst als graue Maus sah, heiraten wollte, hatte sie angenehm überrascht. Genau wie ihren Vater, der an der Hoffnung festhielt, dass sie eines Tages eine genauso gute Partie wie Louis machen würde.
Fast ein Jahr lang glaubte Ella, sie sei in Rudolph verliebt, so geblendet war sie von seinen Schmeicheleien. Aber als ihre Verlobungszeit fortschritt und sie ihn besser kennen lernte, wurde ihr schließlich klar, dass sie seine unterschwellige Arroganz nicht ertrug. Für Rudolph waren Frauen tatsächlich nicht viel mehr wert als Nutztiere. Für ihn war eine Ehefrau jemand, der seine Kinder gebar und erzog und ihm effizient den Haushalt führte. Außerdem machte er Ella in den Monaten vor ihrer Hochzeit schmerzhaft deutlich, dass ihre beträchtliche Mitgift für einen großen Teil seiner Vorfreude auf die Ehe verantwortlich war. Deshalb löste Ella, zu Rudolphs Überraschung und Ärger und zur Enttäuschung ihres Vaters, zwei Monate vor der Hochzeit die Verlobung auf.
Die Erfahrung mit Rudolph prägte Ella tief und machte sie gegenüber den Motiven aller nachfolgenden Verehrer misstrauisch. Sie wollten nicht sie; sie gierten alle nur nach einem Anteil am Vermögen der Van Leydens. Also gewöhnte sich Ella nach ihrem einundzwanzigsten Geburtstag, als der Strom der Verehrer schwächer wurde und schließlich ganz austrocknete, an den Gedanken, unverheiratet zu bleiben, ihrem Vater den Haushalt zu fuhren und Louis’ zarter Frau Annalise bei der Erziehung ihres Sohnes Dirk zu helfen. Seit einiger Zeit bedrückte sie jedoch zunehmend die Aussicht, als alte Jungfer zu enden, aber eine angemessene Lösung für ihr Problem fiel ihr auch nicht ein.
Als Ella, die sich nicht gerne als Hausherrin aufspielte, ihren Tee getrunken hatte, trug sie das Tablett selbst in die Küche zurück und besprach mit dem Koch, was es für sie zum Mittagessen und für die ganze Familie zum Abendessen geben sollte, wenn die größte Hitze des Tages abgeklungen war. Als sie später durch den Flur ging, der mit gemusterten Läufern ausgelegt war, um den Klang der Schritte auf den polierten Dielen zu dämpfen, gestand sie sich ein, dass sie sich nach Kraaldorf sehnte, obwohl sie erst vier Tage in Durban waren. Dort fühlte sie sich wirklich zu Hause … und hielt die Fäden in der Hand.
Auf Kraaldorf war sie eine Königin, die Herrin über Haus und Hof, während Papa und Louis sich um die vielen Morgen Zuckerrohrfelder kümmerten. Dort gab sie die Anordnungen und wurde respektiert und geschätzt, und zwar über die Grenzen der Plantage hinaus. Und dann war da noch die Freiheit. Sie konnte ganz sie selbst sein, ohne die Zwänge und die perfekten Manieren, die die Gesellschaft von Durban forderte.
Willem schwitzte in der späten Vormittagssonne, als er den überfüllten Square auf der Suche nach Informationen darüber durchstreifte, wie er am besten zu den Diamantenfeldern von Johan’s Glen kam. Donald und Bertie waren nirgends zu sehen, aber er hatte keine Schwierigkeiten, sich die Informationen zu beschaffen, die er benötigte. Als Erstes fand er heraus, dass die Transportkosten ein großes Hindernis darstellten. Der Preis für einen Platz auf einem der überfüllten Wagen war unglaublich hoch, er grenzte an Diebstahl. Als er kalkulierte, wie viel die Minimalausrüstung kosten würde, die er mitnehmen musste, wenn er sie nicht zu überhöhten Preisen in den Minen kaufen wollte, wurde ihm klar, dass er deutlich weniger Geld besaß, als er benötigte.
In ihm stritten sich Frustration und trotzige Entschlossenheit, denn er musste zugeben, dass die Aufgabe, die er sich gestellt hatte, nicht so leicht war, wie er vermutet hatte. Er erinnerte sich an Louis Van Leydens Gesichtsausdruck, als er ihm von seinem Plan erzählt hatte. Der Bure hatte einen Ausdruck in den Augen gehabt, den Willem jetzt als amüsiertes Mitleid interpretierte. Aber Willem tröstete sich mit dem einzigen, wenn auch kleinen Erfolg, den er an diesem Morgen zu verzeichnen hatte: Er hatte sich ein Buch über Diamanten und die verschiedenen Methoden der Edelsteingewinnung gekauft.
Bei seiner Wanderung über den Square gab ihm ein Händler, der sah, wie enttäuscht der Holländer dreinblickte, einen Tipp, während er seinen Wagen belud.
»Wenn Sie sich keinen Platz auf den Transportwagen leisten können, dann versuchen Sie es bei einem der Kaufleute, die die Minen und die Städte, die auf dem Weg liegen, versorgen. Manchmal lassen sie, gegen eine Gebühr, einen Mann neben ihrem Karren herlaufen. Als Gegenleistung muss man dafür mit dem Ochsengespann und beim Auf- und Abladen von Waren helfen. Aber man bekommt Verpflegung und einen Schlafplatz unter dem Karren.«
Willem lächelte. Diese Information munterte ihn auf und verscheuchte die Resignation, die sich seiner bemächtigen wollte. »Wo finde ich denn so einen großzügigen Mann?« Gott war sein Zeuge, er hatte heute, außer diesem Mann, noch keinen einzigen Händler getroffen, der auch nur eine Spur von Großzügigkeit in seiner verhärteten Seele gehabt hatte.
»Versuchen Sie es in der südlichen Ecke des Squares. Bei einem Mann namens Le Petit.« Der Händler zwinkerte Willem zu. »Vielleicht hilft er Ihnen aus der Patsche, im Austausch für ein paar Münzen. Er ist ein mürrischer, humorloser Jude. Wenn Sie das nicht stört, dann können Sie –«
Nach einem hastigen Dankeschön machte sich Willem schnurstracks auf den Weg zum südlichen Ende des Squares.
Maurice Le Petit sah Willem Dewar mit seinen unbarmherzigen braunen Augen abschätzend an, als der Seemann seine Bitte vorbrachte, ihn begleiten zu dürfen, und dabei den Namen des Händlers anführte, der vorgeschlagen hatte, er solle sich an ihn wenden.
»Hat er das gesagt?« Le Petits Stimme war dünn und beinahe winselnd. Er kratzte sich den von schütterem, graumeliertem Haar bedeckten Schädel. »Die anderen Händler auf dem Square sollten sich um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern und mich in Ruhe lassen.«
Unbeirrt versuchte Willem es weiter. »Ich bin ein guter Arbeiter, Herr Le Petit. Bis heute Morgen war ich dritter Maat auf der Andover Lady. Sorensen, der Kapitän des Schiffes, wird für meinen Charakter bürgen.«
»Als ob ich Zeit hätte, die Referenzen von allen zu prüfen, die hier vorbeikommen und um Hilfe bitten!«
Le Petit begutachtete den Riss in Willems Hemd und die Schürfwunde auf seiner Wange. »Kämpfst wohl gerne, was?«
Er wartete Willems Antwort nicht ab. »Ich warne dich, Freundchen, die Straße, die zu Johan’s Glen führt, ist sehr unsicher. Es gibt Berichte über Banden von Gesetzlosen auf dem Weg, meistens Diamantensucher, die kein Glück hatten. Sie rauben die Karren und die Transportwagen aus. Verfluchte, feige Aasfresser, das sind sie.«
»Wurden Sie schon einmal ausgeraubt, Herr Le Petit?«, fragte Willem.
Er hatte überhaupt nicht an die Gefahren gedacht, denen er auf dem Weg ausgesetzt sein würde. Er sah sich den Juden genauer an. Le Petit war ein kleiner Mann, wirkte allerdings zäh und drahtig. Willem konnte sich vorstellen, dass Banditen ihn ohne größere Probleme in die Mangel nehmen konnten, selbst wenn er bewaffnet war.
»Das wurde ich. Die meisten Händler hier auf dem Square sind schon mindestens einmal ausgeraubt worden. Die dreckigen Diebe haben alles mitgenommen, sogar meinen Karren und die Ochsen. Aber«, auf seinem Gesicht erschien ein listiger Ausdruck, »jetzt habe ich vorgesorgt.«
Er zog eine Winchester unter dem Sitz seines Karrens hervor und zeigte Willem die Waffe. Dann ließ er einen schrillen Pfiff los.
Ein Hund, so schwarz wie eine mondlose Nacht, kam unter dem Karren hervor, wo er mit einer stabilen Kette festgehalten wurde. Ein Tier von solcher Größe hatte Willem bisher noch nicht gesehen. Der Hund knurrte, fletschte die Zähne und stellte sich in aggressiver Pose neben seinen Herrn. Die Augen des Tieres blickten wachsam, die Ohren hatte er flach an den Kopf gelegt. Der Hund wirkte derartig bedrohlich, dass Willem sich zwingen musste, nicht einen großen Schritt zurückzuweichen.
»Das ist Brutus. Seit er auf dem Karren mitfährt und meine Winchester unter dem Sitz liegt, hat es sich schnell herumgesprochen, dass es fatale Folgen haben könnte, Le Petit zu überfallen. Seit ich Brutus habe, lassen mich die Diebe völlig in Ruhe.«
»Er ist ein … ein …«, Willem suchte nach einem passenden Ausdruck, »ein prächtiges Tier.«
»Das stimmt, und er gehorcht nur mir allein. Das solltest du dir merken.«
Er starrte Willem lange und durchdringend an und sagte dann mit tonloser Stimme: »Jeder, der mich auf dem Treck begleitet – es sind fast zweihundert Meilen, weißt du – und irgendein krummes Ding drehen will, riskiert, dass ihn Brutus auseinander nimmt.« Le Petit kicherte plötzlich, als finde er die Vorstellung höchst amüsant. »Abgesehen davon riskiert er ziemlich wunde Füße.«
»Um meine Füße mache ich mir keine Sorgen, Herr Le Petit. Ich laufe gern. Wie viele Meilen schafft Ihr Karren denn am Tag?«
Le Petit blickte diesen gut gebauten jungen Mann, der sich nicht so leicht abwimmeln ließ, mit zusammengekniffenen Augen an. »Das kommt darauf an. Fünfzehn Meilen, wenn das Wetter gut ist und der Weg einigermaßen in Ordnung.«
Sein Blick fiel auf Willems Füße. »Du brauchst stabilere Stiefel als die, die du anhast, und einige Paare dicke Socken, sonst hast du nach ein paar Tagen Blasen.« Er stach warnend mit dem Zeigefinger nach Willem. »Und wenn das der Fall sein sollte und du nicht mehr laufen kannst, dann lasse ich dich im nächsten Dorf zurück, das kannst du mir glauben.« Er kicherte freudlos. »Und dein Geld behalte ich trotzdem.«
»Ich kaufe mir heute noch neue Stiefel«, erwiderte Willem zuversichtlich.