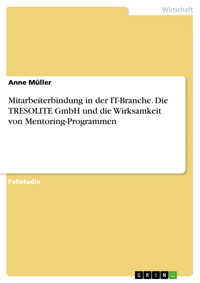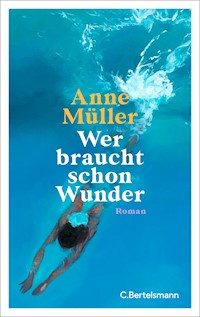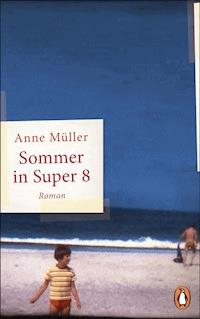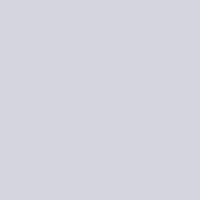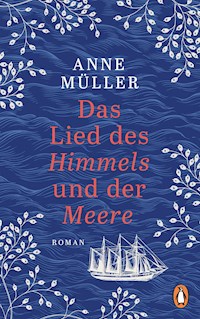
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Feinfühlig, atmosphärisch, humorvoll - Anne Müller schreibt kluge Romane über starke Frauen!
Schleswig 1872. Zum Ärger ihrer Mutter lehnt Emma eine sehr gute Partie ab. Anstatt einen Mann zu heiraten, den sie nicht liebt, besteigt sie voller Erwartungen den Dampfsegler »Borussia«, um nach Kalifornien auszuwandern. Emma arbeitet als Gesellschafterin bei einer reichen Witwe in San Francisco und verliebt sich schon bald in den sympathischen Holzhändler Lars. Sie wollen heiraten und eine Familie gründen. Emma zieht zu ihm in den Norden an die Humboldt Bucht. Doch die Ehe bleibt kinderlos, Lars ist geschäftlich viel unterwegs und Emma fühlt sich einsam. Als Hans, Lars’ bester Freund und Trauzeuge, ihr eine Stelle im Kontor seiner Schiffswerft anbietet, entwickelt sich eine starke Zuneigung zwischen beiden – doch ihre Liebe darf nicht sein.
Herzerfrischend, packend und mit feinem Humor erzählt Anne Müller von einer starken jungen Frau, die den Zwängen ihrer Zeit trotzt und ihren eigenen Weg sucht, findet und geht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 455
Ähnliche
Feinfühlig, atmosphärisch, humorvoll – Anne Müller schreibt kluge Romane über starke Frauen!
Schleswig 1872. Zum Ärger ihrer Mutter lehnt Emma eine sehr gute Partie ab. Anstatt einen Mann zu heiraten, den sie nicht liebt, besteigt sie voller Erwartungen den Dampfsegler Borussia, um nach Kalifornien auszuwandern. Emma arbeitet als Gesellschafterin bei einer reichen Witwe in San Francisco und verliebt sich schon bald in den sympathischen Holzhändler Lars. Sie wollen heiraten und eine Familie gründen. Emma zieht zu ihm in den Norden an die Humboldt Bucht. Doch die Ehe bleibt kinderlos, Lars ist geschäftlich viel unterwegs, und Emma fühlt sich einsam. Als Hans, Lars’ bester Freund und Trauzeuge, ihr eine Stelle im Kontor seiner Schiffswerft anbietet, entwickelt sich eine starke Zuneigung zwischen beiden – doch ihre Liebe darf nicht sein.
Herzerfrischend, packend und mit feinem Humor erzählt Anne Müller von einer starken jungen Frau, die den Zwängen ihrer Zeit trotzt und ihren eigenen Weg sucht, findet und geht.
Anne Müller wuchs in Schleswig-Holstein auf und lebt heute in Berlin. Nach dem Studium der Theater- und Literaturwissenschaften arbeitete sie zunächst als Radiojournalistin, dann als Drehbuchautorin. Ihre beiden Romane Sommer in Super 8 und Zwei Wochen im Juni begeisterten zahlreiche Leserinnen und Leser. Inspiriert durch die Lebensgeschichte einer Vorfahrin schrieb sie ihren neuesten Roman Das Lied des Himmels und der Meere.
»Einfühlsame Familiengeschichte um Aufbruch und Abschied.«FÜRSIEüber Zwei Wochen im Juni
»Zwei Wochen im Juni ist ein leiser, ein literarischer Roman. Wie schon in ihrem Roman Sommer in Super 8 gelingt es Anne Müller, das fein gesponnene Netz familiärer Beziehungen mit etwas distanziertem Wohlwollen und feiner Ironie darzustellen, wie es nur wenige Autoren deutscher Sprache können.« Das Stadtgespräch
»Eine Familiengeschichte, atmosphärisch fein gesponnen und dicht. Sehr zu empfehlen.« Wetzlarer Neue Zeitung über Sommer in Super 8
Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook.
ANNEMÜLLER
Das Lied
des Himmels und
der Meere
ROMAN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2022 Penguin Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: © Favoritbuero, München,
unter Verwendung von Bildmaterial von
shutterstock/Marzufello, mamita, Stocksnapper
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-27767-3V001
www.penguin-verlag.de
Für Pia
in Dankbarkeit für diese Freundschaft
Teil I
Prolog
Emma packte in ihren Koffer ein Nachthemd und ein Unterkleid, Zuversicht, ein Stück Kernseife, Vorfreude, ihre Klaviernoten, Unterwäsche, Strümpfe, Neugier, Strumpfbänder, Zweifel, Handschuhe, Talkumpuder, Befürchtungen, eine Haarbürste. Obenauf legte sie das gute Kleid und ein gerahmtes Foto von ihrer Familie, das sie vor Kurzem im Fotoatelier am Dom hatten machen lassen und auf dem sie alle sehr ernst blickten. Emma nahm wieder heraus: Die Bibel, es ließ sich dort bestimmt bei Bedarf eine neue finden, Amerika war ja kein gottloses Land, den Handspiegel, weil es mit großer Wahrscheinlichkeit auch in der neuen Welt Eitelkeit und somit Spiegel gab. Was war wichtig? Was entbehrlich? Wie sollte man, bitte schön, sein Leben in einen einzigen Koffer hineinbekommen?
Bertha, die im Lehnstuhl neben dem Bett kauerte, sah mit verweinten Augen zu, war ihr die letzten Tage nicht mehr von der Seite gewichen.
»Hier, den schenk ich dir.« Emma reichte ihrer Schwester den Handspiegel. Es klopfte an der Tür, der Vater steckte seinen Kopf herein. »Darf ich?«
Sie nickten, und der Vater trat ein, fast ein bisschen verlegen, schien es Emma, kam er auf sie zu, die Hände hinterm Rücken.
»Ich habe da noch etwas, was auf keinen Fall in der neuen Welt fehlen darf.«
Die Schwestern sahen gespannt auf den Vater. Dieser überreichte Emma eine der kleinen spitzen Papiertüten von »Konditorei Johannsen«, es duftete nach Karamell und Emmas Lieblingsbonbons, den Goldtalern. Jetzt traten ihr Tränen in die Augen.
»Das Gold aus Schleswig«, sagte der Vater.
»Oh, wie lieb von dir!«
Sie legte die Tüte mit den Bonbons ab und umarmte ihren Vater, drückte ihn fest an sich, und er erwiderte es, als wolle er sie festhalten, und Bertha erhob sich vom Stuhl und drückte nun ihrerseits das Menschenknäuel, und über sechs Wangen liefen Tränen. Nachdem sie sich wieder voneinander gelöst hatten, nahm Emma die Bonbontüte und stopfte sie in den Koffer, dann schloss sie den Deckel.
1.
Das Buggefühl
Der Wind konnte so zärtlich sein. Emma spürte, wie ihr der feuchtmilde Westwind über die Wangen und den Nacken strich, ihr in die Haare fuhr. Binnen Minuten hatte sich »der Windbeutel«, so nannte sie den eigens fürs pustige Deck gebundenen Dutt, aufgelöst, sobald sie an der Reling der Borussia stand. Und sie stand oft hier, bewunderte die Segel, roch je nach Windrichtung den Rauch und blickte zurück oder nach vorn, was seit ein paar Tagen egal war, der Ausblick war immer gleich. Wasser, Wasser. Und nochmals Wasser. Der Atlantik, der zwischen Europa und der Neuen Welt lag. Und kein geringeres Ziel hatte Emma Johanna Callsen. Insofern war es doch ein Unterschied, ob sie über den Bug hinweg in Fahrtrichtung des Schiffes aufs Meer sah, denn dort würde in wenigen Tagen die Küste von Panama erscheinen und sie an Land gehen, sie würde mit dem Zug weiterreisen, den Atlantik gegen den Pazifik tauschen und mit einem anderen Dampfschiff nach Kalifornien fahren. Der Bug war die Zukunft, das Heck die Vergangenheit und an Deck zu stehen und aufs Meer zu sehen, pure Gegenwart.
Wenn Emma über das Heck zurückschaute, dann sah sie wieder ihre Familie in Hamburg am Kai stehen, als unter lautem und langem Tuten des Nebelhorns und dem Kommando »Leinen los!« die Schiffstaue an Land von den dicken Eisenpollern gelöst wurden und das große Schiff langsam ablegte. Emma sah wieder genau vor sich, wie ihr kleiner Vater den schwarzen Hut lüftete und ihn schwenkte, seiner Tochter zu Ehren, und wie ihm seine grauen Haare dabei zu Berge standen. Daneben winkte die Mutter mit ihrem Taschentuch und war, so dachte Emma in dem Moment, vielleicht insgeheim ganz froh, die mittlere Tochter auf diese Weise elegant loszuwerden. Und da standen inmitten eines Meeres weißer, flatternder Taschentücher, Erika und Bertha, in ihren guten Kleidern, alle hatten sich herausgeputzt für die Fahrt nach Hamburg. Erika wahrte die Fassung, wie es sich für eine große Schwester gehörte, und Bertha winkte und weinte zugleich.
Zuvor, am Kai beim Verabschieden, war viel um sie herum geschluchzt worden, es gab regelrechte Dramen. Man wusste nicht, ob man sich jemals wiedersehen würde. Und während Emma und ihre Familie letzte gute Wünsche miteinander austauschten und sich dabei zu wiederholen begannen, wurde das große Gepäck ins Unterdeck verladen, Truhen, Schrankkoffer, sogar eine Klavierkiste war dabei. Vier laut fluchende Hafenarbeiter bugsierten sie gemeinsam an Seilen in die Ladeluke, es fielen unschöne Bemerkungen über das Musizieren an sich und wozu der Mensch, verdammig noch mal, ein Klavier braucht da unten bei den Hottentotten. »Guckt mal, da muss ein Klavier mit auswandern!«, sagte Emma, und ihr Vater antwortete: »Ich denke mir, dass es darüber sehr verstimmt sein wird.« Was hatten sie alle gelacht. Sogar die Mutter. Und dieses Lachen hatte um sie als Familie ein letztes Mal ein Band geschlungen.
Wenn Emma an Deck stand und zurückblickte, Richtung Deutschland, dann kamen unweigerlich die Gedanken an das, was sie ausgeschlagen hatte, kam das Bild vom hageren Hinrichsen. Emma musste an seinen Händedruck denken, als sie Hinrichsen das erste Mal begrüßt hatte. Krötenhaut. Da wusste sie noch nicht, dass diese Hand um ihre Mädchenhand, die Chopinläufe aus dem Effeff beherrschte, anhalten würde, um die zwanzigjährige Tochter des Professors an der ehrwürdigen Domschule, Herrmann Callsen. Die erste Tochter war in sehr guter Partie verheiratet mit dem Besitzer der Zuckerfabrik, und nun war Emma an der Reihe. Bertha mit ihren siebzehn Jahren hatte noch eine kleine Schonfrist. Bertha, Emmas Lieblingsschwester und Vertraute.
Es war ein verregneter Januartag, als Landrat Hinrichsen vorfuhr und bei ihren Eltern ganz offiziell um sie anhielt. Er fände sie allerliebst, reizend, auch ihr Temperament sei ihm nicht entgangen, und sie könne, wenn man sie erst etwas an die Kandare genommen hätte, sicher eine gute Mutter und treuliebende Ehefrau werden. So in etwa gab die Mutter es, nachdem Hinrichsen gegangen war, Emma gegenüber im Salon wieder, sichtlich stolz auf ihre Tochter und diesen Antrag. Emma war ganz mulmig geworden, vor allem aber bei dem Wort »Kandare« hatten sich ihr die Nackenhaare aufgestellt. Es war der Vater, der ihr in die Augen sah und fragte: »Emma, liebes Kind, kannst du dir vorstellen, die Frau von Landrat Hinrichsen zu werden?«
Und sie hatte, wie aus der Pistole geschossen, gesagt: »Niemals!« Es war ein Niemals, das aus ihrem Rückenmark kam, den Eingeweiden, aus ihrem ganzen Körper, und sie hatte noch nie in ihrem Leben etwas so ernst gemeint. Ihre Mutter war blass geworden, und ihr Vater konnte sich ein leichtes Schmunzeln nicht verkneifen. Ihr, Emma, jedoch war in diesem Moment vollkommen klar, dass sie nicht nur niemals Hinrichsens Frau werden wollte, sondern dass sie es auch keinen Augenblick lang abwägen würde und dass ihre Antwort, ihr Niemals, durch nichts auf der Welt zu revidieren war.
Emma hatte gewusst, wie ihr Leben ab der Hochzeit aussehen würde, Tag für Tag, Stunde für Stunde, sie hatte gewusst, dass sie genau so ein Leben führen würde, wie ihre Mutter es tat und wie ihre Schwester es seit der Hochzeit als Direktorengattin führte. Ein Leben, das für eine Frau vorgezeichnet war, das genauen Abläufen entsprach, voller Pflichten und Aufgaben und nur kleinen Freiheiten und Belohnungen, es war das Allerletzte, worauf Emma Lust hatte. Vor allem aber wollte sie dieses Dasein nicht neben einem hageren Beamten wie Berthold Hinrichsen führen, der zudem siebzehn Jahre älter war. Nichts, aber auch gar nichts zog Emma an ihm an, und es kam ihr falsch vor, eine Lüge, sich diesem Mann hinzugeben. Sie wünschte sich, zumindest in Maßen, eine gewisse Leidenschaft und Zärtlichkeit mit einem Mann, wenigstens eine gute geistige Verbindung, eine Freundschaft und Kameradschaft. Sie hatte andere Vorstellungen, »Flausen im Kopf«, wie ihre Mutter es nannte, die überhaupt nicht verstehen wollte, wie man eine so sichere und solide Partie wie den Landrat ausschlagen konnte. Ihr Vater dagegen brachte etwas mehr Verständnis für seine mittlere Tochter auf, aber das war seit jeher so gewesen.
Emma hatte ihren Eltern erklärt, dass sie lieber in ein Stift gehen und Jungfrau bleiben würde, als diesen Hinrichsen zu heiraten. Denn es sei besser, sich niemals einem Mann hinzugeben, als mit einem wie dem Landrat in die Federn zu steigen. Die Mutter bekam ihre roten Flecken, verstand wieder mal nicht, was dieses Kind sich nur dachte und woher all diese Ausdrücke kamen. Schmallippig sagte sie zu Emma: »Meine liebe Tochter, ich weiß nicht, ob du dir erlauben kannst, derart krüsch zu sein. Du wirst nie wieder so ein gutes Angebot bekommen, einen Antrag von allererster Güte! Bilde dir bloß nicht ein, dass noch ein Prinz dahergeritten kommt, denn für einen Prinzen lässt du es an weiblicher Anmut und Demut fehlen, du neigst zum Widerspruch und zum Aus-der-Form-Gehen, weil keine Cremeschnitte vor dir sicher ist, und du bist zwar ein hübsches Mädchen, aber bei Weitem keine Schönheit, für die ein Mann eventuell geneigt sein könnte, anderweitig Abstriche zu machen.«
»Ottilie, ist gut jetzt!«, unterbrach Herrmann Callsen seine Frau, die noch weiter Munition verschossen hätte. Doch all das, was die Mutter ihr gesagt hatte, wusste Emma selbst, und es kränkte sie nicht besonders.
Und so hatte sie das wochenlange Muckschsein der Mutter ertragen, in vielen Gesprächen mit Bertha alles erörtert und sich mit ihr gemeinsam unter Lachanfällen ausgemalt, wie Hinrichsen wohl in langen Unterhosen aussah. Ob er jemals in seinem Leben eine Kissenschlacht veranstaltet hatte? Einen Streich ausgeheckt? Beide Schwestern konnten es sich nicht vorstellen. Eher, dass er Krampfadern hatte und gelbliche, verwachsene Zehennägel und dass er hüstelte im Bett beim Vollzug des ehelichen Aktes. Emma musste schmunzeln. Sie vermisste ihre kleine Schwester mit dem tiefen Lachen schon jetzt so schmerzlich.
Eines war aber auch klar: Ohne Hinrichsens Antrag und ihre Ablehnung und die daraus folgende Frage, was nun aus ihr werden sollte, hätte sie nicht auf die Anzeige geantwortet, in der die Kieler Agentur »Matthiessen & Co« Bedienstete für Amerika suchte.
Wenn Emma über das Heck hinweg Richtung Hamburg sah, dann kamen die Gedanken aus dieser Ecke ihres Bewusstseins, und wenn sie in Richtung des Schiffsbugs blickte, dann sah sie die Zukunft vor sich, die ungewisse, die sie sich in den letzten Monaten während ihrer Vorbereitungen in Schleswig vorzustellen versucht hatte. Ihr Anlaufpunkt war Mrs. Thompson in San Francisco, eine gebürtige Hamburgerin, die ihr die Stellung als Gesellschafterin gegeben hatte und sie erwartete. Der Lohn war viel besser als in Deutschland, und Emma hatte gehört, dass in Kalifornien auf eine Frau fünfzig heiratswillige Männer kamen, sie würde also genügend Auswahl haben und sich in Ruhe einen passenden Mann aussuchen. Aber alles zu seiner Zeit. Erst mal wollte sie etwas arbeiten und Englisch lernen, sich mit der neuen Kultur vertraut machen. Ansonsten war die Zukunft eine unfertige Skizze, aber das machte Emma keine Angst, sondern löste in ihr eine freudige Neugier aus. Sie hatte bereits festgestellt, dass die Aufregung an Land eine andere gewesen war als die hier auf dem Schiff. Die Aufregung in Schleswig war mit dem Abschiedsschmerz vermischt, hatte melancholische Züge, aber die Aufregung hier auf dem Atlantik war die einer Aufbruchstimmung. Sie war unterwegs, eine Reisende auf der Borussia, einem stattlichen Dampfschiff mit drei Masten und beeindruckenden Segeln. Ein Schiff, dessen Dampfmaschine schwarzen Rauch ausstieß und manchmal auch »Heizerflöhe«, noch glühende Rußpartikel, die einem kleine Löcher in die Kleidung brennen konnten, wenn man nicht höllisch aufpasste. Sie musste also immer ganz genau Ausschau halten, von wo der Wind kam und wie der Rauch zog, aber inzwischen hatte sie darin Übung.
Und schon das Schiff selbst war eine Welt für sich mit seiner Dreiklassengesellschaft, zu der sich noch die unsichtbaren Maschinisten und Heizer unten im Bauch des Schiffes und die Seeleute mit ihren verschiedenen Rängen als eine eigene Gemeinschaft gesellten.
Emma war im Begriff, in ein neues Leben aufzubrechen.
Es war eine Mischung aus Lampenfieber, der hoffnungsfrohen Erwartung beim Öffnen eines Loses auf dem Jahrmarkt, der Angst, beim Äpfelklauen im Nachbargarten erwischt zu werden, dazu diese Art Kribbeln vor dem ersten Tanz mit einem Jungen, den man gern mochte, all das gemischt mit der kindlichen Aufregung am Weihnachtstag, welche Geschenke der Weihnachtsmann wohl bringen werde, so in etwa war das Buggefühl der auswandernden Emma Johanna Callsen an Deck der Borussia im Jahre 1872.
2.
Der Zauberer
Auf der Borussia auf dem Atlantik, 26. Juni 1872
Meine liebe Bertha,
ich bin nun schon vier Tage auf See, und allmählich kann ich kein Meer mehr sehen, es ist nämlich, musst Du wissen, in jeder Richtung gleich, und wenn Du mitten auf dem Atlantik bist, dann ist es ganz egal, wo Osten oder Westen ist, Norden oder Süden, ja an manchen Tagen auch egal, wo oben ist, denn der Himmel scheint mit dem Horizont zu verschmelzen. Du bist umgeben von einem einzigen Blau und sehnst Dich nach Farben, nach Grün, nach Gelb und nach Rot.
Zu Beginn die Elbe runter war ja noch was los, und es winkten auch immer wieder Menschen am Ufer dem Schiff zu mit ihren Taschentüchern, aber dann wurde das Getümmel immer weniger, und seit gestern haben uns nun auch die Möwen, Papageientaucher und Eisvögel verlassen, wir sind weitab jeder Küste mitten auf dem Atlantik. Die Tage gehen nur langsam voran, unterbrochen von passablen Mahlzeiten. Es gibt zum Frühstück frisch gebackenes Weißbrot, Milch (stell Dir vor, wir haben eine Kuh an Bord, die täglich für frische Milch sorgt. Das ist doch wirklich sehr nett von der Hamburg-Amerikanischen Packetfahrt-Actien-Gesellschaft!), mittags und abends gibt es dann eine warme Mahlzeit. Die Kartoffelschäler werden liebevoll »Augenärzte« genannt. Köstlich, oder? Das musst Du bitte der lieben Gertraud erzählen. Zum Tee im Salon fiedelt jemand auf einer Geige herum, damit es stilvoll wirkt und die Leute das Gefühl haben, sie bekommen was geboten für das Geld ihrer Überfahrt. Nach dem Abendessen gehe ich dann meist mit einem Buch ins Bett (davon wird man wenigstens nicht schwanger, wie Du weißt). Ich schlafe herrlich, denn das leise Brummen der Maschinen wiegt einen in den Schlaf, und die Kabinen werden durch die Rohre der Dampfmaschine mit beheizt. Es ist also warm wie in einer Höhle und sehr kommodig.
Die 2.-Klasse-Kabine hat zwei Kojen übereinander, zwei schmale Mahagonischränke, einen kleinen Tisch an der Wand, an dem ich gerade sitze, und von der oberen Koje das Weinen meiner Kabinengefährtin, einer Dorothea Martensen aus Flensburg, höre, die als Dienstmädchen in Los Angeles eine Stelle antreten wird. Dorothea hat blonde Korkenzieherlocken, eine Stupsnase, ist eigentlich aus gutem Hause, aber wurde verstoßen, weil sie unehelich ein Kind bekommen hat, das jetzt in einem Heim lebt. Dorothea ist neunzehn, und sie sagt, mit dem Kind hätte sie nicht auswandern können, denn dort drüben sei sie auf sich gestellt. Ihre Familie habe ihr nur diese Fahrkarte gegeben, damit sie verschwinde. Immerhin 2. Klasse, es hätte auch die 3. sein können. Was für ein Abstieg, von der Tochter eines Flensburger Rumfabrikanten zu einem Dienstmädchen! Ich bin allerdings sicher, und das habe ich ihr auch gesagt, dass sie bei ihrem Aussehen und diesen Locken schon bald einen Millionär finden und dann selbst einige Dienstmädchen haben wird. Da hat Dorothea mich angelächelt, ungläubig, aber doch etwas zuversichtlicher. Jetzt malen wir uns immer wieder ihr Leben in Los Angeles an der Seite eines Millionärs aus. Ihre Kleider und ihre Hüte, ihre Zimmer in einem Riesenhaus, ihre verschiedenen Angestellten, die sie hat und über die sie sich ständig ärgern muss. Ach, es sind herrliche Spinnereien, mit denen wir uns die Zeit vertreiben.
Dann wieder fängt Dorothea auf ihrem Bett an zu weinen und ist stundenlang nicht ansprechbar, da rette ich mich an Deck, zum Glück spielt das Wetter bisher mit. Wir hatten erst einen kleinen Sturm, vor zwei Tagen, der ging auch nur ein paar Stunden, ein Zwergensturm, aber er war ein Vorgeschmack auf das, was einen so auf See erwarten kann. Das Schiff schaukelte ganz schön, und mir war sehr schlecht. Im Grunde war es nur im Liegen einigermaßen auszuhalten. Seekrankheit ist etwas, was nicht vergleichbar ist mit anderen Arten von Übelkeit. Manche Passagen müssen furchtbar sein. Sogar die Kuh scheint seekrank gewesen zu sein, denn am Tag nach dem Sturm gab es keine Milch, und wir ulkten alle hier beim Frühstück, dass vielleicht saure Milch aus den Eutern geflossen sei oder Quark die Zitzen verstopft hätte. Unsere Tischgespräche tendieren oft zum Albernen, neben Dorothea und mir sitzt noch ein junges Ehepaar am Tisch, Herr und Frau Johannsen aus dem Alten Land und die unverheiratete Cousine von Frau Johannsen, Auguste, die furchtbar schmatzt und schlürft und gemeinsam mit den beiden auswandert. Sie gehen nach Stockton in Kalifornien, um bei Verwandten auf einer Obstplantage zu arbeiten, und Auguste sagte uns, sie werde sich dann dort einen reichen Goldgräber suchen. Wir spielen manchmal gemeinsam Karten oder werfen an Deck Ringe über Flaschen, dabei gesellen sich oft auch andere dazu, seltsamerweise aber immer nur Passagiere derselben Klasse.
Du willst sicher wissen, ob ich hier an Bord schon irgendeinen ansehnlichen Mann entdeckt habe? Ich muss Dich leider enttäuschen. Die meist bärtigen, tätowierten Seeleute sind nicht nach meinem Geschmack und verhalten sich auch uns gegenüber so, als wenn es uns nicht gäbe. Es sind getrennte Welten zwischen ihnen und uns. In der 1. Klasse erinnern mich die Männer sehr an Hinrichsen oder an Schwager Alfred, als hätten sie alle einen Stock verschluckt. Auch zwischen 1. und 2. Klasse gibt es hier an Bord eine feine Trennwand, unsichtbar, als wäre sie aus Glas, und manch einer rennt dann auch mal dagegen und holt sich eine Beule. Kaum in Berührung dagegen kommen wir mit den Passagieren vom Zwischendeck, der 3. Klasse, all den armen Menschen, die dort recht beengt leben! Es kursieren, vielleicht zum Amüsement der insgesamt etwas gelangweilten bessergestellten Schicht, die schlimmsten Gerüchte über das Zwischendeck, dass es dort Raub und Schlägereien gäbe. Vor zwei Tagen wurde dort ein Kind geboren. Stell Dir vor! Auf einem Schiff mitten auf dem Atlantik zur Welt zu kommen, zwischen Horizont und Meeresgrund. Was steht dann als Geburtsort in den Papieren? Atlantik? Das würde doch kein preußischer Beamter akzeptieren. Normalerweise, so erfuhr ich von einem Decksteward, werden die Neugeborenen sofort vom Kapitän getauft, aber wegen des Sturmes wurde es auf den kommenden Sonntagsgottesdienst verschoben.
Gestern gab es eine kleine Ablenkung an Bord, ein Fest für die Kinder (der 1. und 2. Klasse, versteht sich), dem wir Erwachsenen aber beiwohnen durften. Ein Zauberer war zugegen und ein Clown mit roter Clownsnase (den ich sofort als den Schiffskoch identifizierte, der auch sonst eine rote Kartoffelnase hat). Sie haben die lieben Kleinen mit ihren Tricks und Späßen aufgemuntert. Es sind doch auch viele Kinder an Bord, die ebenfalls die große Reise antreten, gemeinsam mit ihren Eltern. Sie sind zu niedlich ausstaffiert, man hat das Gefühl, sie hätten alle zu Hause noch eine komplett neue Garderobe genäht bekommen für das neue Leben da drüben und um einen guten Eindruck zu machen in der neuen Welt. Ob aus diesen Kindern schon bald echte Amerikaner werden? Ob aus mir Schleswiger Deern eine Amerikanerin wird? Man kann es sich nicht vorstellen momentan. Ach, Bertha, ich bin so gespannt, wie es da drüben sein wird, was mich erwartet. Bei Mrs. Thompson und überhaupt. Wenn sie es nicht schon kann, werde ich der Alten schnell Kartenspielen beibringen! Erst mal lasse ich sie oft gewinnen, damit sie Freude daran findet, dann natürlich nicht mehr, auch wenn sie zehnmal meine Vorgesetzte ist.
Eine Szene gestern bei dem Kinderfest war zu drollig! Ein etwa sechsjähriges Mädchen sollte dem Zauberer assistieren und den Zylinder umdrehen. Die Kleine war erstaunt, darin ein weißes Kaninchen vorzufinden. Das Mädchen nahm das Kaninchen auf den Arm, streichelte es. Als der Zauberer es ihm wieder wegnehmen wollte, fing das Mädchen an zu weinen und lief weg, mit dem Kaninchen auf dem Arm, der Zauberer hinterher. Es gab eine Verfolgungsjagd über das ganze Deck, zum Amüsement aller, irgendwann kam der Zauberer dann mit Kind und Kaninchen auf dem Arm wieder. Jetzt war es natürlich Teil der Nummer, das Kaninchen wieder wegzuzaubern. Vorher erzählte der Zauberer den Kindern aber noch, dass es ganz sicher wohlbehalten in der wunderschönen Kaninchenwelt landen und mit all den anderen ausgewanderten und weggezauberten Kaninchen leben werde und dass es dort sogar in der Verfassung ein Recht auf Glück für jedes noch so kleine Kaninchen gäbe, ob das nicht wunderbar sei. Die Kinder standen staunend da, und manche der Erwachsenen wischten sich verstohlen eine Träne aus den Augen.
Liebe Bertha, vermisst Du mich? Wirst Du mir bald schreiben? Tröstest Du unseren geliebten Herrn Papá ein bisschen? Mutter wird sicher nicht sehr traurig sein, dass ich weg bin, ihr störrisches Kind mit den Flausen im Kopf. Bei ihr hatte ich schon von klein auf das Gefühl, dass sie mich manchmal weit weg, auf den Mond und noch weiter, wünschte, verwünschte.
Ach, was würde ich darum geben, Dich durchzukitzeln, Dein Lachen zu hören! Stattdessen höre ich mal wieder die liebe Dorothea auf ihrem Bett schluchzen. Sie ist im wahrsten Sinne untröstlich und keine sehr aufmunternde Kabinengefährtin, aber sie hat auch wirklich ein hartes Schicksal und allen Grund zu weinen. So ist viel Wasser außerhalb des Schiffes, aber auch nicht gerade wenig hier unter Deck, in unserer kleinen Kabine.
Alles Liebe, Deine Schwester Emma
3.
Seemannslieder
Es war strahlender Sonnenschein, und das Meer lag friedlich da, große Stoffbahnen blauer, leicht changierender Seide. Die Borussia dampfte ohne Segel voran, da es windstill war. Es hieß, man werde Panama in drei Tagen erreichen. Emma stand wieder mal an Deck. Inzwischen konnte sie gar nicht genug davon kriegen, aufs Meer zu sehen, auf den Horizont. Diese Weite schien ihr Sinnbild für das neue Land mit seinen Möglichkeiten, die neue Welt, die sie schon bald mit ihrem Koffer betreten würde.
Emma fand das ewige Meer längst nicht mehr eintönig wie noch zu Beginn, vielleicht lag es am hellblauen Himmel, der Sonne, oder sie selbst hatte an Bord eine Wandlung durchgemacht. Auch die Tage erschienen ihr weit weniger langweilig, vor allem aber war unten in ihrer Kabine eine gravierende Veränderung eingetreten. Dorothea war vom Trauerkloß zum Plappermaul geworden, wollte von morgens bis abends schnacken, und nun ging Emma nicht mehr an Deck, um vor dem Schluchzen der Kabinengefährtin zu fliehen, sondern vor deren Wortschwall. Was hatte sie inzwischen nicht alles erfahren von dieser Dorothea, vom Vater, der nicht nur das große Geld im Rumgeschäft machte, sondern auch seine Sorgen im Grog ertränkte und dann sehr zornig werden konnte. Von der hübschen, aber schwachen Frau Mámá, oft von Migräne geplagt; die fünf Kinder hatten gelernt, mucksmäuschenstill im Haus zu spielen und stumme Zeichen miteinander auszutauschen, weil die Mutter im abgedunkelten Zimmer wieder mal mit kaum zu ertragenden Kopfschmerzen darniederlag.
Dorothea hatte Otto auf einem Ball kennengelernt, er sah in seiner Uniform so adrett wie der Kronprinz Friedrich aus, und sie hatten getanzt. Und es war wunderschön. Er versprach ihr auch sogleich die Ehe, und dann war sie mit ihm, ein großer Fehler, einmal heimlich in einer Kutsche ausgefahren, an der Förde entlang, wo kein Mensch war, und dort am Ufer sei es dann passiert. Nicht, dass sie es wollte, aber er wollte es, und sie hätte es ihm nicht abschlagen wollen, und dann sei er gekommen, sie, Emma, wisse schon, er habe in ihr losgespritzt, und das dürfe eben an bestimmten Tagen einer Frau nicht passieren, wie sie jetzt wisse, denn dann werde die Frau schwanger.
Emma selbst wusste lediglich, dass Mann und Frau nach der Hochzeit nackt ins Bett gingen, und der Mann sich dann auf die Frau legte und in sie eindrang, wie genau, davon hatte sie nur eine grobe Vorstellung und wollte es auch gar nicht so genau wissen. Es würde sich schon alles finden, dachte sie immer. Und dass Mädchen schnell schwanger werden konnten, das wusste sie auch. Aber nicht von ihrer Mutter, die mit ihren Töchtern niemals über derlei Dinge gesprochen hätte, sondern von Gertraud, der Küchenhilfe, die, seit Emma denken konnte, in ihrer Schürze bei ihnen zu Hause in der Küche gestanden hatte, den Herd schürte, Kartoffeln schälte und Gemüse putzte.
Dorotheas Vater wollte, dass sie »den Bastard« bei einer Engelmacherin wegmachen ließ, aber da habe ihre Mutter sich durchgesetzt und gesagt, niemals. Die Frauen sterben dabei sehr oft.
»Und was ist aus Otto geworden?«
»Der liebe Otto«, sagte Dorothea bitter, »hat sich versetzen lassen. Von Heiraten war keine Rede mehr. So ist das, Emma, wenn es ernst wird, dann sind wir Frauen allein mit dem Malheur. Weil Otto seinen Spaß hatte, ist mein Leben ruiniert.«
»Aber vergiss nicht«, sagte Emma, »dass du ja da drüben einen Millionär heiratest, und später wirst du einmal sagen: Diesem Otto verdanke ich es, dass ich nach Amerika gegangen und stinkreich geworden bin!«
Sie mussten lachen. »Ach Emma, was würde ich nur ohne dich machen? Was für ein Glück, dass wir die Kabine teilen! Dich hat der Himmel geschickt.«
Emmas Gedanken wurden von einer Ansammlung auffällig stiller Menschen gestört, die aus dem Zwischendeck ans Tageslicht traten, einige Offiziere und vielleicht ein Dutzend Matrosen hatten sich in Reih und Glied aufgestellt. Das Schiff verlangsamte seine Geschwindigkeit merklich, um dann nur noch auf dem Meer zu treiben. Es war, als bliebe die Zeit stehen. Emma versuchte, einen Blick zu erhaschen von dem, was da vor sich ging. Sie trat etwas näher, stellte sich hinter eines der Rettungsboote. Der Kapitän hatte eine Bibel in der Hand, und Emma sah, wie ein Holzbrett auf die Bordkante gelegt wurde, auf dem etwas in ein Segeltuch Gewickeltes lag. Als Emma das verzweifelte Schluchzen einer Frau hörte, wurde ihr klar, was sich in dem Segeltuch befand, und sie bekam eine Gänsehaut. Es war mucksmäuschenstill an Deck, auch weil jetzt alle Maschinen stillstanden, und Emma hörte die Worte des Kapitäns: »Und so nimmt der Herr, der Allmächtige, die kleine Mathilde Kröger, der er doch erst vor vier Tagen das Leben geschenkt hat, sie heute zu sich ins Paradies, er möge ihr das ewige Leben schenken.«
»Nein!«, rief die Mutter. »Nicht das Kind da unten allein am Meeresgrund, sie ist doch noch nicht getauft!« Emma schossen Tränen in die Augen, ihr tat diese Frau unendlich leid.
Der Mann, starr vor Schmerz, legte den Arm um seine Frau und flüsterte ihr etwas zu. Dann wurde das Brett gekippt und unmittelbar danach hörte man das Aufklatschen auf dem Meer und ein Vaterunser, das gemurmelt wurde. Durch die vielen tiefen Stimmen der Männer an Bord klang es ganz anders, als wenn sie es sonntags im Schleswiger Dom gebetet hatten. Auch Emma faltete die Hände und betete halblaut mit, für die kleine Mathilde, die noch vor Tagen für eine so freudige Aufregung an Bord gesorgt hatte, durch alle Schichten hinweg. Und Emma war sich sicher, dass der liebe Gott auch die ungetauften Kinder zu sich nahm und hätte das am liebsten der fremden Frau gesagt. Diese hing schluchzend an ihrem Mann, der sie, das rührte Emma besonders, obwohl er selbst schwankte, zu stützen versuchte. Dann verschwand die Gruppe im Zwischendeck, und die Seeleute gingen wieder an die Arbeit, und nicht mal eine halbe Stunde später wurde die Borussia wieder unter Dampf gesetzt, nahm Fahrt auf und verbreitete ihren Rauch an Deck. Für einen Moment hatte das große Schiff stillgestanden mitten auf dem Meer, aus Ehrbezeugung für eine kleine unschuldige Heidin aus dem Zwischendeck. Der Tod, dachte Emma, vermochte den Lauf der Welt anzuhalten.
Am Abend gingen Dorothea und sie gemeinsam auf eine kleine Tanzveranstaltung, im jetzt umgeräumten Speisesaal der 1. Klasse, ein wunderschöner Raum mit gemusterten Seidentapeten, Wandmalereien und einem Holzparkett. Auf einem Podest in der Ecke stand ein Orchester, und Emma erkannte in einem der Geiger den Zauberer wieder, der mit dem Mädchen um das Kaninchen gerungen hatte. Der Raum war gut gefüllt, es roch nach teuren Parfums und Seifen und auch nach dem damit übertünchten Schweiß von Wohlhabenden. Alle hatten ihr bestes Gewand angezogen, auch sie und Dorothea, aber es waren eben nur die guten Kleider, die Mädchen in Schleswig und Flensburg trugen und die nichts waren im Vergleich zu den Abendroben aus Samt und Seide der feinen Damen der 1. Klasse. Sie beide fielen auf, weil sie ohne männliche Begleitung kamen, und Emma merkte sofort, dass viele der Männer verstohlen zu Dorothea blickten. Die blonden Locken, die blauen Augen, die Stupsnase. Es war ein Puppengesicht, allerliebst. Dorothea hatte eine besondere Wirkung auf Männer, und Emma sah das mit großer Zufriedenheit, denn sie war es, die sich am meisten über Dorotheas Wandlung vom Trauerkloß zum kecken Fräulein Flensburg freute, da sie diese Veränderung hautnah miterlebt hatte. Ein Mensch konnte todtraurig sein, aber ein paar Tage später dasitzen und frivol lächeln. Dorothea wird immer einen Schlag bei den Männern haben, dachte Emma, sie war dieser Typ Frau. Hoffentlich geriet sie da drüben wirklich an einen netten Kerl.
Dass sie selbst neben Dorothea eher unsichtbar blieb, war Emma gewohnt, auch ihre Schwestern Erika und Bertha waren hübscher als sie, und Emma hatte früh begriffen, dass ihre Schönheit nicht das Pfund war, mit dem sie wuchern konnte. Dass ihr eines Auge manchmal schief stand, wenn sie müde war oder angestrengt, dass sie nicht so eine Wespentaille besaß wie Erika, die nicht nur in der Hinsicht Kaiserin Elisabeth von Österreich nacheiferte, hatte sie bisher nicht groß gestört. Und dass es nun Dorothea war, die zuerst aufgefordert wurde, gab Emma keinen großen Stich, sondern es fühlte sich vertraut an. Sie, Emma Johanna Callsen, war nie als eine der Ersten aufgefordert worden, und das Einzige, was sie daran wirklich störte, war die Tatsache, dass sie, die doch so gern tanzte, nun auf dem Stuhl sitzen bleiben musste, obwohl ihr ganzer Körper bereits im Takt wippte. Ihr blieb nichts übrig, als den anderen Paaren beim Tanzen zuzusehen, wie sie sich abmühten, mal mehr, mal weniger erfolgreich. Aber Dorothea tanzte gut und stellte ihren Körper zur Schau, die kleine gefallene Tochter des großen Flensburger Rumkönigs. Wie grausam, sein eigenes Kind in die Neue Welt zu verstoßen. Dorothea hatte alles verloren, Otto nichts. Emma empfand das als himmelschreiend ungerecht.
Ein »Darf ich bitten, gnädiges Fräulein« riss sie aus ihren Gedanken. Emma staunte nicht schlecht. Der da vor ihr stand, war ein Mann, der ihr bisher entgangen sein musste. Dunkelblond, gepflegte Erscheinung, adrett gekleidet. Ein netter Mann, schien ihr, ohne verschluckten Stock im Körper, vielleicht zehn Jahre älter als sie, mit einem kleinen Schnauzbart und atlantikblauen Augen, die neugierig in die Welt sahen. Sie nickte, erhob sich, und er führte sie auf die Tanzfläche, wo ihr Dorothea fröhlich zuwinkte. Emma lächelte ihren Tanzpartner an, er legte seinen Arm auf ihr Schulterblatt, und dann ging es los, und weil das kleine Orchester, als könnte es Emmas Sehnsüchte lesen, soeben einen Walzer angestimmt hatte, schwebte Emma am Arm dieses Fremden über das Parkett, dass es eine Freude war. Sie drehten und drehten sich, bis das Muster der Tapeten verschwamm und Emma vergaß, dass sie auf einem Schiff war, mitten auf dem Atlantik. Ihr war leicht schwindelig, aber es war nicht der Schwindel wie bei einer Seekrankheit, sondern der des Tanzes, sich vollkommen in der Musik und den Schritten zu verlieren, ja, zu vergessen, dass es einstudierte Schritte waren. Es gab nur noch eine gemeinsame Bewegung, man verschmolz zu einem Wesen und vergaß nicht nur die Schrittfolge, sondern auch sich selbst. Vorausgesetzt, der Tanzpartner stieg einem nicht auf die Füße. Beim Tanzen, das war Emma schon immer so ergangen, vergaß sie, wer sie war, was sie war und was sie nicht war. Vergaß ihren Namen, ihre Mängel, ihre Ängste, ihre Sorgen. Vergaß ihr Geschlecht, ihre Vergangenheit, ihre Herkunft. Beim Tanzen war Emma nur in diesem Moment, ganz der tanzende Körper in der Musik.
Sie war erstaunt, wie leicht ihr das Tanzen mit diesem Unbekannten fiel. Als wären sie sich schon mal begegnet, irgendwo, vielleicht in einem anderen Leben. Auch er sagte zwischendrin einmal, dass es sich ja ganz prächtig mit ihr tanze. Nach einem weiteren Walzer führte er sie zurück zu ihrem Platz, stellte sich als Christian Grohmann vor und dass sein Ziel Los Angeles sei, wo er bei einer Zeitung arbeiten werde. Emma erzählte ihm, dass sie nach San Francisco gehe und meinte, ihm eine leichte Enttäuschung anzusehen, als wäre ihre Bekanntschaft für ihn plötzlich nicht mehr interessant. Gerade kam Dorothea gerötet zurück von der Tanzfläche mit ihrem Begleiter, den sie gekonnt verabschiedete, ja, abfertigte auf eine Weise, dass er sie nicht noch einmal auffordern würde. Sie schien darin sehr geübt zu sein. Emma stellte Dorothea ihrem Tanzpartner vor und sagte, dass sie ebenfalls nach Los Angeles ginge wie er. Christian Grohmann schien erfreut, lächelte Dorothea unter seinem Schnauzbart an, und sie erwiderte das Lächeln.
»Erlauben Sie, dass ich Ihre Kabinengefährtin zum Tanz entführe?«, fragte Grohmann und lächelte beide Frauen charmant an. Emma nickte und wandte sich an Dorothea: »Herr Grohmann ist ein ausgesprochen guter Tänzer, du kannst dich freuen.« Dorothea riss die Augen noch etwas weiter auf und sagte keck: »Na, da bin ich aber gespannt!«
Die beiden entschwanden auf die Tanzfläche, und Emma beschloss, einen Moment frische Luft zu schnappen. Sie zog ihre Stola über und ging an Deck.
Nachts herrschte auf dem Schiff eine ganz andere Stimmung. Es war dunkel, nur hier und da brannte eine funzelige Petroleumlampe, und oben am Nachthimmel stand der Mond, halb voll. Emma hörte das Plätschern der Bugwelle und das Knarzen der Taue, alles viel deutlicher als tagsüber. Es waren gerade keine anderen Passagiere da, vom Vorderdeck hörte sie ein Schifferklavier und eine Mundharmonika Weisen spielen, die sehnsüchtig und nach Heimweh klangen, nach verlorener Heimat und Heimatlosigkeit. Sie und Bertha hatten früher bei der abendlichen gemeinsamen Hausmusik mit dem Vater die Lieder in Lieder des Himmels und der Erde unterteilt. Dies hier waren Lieder der Meere. Doch trotz aller Melancholie lag in den Melodien etwas Tröstendes und Kraftvolles, als könne man sich durch das Musizieren über den Zustand der Welt erheben, ihn selbst nicht verändern, aber seine Haltung dazu. Emma musste kurz an die Szene tagsüber denken, an das Brett und das kleine Segeltuchpaket und den verzweifelten Aufschrei der Mutter. Sie hatte Dorothea nach ihrer Rückkehr in die Kabine nichts davon erzählt, das hätte diese nur wieder an ihren eigenen Verlust erinnert.
So stand Emma an der Reling, allein, blickte auf den Mond, der ihr wie ein alter Bekannter vorkam, da sie ihn auch aus ihrem Zimmer in Schleswig nachts oft über den Kastanienbäumen gesehen hatte, die wie Wächter vor dem Haus standen. Emma sah auf die vielen Sterne, deren Namen sie nicht kannte. Es gab so vieles, was sie gern noch lernen würde. Aber immerhin, sie konnte gut schreiben und rechnen, hatte die letzten Wochen auch ihr Englisch aufpoliert. Sie konnte Klavier spielen, Handarbeiten und Karten spielen, sie hatte zeichnerisches Talent, sie hatte in den letzten Jahren bei ihrer Mutter Kochen gelernt, die einheimischen Gerichte, die Grundrezepte, alles, was eine Frau wissen musste, wenn sie in Stellung ging, als Gesellschafterin, oder wenn sie heiratete und einen Mann mit ihrem Essen beglücken sollte, sofern es keine Köchin gab oder wenn diese ihren freien Tag hatte. Zuhause hatte ihre Mutter meist gekocht, mit Gertraud als Küchenhilfe, die ihr vieles zuarbeitete und vorbereitete. Ihre Schwester Erika, die nie gern kochen mochte und es auch nicht besonders gut konnte, was sich zu bedingen schien, musste sich um derlei Dinge überhaupt nicht mehr kümmern, seit sie mit Alfred verheiratet war. An Personal mangelte es nicht. Emma dagegen hatte sich fürs Kochen interessiert, denn sie aß gern, und sie sah im gut Kochen mitnichten die Aufgabe, einen zukünftigen Ehemann zu beköstigen und glücklich zu machen, sondern vor allem sich selbst. Das hatte sie ihrer Mutter auch gleich bei den Lektionen in der Küche erklärt, und diese hatte ihr in die Wange gezwickt, schon das Höchste an Gefühlen bei ihr. »Gut, liebes Kind, dann lernen wir jetzt kochen, damit du für dich selbst immer gut kochen kannst.«
Emma hatte sich schnell für die schwierigen Dinge interessiert, den Brand- und Blätterteig und den Biskuit, für Pasteten. Und sie hatte sich gefreut, wenn ihre Kuchen und Torten, ihre Suppen und Aufläufe ihrer Familie geschmeckt hatten. Es war eine ehrliche Anerkennung. Und umgekehrt war es auch für sie selbst ein Zeichen aufrichtiger Liebe und Zuneigung, wenn sie für jemanden kochte. Sie konnte sich Hinrichsen zum Beispiel nicht als einen Menschen vorstellen, der genussvoll ein Essen zu sich nahm.
Dass der Landrat sie liebte, hatte Emma sowieso nicht geglaubt, sie kannten sich ja auch kaum. Er war vielleicht verzückt von ihrer Jugend, dem Frischen, dem noch etwas Ungebändigten. Emma war noch nicht verdörrt von endlosen Nachmittagen in Salons mit anderen Damen, von den Kaffeekränzchen, den Handarbeitszirkeln oder den Einladungen zu Hauskonzerten. Sie war noch nicht mürbe von den gesellschaftlichen Verpflichtungen, wie es sich gerade bei Erika anzudeuten schien, die nach zwei Geburten in vier Jahren und dem Führen ihres Haushaltes zu einer der ersten Damen der Stadt geworden war. Das hatte Erika viel ernster gemacht, strenger mit sich und anderen, und Emma hatte diese Wandlung ihrer großen Schwester in den letzten Jahren genau studiert, ja, sie hatte oft gedacht, dass ihr dasselbe blühte, wenn sie eine gute Partie machen und in die besseren Kreise hinein- und hinaufheiraten würde, ohne Zuneigung zu dem Mann, der diesen Schritt ermöglichte. Die Idee, sich der körperlichen Liebe ohne zärtliche Gefühle hinzugeben, erschien Emma vollkommen abwegig, ja auch gegen ein göttliches Gesetz zu verstoßen, die Schöpfung geradezu verhöhnend, und sie hatte es im Gesicht ihrer großen Schwester gesehen, wie schnell ein gewisser Glanz, der zu Beginn ihrer Ehe mit Alfred noch da gewesen war, aus Erikas Augen verschwunden und einer Abgeklärtheit gewichen war, die nicht unbedingt schöner machte.
Der Mond hatte eine gelb schimmernde Brücke auf dem Meer ausgelegt. Sonne, Mond und Sterne. Sie würden weiter ihre Bahnen ziehen, nach ihren ewigen Gesetzmäßigkeiten. Ihnen war es egal, ob sie, Emma Johanna Callsen, eine junge Frau aus dem Norden Deutschlands, aus einem Stück Land, in dem in den letzten Jahren je nach politischer Wetterlage mal die dänische, mal die preußische Flagge im Wind flatterte, ob eine Schleswiger Deern nun ihre Heimat verließ, in die Neue Welt aufbrach. Für Emma war es ein riesiger Schritt, sie veränderte die Koordinaten, die eigentlich für ein Mädchen ihres Standes vorgesehen waren. Sie war im Begriff, in ihr eigenes Schicksal einzugreifen, es zu gestalten, »herauszufordern«, würde ihre Mutter sagen. Doch hier an Bord taten alle das Gleiche. Emma war nicht allein, sie war Teil einer Bewegung. Viele andere machten es ebenso, gingen auf ein Schiff, fein sortiert nach gesellschaftlichen Klassen, und fuhren hinüber nach Amerika.
Emma wandte sich zum Gehen. Hinten an der Reling stand jetzt ein Paar, das gemeinsam aufs Meer schaute. Der Mann hatte seinen Arm um die Frau gelegt, und sie hatte ihren Kopf an seine Schulter geschmiegt, ein wunderschöner Scherenschnitt.
4.
Beruf Plaudertasche
San Francisco, 20. August 1872
Meine liebe Bertha,
ach, es war zu schön, heute Deinen Brief zu erhalten! Ich danke Dir, liebe Schwester, von Herzen. Habe mich amüsiert beim Lesen und sah Euch wahrhaftig vor mir, so gut hast Du alles beschrieben. Ich denke mir, dass Du, um mich zu schonen, auch einiges weggelassen hast, aber das musst Du in Zukunft nicht tun, wir wollen uns immer aufrichtig schreiben, wie es uns ergeht, und Du musst mir auch immer ehrlich schreiben, wie es der Familie geht. Wir wollen Freud und Leid teilen, und all die wichtigen Dinge dazwischen.
Ich schulde dir wenigstens noch kurz den Bericht meiner weiteren Reise mit einigen Wundern für ein Kind aus unseren Breitengraden. Je weiter wir südlich auf dem Atlantik kamen, desto öfter wurde das Schiff von Delfinen begleitet, die vor dem Bug aus dem Wasser sprangen und unter dem Schiff durchtauchten, dass es eine Freude war. Sie waren sogar schneller als das Schiff! Vor allem die Kinder an Bord kamen aus dem Staunen nicht heraus. Auch manch einer der fliegenden Fische landete an Deck als blinder Passagier. Nach der Ankunft in Panama schwankte das Festland unter den Füßen, es war, als ginge man auf einem Pudding. Im Hafen wurden wir Wankelmütigen regelrecht umlagert von der einheimischen Bevölkerung, die uns sehr geschäftstüchtig und kaum anders als die Marktfrauen oder Fischverkäufer bei uns zu Hause Apfelsinen, Bananen und Kokosnüsse anboten. Dorothea mit ihren blonden Locken wurde von ihnen angestarrt wie das siebte Weltwunder, und manche der Kinder begrapschten sie regelrecht, was sie ekelhaft fand und auch mit Flensburger Rumtochterflüchen vom Feinsten zum Ausdruck brachte. Sie ist im Kern nicht gerade eine Dame, sondern hat das Ordinäre, das ich auch an Bord bei manchen Geschäftsleuten beobachtet habe, meist ein Hinweis darauf, dass sie es zu schnell zu Geld gebracht haben und die innere Kultur dabei nicht ganz mithalten konnte.
Von der Hitze in Panama kannst Du Dir keine Vorstellung machen, es ist eine sumpfige Gegend, und es war unerträglich schwül. Wir waren heilfroh, als wir endlich im schattigen Zugabteil saßen und der Fahrtwind durch die Fenster zog, wenn auch ein heißer Wind. Und die Mücken überall! Wir hatten uns mit Schleiern und Tüchern über dem Strohhut so gut es ging verhüllt, sahen aus wie eine Reisegruppe von Imkern, doch die arme Dorothea wurde dennoch bös zerstochen, vor allem im Gesicht. Ich sah es als die gerechte Strafe Gottes dafür, dass sie die Kinder in Panama so beschimpft hatte. Unser neuer Reisefreund, ein Herr Grohmann aus Hannover, der in Los Angeles bei einer Zeitung arbeiten wird, machte sich Notizen in sein Büchlein, denn er wollte einen Bericht von seiner Überfahrt schreiben. Er war es auch, der uns immer wieder Dinge erklärte, zum Beispiel, dass beim Bau der Eisenbahnstrecke sehr viele Arbeiter gestorben seien und sie eine der teuersten Routen der Welt sei. Er wollte damit wohl vor allem Dorothea imponieren, die ihn aber nicht so recht erhören mochte. Er sei ihr, wie sie mir anvertraute, zu klug und studiert, neben ihm fühle sie sich dumm, sie bevorzuge starke Männer, zum Anlehnen, die sie beschützten, und dieser Grohmann habe was von einem Klookschieter. Und dann wollte sie von mir wissen, welchen Geschmack ich in Bezug auf Männer hätte, und ich wusste keine rechte Antwort auf diese Frage und kam mir vor wie ein dummes Mädchen, das bei einer Prüfung patzt.
Der Zug fuhr recht langsam durch Panama, sodass wir genügend Zeit zum Staunen hatten, und nach vier Stunden waren wir bereits auf der anderen Seite am Pazifik angelangt, wo wir auf ein weiteres Dampfschiff umstiegen.
Von der ruhigen Weiterfahrt nach San Francisco, die nur noch wenige Tage dauerte, gibt es nicht viel zu erzählen, außer, dass ich einmal einen Wal gesichtet habe! Stell Dir vor, ich stand an Deck, und plötzlich sah ich in vielleicht hundert Metern Entfernung eine Fontäne und ein großes schwarzes Tier aus dem Wasser stoßen und dann wieder verschwinden. Ich dachte erst, ich träume, aber dann war mir klar, dass ich den ersten Wal meines Lebens gesehen hatte und nun in einem Teil der Welt lebe, an dessen Küste es Wale gibt. Nicht die lütten Schweinswale wie bei uns oben, das Tier, das da aus dem Meer schoss, war bestimmt zehn Meter lang! Mindestens.
Seit vier Wochen bin ich nun hier in San Francisco bei Mrs. Thompson im Haus. Wenn die hier für den Sommer typischen Nebel mittags weggezogen sind, dann genießen wir die wärmenden Sonnenstrahlen und sitzen oft auf der Veranda draußen und trinken einen Eistee. Der Nebel ist hier manchmal so dicht, dass ich verstehe, dass die ersten Eroberer schlichtweg an der Bucht vorbeigesegelt sind. Mrs. Thompson ist Hamburgerin und vor dreiundzwanzig Jahren mit ihrem Mann ausgewandert. Jetzt ist sie Ende sechzig und sieht auch nicht einen Tag jünger aus. Sie hat Falten, nicht nur im Gesicht, auch in der Kleidung, sie trägt immer schwarz, wie es sich für eine Witwe gehört, aber ich habe nicht den Eindruck, dass sie ihren Mann wahnsinnig geliebt hätte, geschweige denn, dass sie ihn vermisst. Er ist jetzt fast zwei Jahre lang tot, manchmal sagt sie sogar »der alte Thompson, der Mistkerl« über ihn, dann ermahne ich sie scherzhaft, dass man so aber nicht über einen geliebten verstorbenen Gatten reden dürfe, und sie muss laut lachen. Dass sie Humor hat, ist natürlich schon mal ganz wunderbar, verhindert allerdings nicht, dass sie uns alle ganz schön herumscheucht, mich aber im Vergleich zu den anderen Bediensteten am wenigsten. Vielleicht ahnt sie, dass man eine Emma Johanna Callsen nicht den ganzen Tag herumkommandieren darf, weil diese dann ganz gnaddelig wird und keine gute Gesellschafterin mehr sein kann. Natürlich, sie bezahlt mich, und ich bin ihre Angestellte. Ihre Untergebene aber nicht! Eine Gesellschafterin muss meiner Meinung nach mit Respekt behandelt werden, wie ein Biskuit. Ich bin ja viel in ihrer Nähe, wir handarbeiten zusammen, spielen Karten, ich lese ihr vor, wir unterhalten uns. Sie hat einen wunderschönen Flügel, leicht verstimmt, und ich soll ihr des Öfteren vorspielen. Sie selbst kann nicht mehr spielen, weil sie Gichtfinger hat. Die Ärmste. Zum Glück schläft sie lange und geht früh zu Bett, das verkürzt meine Arbeitszeiten auf natürliche Weise, und ich komme auch noch dazu, selbst zu lesen oder mal einen Brief zu schreiben oder einfach nichts zu tun, auch wenn ich dann in Gedanken unsere Mutter höre, die ja jeden, der auch nur fünf Minuten nichts tut, als Faulpelz und Made im Speck bezeichnet. Hier in Amerika gibt es in dieser Hinsicht viel mehr Lockerheit, was mir gefällt. Man macht auch mal Pausen und trinkt eine selbst gemachte Limonade oder einen Tee und plaudert. »Small talk« nennen sie hier unseren Klönschnack, das beginnt mit der Frage nach dem Befinden (wobei niemand ernsthaft Auskunft über seine dunklen Seelenanteile gibt!), geht weiter in ein Geplauder über Krankheiten, das Wetter, die neuesten Nachrichten, immer wieder das Wetter oder noch besser das Reden über einen Wetterumschwung. Außerdem das Plaudern über Mahlzeiten, über die an dem Tag anstehenden oder die bereits verdauten oder über die noch in der folgenden Woche zu essenden (und zu verdauenden).
Ich habe inzwischen verstanden, dass es unhöflich oder indiskret wäre, direkt zu sagen: »Ich bin niedergeschlagen.« Lieber sagt man: »Heute ist es aber drückend«. Man spricht über den Blutdruck, Hochdruck- oder Tiefdruckgebiete, über Strick- und Stickmuster, und ich beginne, die Botschaften, die darunterliegen, allmählich immer besser zu verstehen. Es ist wie eine Fremdsprache, die eine Gesellschafterin zu lernen und zu beherrschen hat. Es geht bei den Gesprächen mit Mrs. Thompson viel um Essen und um das Zubereiten der Mahlzeiten, auch wenn wir damit nicht viel zu tun haben, denn das erledigt ja Rose, die Köchin, die gleichzeitig auch das Dienstmädchen ist und die Speisen aufträgt und abräumt. Rose ist der erste schwarze Mensch in meinem Leben, dem ich näherkomme. Mit ihr muss ich Englisch reden, aber ich verstehe ihren Dialekt oft nicht, und dann lachen wir über die Missverständnisse, die sich ergeben. Zu Beginn musste ich mich immer sehr zusammenreißen, Rose nicht anzustarren, denn über die Hautfarbe hinaus war ich auf der Suche nach weiteren Unterschieden. Stell dir einfach nur den Mocca vor, den Mama bei Gesellschaften reicht, genauso dunkel ist Rose. Einmal hat sie mich mit verschränkten Armen zurückangestarrt, um mir deutlich zu machen, wie sich das anfühlt, und ich habe mich richtig erschrocken. Da hat sie einen Lachanfall bekommen und zu mir gesagt: »You are a person without any colour!«
Tja, liebe Schwester, aus der Sicht der Schwarzen sind wir Bleichgesichter. Rose nannte meinen Teint mehlfarben, auch nicht gerade sehr charmant. Mrs. Thompson hat mich allerdings ermahnt, nachdem sie mich öfter in der Küche bei Rose sitzen sah, dass sich das nicht gehöre als ihre Gesellschafterin.
Der Ehemann von Rose, Jack, ist der Gärtner, Kutscher, macht die Einkäufe, die beiden bewohnen eine kleine Holzhütte am Ende des Riesengrundstücks und sind schon seit einigen Jahren bei Mrs. Thompson. Jack und Rose waren früher Sklaven auf einer Baumwollplantage irgendwo im Süden der Vereinigten Staaten, aber sie konnten fliehen und sind nach Kalifornien gekommen, wo Jack beim Bau der Eisenbahnstrecke mithalf, dann sind sie hier hängen geblieben. Jack hat die rührende Angewohnheit, im Garten mit den Pflanzen zu sprechen, als wäre er ein Prediger und sie seine Gemeinde, ich höre immer nur so Fetzen wie »Ja, deine Gebete haben genützt, und du hast endlich Blüten!« oder »Gott hat dich erhört, und du treibst endlich aus!«
Auch wenn Mrs. Thompson immer ausgesprochen nett zu Rose ist, so blickt sie doch auf sie herab aufgrund der Hautfarbe, sonst würde sie mich ja auch nicht ermahnen, den Umgang mit Rose nicht zu sehr auszuweiten. Freundlich ist sie, weil die gute Rose für unser leibliches Wohl sorgt und man sich immer gut stellen muss mit seiner Köchin, eine Weisheit, die mir Mrs. Thompson auch schon mit auf den Weg gegeben hat. Ich habe ihr daraufhin geantwortet, dass ich nicht wisse, ob ich es jemals dazu bringen werde, mir eine Köchin leisten zu können, aber dass das auch nicht tragisch sei, denn ich würde selbst gern kochen. Es war ein Fehler, das zu sagen, denn nun muss ich an den freien Tagen von Rose (sonntags) manchmal ran an den Herd und Mrs. Thompson nicht nur bekochen, sondern auch noch beweisen, dass ich eine gute Köchin bin. Aber es macht mir ja Freude, wie Du weißt, und ich habe sie und mich schon mit ein paar Gerichten aus Schleswig glücklich gemacht und neulich sogar Schnüsch gekocht.
Meine Arbeit als Gesellschafterin lässt sich also gut an. Das Haus ist groß, ein Holzhaus, das an allen Ecken knarzt und quietscht, bei jedem Schritt und bei jedem Windhauch und manchmal auch einfach nur so, ohne Grund. Ich glaube, Holz ist doch sehr lebendig als Baumaterial, und Du spürst das Außenklima immer durch die Wände, es kann ganz schön klamm und kühl werden. Ich habe mein Zimmer im ersten Stock, es gibt ein schlichtes Bett, einen Schreibtisch, einen Waschtisch, eine Kommode, schöne Gardinen und einen Blick auf den Garten, in dem wahnsinnig hochgewachsene Palmen stehen. Stell dir vor, Palmen sind hier überall! Überhaupt ist der Garten voller Kakteen, exotischer Pflanzen und bunter Papageien und Kolibris. Ich nenne den Papagei mit dem roten Kopf »Suffkopfpapagei« oder den blauen »Marinepapagei«. Neben Rose, Jack und mir gibt es noch eine Frau, die zum Putzen kommt, drei Tage die Woche, und die das ganze Haus im Griff hat, die Holzböden und die Teppiche, die Gardinen, die Fenster putzt, die hier witzigerweise von unten nach oben hochgeschoben werden, wenn man sie öffnet. Nur Staubwischen gehört zu meinen Aufgaben, und ich gehe durchs Haus mit einem edlen Wedel aus Pfauenfedern und staube alles ab wie der Teufel. Es ist eine schöne, schlichte Tätigkeit, bei der man herrlich nachdenken kann. Manchmal stelle ich mir vor, der Wedel wäre mein Zauberstab und ich eine Fee. Tja, was würde ich mir dann herbeizaubern? Einen reizenden Mann, der mit mir ein paar hübsche Kinder hat, um die sich wiederum eine herbeigezauberte, nicht allzu reizende Nanny reizend kümmert. Vier Kinder hätte ich gern, aber herbeigezaubert, ohne Geburt und Schmerzen, ein Zwillingspärchen könnte dabei sein. Vier Kinder, die ich immer schön ausstaffieren könnte, für die ich selbst nähen und stricken würde, damit sie adrett aussehen. Und meine Schwester Bertha würde ich mir auf das Kanapee zaubern, dazu einen großen Krug Limonade, und dann würden wir plaudern, bis der Abend kommt.
Das mit dem herbeigezauberten Mann ist übrigens in Wirklichkeit so: Mrs. Thompson veranstaltet alle halbe Jahr einen Tanztee und lädt unverheiratete Männer ein, die Brautschau halten, und sie lädt ledige Frauen ein, die ebenfalls auf der Suche sind. Sie ist wohl eine sehr bekannte Institution in San Francisco und Umgebung. Es sind meist deutschstämmige Personen, die wie die Thompsons bereits vor einiger Zeit ausgewandert sind, manchmal verirrt sich wohl auch ein Holländer, Schwede oder Däne darunter, wie sie mir sagte. Protestantisch sei die einzige Bedingung. Im Oktober ist der nächste Tanztee. »Aber nicht, dass Sie mir dann gleich heiraten und weggehen, Emma«, hat sie zu mir gesagt, und ich habe gelacht, denn ich kann mir momentan eigentlich noch gar nicht recht vorstellen, an der Seite eines Mannes einen Hausstand zu führen, Kinder zu erziehen und all das Gedöns. Ich finde es ganz schön, mich hier bei Mrs. Thompson an Amerika zu gewöhnen, mich einzuleben. Ich will meine Freiheit noch etwas genießen! Außerdem muss ich ja noch die Kosten für die Schiffspassage abarbeiten.