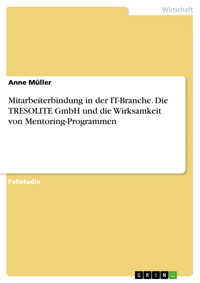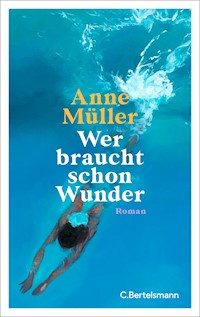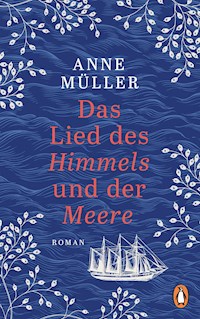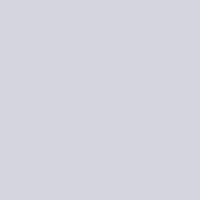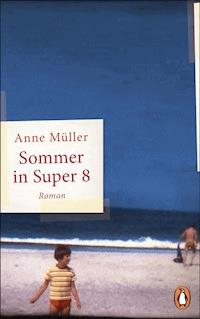
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
»Ein zärtlicher und kluger Familienroman.« flow
Schallerup, nahe der Ostsee, in den Siebzigerjahren. Hier wächst Clara mit vier Geschwistern in einer turbulenten Landarztfamilie auf. Der Vater, von seinen Patienten sehr geschätzt, hält die Ausflüge an den Strand und Geburtstage auf Super-8-Filmen fest. Dort wirkt alles perfekt. Doch je älter Clara wird, desto deutlicher spürt sie, wie dem geliebten Vater das Leben immer mehr entgleitet und sich unaufhaltsam eine Katastrophe anbahnt … Warmherzig, humorvoll und mit psychologischem Feingefühl erzählt Anne Müller von den Höhen und Tiefen des Erwachsenwerdens in der Provinz und lässt die 70er-Jahre wieder auferstehen.
»Wer in den 1970er Jahren jung war, wird dieses Buch lieben! Eine Familiengeschichte, die atmosphärisch fein gesponnen und dicht ist.« Wetzlarer Neue Zeitung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 335
Ähnliche
Schallerup, ein Dorf in Norddeutschland in den 70er-Jahren. Hier wächst Clara als mittleres von fünf Kindern in einer turbulenten Landarztfamilie auf, mit Ausflügen ans Meer, abendlicher Hausmusik und den aufregenden Vorführungen der neuesten Super-8-Filme. Die Mutter klug, hübsch und mit etwas mehr Chic als die anderen Dorffrauen, der Vater von seinen Patienten geschätzt, weltmännisch und witzig. Die Partys, zu denen die Königs einladen, sind legendär. Doch zunehmend erschüttern die Eskapaden des Vaters das Familienleben. Clara, die ihren Vater über alles liebt, macht sich große Sorgen. Eines Tages spitzt sich die Situation zu.
Mit feinem Humor erzählt Anne Müller von einer scheinbar perfekten Familie – und lässt zugleich die 70er-Jahre mit Tritop, Apfelshampoo und Super-8-Filmen wieder auferstehen.
Anne Müller wuchs in Schleswig-Holstein auf und lebt heute in Berlin. Nach dem Studium der Theater- und Literaturwissenschaften arbeitete sie als freie Radiojournalistin und wandte sich dann dem Drehbuchschreiben zu. Sommer in Super 8 ist ihr erster literarischer Roman.
Anne Müller
Sommer in Super 8
Roman
Für meine Mutter
»Strange, it is a huge nothing that we fear.«
Seamus Heaney
Teil I
Die Sehnsucht der Fische
Alles Wichtige in meinem Leben ist an einem Mittwoch passiert. Es war noch Mittwoch, spätabends, als ich geboren wurde, an einem Mittwoch bekam ich meinen ersten Kuss, wenn auch ganz anders als erwartet, und die Sache mit meinem Vater ist ebenfalls an einem Mittwoch passiert. Und mittwochs kam immer der Fischmann. Er fuhr mit seinem blaugrauen Lieferwagen über die Dörfer, klingelte mit einer Glocke, rief: »Der Fischmann ist da! Fiiiiische, frische Fiiiische!« Und wenn er vor unserem Haus anhielt, schnappte meine Mutter ihr Einkaufsnetz, das Portemonnaie und mich.
Am Mittwoch hatte ich schulfrei. Die anderen Tage lernte ich lesen, schreiben, gehorchen, stillsitzen, nicht in der Nase zu bohren, keine dummen Fragen zu stellen, nicht zu träumen, lernte Kopfrechnen, Lehrer berechnen. Aber am Mittwoch, dem schulfreien Tag, lernte ich am meisten.
Am Mittwoch aßen wir Fisch. Butt, Heringe, Makrelen, Dorsche lagen in den Holzkisten, im Eis. Tot, ganze Fische mit ihren Köpfen, von denen nur eine schuppige Hälfte mit einem Fischauge zu sehen war. Die eine Pupille fixierte einen Punkt im Nirgendwo, die andere starrte ins Eis. Das sah ich mir jeden Mittwoch an, während meine Mutter mit geübtem Blick die Holzkisten taxierte. Für sie war der Fisch die Nahrung, mit der sie uns sieben, vor allem meinen ewig hungrigen Vater, satt kriegen musste. Es gab, je nach Jahreszeit, Butt mit Béchamelkartoffeln oder Kartoffelsalat, gebratene Heringe, gekochten Dorsch mit Salzkartoffeln. Für meine Mutter war der Mittwoch Fischtag, für mich der Tag, an dem ich den Tod studierte.
Der Fischmann in seinem blaugrauen Kittel war klein und noch gar nicht alt. Ich mochte ihn, er war immer nett. Wenn er Schlachter gewesen wäre, hätte er mir eine Scheibe Jagdwurst oder ein Wiener Würstchen geschenkt. Aber als Fischmann hatte er nichts, was er mir geben konnte. So köderte er mich jedes Mal mit einem Lächeln, bei dem seine hellblauen Augen in einem Hefeteiggesicht blitzten. Es war ein gütiges Lächeln. Ich wollte daher nie diesen Moment am Mittwoch verpassen und lief immer mit meiner Mutter, dem Einkaufsnetz und dem Portemonnaie mit.
Gemeinsam mit den Nachbarinnen aus der Straße warteten wir vor der offen stehenden Lieferwagentür. Ich hätte die Fische stundenlang betrachten können. Ich hatte nämlich das Gefühl, dass sie noch gar nicht wirklich tot waren, sondern nachdachten, während sie auf dem Eis lagen. Ich war mir sicher, dass den Fischen in den Holzkisten zwischen den Eisstücken sehr kalt war und sie sich nach dem Meer zurücksehnten.
Frau Lassen von gegenüber und Frau Lorenzen drei Häuser weiter standen vor uns in der Schlange, so nah nebeneinander, dass sich ihre Kittelschürzen oben an den Schultern beinahe berührten, während sie sich gegenseitig etwas zuraunten. Ich musste diese Silhouette bewundern, die Farben und das Muster der Kittelschürzen, darunter die strammen Waden in dunklen Strumpfhosen. Frau Lassen hatte eine Laufmasche, und unter Frau Lorenzens Strumpfhosen dehnten sich Krampfadern aus. Ich hörte nur Fetzen ihres Gesprächs, und bei den interessanten Stellen sprachen sie etwas leiser, sodass ich sie nicht verstand.
»Haben Sie schon gehört?«
»Ach, nee, sieh mal einer an.«
»Sie soll ja zu ihm gesagt haben … und dann soll er …«
»Ohauehaueha, watn Aggewars!«
»Ich will ja nichts gesagt haben, aber …«
Ich stand da und musste mir selbst ausmalen, um was es ging, und platzte fast vor Neugier. Das Nichtgesagte, das Ausgelassene und Verborgene, das Geflüsterte war immer das Spannendste, das, was einen noch lange weiter beschäftigte. Sie soll ja … und dann soll er … ja was denn?
Manchmal flüsterten auch meine Eltern, meist wenn es um etwas Wichtiges, Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenke für uns Kinder ging, oder sie redeten auf Französisch und waren dann bass erstaunt, als ich, ohne Französisch zu können, sofort kapiert hatte, dass »bissiklett« Fahrrad bedeutete, denn tatsächlich sollten die Zwillinge Fahrräder geschenkt bekommen. Seitdem redeten meine Eltern Latein oder schickten mich aus dem Zimmer.
Meine Mutter tratschte nie mit am Fischwagen, die junge Frau Doktor im Twinset und den modischen Röcken aus Flensburg oder Kiel. Mama unterhielt sich gerade mit der Witwe von Papas Vorgänger. Frau Peters wohnte seit dem Tod ihres Mannes allein in der ersten Etage unseres Hauses, einer Jahrhundertvilla, die früher ihnen gehört und die sie samt Praxis an meine Eltern verkauft hatten. Jetzt stand auf dem Schild »Dr. med. Roman König – praktischer Arzt«. Auch Frau Peters war nicht wie die anderen Dorffrauen, viel eleganter und das feine Silberhaar hochgesteckt mit Kämmen aus Perlmutt. Sie erklärte gerade, dass sie an den Sud für den Dorsch noch ein Lorbeerblatt tat, und meine Mutter hörte ihr aufmerksam zu.
Wenn der Fischmann kam, dann stand gegenüber auch der Friseur Christiansen im hellblauen Kittel vor der Tür seines Salon Chic. Herr Christiansen rauchte und guckte rüber zu den Frauen, die den Fischmann umlagerten, die meisten waren seine Kundinnen. Vielleicht hoffte Christiansen, wenn er vor seinem Salon stand und rauchte und lächelte wie Cary Grant, dass die Kundinnen sich an ihn erinnerten, daran, dringend mal wieder zum Friseur zu müssen. Waschen, schneiden, föhnen. Dauerwelle. Farbe. Nur Christiansen war nicht Cary Grant mit seiner Knollennase und den großen Poren. Christiansen kaufte jedenfalls nie Fisch, überhaupt tauchte selten ein Mann in der Schlange vor dem Fischwagen auf. Der Fischmann war allein unter Frauen, manche hatten ihre kleinen Kinder am Rock- oder Schürzenzipfel hängen. Es herrschte eine besondere Art des Einverständnisses zwischen den Frauen und dem Fischmann, er brachte ihnen eine Herzlichkeit und Wertschätzung entgegen, wie sie es von ihren Ehemännern nicht gewohnt waren. Der Fischmann wusste viel über seine Kundinnen, oft, ohne mit ihnen über anderes als das Wetter und den Fisch geredet zu haben. Als blickte er tiefer, weiter, woanders hin, als sähe er den Schatten ums Herz. Er wusste, dass Frau Lorenzens Mann soff und sie schlug, er wusste um die Totgeburten von Frau Götze, die Verzweiflung Frau Lassens wegen ihres Sohnes, der schon wieder im Gefängnis saß, er wusste, dass der jüngste Sohn von Frau Peters sich im Alter von neun Jahren beim Klettern über einen Zaun die Leber aufgespießt hatte und dass meine Mutter alles andere als glücklich war in ihrer Ehe.
Auch ich fühlte mich vom Fischmann wahrgenommen, als spürte er, dass ich seine Fische eher philosophisch betrachtete. Der Fischmann selbst war vielleicht der größte Philosoph, der herumfuhr, getarnt mit einem blaugrauen Kittel und einer altmodischen Waage und kleinen Gewichten, die er auf die Waagschale legte mit einer Zartheit, die gar nicht zu einem Fischmann passen wollte, als läge er bei jeder Kundin ein anderes Seelengewicht auf die Waage. Auch das Bezahlen, das Entgegennehmen von Geld und Herausgeben von Wechselgeld aus seiner schwarzen Lederbörse wirkte bei ihm nicht geschäftsmännisch. Es passierte so nebenbei, während er mit allen sprach und für alle ein gutes, das hieß nichts anderes als ein passendes Wort fand. Als wenn er gar nicht wegen des Geldes unterwegs wäre, sondern den Fisch unter die Menschen bringen müsste. Wahrscheinlich wurde er nie gefragt, ob er Fischverkäufer sein wollte. Schon sein Großvater war zum Fischen rausgefahren und sein Vater, und nun hatten sie diesen Laden eröffnet, und er war zuständig für den Verkauf auf dem Land, fuhr über die Dörfer, den Lieferwagen voller Kisten mit Fisch und Eis.
Mit dem Fischmann kam mittwochs eine frische Brise ins Dorf. Er brachte die Hoffnung, die Güte, die Wertschätzung für die Frauen, für ihre Treue, jeden Mittwoch kam er, der fahrende Beweis dafür, dass es Jenseits des Dorfes noch etwas anderes gab, das große Meer, das alles miteinander verband, uns und die anderen, die Menschheit, das Leben.
Mittwochs war Fischtag. Ich folgte meiner Mutter in die Küche, wo sie ihren Verlobungs- und ihren Ehering abnahm und auf die Fensterbank legte, als müsste sie für das, was sie jetzt tat, ungebunden, frei sein. Ich schaute ihr gern dabei zu, wenn sie ganz selbstverständlich grausame Dinge tat, nur um uns zu ernähren. Mama hatte ihre weiße Schürze dabei an, ein Verlobungsgeschenk von meinem Vater. Mit dem scharfen Messer schlitzte sie die Fische an der Unterseite auf. Erst wenn meine Mutter die Fische ausnahm, alles aus ihnen herausriss, das Herz, die Nieren, Leber und Gedärme, erst dann war ich überzeugt, dass die Fische wirklich tot waren. Danach wusch Mama die Fische aus, trocknete sie auf Küchenkrepp, salzte sie, füllte die Heringe mit Dill. Jetzt rauchte sie im Wohnzimmer eine Zigarette, dann wurden die Fische in Mehl gewendet und in viel Butter gebraten. Manchmal bogen sich vor allem die Buttschwänze noch in der Pfanne nach oben, ein letzter Gruß aus dem Jenseits, und meine Mutter musste sie mit dem Pfannenwender wieder herunterdrücken. Und während sie die zwei abgelegten Ringe zurück auf den Finger schob, bat sie mich mit ihrer weichen, warmen Stimme, die erst gar keinen Widerspruch aufkommen ließ, den Tisch zu decken. Meine Mutter wurde nie laut. Wenn sie wütend war, dann schwieg sie wie ein Fisch.
Verkehrt herum
Am Abend meiner Geburt, einem Mittwoch, stand der Vollmond über dem Flensburger Sankt-Franziskus-Krankenhaus, dem einzigen katholischen Hospital weit und breit, in dem mein Vater in der Chirurgie als Medizinalpraktikant eine Stelle hatte. An diesem Oktoberabend war, so Papa, die Hölle los. Ein Schädelbasisbruch nach einer Schlägerei am Hafen, eine schlimm zugerichtete Frau, deren betrunkener Ehemann sie aber persönlich vorbeibrachte und die ganze Zeit beklagte, was er ihr angetan hatte, ein schwer Verwundeter nach einem Autounfall und auch auf der Geburtsstation, wie immer bei Vollmond, großer Andrang. Mein Vater assistierte dem Gynäkologen, wollte unbedingt bei der Geburt seines dritten Kindes dabei sein. Die Geschichte meiner Geburt war seine Geschichte, und er gab sie so oft und anschaulich zum Besten, dass ich das Gefühl hatte, bei meiner eigenen Geburt dabei gewesen zu sein.
Papa erzählte immer ganz stolz, dass es wegen der zahlreichen Geburten in jener Nacht für die Neugeborenen nicht genügend weiße Decken gab und ich, seine Tochter, als Einzige ein fliederfarbenes Handtuch bekam, und dass sein Chef ihm gratulierte zur »Königs Tochter«. Gerne hörte ich, dass ich gleich zu Beginn meines Lebens und trotz des geburtenstarken Abends etwas Besonderes gewesen sein soll, weniger gern die immer wieder von Papa, dem Entertainer, nie von Mama, zum Besten gegebene Geschichte meiner Steißgeburt. Ich hätte der Welt als Erstes meinen Hintern entgegengestreckt, die Anwesenden bekamen zunächst einen großen Schreck, da sie meinen Arsch für mein Angesicht hielten. An dieser Stelle übertrieb Papa, der Pointe zuliebe, den Schrecken stets etwas. Jedenfalls, so bekundete mein Vater es immer wieder, waren alle heilfroh, als endlich Arsch, Gesicht und Menschenkind, wenn auch in falscher Reihenfolge, heil heraus waren.
Nachdem ich kleiner Bundesbürger mich zu den anderen Menschen, die 1963 schon da waren, gesellt hatte, und während ich zu leben und gleichzeitig auch schon wieder zu sterben begann, packte mich Oberschwester Clementia an den Beinen, hielt meinen Kopf nach unten und schlug mir sehr geübt mit der Hand auf meinen nackten Po, und ich schrie in den Kreißsaal hinein. Papa nabelte mich ab und machte mir den »Bikinibauchnabel«, seine Spezialität und Erfindung, wie er immer stolz betonte. Ich schrie also, bis meine Mutter mich endlich auf den Arm nehmen dufte, und da war es gut, eingewickelt in ein fliederfarbenes Handtuch, dessen Farbe mir in diesem Moment vermutlich total schnurz war. Mama, die in der Wartezeit bis zu den Geburtswehen bei einer Krankenschwester die Zopfpatience erlernt hatte, hielt mich, fest und gleichzeitig liebevoll, wie nur Mütter es können – ich war ihr und Vaters Wunschkind. Die Dritte, bisher alle Kinder im gesitteten Abstand von drei Jahren.
Sie habe ihre ersten beiden Kinder im selben Jahr wie Jackie Kennedy bekommen, nur bei ihr war es zuerst ein Sohn und dann eine Tochter und bei den Kennedys umgekehrt. Dass auch John Kennedy und mein Vater etwas gemeinsam hatten, erwähnte Mama nicht, aber sie fühlte sich der modernen, stets modisch-eleganten First Lady der USA in ihrem Mutterschicksal und, wer weiß, vielleicht überhaupt in gewisser Weise verbunden.
Es gab da dieses eine Foto, schwarz-weiß, von Papa mit seiner Leica geschossen und wie alle seine Bilder in der Dunkelkammer von ihm selbst entwickelt. Mama hielt mich, wenige Wochen alt, im Arm und lächelte zärtlich und voller Mutterstolz, mein älterer Bruder, Sven, sechs, stand rechts von ihr, legte den Arm um sie und guckte ebenfalls ganz stolz und voller Liebe auf mich. Aber auf der linken Seite, da stand meine Schwester Irene, drei Jahre alt und alles andere als begeistert von meiner Ankunft, meinem Dasein und Dableiben. Und sie machte für das Foto keinen Hehl daraus, dass ich ihr zuwider war, zog eine Schnute, guckte mich missmutig an, streckte auf einem anderen Abzug desselben Motivs unserem Vater, dem Fotografen, sogar die Zunge heraus.
Papa sagte später manchmal zu mir: »Du warst die Einzige von euch fünfen, die geplant war.« Und Mama erzählte, dass sie, als sie Wochen später wieder schwanger wurde, obwohl sie mich noch stillte, erst mal natürlich nicht begeistert war. Sie und Papa dachten sich aber irgendwann: »Na gut, dann kriegt die Lütte noch einen Spielkameraden.«
Dass es ausgerechnet Zwillinge wurden, Hendrik und Claas, die nicht mal elf Monate nach mir das Licht der Welt erblickten, die einander als Spielgefährten haben und in Zukunft alles andere als auf mich angewiesen sein würden, das stand auf einem anderen Blatt. Jedenfalls geriet ich schneller als gedacht aus dem Status der Jüngsten zum mittleren von fünf Kindern.
Mein Vater, nicht katholisch, war beliebt im Krankenhaus. Die Patienten mochten seine freundliche Art, Frauen mochten Papas Charme, selbst die katholischen Nonnen, auch die ganz Spröden wie Oberschwester Clementia, konnte Papa bezaubern und schaffte es, in ihre schmalen, geraden Lippen eine Kurve zu bringen. Er hatte einen Schlag bei Frauen, anders konnte man es nicht sagen. Sein Chef mochte ihn, weil Papa wie er selbst Mozartliebhaber war, klug und sehr geschickt und sorgfältig, aber dennoch effizient arbeitete. Und die Kollegen? Die einen mieden ihn, weil sie befürchteten, ihre Karriere zu gefährden, denn mein Vater und ein paar der anderen Kollegen hatten viel Spaß in der Flensburger Klinik, machten öfter mal Streiche, und immer wieder erzählte Papa uns Kindern beim Abendbrot davon, und immer wieder wollten wir diese Geschichten hören, die vor unserer Zeit spielten und nach denen wir süchtig waren. Und vielleicht wollte Papa auch deswegen gern viele Kinder haben, um eine ständig aufmerksame Zuhörerschaft um sich zu scharen. Er erzählte von einem Volksschullehrer aus Wanderup, der nach dem Aufwachen aus der Narkose gefragt hatte, ob man seinen Blinddarm aufbewahrt habe und er ihn mitnehmen könne, um ihn seinen Schülern zu zeigen. Papa hatte geantwortet, natürlich, das ließe sich machen, und hatte dann im Garten des Krankenhauses mit einem Spaten nach einem Regenwurm gebuddelt, diesen schön abgespült, in ein Glas mit Spiritus getan, es lateinisch beschriftet und dem Lehrer ans Krankenbett gebracht. Der, so Papa grinsend, habe sich überschwänglich bedankt bei ihm und ganz erstaunt festgestellt, dass der menschliche Blinddarm dem Regenwurm doch verblüffend ähnlich sehe.
Oder als sie die Flensburger Möwen, die am Fenster des nahe der Förde liegenden Krankenhauses vorbeiflogen, gefüttert hatten. Mit in hochprozentigem Alkohol getränkten Brotstücken. Irgendwann fingen die Möwen an, sturzbesoffen, ja, fast torkelnd im Sturzflug zu fliegen, und auch ihre Schreie waren anders als sonst. Papa lachte, und wir Kinder lachten über die besoffenen Möwen, und wir wollten wissen, wie das genau aussah, wenn Möwen besoffen flogen, standen auf und machten es vor und fragten »War es so? Oder so?«, und unsere Mutter bat uns, uns zurück an den Abendbrottisch zu setzen.
Papas Leben war voll von diesen Jungenstreichen. So hatten sie als Gymnasiasten in Gelsenkirchen keine Kosten gescheut, um ihre Musiklehrerin zu ärgern, und Anfang Januar eine Anzeige mit deren Telefonnummer in die Zeitung gesetzt: »Kaufe gebrauchte Weihnachtsbäume!«
Auch Mama schmunzelte, wenn unser Vater davon erzählte, aber manchmal, so sagte sie später, hätte sie sich einen etwas reiferen Mann an ihrer Seite gewünscht, dabei war Papa neun Jahre älter als sie.
Unser Vater war nicht nur ein großes Kind, sondern auch der Gott von Schallerup, als er dort, kurz vor meiner Zeugung, eine Landarztpraxis übernahm von einem alten Arzt, der sich endlich zur Ruhe setzen wollte und händeringend einen Nachfolger suchte. Eigentlich hatte Papa immer von einer wissenschaftlichen Laufbahn geträumt, aber eine Existenz als praktischer Arzt schien angesichts seiner inzwischen kleinen Familie handfester, vernünftiger. Da Schallerup ein Kaff am Ende der Welt, fast in Dänemark war und das nächste Konzerthaus ziemlich weit entfernt, lockte der alte Dr. Peters Vater, indem er ihm sagte, dass er hier fantastisch verdienen könne und alle zu ihm aufschauen würden. Die Idee, sich endlich einen dicken Mercedes leisten zu können und darin über die Dörfer auf Patientenbesuch zu fahren, ein Gott zu sein in einem kleinen Dorf, eine alte Villa mit einer florierenden Praxis zu übernehmen, reizte unseren Vater. Und Mama stachelte ihn zusätzlich noch an, weil die Aussichten wesentlich rosiger waren, als wenn er ein schlecht bezahlter, angestellter Arzt geblieben wäre in einem Krankenhaus, in dem Papa keine Karriere machen konnte, weil er, wie er uns sagte, nicht katholisch war. Aber vielleicht war das auch nicht der einzige Grund, denn mein Vater, als Erzähler stets darum bemüht, selbst blendend dazustehen, sagte uns nicht immer die ganze Wahrheit. So auch bei der Geschichte vom Kennenlernen meiner Eltern, die ich am meisten liebte.
Der vergilbte Karton
Auf der Liegewiese des Freiburger Freibades fragte Papa Mama, nachdem sie ihm in der Mensa schon aufgefallen war, frech: »Junges Frollein, darf ich Ihnen den Rücken eincremen?« Mama dachte sich: Du unverschämter Kerl, und sagte, nur um ihn zu verblüffen, Ja. Papa, erst verdattert, dann erfreut, cremte ihr, ein kleiner Skandal 1956, den Rücken ein, und nun war Mama wiederum hin und weg von ihm und seinen Massagekünsten und diesen zärtlichen Händen und ahnte da noch nicht, dass dieselben Hände auch ganz anders zupacken konnten. Ebenso wenig wusste sie, dass dieser Roman König direkt von einer Prüfung in »topografischer Anatomie« kam und seine Hände in den Stunden zuvor eine Leiche seziert hatten. Allerdings hatten er und seine Kommilitonen den Leichenwärter geschmiert und sich die infrage kommende Leiche tags zuvor schon mal zeigen lassen. Sie waren bestens vorbereitet, und Papa konnte zur Freude seines Professors problemlos eine »Hufeisenniere« diagnostizieren.
Wir Kinder waren vertraut mit der Kennenlerngeschichte unserer Eltern, doch keiner kannte sie so gut wie ich. Und so wie mein Vater meine Geburt zu seiner Geschichte machte, so eignete ich mir die Geschichte des Aufeinandertreffens meiner Eltern, der Sportstudentin und dem Medizinstudenten, an. Ich stellte mir vor, wie sie gemeinsam schwimmen gingen, um sich abzukühlen in der Mittagshitze, und wie die Julisonne glitzernde Diamanten auf die Oberfläche des türkisfarbenen Wassers streute, und Mama und Papa schwammen um die Wette. So gern Papa die Geschichten erzählte, in denen er sich einen Jux mit anderen erlaubte und ihnen überlegen war, so ungern hörte er, dass unsere Mutter bei diesem Wettschwimmen die Schnellere gewesen war, knapp war es wohl, das musste sie zugeben, und unser Vater gab es gar nicht gern zu, nicht mal, dass er nur knapp verloren, überhaupt, dass er verloren hatte. Er erzählte die Geschichte immer so, als wenn ganz eindeutig er zuerst am Beckenrand gewesen wäre. Warum er der so viel jüngeren Sportstudentin, blond, blauäugig, ganz und gar nordisch einschließlich ihres Namens Freya, die sechzehn Stunden die Woche trainieren musste und in Volkstanz und Rudern bald staatlich geprüft sein würde, warum er, der Junge aus dem Ruhrpott, ihr, die aus einer kleinen Stadt in Norddeutschland kam, diesen Sieg nicht gönnte, war mir schleierhaft.
Nach dem Schwimmen trockneten sich meine zukünftigen Eltern ab und verabredeten sich an den Fahrrädern, und Mama, nicht nur schneller beim Schwimmen, sondern auch im Umziehen, was Papa durchaus zugab, war zuerst an ihrem Fahrrad. »Da hatte ich das Gefühl, jetzt kannst du vor deinem Schicksal noch davonfahren«, hatte sie Irene und mir mal anvertraut. Aber sie tat es nicht, und so nahm alles seinen Lauf.
In einem alten Pappkarton bewahrte mein Vater einen Teil seiner Fotos von früher auf, alle mit der Leica gemacht und selbst entwickelt. Da gab es aus dieser Freiburger Zeit auch ein Foto von Mama, damals noch eine freie Freya, zwanzig, modisch gekleidet in Steghosen und einem Pullover mit Fledermausärmeln, den kurzen, blonden Haaren, den blauen Augen, was man dem Schwarz-Weiß-Bild natürlich nicht ansah. Sie umfasste eine Säule und steckte ihren Kopf keck hervor und zeigte lächelnd etwas zu viel Zähne. Kann ich dir vertrauen?, schien der Blick zu sagen.
Unser Vater stand auf den nordischen Frauentyp. Er hatte, bevor er nach Freiburg zum Studium ging, jahrelang in Schweden gelebt und einem Professor in Uppsala bei wissenschaftlichen Laborversuchen mit Mäusen assistiert. Papa konnte fließend Schwedisch in Wort und Schrift, sogar Artikel für schwedische Zeitungen hatte er verfasst, seine Fotoalben aus der Zeit waren schwedisch beschriftet, so sehr war er dort angekommen und gewillt zu bleiben, für immer. Er wollte heimisch werden in diesem Land, das ihm Chancen bot und wo es nicht so trist war wie in Deutschland Mitte der 50er-Jahre. Doch sein Professor, ein Ungar, riet ihm, zurück nach Deutschland zu gehen und ein Studium zu absolvieren, dann könne er wiederkommen. In Schweden zu studieren, ging aus irgendwelchen Gründen nicht.
Meine Mutter schwärmte: »Euer Vater war dadurch, dass er erst im Krieg und danach in Schweden war, ein relativ alter Student und viel interessanter als die anderen und vor allem nicht so langweilig wie meine Lehramtskommilitonen. Und wenn er mit seinem schönen Bariton zur Gitarre schwedische Lieder von Bellmann sang, da war ich hin und weg.«
Außerdem sah Papa gut aus, war sportlich, trainiert, und dass ausgerechnet er sich für sie, die so viel jünger war und im Grunde noch nicht viel gesehen hatte von der Welt, interessierte, schmeichelte ihr vermutlich. Sie hatte zwar schon Gerüchte gehört über diesen Roman König, dass der selbst Schnaps brennen könne und ein Hallodri sei, dessen Freunde ihn mit Spitznamen »Pirsch« nannten. Mama war zudem von einer aus Ostfriesland stammenden Kommilitonin aus dem Studentenwohnheim gewarnt worden vor unserem potenziellen Vater, der sei ein schlimmer Weiberheld, aber Mama, in ihrer kleinstädtischen Unschuld, wie sie später zugab, behauptete: »Ach, das werden oft die besten Ehemänner, wenn sie sich erst mal ausgetobt haben.«
An Regentagen, von denen es in Schallerup sehr viele gab, holte ich mir manchmal aus dem Wohnzimmerschrank den vergilbten Karton mit den Fotos von Papa. Die meisten davon Bilder aus Schweden. Der Karton war voller Frauen, und nur von wenigen gab es mehrere Bilder. An diesen Nachmittagen, wenn der Regen fiel in einer Monotonie und Lässigkeit und man nicht wusste, ging das jetzt noch drei Tage oder drei Wochen lang so, sah ich mir in einem Zustand süßer Langeweile die Fotos an. All die fremden, so vertrauten Frauen, ihre gute Haut, ihre glatten oder gelockten, kurzen oder langen Haare, Bubiköpfe, Pagenschnitte. Sie trugen Schuhe mit Absatz und Mäntel, lächelten vor Straßenbahnen, an Brücken gelehnt ihr schwedisches Lächeln, hatten Handtaschen und Baskenmützen, deren Farben ich nur erraten konnte, und sahen alle sehr hübsch aus. Und ihre Lippen glänzten dunkelgrau. Ich war fasziniert, solche Frauen gab es in Schallerup nicht. Auf den Rückseiten hatte Papa die Fotos beschriftet, mit seiner geschwungenen Handschrift, »Uppsala, Uta, ’56« stand da oder »Doris, Uppsala, ’55«. Und ich fragte mich, was gewesen wäre, wenn er eine dieser Frauen geheiratet hätte und dort geblieben wäre in dem fernen Land. Dann hätte er Mama, die schwedischer aussah als so manche Schwedin, nicht in Freiburg getroffen, und sie wären nicht um die Wette geschwommen, und es gäbe weder Sven, Irene, noch mich und meine jüngeren Brüder auch nicht. Das Betrachten der Bilder war ein Kartenlegen in die Vergangenheit, und immer kam dabei heraus, dass es uns nicht gegeben hätte und dass ich jetzt nicht hier in Schallerup bei Regen, der jede Faulheit rechtfertigte, vor diesem Karton sitzen und die Fotografien betrachten würde, wenn mein Vater einer anderen aus dem Karton ein Kind gemacht und sie dann eben auch geheiratet hätte.
Zu Papas schwedischen Freundinnen gab es immer nur lustige und leichte Geschichten, so erzählte Papa oft grinsend von Greta, die ihm unbedingt einen Pyjama schneidern wollte, aber nicht nähen konnte. Jedenfalls sollte er sich auf den Stoff legen, und sie zeichnete seine Umrisse mit Nähkreide auf den Stoff. Nur hatte Papa die Arme leicht schräg neben dem Körper, und später bekam er bei dem Pyjama die Arme nicht hoch. Von den vielen Geschichten aus seinem Leben, die mein Vater so oft wiederholte, dass wir sie schon als unsere eigenen empfanden, mochte ich diese besonders gern. Und ich stellte mir diese Freundin vor, die ihm unbedingt einen Pyjama nähen wollte, der eine Zwangsjacke wurde, und Papa lachte noch lange über diese Nähaktion und auch wir Kinder, nur Mama nicht. Sie ignorierte auch den Fotokarton, tat so, als gäbe es ihn nicht, sie, die Meisterin im Drüber-hinweg-Gehen. Wenn ich den Zauberkarton wieder mal hervorgeholt hatte und die Fotos wie aufgedeckte Patiencekarten auf der Auslegware nebeneinander auslegte, war das eine Patience, die nie aufging. Bekam Mama es mit, hatte ich das Gefühl, dass sie mir mit ihrem sechsten Sinn an der Nasenspitze ansah, dass ich mir Papas Leben vor ihr vorstellte, sein Leben ohne sie, sein Vorleben, die anderen Frauen.
Wenn er von Schweden erzählte, strahlte unser Vater jedes Mal. Als wäre sein Leben dort unbeschwert gewesen. Als wäre er erst dort, weit weg von seinen Eltern und der Heimat, bei sich angekommen. Als hätte das Land seine guten Anlagen hervorgekitzelt. Als bräuchte er uns nicht zum Glücklichsein, ja, als wäre er dort, ohne uns, glücklicher gewesen.
Das Meer am Sonntag
Sonntagmorgen, ganz früh, weit und breit nur unser Peugeot auf der Strandkoppel. Wenn sich alle Autotüren gleichzeitig öffneten, dann kullerten wir sieben aus dem Inneren, Mama, Papa und wir Kinder. Meine Mutter war noch immer schlank, und man sah ihr die vielen Geburten innerhalb von sieben Jahren nicht an. Adrett sah sie aus im gestreiften rosafarbenen Leinenanzug von der Schneiderin. Sie trug ihre große Sonnenbrille, wie die abgebildeten Filmstars in den Zeitschriften im Praxiswartezimmer, und sie hatte ein Kopftuch umgebunden, als sei sie eine Frau von Welt, dabei hatte Mama ihre Heimat, die nun die unsere, aber nicht die unseres Vaters geworden war, nie verlassen. Nur für ihr kurzes Studium in Freiburg, das ja durch Sven im dritten Semester bereits wieder beendet wurde. »Ich bin aber noch staatlich geprüft in Volkstanz und Rudern«, sagte Mama oft mit diesem speziellen Grinsen, bei dem ihre blauen Augen leuchteten vor Schalk. Sven hatte Mama und Papa endgültig zusammengebracht, zusammengezwungen, oder wie sollte man es sagen? Sven hatte Fakten geschaffen, auf jeden Fall bedingte seine Existenz die unsere, die von Irene, mir, Hendrik und Claas. Man konnte vielleicht sogar so weit gehen zu behaupten, dass wir ohne Sven jetzt nicht zu siebt an den Strand gefahren wären, um eines jener Sonntagmorgenpicknicke zu machen, die gerade Sven so gar nicht leiden konnte. Jimi Hendrix, sein Idol, wäre vermutlich nie in aller Herrgottsfrühe zum Frühstücken an einen Strand mitgefahren. Ich mochte meinen großen Bruder, wenn er so verpennt war, wehrlos, mit offener Flanke, verletzlich und noch Schlaf zwischen seinen langen, dichten Wimpern, wenn seine Gliedmaßen schlaff an ihm herunterhingen.
Papa trug eine Lee und ein kurzärmeliges, weißes Hemd, sodass seine Schuppenflechte am Ellenbogen zu sehen war. Für mich gehörten die roten Stellen an der Haut und die weißen Schuppen, die immerzu von ihm rieselten, zu meinem Vater dazu, als wenn jeder Vater eine Schuppenflechte hätte. Er holte aus dem Kofferraum die große Korbtasche mit dem Proviant und den Windschutz heraus, wir Kinder griffen unsere Handtuchrollen, von unserem Vater darauf gedrillt, zu Hause schnell die Badesachen in ein Handtuch zu rollen, mehr durften wir nicht mitnehmen, höchstens noch einen Ball. T-Shirts und Shorts hatten wir an, und unsere Schuhe ließen wir alle im Auto. Jetzt gingen wir barfuß auf dem noch taufeuchten Boden den schmalen Weg Richtung Wasser, eine kleine Freizeit-Freiwilligen-Armee, die als erste den Strand eroberte. Dieser ganz besondere Duft nach Heckenrosen und Strandhafer, nach Gräsern und feuchtem Sand. Und dann lag es vor uns. Das Meer. Der Grund, warum wir uns zu siebt ins Auto gequetscht hatten und über zwanzig Kilometer gefahren waren.
Die Ostsee schien, wie mein großer Bruder, auch noch nicht richtig wach. Sie wirkte unentschieden, ob sie heute lieber blau oder grün sein wollte. Es war erstaunlich, wie viele Farben das Meer haben konnte. Manchmal wirkte es auch grau. Unser Windschutz dagegen knallte richtig. Orange, zur Freude der Marienkäfer, Gewitterfliegen und Rapskäfer. Als Erstes wurde immer der Windschutz aufgebaut, alle halfen mit. Mein Vater befeuchtete seinen Zeigefinger und hielt ihn in die Luft, bestimmte, aus welcher Richtung der Wind kam und wie der Windschutz aufgestellt werden musste. Die Metallstäbe wurden erst ineinander, dann in die Tunnelbahnen im Stoff geschoben, die Leinen befestigt und die Heringe mit Steinen in den Sand geschlagen. Und schon stand unsere Burg, die uns schützte, vor dem Süd-Ost-Wind, zu viel Sonne und vor Blicken.
Die Badesachen an, noch vor dem Frühstück das erste Bad, nur wir Kinder und Papa. Papa lief wie immer mit einem lauten »Jappadappaduh!« ins Wasser, stürzte sich dann freudig in die Fluten, als umarme er das Meer, das Leben. Mama saß im Sand auf einer Decke und schaute uns von ferne zu, dabei rauchte sie Lord Extra. Sie liebte die sonntäglichen Ausflüge, ließ uns jedes Mal im Auto noch auf sie warten, und dann endlich kam sie als Letzte, wohlduftend und mit Lippenstift stieg sie ein, und Papa, der ungeduldigste Mensch, sagte: »Das wurde aber auch mal Zeit«, und konnte doch nicht verbergen, wie stolz er war und wie schön er unsere Mama fand. Sie lehnte sich auf dem Beifahrersitz zurück, und noch während unser Vater den Wagen rückwärts aus der Einfahrt fuhr, rief sie diesen einen bestimmten Satz, ohne den ein Ausflug kein richtiger Ausflug war: »Ach, Kinners, ist das schön, dass wir losgekommen sind!«
Das Wasser war sonntags anders als sonst. Keiner konnte mir erzählen, dass die Ostsee nicht wusste, dass Sonntag war. Selbst der Militärhafen am Ende der Bucht wirkte heute verlassen. Wenn der Russe schlau war, dachte ich, dann kam er an einem Sonntag. »Lieber tot als rot!«, sagte Herr Boysen immer. Boysen war Bauer und Patient bei Papa, und wir besuchten ihn regelmäßig. Herr Boysen sagte auch nicht »die Russen«, sondern »der Russe« oder »der Iwan«.
Gemeinsam mit den anderen und doch allein schwamm ich hinaus Richtung Horizont. Vielleicht war meine Mutter beim ersten Schwimmen aber doch dabei, zum Schutz der Frisur die Badekappe mit den bunten Plastikblumen auf, die sie so alt machte und die wir alle deswegen nicht mochten. Mit der Badekappe sah sie aus wie eine, die es nie von hier oben weggeschafft hatte, höchstens ins nächste Kaff, und genau das sagte Mama ja selbst von sich: »Ich hätte mir doch niemals in meinem Leben träumen lassen, später mal ausgerechnet in Schallerup zu landen!« Unser Vater hasste die Badekappe besonders und machte immer einen abfälligen Kommentar, Mama sähe aus wie aus einem Krampfadergeschwader.
Ich fand meine drei Brüder schön, wenn sie nass waren, ihre Augen glänzten, umrahmt von nassen Wimpern, die Haare lagen zurück am Kopf, und sie hatten auf einmal eine Stirn. Meine Schwester schwamm schon sehr gut, und ich eiferte ihr nach, blieb aber, wie immer, etwas zurück und konnte die drei Jahre nie aufholen, was ich aber auch nicht schlimm fand.
Papas sonst weiße Schuppenflechte auf der Kopfhaut leuchtete im Wasser rot durch das Haar. Er kraulte Richtung Dänemark, und man sah seine Fersen abwechselnd wie helle Tennisbälle auf- und abtauchen. Ich hatte immer etwas Angst, dass er nicht mehr zurückkehrte. Jedenfalls ließ er uns Kinder zurück, und wir tauchten gegenseitig durch unsere geöffneten Beine hindurch und spielten, wer am weitesten tauchen konnte, bis uns kalt wurde und wir bibbernd an Land gingen. Und dann tauchte Papa wie Jonny Weissmüller aus den Fluten wieder auf und winkte uns, »Kommt, Kinder!«, und nun liefen wir fünf der Größe nach hinter ihm am Ufer her, ich den Blick auf die Waden meiner Schwester, ein kleiner Dauerlauf zum Trocknen über Kiesel und Sand. Und Sven, jetzt wach vom frischen Ostseewasser, lief voran und schien Jimi Hendrix ganz vergessen zu haben. Mama sah uns Strandläufern stolz hinterher, gleichzeitig glücklich, noch einen Moment für sich zu haben.
Nach dem kleinen Dauerlauf streiften wir die nassen Badesachen ab und die trockenen über, das war ein Gebot, nie durften wir die nassen Sachen anbehalten. Über den Bikini zog ich das so weiche T-Shirt aus Frottee an. Hungrig waren wir, und jetzt kam das Allerbeste: belegte Brote, hart gekochte Eier, Kaffee für meine Eltern aus der Thermoskanne. Dieser besondere Duft: Nach Salami, Graubrot, Kaffee und nach Süd-Ostwind roch es, nach der Sonnenmilch Delial, Faktor zwei, nach Strandhafer, dem Stoff des Windschutzes, ja, sogar leicht nach dem Dachboden, auf dem er überwintert hatte. Wer uns so sah, musste uns für eine glückliche Familie halten.
Nach dem Frühstück gingen wir Kinder am Strand entlang zum nördlichen Ende Richtung Mole. Die Mole ragte weit ins Meer hinein, setzte dem Strand ein abruptes Ende. Das Wasser hier hinten war flach und fast türkis, doch der Seetang am Ufer stank faulig in der Hitze. Auf den Felsen im Wasser kletterten wir entlang an der Mauer der Mole, darüber ein Nato-Stacheldrahtzaun, wie Papa uns einmal erklärte hatte. Es war ein anderer Stacheldraht als der an Koppeln, und ein Schild war daran angebracht: »Betreten und Fotografieren verboten!« Und immer versuchten wir, einen Blick nach drüben zum Militärhafen zu erhaschen, gaben uns gegenseitig eine Räuberleiter. Es lagen große graue Schiffe im Hafen, die uns im Ernstfall gegen den Russen verteidigen sollten. Seltsamerweise sahen wir aber nie jemanden da drüben im Marinehafen, als lägen die Boote nur zur Abschreckung da, Geisterschiffe, ohne Besatzung. Das konnte natürlich nicht sein, denn ab und zu fuhren die Schiffe raus auf die Ostsee, und wir sahen sie am Horizont. Vielleicht mussten sie einfach nur bewegt werden, oder sie sollten dem Russen zeigen, dass wir da waren und uns wehrten, wenn er angriff.
Beim Klettern bestaunten wir die besonders schönen Exemplare an Seesternen, die lila und rosa unter Wasser an den Felsen klebten, zwischen Algen, Seepocken und Muscheln. Ich fragte mich, ob Seesterne echte Tiere waren, Lebewesen mit einem Herzen, und wenn ja, wo das Herz der Seesterne saß.
An die Mauer der Mole hatten Liebespaare ihre Namen geschrieben und Herzen darum gemalt. »Michaela + Rüdiger« oder »Claudia + Ralf« stand da, mit Datum versehen, manche verblasst und eines ganz frisch. So gut wie wir Kinder alle die Mole und jeden ihrer Felsen kannten, genau wussten, von welchem Stein man am besten auf den nächsten sprang, so gut kannte ich die Liebespaare und bekam immer mit, wenn ein neues Paar dazugekommen war. Es schien mir ein Beweis für eine wirklich große, romantische Liebe zu sein, sich an einer Wand zu verewigen, und ich sehnte mich, obwohl erst sechs Jahre alt, schon jetzt nach genau so einer Liebe später. Vielleicht steigerte ich mich auch in diese Idee so hinein, weil meine Eltern in ihrem Umgang miteinander so gar nichts davon hatten. Sie hielten nie Händchen oder waren zärtlich zueinander vor unseren Augen. Meine Eltern hätten auch nie »Roman + Freya« irgendwo an eine Wand geschrieben und ein Herz drum herumgemalt und hatten es auch in Freiburg damals bestimmt nicht getan.
Die Felsen wurden in der Sonne immer heißer, und nun kehrten wir um und liefen zurück zum knallorangefarbenen Windschutz, der gut von Weitem zu erkennen war und den unsere Eltern vielleicht auch deshalb in dieser und keiner anderen Farbe gekauft hatten, damit wir immer zu ihnen zurückfanden.
Der Strand hatte sich inzwischen gefüllt. Bald würden wir wieder nach Hause fahren, müde vom frühen Aufstehen, von der Sonne, dem Meer. Der schönsten und sattesten Müdigkeit, die es gab. Noch Sand zwischen den Zehen und in den Haaren, Salz auf der Haut, quetschten wir uns alle wieder ins Auto, die Autotüren schlugen zu, und wir fuhren von der jetzt vollgeparkten Koppel, als wäre alles ein Super-8-Film, den man rückwärts laufen ließ.
Königs Tochter
Frau Paulsen in Dünewatt hatte Bluthochdruck und eine Kuckucksuhr mit Schwarzwaldmädchen, die sich im Kreis drehten, bei Bauer Boysen in Barneby mit seinem Diabetes roch es, sobald wir auf den Hof fuhren, ganz intensiv nach Schweinestall, und bei Frau Möller in Nörreby bekam ich immer eine kleine durchsichtige Plastiktüte, in die sie extra für mich mit ihren verbogenen Gichtfingern eine Naschkrammischung abgepackt hatte, und Papa musste ihren selbst gemachten Schlehenschnaps probieren.
Nach der Schule kam ich mit auf Patientenbesuch, das hatte ich aber auch schon früher gemacht, als ich noch kleiner war. Papa fuhr auf Praxis, zu denen, die nicht zu ihm in die Sprechstunde konnten. Zu den Alten und Gebrechlichen, zu den Bauern, zu denen ohne Auto oder die im Bett lagen und zu krank waren. Zweimal täglich, von Montag bis Freitag, machte mein Vater, der Landarzt, diese Touren über die Dörfer, und ich war oft dabei.
Es hatte damit angefangen, dass meine Mutter die Zwillinge füttern und hinlegen musste zur Mittagsstunde, und Papa nahm ihr mich dann ab. Dieses Ritual hatten wir beibehalten. Jetzt war ich sieben. Mein kurzes Haar so schwarz wie das meines Vaters, saß ich auf dem Beifahrersitz und genoss es, ihn ganz für mich zu haben. Wir fuhren über die schmalen und kurvigen Landstraßen, gesäumt von Knicks, dahinter die Felder, das leicht gewellte Land, als habe es jemand zusammengeschoben, um es lieblicher zu machen, in der Ferne das Meer, das man nicht sah, aber an bestimmten Tagen roch. Papa schien meine Begleitung zu gefallen. Die öden Äcker, die ewig kurvigen Straßen – war doch alles viel netter zu zweit. Wir unterhielten uns, sangen oder hörten Radio. NDR. Und regten uns gemeinsam auf, wenn die Sprecher in den Verkehrsnachrichten die Orte bei uns oben falsch aussprachen, Lindáunis statt Lindaunís sagten, was nur zeigte, wie weit weg die von uns und wir von Hamburg waren. Im Auto konnten wir auch Diagnosen besprechen, zum Beispiel fragte ich Papa, was denn Diabetes bedeutete. Er sagte, Boysen habe Zucker, doch ich verstand nicht, was das für eine Krankheit sein sollte, Zucker zu haben.