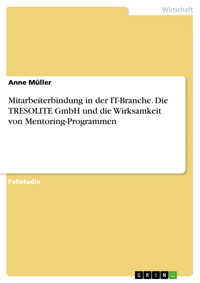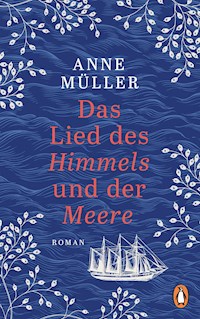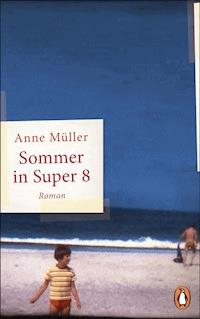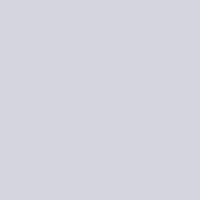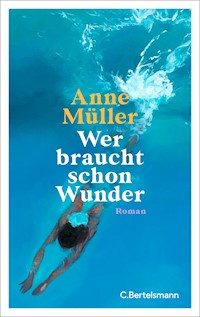
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Sommer 1983: Lika hat endlich das Abitur in der Tasche. Bevor sie die norddeutsche Heimatstadt Kappeln, ihren Vater und kleinen Bruder verlassen und in ein neues Leben eintauchen wird, fängt sie als Bedienung bei Fränki im Kakadu an. Kellnerin Biggi ist hier die gute Seele, auch wenn es privat alles andere als rund läuft bei ihr. Der Kakadu wird für Lika schnell zu einer Art Ersatzfamilie. Das liegt auch am französischen Koch, der sie mit seinem Charme und seinen Kochkünsten umwirbt. Ob Picknick beim Segeln oder nächtliches Schwimmen, durch Antoine entdeckt Lika in diesen sommersatten Wochen ganz neue Facetten der Liebe. Aber es wird auch ein Sommer der schmerzlichen Wahrheit, denn Lika erfährt etwas über ihre verstorbene Mutter, was sämtliche Gewissheiten erschüttert.
Warmherziger Humor und eine leise Melancholie – in ihrem unverwechselbaren Sound erzählt Anne Müller vom Weggehen und Aufbrechen und vom Erwachsenwerden. Vor dem einzigartigen Hintergrund der Schleilandschaft weckt die Autorin die frühen 80er Jahre zum Leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 262
Ähnliche
Das Buch
Sommer 1983: Lika hat endlich das Abitur in der Tasche. Bevor sie die norddeutsche Heimatstadt Kappeln, ihren Vater und kleinen Bruder verlassen und in ein neues Leben eintauchen wird, fängt sie als Bedienung bei Fränki im Kakadu an. Kellnerin Biggi ist hier die gute Seele, auch wenn es privat alles andere als rund läuft bei ihr. Der Kakadu wird für Lika schnell zu einer Art Ersatzfamilie. Das liegt auch am französischen Koch, der sie mit seinem Charme und seinen Kochkünsten umwirbt. Ob Picknick beim Segeln oder nächtliches Schwimmen, durch Antoine entdeckt Lika in diesen sommersatten Wochen ganz neue Facetten der Liebe. Aber es wird auch ein Sommer der schmerzlichen Wahrheit, denn Lika erfährt etwas über ihre verstorbene Mutter, was sämtliche Gewissheiten erschüttert.
Warmherziger Humor und eine leise Melancholie – in ihrem unverwechselbaren Sound erzählt Anne Müller vom Weggehen und Aufbrechen und vom Erwachsenwerden. Vor dem einzigartigen Hintergrund der Schleilandschaft erweckt die Autorin die frühen 80er-Jahre zum Leben.
Die Autorin
Anne Müller wuchs in Schleswig-Holstein auf und lebt heute in Berlin. Nach dem Studium der Theater- und Literaturwissenschaften arbeitete sie zunächst als Radiojournalistin, dann schrieb sie Komödiendrehbücher fürs Fernsehen. Ihre Romane »Sommer in Super 8«, »Zwei Wochen im Juni« und »Das Lied des Himmels und der Meere« begeisterten zahlreiche Leserinnen und Leser. In ihrem neuen Roman »Wer braucht schon Wunder« kehrt sie in ihre Heimat an Schlei und Ostsee und in die 80er-Jahre zurück. Sie erzählt vom letzten Sommer, bevor man das Elternhaus verlässt und ins Leben aufbricht.
Anne Müller
Wer braucht schon Wunder
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Das Mottozitat ist entnommen aus Rose Ausländer, »blaue Gedichte«, in: Gesammelte Werke in sieben Bänden. Hrsg. von Helmut Braun. (Bd. 4): Im Aschenregen die Spur deines Namens. Gedichte und Prosa © 1976, S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main
Copyright © 2023 C.Bertelsmann in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Favoritbuero
Umschlagabbildung: T.S. Harris, Taking the Plunge, 2017 (Ausschnitt) © T.S. Harris. All rights reserved 2022/Bridgeman Images
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-29650-6V001
www.cbertelsmann.de
Für die Jungs und Männer in meinem Leben, mit denen es nichts wurde.
Mehr noch aber für die, mit denen es was wurde.
»Mit meinem Blau male ich Sterne«
Rose Ausländer, Verwandelt
1. Der Kakadu
Fränki war mir nicht unbedingt sympathisch, als ich mich bei ihm vorstellte, aber ich ihm, und das war wichtiger, denn er war der Boss, und er sollte mich einstellen. Er sollte das Gefühl haben, dass ich genau die Richtige war, um den Kakadu als Aushilfe im Service mit zu schmeißen, denn es gab ja schon Biggi, die fest angestellt war und wie Fränki zum Inventar gehörte. Köche, Küchenhilfen und Aushilfen wechselten, aber Fränki und Biggi waren die Konstanten im Kakadu, seit er eröffnet hatte, wir wussten alle nicht mehr, wann das genau gewesen war. Inzwischen gehörte der Kakadu aber so zu unserer kleinen Stadt, dass ihn sich keiner mehr wegdenken konnte, und alles, was man sich nicht mehr wegdenken kann, ist im Grunde schon immer da gewesen.
Es war auch nicht so, dass Fränki die Kneipe von jemandem übernommen hatte; vorher war in dem Gebäude, an dem nun ganz selbstverständlich draußen ein breites, bunt bemaltes Holzschild mit der Aufschrift »Kakadu« hing, ich weiß nicht mehr was, gewesen, es war einfach ein großes, leer stehendes Haus mitten in der Stadt, nahe der Kirche und nicht weit vom Hafen. Ein Haus, das einer Erbengemeinschaft gehört hatte, die sich nach jahrelangem Streit irgendwann darauf einigte zu verkaufen. An Fränki, der auch nicht aus Kappeln stammte, sondern ein weit Zugereister war. Doch inzwischen zählte auch das nicht mehr. Wer eine der akzeptablen Kneipen am Ort besaß, die für manche zum zweiten Wohnzimmer geworden war, der brauchte keine Einbürgerungsurkunde. Fränki war Fränki, alle nannten ihn so, keiner von den Stammgästen sagte Frank oder siezte ihn, und das hätte er sich auch verbeten. Sein Nachname stand auf dem kleinen Klingelschild außen am Eingang des Kakadu. F. Hoffmann. Wenn man draufdrückte, klingelte es oben in seiner Wohnung. Eine Kneipe braucht keine Türklingel. Sie ist geöffnet oder geschlossen.
Fränki, immer im Jeanshemd mit schwarzer Lederweste drüber, spülte gerade Biergläser am Tresen. In dem Moment wusste ich noch nicht, dass das Abwaschen und Polieren der Gläser zu seinen Lieblingsbeschäftigungen gehörten, es schien ihn zu beruhigen, ihm eine innere Befriedigung zu geben, wenn sein Tresen blitzte. Hinter ihm standen die Spirituosen im Regal. Whisky, Rum, Liköre, Schnäpse. Die Vormittagssonne spiegelte sich in den vielen Gläsern und Flaschen, es sah aus wie eine Orgel aus Licht und Glas. Die alte Standuhr tickte, und alles wirkte so aufgeräumt und friedlich. Schwarzer Kaffee duftete zu mir rüber aus einem Becher mit Stones-Zunge.
»Und? Schon mal gekellnert?«, fragte Fränki mit seiner tiefen, sanft-kratzigen Raucherstimme.
»Nee.« Ich lächelte ihn an, um meine mangelnde Erfahrung wettzumachen. Ich wusste, dass ich mit meinem Lächeln schon viel im Leben erreicht hatte, und auch wenn ich nicht unbedingt stolz darauf war, mit solchen Tricks zu operieren, es klappte so gut, dass ich schön blöd gewesen wäre, mein Lächeln nicht einzusetzen.
Im Englischleistungskurs hatte ich zwei Mitschülerinnen gehabt, Sybille und Kerstin, die sich als Feministinnen bezeichneten. Für sie hieß das offenbar, auf keinen Fall mit einem BH, gewaschenen Haaren und einem Lächeln in die Schule zu kommen, als wäre das Verrat an der Sache. Ich verstand das nicht, denn man konnte beobachten, wie sie sich damit das Leben selbst schwer machten. Es war doch ganz leicht, mit einem Lächeln manche Herzen zu öffnen und zum Beispiel meinen etwas verklemmten Mathelehrer, Herrn Heitmeyer, davon zu überzeugen, dass eine Schülerin, die so intelligent lächelte, unmöglich eine Fünf im Zeugnis erhalten konnte, obwohl die Noten der Tests und Klausuren eher dafürsprachen. Heitmeyer trug immer so seltsam gestrickte Pullis mit misslungenen, puffärmelartigen Armkeulen, die ihm jegliche Autorität nahmen. Mich beschäftigte sehr, wer sie wohl gestrickt hatte und wem zuliebe er sie anzog und sich damit zum Affen machte.
Den Trick mit dem Lächeln hatte ich übrigens auch bei anderen beobachtet. Ich war bei Weitem nicht die Einzige, auch Jungs wandten ihn an, und dann klappte es für sie besonders gut bei den Referendarinnen, die sie damit um den Finger wickelten. Die eine, Fräulein Jäger, soll sogar mit einem meiner Mitschüler, Henning Hansen, eine Affäre gehabt haben. Zum Glück erfuhr ich das erst nach dem Abi bei einer der Feten, dass die Jäger Henning erlegt hatte. Ich hätte sie sonst in der mündlichen Prüfung, die sie mir in Bio abnahm, nicht ernst nehmen können und mich die ganze Zeit gefragt, wie der Lehrkörper wohl so im Bett war.
Fränkis Alter ließ sich schwer schätzen, und er verriet es niemandem. Irgendwo zwischen mittelalt und alt. Mit seinen blauen Augen und langen, lockigen Haaren, die ihm seitlich bis zu den Ohren und hinten bis zur Schulter reichten, wirkte er wie ein Rockmusiker. Er war meistens schlecht rasiert, und wenn er es dann doch mal tat, stand er mit einigen feinen Schnittwunden im Gesicht am Tresen, was dazu führte, dass ihm nicht wenige der männlichen Stammgäste Vorträge hielten, wie man sich richtig rasierte, und alle sich verwundert fragten, warum Fränki keinen elektrischen Rasierer besaß. Doch das lehnte er ab. Ein Elektrorasierer war gegen seine Ehre, denn Fränki hatte einen Hang zum Altmodischen und zu Antiquitäten.
Der Kakadu war entsprechend voller alter Möbel, überall zusammengekauft von Fränki bei alten Leuten, die die Nähmaschinentische, dunklen Anrichten, Holzstühle und Tische nicht mehr wollten, oder bei den Nachfahren der Alten, die die traurigen Möbel noch nie gemocht hatten und sich lieber mit dem jetzt angesagten hellen Holz einrichteten. Manche, sagte Fränki, hätten ihm die dunklen Möbel, auch die Standuhr, geschenkt und sogar geliefert, so erleichtert waren sie, sie endlich loszuwerden, als klebte an den Möbeln schwere Vergangenheit. »Mensch, Fränki, da hättest du doch vielleicht noch Kohle dafür verlangen können, Leuten diese Möbel abzunehmen«, ärgerte ihn die Mittwochs-Skatrunde. Fränki hatte mal stolz verkündet, dass ihn die gesamte Einrichtung des Kakadu nicht mehr als 500 Mark gekostet habe.
Es gab auch noch ein paar alte Sofas, deren Federung sich unter dem dunkelroten Samt hervorwölbte, aber für Frankis Lieblingsgäste, picklige Teenager im Stimmbruch, die zwei Stunden lang vor einer Cola herumhingen und ihn mit ihren hohen, albern giggelnden Stimmen nervten, waren die abgewetzten Sofas immer noch gut genug. Auch ich hatte hier auf den Samtsofas schon mit Freundinnen gesessen, KiBa oder Kakao getrunken und Probleme gewälzt. Meist ging es um Jungs, um unerreichbar Angeschwärmte (»er hat heute auf dem Schulhof zu mir rübergeguckt und gelächelt«), um Verflossene (»er hat mich heute nicht mal mehr gegrüßt und einfach weggeguckt«) oder um aktuelle Probleme an der Liebesfront. Es fühlte sich auf jeden Fall sehr erwachsen an, die Herzensangelegenheiten nicht mehr nur in der Pause auf dem Schulhof oder in unseren Mädchenzimmern zu bekakeln, sondern jetzt auch in einer Kneipe. Dabei hatte ich Fränki und Biggi schon erlebt, auch Aushilfen, meist Schülerinnen, wie sie sich mehr oder weniger gut schlugen.
An den gelben Wänden des Kakadu hingen vergrößerte, gerahmte Landschaftsaufnahmen von Fränki selbst, der sich immer auch ein bisschen als Künstler und Intellektueller gab. Doch daran, wie er die Ostsee, den Strand, die Schlei und ihre Ufer fotografiert hatte, erkannte man sofort, dass er nicht von hier war. Wir Einheimischen hätten nie solche Fotos gemacht. Schwer zu sagen, was es genau war. Fränki fotografierte zum Beispiel den blühenden Raps bei Sonnenschein, ein Beweis, dass bei uns ab und zu auch die Sonne schien, aber ehrlich gesagt hatte ich den kaltleuchtendgelben Raps viel öfter unter einem grauen oder bewölkten Himmel gesehen, was meiner Meinung nach auch viel besser aussah. Unser Himmel war selten strahlend blau, unterm Strich nur wenige Wochen im Jahr. Im Grunde genommen wählte Fränki mit seinem Blick von außen Motive für Apothekenkalender und Postkarten aus, und wenn unsere Gegend eines nicht war, dann ein Postkartenmotiv. Dafür gab es zu viel Wind, Regen und Wolken, war es zu rau.
Auf jeden Fall waren wir weit ab vom Schuss, am Ende der Welt, kurz vor Dänemark. Dass es nördlich von Hamburg noch ein bisschen deutsches Land gab, wussten viele ja gar nicht. Diese geografische Unwissenheit und Ignoranz bekamen wir Einheimischen immer schmerzlich zu spüren, sobald wir uns südlich von Hannover begaben. Wir waren einfach nicht existent. Terra incognita. Das unbekannte Land zwischen den zwei Meeren. Von dem das eine, von uns weit entfernte Meer die Nordsee war und das andere, nur ein paar Kilometer weg, die Ostsee. In der »Tagesschau« kamen wir so gut wie gar nicht vor, das letzte Mal bei der Schneekatastrophe 78/79. Angesagte Kinofilme, Moden oder Strömungen erreichten uns hier oben, wenn überhaupt, immer mit Verspätung. Mit verspäteter Verspätung sogar noch. Als meine Freundin Anja mit einem Foto von Kim Wilde zum »Salon Chic« in Kappeln ging, weil sie genau so einen Haarschnitt wollte, da grinste Friseur Kühn sie an. »Jo, min Deern, das ischa man auch bloß ’ne Föhnfrisur mit kurzen Haaren.« Damit beschämte er nicht nur Kim Wilde und Anja, sondern uns alle!
Für das Vorstellungsgespräch bei Fränki im Kakadu hatte ich extra meine langen Haare gewaschen, trug sie offen und hatte mir eine, wie meine Mutter gesagt hätte, »anständige« Bluse angezogen, weil ich den Ferienjob unbedingt haben wollte. Genau genommen hatte ich aber keine Ferien mehr, ich war fertig mit der Schule. Ein paar Jungs aus meinem Jahrgang hatten mit weißer Farbe für alle sichtbar »Abbi 83« zum Abschied auf die Betonkuppel unserer Schule gepinselt. Unser Direx hatte sich mächtig aufgeregt und gedroht, dass er dem Übeltäter das Abitur aberkennen würde. Die Schule lag am Wald und war noch ziemlich neu und sehr modern, ein doppelstöckiger Bau mit Flachdach, alles aus Beton mit farbigen Fensterrahmen. Ursprünglich war geplant, in der Kuppel eine Sternwarte einzubauen, doch dafür fehlte am Ende das Geld, und nun lagerten dort die Abiklausuren. Ich persönlich fand das mit dem Doppel-b genial, wer auch immer sich das ausgedacht hatte. Es ging das Gerücht, dass Henning Hansen, der Jäger-Erleger, Johann Kröger und Dirk Lubinski nachts, wohl nicht mehr ganz nüchtern, die Idee mit der Farbe auf der Kuppel hatten. Irgendjemand behauptete, dass sich Dirk an seinen Lehrern rächen wollte, weil er als Legastheniker wie ein Mensch zweiter Klasse behandelt worden war. Jedenfalls war ein Foto mit »Abbi 83« durch die Zeitungen gegangen, verbunden mit der fassungslosen Frage, ob die Abiturienten heutzutage denn gar nichts mehr lernen würden. Auf die Idee, dass das ironisch gemeint war, kam offensichtlich niemand.
Ich war also keine Schülerin der Klaus-Harms-Schule mehr und noch keine Studentin, ich war ein 19-jähriges Mädchen aus Kappeln, eine Abbiturientin, deren Tage in der Heimat gezählt waren. Im Oktober würde ich zum Studium der Theaterwissenschaften weggehen, aber bis dahin musste ich mir noch etwas Geld verdienen.
Fränki hatte einen Schluck Kaffee genommen und stellte den Becher wieder ab, die Stones-Zunge in meine Richtung.
»Gut, dann probieren wir es. Du kriegst 7 Mark die Stunde plus Trinkgeld«, sagte er im Ton der Lottofee Karin Tietze, als hätte er gerade die Gewinnzahlen verkündet und ich den Jackpot gewonnen. Ferienjob als Kellnerin bei ihm im Kakadu, den Sommer über dort arbeiten, wo andere Urlaub machten und während die meisten meiner Freundinnen gerade in den Ferien waren! Fränki hatte das »plus Trinkgeld« so betont, als würde er es persönlich als Prämie oben drauflegen. Dann zündete er sich eine seiner Roth-Händle an.
Mist, 7 Mark, das war wenig. Schlaksi hatte im Schliekrog 9 Mark 50 bekommen! Fränki war eindeutig ein Geizkragen. Wenn ich geraucht hätte, hätte ich mir jetzt auch eine angezündet, um zu zeigen, dass ich es mit ihm aufnahm. Stattdessen warf ich meine Haare zurück, fixierte ihn und sagte, nicht ohne zu lächeln:
»Okay, ich verstehe, weil ich keine Berufserfahrung habe. Aber nach einer Woche reden wir dann noch mal, ob es nicht auch 8 Mark sein könnten. Das kriegen alle, die ich kenne. Mindestens.«
Und Fränki widersprach mir nicht, vielleicht weil gerade der französische Koch aus der Küche nach vorn an den Tresen gekommen war, um sich eine Cola einzuschenken.
»Gut, dann morgen um zehn, und die Haare bitte hochbinden, ich will kein Haar von dir auf den Tellern sehen!«
»Alles klar, Fränki.«
Der Koch sah ziemlich gut aus, hatte aber mitten in seinem hübschen Gesicht eine ziemlich markante Nase. Er nickte mir zu und musterte mich mit seinen dunkelbraunen Augen von oben bis unten und wieder hoch, und ich hätte zu gern gewusst, was er dabei dachte, denn sein Blick flirrte. Der zweite Knopf seiner weißen Kochjacke war lose, keine Ahnung, warum mir das auffiel. Was man so hörte von all denen, die als Küchenhilfen gejobbt hatten, waren Köche kleine, cholerische Egomanen, die alle herumkommandierten und nur an Sex und Essen dachten. Aber der hier wirkte anders, für Höheres vorgesehen, und es war mir ein Rätsel, was diesen Typen in unsere kleine Stadt verschlagen hatte und warum er ausgerechnet Koch im Kakadu geworden war.
»Antoine, das ist Lika, sie fängt ab morgen bei uns an als Aushilfe im Service.«
»Salut«, sagte ich. Wozu hatte man sonst jahrelang einen Französischleistungskurs belegt?
Seit ein paar Wochen, so was sprach sich in Kappeln schnell herum, schmeckte das Essen im Kakadu um Klassen besser als zu Sabines Zeiten. Sie war vorher Köchin in einer Rehaklinik im Ostseebad Damp 2000 gewesen, und das war das Problem. Fränki hatte Sabine feuern müssen, seine Gäste wollten ein herzhaftes Bauernfrühstück, goldbraune Bratkartoffeln und Pommes, einen frisch gebratenen Hering, wenn Saison war, und sie wollten Wiener Schnitzel und Jägerschnitzel, aber nicht die salzarme, lasche Krankenhausvariante mit Sättigungbeilagen wie Erbsen und Möhren aus der Dose. Nicht für Herzkranke, sondern mit Herzblut sollte das Essen zubereitet sein.
Nachdem ich schon ein paar Tage gearbeitet hatte, bekam ich mit, dass die Kündigung Sabine so zugesetzt haben musste, dass sie, seitdem arbeitslos, sich ab und zu bei gutem Wetter gemeinsam mit ihrer Mutter auf die Terrasse des Kakadu setzte, um unbedingt die tollen Gerichte des neuen Kochs zu probieren. Beide waren dick, auf die unförmige Art, und schienen die Verkörperung des Begriffs Sättigungsbeilage. Sabine saß dann mit schmalen Lippen da wie ein Restaurantkritiker und gab hinterher Fränki ausführlich ihre Meinung zu dem Gericht wieder. Dass da vielleicht etwas zu viel Alkohol an der Jägerschnitzelsoße sei und man auf der Karte davor warnen müsse, für alle trockenen Alkoholiker, und es sei ziemlich viel Knoblauch an der Salatsoße. Oh ja, entgegnete Fränki genervt, da müsse man auf der Karte alle frisch Verliebten warnen! Fränki kriegte die Krise, wenn Sabine mit Muttern auftauchte, aber ihr schien es eine geradezu diebische Freude zu bereiten, sich auf diese Weise an ihrem ehemaligen Chef zu rächen.
Ich bekam zudem mit, dass Antoine sich nie ans Budget hielt. Für ihn begann gutes Essen beim Einkauf, deswegen gab es öfter mal Zoff zwischen ihm und Fränki. Antoine regte sich dann auf Französisch über die kulturlose deutsche Küche auf und dass er so nicht arbeiten könne. Biggi musste in dem Fall vermitteln, wie so oft, weil sie mit Menschen konnte wie niemand sonst. Wenn nachts nur noch ein paar verstreute Seelen stammelnd vor einem Getränk saßen, zu betrunken, um zu trinken, und es keine Umsätze mehr brachte, dann war es an Biggi, die Verbliebenen charmant nach draußen zu komplimentieren, darin war sie eine Wucht. Sie fasste manche Gäste unter wie jemanden, der einen gebrochenen Fuß hatte, und begleitete sie zur Tür, dabei hielt sie mit ihrer tiefen, rauchigen Stimme pädagogische Ansprachen. »Ja, auch die liebe Biggi muss mal Heia machen, denn morgen ist wieder ein Tag, und wenn du jetzt gleich im Bett liegst und schläfst, dann muss ich hier noch putzen und die Kasse machen, und ich werde noch lange nicht im Bett liegen und schlafen. Frühestens in zwei Stunden, alles klar?«
Biggi war es auch, die über den Kakadu eines Nachts zu Fränki und mir beim Absacker sagte: »Wir sind keine Kneipe, wir sind ein Fundbüro für verlorene Seelen.«
Biggi hieß eigentlich Birgit Lassen, war vierzig, klein, etwas drall, hatte zur Arbeit gern eine leicht durchsichtige und von daher nicht unbedingt anständige weiße Rüschenkragenbluse an, die den BH durchscheinen ließ. Den Kragen trug sie offen, sodass die Rüschen sich nicht am Hals aufstellten, sondern auf Biggis Schultern lagen und vorne etwas Dekolletee zu sehen war und ein Goldkettchen mit einem Widder daran, ihrem Sternzeichen. Ihre dunklen dauergewellten Haare reichten ihr bis zur Schulter, und man wünschte den Haaren dringend mal eine Kur, eine Pause zur Erholung von all der Chemie, sie wirkten ganz ausgelaugt. Biggis fahle Haut konnte auch eine Schicht Puder im Gesicht nicht verdecken, sie sagte mal zu mir: »Beneidenswert, wie rosig deine Haut ist.«
Mit Highlighter und hellblauem Lidschatten betonte Biggi ihre wunderschönen grünblauen Augen. Es war aber vor allem ihr Blick, der einen für sie einnahm. Hellwach, mitfühlend, Biggi war jemand, der anderen mitten ins Herz sah.
»Ich mochte deine Mama sehr, sie war eine ganz tolle Frau«, sagte sie eines Nachmittags zu mir, als nicht viel los war. Sie hielt kurz inne, als fiele ihr etwas ein, dabei zog sie an ihrer Ernte 23 und stieß dann lediglich einen Rauchkringel aus, nicht den Gedanken. Biggi war mit Mama ein paar Jahre vormittags im selben Gymnastikkurs bei Renate gewesen, und Mama wiederum hatte nicht selten von der Gymnastik einen neuen Witz von Biggi mitgebracht, den diese in der Umkleide erzählt hatte.
»Und meist war sie so strahlend«, fügte Biggi nachdenklich hinzu.
Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass die liebe Biggi noch etwas zu meiner Mutter sagen wollte, es sich dann aber anders überlegte. Sie war auch damals zur Beerdigung gekommen. Nicht, dass ich sie da gesehen hätte, aber sie sagte es mir.
»War schlimm, für alle. Ich weiß noch, dass ich beim Trauergottesdienst auf den Gekreuzigten rechts an der Wand sah und dachte: ›Tja, so viele traurige Menschen hast du hier in der Kirche auch noch nie gesehen, was Jesus?‹ Ach, Schätzchen, hätte dieser Milchlaster nicht einen Gerichtsvollzieher auf dem Weg zur Arbeit erwischen können? Das Leben ist so ungerecht, Lika! Und der Tod erst recht.«
Biggi tätschelte dabei meinen Unterarm, und selten empfand ich die Berührung eines anderen Menschen so wahrhaftig und dadurch tröstlich.
Nach dem Tod meiner Mutter hatte ich gemerkt, dass die meisten dazu einfach nichts zu sagen wussten. Monatelang konnte ich nach dem Unfall studieren, wie wir gemieden wurden, weil viele einfach keine Ahnung hatten, was man in so einem Fall sagt oder tut. Ganz ehrlich? Nichts sagen, gemeinsam ein bisschen schweigen war völlig in Ordnung. Die Straßenseite wechseln nicht. Oder so was sagen wie: »Das Leben geht weiter.« Kein Satz war so banal und falsch zugleich, denn das Leben ging für uns nicht weiter. Das Leben hatte mittendrin gestoppt, und Papa, Lars und ich waren in unserem Schock wie ein angehaltenes Bild im Videorecorder. Wer zu Trauernden »Das Leben geht weiter« sagt, der hat wirklich nichts, aber auch rein gar nichts verstanden.
»Wie alt ist dein kleiner Bruder jetzt?«, fragte Biggi.
»Lars ist neun.«
»Und? Wie hat er das Ganze so verkraftet?«
»Geht so.«
»Wär’ schön, dein Vadder findet vielleicht noch mal ’ne Frau, schon für den Jungen«, sagte Biggi und machte die Zigarette im Aschenbecher aus.
Ich selbst hatte auch schon daran gedacht und mich umgeguckt, war aber bisher in Kappeln noch nicht fündig geworden. Keine reichte an Mama heran.
Auch wenn Fränki der Besitzer des Kakadu war, Biggi war die Seele. Selbst wenn der Laden brummte, hatte sie immer noch ein nettes Wort für die Gäste, während sie an den Tischen Nachschub lieferte oder leere Gläser abräumte. Sie kannte die meisten, und auch für die, die sie nicht kannte, hatte sie einen Spruch parat. Alle mochten Biggi. Und Fränki war klar, dass sie für seinen Laden Gold wert war. Nur wenn Leute schnöselig und unfreundlich waren oder die Bierdeckel schredderten, konnte sie durchaus eine klare Ansage machen. Mich hatte sie auch schon mal freundlich ermahnt, als ich noch Gast war und vor lauter Wut auf Henner, von dem ich Anke gerade erzählte, einen Bierdeckel zerfetzte. Biggi schien nicht zu wissen, wie gut es tat, Pappe in kleine Stücke zu reißen.
Wenn es sich ergab, hörte ich Biggi gern zu, wie sie mit den Stammgästen sprach, die ihr alles Mögliche anvertrauten. Sie knüpften einfach da an, wo sie beim letzten Mal aufgehört hatten, wie alte Bekannte.
»Na, Peter, hast du inzwischen mal mit deinen Eltern geredet?«
»Oh, ne du. Das verkraften die nicht.«
»Wer weiß, vielleicht reagieren sie ganz anders, als du befürchtest.«
»Biggi, ich kenn meine Eltern und die Leute hier. Kein Mensch hat dafür Verständnis, die finden so was einfach nur pervers. Ich nehm noch ein Bier. Sag mal, hat Rost-Robert deinen Auspuff repariert?«
»Ja, hat er, für einen echt netten Preis.«
Biggi strahlte. Rost-Robert hieß eigentlich Robert Sörensen und reparierte schwarz Autos in seiner Scheune bei Loit. Alle, die wenig Geld hatten, gingen zu ihm.
Ich fragte mich, was das war, das Peter seinen Eltern nicht sagen konnte. Der Tresen hatte bei manchen die Funktion eines Beichtstuhls, die Schweigepflicht im Preis der Getränke inbegriffen. Es war offensichtlich, dass Alkohol die Zungen löste, manche laberten vor sich hin, egal ob ihnen jemand zuhörte, andere wurden aggressiv und legten sich mit allen an, wieder andere beschimpften Abwesende, die, wie sich manchmal herausstellte, schon lange auf dem Friedhof von Kappeln lagen, und manche wurden sehr vertrauensselig.
Fränki sagte einfach nur ab und zu »aha« oder machte »hmm«, das reichte den meisten als Ausdruck von Mitgefühl, während sie ihm Teile ihrer Lebensgeschichte erzählten. Was hatte sich dieser alte Tresen wohl schon alles anhören müssen? Mir fiel auf, dass sie viel von gescheiterten Ehen oder Beziehungen, fehlgeschlagenen beruflichen Unternehmungen redeten, von verpassten Gelegenheiten, den Momenten im Leben, in denen sie falsch abgebogen waren. Es ging immer wieder um Geld, um Liebe und um Streit in den Familien. Viel Wiederholung war dabei, mit kleinen Varianten, auch Widersprüche, und Fränki ließ es sich nicht nehmen, gelegentlich darauf hinzuweisen, vielleicht um zu zeigen, dass er sehr wohl zuhörte.
»Ulli, letztes Mal hast du noch gesagt, dass du sie wirklich geliebt hast, jetzt ist sie auf einmal eine Schlampe!«
»Ja, Fränki, ich habe sie auch wirklich geliebt, die Schlampe!«
Nach zwei Wochen im Kakadu vertrat ich an einem frühen Dienstagabend Fränki das erste Mal am Tresen, und Peter saß mir auf einem Barhocker gegenüber, nur die Theke zwischen uns. Peter war stämmig und hatte sehr muskulöse Arme. Ich schätzte ihn auf Mitte dreißig. Er arbeitete im Straßenbau, und ich hatte mal gesehen, wie er den heißen Asphalt in der Gartenstraße glatt strich. Nach der Arbeit ging er zu Hause duschen und kam dann nach Shampoo duftend fast täglich gegen sechs in den Kakadu, immer an den Tresen. Der Kakadu war sein Wohnzimmer, offensichtlich fühlte er sich zu Hause nicht wohl. Er war Junggeselle und wohnte noch bei seinen Eltern, in einer Kellerwohnung. Das hatte Biggi mir mal erzählt. »Er muss keine Miete zahlen, und so lässt er seinen Lohn dann eben hier bei uns, der liebe Peter.« Er trug eine Vokuhila-Miniplidauerwelle und kam nie ohne seine Herrenhandtasche, die er vor sich auf den Tresen legte. Da waren seine Kippen drin, sein Portemonnaie und ein spezieller Kamm für seine Dauerwelle, eine Art Miniaturmistforke, die er immer wieder hervorzog und sich damit geradezu fröhlich durch seine Mähne fuhr, als liebte er Kämmen.
Peter guckte auf meine Haare, die ich mir für den Kakadu seitlich mit Klammern hochsteckte und hinten offenließ.
»Was für tolle Locken du hast. Ist das Natur?«
Ich nickte.
Peter sah mich an, aber es hatte nichts von dem sonstigen Angegucktwerden, es war ganz anders. Wehmut lag in seinem Blick, als beneidete er mich um etwas, das über meine Locken hinausging. Er saß vor seinem dritten Bier mit Schnaps, und ich war völlig überfordert, als ihm Tränen in die Augen traten. Zum Glück war gerade sonst niemand an der Bar. Gegen tropfendes Bier half die Papiermanschette, aber bei Tränen der Gäste wurde es schwieriger. Peter kramte schnell ein Stofftaschentuch aus seiner Hosentasche, verschämt wischte er sich seine Tränen weg.
»Du bist so schön, und du hast das Leben noch vor dir«, sagte er.
Ich lächelte, wie immer, wenn ich verlegen war; dass ein Kraftprotz von einem Mann so weich wurde, irritierte mich zutiefst.
»Ich wünschte, ich könnte noch mal ganz von vorn anfangen, am besten im Mutterleib«, fuhr er fort.
Ich hatte keine Ahnung, was ich darauf sagen sollte. Peter wirkte auf einmal so tieftraurig und im wahrsten Sinne untröstlich. Zum Glück kam Biggi gerade und stellte ein Tablett mit leeren Gläsern vor mir auf dem Tresen ab.
»Sieben Flens, bitte!«
Ich begann mit dem Zapfen. Ich liebte es. Leider kam ich viel zu selten dazu, der Tresen war ja Fränkis Revier. Während ich das Bierglas leicht schräg hielt, ließ ich den ersten Schwung aus dem Fass hineinlaufen.
Biggi zündete sich eine von ihren Zigaretten an, die immer am Tresen lagen.
»Na, Peter, heute schlecht drauf?«
Er nickte, und sie legte den Arm um seine Schultern und zog ihn etwas an sich.
»Ja, dieser ewige Sonnenschein und die Dallas-Sommerpause schlägt uns allen aufs Gemüt«, frotzelte sie. Normalerweise hatte Biggi dienstags immer ihren freien Abend, denn der Dienstag war heilig. Gemeinsam mit ein paar Freunden guckte sie Dallas. Sie machten dann eine Flasche Whisky auf und immer, wenn JR sich einen einschenkte, tranken sie auch einen. Ich hatte schon von diesen Dallas-Partys gehört, hielt sie aber für eine Legende, bis ich Biggi kennenlernte. Es beschäftigte sie stark, was bei den Ewings auf der Ranch wieder passiert war, und sie tauschte sich am Mittwoch immer mit anderen darüber aus, auch gern mit Peter, der die Folgen nie verpasste.
»Ich vermisse Pamela«, sagte Peter zu Biggi und dann an mich gewandt: »So, ich soll mal sehen und zahlen meinen Deckel.«
Er gab mir großzügige 2 Mark Trinkgeld.
Wenn nichts mehr los war, schickte Fränki mich um neun Uhr nach Hause, aber wenn der Laden brummte, vor allem am Freitag- und Samstagabend, musste ich natürlich auch bis zum Schluss bleiben. Gegen halb zwei, zwei wurden alle rausgeschmissen, und nachdem Fränki hinter dem letzten Gast die Tür abgeschlossen hatte, passierte etwas Wunderbares. Der Kakadu gehörte nun uns. Fränki, Biggi und mir. Die Aufräumkassette wurde eingeworfen, zuerst kam »Copacabana«.
Her name was Lola, she was a showgirl
With yellow feathers in her hair
Fränki drehte auf, und ich stellte amüsiert fest, dass Biggi und Fränki an der Stelle »at the copa, copacabana« immer laut »at the Kakadu, Kappeln-cabana, the hottest spot north of Havana« sangen. Sie quetschten den Kakadu auf das zweisilbige Copa, in dem sie die erste Silbe betonten, und ich machte schon bald mit, und es war, als hätte Barry Manilow es nie anders gesungen. Wir stellten die Stühle hoch auf die zuvor abgewischten Tische, leerten die Aschenbecher und spülten sie alle ab, Fränki wusch die restlichen Gläser und trocknete sie sorgfältig ab. Wir fegten den Boden und wischten ihn, Fränki polierte Zapfmaschine und Spüle. Wir sangen laut mit, auch bei den folgenden Liedern aus der »Rocky Horror Picture Show« oder von Queen »We are the Champions«. Es kam mir dann selbst verrückt vor, dass ich mitten in der Stadt, in der ich aufgewachsen war, mitten in der Nacht, nahe der Kirche und des Hafens, mit diesen beiden Menschen, die ich Wochen zuvor nur vom Sehen gekannt hatte, jetzt wie eine kleine verschworene Gemeinschaft eine Aufräumparty feierte.
Nichts verband uns drei so sehr wie diese nächtlichen Putzaktionen. Jeder hatte in der Choreografie seinen Part. Wenn die Kassette mal eierte und es einen Bandsalat gab, dann war es Biggi, die an die Stereoanlage ging, die Kassette vorsichtig herausholte und mit einem Bleistift und einem »So, dann wollen wir mal sehen und kriegen das in Ordnung!« wieder aufspulte. Sie machte das mit einer so fingerfertigen Routine, dass ich sie im Spaß »Professor Dr. Lassen« nannte, worauf sie entgegnete: »Wenn man nur den Bandsalat im eigenen Leben auch so einfach wieder entwirren könnte!«
Abgesehen von diesen kleinen Unterbrechungen taten wir einträchtig das, was am Ende des Abends im Kakadu anstand, auch das Putzen der Toiletten, mal Fränki, mal Biggi, mal ich, weil es niemandem zuzumuten war, das jede Nacht zu machen. Vor allem das Männerklo war ekelhaft, sie pinkelten daneben, und es stank widerlich, nach Urin und Klostein. Wenn ich dran war, es zu putzen, fragte ich mich jedes Mal, wie hoch der Stundenlohn hierfür sein müsste, und landete bei mindestens 25 Mark.
Ich hatte im Frühjahr für wenige Wochen einen solchen, sensationell gut bezahlten Job gehabt! Für 50 Mark sollten mein Kumpel Dirk Mahnke und ich die Zahnarztpraxis seines Vaters putzen, am Samstagmittag nach der Sprechstunde. Wenn man es nicht allzu genau nahm, war man schnell durch, in eineinhalb Stunden zu zweit. Es gehörte zudem zu unseren Aufgaben, eine Ansage auf den Anrufbeantworter zu sprechen, welcher Zahnarzt an dem Wochenende Notdienst hatte. Ich sprach dies zwar zunächst aufs Band, konnte es mir dann aber nicht verkneifen hinzuzufügen: »Und noch ein Hinweis in eigener Sache: Nächste Woche sind bei uns in der Praxis Dr. Mahnke Goldzähne im Sonderangebot!«
Als das aufflog, waren wir den Job sofort wieder los. Dirk war sauer auf mich und zitierte seinen Vater, man solle keine Mädchen einstellen, die was mit Theater machen wollten.