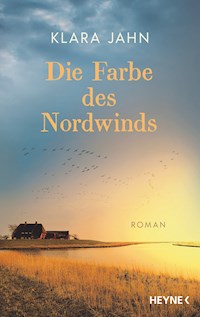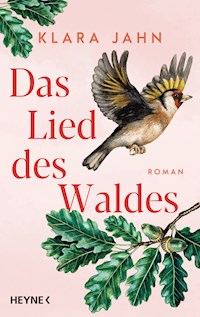
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Weisheit eines besonderen Ortes durch alle Zeiten
Nach dem Tod ihrer Mutter kehrt Veronika in ihr Elternhaus im Nürnberger Reichswald zurück, um dessen Verkauf abzuwickeln. Ganz ungelegen kommt ihr diese Flucht aufs Land nicht: Ihre Ehe liegt in Scherben, von ihrem Job und sich selbst ist sie entfremdet. Die Kindheitserinnerungen in dem alten Forsthaus und das Wiedersehen mit ihrer Jugendliebe überwältigen Veronika – da entdeckt sie alte Aufzeichnungen über Anna Stromer, die sich im 14. Jahrhundert mit Pioniergeist für den Schutz des Waldes eingesetzt hat. In Annas Geschichte findet sie Trost und Inspiration, und es entwickelt sich ein besonderes Band zwischen den beiden Frauen, denen derselbe Ort durch die Zeiten hindurch Kraft gibt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 458
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
DASBUCH
Nach dem Tod ihrer Mutter kehrt Veronika in ihr Elternhaus im Nürnberger Reichswald zurück, um dessen Verkauf abzuwickeln. Ganz ungelegen kommt ihr diese Flucht aufs Land nicht: Ihr Mann Joachim hat sich in einer Midlife Crisis auf einen Selbstfindungstrip verabschiedet, die PR-Agentur, in der Veronika seit Jahren arbeitet, hat ihr kurzerhand gekündigt, und ihre Tochter Ava verbringt ein Jahr in Neuseeland, von wo aus sie sich nur sporadisch meldet, und das auch eher aus Pflichtgefühl denn aus Zuneigung.
Nun, zurück in dem Wald, in den Veronika nie zurückkehren wollte, weil sie als Jugendliche alles, was mit ihrer Herkunft zu tun hatte, restlos hatte abstreifen wollen, stürzen die Kindheitserinnerungen auf sie ein. Zu ihrer eigenen Überraschung sind es nicht nur schlechte. Da sind die an ihre Beziehung zur Natur, in der sie aufgewachsen ist, an die Bücher, die sie gern gelesen hat – und an Martin, ihre große Jugendliebe. Auch ihn hat sie damals zurückgelassen. Das Wiedersehen mit ihm überwältigt und überfordert Veronika, genauso wie die Anwesenheit eines ungebetenen Besuchers auf ihrem Waldstück. Da entdeckt sie alte Aufzeichnungen über Anna Stromer, eine mutige junge Frau die sich im 14. Jahrhundert mit Pioniergeist für den Schutz des Waldes eingesetzt hat. In Annas Geschichte findet sie Trost und Inspiration, und es entwickelt sich ein besonderes Band zwischen den Leben beider Frauen, denen derselbe Ort durch die Zeiten hindurch Kraft gibt.
DIEAUTORIN
Klara Jahn ist das Pseudonym einer bekannten Bestsellerautorin. Die Historikerin liebt es, große Geschichten zu erzählen und dabei tief in die Vergangenheit der Orte und Menschen einzutauchen. Dabei lässt sie sich von ihrer Liebe zur Natur und ihrer Faszination für raue Landschaften leiten. Die gebürtige Österreicherin und Mutter einer Tochter lebt seit 2001 in Frankfurt am Main. Ebenfalls bei Heyne erschienen ist Die Farbe des Nordwinds.
KLARA JAHN
Das Lied
des
Waldes
ROMAN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originalausgabe 03/2022
Copyright © 2022 by Klara Jahn
Copyright © 2022 dieser Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Uta Rupprecht
Umschlaggestaltung: FAVORITBUERO, München
unter Verwendung von Getty Images/Andrew_Howe;
Bridgeman Images/Granger
Herstellung: Mariam En Nazer
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-28439-8V003
www.heyne.de
Wie deine grüngoldenen Augen funkeln,
Wald, du moosiger Träumer!
Wie deine Gedanken dunkeln,
Einsiedel, schwer von Leben,
Saftseufzender Tagesversäumer!
Über der Wipfel Hin- und Widerschweben
Wie’s Atem holt und voller wogt und braust
Und weiterzieht –
Und stille wird –
Und saust!
Über der Wipfel Hin- und Widerschweben
Hoch droben steht ein ernster Ton,
Dem lauschten tausend Jahre schon
Und werden tausend Jahre lauschen …
Und immer dieses starke, donnerdunkle Rauschen.
Peter Hille
VERONIKA
»Verdammt!«, entfuhr es Veronika. Sie hatte eine randvolle Kiste mit Einkäufen aus dem Kofferraum geladen, dabei war eine Packung Hafermilch heruntergefallen und auf dem Waldboden zerplatzt. Einige Tropfen landeten auf ihrer Jeans.
Ihre Freundin Luna würde sie jetzt rügen. Sie hatte die Stille des Waldes erst kürzlich als heilig bezeichnet. Und als heilsam. »Wusstest du, dass Menschen, die in der Nähe von Wäldern leben, mehr Killerzellen produzieren, die Krankheitserreger bekämpfen?«
Veronika hatte es nicht gewusst.
Sie wusste nur, dass sie immer noch von Luna enttäuscht war. Diese hatte versprochen, sie in den Wald zu begleiten, und dann kurzfristig abgesagt. So erdend ein Trip in das Forsthaus, wo Veronika ihre Kindheit und Jugend verbracht hatte, auch sein mochte – mit dem auf den letzten Drücker frei gewordenen Platz in einem Klangschalenseminar hatte er nicht mithalten können.
Veronika bückte sich. Beim Aufheben riss die Packung noch weiter auf, die Hafermilch ergoss sich über den Ärmel ihrer Jacke. Diesmal verkniff sie sich einen Fluch, stampfte wütend auf. Prompt drang Matsch in die Ritzen ihrer Schuhe.
Stadtschuhe, hätte ihre Mutter dazu gesagt, obwohl die Absätze nur drei Zentimeter hoch waren.
Auf Walderde geht man am besten mit nackten Füßen, behauptete Luna. Sie hatte für die paar Tage im Wald viele Pläne gemacht. Shinrin Yoku, das Waldbaden, reize sie schon seit Langem, die Japaner meinten damit nicht bloß einen Waldspaziergang, sondern eine Aromatherapie, eine Stressmanagement-Methode, eine Achtsamkeitsübung.
Veronika hatte keinen Sinn für ein Bad im Wald. Die Hafermilch war im Boden versickert, sie warf die leere Packung in den Kofferraum. Er schloss sich auf Knopfdruck, ganz leise. Ihre Schritte waren auch kaum zu hören, als sie vom Waldrand zum Forsthaus ging, auf einem schmalen Weg, beschattet von alten Birken und Kiefern. Lauter klang der Ruf eines einsamen Waldkauzes, und er war ähnlich melancholisch wie die Erinnerungen, die in ihr hochstiegen, als sie ihr Elternhaus erreichte.
Nur zwei der weißen Sprossenfenster waren zu sehen, die anderen verbargen sich hinter Fensterläden, von denen grüne Farbe blätterte. Das Holz darunter war verwittert. Das Haus schien sie aus müden Augen anzustarren. Risse zogen sich durch die Fassade, Putz bröckelte ab, die Dachbalken waren größtenteils von grauem Moos überwuchert. Durch die löchrige Dachrinne tropfte es. Gut möglich, dass es auch durchs Dach ins Haus tropfte, aber darum musste Veronika sich nicht mehr kümmern, das wäre das Problem der künftigen Besitzer. Lange blieb sie ohnehin nicht, für die paar Tage hatte sie eigentlich zu viel eingekauft.
Sie stellte die Kiste ab, um das Gartentor zu öffnen. Der Zaun aus dünnen Fichtenstämmen war morsch, das Holz des Tors rumpelte über den unebenen Boden. Sie musste mit ganzer Kraft dagegendrücken, um sich mitsamt der Kiste in den Garten zwängen zu können.
Ihre Erinnerungen hatten nun nichts mehr mit dem Schrei des Waldkäuzchens gemein, gedämpft vom Wald und so weit entfernt, dass man ihn geflissentlich überhören könnte. Hartnäckig klopften sie an wie ein Specht, der mit dem Schnabel Baumrinde bearbeitet. Sie drangen durch die Schichten der Zeit, die zwischen Veronika und der Vergangenheit stand, ganze siebenundzwanzig Jahre, in denen sie nur sporadisch hier gewesen war. Seit dem Tod ihrer Mutter Ilse im letzten Herbst hatte sie das Forsthaus überhaupt nicht mehr betreten. Doch jetzt stand sie in Ilses Garten – und in ihrem eigenen früheren Leben.
Ilse Pichlers Garten war immer schon der Schauplatz eines langen, zermürbenden Stellungskriegs gewesen. Die Front verlief rund um die Beete, wo Kohl, Rote Rüben und Rettich angebaut wurden, rund um die Salbei-, Thymian- und Ziermohnstauden, um die Narzissen, Tulpen und Rosen. Auf diesem Schlachtfeld galt keine Genfer Konvention, sammelte kein Rotes Kreuz die Verletzten ein. Ilse Pichler hatte mit Schaufel und Spaten, Sichel und Rasenkantenstecher, Unkrautjäter und Blumenkralle, mit Dicamba, Glyphosat und Rasenherbiziden gekämpft. Der Wald mit Pollen, Samen, Insekten und Wühlmäusen.
Sie hatte die giftigeren Waffen, er das beweglichere Heer, manchmal auch die bessere Taktik. Die blauen Vergissmeinnichtpolster, die sich einmal übers ganze Gemüsebeet ausbreiteten, konnten auf Allianzen setzen. Ameisen mochten die nährreichen Samenkappen und verteilten freudig die Samen.
Als Veronika etwa zwölf Jahre alt war, erklärte sie das einmal der Mutter. Gerade hatte diese verlangt, sie solle ihr beim Ausreißen der Vergissmeinnicht helfen. »Wusstest du«, sagte Veronika und ließ sich, anstatt zu pflücken, zu rupfen, zu jäten und zu tilgen, auf der Gartenbank nieder, »dass das Gesamtgewicht aller Ameisen dem Gewicht sämtlicher Menschen auf der Erde entspricht?«
»Hmpf«, machte die Mutter und wiederholte ihre Bitte nicht. Sie kämpfte gegen den Wald, nicht gegen den Widerstand der Tochter. Während die auf der Gartenbank ihre Hausaufgaben machte, arbeitete sich die Mutter durch die Beete, bis nicht nur die Vergissmeinnicht verschwunden waren, sondern auch sämtliches Unkraut und etliche ihrer Blumen. Die schwarze Erde, die zwischen armseligen Farbtupfern zurückblieb, war zwar nicht unbedingt Zeichen für einen Sieg, aber auch nicht für eine Kapitulation.
Ilse Pichler konnte nicht lange stolz darauf sein. Kurze Zeit später schickte der Wald ein Reh als Verstärkung, das Salat, Erdbeeren und Johannisbeeren liebte. Es schaffte es, den Gartenzaun zu überwinden, der bislang alle Artgenossen abgehalten hatte, und innerhalb einer Nacht das Ergebnis von mehreren Monaten Arbeit wegzufressen.
Die Mutter streute ein Gemisch aus Wasser und Blutmehl auf ihre Pflanzen, aber das Reh scheute den Geruch von Tierblut nicht. Sie platzierte ungewaschene, naturbelassene Schafwolle strategisch günstig rund um die Gartenbeete, aber anders als erhofft ließ sich das Reh auch davon nicht stören. Sie drohte, Goldregen, Rhododendron und Kirschlorbeer anzubauen – Gift für das Reh –, aber bis das alles angewachsen war, hätte sie den Garten in einen Bunker verwandeln müssen. Beim Gift blieb sie, sie vermischte Rattengift mit Wildfutter und verteilte es auf dem Rasen. Das Reh verschmähte es und hinterließ Rehlosung als Gruß.
Das Waffenarsenal der Mutter war aufgebraucht.
»Erschieß es«, befahl sie dem Vater, doch der schob die leidige Pflicht wieder und wieder auf. Er schoss lieber Hirsche.
Veronika betrachtete den Garten. Am Ende hatte doch der Wald gewonnen. Die Beete waren von überbordenden Sträuchern, Wildkräutern, Gräsern, Farnen, Moosen und Flechten bedeckt. Auf dem Rasen, einst eine glatte grüne Fläche, wucherten Huflattich, Klee und Wegerich. Und auf dem Weg zum Haus riss sie sich die Hose an einer dornigen Ranke auf. Als sie die Einkäufe abstellte, wanderte ihr Blick hoch zum Türstock aus Sandstein – neben dem Gewölbekeller der älteste Teil des Hauses. Die darauf eingeritzte Jahreszahl war einmal deutlich zu lesen gewesen, jetzt waren da nur verwischte graue Spuren. Veronika wusste auch so, dass der erste Bewohner das Forsthaus Anfang des 16. Jahrhunderts bezogen hatte.
An den Sandstein schlossen sich die Reste einer pechschwarzen Holzvertäfelung an, übersät von Vogelkot. Darüber befand sich der Balkon mit der hohen gedrechselten Balustrade. Die Mutter hatte damals auch hier Blumen angepflanzt, Geranien, so prächtig, dass man den Balkon nicht betreten konnte, ohne von ihnen gekitzelt zu werden. Der Feind der Geranien war nicht der Wald gewesen, sondern der Sturm. Wenn der anrückte, blieb nur die Flucht, alle Blumentöpfe mussten so schnell wie möglich in Sicherheit gebracht werden.
»Hilf mir doch!«, sagte Ilse dann zu Veronika, aber die war wieder mal in ein Buch vertieft und stellte sich wie so oft taub, wenn die Mutter um Hilfe bat.
Veronika sperrte das widerspenstige alte Türschloss auf und zog den wurmstichigen Holzriegel zurück. Der Dielenboden war zerkratzt und uneben. Sie hatten den Flur nie mit Schuhen betreten, doch jetzt tat sie es, obwohl an ihren Sohlen noch Waldboden klebte. Vorsichtig setzte sie einen Fuß vor den anderen, als wäre die Fläche vermint.
Der modrige Geruch, der sie empfing, erinnerte sie an jene Gläser mit Himbeermarmelade, die die Mutter eingerext hatte, nicht immer sorgfältig genug, sodass sich oft eine graue Schimmelschicht bildete. Ilse pflegte den Schimmel mit einem Messer abzukratzen. »Das darunter kann man noch essen«, meinte sie, auch wenn sich zum süßen Aroma eine muffige Note gesellt hatte. »Wenn der Pilz bereits sichtbar ist, ist das ein Zeichen, dass das ganze Lebensmittel mit Pilzgeflecht durchzogen ist«, erläuterte Veronika altklug. Aber gegen Unsichtbares kämpfte die Mutter nicht.
Mit jedem Schritt, der Veronika tiefer in den länglichen Flur führte, verstärkte sich der unangenehme Geruch. Sonst empfing sie nichts, und diese Leere konnte man nicht abkratzen. Sämtliches Mobiliar, das einst im Flur gestanden hatte – der Schuhkasten, der Schirmständer, der Telefontisch –, war verschwunden, der Staub konnte sich nirgendwo verstecken, blieb nirgendwo haften. Im Luftzug, der von draußen kam, tanzte er haltlos hin und her. Über der Tür zur Stube hatte früher ein prächtiges Hirschgeweih gehangen. Jetzt war da nur mehr ein schwarzer Nagel, der wie eine zerquetschte Fliege auf einem ovalen Stück Tapete saß.
Es war Josef Pichlers schönstes Geweih gewesen, eines der ersten Dinge, das die Mutter entfernt hatte, nachdem er gestorben war und sie beschlossen hatte, nicht allein im Forsthaus wohnen zu bleiben. Und das Letzte, bei dem Veronika ihr geholfen hatte. Sie hatte keine Zeit gehabt, beim Entrümpeln zu helfen, berufstätig und mit Familie. Ihr Frankfurter Leben war mindestens so vollgestopft wie dieses Haus.
»Willst du sie nicht haben?«, hatte die Mutter gefragt und damit nicht nur das Hirschgeweih gemeint, sondern auch den Kopf eines Keilers, der weiter hinten hing, und die Geweihe von unzähligen Böcken. »Ich kann sie nicht mitnehmen, aber es wäre doch schade um die Trophäen deines Vaters.«
»Wo denkst du hin, so etwas passt doch nicht in unsere Wohnung.«
Ilse hatte sie vorwurfsvoll angeschaut. »Magst dich ja gar nicht an uns erinnern.«
»Hast du dich nicht selber geärgert, dass Vater es nie erwarten konnte, Hirsche zu schießen, es aber endlos lange aufgeschoben hat, deinen Garten von diesem Reh zu befreien? Weil das zu schießen ja keine echte Herausforderung sei?«
Die Mutter zuckte die Schultern, nun war sie es, die sich nicht erinnern wollte. Der Triumph über das Reh hatte damals nicht lange gewährt, eine Schneckenplage war gefolgt. An deren Ende stand wieder einer ihrer Pyrrhussiege: Der Schädling war beseitigt, aber der Garten entweder vergiftet oder kahl.
Anders als der Flur war die Wohnküche, die sie stets Stube genannt hatten, nicht komplett leer. Ilse Pichler hatte bei ihrem Auszug ein paar Möbelstücke zurückgelassen. Das sei kein rechtes Leben mehr hier, so ganz allein, hatte sie gesagt. Aber bei ihrer Schwester auf dem Hof, wo sie die Kindheit verbracht hatte, passte es ihr dann auch nicht. So viel Land, so wenig Wald, ein gepflegter Garten. Ohne Kampf wurde sie müde, zerbrechlich.
Das graue Sofa stand noch da, das Bild darüber – zwei Birken an einem Bächlein – war verschwunden, hatte aber Spuren hinterlassen: Wo es gehangen hatte, war die Tapete nicht nachgedunkelt, die Vergangenheit hatte dort keine Schatten geworfen.
Eine Matratze lag auch noch da, uralt, mit zerkrümelten Schaumstoffecken, von Mäusekötel übersät. Wahrscheinlich hatte die Mutter hier geschlafen, als das Schlafzimmer schon leer geräumt war. Die hölzerne Bank gegenüber vom Gasherd hatte sie ebenfalls zurückgelassen, nur die Sitzpolster fehlten. Die Mäuse mussten auch hier hochgeklettert sein, denn die Häkelborte am vergilbten Vorhang, der vor dem Fenster hing, sah angefressen aus.
Veronika stellte die Kiste mit den Einkäufen auf ein schiefes Regal neben dem Gasherd. Sie hatte nicht vor, den Herd zu benutzen, sondern hatte einen Wasserkocher mitgebracht, um sich notdürftig versorgen zu können. Sie entnahm dem Karton zwei weitere Packungen Hafermilch, ein paar Quinoa-Cups und Reisnudeln. Eine Packung Nüsse – Haselnüsse, Mandeln, Cashewkerne – hatte sie ebenfalls dabei, außerdem Kiwis, Äpfel und Bananen.
Danach sah sie sich weiter um: Dort hinten hatte der Fauteuil gestanden, auf dem ihr Vater stets ferngesehen hatte. Josef Pichler hatte zeit seines Lebens auf den schlechten Fernsehanschluss geschimpft. Man musste die Antenne des Uraltmodells immer eine Weile hin und her schieben, bis ein scharfes Bild zu sehen war und der Ton nicht mehr rauschte. Am besten bekam man es hin, wenn man die Antenne um ein paar Grad knickte, aber der Vater bevorzugte es, dass sie gerade stand. Er mochte auch gerade gewachsene Bäume am liebsten, »Steckeleswald« aus hochstämmigen Föhren machte keine Arbeit. Auf die Ranken und Sträucher, die sich am Boden duckten, trat er achtlos. Während die Mutter ihren Kampf gegen den Wald bis zum Schluss ausfocht, war er für den Vater nie ein Gegner auf Augenhöhe gewesen.
Wenn der Vater fernsah, stand die Mutter ein kleines Stück daneben und bügelte. Wie der Fauteuil hatte das Bügelbrett Abdrücke im Boden hinterlassen. Wenn Ilse bügelte, lächelte sie meist zufrieden, weiße Hemden ließen sich leichter glätten als schwarze Erde. Nur an einem Tag, der Veronika nun deutlich vor Augen stand, war das Lächeln nicht zufrieden, sondern verbissen gewesen.
»Wann kriegen wir endlich einen neuen Zaun?«, fragte sie ungehalten. »Der jetzige ist zu niedrig.«
Das Reh war damals schon Geschichte, aber sie hatte Angst vor neuen Angriffen aus dem Wald.
Erstaunlich, dass ihre Mundwinkel trotz der mürrischen Stimme nach oben gebogen blieben, als wären die Lippen aus Maschendraht, dem selbst ein Sturm nichts anhaben konnte. Sie waren nicht unter sich: Sophie war da, die Neue in Veronikas Schulklasse, deren Familie erst vor Kurzem aus Hamburg nach Nürnberg gezogen war. Die beiden Mädchen mussten gemeinsam ein Referat für den Sachkundeunterricht der vierten Klasse vorbereiten. Übergeordnetes Thema war die Geschichte Nürnbergs im Mittelalter. Sophie und Veronika sollten das Handelshaus der Familie Stromer vorstellen.
Der Vater achtete nicht auf die Mutter, er stand auf, um die Antenne gerade zu richten. Es lief »Unser Land«, die Stimme von Carolin Reiber verlor sich im weißen Rauschen.Die Mutter seufzte genervt, das Maschendrahtlächeln hielt.
»Diese verfluchten Schädlinge …«, setzte sie an.
Der Vater saß noch nicht wieder auf dem Fauteuil, als er sich an die beiden Mädchen wandte. »Soll ich euch später meine Insektensammlung zeigen?«
Die Insektensammlung bestand aus Hunderten von Käfern, Spinnen, Wespen und anderen Kerbtieren, auf Nadeln gespießt und in Schächtelchen auf Schaumstoffkissen gebettet, von denen die größeren Tiere sogar Glasaugen hatten.
»Die interessiert doch niemanden«, sagte Veronika schnell.
»Nürnberg im Mittelalter – das interessiert niemanden«, erwiderte Sophie genervt und verdrehte die Augen. Sie zog etwas aus ihrem Rucksack und hielt es Ilse vors Gesicht. »Das soll ich Ihnen von meiner Mutter geben.«
Es waren Sanddornpralinen, verpackt in knisterndes Stanniolpapier, auf dem die Hamburger Landungsbrücken zu sehen waren. Sogar eine dunkelrosa Schleife war darumgebunden.
Die Mutter starrte darauf. »Das wäre doch nicht nötig gewesen, so etwas Feines.«
»Das ist ein Dankeschön, weil ich mit Veronika lernen darf.« Sophie war die Einzige, die sie so nannte, alle anderen sagten Vroni zu ihr.
»So etwas Feines«, murmelte die Mutter erneut und nahm die Pralinen immer noch nicht. Erst als Sophie sie auf die Ablagefläche für das Bügeleisen legte, griff die Mutter vorsichtig danach und verstaute das Geschenk im obersten Fach des Küchenschranks. Sie würde nie an der Schleife ziehen, nie das knisternde Stanniolpapier entfernen. So etwas Feines verschwendete man nicht leichtfertig, das war für einen besonderen Anlass bestimmt. Nur kam der nie.
Sie kehrte zurück zum Bügeltisch. »Das wäre doch nicht nötig gewesen.«
Nach Ilses Ansicht wäre es auch nicht nötig gewesen, dass Sophies Mutter Nora das Mädchen mit dem Auto zum Forsthaus brachte, es hätte doch laufen können.
»Das sind zwanzig Minuten durch den Wald!«, hatte Nora entsetzt ausgerufen.
Ilse hatte nicht verstanden, wo das Problem lag. Vor dem Wald schützte man seine Blumen- und Gemüsebeete, Kindern tat er ja nichts.
Um achtzehn Uhr würde Nora Sophie wieder abholen.
»Wir müssen uns beeilen, wenn wir noch etwas schaffen wollen«, drängte Veronika.
Sophie schaute fasziniert auf den flimmernden Bildschirm. Ähnlich fasziniert hatte sie vorhin den ausgestopften Keiler und das Hirschgeweih angestarrt. »Ich würde die toten Insekten gerne sehen.«
»Vielleicht später, jetzt komm mit.«
Sophie verdrehte wieder die Augen, aber sie folgte Veronika nach oben.
Den gleichen Weg nahm Veronika auch jetzt. Ihr Zimmer war das letzte am Ende des Korridors im ersten Stock, wo sich auch das Schlafzimmer der Eltern, das Badezimmer und ein kleines Büro befanden. Anders als der Flur im Erdgeschoss war dieser Gang nicht gänzlich leer. Neben der Tür zu Veronikas Zimmer stand noch ein alter fränkischer Bauernschrank aus massivem Holz, mit originalen Beschlägen aus dem Jahr 1887 und floralen Motiven.
Wenigstens den könnte sie doch nehmen, hatte Ilse bei ihrem Auszug gesagt, auch Städter stellten sich so was in ihre Wohnung. Man müsse ihn nur richtig gegen den Holzwurm behandeln. Dazu hatte sie viele Vorschläge parat, ihr Giftrepertoire war umfangreich. Der Schrank stammte aus dem Bauernhof von Ilses Eltern, sie hatte ihn mitgenommen, als sie Josef Pichler geheiratet und mit ihm das Forsthaus bezogen hatte. Warum sie ihn beim Umzug zurück ins Elternhaus nicht selbst mitnehme, hatte Veronika wissen wollen.
Aber auf dem Hof hatte man nicht mal Ilse haben wollen, geschweige denn einen alten Schrank. Zwei Jahre später war sie ins Altersheim gezogen; sie und die Schwester, das sei einfach nicht gegangen.
»Hier hast du es doch schön«, hatte Veronika bei ihrem ersten Besuch im Heim gesagt, als sie sich in dem hellen, geräumigen Zimmer umsah. Sie hatte die Mutter von nun an drei-, viermal im Jahr besucht und immer feine Pralinen mitgebracht.
Die alten Dielen knarrten bei jedem Schritt. Was die Mutter wohl mit Veronikas Möbeln gemacht hatte?
Sie erreichte die Tür und drückte mit dem Knie gegen das Holz. Die Tür öffnete sich nur zu einem Drittel, dann stieß sie auf Widerstand – ihr alter Flickenteppich war verrutscht. Sie drückte nicht weiter gegen die Tür, sondern zwängte sich durch den Spalt. Das Bett sah aus wie frisch gemacht, die Kissen- und Deckenbezüge waren die geblümten von einst. Ihr Schreibtisch stand wie damals vor dem Fenster, der Drehstuhl davor war leicht zur Seite gedreht, als hätte sie eben noch dort gesessen. Im Wandregal standen ihre alten Bücher, von einer dicken Staubschicht bedeckt. Gleich daneben hing der vertraute Kupferstich, der Nürnberg im Mittelalter zeigte, rechts vom Fenster das Hinterglasbild mit der Wildschweinjagd. Darauf waren die Nester in den Bäumen riesig, die Vogeljungen darin fast so groß wie der Frischling. Die einst weißen Häkelborten der Vorhänge waren vergilbt, aber nicht angefressen wie die in der Stube. Nichts hatte an diesem Raum genagt, er war erhalten geblieben wie in einem Einmachglas, die Zeit hatte sich als zahnlos erwiesen. Als hätte er auf Veronika gewartet. Als hätte die Mutter auf sie gewartet.
»Schade, dass Sie nicht rechtzeitig kommen konnten«, hatte die Altenpflegerin nach dem Tod der Mutter vorwurfsvoll erklärt. Dabei hatte Veronika sich doch sofort ins Auto gesetzt. Sie hatte später noch Stunden neben dem Bett gesessen, in dem die tote Mutter lag, hatte gewartet, bis die Kerze heruntergebrannt war. Ilses Lächeln war so sanft gewesen, in diesem gelblich-wächsernen Gesicht war nichts mehr aus Maschendraht, kündete nichts mehr von einem Kampf.
Vergissmeinnicht.
Sie hatte die Mutter nicht vergessen, der Anblick des konservierten Kinderzimmers trieb ihr Tränen in die Augen.
Sie hatte auch Sophie nicht vergessen, die ständig gemault hatte, wie langweilig Sachkunde sei. »Warum spielen wir nicht?« In Veronikas Zimmer gab es kein Spielzeug.
»Die Familie Stromer, Besitzerin eines großen Handelshauses, hat im Mittelalter von Nürnberg aus die ganze Welt erobert«, belehrte Veronika sie.
Sie selbst hatte zwar vom Forsthaus aus nicht die ganze Welt erobert, aber sich in Frankfurt eine eigene geschaffen. Hatte Karriere gemacht, geheiratet, eine Tochter großgezogen.
Sie sank auf das Bett. Die Bettwäsche war glatt wie frisch gebügelt, nirgendwo eine Falte, nur eine Stopfnaht. Unwillkürlich japste sie nach Luft, aber in einem Einmachglas gab es keinen Sauerstoff. Sie stürzte zum Fenster, riss es auf.
Wieder sog sie tief den Atem ein. Der Druck auf der Brust verging, die würzige Waldluft füllte die Lungen, und als sie sich hinausbeugte, tropfte es ihr von der löchrigen Regenrinne auf den Hinterkopf. Sie fühlte sich erfrischt, aber dennoch beklommen und … schrecklich einsam. In der Ferne rief immer noch der Waldkauz.
ANNA
Als ich das erste Mal allein im Wald war, dachte ich, ich würde dort sterben. Dabei stirbt man im Wald nicht, man wird nur verwandelt.
Wäre ich verdurstet oder erfroren, hätten sich Bären, Wölfe und Raben an meinem Leichnam gütlich getan und dabei den Boden rundherum aufgerissen, sodass dort Samen keimen könnten. Die Reste meines verwesenden Fleisches wären ein vorzüglicher Dünger gewesen, die Knochen ein köstliches Mahl für die Mäuse. Sie hätten die harte Schale aufgebrochen, und die Linsenfliegen hätten darin ihre Eier ablegen können, während ein Käfer namens Totengräber sämtliche Haare abgebissen und mit seinem Speichel dafür gesorgt hätte, dass meine Überreste sich nach und nach mit dem Boden verbanden und frische Erde entstand.
Dieses Verschwinden macht einer alten Frau wie mir keine Angst, im Gegenteil. Es ist eine Verheißung. Als kleines Mädchen wusste ich freilich noch nicht, dass der Tod nie das Ende ist, nur eine Faser im Lebensfaden.
Ich heiße Anna Stromer, und die Geschichte, die ich erzählen will, beginnt im Jahr 1366, als ich acht Jahre alt war. Zu diesem Zeitpunkt war ich dem Tod schon zweimal begegnet.
Einmal hatte er mein kleines Brüderchen geraubt, als es noch eine Larve war. Nein, keine Larve, ein Säugling. Ich lebe schon so lange zurückgezogen in den Wäldern, dass mir die menschliche Sprache mehr und mehr abhandenkommt. Manchmal muss ich mühsam nach einem Wort suchen, während es ein Leichtes wäre, wie ein Kolkrabe zu krächzen.
Nach dem Tod meines Brüderchens ging meine Mutter Anna Hegner bald wieder schwanger, doch diesmal brachte sie das Ungeborene nicht auf die Welt. Es starb in ihr und vergiftete ihren Körper. Mit schweißbeflecktem Gewand, dunklen Adern unter der weißen Haut und verzerrtem Gesicht zeichnete sie mir ein Kreuz auf die Stirn und tat ihren letzten Atemzug. Noch Tage später glaubte ich, das Kreuz wie ein Brandmal zu spüren. Noch Monate später war ich von Trauer wie gelähmt.
Mein Vater Ulmann Stromer hatte seine Trauer schneller verwunden. Um mein kleines Brüderchen nicht zu vergessen, hatte er dessen Namen – Ulrich – in ein kleines Büchlein geschrieben, wo er später auch das Todesdatum meiner Mutter eintrug. Sodann nahm er sich eine neue Frau namens Agnes, die erst fünfzehn Jahre alt war. Gab ein Stuhl unter ihm nach, weil die Beine morsch geworden waren, verlegte er sich schließlich auch nicht aufs Stehen, sondern ließ sich einen neuen zimmern.
Agnes kümmerte sich nicht um mich. Sie sah in mir eher eine lästige kleine Schwester denn eine Stieftochter. Sie trachtete danach, sich nach der neuesten Mode zu kleiden, drehte sich damit hoffärtig vor dem Spiegel und erfreute sich an dem fußlangen, seidigen herbstbunten Unterkleid ebenso wie an dem ärmellosen Überkleid in der Farbe des Winterhimmels. Das eigene Spiegelbild lächelte ihr zu, ich stand stumm und bleich daneben.
»Sag, hast du deine Zunge verschluckt?«, rief Agnes einmal und brach in spöttisches Lachen aus.
Tiefes Entsetzen erfasste mich. Als meine Mutter noch lebte, hatte ich einmal einen der Knöpfe verschluckt, die seit geraumer Zeit jene Schlaufen ersetzten, mit denen die Nürnbergerinnen bislang ihre Kleider verschlossen hatten. Die Mutter hatte Angst gehabt, ich könnte ersticken. Der Vater hatte sich geärgert, denn Knöpfe waren teuer.
Am Ende hatte ich den Knopf wieder ausgeschieden. Doch eine Zunge war größer, daran würde ich wohl tatsächlich ersticken.
»Na los«, sagte Agnes und packte mich an den Schultern, »mach den Mund auf und lass mich schauen.«
Ich presste die Lippen zusammen und schüttelte den Kopf. Agnes schimpfte, ich sei ein böses, verstocktes Mädchen.
Erst nachdem die Stiefmutter den Raum verlassen hatte, stellte ich mich selbst vor den Spiegel und machte den Mund auf. Als ich meine Zunge erblickte, war ich erleichtert. Ich war nicht böse und auch nicht verstockt, aber einsam war ich, schrecklich einsam. Und fürderhin stumm.
Meinem Vater gefiel es, wenn Mädchen und Frauen wenig sprachen. Aber dass sie gar nicht sprachen, hatte der Allmächtige wohl nicht vorgesehen. Die Leute begannen zu tuscheln, die junge Anna sei am Tod ihrer Mutter irre geworden. Doch eine verrückte Frau würde dereinst kein ehrbarer Nürnberger ehelichen.
Also suchte mein Vater Rat in der Sebalduskirche, dann in der Lorenzerkirche, schließlich in der Frauenkirche.
Ein Priester sagte, dass nicht ich es sei, die beharrlich schwiege, sondern der Dämon, der in mir wohne. Der zweite sprach von einem bösen Zauber, gegen den Milch helfe, die man rot oder blau färben müsse. Der dritte behauptete, ich hätte etwas aus Eisen verschluckt, das mir nun schwer im Magen liege und jedes Wort in die Tiefe ziehe, bevor es den Mund erreiche.
Ich saß bei diesen Unterredungen daneben. Gerne hätte ich eingeworfen, dass der Knopf, den ich verschluckt und der den Körper schon wieder verlassen hatte, nicht aus Eisen bestanden habe, sondern aus Holz, und dass er mit Seidenstoff überzogen gewesen sei, der im Frühlingswind wie Schmetterlingsflügel flatterte. Doch ich bekam den Mund nicht auf. Mein Vater schon. Als der eine von Exorzismus sprach, der zweite von Gebeten, der dritte vom strengen Fasten und alle drei von großzügigen Schenkungen an die jeweilige Gemeinde, die Gott günstig stimmen würden, lehnte er ab.
Ulmann Stromer hätte sich zwar selbst als frommen Menschen bezeichnet, aber ich glaube nicht, dass er im tiefsten Herzen einer war. Vielmehr gehörte er zu jenem neuen Menschenschlag, wie man ihn vor allem in den Städten trifft – er fürchtete Gott nicht mehr, sondern handelte mit ihm. Und die Preise, die ihm die Priester nannten, deuchten ihn zu hoch.
Wer keine Schenkung wollte, sondern ihre Hilfe umsonst gewährte, war meine Tante Gerhaus. Die Schwester meines Vaters war eine belesene und kluge Frau, die dem Nürnberger Katharinenkloster als Äbtissin vorstand. Zunächst erging sie sich in mannigfaltigen Vermutungen, doch die meisten verwarf sie wieder. Vergiftetes Brunnenwasser hätte einen solchen Schaden anrichten können, aber die Juden habe man ja jüngst aus der Stadt vertrieben. Im Krankenhaus zum Heiligen Geist habe sie einmal gesehen, wie einem Siechenden ein Knochen aus dem Kopf wuchs, weil der Kranke einst einem Mann den Arm gebrochen hatte, doch ich sei noch zu jung für solch schwere Sünden und die daraufhin von Gott gesandte Strafe.
»Du musst mit ihr zu Sebald pilgern«, schloss sie ihre Ausführungen.
Sebald war ein frommer Mensch, der einst als Eremit im Wald gelebt hatte. Die Nürnberger pilgerten regelmäßig zu seinem Grab mit dem verwitterten Steinkreuz und zu der Quelle gleich in der Nähe, erhofften sie sich von dem Wasser doch Linderung für alle möglichen Leiden.
»Er wird deinem Töchterlein die Sprache zurückgeben«, schloss Tante Gerhaus hoffnungsvoll.
Ich war noch nie aus Nürnberg herausgekommen.
Die Freie Reichsstadt zählte damals schon mehr als dreihundert Jahre. Bei einer Eiche werden in diesem Alter die jährlichen Neuaustriebe etwas kürzer, mancher Zweig verbiegt sich krallenartig. Nürnberg hingegen streckte die Hände immer weiter nach Macht, Einfluss und Reichtum aus. Und die Hände meines Vaters bekamen besonders viel zu fassen.
Unsere Familie war eine der mächtigsten in der Stadt und eine der wohlhabendsten. Sie hatte mit Waren aus ganz Europa – Gewürzen, Tuch und Wein – ein riesiges Handelshaus erschaffen, dessen Verbindungen bis nach Maastricht, Valenciennes, Lüttich, Metz, Antwerpen reichte. In seinem Kontor wurde so emsig gearbeitet wie in einem Bienenstock. Bei den Bienen dreht sich freilich alles um die Königin, indes mein Vater und die anderen Patrizierfamilien alles daransetzten, den Herrscher, der in unserer Welt Kaiser heißt, mit Steuern gnädig zu stimmen, ansonsten aber von der Stadt fernzuhalten.
Der Reichswald umgibt Nürnberg von allen Seiten und ist so riesig, dass man ihn selbst dann nicht überblicken kann, wenn man am höchsten Punkt des Norenberc steht – dem Sandsteinfelsen, auf dem die Kaiserburg errichtet wurde. Manche nennen den Reichswald auch den Mantel der Stadt. Doch ein Mantel schmiegt sich sanft an den Körper, wohingegen zwischen der Stadt und dem Wald ein schmaler, abgeholzter Streifen Land liegt – das Knoblauchsland, auf dem die Menschen auf kargem Boden Gemüse anbauen. Auch quer durch den Wald hat man Schneisen geschlagen – Straßen, die nicht nur nach Bamberg oder Regensburg, sondern auch zur besagten Quelle des Eremiten Sebald führen.
Es hätte nicht gereicht, bloß meine Hände ins Wasser zu tauchen und einen Schluck aus der heilsamen Quelle zu trinken. Nein, Tante Gerhaus hatte geraten, mich gänzlich darin unterzutauchen und dazu einen lateinischen Segen zu sprechen. Sobald ich prustend auftauchte und nach Luft schnappte, würde ich gleich einem Neugeborenen einen durchdringenden Schrei ausstoßen.
Bang fragte ich mich, ob unter Wasser getaucht zu werden sich so anfühlte, wie an der Zunge zu ersticken. Ich hatte schreckliche Angst davor und hielt darum beharrlich den Kopf gesenkt. So merkte ich weder, wie unser Gefährt durch eines der Stadttore fuhr, noch, wie wir die mächtige Stadtmauer, an der unermesslich lange gebaut worden war, hinter uns ließen und bald der Schatten der Bäume auf die Kutsche fiel. Nicht nur, dass ich den Wald zu diesem Zeitpunkt noch nie betreten hatte – ich wusste nicht einmal, dass dies ein Wald war, hatten meine Amme und meine Mutter in meiner Gegenwart doch vornehmlich über Dinge getuschelt, die sich innerhalb der Stadtmauern zutrugen.
Auch Agnes nannte ihn nicht so. Seit Tagen beschwerte sie sich lautstark, weil sie meinen Vater und mich begleiten sollte, und hörte auch jetzt nicht auf, schiefmäulig zu klagen. Gut möglich, dass die Quelle besondere Heilkraft besitze, ihre Umgebung jedoch sei Feindesland.
»An einem Ort, wo hohe Bäume stetig Schatten werfen, werden böse und verstockte Menschen nur noch böser und verstockter«, rief sie. Eine terra inculta sei dieser Ort, wo sich finstere Menschen mit noch finsterer Seele versteckten. Ein res nullius, wo keine rechtschaffenen Menschen leben könnten – in schönen Häusern, prächtigen Gewändern und in Gesellschaft von ihresgleichen.
Die lateinischen Worte klangen aus ihrem Mund wie ein Fluch. Vater indes wurde zunehmend gereizt, weil seine Tochter zu viel schwieg und seine neue Frau zu viel redete. Doch ich hörte nicht auf zu schweigen und Agnes nicht auf zu reden.
»Ein Erzbischof ist vor vielen Jahren im Traum in die Hölle gereist«, erzählte sie, »und als man ihn fragte, wie es dort aussehe, da sprach er nicht von Feuerseen und Eisenrosten, auf denen Sünder brieten, sondern von Bäumen, die so dicht wüchsen, dass dazwischen bloß Platz für Schwärze und Ödnis sei. Der Boden sei nicht fest, die Schritte darauf würden versinken in einer Masse, die sich der ordnenden Hand, der Formung entzieht. Zudem ersticke man an giftigen Miasmen und werde von Schlingpflanzen zu Fall gebracht. Jungfräulich sei dieser Ort, doch wenn der Jungfrau der Gebieter fehlt, dem sie sich unterwirft und der sie fruchtbar macht, wird sie zum verdorbenen, gefährlichen Weibsbild.«
Vater wurde unbehaglich zumute. Er hatte durchaus Angst vor der Hölle und auch vor dem Fegefeuer. Allerdings hatte er in seinem Testament verfügt, dass nach seinem Tode gleich mehrere Klöster einen beträchtlichen Geldbetrag erhalten sollten, um regelmäßig Seelenmessen für ihn zu lesen und dadurch seine Zeit im Fegefeuer zu verkürzen. Das musste reichen.
»Schweig!«, fuhr er Agnes nun rüde an, und diesmal hielt sie den Mund, wenn auch mehr trotzig als ängstlich. Meine Furcht dagegen wuchs immer weiter, mein Magen verkrampfte sich schmerzhaft. Vielleicht wucherte eine Schlingpflanze auch in meinem Leib und setzte gerade an, sich um mein Herz zu ranken!
Aber noch schlug es, denn ich vernahm, wie Agnes erklärte, sie müsse sich erleichtern. Wir waren kaum eine Stunde unterwegs, hatten die Quelle noch lange nicht erreicht.
Als die Kutsche hielt, stieg Agnes aus, um aufstöhnend hinter einem Gebüsch zu verschwinden, und desgleichen mein Vater, weil er sich die Beine vertreten wollte. Ich folgte ihnen, um nicht allein zurückzubleiben – nicht ohne Unbehagen, aber auch nicht ohne Neugierde.
Beim Aussteigen zögerte ich kurz, lugte bloß nach draußen. Sodann setzte ich meinen Fuß auf die Erde, ganz vorsichtig, misstrauisch, schien sie mir doch gefährlich. Als ich freilich feststellte, dass ich mitnichten versank, wagte ich ein paar Schritte und erkannte: Zwischen den Bäumen, die den Weg säumten, wartete keine Ödnis, kein Feindesland. Ich stand auf einem samtweichen tiefgrünen Untergrund, nicht auf sumpfigem Boden, der mich zu verschlingen drohte. In der Luft lag nicht der Gestank von Schwefel, wie ich es erwartet hatte, sondern ein angenehm würziger Duft. Ich war auch nicht in ewiger Nacht gefangen – das Licht, das durch die Kronen rieselte, spann vielmehr grünliche Fäden, die, wo sie den Boden sprenkelten, einen warmen Bronzeton annahmen. Ich vernahm nicht das Echo jener Wehklagen, die die armen Sünder und Verdammten ausstießen, stattdessen ein Knacken und Rauschen und Rascheln, als würden die Geister, wenn es sie denn fürwahr gab, einander fröhlich necken.
Behutsam setzte ich noch mehr Schritte auf die weichgrünen Polster, sog den herben Geruch ein, entfernte mich immer weiter von Straße und Gefährt – und stand plötzlich vor einem mächtigen braunen Riesen.
Dass die gefurchte Haut nur die dicke Borke einer Eiche war – robuster als die glatte, dünne Haut der Buche, erst recht dann, wenn sie Jahrhunderte alt war –, erkannte ich noch nicht. Ich begriff auch nicht, dass die vermeintlichen Arme des Riesen bloß kräftige Äste waren und sein feister Leib ein Stamm, der noch den gewaltigsten Stürmen trotzte, und hielt es selbstredend für möglich, dass Riesen anstelle blonder Haare grüne Blätter trugen. Dass da anstatt der Füße Wurzeln waren, die aus der Tiefe Nahrung fischten, war nicht zu sehen – zu spüren hingegen schon. Prompt stolperte ich, als ich davonlaufen wollte, über eine von ihnen und fiel dem Riesen entgegen. An seinem Barthaar schrammte ich mir das Gesicht blutig. Wie das brannte!
Mit dem Schmerz überwältigte mich die Angst. Ich wich zurück, erst einen Schritt, dann einen zweiten, dann begann ich zu rennen. Fort, fort, fort von diesem Riesen! Fort, fort, fort von der Angst! Doch die Angst verfolgte mich, holte mich ein. Selbst wenn der Riese bloß ein Baum war – andere Gestalten aus dunklen Legenden kamen mir in den Sinn. Versteckte sich dort hinten im Dickicht nicht eine goldhaarige Fee, die liebreizend anzusehen war, aber Unheil brachte? Gut möglich auch, dass in den tiefen Baumlöchern, aus denen eine rötliche, sämige Flüssigkeit perlte, bösartige Zwerge ihre Heimstatt hatten! Und dass die rosig blühende Pflanze dort, die auf dem sumpfigen Boden wogte, sich nicht nur regte, weil der Wind mit ihr spielte, sondern weil sie ein verzaubertes Wesen war, das mich anstarren, einkreisen, betasten, erwürgen wollte.
Ich lief und lief, doch der Riese war schneller. Wohin ich auch kam, der Eichenbaum war immer schon dort. Verfolgte er mich oder ich ihn? Wo war die Straße mit der Kutsche? Wo waren mein Vater, der Kutscher, Agnes? Wie hatte ich mich so schnell zwischen all diesen Bäumen verirren können? Warum konnte ich nicht schreien, nur den Mund weit aufreißen und dem schwachen Stöhnen nachlauschen, das aus dem Dickicht entkam, während ich seine Gefangene blieb?
Ich konnte diesen leisen Ort nicht übertönen. Nicht den Gedanken, der sich in mir einnistete.
Ich war allein.
Ganz allein im Wald.
VERONIKA
Veronika stand noch eine Weile am Fenster. Die melancholischen Rufe des Waldkauzes waren verstummt, ihre Erinnerungen nicht. Mit einer abrupten Bewegung schloss sie das Fenster, doch sie ließen sich nicht aussperren. Ein sachter Schmerz wanderte den Rücken hoch, er ließ erst nach, als sie sich mitsamt Schuhen und Jacke aufs Bett fallen ließ. Der Geruch der Lavendelsäckchen, die die Mutter gegen Motten in allen Schränken aufgehängt hatte, stieg ihr in die Nase, vermischt mit dem von stark duftendem Waschmittel.
Wie war es möglich, dass die Gerüche nach all den Jahren noch so intensiv waren? Wie war es möglich, dass die Erinnerungen so intensiv waren, dass sie sie nicht wieder zurückstopfen konnte in den Seelenwinkel, in den sie gehörten? Offenbar war es ihnen dort so eng wie Veronika in diesem Bett. Ihr Kinderbett, das sie in ihren Jugendjahren nicht hatte hergeben wollen, obwohl schon damals die Füße über den Rand hinausgeragt hatten. Sie hatte sich schon immer ganz klein gemacht, nun presste sie sich unwillkürlich das Kissen auf die Ohren.
Unter dem Bett stand vermutlich noch die Kiste mit den Büchern, die sie damals nicht nach Frankfurt mitgenommen hatte.
»Warum nicht?«, hatte Ilse gefragt.
»Was soll ich denn mit Kinderbüchern?«, hatte Veronika zurückgegeben.
Ein paar Schulhefte waren dabei, auch die mit den Notizen fürs Referat, das sie in der vierten Klasse der Grundschule mit Sophie gehalten hatte. Sie hatten eher gegeneinander gearbeitet als miteinander.
Sophie hätte lieber das Forsthaus inspiziert, als in Veronikas Zimmer das Referat vorzubereiten, sie hing im Stuhl und hielt den Blick auf die Wand gerichtet. Veronika hatte längst losgelegt, erzählte, dass Ulmann Stromer etliche Kinder hatte.
»Die älteste Tochter hieß Anna.«
»Wie öde«, kam es von Sophie. Sie würden sich doch nicht die Namen aller Kinder merken müssen, oder? Woher Veronika das überhaupt wisse?
Veronika hatte sich in der Gemeindebibliothek Bücher besorgt und die wichtigsten Absätze abgeschrieben. Die Bibliothekarin hatte sie misstrauisch gemustert. Die selbst gestrickte Jacke, die Schuhe, an denen Walderde haftete. An gerippten Sohlen blieb immer so viel hängen. »Du passt mir schön auf, dass du kein Eselsohr machst! Und du schreibst nichts hinein.«
Veronika hatte jede Seite glatt gestrichen, sobald sie sie gelesen hatte, mit einer Behutsamkeit und Gründlichkeit, die ihre bügelnde Mutter erfreut hätte.
Sophie, die bis jetzt das Hinterglasbild von der Wildschweinjagd betrachtet hatte, beugte sich über Veronikas Heft. Ihre Buchstaben waren winzig, aber gut lesbar. »Die wichtigsten Absätze?« Sie blätterte und blätterte, die winzigen Buchstaben nahmen kein Ende.
»Wusstest du, dass Anna Stromer …«, setzte Veronika an.
»Wenn du das alles schon abgeschrieben hast, dann müssen wir nichts mehr tun. Dann lesen wir einfach ab.«
Sie riss eine der Seiten aus dem Heft, faltete sie und steckte sie in ihre Hosentasche. »Ich will jetzt die Insektensammlung sehen.«
Veronika folgte ihr zögerlich nach unten. Lieber wäre sie bei den Büchern geblieben.
Als sie in die Stube kamen, war Ilse mit der Wäsche fertig und kochte, der Vater hatte die Insektensammlung vergessen. Seine Sendung war zu Ende, er stellte den Fernseher ab und zog wie immer den Stecker aus der Büchse.
»Na, willst du barteln?«, fragte er.
»Was ist das?«, gab Sophie neugierig zurück.
Veronika schoss die Röte ins Gesicht. Als Kind hatte sie manchmal auf den Schultern ihres Vaters gesessen, wenn er durch den Wald ging. Vage konnte sie sich erinnern, wie sie juchzend die Hände ausgestreckt hatte, um Blätter von den Bäumen zu pflücken. Hinterher waren ihre Haare voller Zweige und Blätter und ihr Gesicht voller Rindenstaub gewesen. Die Krümel, die in die Augen geraten waren, hatten sie nicht gestört. Sie hatte sich dem Wald ganz nahe gefühlt.
Als sie dem Vater zu schwer geworden war, hob er sie nicht mehr auf die Schultern, aber zu Hause durfte sie auf seinem Schoß sitzen. In solchen Situationen wusste Josef Pichler nicht so recht, was man mit einem Kind anfing, also zog er sie an sich und rieb seinen spitzen Bart scherzhaft an ihre weichen Kinderwangen. Das hatte stets gebrannt, was Veronika aber nicht störte. Sie hatte sich dem Vater ganz nahe gefühlt. Irgendwann wollte sie das nicht mehr – nicht das Brennen, nicht die Nähe zum Vater.
»Feigling«, sagte der Vater, als sie die Mutprobe ablehnte.
Als solche betrachtete es Sophie. »Ich traue mich.« Sie ging auf Veronikas Vater zu mit dem Blick eines Toreros, der den Stier zum Kampf herausfordert.
Als Sophie später von ihrer Mutter Nora abgeholt wurde, war ihr Gesicht von Kratzern übersät. »Du lieber Himmel, was ist denn mit dir passiert?«
Veronika war ebenfalls rot, vor Scham. Sie hatte Sophie den schmalen Waldpfad zum Auto begleitet und zog nun den Kopf ein, während Sophie stolz vom Barteln berichtete.
Nun wurde auch Noras Gesicht rot. Sonst war sie immer sehr blass, der Hautton unterschied sich fast nicht vom weizenblonden Haar. Dünn war sie auch. »Ein Mensch, den’s umweht«, hatte Veronikas Mutter über sie gesagt. Veronika war nicht sicher, ob das stimmte. Nora kam schließlich aus dem Norden, und dort gab es das Meer, das, anders als die Berge und der Wald, den Wind nicht bremste. Wer dort nicht umgeweht wurde, blieb auch hierzulande stehen.
Als sie jetzt hochblickte, schien Nora etwas zu wanken.
»Er hat … was gemacht?« Die Stimme klang ähnlich vorwurfsvoll wie an dem Tag, als Ilse vorgeschlagen hatte, Sophie solle zum Forsthaus laufen, so weit sei es nicht, nicht von der Schule, nicht von der Reihenhaussiedlung, wo sich nicht nur das Heim der Familie, sondern auch die Hausarztpraxis von Sophies Vaters befand.
Veronikas Gesicht glühte nun regelrecht, obwohl sie mit den Barthaaren nicht in Berührung gekommen war. Auch ihre Stimme klang zerkratzt. »Das … das ist ein Brauch«, sagte sie schnell, »ein typisch fränkischer Brauch.«
Nora hob etwas argwöhnisch die Braue, hinterfragte es aber nicht. Nach ihrem Umzug in den Reichswald hatte sie sich ein Dirndl gekauft und es stolz getragen, war es in ihren Augen doch nicht nur das perfekte Outfit einer Landarztgattin, sondern machte sie auch zur »waschechten Bayerin«. Vor diesem Wort legte sie eine Pause ein, als müsste sie es in eine ganz spezielle Tonlage verpacken, wie Sanddornpralinen in Stanniolpapier.
»Ein Dirndl trägt man hier in Nürnberg übrigens nicht«, hatte ihr ausgerechnet Veronikas Mutter beim letzten Gespräch beschieden, »und wenn man Franken wie uns beleidigen will, dann sagt man ›Bayern‹ zu ihnen.«
An diesem Tag trug Nora ein langes Blümchenkleid, und nachdem sie der Tochter ins Gesicht gestarrt hatte, blickte sie an sich herunter, ein wenig verloren, als könnte sie sich nicht erklären, wie sie in diese Kleidung, in dieses Leben geraten war. »Das nächste Mal kommst du zu uns«, sagte sie zu Veronika.
»Wir sind doch fertig mit dem Referat«, maulte Sophie.
Veronika wollte gerne wissen, wie eine Landarztgattin lebte. »Noch lange nicht«, sagte sie. »Wir müssen noch viel mehr vorbereiten.«
Der Garten vor Noras frisch verputztem Einfamilienhaus hatte Ähnlichkeiten mit den Blumenbeeten der Mutter, wenn eine große Schlacht gegen den Wald ausgestanden war: Da war nur feuchte braune Erde, noch glatter als bei Ilse. »Der Rasen kommt bald«, sagte Nora, »ich werde dann auch etwas anbauen. Was sind denn typisch bayerische Blumen?«
Veronika dachte an die Vergissmeinnicht der Mutter, an die Geranien auf dem Balkon, wusste aber nicht, ob das typisch bayerisch war.
Gartenschmuck wolle sie natürlich auch haben, fügte Nora hinzu. An einen Edelrosthirsch habe sie gedacht. Oder ein Rotkehlchen aus Metall. Das könnte man auf ein Zweiglein des Apfelbäumchens setzen, das sie pflanzen würde.
»In unserem Garten haben wir so was nicht«, sagte Veronika und verschwieg das echte Wild, das diesen heimsuchte.
Im Forsthaus gab es auch keine Fußbodenheizung, sie wunderte sich, warum der weiße Steinboden im Flur hier so warm war. Auch in der Küche war alles weiß. Vielleicht lebten Ärzte so? Etwas unpassend war das Kruzifix, das an der Wand hing und das Nora, wie sie berichtete, kürzlich auf einem Flohmarkt erstanden hatte. »Wieso bleibst du denn im Flur stehen?«
Betreten schaute Veronika auf den beheizten Steinboden und dachte an das Mitbringsel, das ihre Mutter ihr heute Morgen in den Schulranzen gepackt hatte, um sich für die Sanddornpralinen zu revanchieren: frische, hausgemachte Rehwurst, grob in Frischhaltefolie gewickelt statt hübsch in knisterndem Stanniolpapier verpackt. Im kleinen Schuppen im Garten zog Ilse den geschossenen Tieren die Haut ab, weidete sie aus und drehte sie durch den Fleischwolf. Als Sophie vorhin einen Blick darauf geworfen hatte, hatte sie gefragt, warum sie Zombiefinger durch die Gegend schleppe. Nun traute Veronika sich nicht, das Gastgeschenk zu überreichen.
»Hast du Hunger?«, fragte Nora.
Heute trug sie kein Blümchenkleid, sondern Jeans und T-Shirt, aber die dünnen blonden Haare hatte sie zu Zöpfen geflochten. Wegen ihres schicken Stufenschnitts hatten sich etliche Strähnen gelöst. Lasse, der fünfjährige Bruder von Sophie, kam die Treppe heruntergesaust.
»Sag ›Servus, Vroni!‹«, forderte Nora ihn auf.
Lasse starrte sie nur misstrauisch an.
»Grüß Gott«, sagte Veronika, »Sophie nennt mich Veronika, so möchte ich gerne gerufen werden. Ich habe keinen Hunger, wir können loslegen.«
Sophie verdrehte die Augen. Aus einer der weißen Küchenladen hatte sie etwas Längliches hervorgezogen, das Ähnlichkeit mit einer Blindschleiche hatte, allerdings grellrot war. Sie stopfte es in den Mund, ihre Zunge färbte sich ebenfalls rot. »So eine Streberin«, spöttelte sie.
»Jetzt zeig ihr dein Zimmer. Und vor dem Mittagessen gibt es keinen Süßkram mehr.«
Die restliche Blindschleiche verschwand in Sophies Mund, sie winkte Veronika, ihr zu folgen.
Veronika dachte an die Rehwürste, zögerte wieder. Sophie hatte sie nicht nur mit Zombiefingern verglichen, sondern auch mit getrockneter Hundescheiße. Am Ende ließ sie die Würste im Ranzen und folgte Sophie in ihr Zimmer. Lasse rannte ihnen aufgeregt hinterher, er wollte zur Hängematte, die dort hing. Veronika hatte noch nie eine Hängematte in einem geschlossenen Raum gesehen. Lasse zog sich mit beiden Händen am Strick hoch, der darüber baumelte.
»Mein Papa und ich klettern viel«, erklärte er. »Und Surfen gehen wir auch. Mein Papa liebt die Seen und auch die Berge, deswegen leben wir in Bayern.«
»Halt doch mal die Klappe!«, rief Sophie ungehalten.
»Stör sie nicht, Lasse!«, mischte sich Nora ein. »Sie müssen in Ruhe arbeiten.« Lasse hörte nicht. Veronika erzählte, dass sie noch mehr über die Stromer gelesen habe, Sophie hörte auch nicht.
Als Veronika später nach Hause kam, lagen die Rehwürste immer noch im Ranzen. Sie wusste nicht, wohin damit. Wenn die Mutter sie entdeckte, würde sie die Würste womöglich selbst übergeben. Schließlich nahm Veronika sie aus der Frischhaltefolie und vergrub sie in einem der aufgewühlten Gartenbeete.
Zwei Tage später fand sie die Würste im Müll. Ilse fragte nie, warum sie Nora die Rehwürste nicht gegeben hatte, und Veronika fragte nie, warum sie sie wortlos weggeworfen hatte, statt sie dafür zur Rede zu stellen. Sie sprachen auch nie über die Sanddornpralinen. Bis heute wusste Veronika nicht, ob Ilse bemerkt hatte, dass sie heimlich genascht und danach immer wieder die Schleife ums Stanniolpapier drapiert hatte.
Als sie das Referat hielten, trug Sophie eine weiße Spitzenbluse. Veronika trug eine alte Cordsamthose und die selbst gestrickte Weste, an ihren Schuhen klebte verkrusteter Schlamm, weil es am Tag zuvor geregnet hatte. Veronika starrte auf den Schlamm und verknotete ihre Hände hinterm Rücken, während Sophie lächelnd in den Klassenraum blickte. Sicher und unbeirrt trug sie alles vor, was Veronika aufgeschrieben hatte.
Nora hatte den Text am Abend zuvor überflogen. »Du kannst richtig gut schreiben. Dass du das alles herausgefunden und so lebendig erzählt hast! Da bekommt man richtig Lust, mehr zu erfahren. Und was für eine großartige Idee, die Geschichte der Stromer aus der Perspektive eines Mädchens in eurem Alter darzustellen.«
Veronika hatte sich bedankt, brachte im Klassenzimmer jedoch kein Wort heraus.
»Du kannst wirklich gut frei sprechen«, lobte die Lehrerin Sophie. »Dass du das alles herausgefunden und so lebendig erzählt hast! Da bekommt man richtig Lust, mehr zu erfahren. Willst du nicht auch noch was sagen, Vroni?«
Sie öffnete den Mund, doch ihre Zunge stieß gegen die Zähne wie gegen Gefängnismauern, die Worte blieben gefangen.
»Das musst du noch üben«, mahnte die Lehrerin, ehe sie Sophie eine Eins eintrug und Veronika eine Drei minus.
Mit gesenktem Kopf schlich sie zu ihrem Platz.
»Hast du etwa deine Zunge verschluckt?«, spottete einer der Jungs. In der Pause kicherten er und andere über sie, weil sie den Mund immer noch nicht aufbekam.
Am nächsten Tag begleitete Nora Sophie zur Schule. Sie hielt sie an der einen Hand und ergriff mit der anderen die von Veronika.
Sophie folgte unwillig, Veronika fügte sich ihr gerne. Noras Hand war warm und weich.
Veronika hatte keine Ahnung, was Nora vorhatte, schaffte es aber nicht, danach zu fragen. Zu Hause hatte sie tags davor ihre Sprache wiedergefunden und sich beschwert, wie unfair die Benotung war.
»So ist halt manchmal das Leben, das muss man schlucken«, sagte die Mutter.
»Noten sind eh nicht wichtig, vor allem nicht für Mädchen«, sagte der Vater.
Nora beschleunigte ihren Schritt. »Deine Lehrerin kann was erleben.«
Sophie trug keine Spitzenbluse mehr. Nach dem Unterricht gestern hatte sie sich beschwert, dass sie schrecklich unbequem sei, sie zwicke unter den Achseln und kratze am Hals. Nora wiederum hatte sich endgültig von ihren Zöpfen verabschiedet.
Ein Gespräch mit der Klassenlehrerin hatte Nora nicht genügt, sie verlangte eine Unterredung mit ihr und dem Schulleiter. Die Lehrerin blickte indigniert auf Nora, als diese im Direktorat zu einem Vortrag ansetzte. Der Schulleiter begann zu schwitzen. Wie Sophie konnte Nora wunderbar frei sprechen, aber anders als ihre Tochter lächelte sie nicht.
Es sei nicht in Ordnung, dass Veronika so schlecht bewertet worden sei, sie habe doch die ganze Arbeit gemacht, sei hochintelligent, erkenne man das hier denn nicht? Sophie habe als Akademikerkind einen Bonus, aber auf den verzichte sie gerne, sie wolle, dass Leistung zähle, und Veronika habe diese Leistung erbracht. Auch in der Provinz sollte sich herumgesprochen haben, dass Bildungschancen nicht vom Elternhaus abhängig sein dürften.
Der Direktor schwitzte stärker. Wann genau er einknickte, konnte Veronika nicht sagen. Sie starrte wieder auf ihre schmutzigen Schuhe, hob schließlich einen Fuß, streifte den Schuh am Stuhlbein des Bürotisches ab. Der getrocknete Schlamm rieselte als grauer Staub auf den grauen Boden.
Nach dem Gespräch bekam sie ebenfalls eine Eins eingetragen.
Nora ließ Veronikas Hand los und umfasste ihre Schultern, als sie sich von ihr verabschiedete. »Du bist sehr klug, sehr begabt, lass dir von niemandem etwas anderes einreden.«
Nora hatte in ihrem Garten schließlich doch nie Blumen angepflanzt. Stattdessen stand da ein riesiger Sandkasten für Lasse, den er als Kind leidenschaftlich mit seinen Baggern durchpflügte. Später begleitete er lieber den Vater, der jede freie Minute im Fränkischen Seenland surfte. Warum sonst zog man nach Bayern, wenn man die Natur nicht nutzte?
Nora wollte die Natur nicht nutzen, und das Surfen machte ihr Angst, und überhaupt, könnten sie nicht öfter etwas gemeinsam machen? Die Praxis, der Wassersport, wo bleibe da Zeit für sie, die für ihn alles aufgegeben hatte, die Heimat, das Studium der Literaturwissenschaften? Mit den Jahren stritten sie immer lauter.
Sophie war das peinlich. Manchmal drehte sie in ihrem Zimmer laut Musik auf und sagte zu Veronika: »Am liebsten würde ich abhauen.«
Veronika konnte das nicht verstehen. Sie mochte es zwar auch nicht, wenn Nora und der Doktor sich stritten, aber wenn er erst mal mit seinem Bord ausgerückt war und Nora Sophie bat, die Musik leiser zu stellen, und diese auf Kopfhörer umstieg, winkte Nora Veronika immer in den Raum ganz oben unter den Dachschrägen, ihre Bibliothek.
»Du kannst dir alle Bücher ausleihen, wenn du magst«, sagte sie. Manchmal nahm Veronika tatsächlich eins mit, aber am liebsten las sie auf dem Schaukelstuhl gleich neben der Bücherwand.
»Man sieht dich ja gar nicht mehr«, klagte die Mutter. »Kommst immer später heim.«
Veronika zuckte die Schultern. Sie konnte Ilse nicht erklären, dass die tägliche Rückkehr ins Forsthaus für sie kein Heimkommen war.
In den folgenden eineinhalb Jahren nach dem Sachkundereferat wurde Nora mehrmals beim Direktor vorstellig, um sich über Veronikas Noten zu beschweren. Schließlich marschierte sie entschlossen zu Veronikas Eltern.
»Das Kind muss aufs Gymnasium«, erklärte sie ohne Umschweife.
Der Vater reinigte gerade sein Gewehr, die Mutter eine Mausefalle. Der Wald war ein listiger Gegner, der nicht nur große Tiere zum Kriegsdienst einberief. Es war eine Einmal-Mausefalle, doch die Mutter verwendete sie mehrmals, wusch sie in der Spüle ab und stellte sie neben das umgedrehte Kaffeegeschirr zum Trocknen hin.
Noras Blick wanderte erst über die Mausefalle, dann zum Gewehr. »Die Waffen werden aber schon in einem abgeschlossenen Schrank untergebracht?«
Der Vater sah sie begriffsstutzig an. Das einzig Gefährliche in diesem Raum war für ihn diese Frau, die seine Tochter aufs Gymnasium schicken wollte.
»Gymnasium?«, fragte er gedehnt.
»Ja, ich will wirklich dorthin«, schaltete sich Veronika ein.
Die Mutter betrachtete sie zweifelnd wie ein feindliches Tier, von dem sie nicht wusste, mit welcher Methode sie ihm zu Leibe rücken sollte. Mit Eindringlingen hatte sie Erfahrung. Aber mit Ausreißern?
»Das … das musst du entscheiden«, murmelte sie schließlich.
Sie wusste wohl selbst nicht, an wen sie diese Worte richtete. An ihren Mann, der eilig das Gewehr wegräumte? An Veronika, die Angst vor der eigenen Courage bekam, je länger die peinvolle Stille währte?
Wer nicht gemeint war, war Nora. Und doch war sie diejenige, die nun grimmig nickte und damit die Sache besiegelte.
Sie entschied auch, welches Gymnasium es sein sollte, und dass Veronika in der sechsten Klasse Nachhilfe in Mathematik bekam. Das Fach war Veronikas größte Schwäche, aber daran sollte es nicht scheitern. Der Lehrerin, die einen Wechsel auf die Realschule vorschlug, erzählte Nora was. Veronika wiederum erzählte sie von ihrem Studium und wie sehr sie bereute, es abgebrochen zu haben. Nora entschied auch, dass Veronika sich in der siebten Klasse für das Wahlfach Literatur anmeldete, das sei ihr Ding, und in der Abiturklasse beschaffte sie ihr diverse Broschüren. Fünf Dinge, die du nach dem Abitur machen solltest. – Steile Karriere oder erst mal leben? – Das passende Studium finden. Sie durchblätterten sie gemeinsam, saßen im Herbst und im Winter in der Bibliothek und im Frühling und im Sommer im Garten. In der verwaisten Sandkiste verrotteten ein Schildkrötenförmchen und ein kleiner Drache.