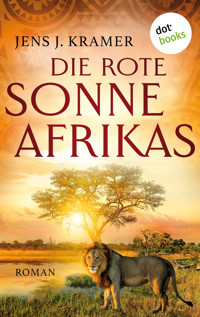1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine mutige Frau und die Herausforderungen ihrer Zeit: Der farbenprächtige Roman »Das Lied von Afrika« von Jens J. Kramer jetzt als eBook bei dotbooks. Ein dunkler Sturm braut sich über dem afrikanischen Kontinent zusammen … 1894 bricht die junge Mary Cooley als erste weiße Frau ins Nigerdelta auf: Hier soll sie für die Royal Geographic Society Forschungen anstellen – und ist sofort fasziniert von dem farbenprächtigen Land und seinen außergewöhnlichen Menschen. Doch schon bald muss sie erkennen, dass viele ihrer Landsleute nur nach den Bodenschätzen Nigerias gieren. Schon lange schwelt der Konflikt mit den Einheimischen … und es braucht nur einen Funken, um ein verheerendes Feuer zu entzünden. Als Mary den Flusskapitän und Schmuggler Charles DeCardi kennenlernt, den ein gefährliches Geheimnis mit den Aufständischen verbindet, ist ihr Herz schon bald zerrissen zwischen zwei Welten … Inspiriert durch die wahre Geschichte der jungen britischen Forscherin Mary Kingsley und ihrer Reisen: »Zwischen Liebe und Grausamkeit, Macht und Verrat spielt Jens J. Kramer nach exzellenter Recherche virtuos mit Zutaten, die das Buch zum starken Stück machen.« Hamburger Abendblatt Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der mitreißende historische Roman »Das Lied von Afrika« von Jens J. Kramer, auch unter dem Titel »Das Delta« bekannt. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 683
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über dieses Buch:
Ein dunkler Sturm braut sich über dem afrikanischen Kontinent zusammen … 1894 bricht die junge Mary Cooley als erste weiße Frau ins Nigerdelta auf: Hier soll sie für die Royal Geographic Society Forschungen anstellen – und ist sofort fasziniert von dem farbenprächtigen Land und seinen außergewöhnlichen Menschen. Doch schon bald muss sie erkennen, dass viele ihrer Landsleute nur nach den Bodenschätzen Nigerias gieren. Schon lange schwelt der Konflikt mit den Einheimischen … und es braucht nur einen Funken, um ein verheerendes Feuer zu entzünden. Als Mary den Flusskapitän und Schmuggler Charles DeCardi kennenlernt, den ein gefährliches Geheimnis mit den Aufständischen verbindet, ist ihr Herz schon bald zerrissen zwischen zwei Welten …
Inspiriert durch die wahre Geschichte der jungen britischen Forscherin Mary Kingsley und ihrer Reisen: »Zwischen Liebe und Grausamkeit, Macht und Verrat spielt Jens J. Kramer nach exzellenter Recherche virtuos mit Zutaten, die das Buch zum starken Stück machen.« Hamburger Abendblatt
Über den Autor:
Jens J. Kramer, Jahrgang 1957, studierte in Berlin Ethnologie und Publizistik. Der historische Roman »Die rote Sonne Afrikas« über die Kolonialzeit war sein Debüt, dem weitere Romane folgten. Als Jo Kramer schrieb er außerdem romantische Komödien, als Mike Schulz Krimikomödien und zusammen mit seiner Ehefrau, der Bestsellerautorin Nina George, ist er Jean Bagnol, der Erfinder des provenzalischen Ermittlers »Commissaire Mazan«. Ebenfalls mit Nina George als Autorenduo veröffentlicht er seit 2022 Kinderbücher. Seit 2017 ist er Vorsitzender des SYNDIKATS. Heute lebt Jens J. Kramer in Berlin und der Bretagne.
Die Website des Autors: www.jensjohanneskramer.de
Jens J. Kramer veröffentlichte bei dotbooks auch seinen Roman »Die rote Sonne Afrikas«.
***
Aktualisierte eBook-Neuausgabe Dezember 2022
Dieses Buch erschien bereits unter dem Titel »Das Delta« 2007 im Fredebold und Fischer Verlag und 2010 als vollständige Taschenbuchausgabe bei Knaur.
Copyright © der Originalausgabe 2007 bei fredebold & partner gmbh
Copyright © der aktualisierten Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-98690-427-2
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Das Lied von Afrika« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Jens J. Kramer
Das Lied von Afrika
Roman
dotbooks.
»There are many ways to take
Of the eagle and the snake,
And the way of a man with a maid;
But the sweetest way for me
Is a ship upon the sea
On the track of the North-East trade.«
Rudyard Kipling
Kapitel 1Schmuggel
Die Nacht schien aus den Sümpfen emporzuwachsen. Oberhalb der niedrigen Wipfel der Mangrovenbäume sandte die untergehende Sonne ihr letztes Licht in die tief hängenden Wolken. Darunter verdichtete sich die Dunkelheit. Und die Stille. Es war die Stunde der Dämmerung. Jene kurze Zeit, in der alles den Atem anzuhalten schien. Denn die Nacht würde keinen Frieden bringen. Es war die Stunde des Hungers, in der lautlose Jäger in ihren Verstecken erwachten und mit kalten, grausamen Augen nach Beute spähten. Und Beute war alles, was lebte.
Dem schwarzen Wasser des Bonny-Flusses war nicht anzusehen, wo es befahrbar war oder wo es nur noch handbreit den schlammigen Grund bedeckte. Aber die Männer, die reglos in ihrem schwer beladenen Boot auf die heraufziehende Nacht warteten, kannten alle tückischen Eigenarten des Flusses. Sie wussten, dass manche der Seitenarme als schmale Kanäle durch den Sumpf führten und andere in morastigen, stinkenden Löchern endeten. Sie erkannten die seichten Stellen, an denen die Krokodile lauerten, die in ihrer Gier nicht davor zurückschreckten, ein Boot anzugreifen. Sie wussten, dass ein einziger Fehler den Tod bedeuten konnte. Denn der Tod lauerte überall im Delta.
Aufmerksam spähten sie durch die Mangroven zu der Handelsstation hinüber, deren Lichter die Anlegestelle am gegenüberliegenden Ufer beleuchteten. Die Gefahr, die von diesen Lichtern für die sechs Ruderer und ihren Anführer ausging, war weitaus größer als alles, was sie im nächtlichen Sumpf zu fürchten hatten. Es waren die Lichter des Feindes.
Die Männer hatten mit ihrem hochwandigen Boot einen weiten Weg hinter sich gebracht. Von den Ölmärkten im Norden, wo sie ihre Fässer mit Palmöl, dem flüssigen Gold des Deltas, gefüllt hatten, bis hinunter ins Reich der Mangroven. Auf ihrer Fahrt nach Süden waren sie oft in die Seitenarme des Nigers oder später des Bonny-Flusses ausgewichen. Zudem hatten sie den größten Teil der Strecke nachts zurücklegen müssen, immer darauf bedacht, nicht von den Wachen der zahlreichen Stationen der Company entdeckt zu werden. Diese hier stellte das letzte Hindernis auf dem Weg zur Küste dar. Sobald sie die Fässer mit dem Öl an den Mann mit den Pockennarben abgeliefert hätten, könnten sie in ihr Dorf zurückkehren, und statt Fässern hätten sie Gewehre im Boot, und Rum. Noch aber war es nicht so weit.
Als der letzte Schimmer der Sonne über den Sümpfen des Deltas verblasst war, gab der Anführer das Zeichen. Mit lautlosen Schlägen ihrer langen Paddel steuerten die Schmuggler das Boot aus seinem Versteck in den Fluss, bis die sanfte Strömung es erfasste. Langsam näherten sie sich den Lichtern, die in der feuchten Luft zerfasert wirkten. Sie hielten größtmöglichen Abstand zu ihnen. Unter der dichten Wolkendecke, die jegliches Sternenlicht absorbierte, war das Boot nur ein weiterer Schatten in der Dunkelheit.
Der Anführer war sich bewusst, dass sie ein hohes Risiko eingingen, wenn sie um diese Zeit die Station passierten. Besser wäre es später in der Nacht, in der Stunde vor dem Morgengrauen, wenn den Wachen vor Müdigkeit die Augen zufielen. Aber seine Männer waren erschöpft. Zu viele Stunden hatten sie schon in irgendwelchen übel riechenden Tümpeln gewartet, weil die Boote der Company auf dem Fluss unterwegs waren, eingehüllt in Tüchern, um den blutgierigen Moskitos möglichst wenig freie Haut darzubieten. Noch mehr als das Rudern zehrte das untätige Warten ihre Kraft auf. Nein, es war besser, jetzt die Durchfahrt zu wagen. Niemand würde damit rechnen. Der Anführer beabsichtigte, die Sache schnell hinter sich zu bringen. Er wies seine Ruderer an, weiter in die Mitte des Stromes zu steuern. Dort war die Strömung kräftiger und würde sie in kürzester Zeit an der Station vorbeitragen.
Die Station! Der Anführer fühlte brennenden Hass in seiner Brust aufsteigen, als sich die niedrigen Gebäude aus der Dunkelheit herausschälten. Es hatte eine Zeit gegeben, in der sie nicht heimlich in der Nacht über die Flüsse hatten schleichen müssen; eine Zeit, in der die Brass die alleinigen Herren des Deltas gewesen waren und die Weißen auf ihren großen Schiffen vor den Lagunen darauf gewartet hatten, dass sie ihnen die begehrte Ware brachten: Sklaven. Die Weißen waren zu schwach für dieses Land. Sie wagten es nicht, in das Delta vorzudringen. Viele starben am Fieber, während sie warteten. Manchmal war sogar keiner mehr von ihnen am Leben, wenn die Brass ihnen schließlich die Ware brachten. Ihre Schiffe verfaulten und versanken im Schlamm. Aber es kamen genug andere nach.
Keiner hatte begriffen, warum die Weißen so viele Sklaven brauchten. Für die Arbeit, sagten sie, in der Neuen Welt. Irgendwann hatte die Neue Welt jedoch genug Sklaven, und die gleichen weißen Händler fragten nach Palmöl. Wieder waren es die Brass, die ihnen das Öl brachten, denn nur sie kannten den Weg durch das Delta hinauf in den Norden, wo die Ölpalmen wuchsen. Der Handel machte sie reich, und es kamen immer mehr Weiße, die immer mehr Öl kauften. Aber dann war diese Company aufgetaucht und hatte binnen Kurzem den gesamten Handel an sich gerissen. Mit ihren großen Booten aus Eisen beherrschte sie bald alle Flüsse, und von ihren Stationen aus überwachten sie jedes Boot, das von Norden kam. Sie hatten Kanonen, und mit diesen Kanonen diktierten sie den Brass ihr Gesetz. Dafür hasste der Anführer der Schmuggler die Company.
Das Boot war schon ein Stück an der Station vorbei, als sie entdeckt wurden. Laute Rufe. Männer rannten ans Ufer. Dann fiel ein Schuss. Jetzt gab es keinen Zweifel mehr. Mit scharfer Stimme feuerte der Anführer seine Männer an. Aber die wussten, welche Gefahr ihnen drohte. Mit aller Kraft zogen sie die Ruder durch. Ein zweiter Schuss fiel. Der Anführer hoffte, dass es wie der erste ein Warnschuss war. Aber dann vernahm er das helle Zischen, mit dem die Kugel nicht weit vom Boot ins Wasser fuhr. Jetzt brüllte er: Schneller! Wie rasend holten die Männer aus. Kämpften mit jedem Ruderschlag um ihre Freiheit. Und um ihr Leben. Das schwere Boot nahm Fahrt auf. Pflügte sich durch das schäumende, schwarze Wasser. Da schlug die dritte Kugel mit dumpfem Knacken in ein Ölfass, fast gleichzeitig traf eine weitere den Ruderer im Heck in den Hals. Mit einem gurgelnden Laut fiel er zur Seite ins Boot, wo sich das Blut des Sterbenden mit dem auslaufenden Öl vermischte.
Ein anderer Ruderer wurde am Arm verletzt und verlor sein Paddel. Das Boot driftete ab. Sofort steuerten die Männer gegen. Die anderen Kugeln schlugen hinter ihnen ins Wasser. Da kamen sie endlich außer Schussweite. Damit war die Gefahr aber noch nicht vorbei. Der Anführer wusste, dass man sie verfolgen würde. Mit dem Gewicht ihrer Ladung wären sie den schnellen Patrouillenbooten der Company nicht gewachsen. Aber er wusste auch, dass sich eine Meile weiter der Fluss teilte. Von dem kleineren der beiden Seitenarme zweigte wiederum ein schmaler Wasserlauf ab. Der verlief sich zwar im Sumpf, war aber schwer zu erkennen und nur bei jetzigem Wasserstand befahrbar. Unwahrscheinlich, dass die Bootsführer der Company diesen Wasserlauf kannten. Wenn seine Männer es rechtzeitig dorthin schafften, ohne gesehen zu werden, konnten sie sich verbergen und einfach abwarten. Bis ihre Jäger die Suche aufgaben.
Ein Blick zurück zeigte ihm, dass die Verfolger bereits aufholten. Er konnte ihre Umrisse im Gegenlicht der Station gut erkennen. Sein Boot hingegen war kaum auszumachen vor der dunklen Masse der Mangroven. Der Anführer wusste, dass er diesen Vorteil ausnutzen musste. Mit leisen, scharfen Befehlen trieb er seine Männer an.
Er machte sich keine Illusionen darüber, dass man sie vielleicht im falschen Seitenarm vermuten würde. Ihre Route war vorgegeben. Sie waren das westliche Ufer entlanggekommen. Mit dem langsamen Boot in den östlichen Seitenarm zu wechseln, war nicht mehr möglich. Zumindest nicht, ohne wieder in Schussweite zu kommen. Alles hing davon ab, dass sie den toten Wasserlauf erreichten, bevor ihre Verfolger wieder Sichtkontakt hatten.
Der Anführer spähte jetzt nur noch nach vorn. Zwar hatten sich seine Augen mittlerweile so weit an die Dunkelheit gewöhnt, dass er die schwächsten Schattenvariationen ausmachen konnte. Auch wusste er um die Distanzen, wusste, wann er den Seitenarm und wann den toten Wasserlauf zu erwarten hatte. Aber das war es nicht, wonach er sich orientierte. Er war ein Mann des Deltas. Er war hier aufgewachsen und hatte schon in einem Boot gesessen, bevor er laufen konnte. So wie es seinem Vater und dessen Vater ergangen war. Alle seine Vorfahren waren Männer des Deltas gewesen. Es war sein Blut, das ihn jetzt durch die Nacht trug. Und es war das Wissen seiner Ahnen, das ihn führte.
Als sie den Seitenarm erreichten, spürte er die Flussteilung mehr, als dass er sie sah. Das Wasser floss anders, es roch anders, es sprach anders zu ihm. Er sah nicht mehr zurück. Die Biegung des Stromes verdeckte das Licht der Station. Das Boot der Company war nun genauso unsichtbar wie sein eigenes. Alle seine Sinne waren auf das rechte Flussufer gerichtet. Ein Ufer, das keines war. Denn das Wasser des Flusses hatte den Sumpf weit überflutet. Nur die Mangroven markierten die unscharfe Grenze.
Er wusste es sofort. Die Dunkelheit war nicht dunkler dort, der Schatten nicht schwärzer, aber dennoch erkannte er den Eingang auf Anhieb. Ohne ein Wort wies er seinen Ruderern die Richtung. Die gehorchten sofort, so sehr vertrauten sie ihm und seinem Wissen. Das Gefühl des Triumphes stieg wie eine Welle in ihm hoch. Trotz aller Demütigungen durch die Weißen und die Company war er immer noch ein Brass, ein Mann des Deltas. Jetzt erkannten auch die anderen die schmale Öffnung, die sich im Mangrovenwald auftat. Mit verhaltenem Schwung, um sich nicht durch Geräusche zu verraten, steuerten sie darauf zu.
Doch als sie sich der Öffnung näherten, erfasste den Anführer ein Gefühl des Widerwillens. Irgendetwas stimmte nicht. Irgendeine Stimme in seinem Inneren warnte ihn vor diesem Versteck. Es war die gleiche Stimme, die ihn unbeirrbar durch das Labyrinth sich ständig verändernder Wasserläufe führte; die Stimme des Wassers, in dem die Geister seiner Ahnen hausten. Immer hatte er auf diese Stimme gehört. Aber was sollte er nun tun? Seinen Männern sagen, dass er sich getäuscht hatte? Dass sie kehrtmachen sollten? Um sich den Häschern der Company auszuliefern? Nein! Niemals würde er sich den Gesetzen der Company beugen. Eher würde er sterben.
Aber was war mit seinen Männern? Er war ihr Anführer. Sie vertrauten ihm. Vertrauten darauf, dass er sie durch alle Gefahren führte und heil nach Hause brachte, zurück zu ihren Familien. Hin- und hergerissen zwischen seinem Instinkt und seinem Hass auf die weißen Herren des Deltas entschied er, dass die größte Gefahr, die ihnen drohte, von den Booten der Company ausging. Dieser Wasserlauf war die einzige Möglichkeit, ihnen zu entkommen. Doch die warnende Stimme in seinem Herzen verstärkte sich mit jedem Ruderschlag. Mit vor Anstrengung brennenden Augen spähte er in die ölige Schwärze, in die sie hineinfuhren.
Es schien, als wollte der Sumpf sie schlucken. Stille umgab sie. Nur ein leises Glucksen war zu hören, wenn die Bugwelle ihres treibenden Bootes sich an den Wurzeln der Mangroven brach. Sie drangen nicht weiter als dreißig Meter vor und waren schon unsichtbar für jeden, der dort draußen auf dem Fluss entlangkam. Die Männer zogen ihre Paddel ein und schauten nach hinten. Keiner rührte sich mehr. Nur der Anführer spähte nach vorne, suchte nach einem Grund für seine Ahnung oder eine Bestätigung, dass sie ihn täuschte. Sachte trieb das Boot weiter.
Er sah es nicht. Aber er hörte, wie sich etwas aus dem Wasser hob. Eine Welle rollte gegen den Bug. Das Boot schaukelte. Jetzt merkten es auch die anderen und wandten sich erschreckt nach vorn. Dort wuchs etwas Breites, Schweres aus dem Wasser empor. Ein dumpfes Grollen erklang. Dann noch mal. Ein Stück weiter. Und noch mal. Es kam von vorne, von der Seite. Überall um sie herum wuchsen aus der Dunkelheit namenlose Ungeheuer heran. Erst als sich das Nächste von ihnen umwandte und sein gigantisches Maul aufriss, erst da erkannten sie, was es war: Gewouw Roua. Wasserelefanten. Ein ganzes Rudel. Die Männer schrien auf. Hieben mit den Paddeln in das Wasser. Zurück. Nur fort.
Fassungslos starrte der Anführer auf die massigen Körper, die sich um sie herum aus dem Wasser wälzten. Die Wasserelefanten, die die Weißen Flusspferde nannten, waren die gefährlichsten Bewohner der Flüsse. Ihre Wut und Schnelligkeit machte sie unberechenbar. Aber was taten sie hier? Nie zuvor hatte der Anführer diese schrecklichen Tiere so weit südlich gesehen.
In heller Panik versuchten die Ruderer zu entkommen. Aber es war zu spät. Eine solche Begegnung mit Flusspferden überlebte niemand. Der Anführer begriff, dass er sich und seine Männer ins Verderben geführt hatte. Die Stimmen seiner Vorfahren hatten ihn gewarnt. Aber die Stimme seines Hasses war stärker gewesen.
In der Sekunde, in der der erste schwere Körper auf das Boot einschlug, begriff er, dass sein Leben in diesem Sumpf nun ein Ende fand. In seiner Brust sammelte sich alle Kraft und Wut. Und mit seinem letzten Schrei verfluchte er die Company.
Dann forderte das Delta seinen Tribut von ihm.
Kapitel 2Mary
Die Batanga lag jetzt schon tief im Wasser, aber immer noch hievten die knarrenden Hebebäume weitere Netze mit Ladung an Bord. Die junge Frau, die etwas verloren mitten im lärmigen Getriebe der Docks stand, schaute mit zweifelndem Blick auf den alten Dampfer, dessen Name unter all dem Rost und Schmutz kaum lesbar war. Mary wusste nicht, ob sie lachen oder weinen sollte. Das Schiff machte auf sie den Eindruck, als wolle es im nächsten Augenblick mit einem letzten Rülpser im öligen Wasser des Hafens versinken. Die Vorstellung, dass es ihn je verlassen könnte, dass es sie über Tausende von Meilen an eine fremde Küste bringen sollte, brachte Mary die ganze Verwegenheit ihres Vorhabens zu Bewusstsein. Der Moment der Abreise, dieses unwirkliche Etwas, das sie über Monate der Planung und Vorbereitung weitergetragen hatte, diese Vision eines Aufbruchs, mit der sie alle Ermahnungen und besorgten Versuche, sie davon abzubringen, abgewehrt hatte, kristallisierte sich im Anblick dieses schäbigen, altersschwachen Dampfers heraus.
Ein wenig wunderte es sie, dass ein so großer und sehnlich erwarteter Moment vor solch einer unspektakulären Kulisse stattfand. Aber vielleicht, dachte sie sich, ist das immer so. Die entscheidenden Ereignisse kommen nicht mit dem Hall der Fanfaren daher. Die großen Ereignisse wählen ein bescheidenes Dekor. Denn sie sind ja schon groß.
Dieser Gedanke gefiel ihr, und in seinem Licht begann sie, Zutrauen zu diesem alten Schlachtross zu fassen, dessen Narben von den vielen Reisen zeugten, die es hinter sich hatte. Sie schaute zu der Brücke hoch, hinter deren verschlierten Fenstern sie zwei Männer ausmachte. Aus dem Schornstein stieg dunkler Rauch auf, der vom Wind über den Kai getrieben wurde, die Atemwege mit seinem feinen Ruß reizte und das bucklige Pflaster schwarz färbte.
Die Batanga war nicht das einzige Schiff, das an diesem feuchtkalten, windigen Herbstmorgen 1894 im Hafen von Liverpool seinen Bauch füllte. Überall hetzten Packer und Matrosen die Docks entlang, schleppten Kisten und rollten Fässer über die hölzernen Laufstege, angetrieben von hektisch brüllenden Offizieren und Frachtaufsehern, die mit ihren schrillen Pfeifen immer mehr Ladung forderten, obwohl die Schiffe doch längst bis zum Bersten gefüllt schienen.
Kleine Jungs in schmutzigen Jacken, aus denen dünne Ärmchen ragten, huschten zwischen den Beinen der Erwachsenen hin und her. Mit hungrigen Augen lauerten sie auf Beute, sei es, dass durch Zufall eine Kiste fiel und seinen Inhalt preisgab, oder sei es, dass eine Tasche für einen winzigen Moment unbeobachtet blieb. Huren, übernächtigt und zerzaust, suchten einen warmen Platz zum Ausruhen. Krüppel und Blinde, die um Pennys bettelten, liefen vorbei. Betrunkene, die den Weg nach Hause vergessen hatten und den Teufel verfluchten. Dieses Gewühl schien einem babylonischen Tollhaus entsprungen; eine Melange aus Männern und Schmerz, Huren und Suff, Geschäft und Betrug. Aus Hoffnung, Verrat und all seinen Banalitäten.
Niemand in diesem Gewirr schien Mary Cooley zu beachten. Nur hier und da streifte sie ein neugieriger Blick, weil sie in ihrem schwarzen, hochgeschlossenen Kleid wie ein Fremdkörper wirkte, wie etwas, das man versehentlich dort abgestellt und dann vergessen hatte. Scheinbar ungerührt von dem Lärm und dem Gedränge, stand sie inmitten seltsamer Kisten und mit einer großen Tasche seitlich des Kais, der für sie zum letzten Haltepunkt ihres bisherigen Lebens geworden war.
Dass ihr das Herz heftig in der Brust schlug, merkte man Mary nicht an. Auch nicht, dass sie alles verloren hatte, was ihrem Leben bisher einen Sinn gegeben hatte. Dass sie nach dem Tod ihrer Eltern in dem Haus mit den vielen Büchern umhergeirrt war, verzweifelt auf der Suche nach einer Aufgabe, die ihr nun nutzloses Dasein in der Welt rechtfertigen konnte. Erst nach und nach, während sie die Aufzeichnungen ihres Vaters sortierte und überarbeitete, war die Idee zu diesem Vorhaben entstanden. Es war, als hätte der unruhige väterliche Geist, der aus den Aufzeichnungen sprach, von ihr Besitz ergriffen und wolle sie nun drängen, das zu vollenden, was dem Verfasser verwehrt geblieben war. Dieser rastlose Mann, den sie so grenzenlos bewundert hatte, war sein Leben lang auf der Suche nach dem Unbekannten gewesen; nach Orten, Ideen und Lebensvorstellungen, die weder auf der reellen noch auf der geistigen Karte der Zivilisation verzeichnet waren.
Sie nahm diesen Ruf an, als wäre es das Natürlichste auf der Welt. Und so empfand sie es auch, nachdem die Entscheidung einmal getroffen war. Aber die Pragmatikerin in ihr wusste auch, dass ein solches Leben ihre finanziellen Möglichkeiten überschritt. Die bescheidene Erbschaft reichte dafür bei Weitem nicht aus.
Die Lösung dieses Problems erschien eines Tages in Gestalt von Mr Cecyl Howard, einem alten Freund ihres Vaters, den sie schon seit ihrer Kindheit kannte. Mr Howard war Mitglied der Royal Geographic Society. Während sie zusammen Tee tranken und er Marys selbst gebackene Plätzchen aß, erzählte sie ihm von ihren Plänen und den damit verbundenen Schwierigkeiten. Mr Howard hörte ihr schweigend zu. Nachdem er das letzte Plätzchen mit einem Schluck Tee heruntergespült hatte, sah er sie ruhig an und fragte: »Sagen Sie, Mary, verstehen Sie etwas von Fischen?«
Sechs Monate später stand sie am Kai von Liverpool. Keiner der Matrosen oder Tagelöhner, der Huren oder kleinen Diebe wäre wohl auf die Idee gekommen, dass die schlanke, blonde Frau mit den blauen Augen und einem nur auf den zweiten Blick erkennbaren Lächeln in den Mundwinkeln auf dem Weg in eine der gefährlichsten Regionen der Welt war.
Während Mary darauf wartete, dass man sie und ihr Gepäck an Bord holte, hakte sie in Gedanken noch einmal die einzelnen Teile ihrer Ausrüstung ab. Das Wichtigste waren die Kisten, in denen die mit Spiritus gefüllten Gläser gelagert waren. Sie würde sie nicht aus den Augen lassen, bis sie fest verzurrt ihren Platz im Lagerraum des Schiffes gefunden hatten. Ihr persönliches Gepäck war vergleichsweise spärlich. Die große, wasserdichte Tasche enthielt ein zweites Kleid in hellem Grau, das einzige Zugeständnis an die tropischen Bedingungen, die sie erwartete. Des Weiteren zwei Blusen, Wäsche, Stiefel, Bücher und Schreibzeug. Dazwischen der Revolver, den sie aus der Schreibtischschublade ihres Vaters genommen hatte. Er hätte es gutgeheißen, dessen war sie sicher. Die Waffe hatte ihn auf all seinen Reisen begleitet.
Als er Mary das schwere Eisen zum ersten Mal in die Hand gedrückt hatte, um ihr die Funktionsweise zu erklären, war sie ein mageres Mädchen von vierzehn Jahren gewesen. Dr. Cooley hatte eine sehr eigenwillige Auffassung von Erziehung gehabt. Für damenhafte Tugenden hatte der cholerische Doktor wenig Sinn entwickelt. Mary war nicht in einem Salon aufgewachsen, sondern unter Männern vom Schlage ihres Vaters.
Das bekam auch Captain Olsen von der Batanga zu spüren, der es offenbar unpassend fand, dass eine junge Dame alleine reiste. Zumindest gab er Mary dies in seiner knappen, mürrischen Begrüßung zu verstehen. Als er aber aus ihren Papieren das Ziel ihrer Reise ersah, entfuhr dem Mann mit dem rotblonden Vollbart ein erstaunter Grunzer: »Verzeihung, Miss, ich hatte angenommen, dass wir Sie auf den Kanarischen Inseln absetzen.«
»Die Kanaren sollen sehr schön sein, und ich freue mich darauf, sie zu sehen. Aber leider werde ich dort nicht bleiben können.« Mary genoss die Verwirrung des Captains sehr. Mit seiner kompakten, kräftigen Gestalt und dem vollen, roten Haar erinnerte er sie an einen Wikinger.
»Aber Westafrika … ich meine … eine junge Lady?«
»Da man mich beauftragt hat, die Fischarten in den westafrikanischen Flüssen zu untersuchen, werde ich kaum darum herumkommen, dort auch hinzufahren. Ich wüsste jedenfalls nicht, wie ich anders geeignete Exemplare nach London zurückbringen kann.«
Captain Olsen starrte sie an: »Fische? Sie fahren nach Afrika … zum Angeln?«
Es dauerte noch eine ganze Weile, bis er begriff, dass Mary im Auftrag der hochehrenwerten Royal Geographic Society nach Afrika reiste. Das änderte zwar nichts daran, dass er sie für verrückt hielt oder zumindest für hoffnungslos überspannt, aber er sah ein, dass er nichts daran ändern konnte.
Mary wusste, wie sie mit bärbeißigen Männern wie ihm umzugehen hatte. Sie stellte sich vor ihn hin, sah ihm gerade in die Augen und erklärte in ruhigem Ton ihr Anliegen. Was sie nicht wusste, war, welche Wirkung der Blick aus ihren klaren, hellblauen Augen auf Männer gleich welchen Schlages ausüben konnte. Vielleicht war es die unverwandte Offenheit, mit der sie ihr Gegenüber ansah. Eine Offenheit, die nicht mit Koketterie einherging. Vielleicht war es aber auch ihr Wille, der in diesem Blick zu erkennen war. Ein Wille, vor dem Zorn oder Anmaßung kapitulieren mussten.
Das erfuhr auch der Missionar aus Kent, der ebenfalls eine Passage auf dem Schiff gebucht hatte. Reverend Jampole war ein rundlicher Mann mit lichtem Haupthaar und umso dichterem Backenbart. Der Captain, der wohl gehofft hatte, dass er Mary in die Obhut des Geistlichen geben konnte, machte sie miteinander bekannt. Leider hatte Mary von ihrem Vater nicht nur einen Revolver geerbt, sondern auch dessen herzliche Abneigung gegen jegliche Art von christlicher Mission. Außerdem blies ihr Reverend Jampole bei der Begrüßung, während er sich vertraulich zu ihr beugte, seinen übel riechenden Atem ins Gesicht. Mangelhafte Sauberkeit gehörte ebenfalls zu den Dingen, die Mary verabscheute.
Der Geistliche begann sogleich, schwungvoll über die Freuden eines gottgefälligen Lebens zu dozieren. Damit verdarb er es sich restlos mit Mary. Sie sah ihn an. Er redete. Jegliches Bemühen seinerseits, sie zur Zustimmung oder doch wenigstens zu einem kleinen Nicken zu bewegen, blieb vergeblich. Sie sah ihn einfach nur an. Nach und nach verebbte der Eifer des Reverends. Er legte eine Pause ein, wartete. Sie sah ihn an. Er sagte: »Nun … ääh.«
Daraufhin bedankte Mary sich höflich für den erbaulichen Vortrag und ließ ihn stehen.
Ihm aus dem Weg zu gehen, war nicht schwer. Reverend Jampole blieb die meiste Zeit in seiner Kabine, während Mary keine Gelegenheit ausließ, sich im Freien, an Deck, aufzuhalten. Erst als sich die Batanga aus der Irischen See in den Atlantik hinauskämpfte, kam er aus der Luke geklettert.
Mary stand zu diesem Zeitpunkt an der Reling und beobachtete die sich kreuzenden und überlagernden Wellenberge.
»Mein Kind!«, rief er mit vom Wind verwehter Stimme. Sie wandte sich um und sah ihn schwankend auf sich zukommen. Das Schlingern des Schiffes in der herbstlichen See machte ihm offenbar weitaus mehr zu schaffen als ihr.
»Mein Kind, was machen Sie denn hier draußen. Kommen Sie, ich bringe Sie in Ihre Kabine!«
Fasziniert musterte Mary das blasse Gesicht des Reverends, in dem bereits die ersten Symptome der Seekrankheit erkennbar waren. Er tat ihr ein wenig leid, aber sie hatte gerade über ein physikalisches Problem nachgedacht, und dabei hatte der Geistliche sie gestört. Außerdem gefiel es ihr nicht, dass er sie als sein »Kind« bezeichnete. Bevor Jampole vielleicht noch auf die Idee kam, sie am Arm zu nehmen und mit sich zu ziehen, entgegnete sie ihm: »Ich denke an die Seelen, Reverend.«
»Nun, das ist zweifellos sehr lobenswert. Aber ich bin sicher, dass Sie sich deswegen nicht in diesem scheußlichen Wetter … ääh, von welchen Seelen sprechen Sie?«
»Wussten Sie, dass dieser Teil des Atlantiks mit seinen Strömungen eines der gefährlichsten Gewässer der Welt ist?«
»Nein, aber wenn wir auf Gott vertrauen …«
»Und dass dort unten wahrscheinlich mehr Wracks liegen, als die Navy Schiffe zählt?«
»Aber liebe Miss, ich bin sicher …«
»Stellen Sie sich das nur vor, all die Hunderte und Tausende, die ins kalte Wasser stürzen.« Mary wies mit der Hand in die schäumenden Wellen. Unwillkürlich folgte der Blick des Reverends ihrer Geste. Seine Unterlippe zitterte ein wenig.
»Viele von ihnen waren sicherlich gläubige Menschen. Sie riefen Gott um Hilfe. Schwammen auf den Wellen und riefen um Hilfe.«
Der Reverend schwankte, als ein Brecher das Schiff traf. Unbarmherzig fuhr sie fort: »Doch alles, was diese verlorenen Menschen sahen, war ihr Schiff, das in der Tiefe versank. Und sie wussten, dass sie ihm folgen würden.«
Sie konnte in der Miene des Missionars regelrecht ablesen, wie das Bild des bodenlosen Meeres ihn überwältigte. Den Blick immer noch wie gebannt auf die See gerichtet, stieg dem frommen Mann von innen etwas die Kehle hinauf. Er presste die Hand auf den Mund, warf ihr einen entsetzten Blick zu und wankte mit mühsam unterdrücktem Würgen davon.
Hochzufrieden widmete sich Mary wieder der Dünung. Dabei fragte sie sich, wieso Pfarrer und besonders Missionare ständig meinten, sie müssten sich um alle Welt kümmern. Auch wenn niemand sie um ihren Beistand gebeten hatte. Die Art, wie Reverend Jampole sich aufführte, erinnerte sie stark an einen Pfarrer, mit dem sie schon als Kind mehrfach aneinandergeraten war. Während sie das Tuch, das ihren Hut hielt, fester zog, weil der Wind daran zerrte, versuchte sie, sich zu erinnern, wann ihr Reverend Tweedle das erste Mal aufgefallen war. War es nach der Explosion im Garten gewesen? Nein. Jetzt fiel es ihr wieder ein. Reverend Tweedle hatte bei ihrem Vater vorgesprochen, um eine Spende für die Missionsarbeit zu erbitten. Ein kleines, glucksendes Lachen entfuhr ihr, als sie an das Zusammentreffen dieser beiden ungleichen Männer dachte.
Es war kurz nach dem Einzug der Familie Cooley in das kleine Haus in Highgate gewesen. Direkt neben ihrem Grundstück befand sich eine Baptistenkirche mit dazugehörigem Pfarrhaus. Reverend Tweedle, der neue Schäflein für seine Gemeinde witterte, hatte angefangen, von der aufopfernden Arbeit der Missionare zu erzählen, als Dr. Cooley, dessen Laune an diesem Tag ohnehin nicht die beste war, ihn ruppig unterbrach. Mit wachsendem Entsetzen hatte der Pfarrer erleben müssen, wie sein offenkundig gebildeter und weit gereister Nachbar in eine Art Raserei verfiel, in deren Verlauf er die Tyrannei der Missionare auf den Inseln der Südsee anprangerte und beschrieb, wie diese aus freundlichen, sorglosen Eingeborenen düstere Puritaner geformt hatten. Wie die finsteren Gottesmänner diesen unschuldigen Menschen die Erbsünde eingebläut hätten. Ihnen unpraktische Kleidung aufzwangen. Ihre fröhliche Amoralität als schändlich geißelten. Ihnen ihre Traditionen raubten und aus ihnen seelenlose, aber folgsame Schafe machten.
Mary, die damals zwölf Jahre alt gewesen war, hatte diesen Zusammenprall der Weltanschauungen mit höchstem Interesse verfolgt. Seit diesem Tag war Reverend Tweedle ihrem Vater aus dem Weg gegangen, was immerhin den Vorteil hatte, dass er sich nicht zu beschweren wagte, als Mary eines Tages in ihrem Drang nach physikalischen Experimenten etwas über das Ziel hinausgeschossen war.
Die daraus folgende Explosion war zwar nicht so gewaltig gewesen, dass sie eine Panik ausgelöst hatte, aber für die kleine Ortschaft im Südwesten Englands doch das ungewöhnlichste Ereignis, seit Viktoria zur Königin ausgerufen worden war, und das war immerhin schon siebenunddreißig Jahre her. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, auch größerer Sachschaden entstand nicht. Lediglich die Tischdecken, die an diesem Tag im Garten von Dr. Cooley zum Trocknen aufgehängt waren, wurden mit Jauche besprenkelt. Ein paar fette Spritzer trafen auch die Fenster der Baptistenkirche von Reverend Tweedle. Mary sah seine ängstlichen Augen durch die Hecke lugen, als ihr aufgebrachter Vater sie ins Haus zerrte. Zweifellos hatte der Pfarrer es als gerechte Strafe betrachtet, dass ein gottloser Mann wie Dr. Cooley eine so missratene Tochter hatte.
Auch wenn Dr. George Cooley, der neben seinem medizinischen Fachgebiet breit gefächerte wissenschaftliche Interessen verfolgte, es nie zugegeben hätte, so trug er doch eine gewisse Mitverantwortung an den übel riechenden Flecken auf den Tischdecken und den Fenstern der Baptistenkirche. Nicht etwa, weil das Schwarzpulver aus seinen eigenen Beständen stammte und seinen Worten nach »eine besonders kräftige Mischung« darstellte. Auch nicht, weil er das Buch, in dem seine Tochter die Anleitung zum Bau von Minen fand, achtlos hatte herumliegen lassen. Nein, die Verantwortung, die einzugestehen er sich zeit seines Lebens weigerte, lag darin, dass seine Lebensführung nicht nur die Gesundheit seiner Frau ruinierte, sondern auch aus seiner Tochter eine Persönlichkeit werden ließ, die ohne überzeugende Gründe weder Gebote noch Autoritäten akzeptierte.
Dr. Cooley liebte das Abenteuer. Schon als Student hatte er den Kontinent bereist. Mit dem frischen Diplom als Mediziner in der Tasche zog es ihn nach Paris, wo er 1848 mit anderen Liberalen Barrikaden errichtete und sich prompt eine Kugel einfing. Kaum zurück in England, zog es ihn schon bald wieder in die Ferne. Die großen Reisen waren zwar ein Privileg der Oberschicht, junger Adliger, für die er aber als geschickter Arzt und durchtrainierter Mann ein willkommener Reisegenosse war. Doch bevor es losgehen sollte, heiratete er noch. Als er seinen ersten Brief nach Hause schickte, wusste er noch nicht, dass eine Schwangere ihn lesen würde. Und zu erzählen hatte er immer etwas. Mal rettete er sich von einem Schiff, das die Korallenriffe von Nukumbasanga gerammt hatte, mal durchstreifte er mit Buffalo Bill die Weiten der nordamerikanischen Prärie. Tornados, Kannibalen, Grizzlys. Sosehr seine Briefe und seine Erzählungen – wenn es ihn denn mal nach Hause verschlug – die Ängste seiner Frau zu einem Knäuel verknoteten, das sich bis an ihr frühes Lebensende nicht mehr lösen sollte, so sehr fieberte die heranwachsende Tochter jeder seiner Nachrichten entgegen. Doch viel zu kurz waren seine Briefe, viel zu selten seine Aufenthalte in dem kleinen Haus in Highgate, als dass ihre Begeisterung befriedigt oder ihr Wissensdurst hätte gestillt werden können.
Man musste dem Doktor zugutehalten, dass, wäre er ein gewöhnlicher Vater gewesen, aus Mary wohl kaum mehr geworden wäre als eine leidlich gebildete Hausfrau mit einer Vorliebe zu strenger Kleidung. So aber waren es gerade seine Abwesenheit und die viel zu seltenen Briefe aus irgendeinem verlorenen Winkel der Welt, in denen er mit unbarmherziger Detailfreude von tödlichen Gefahren erzählte, denen der Verfasser nur mit knapper Not und größtem Glück entronnen war, die die Sehnsucht des Mädchens nach Abenteuern und Weite von klein auf entfachten.
Blieben die Briefe wieder einmal eine Zeit lang aus, kam Mary ihre Fantasie zu Hilfe. Doch auch das reichte irgendwann nicht mehr. So verfiel sie den Büchern, den Ersatzgefährten in Abwesenheit ihres Vaters. Ein naheliegender Schritt, denn das kleine Haus war praktisch bewohnt von Büchern. Unzählige Bücher: Romane, Reisebeschreibungen, wissenschaftliche Abhandlungen, Zeitschriften; Bücher über Sport, Medizin und Geschichte. Und all diese kleinen Tresore voller Wissen waren in einer Weise geordnet, wie sie der Seele eines Kindes am schönsten entgegenkommt, nämlich gar nicht. Man könnte sagen, die Bücher rangen in diesem Haus um Raum wie die Bäume im tropischen Regenwald um Licht. Doch damit nicht genug, dieser Dschungel besaß ein Unterholz von Kuriositäten aus den seltsamsten Winkeln der Erde. Wollte man beispielsweise einen Stuhl freiräumen, galt es zunächst, einen Platz zu finden für Darwins The Expression of the Emotions, die Kabbala Denudata, Tristram Shandy und – halt – die Zeremonienweste eines Sioux-Medizinmannes. Darunter Lotzes Microcosmos, Mr Sponges Sporting Tour und Fitzgeralds Omar Khayyam. Schließlich steckte unter Mr Philemon Hollands Pliny die Steinaxt vom Harauki Golf, die man schon seit Ewigkeiten suchte. Ah ja, und da waren ja auch die Pfeilspitzen und das indianische Eisenornament …
Mary hatte bei der Auswahl ihrer Lektüre kaum auf Anleitung hoffen können. Wäre sie ein Junge gewesen, ihr Vater hätte nicht gezögert, ihre Ausbildung in jeder Form zu unterstützen. Marys Drang nach Bildung jedoch rief bei ihm nur ein mildes Lächeln hervor. Das blasse, schmächtige Mädchen musste ihren eigenen Instinkten folgen. Und so las, wühlte und suchte sie sich durch dieses beinah organische Durcheinander, fand immer wieder Nahrung, ließ kaum etwas aus, nippte hier, schnupperte da, probierte alles und durfte ihren Interessen folgen.
Besonders angetan war sie von Reiseberichten, die ihr anfangs quasi als Ersatz für die ausbleibenden Briefe des reisenden Vaters dienten. So fuhr sie ihm nach durch Raum und Zeit, landete im Afrika des 17. und 18. Jahrhunderts, streifte durch die Paläste persischer Potentaten oder segelte mit den berühmtesten Freibeutern und Piraten durch die Karibik.
Neben solchen, die Fantasie anregenden Schriften waren es vor allem praktische Themen, die Mary interessierten. Sei es der menschliche Knochenbau, die Newtonsche Physik oder die English Mechanic, eine Zeitschrift, in der sie Anleitungen und Hinweise fand, die sie tagtäglich zur Anwendung bringen konnte: In einem alten Haus gab es immer etwas zu klempnern oder sonst wie zu reparieren. Wenn ihr auch nicht alles gelang, so bekam sie doch im Laufe der Zeit geschickte Hände.
Da ihre Mutter leidend war, musste Mary von früh an den Haushalt besorgen. Eine Sisyphosaufgabe, die sie mit nie ermüdendem Fleiß annahm. Zur Seite stand ihr dabei lediglich eine ältere Köchin mit einem Hang zu religiösen Hymnen, die zudem die Angewohnheit hatte, regelmäßig den Ruß in der kupfernen Küchenesse mit einer Ladung Schwarzpulver wegzublasen. Mit beidem, sowohl dem Singen als auch dem Rußentfernen, hielt sich die Köchin jedoch zurück, wenn Dr. Cooley im Hause war. Der Doktor reagierte empfindlich auf Geräusche. Lärm konnte bei ihm eine ähnliche Reaktion hervorrufen wie die Erwähnung von Missionaren. Mary schaffte es häufig spielend, seinen Unmut auf sich zu ziehen. Dass sie eine Zeit lang Kampfhähne als Haustiere hielt, machte die Sache nicht gerade besser. Dr. Cooleys Wutausbrüche waren eruptiv: Meist warf er mit Büchern oder anderen Gegenständen nach der Quelle seines Ärgers. Auf diese Weise lernte Mary hervorragend, ihre Reflexe zu trainieren.
Es war denn auch in einer Zeit, in der Dr. Cooley sich ausnahmsweise in Highgate aufhielt, als es zu dem Vorfall mit den Tischdecken und Kirchenfenstern kam. Die Explosionen der Köchin hatten Mary immer mächtig beeindruckt. Als diese nun aus ängstlicher Rücksicht auf ihren Vater eine ganze Weile unterblieben, beschloss Mary, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Nachdem sie in einem Buch über den französisch-preußischen Krieg von 1870 einige Hinweise zum Bau von Minen gefunden hatte, glaubte sie sich wohlgerüstet. Leider hatte die Köchin das Schwarzpulver unter Verschluss. Doch wurde Mary nach gar nicht langer Suche im Arbeitszimmer ihres Vaters fündig. Mit seiner »Spezialmischung« gedachte sie im hinteren Teil des Gartens, verborgen hinter dem Jauchebottich, eine kleine Probezündung zu machen.
Das Experiment übertraf alle ihre Erwartungen. Die Explosion war so heftig, dass die Scheiben im Haus zitterten. Die Druckwelle warf Mary um. Benommen und mit weit aufgerissenen Augen beobachtete sie, wie der Jauchebottich barst. Die dunkle Brühe schoss in einer Fontäne in die Höhe und verteilte sich in einer einzigartigen Wolke aus Gestank.
Dass ein paar Spritzer auf Reverend Tweedles Kirchenfenstern landeten, entging ihr. Und auch, dass ihr Kleid und ihr Gesicht tüchtig etwas abbekommen hatten, wurde sie erst nach Dr. Cooleys Züchtigung gewahr, die sie übrigens schweigend über sich ergehen ließ, ebenso wie die Prophezeiung, dass sie gewiss einmal ein schreckliches Ende nehmen würde.
Die kannte Mary nämlich schon.
Die Kiellinie, die die Batanga in den Nordatlantik pflügte, verlor sich schon nach einer Schiffslänge in den schäumenden Wogen. Mary hatte in den vergangenen Jahren einiges über Meeresströmungen gelesen, aber nie Gelegenheit gehabt, deren Auswirkungen direkt zu studieren. Und genau dabei hatte Reverend Jampole sie mit seiner unbeholfenen Fürsorge gestört. Sie konzentrierte sich wieder auf die Bewegungen des Wassers und des Schiffes darin. Nach einiger Zeit musste sie jedoch feststellen, dass ihre Untersuchung unbefriedigend verlief. In diesem Wellendurcheinander war nicht die geringste Richtung zu erkennen. Also stieg sie zur Brücke hoch, um sich von einem der Offiziere das Muster anhand der Seekarten erklären zu lassen. Leider zeigten weder der Steuermann noch der Erste Offizier, der die Wache hatte, irgendein Verständnis für ihre Fragen. Mary fand es ein wenig übertrieben, mit welcher Konzentration die Männer damit beschäftigt waren, ihren Kurs zu halten. Schließlich war weit und breit nichts zu sehen, womit das Schiff hätte kollidieren können. Aber alles Nachhaken half nichts, höflich, aber bestimmt verwies der Offizier sie der Brücke.
Ähnlich ging es ihr mit dem Matrosen, den sie nach der Beschaffenheit des Tauwerks befragen wollte. Mit einem »Verzeihung, Ma’m« schob er Mary beiseite. Verärgert stellte sie sich wieder an die Reling, als ein besonders heftiger Brecher das Schiff traf und sie von oben bis unten durchnässte. Triefend und blinzelnd lief sie Captain Olsen in die Arme, der ihr kurzerhand befahl, sich unter Deck zu begeben. Sie ging in ihre Kabine, hängte das Kleid zum Trocknen über die Lüftungsrohre des Maschinenraumes, die so verlegt waren, dass sie etwas Wärme in die Kabinen leiteten, setzte sich auf ihr schmales Bett und wippte verärgert mit dem Fuß. Nach einer halben Stunde hielt sie es nicht mehr aus. Sie zog sich wieder an und machte sich auf den Weg zum Maschinenraum. Dort fand sie ein paar Stunden später der Dritte Offizier, wie sie sich mit verschwitzten Haaren und verrußten Händen von dem Maschinisten das faszinierende Zusammenwirken von Pleuel und Ventilen, Schwungrad und Kurbelwelle erklären ließ.
»Miss, der Captain wünscht Sie zu sehen.«
Auf dem Weg zur Brücke erklärte ihr der junge Mann, dass man sie überall gesucht und schon gefürchtet habe, sie sei über Bord gegangen. Entsprechend finster war der Blick Captain Olsens, als sie vor ihn hintrat. »Was, zum Teufel, denken Sie, wo Sie hier sind?«
Diese Frage kam Mary doch etwas merkwürdig vor. Sie entschied, dass der Kapitän nicht wirklich eine Antwort erwartete.
»Was laufen Sie bei diesem Wetter an Deck herum? Glauben Sie etwa, wir würden Sie wiederfinden, wenn Sie über Bord gespült werden? Da draußen findet man nichts wieder! Und ich darf mich dann vor einem Seegericht verantworten!«
Der Captain schnaubte aufgebracht, wandte sich ab und schaute durch das Fenster, an dem draußen das Regenwasser hinunterlief. Schließlich wandte er sich ihr mit einer ruckartigen Bewegung wieder zu.
»Wir sind hier nicht auf einer Ruderparty in Cambridge. Das da draußen ist der Atlantik!« Er wies mit der Hand in Richtung Bug. »Eine Mördersee! Ein Schiffsfresser! Wir haben alle Hände voll zu tun, das Schiff auf Kurs zu halten. Ich wäre Ihnen daher sehr …«, er beugte sich vor, sah sie durchdringend an und betonte jedes Wort, als wolle er es ihr eingravieren, »sehr dankbar, wenn ich nicht ständig auf Sie aufpassen müsste.«
Mary, die wusste, dass dies ein kritischer Moment war, zuckte mit keiner Wimper. Der Captain war noch nicht fertig.
»Und keiner der Passagiere, ich wiederhole: keiner … hat irgendetwas im Maschinenraum zu suchen!«
Sein Gesicht mit den buschigen, rotblonden Augenbrauen war jetzt nur noch zwei Handbreit von ihrem entfernt. Ihr fiel auf, dass die Farbe seiner Augen vom Grünlichen ins Bräunliche gewechselt war. Sie vermutete, dass dieser Effekt immer dann auftrat, wenn das Temperament seiner Vorfahren mit ihm durchbrach.
»Sie haben«, fuhr Olsen fort, »die Freiheit, sich in Ihrer Kabine aufzuhalten. Oder in der Offiziersmesse. Die Brücke jedenfalls ist ausschließlich den wachhabenden Offizieren vorbehalten.«
Er musterte sie von oben bis unten. Dabei war ihm anzusehen, dass ihr Äußeres nicht dem entsprach, was er von einem weiblichen Passagier erwartete. Tatsächlich fühlte sich ihr Kleid noch ziemlich klamm an. Auch hingen ihr ein paar Haarsträhnen ins Gesicht. Sie unterdrückte den Impuls, sie wegzustreichen, weil ihre Hände schmutzig waren und sie nicht auch noch Ruß auf ihrer Stirn verteilen wollte.
»Ich beginne, mich zu fragen«, sagte der Captain langsam, als er seine Inspektion beendet hatte, »ob man Sie vor Afrika oder Afrika vor Ihnen schützen muss.«
Mary gewann den Eindruck, dass Captain Olsen am Ende seiner Strafpredigt angekommen war. Sie hatte aus den Augenwinkeln gesehen, dass auf dem breiten Tisch neben dem Ruder mehrere Seekarten ausgebreitet lagen. Nun wies sie auf den Tisch und fragte in beiläufigem Ton: »Ist das dort eine Karte des Atlantiks?«
»In der Tat. Warum?«, fragte Olsen misstrauisch.
»Und die Linien darauf geben die Strömungen an, nicht wahr?«
»Jaah«, sagte der Captain langsam. »Und?«
»Deren Stärke und Richtung Sie natürlich kennen müssen, wenn Sie Ihren Kurs ermitteln wollen?«
»So ist es.«
Sie trat einen Schritt auf den Kartentisch zu. »Und diese kleinen Zahlen zwischen den Linien geben vermutlich die Stärke in Knoten an, nicht wahr?«
Captain Olsen starrte sie an. »In Knoten. Ganz recht.«
»Sehen Sie, Captain, ich habe mich schon immer für Navigation interessiert. Ein Schiff zu steuern heißt ja nicht, einfach nur geradeaus zu fahren. Es gilt nicht nur, den Wind zu beachten, sondern auch die Strömungen, ihre Stärke und Richtung zu ermitteln. Wenn Sie mir erlaubten, ein wenig über dieses faszinierende Handwerk zu erfahren, würden Sie mir einen großen Dienst erweisen. Natürlich nur, soweit es Sie nicht von Ihren Aufgaben abhält.«
Der Captain betrachtete sie nachdenklich, schließlich schüttelte er leicht den Kopf und wandte sich an den Dritten Offizier: »Mr Wilkins!«
»Sir.«
»Übernehmen Sie das Kommando!«
»Aye, Sir.«
Einige Tage später, als sie die Biskaya längst hinter sich gelassen hatten, ließ Captain Olsen in einem beiläufigen Satz erkennen, was ihn bewogen hatte, ihrem Wunsch nachzukommen. »Sie hätten ja eh keine Ruhe gegeben. Und solange Sie mir zuhören, kann ich wenigstens sicher sein, dass Sie keinen Unsinn anstellen.«
Zu diesem Zeitpunkt hatte er sie in gewisser Weise bereits adoptiert. Mary lernte bei diesem erfahrenen Seefahrer nicht nur die Grundlagen der Navigation. Captain Olsen legte auch ein besonderes Augenmerk darauf, sie mit den Gefahren der westafrikanischen Küste vertraut zu machen. »Das Gefährlichste sind die Felsen und Riffe, die die Küste säumen. Sie liegen fast immer leicht unter der Wasseroberfläche, sodass man sie nicht sieht. Manchmal kann man sie daran erkennen, dass die Wellen sich brechen, aber nicht immer. Schlimm sind die Strudel, die sich dort bilden.«
Olsen schilderte ihr Westafrika in einer Weise, wie sie es in keinem Buch hätte lesen können. Er übertrieb die Gefahren nicht, aber er verharmloste sie auch nicht. In unzähligen Details zeichnete er ihr ein Bild dieser Region und zeigte ihr Möglichkeiten auf, damit umzugehen. Ihr Unternehmen hielt er zwar weiterhin für unverantwortlich, aber da er sie nicht davon abbringen konnte, machte er es sich zur Pflicht, sie so gut wie möglich darauf vorzubereiten. Damit aber nicht genug, er hatte bereits weitere Pläne, was ihre Sicherheit betraf: »Wir werden in Las Palmas weitere Passagiere an Bord nehmen. Sir Claude MacDonald hält sich ein paar Tage dort auf, um mit uns weiterzureisen. Er ist der Gouverneur des Niger-Coast-Protektorats und kann Ihnen bei Ihrer Arbeit sicher behilflich sein.«
Mary war natürlich klar, dass der Captain sie damit unter die Fittiche eines weiteren Mannes stellen wollte. Aber dagegen hatte sie nichts. Von Gouverneur MacDonald hatte sie schon gehört. Der ehemalige Offizier hatte einige Jahre zuvor für die britische Regierung eine Untersuchung im Nigerdelta durchgeführt, die durch zahlreiche Beschwerden über das Vorgehen der dort ansässigen Royal Niger Company ausgelöst worden war. Sein Bericht hatte dazu geführt, dass London eine Zivilverwaltung aufgebaut hatte, die den Rechtsfrieden dort unten wiederherstellen sollte. Die Leitung über dieses Protektorat, das sich von Benin im Westen bis nach Calabar im Osten erstreckte, übergab man dem Mann, der den Bericht erstellt hatte: Sir Claude MacDonald.
Nun überschnitt sich dieses Protektorat mit dem Einflussgebiet der Royal Niger Company, die durch eine königliche Charter ebenfalls Amtsgewalt ausübte, was immer wieder zu Konflikten führte. Mary hatte keine Ahnung, was die Bürokraten des Außenministeriums sich dabei gedacht hatten. Sie fand, dass die Regierung sich für das eine oder andere hätte entscheiden müssen. Entweder sie überließ die Ölflüsse den Händlern und vertraute auf deren gesunden Menschenverstand. Oder sie annektierte das gesamte Gebiet, so wie es die Franzosen im westlich angrenzenden Dahomey oder die Deutschen in Kamerun gemacht hatten.
In ihre Überzeugung spielte aber noch eine andere, persönliche Ansicht mit hinein: Sie traute den Männern vor Ort, die wie ihr Vater waren, eine größere Kompetenz zu als den Politikern. Nun war sie gespannt, zu welcher dieser beiden Gattungen Gouverneur MacDonald gehörte.
Die Batanga erreichte Mitte November Gran Canaria. Reverend Jampole, der seit der Begegnung in der Irischen See kein Wort mehr mit Mary gewechselt hatte, eilte als einer der Ersten von Bord. Er hatte praktisch die ganze Zeit in seiner Kabine verbracht. An seinen ausgezehrten Gesichtszügen erkannte Mary, dass ihn Probleme mit der Nahrungsaufnahme geplagt hatten. Kaum dass er den Kai betrat, kniete er tatsächlich nieder und faltete die Hände zum Gebet. Mary beobachtete diese Zeremonie von der Brücke aus, wo Captain Olsen mit seinen Offizieren gerade das Bunkern von Kohle, Wasser und Lebensmitteln besprach. Als er sich zu Mary stellte, war der Missionar immer noch beim Beten. Der Captain runzelte die Stirn bei diesem Anblick.
»Ich habe Gouverneur MacDonald von unserer Ankunft informiert. Er und seine Gattin, Lady Sarah, erwarten uns heute Abend zum Dinner«, erklärte er Mary, ohne die Szene am Kai aus den Augen zu lassen. Dort waren bereits die Hafenarbeiter auf den knienden Gottesmann aufmerksam geworden. Einige näherten sich der seltsamen Gestalt. Sie betrachteten ihn neugierig und unterhielten sich offenbar über dessen sonderbares Gebaren.
»Das ist sehr freundlich, Captain Olsen. Ich freue mich darauf, Sir Claude und seine Frau kennenzulernen.«
»Vielleicht möchten Sie bis dahin ein wenig die Stadt erkunden«, bot der Captain ihr an. »Ich könnte Ihnen Mr Wilkins als Begleitung mitgeben.«
Mittlerweile hatte sich eine Menschentraube um den Missionar herum gebildet.
»Danke, das ist sehr aufmerksam. Aber ich denke, ich werde zurechtkommen. Außerdem wird hier ja jeder Mann gebraucht.« Sie wies mit einer kleinen Geste nach unten: »Der Reverend scheint übrigens weitaus weniger Vertrauen in Ihr seemännisches Können zu haben als ich.«
»Ganz offensichtlich«, nahm er ihren ironischen Ton auf. »Es handelt sich anscheinend um ein sehr langes Gebet.«
»Wird er mit uns weiterreisen?«
»Ich fürchte, ja. Seine Gesellschaft hat ihn nach Accra entsandt.«
Der Reverend schien aus seiner Versunkenheit zu erwachen und sich der Menschenmenge um sich herum bewusst zu werden. Er richtete sich etwas mühsam auf und hob die Arme in die Höhe, als wolle er die Umstehenden segnen. Zwar konnten Mary und der Captain auf der Brücke nichts hören, aber an den feixenden Gesichtern der Menschen erkannten sie, dass der Missionar zu seinem Publikum sprach.
»Was er da wohl tut?«, murmelte der Captain.
»Ich denke, er versucht, ihnen das Wort Gottes nahezubringen«, antwortete Mary vergnügt.
»Hmmh«, der Captain sah sie von der Seite an, »wir befinden uns aber auf spanischem Territorium. Das Land ist, soviel ich weiß, weitgehend christianisiert.«
Mary erwiderte den Blick. Ihre Mundwinkel zuckten ein wenig, als sie sagte: »Vielleicht weiß er das nicht. Haben Sie ihm gesagt, wo wir sind?«
»Nein, das muss ich wohl vergessen haben.« Zum ersten Mal, seit Mary an Bord war, sah sie Captain Olsen schmunzeln. Sie fand, dass es ihm gut stand.
»Er wird doch keine Schwierigkeiten bekommen?«, fragte sie mit betonter Besorgnis. »Ich meine, immerhin sind das alles Katholiken.«
Jetzt zeigte der Kapitän ein breites Wikingergrinsen. »Ich glaube nicht. Man ist hier einiges gewohnt.«
Tatsächlich begann das Interesse der Leute an dem Prediger abzuflauen. Die Menschen wandten sich einer nach dem anderen ab, um wieder ihrer unterbrochenen Beschäftigung nachzugehen. Der Reverend stand noch einen Moment unsicher da, dann trottete er ebenfalls langsam davon.
»Also, Miss Cooley, man erwartet uns um sieben Uhr«, wandte sich der Captain wieder an Mary, dem mit einem Mal bewusst wurde, welches Einverständnis mittlerweile zwischen ihnen herrschte. Ohne dass sie es verhindern konnte, löste dies in ihr eine Folge von Gedanken aus, die sich so ungewohnt anfühlten wie der Anblick der Insel, vor der die Batanga lag. Mit einem Mal sah sie in dem Captain nicht mehr nur den väterlichen Freund, sondern auch den Mann, der er war. Das führte sie schlagartig zu der irritierenden Vorstellung, dass er in ihr vielleicht auch die Frau sehen könnte, die sie war.
»Wir sollten um sechs Uhr dreißig aufbrechen«, fügte Olsen hinzu. »Seien Sie bitte rechtzeitig wieder hier.«
Was sie beinah noch mehr verstörte als die Wirkung ihrer Weiblichkeit, war die Unberechenbarkeit, mit der diese Assoziationen, kleinen Funken gleich, durch ihren Verstand schossen. Und die Geschwindigkeit, mit der sie wieder verschwanden, nichts weiter zurücklassend als die Erinnerung an ein irreales Bild. Doch all dies ließ sie sich nicht anmerken. Nur ihre Stimme fühlte sich weicher an, als sie ihm antwortete: »Natürlich, Kapitän Olsen. Bis heute Abend.«
»Bis heute Abend, Miss Cooley.«
Kapitel 3In der Hölle
»There are many ways to take …«
Der massige Mann setzte die Flasche an und nahm einen ordentlichen Schluck, bevor er weitergrölte:
»Of the eagle and the snake.«
Wieder trank er aus der Flasche, ein Rinnsal des goldgelben Getränkes lief ihm die stoppelige Wange herab. »Nattern«, flüsterte er heiser, als er durch das Fenster im ersten Stock des Hauses ins Dunkel hinaussah, wo er die Hütten der Eingeborenen wusste. Sein Gesicht verzog sich vor Abscheu. »Dreckiges Pack«, stieß er hervor. Er wusste, dass sie ihn bestahlen, allen voran die kleine Hure, die er sich ins Haus geholt hatte. »Dreckspack«, wiederholte er, diesmal lauter. Dann stieß er das Fenster auf und brüllte in die Nacht hinaus: »Verdammtes Gesindel, ihr werdet mich nicht mehr betrügen!«
Er bemerkte eine Bewegung am Bootssteg. Näherten sich dort geduckte Schatten seinem Haus? War es so weit? Diesmal würden sie ihn vorbereitet finden. Mit einem Satz war er am Tisch, griff nach dem Revolver, drehte die Flamme der Petroleumlampe herunter und stellte sich neben das Fenster. Wo waren sie? Hatten sie das Haus bereits erreicht? Waren sie dabei, einzudringen?
Unten am Ufer. Da schlich etwas heran. »FAHRT ZUR HÖLLE«, brüllte er und schoss. Einmal, zweimal, dreimal. Erschreckte Schreie. Hatte er sie erwischt? Von den Mündungsfeuern geblendet, erkannte er nichts mehr in der tintigen Schwärze. Nur drüben, vor dem Wald, leuchteten die Lehmmauern des Dorfes im Schein der Kochfeuer.
Mit einem Mal erfasste den massigen Mann bleierne Müdigkeit. »Dreckspack«, murmelte er wieder. Er ging zurück zum Tisch, ließ sich auf den Stuhl sacken und tastete nach der Flasche. Die Hand mit dem Revolver lag auf der rissigen Tischplatte. Er hatte Hunger.
»There are many ways to take«, brummte er mit schleppender Zunge, »Of the eagle and the snake …« Wo blieb die Hure mit dem Essen? Kleines schwarzes Miststück. Sie hatte ihn reinlegen wollen, wie all die anderen. Aber er hatte es ihr gezeigt. Ihn würde niemand mehr reinlegen. Er war clever. Aber verdammt, es war nicht einfach. Auf der einen Seite die schwarzen Affen, denen nicht über den Weg zu trauen war. Auf der anderen Seite die verfluchte Company, die ihn um sein Geld betrog.
»And the way of a man with a maid.« Er lachte laut auf. Wo blieb die Hure mit dem Essen? Er richtete sich auf, wankte, dann stieß er sich vom Tisch ab, in der einen Hand die Flasche, in der anderen den Revolver. Stapfte durch die Tür in den Flur, zur Treppe. Unten im Kontor brannte Licht.
»Hey, kleine Hexe«, rief er und zielte mit der Waffe nach unten, aber nichts rührte sich. Hatte sich wahrscheinlich wieder aus dem Staub gemacht. Aber sie würde zurückkommen. Wo sollte sie auch hin? Keiner wollte eine Hure in seinem Haus haben. Sie würde wiederkommen. Und dann? Eine Tracht Prügel, und sie würde wieder spuren.
Er torkelte zurück in sein Zimmer: »… a man with a maid.« Er führte die Flasche an den Mund und trank, bis er keine Luft mehr bekam. Der letzte Schluck schwappte ihm über das Hemd.
»But the sweetest way for me
Is a ship upon the sea.«
Misstrauisch sah er sich um, die winzige Flamme in der Lampe beleuchtete nur noch die Tischplatte. In den Schatten um ihn herum waberte Leben. Seine schwitzigen Finger packten den Griff des Revolvers fester.
Verdammt! Es war ein gutes Land gewesen, als sich noch keiner darum scherte, was man machte. Von denen, die ihm jetzt Vorschriften machten, hätte keiner überlebt damals. Jetzt taten sie so, als wäre das alles ihr Werk. Die feinen Pinkel ahnten ja nicht, was ihnen blühte. Glaubten, sie hätten alles im Griff. Aber er wusste es besser.
Er wusste von den Waffen. Und was die Brass vorhatten. Er wusste auch von dem Pakt mit Calabar, und wer noch alles mit drinsteckte. Der massige Mann lachte auf, aber es wurde nur ein Husten. Warum sollte er die Company warnen? Wenn es losginge, würde er schon seinen Schnitt machen. Das hatte er immer geschafft. Er musste nur aufpassen, dass sie ihn nicht mit hochnahmen. Musste ihnen zeigen, dass sie mit ihm nicht so leicht umspringen konnten.
Er trat ans Fenster und spürte, wie die Galle in ihm hochstieg. Voller Wut schoss er hinaus, einmal, zweimal: »Feiges Pack«, murmelte er, »werd’s euch zeigen. »But the sweetest way …«, sang er, als er sich wieder setzte und die Lampe hochdrehte.
Während er in seiner Hosentasche nach Patronen suchte, schnaubte er verächtlich aus. Hatten alle Dreck am Stecken. Und wollten ihm erzählen, wie man mit dem schwarzen Pack umzugehen hatte.
Er fummelte an seinem Revolver herum, schaffte es aber irgendwie nicht, die Verriegelung der Trommel zu öffnen. »Mistding«, murmelte er. Aber zuerst würde er es der Hure besorgen. Schon die Vorstellung machte ihm Spaß.
»But the sweetest way for me
Is a ship upon the sea.«
Was war nur mit diesem blöden Ding los.
»On the track of the North-East trade.«
Ein Hustenanfall ließ ihn vornüberkippen. Die Hand mit der Pistole schlug auf den Tisch. Der massige Mann vernahm noch das Klicken, mit dem der Hahn auf die letzte Patrone schlug. Den Schuss hörte er schon nicht mehr.
Die Kugel schlug unterhalb seines linken Auges ein. Das Loch, das sie beim Austritt aus seinem Hinterkopf verursachte, war beträchtlich größer. Als er mitsamt dem Stuhl hintenüberkippte, war das Geräusch seines Aufpralls fast so laut wie zuvor der Schuss. Keiner im Dorf kümmerte sich darum, nur einige Köpfe wandten sich dem Haus des weißen Händlers zu. Sie würden sich hüten, dem Haus näher zu kommen, wenn er in dieser Stimmung war. Die Frau allerdings, die bei ihm lebte, kauerte verängstigt in ihrem Verschlag hinter der Kochstelle. Sie hatte keine Wahl.
Kapitel 4Erbsenpüree
»Kannten Sie John Bartholomew?«
»Hmmh, ziemlich gut sogar.« Der Doktor legte seine wulstige Stirn in Falten und wiegte bedauernd den Kopf, ohne sich dabei allzu sehr von seiner Mahlzeit ablenken zu lassen.
»Tja, armer Kerl«, schob Kapitän Olsen nach, während er sein Stück Braten in Angriff nahm. »Hat sich noch eine halbe Meile weit geschleppt, nachdem ihm ein Krokodil das halbe Bein weggefressen hatte.«
»Wäre auch noch weiter gekommen«, nuschelte der Doktor durch das Erbsenpüree, mit dem sein schadhaftes Gebiss besser zurechtkam als mit dem Fleisch, »wenn er nicht so dick gewesen wäre.« Ein Glucksen stieg aus seinem behäbigen Leib empor und stieß in der Kehle auf das Püree, woraufhin es sich in ein heftiges Husten verwandelte. Schließlich löste sich das Problem mit einem explosionsartigen Knall.
»Na, na«, murmelte Olsen, während er das hochrote Gesicht des Doktors musterte, »wir haben immerhin Damen mit am Tisch.«
»Verzeihung, Ladys«, röchelte der Doktor und tupfte sich den Mund mit der Serviette ab.
Tatsächlich machte Lady Sarah MacDonald einen etwas befremdeten Gesichtsausdruck. Aber als einziger englischer Arzt auf der Insel genoss Dr. Tolman weitgehende Narrenfreiheit. Außerdem hatte er mehrere Jahre in Afrika zugebracht, was ihm in dieser Tischrunde eine gewisse Reputation verlieh.
Die Kanaren waren ein beliebter Erholungsort für all diejenigen, die dem mörderischen Klima Westafrikas für eine Weile oder sogar für immer entfliehen wollten. Sei es, um irgendwelche Tropenfieber auszukurieren, oder auch nur, um mal wieder den frischen Wind der nördlichen Hemisphäre zu spüren. Zwar träumten sie alle von den grünen englischen Gärten, doch die meisten vertrugen die Kälte Großbritanniens nach all den Jahren in der schwülen Hitze des Äquators nicht mehr. So hatte sich auf diesen Inseln eine kleine englische Kolonie gebildet, für die die Erinnerung an Afrika oder auch die Freude, es überlebt zu haben, das Hauptgesprächsthema war. Mary genoss die Geschichten, die sich diese »coaster« erzählten. Außerdem war sie selbst Tochter eines Arztes und nicht so schnell zu schockieren, auch nicht von hungrigen Krokodilen.
»Es ist sicherlich nicht ratsam«, meinte Lady Sarah, indem sie sich zu Mary beugte, »sich einer solchen Gefahr auszusetzen.«
Mary nahm einen etwas süßlichen Parfümgeruch wahr, dessen pflanzliche Komponenten sie nicht recht ausmachen konnte. Er erinnerte sie an Veilchen. Belustigt stellte sie fest, dass sie selbst nicht einmal daran gedacht hatte, Parfüm mitzunehmen.
»Na, was denn, das Biest ist ihm ins Boot geklettert«, entkräftete Olsen Lady Sarahs Ermahnung.
»Das ist zweifellos sehr ungezogen und ein Grund mehr, Bootsausflüge zu meiden.«
»Nun, ohne Boot wird es bestimmt schwierig werden, Süßwasserfische zu fangen«, schlug sich Sir Claude auf Marys Seite, was ihm einen missbilligenden Blick seiner Gattin eintrug.
»Ich bin der Meinung, dass das Fangen von Fischen noch immer Sache der Fischer ist. Um Krokodile zu studieren, muss man sie ja auch nicht selber fangen.« Lady Sarah begleitete ihren Mann das erste Mal nach Westafrika. Aus Rücksicht auf sie hatte Sir Claude diesen Zwischenaufenthalt auf Gran Canaria eingelegt, damit seine Frau sich langsam an das südliche Klima gewöhnen konnte.
»Ich fahre nun seit acht Jahren die Küste rauf und runter«, meldete sich Jan Mattis, ein Holländer mit grauen Bartstoppeln, zu Wort, »und habe noch kein einziges, verdammtes Krokodil zu Gesicht bekommen.«