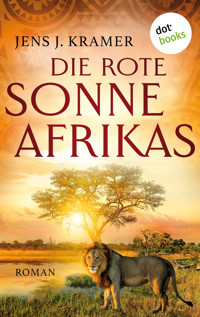
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im Land der Sturmvögel: Der epische Roman »Die rote Sonne Afrikas« von Jens J. Kramer jetzt als eBook bei dotbooks. Im Jahr 1854 führt der abenteuerliche Bericht eines englischen Missionars den jungen Johann Straub an die afrikanische Goldküste. Im Innern des Kontinents soll sich eine geheimnisvolle Stadt verbergen: Abeokuta, ein Ort, an dem Frieden herrscht und die alten Traditionen sich mit den neuen Zeiten verwoben haben. Diesem Ideal folgend, wagt Johann die ebenso wundersame wie gefährliche Reise. Gemeinsam mit dem Yoruba-Krieger Babi, dem freigekauften Sklaven Akute und der jungen Abena, wagt sich der junge Missionar in unbekanntes Gebiet vor. Aber schon bald drohen die dunklen Machenschaften eines Geheimkultes von Fetischpriestern und die Schatten des heraufziehenden Kolonialkrieges den ungleichen Freunden zum Verhängnis zu werden … Fesselnd und voller Hochachtung vor den Wundern dieses farbenprächtigen Kontinents: Jens J. Kramer nimmt uns mit auf die Reise durch ein Afrika, das zwischen Kolonialismus und Freiheitsdrang, Unrecht und Hoffnung steht. Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der mitreißende historische Roman »Die rote Sonne Afrikas« von Jens J. Kramer, auch unter dem Titel »Die Stadt unter den Steinen« bekannt. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 736
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über dieses Buch:
Im Jahr 1854 führt der abenteuerliche Bericht eines englischen Missionars den jungen Johann Straub an die afrikanische Goldküste. Im Innern des Kontinents soll sich eine geheimnisvolle Stadt verbergen: Abeokuta, ein Ort, an dem Frieden herrscht und die alten Traditionen sich mit den neuen Zeiten verwoben haben. Diesem Ideal folgend, wagt Johann die ebenso wundersame wie gefährliche Reise. Gemeinsam mit dem Yoruba-Krieger Babi, dem freigekauften Sklaven Akute und der jungen Abena, wagt sich der junge Missionar in unbekanntes Gebiet vor. Aber schon bald drohen die dunklen Machenschaften eines Geheimkultes von Fetischpriestern und die Schatten des heraufziehenden Kolonialkrieges den ungleichen Freunden zum Verhängnis zu werden …
Fesselnd und voller Hochachtung vor den Wundern dieses farbenprächtigen Kontinents: Jens J. Kramer nimmt uns mit auf die Reise durch ein Afrika, das zwischen Kolonialismus und Freiheitsdrang, Unrecht und Hoffnung steht.
Über den Autor:
Jens J. Kramer, Jahrgang 1957, studierte in Berlin Ethnologie und Publizistik. Der historische Roman »Die rote Sonne Afrikas« über die Kolonialzeit war sein Debüt, dem weitere Romane folgten. Als Jo Kramer schrieb er außerdem romantische Komödien, als Mike Schulz Krimikomödien und zusammen mit seiner Ehefrau, der Bestsellerautorin Nina George, ist er Jean Bagnol, der Erfinder des provenzalischen Ermittlers »Commissaire Mazan«. Ebenfalls mit Nina George als Autorenduo veröffentlicht er seit 2022 Kinderbücher. Seit 2017 ist er Vorsitzender des SYNDIKATS. Heute lebt Jens J. Kramer in Berlin und der Bretagne.
Die Website des Autors: www.jensjohanneskramer.de
Jens J. Kramer veröffentlichte bei dotbooks auch seine Romane »Das Lied von Afrika« und »Der Himmel über Konstantinopel«.
***
eBook-Neuausgabe September 2023
Dieses Buch erschien bereits 2000 unter dem Titel »Die Stadt unter den Steinen« im List Verlag.
Copyright © der Originalausgabe 2000 Econ Ullstein List Verlag
GmbH & Co. KG, München
Copyright © der Neuausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-98690-760-0
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
In diesem eBook begegnen Sie möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. Diese Fiktion spiegelt nicht unbedingt die Überzeugungen des Verlags wider.
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die rote Sonne Afrikas«an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Jens J. Kramer
Die rote Sonne Afrikas
Roman
dotbooks.
»Wenn du beten willst, sprich zum Wind.«
(Ashante-Sprichwort)
PrologDie Flucht
»Ist es der Herr, der uns nicht hier haben will, oder ist es der Teufel, der uns hindert?«
MISSIONAR H. KNECHTin einem Brief aus Keta an dieNorddeutsche Missionsgesellschaft, 1857
Peki, 1853
Der Regen rauschte vom Himmel, gleichmäßig und dicht, als nähme er niemals ein Ende. Wilhelm Däuble stand reglos in der geöffneten Tür der Missionsstation und starrte unter dem Schutz des Verandadaches in die afrikanische Nacht. Das Prasseln des Regens übertönte alle anderen Geräusche. Durch eine Wand aus Wasser schimmerten im Dunkel die Mangobäume, die den Hof vor dem Haus säumten. Der Lichtschein hinter ihm zeichnete die Umrisse seiner gedrungenen Gestalt, deren Haltung Kraft und wache Energie verriet.
Zwei Schritte vor dem Missionar, an der Stelle, wo der lehmige Boden etwas ausgetreten war, stand das Regenwasser schon fußknöchelhoch. Unruhig zuckte die sich zusehends ausbreitende Pfütze unter dem Aufprall der Riesentropfen, die von der Dachkante fielen und in einem wilden Rhythmus auf ihrer Oberfläche zerplatzten.
In Däubles Kopf ballten sich die Niederlagen und die Demütigungen, die Sorgen und Grübeleien der letzten Wochen und Monate zu einem Stoßgebet, das er unablässig wiederholte: Herr, steh uns bei. Wir müssen endlich weg. Hier ist kein Bleiben. Herr, steh uns bei.
Sein Blick wandte sich Richtung Süden, wo die Küste lag und das sichere Christiansborg. Fünf Tagesreisen waren es bei gutem Wetter. Bei dem Regen würde es doppelt so lange dauern oder noch länger. Däuble unterdrückte einen Fluch. Die Schwierigkeiten türmten sich inzwischen so hoch, daß ihm die Übersicht zu schwinden drohte. Was, wenn ihnen die Pekier nun tatsächlich die Transporthilfe verweigerten? Wie sollten sie es ohne die Eingeborenen schaffen? Wenn man auf ihn gehört hätte, wären sie schon längst nicht mehr hier. Aber die Sesselfurzer in den Ratsstuben der Bremer Zentrale, weit weg vom Schuß, hatten entschieden, Peki unter allen Umständen zu halten.
Ein Schattenkörper bewegte sich durch den Regenschleier mit schnellen Schritten auf das Haus zu. An der geschmeidigen Art, den glitschigen Weg hochzulaufen, erkannte Däuble, daß es Babi war, einer der beiden Schwarzen, die ihnen auf der Station zur Hand gingen. Unter der Veranda angekommen, wischte sich der Gehilfe das Wasser aus dem Gesicht. Aufmerksam schaute er über den Hof zurück. War ihm jemand gefolgt?
Sich dem Missionar zuwendend, schüttelte Babi den Kopf. Schweigend, mit unbewegter Miene, sah er Däuble an, dem die Ungeduld ins Gesicht geschrieben stand. Schließlich stieß der Schwarze zwei Wörter hervor: »Keine Männer.«
»Keine Männer? Was soll das heißen?«
»Der König hat gedroht, jeden zu bestrafen, der uns begleitet«, berichtete Babi in der ihm eigenen Sprechweise, bei der er die Wörter erst hinter den Lippen in Stellung zu bringen schien, um sie dann ruckartig herauszuschleudern.
»Ich habe sogar den Preis verdoppelt, aber die Furcht vor dem König ist stärker als die Gier.«
Es war eine verfahrene Situation. Verärgert rekapitulierte Däuble den Rest ihrer Möglichkeiten. Ohne Träger würden sie niemals bis an die Küste gelangen. Bruder Brutschin, vom Fieber geschwächt zu keinem Fußmarsch fähig, müßte die ganze Strecke getragen werden. Außerdem wollten sie ihre Habe nicht zurücklassen, die sie auf fünf Dutzend Kisten verteilt hatten. Er schaute über die Schulter ins Haus. Von Plessing war nichts zu sehen. Wahrscheinlich kümmerte sich der um den Kranken.
Brutschin und Plessing waren erst vor kurzem in Afrika eingetroffen und noch keine zwanzig Tage in Peki. Bei ihrem langen Anfahrtsweg auf einem der neuen Dampfschiffe hatten die beiden frischgebackenen Missionare schwere Stürme zu bestehen gehabt, schon wenige Tage nach dem Ablegen in Bremerhaven ausgangs des Ärmelkanals und dann noch einmal in der Biskaya. Mit Müh und Not, einem erfahrenen Kapitän und vor allem Dank Gottes Hilfe waren ihr Schiff seetauglich und sie am Leben geblieben. »Dem Herrn gefiel es, uns erst zu züchtigen und dann zu erretten«, hatten sie bei ihrer Ankunft erzählt, nicht ohne hinzuzufügen: »Gepriesen sei Er in alle Ewigkeit.«
Einen Moment lang dachte Däuble daran, ihnen die Absage des Königs mitzuteilen. Doch nein, er verwarf diesen Gedanken gleich wieder, das würde seine neuen Brüder nur beunruhigen. Leise sagte er zu Babi: »Ich werde morgen mit dem König sprechen. Vielleicht kann ich in Erfahrung bringen, was da wirklich vor sich geht.«
Als der Regen nachließ, wanderten Däubles Gedanken hinüber zu dem kleinen Friedhof hinter den Bäumen, wo Bruder Menge begraben lag. Sofort beschwerte ein bleiernes Gefühl ihm die Brust. Vier Monate war es her, daß er die Gebeine des Verstorbenen in einer schlichten Andachtsstunde der Erde zurückgegeben hatte. Requiescat in pace.
Der junge Mann, gerade mal zwei Monate in Afrika, hatte nicht einmal die Zeit gehabt, richtig zu begreifen, in was für eine Welt er geraten war, als das Fieber ihn dahinraffte. Ein Schaudern kroch Däubles Wirbelsäule empor, wenn er an die letzten Tage des Missionsbruders dachte, an dieses sonderbare Fieber, das sich in langen, unregelmäßigen Schüben aufgeheizt hatte, begleitet von Wahnvorstellungen, die nur aus den finstersten Regionen der Hölle stammen konnten. Oder war Menge erst dem teuflischen Wahn verfallen, und dieser hatte dann das tödliche Fieber ausgelöst?
Noch immer war ihm der qualvolle Tod des Bruders ein Rätsel. Gewiß war nur, daß ihn seitdem die schlimmsten Zweifel plagten. Stets war er davon überzeugt gewesen, daß das Heidentum auf nichts anderem beruhte als auf Unwissenheit, und diese wie der Schatten dem Sonnenstrahl weichen würde, sobald die Wahrheit des Evangeliums ihr Licht darauf warf. Nun war dieser Grundpfeiler seines Glaubens ins Wanken geraten.
Gehet in alle Welt und lehret alle Völker, das war Gottes Auftrag, wie er in der Bibel stand. Und sie, die Missionare, waren als seine Diener dazu berufen, diesen Auftrag auszuführen – die Menschen hier auf diesem sinistren Kontinent aus ihrer Unwissenheit zu erlösen. Durch belehren zu bekehren, wie ihnen immer wieder eingebleut worden war. Aber was er an Menges Sterbebett hatte erleben müssen, legte die Vermutung nahe, daß sich hinter dem, was die Eingeborenen glaubten, auch ein Wissen von Gott verbarg. Ein anderes Wissen zwar, dem aber eine Macht innewohnte, die er, obwohl er sie nur ahnen konnte, gleichwohl als existentielle Bedrohung empfand.
In dieser abgelegenen Region der Welt waren sie Kräften ausgesetzt, die selbst er, der sie erlebt hatte, nicht begreifen, geschweige denn abwehren konnte. Die Bremer aber waren nicht einmal imstande, diese Kräfte überhaupt wahrzunehmen. Was nicht sein durfte, konnte es auch nicht geben. Machten sie nicht alle einen schrecklichen Fehler, indem sie eine jegliche Form heidnischen Denkens als Götzendienst und Aberglauben abtaten? Gott war doch allgegenwärtig, so mußte er doch auch in Afrika sein. Wie aber hatte es nur geschehen können, daß diese Gegenwart, die der Missionar ganz genau spürte, in der Natur, in jedem Baum, im Rauschen des Windes und, ja, in der Liebe einer Mutter für ihr Kind, vermengt war mit den abscheulichsten heidnischen Riten, deren Wirkung abzustreiten ihm immer weniger gelang?
Von diesen Zweifeln hatte er nichts in seinen Briefen an das Bremer Komitee erwähnt, mußte er doch befürchten, daß seine Gedanken als die Verirrungen eines vom Satan in Versuchung geführten Geistes bewertet würden. Aber da er überzeugt war, daß sie ihr Werk nur vollenden könnten, wenn sie ihren Blick öffneten und sich aus ihrem starren Prinzipiensystem lösten, hatte er die Missionsleitung beschworen, Peki vorerst aufzugeben und eine neue Station an der Küste zu errichten. Dort wären Bauvorhaben und Logistik viel einfacher zu bewerkstelligen, außerdem die klimatischen Verhältnisse bei weitem erträglicher. Die guten Argumente hatten nichts gefruchtet, sein Vorschlag wurde abgelehnt. Als er insistierte, gab ihm Inspektor Treviranus in einem Brief zu verstehen, daß ein weiterer Widerspruch als eklatanter Fall von Ungehorsam aufgefaßt würde, mit entsprechenden Konsequenzen. Eine kaum verblümte Abmahnung, ihn im Wiederholungsfall von seinem Posten abzuberufen. Wie um dies zu bekräftigen, hatte die Bremer Zentrale Plessing und Brutschin geschickt.
Däuble riß sich aus seinen Grübeleien los. Die Zeit drängte. Er wandte sich an Babi: »Was haben der König und seine Karbusiere vor, was denkst du?«
Sein Gehilfe löste sich aus der Versenkung, in die er sich zurückzuziehen pflegte, sobald man ihn nicht direkt ansprach. Bedächtig bewegte der Schwarze den Kopf von einer Seite auf die andere. Nach längerem Schweigen sagte er: »Es riecht nach Tod.«
Däuble nickte wortlos. Er hatte gelernt, das sonderbare Verhalten des schwarzen Hünen ernst zu nehmen. Oft hatten dessen einsilbige Sentenzen, auch wenn sie noch so mysteriös klangen, ihre nachträgliche Bestätigung gefunden.
Der Regen hatte fast aufgehört. Vom Wind getrieben, zog die dunkle Masse der Wolken über das Tal. Unten am Fluß, weit hinter den letzten Hütten des Dorfes, erhob sich ein Leopardenweibchen von seinem Lager. Wachsam witternd sog es die Nachtluft ein. Es war die Stunde der Jäger.
Mitternacht war längst vorbei, als wildes Geknatter von fern über das Tal zu den Hängen des Awudome-Bergzuges herüberschallte: Wie Peitschenschläge zerrissen die Detonationen die Stille der Nacht.
Däuble fuhr aus dem Schlaf hoch, zunächst unfähig, die Geräusche, die ihn geweckt hatten, einzuordnen. Dann waren die Schüsse nicht mehr zu überhören. Hastig zog er sich an und lief in den Versammlungsraum, wo Babi an der halbgeöffneten Tür stand und nach draußen spähte. Da kam auch John, der zweite Missionsgehilfe, aus seiner Kammer, in der Hand eine Lampe, deren Flackern die Silhouetten der drei Männer in bizarren Formen an die Wände malte. Von der Veranda aus schaute Däuble zu dem noch unvollendeten Rund des Mondes hinauf, der sich durch die aufgerissene Wolkendecke zeigte. In weniger als zwei Stunden würde der Morgen dämmern. Aus dem Haus drang die Baßstimme Plessings: »Was um Himmels willen ist da los? John, stell die Lampe auf den Tisch, du wirst sie sonst noch fallen lassen.«
Am Berghang jenseits des Tales blitzten Mündungsfeuer auf. Unmittelbar danach krachten die Schüsse. Däuble wollte sich gerade abwenden, um die Veranda zu verlassen, als direkt neben seinem Fuß ein Knacken zu hören war. In dem Lichtstreifen, der von drinnen durch die Tür fiel, sah er einen hellen Riß in den Bohlen. Aus dem Dunkel traf ihn ein Schlag in die Seite. Hinter ihm riß Babi die Tür auf, packte ihn am Arm und zog ihn in den Innenraum. Der Schwarze handelte so umsichtig wie schnell. Mit einem Satz war er am Tisch und löschte das Licht.
Keiner sagte ein Wort. Däuble war klar, daß man auf ihn gezielt hatte. Die letzten beiden Schüsse waren aus viel geringerer Entfernung abgefeuert worden. Der Schütze mußte in der Nähe des Hauses lauern. »Diese Wahnsinnigen«, keuchte Plessing, »es wird noch ein Unglück geben.«
Däuble lehnte sich neben der Tür an die Wand. Das, was er seit langem befürchtet hatte, war eingetreten. Das schwelende Feuer der Gewalt flammte hoch und drohte alles niederzubrennen, was sie mühsam aufgebaut hatten.
Begonnen hatte es mit dem Unmut über die rigide Politik der englischen Militärverwaltung. Geschürt von dem mächtigen Königreich der Ashante, hatte sich diese Mißstimmung aufgeheizt und im Inland in einigen blutigen Stammesaufständen entladen. Obwohl das eigentliche Territorium der Ashante am Volta endete, bildeten sich auch diesseits des großen Stromes, der das Land von Nord nach Süd durchfloß, Allianzen gegen die Engländer. In ihren Festungen am Meer isoliert, waren die weißen Herrschaften unfähig, die Abhängigkeiten zwischen den Stämmen zu erkennen.
Däuble mutmaßte, daß der König von Peki, dessen undurchsichtiges Verhalten ihm seit jeher Kopfschmerzen bereitete, nun den Wirrwarr des Aufruhrs nutzen würde, um einige alte Rechnungen mit unliebsamen Nachbarstämmen zu begleichen. Doch warum schoß man auf sie, die Missionare?
Irgendwer versuchte da im Windschatten des Scharmützels, ihnen nach dem Leben zu trachten oder zumindest einen Denkzettel zu verpassen. Der Missionar griff an seine linke Seite, die sich merkwürdig taub anfühlte. Seine Finger ertasteten einen feuchten Fleck. Blut. Als hätten sich mit dieser Feststellung seine Nerven wieder aktiviert, durchzuckte ihn der Schmerz. Er zog ein Taschentuch aus der Hosentasche und preßte es auf die Wunde. Neben ihm stand Babi, der von der Tür aus angespannt beobachtete, was sich draußen tat. Eine Minute später schlüpfte der Schwarze hinaus in die Nacht, die ihn sogleich verschluckte.
Däuble ging zu Plessing, der mit John im hinteren Teil des Raumes stand. »Jemand sollte bei Brutschin sein, um ihn zu beruhigen. John kann ja bei mir bleiben.«
Als Plessing in der Kammer verschwunden war, wandte sich Däuble an den Gehilfen: »John, hol mir Alkohol und Verbandsstoff.« Der sah ihn erschreckt an, aber der Missionar beruhigte ihn: »Es ist nichts Schlimmes.«
Er setzte sich an den Tisch und zog das Hemd aus. Undeutlich konnte er die lange Schramme erkennen, aufgerissene Haut, eine Handbreit über seinem Gürtel. Vorsichtig wischte er das Blut ab, das bereits den dunklen Stoff seiner Hose tränkte. Zum Glück war die Wunde nicht tief, ein paar Zentimeter weiter rechts, und es hätte übel für ihn ausgesehen. John legte ihm einen provisorischen Verband an. Mehr war im Augenblick nicht möglich, sie wagten nicht, die Lampe anzuzünden, solange die Schießerei noch andauerte.
Wortlos saßen sie am Tisch und warteten. Langsam sickerte die Nacht in die Erde zurück, ein fahles Frühlicht gab die Sicht frei. Vereinzelt waren noch Schüsse zu hören, dann rührte sich nichts mehr. Däuble blickte angespannt durch das Fenster, reflexartig strichen seine Finger unaufhörlich durch den Bart, der sein Gesicht umrahmte. Die Morgenfeuchte bildete helle Schleiertücher, die sich wie Spinnweben an das Buschwerk hefteten. Von fern waren Stimmen zu vernehmen, anschwellende Schreie des Triumphes, die sich zu Sprechchören bündelten und jaulende Kadenzen des Klagens, die in leisen Tonfetzen verwehten.
Lautlos wie er gegangen war, kehrte Babi über den Hof in das Haus zurück. Fragend sah er auf Däubles Verband. Der winkte ab: »Schon gut, sag mir, was los ist.«
»Sie haben Gefangene gemacht. Sie bringen sie ins Dorf.« Mit einem Seitenblick auf John fügte Babi hinzu: »Es war nur einer. Nicht weit von hier. Er war schon fort, als ich an die Stelle kam.«
Däuble nickte. Nachdem er sein Hemd wieder angezogen und über dem Wundverband zugeknöpft hatte, bat er John, Pater Plessing zu holen. In wenigen Sätzen informierte er dann seinen Bruder über das, was sie beobachtet hatten. Von dem Gewehrschützen, der es auf sie abgesehen hatte, erzählte er nichts. Plessing hatte zwar bemerkt, daß ihnen die Kugeln um die Ohren geflogen waren, nicht aber, daß es sich dabei um gezielte Schüsse aus der Nähe handelte. »Ich werde mit Babi ins Dorf gehen. Vielleicht können wir etwas erreichen.«
»Was glaubst du denn, was du dort erreichen kannst?« Plessing reagierte unwillig auf Däubles Vorhaben.
»Vielleicht nichts, aber Abwarten bringt uns erst recht nicht weiter.«
Sie mußten versuchen herauszufinden, wer hinter dem Anschlag steckte. Und wenn es überhaupt eine Möglichkeit dafür gab, dann nur, solange die Wahrheit noch jung war und unverdorben von den Geschichten, die bald überall verbreitet würden.
Däuble und Babi stiegen den Weg hinab, der zum Dorf führte. Noch bevor sie die ersten Hütten erreichten, hörten sie das Gewirr der Stimmen und Geräusche. Näher kommend sahen sie, daß alle auf den Beinen waren, auch die Frauen, die Alten und die Kinder. In einem großen Kreis standen sie um den schlammigen Dorfplatz herum. Sie schrien, lachten und zeigten mit den Fingern auf eine Handvoll Männer, die in der Mitte des Platzes kauerten. Ein paar Frauen warfen mit Steinen und Klumpen von Dreck nach den Gefangenen.
Däuble stellte sich auf die Zehenspitzen, um besser sehen zu können. Die Männer, die aus zahlreichen Schnittwunden bluteten, drängten sich alle um einen, der ihr Anführer zu sein schien. Er war besonders übel zugerichtet. Weit klafften seine Wunden auseinander, die Oberarme waren bis auf die weißen Knochen aufgeschlitzt. Trotzdem hielt er sich aufrecht. Gott im Himmel. Der Missionar hatte genug gesehen. Entschlossen stieß er die Dorfbewohner beiseite, die mit Verblüffung und deutlichen Zeichen des Unmuts reagierten. Babi blieb direkt hinter ihm, wachsam jede Bewegung um sie herum registrierend.
Am Ende des Platzes erblickte Däuble, schön aufgereiht, die Riege der Stammesführer. Inmitten der Dorfältesten saß ganz vorne, auf einem Stuhl, König Tekpor. Sein mächtiger Kopf, dessen blankgeriebene Platte sich in der Morgensonne spiegelte, ragte aus einem Gewand in einem violett schimmernden Blau, verziert mit gelben Streifen. Links und rechts von ihm standen je zwei Karbusiere, jeder von ihnen trug ein Gewehr und ein langes Buschmesser.
Während Däuble noch überlegte, wie er jetzt vorgehen sollte, erkannte er den Mann, der direkt hinter dem König stand. Augenblicklich füllte sich der Mund des Missionars mit einem galligen Geschmack: Dies war der eigentliche Feind. Sein Blick saugte sich an der krummen Gestalt in dem weiten, weißen Gewand fest, an den Fellfetzen, die daran hingen und die aussahen, als würden sie zum Himmel stinken, an dem blauen Stirnband, das den knochigen Schädel umwand. Die tiefliegenden Augen in dem ausgemergelten Gesicht waren ausdruckslos wie die eines Reptils. Wenn dieser Fetischpriester auch aussah wie eine Vogelscheuche, so war sich Däuble der Gefährlichkeit, die sich dahinter verbarg, wohl bewußt. Dieser Mann lehrte sogar den Eingeborenen das Fürchten. Sie nannten ihn den yewe-no, den Schlangenpriester.
Däubles Gedanken überschlugen sich. Sofort stand ihm Bruder Menge und dessen Todespein wieder vor Augen. Kurz bevor Menge erkrankte, war diese Kreatur, die ihm jetzt als Inbegriff des Bösen erschien, in Peki aufgetaucht. Und in der Nacht, in der er starb, hatte der junge Missionar mit heißem Atem immer wieder dieses Gesicht beschrieben, das ihn in seinen Fieberträumen verfolgte. Däuble fühlte mit einer Sicherheit, die ihn selbst erstaunte, daß da geheimnisvolle Zusammenhänge bestanden. Nein, das waren keine Hirngespinste, was sich da abzeichnete. Für ihn stand fest: Dieses Scheusal hatte Menge in den Tod getrieben.
Mühsam zwang er sich, den Blick von dem Mann zu wenden, seine Abscheu durfte ihn nicht überwältigen. Jetzt galt es erst einmal, diese barbarische Veranstaltung zu beenden. Er sah auf den König, der ihn längst bemerkt hatte, dessen Blick aber gleichmütig auf die Gefangenen gerichtet war, die nicht wagten, sich zu rühren.
Das Eintreffen des Missionars hatte den Dorfbewohnern offenbar die Stimmung verdorben. Das Geschrei ebbte ab, nur ab und zu flogen noch ein paar Steine in die Mitte. Mit knappen Worten instruierte Däuble seinen Begleiter und schickte ihn mit einem Nicken zum König. Sein Vorschlag war, die Gefangenen nach Christiansborg zu schaffen, in die Obhut der Engländer. Das eröffnete vielleicht auch die Möglichkeit des eigenen Abzugs aus Peki.
Babi ließ sich Zeit. Gemessenen Schrittes überquerte er den Platz, weder die Gefangenen noch die Dorfbewohner würdigte er eines Blickes. Etwa ein Dutzend Schritte vor dem König blieb er stehen. Die um den Platz Versammelten waren verstummt. Gespannt schauten sie auf den Mann, der bei den Weißen lebte. Er war anders als sie, das war auf den ersten Blick zu sehen: Diese seltsame Kleidung, die er trug, eine rote Weste, Hosen, die ihm eben über die Knie reichten. Die Form seiner Gesichtszüge unterschied sich von den ihren, die drei senkrechten Narbenstriche auf den Wangen wiesen ihn als Mitglied eines fremden Volkes aus. Gerüchte besagten, daß er aus dem Osten kam, dem Land der noli, in das die Geister der Verstorbenen zurückkehrten. Dies mochte die Aura erklären, die ihn umgab. Vor allem aber irritierte die Dorfbewohner etwas in der Haltung des baumlangen Hünen. Es war die Art, wie er ihrem König gegenübertrat. Dieser Mann würde vor niemandem niederknien.
Babi wartete, bis der König seinen Sprecher vorschickte, der den geschnitzten Amtsstab etliche Male in die Luft stieß, als wollte er sich damit zur Wehr setzen. Als der Mann unmittelbar vor ihm stand, brachte Babi das Anliegen Däubles vor. Daraufhin kehrte der Stabträger – auch er auf ein würdevolles Maß seiner Schritte bedacht – zum König zurück, um das Gesagte zu übermitteln. Schnell war zu erkennen, daß Däubles Vorschlag den Stammesführern nicht gefiel.
Der yewe-no, der Babi nicht aus den Augen gelassen hatte, beugte sich vor und redete auf den König ein. Der nickte schließlich und hob die rechte Hand. Leise klickten die Armreifen aus hellem Elfenbein und grünem Jaspis, die er oberhalb des Ellenbogens trug, aneinander. Auf des Königs Wink ging der Sprecher wieder zu Babi. Nachdem dieser sich die Antwort angehört hatte, kehrte er, nicht links, nicht rechts schauend, fast noch langsamer als auf dem Hinweg, quer über den Platz zu Däuble zurück, der begierig darauf wartete, zu hören, was ihm der König ausrichten ließ.
»Es sind Akwamu von der anderen Seite des Tales. Der yewe-no klagt sie an, einen Raubzug in das Land der Pekier unternommen zu haben. Darum müssen sie sterben.«
Däuble wußte sofort, daß dies nicht der Wahrheit entsprach. Die ersten Schüsse waren zweifelsohne auf dem Gebiet der Akwamu gefallen. »Aber das ist doch gelogen. Frage den König, wo der Überfall ...«
Die Aufregung, die sich der Menschen um ihn herum plötzlich bemächtigte, ließ Däuble mitten im Satz abbrechen. Auf ein Zeichen Tekpors traten zwei Karbusiere hervor und näherten sich den Gefangenen. Aus deren Kehlen drangen schrille Angstschreie, abwehrend hoben sie die Hände. Die beiden Krieger packten den schwerverletzten Anführer und zerrten ihn von seinen Männern fort. Dann stießen sie ihn in den Schlamm. Einen Augenblick lang sah Däuble dem Opfer direkt ins Gesicht, sah die Angst in den weit aufgerissenen Augen, durch die er bis auf den Grund der Seele des Armseligen zu schauen vermochte.
Da hob der Karbusier, der hinter dem geschundenen Anführer stand, den Arm mit der Machete. Ein Sirren. Die Klinge blitzte im Sonnenlicht, fuhr nieder und trennte den Kopf vom Rumpf. Dem Missionar entfuhr ein Schrei, der jedoch in dem augenblicklich losbrechenden Höllenlärm unterging. In Ekstase versetzt, kreischte die Menge wie von Sinnen. Unmenschliche Laute flogen steil in den blauen Himmel. Der abgeschlagene Kopf rollte in den Dreck gleich einer vom Baum gefallenen Kokosnuß. Babi stellte sich vor Däuble, dem die Wut und das Entsetzen die Augen aus dem Kopf trieb. Das Drama war nicht mehr aufzuhalten. Die Menschen, trunken von dem blutigen Schauspiel, schrien nach mehr. Sie trampelten mit den Füßen und brüllten in rhythmischer Wiederholung: miwe, eta, miwe, tötet sie, Kopf ab, tötet sie.
Die anderen Karbusiere traten zu den wimmernden, sich aneinander klammernden Gefangenen, um die Hinrichtungen fortzusetzen. Babi drängte den Missionar mit sanfter Gewalt aus dem Kreis fort. Halb schob er ihn, halb zog er ihn zum Dorf hinaus. Hinter ihnen jubelten die Wilden in wahnsinnigem Entzücken, wenn wieder ein Kopf fiel. Miwe, eta, miwe.
Auf halbem Weg zur Station hielten sie an. Däuble zitterte am ganzen Leib. Kreidebleich suchte er Halt an einem Baum, sackte in die Knie, fiel vornüber und barg das Gesicht, nach Atem ringend, in seinen Händen. Babi schaute zum Dorf zurück, von wo noch immer die Schreie der Menge zu hören waren. »Die yewe-no hassen die Prediger des weißen Gottes«, sagte er. »Sie fürchten um ihre Macht.«
Däuble verstand ihn nicht. Wieder bei Atem, murmelte er unentwegt: »Sie wissen nicht, was sie tun.« Fast flehentlich wandte er sich an seinen Begleiter: »Babi, nicht wahr, sie wissen nicht, was sie tun?« Das Achselzucken seines Begleiters brachte ihm keinen Trost.
Langsam kehrten sie zur Missionsstation zurück. Däuble schleppte sich dahin. Seine Wunde pochte unter dem Verband. Er mußte sich eingestehen, daß er belogen worden war, frech ins Gesicht, was einer offenen Verhöhnung gleichkam. Weit schlimmer, er hatte auch keinerlei Chance gehabt, den Barbaren Einhalt zu gebieten. Demütigung und Ohnmacht verstärkten seinen Schmerz.
Als sie die Station betraten, bemerkte Plessing den dunklen Fleck auf Däubles Hemd. Er bestand darauf, die Wunde zu desinfizieren und den Verband zu erneuern. Fassungslos hörte er, was Däuble ihm von dem Hinrichtungsspektakel im Dorf erzählte. »Eine Schande«, murmelte er vor sich hin, während er den Verband anlegte. »Es ist eine Schande.«
Am Nachmittag stand ohne Ankündigung plötzlich eine Gruppe von Pekiern vor der Station. Däuble, von seiner Wunde geschwächt, hatte sich zur Ruhe gelegt. So empfing Plessing die Männer. John diente ihm als Dolmetscher. Angeführt wurde die Delegation von Quadju, einem jüngeren Bruder des Königs, der sich viel auf diese Verwandtschaft einbildete. Dabei war er nicht mehr als ein Befehlsempfänger, der das zu tun hatte, was ihm aufgetragen wurde.
Sein ganzer Stolz war ein Monokel, das er ständig mit sich herumtrug. Daß es verschmutzt war und mit einem Riß quer über das Glas sein Sehvermögen einschränkte, focht ihn nicht an. Seine Angewohnheit, es bei jeder Gelegenheit mit einer gespreizten Gebärde an sein rechtes Auge zu heben, hatte ihm den Spitznamen janku, Eisenauge, eingebracht. Der Königsbruder wiederholte die verlogene Darstellung des Schlangenpriesters: Die feigen Hunde der Akwamu seien für den nächtlichen Überfall verantwortlich und deshalb für ihr Vergehen bestraft worden.
Nur mit Mühe gelang es Plessing, seine Empörung im Zaum zu halten. Zu entgegnen wußte er nichts. Statt dessen forderte er mit Nachdruck, daß ihnen endlich Träger zur Verfügung gestellt würden, damit sie Peki verlassen und sich an die Küste begeben könnten. Quadju versprach, sich beim König dafür zu verwenden, gab aber zu bedenken, daß die Pekier zur Zeit alle Männer bräuchten, um sich gegen die angreifenden Feinde zu verteidigen. Während sein Sprecher die falschzüngigen Argumente vortrug, betrachtete Eisenauge durch sein Monokel theatralisch das Missionshaus. Dann machte der Pfau kehrt und stolzierte davon. Er hatte den Hof schon fast verlassen, als Plessing die letzten Worte der Replik zu hören bekam.
Plessing war perplex. Mit den Zähnen knirschend, mußte er zusehen, wie der Sprecher sich umdrehte und seinem eitlen Herrn nacheilte.
Am Abend, als er aufwachte, fühlte sich Däuble noch immer klapprig und ausgelaugt. Trotzdem stand er auf und setzte sich in den Versammlungsraum, wo Plessing ihn bereits erwartete. Auch Brutschin hatte sich von seinem Lager erhoben, die graublasse Stirn voller Schweißperlen, die Augen getrübt vom dumpfen Schmerz hinter den Schläfen. Obwohl es noch immer drückend heiß war, saß er mit einer dicken Jacke am Tisch, seine Schultern stachen durch den Stoff. Neben dem kleinwüchsigen, rundlichen Plessing wirkte Brutschin mit seiner hochgeschossenen, hageren Gestalt wie das Leiden Christi. Gesprächsthema war der Besuch vom Nachmittag.
»Sie werden uns keine Träger geben«, zog Däuble nach einer Weile das Fazit. »Ich sehe keine andere Möglichkeit, als daß ihr zur Küste geht und von dort Träger herschickt.«
»Ausgeschlossen«, wehrte Plessing ab. »Wir werden dich nicht alleine zurücklassen.«
»Babi wird bei mir bleiben. Uns wird nichts geschehen. John braucht ihr als Führer und Dolmetscher.«
Mit einem Seitenblick auf den Kranken erwiderte Plessing: »Bruder Brutschin ist noch lange nicht reisefähig. Sieh ihn dir doch an.«
Dem fiel das Sprechen schwer, trotzdem riet er zur Zuversicht: »Wir sollten auf Gott vertrauen. Der Herr wird die Seinen nicht im Stich lassen.«
Plessing pflichtete ihm bei. Däuble preßte die Lippen zusammen. Er hätte die beiden gern im sicheren Christiansborg gewußt. Doch es war aussichtslos. Sie begriffen einfach nicht, worum es ging. Sie spürten die Gefahr nicht. Dazu waren sie zu neu hier. Noch wirkte die Ausbildung auf den Schulbänken der Missionsanstalt in Basel, die sie gegen die Realitäten hier in Afrika geimpft hatte. Für sie waren die Eingeborenen wie Kinder, eben Nachkommen von Hams unwissendem Geschlecht, so wie es ihnen gelehrt worden war.
Sie hatten ja anfangs alle dieser naiven Überzeugung angehangen. Er selbst genauso wie seine ersten Weggefährten, Bruder Quinius, der seine Frau mitgebracht hatte, und Bruder Menge. Nicht einmal zwei Jahre danach war die Bilanz niederschmetternd. Das Ehepaar Quinius hatte Afrika längst wieder verlassen, beide krank und bis auf den Grund ihrer Seele verstört. Bruder Menge war tot, ohne erfahren zu haben, ob es Gott oder der Teufel war, der ihn zu sich rief. Zurückgeblieben in diesem Land der zügellosen Leidenschaften und der abergläubischen Machenschaften war er allein.
Zermürbt von den blutrünstigen Moskitos, die niemals Ruhe gaben, kämpfte er Nacht für Nacht darum, sein Gottvertrauen nicht zu verlieren. Unermüdlich hatte er immer wieder gegen die Mauer aus Unglauben angepredigt, ohne sie zum Einsturz zu bringen. Die Mißerfolge drohten seinen Willen zu brechen, die Zweifel sein Selbstbewußtsein aufzufressen. Es gab Stunden, da fühlte er sich so allein, daß er fürchtete, auch von Gott verlassen zu sein. Doch das hatte er den Herren in der Bremer Zentrale nie offenbart, ebensowenig wie seinen neuen Brüdern, Plessing und Brutschin.
Die nächsten zwei Tage war es ruhig, die Zeit wie zu einem zähen Brei verdickt. Aus dem Dorf war nichts Positives zu hören. Die Hoffnung auf Träger schwand dahin. Die Ungewißheit, wie es weitergehen sollte, zerrte an den Nerven, bis ein Bote aus Christiansborg mit schlechten Nachrichten vom englischen Gouverneur eintraf.
Eine Delegation, bestehend aus einem Offizier, dreißig Soldaten und Missionar Freeman von den Methodisten, sei, so ließ der Gouverneur wissen, nach Kumasi, der Hauptstadt des Ashante-Königreiches, verschleppt worden und werde dort festgehalten. Die Gruppe habe den Auftrag gehabt, mit den Ashante zu verhandeln, um die Aufstände zu beenden. Nun habe man zwar Truppen mobilisiert und drakonische Strafen angedroht, aber einen Vormarsch auf das weit im Landesinneren gelegene Kumasi verbiete die militärische Vernunft. Eine weitere Eskalation der Unruhen sei zu befürchten. Der Gouverneur empfahl deshalb den Missionaren dringend, an die Küste zu kommen. Andernfalls könne er, so sehr er es auch bedaure, nicht mehr für ihren Schutz und ihre Sicherheit garantieren.
Zumindest Däuble war klar, daß die neue Situation ein weiteres Abwarten nicht zuließ. Er wußte, daß dem Gouverneur mehr oder weniger die Hände gebunden waren: Solange die Ashante nicht an die Küste kamen, um sich vor die englischen Kanonen zu stellen, war jede Militäraktion sinnlos. Und wenn die Engländer Druck auf die Verbündeten der Ashante ausübten, schloß das die Reihen der Aufständischen nur noch fester zusammen.
Es gab nur einen Ausweg: »Wir müssen Träger von der Küste besorgen, wir können nicht länger warten.«
Auch Plessing hatte inzwischen begriffen, daß sie hier nicht länger sicher waren. »Wir können Bruder Brutschin nicht zurücklassen. Geh du, dir wird es am ehesten gelingen.«
Das war eine Idee, die auch Däuble schon erwogen, aber noch nicht laut geäußert hatte.
»Gut«, sagte er. »Ich nehme Babi mit. So schnell es geht, werde ich mit Trägern zurückkommen.«
»Wann wirst du aufbrechen?«
»Gleich, noch heute abend.«
Nun, wo die Entscheidung gefallen war, konnte es Däuble nicht schnell genug gehen. »Babi, bereite alles vor, in zwei Stunden geht es los.«
Erschrocken sah Plessing seinen Bruder an: »Du willst wirklich nachts reisen?«
»Es ist nicht beschwerlicher als am Tag, und Babi kennt den Weg auch im Dunkeln.«
Däuble verschwieg, daß es ihm lieber war, wenn niemand aus dem Dorf von seiner Abreise Wind bekam.
Am Abend frischte es auf. Gewitterwolken schoben sich drohend über die Berge südöstlich von Peki. Wenig später flackerten Blitze am Himmel, rollten Donnerschläge über das Land. Däuble hoffte inständig, daß es nicht gleich wieder zu regnen anfangen würde. Der Boden war noch immer naß und rutschig von den Schauern der vergangenen Tage. Es wäre sicherlich einfacher gewesen, den Weg durch das Tal zu nehmen. Aber wenn sie die Hügelkette des Awudome überquerten, um sich dann nach Süden zu wenden, waren die Chancen größer, unbemerkt zu bleiben.
Der Pfad wand sich steil bergan. Däuble blieb einen Moment stehen, um seinen Atem zu beruhigen. Die kühle Nachtluft trocknete den Schweiß von seinem Gesicht. Er schaute zurück. Die erleuchteten Fenster der Missionsstation schienen nur einen Steinwurf weit entfernt. Tiefer im Tal sah er die Lehmmauern im matten Schein der verglühenden Kochfeuer. Wie friedlich die kleinen Hütten von hier oben aussahen. Und welches Horrorspektakel hatte er gerade noch dort erleben müssen. Ein Ort des Schreckens. Und ein Ort des Scheiterns.
Schon vor ihm hatten Missionare seiner Gesellschaft hier kapitulieren müssen. Die Verluste, die sie erlitten hatten, waren gewaltig. Nein, das durfte nicht alles umsonst gewesen sein. Sie würden wiederkommen, das schwor er sich. Sie würden eine Schule bauen und sie würden eine Kapelle errichten, mit einer Glocke, die alle Gläubigen zum Gebet ruft. Der Herr würde aus Peki einen Ort des Sieges machen, Sein Wort würde am Ende triumphieren.
Er wandte sich Babi zu, der ein paar Schritte weiter auf ihn wartete. Einmal mehr mußte er sich auf den Missionsgehilfen verlassen. Schon längst hatte er sich daran gewöhnt. Nachdem er zu ihm aufgeschlossen hatte, stiegen sie zusammen den Hang hinauf. Schon nach kurzer Zeit spürte Däuble seine Muskeln. Es war lange her, daß er solche Märsche unternommen hatte. Seine Wunde machte ihm wieder zu schaffen, doch er biß die Zähne zusammen und lief weiter.
Später, als der Weg sich in sanftem Auf und Ab durch die Hügelkette zog, fiel ihm das Laufen leichter. Er begann es sogar zu genießen. Es war allemal besser als das untätige Warten in der halbfertigen Station.
Die Wolken verschwanden, hoch am Himmel stand der Mond und tauchte das Land in ein silbriges Licht. Gottes Schöpfung lag da wie in ihrem Urzustand. Nichts störte die Stille dieser Nacht, weder die beiden Männer, der Weiße und der Schwarze, die im gleichen Takt über die krustige Haut der Erde liefen, noch jener andere Schatten, der ihnen lautlos folgte.
Teil 1Die Anstalt
»Immer tiefer, immer weiter, In das feindliche Gebiet Dringt das Häuflein Deiner Streiter, Dem voran Dein Banner zieht.«
Aus einem Missionslied,Mitte 19. Jahrhundert
Kapitel 1
Basel, 1852
Still und verlassen lag der Gemüsegarten im Hof der Baseler Mission. Die gepflegten Beete hatten für dieses Jahr ausgedient. Nur die Apfelbäume im hinteren Teil des Geländes trugen noch ihre Früchte. Vom Fenster seiner Kammer im zweiten Stock schaute Johann Straub über den Hof, ohne daß seine Gedanken ein bestimmtes Ziel verfolgten. Der Missionsschüler mochte die den Herbstfarben eigene Melancholie.
Im Garten gab es jetzt immer weniger zu tun. Wie hatte er es doch im Frühjahr und Sommer genossen, die frische, dunkle Erde mit den Händen zu greifen und ihren schweren Duft einzuatmen. Nun stieg dieser Duft mit letzter Kraft in den gedrungenen Stämmen der Bäume empor, hinauf in die rotgoldenen Äpfel, die ihn bewahren und noch auf dem Weihnachtsteller verströmen würden.
Das Knarren einer Tür unten im Hof ließ ihn aufschrecken. Die Küchenmagd trat aus dem Gebäude. Unter dem Arm einen großen Korb, stapfte sie über den Kiesweg. Wie ertappt wandte sich Johann vom Fenster ab. Hier gab es kein müßiges Herumstehen und Aus-dem-Fenster-gaffen. Wann immer jemand dabei beobachtet wurde, traf ihn ein strenger Verweis von Pfarrer Josenhans, der als Inspektor die Anstalt leitete.
Johann setzte sich wieder an sein Schreibpult, um an der Predigt weiterzuarbeiten, die er am Sonntag vorzulegen hatte. Sein Thema stammte aus dem Johannes-Evangelium: »Von der Verwandlung, die jeder erfährt, der Jesu begegnet.« Es war die Geschichte von dem Blindgeborenen, dem Jesus die Augen aufgetan und der daraufhin vor aller Welt Zeugnis für Gottes Sohn ablegte. Zu Sehenden werden die Blinden, wenn sie das Christentum annehmen, blind aber bleiben diejenigen, die es verwerfen, obwohl sie sehend sind. Diese doppelte Deutung von »sehend« und »blind« galt es klar herauszuarbeiten. Schwächen in der Argumentation riefen bei Inspektor Josenhans harsche Kritik hervor, war doch die Homiletik sein spezielles Steckenpferd.
Die Predigtübungen standen im Mittelpunkt der Ausbildung. In den zwei Jahren, die Johann nun an der Schule war, stellten sie höchste Anforderungen an ihn, mehr noch als andere Unterrichtsfächer wie Englisch, Latein und Griechisch. Er und seine Mitschüler mußten sich gehörig anstrengen, das umfangreiche Pensum zu schaffen.
Sie alle waren von ihrer Berufung zum Missionsdienst überzeugt. Das allein reichte jedoch nicht. Sie mußten nicht nur den Glauben haben, sondern auch die Kraft, ihn gegen die Ungläubigen zu verteidigen und weit mehr noch, ihn in die Herzen der Unwissenden zu pflanzen.
»Ich glaube, also rede ich«, pflegte der Inspektor zu sagen, wenn er von der Idee der Predigt sprach. »In der Predigt geht ihr über eure Grenzen hinaus. Ihr sollt euch erst ganz in den Text versenken und dann aus ihm wieder herauskommen und ihn der Gemeinde Löffel für Löffel eingeben.«
Johann legte die Schreibfeder beiseite, überflog noch einmal seine Notizen und begann, sich die ganze Predigt vorzusagen. Sie durfte nicht einfach nur heruntergeleiert werden. Es mußte ein Vortrag in freier, flüssiger Sprache sein, mit einem Duktus, der die Zuhörer fesselte, einer Betonung, die den Sinn der Worte verdeutlichte, mit kleinen und größeren Pausen, die das Gesagte unterstrichen.
Langsam ging Johann, während er seine Predigt vortrug, in dem kleinen Raum auf und ab. Die Gemeinde von schwarzen Kindern, die ihm vor Augen stand, hörte gebannt zu, ihre Herzen weit geöffnet für Gottes Wort. Durch das schmale Fenster fiel das Licht einer milden Oktobersonne. Auf der nördlich gelegenen Schwäbischen Alb hatten die frostigen Tage bereits eingesetzt. Die Stadt am Rheinknie hingegen profitierte noch von der mediterranen Luft, die warm das Rhone-Becken heraufwehte.
Basel war eine Handelsstadt. Der Güterverkehr auf dem Rhein sowie die Nähe zu den deutschen Fürstentümern im Norden und zu Frankreich im Westen hatten ihr beträchtlichen Wohlstand eingetragen. Die Tüchtigkeit ihrer Bewohner verband sich mit der protestantischen Tradition der Stadt. Die Tugenden, die Bankgeschäften und Handelsunternehmen zustatten kamen, kollidierten keineswegs mit dem Eifer, den Geboten Gottes gerecht zu werden. Gottesfurcht und Erwerbstrieb, Frömmigkeit und Bürgersinn gingen Hand in Hand.
Im Jahre 1815 hatten Baseler Bürger eine Missionsgesellschaft gegründet, die den verschiedenen Strömungen der reformierten Kirche eine gemeinsame Aufgabe stellte – die innere und äußere Mission. In den vier Jahrzehnten, die seitdem vergangen waren, hatte die Gesellschaft eine herausragende Stellung in den strenggläubigen, pietistischen Kreisen erlangt, unterstützt von zahlreichen Missionsvereinen, die besonders im Württembergischen viel Zulauf fanden. Die Baseler versorgten ihre Anhänger mit Schriften und Broschüren aus dem Calwer Verlag, aktuellen Informationen zu den religiösen und kirchlichen Fragen der Zeit. Hauptaufgabe aber blieb die Verbreitung des Evangeliums in den heidnischen Regionen der Welt.
Auswahl und Schulung derer, die sich zum Missionsdienst berufen glaubten, wurde mit großer Sorgfalt betrieben. Drei bis vier Jahre verbrachten die Zöglinge in der Anstalt, bevor sie sich wohlpräpariert auf den Weg machen durften.
An der Spitze der Missionsgesellschaft stand ein Komitee, in dem sich wohlhabende Baseler Bürger zusammenfanden. Dessen Beschlüsse setzte ein Inspektor in die Tat um. Seit 1849 nahm der aus Württemberg stammende Pfarrer Joseph Josenhans dieses Amt wahr. Unter den ersten Bewerbungen, über die er zu entscheiden hatte, war auch die des Johann Straub gewesen.
Als dieser mit seinem Predigttext fast fertig war, läutete die Mittagsglocke. Er schrieb den begonnenen Satz noch zu Ende, dann säuberte er die Feder, ordnete seine Materialien und ging in den Speisesaal.
Der langgestreckte Raum nahm einen großen Teil des Erdgeschosses ein. Hohe Fenster wiesen auf den Hof, dem einige Rotbuchen Schatten gaben. Der Saal selbst war von schmuckloser Schlichtheit. Weißgetünchte Wände, die sich dort, wo der Ofen stand, während des Winters eindunkelten vom Ruß und der Hitze. Aus der Decke traten die schweren Balken hervor, die das Obergeschoß trugen. Sie waren von derselben dunklen Farbe wie das massige Kreuz an der Stirnwand.
Johann schritt an den langen Tischen vorbei, die sich quer zu den Fenstern ausrichteten, bis er einen freien Platz nah am Gang fand. Seine Nachbarn begrüßte er mit einem stummen Nicken, dann richtete er den Blick wieder nach vorne, wo unter dem Kreuz der Tisch stand, der für die Lehrer reserviert war. Da der Inspektor heute nicht anwesend war, sprach Pfarrer Dettinger, der Hausvater, das Tischgebet. Ihm oblag es, das fein abgestimmte Getriebe der Schule am Laufen zu halten. Wann immer etwas fehlte, störte oder nicht den Regularien entsprach, war Dettinger derjenige, der es zu richten hatte.
Nach dem Gebet trugen die Zöglinge, die diese Woche den Küchendienst verrichteten, zusammen mit der Magd die Suppe auf. An die fünf Dutzend Schüler saßen auf den Plätzen. Es war üblich, wenn auch nicht ausdrücklich geboten, das Mahl schweigend einzunehmen, und so waren in dem hohen Saal nur die Geräusche klappernden Geschirrs zu hören sowie die Schritte derer, die den anderen das Essen brachten.
Einige der älteren Zöglinge kannte Johann seit seinen ersten Tagen in der Anstalt, ohne daß sich eine tiefere Beziehung zu ihnen ergeben hätte. Was sie alle miteinander verband, war die gemeinsame Aufgabe. Persönliche Freundschaften zwischen den Zöglingen wurden mißbilligt. Derlei Kumpanei führe nur zu Geheimnistuerei, sagte der Inspektor, und die störe das Vertrauensverhältnis zur Anstaltsleitung.
Johann schräg gegenüber saß einer der jüngeren Zöglinge, ein Schweizer, den er noch nicht mit Namen kannte. Dem wurde gerade von dem Küchenmädchen der Teller aufgefüllt, als irgend etwas am Verhalten der beiden Johanns Aufmerksamkeit erregte. Er konnte gerade noch erkennen, daß das Mädchen einen kleinen Gegenstand, wohl ein Stück Papier, in seine Schürzentasche schob und dem Schweizer einen vielsagenden Blick zuwarf, bevor sie zum Nächsten weiterging. Außer Johann schien niemand etwas bemerkt zu haben.
Nachdenklich blickte er auf den Teller, der vor ihm stand, während er das, was er beobachtet hatte, einzuordnen versuchte. Das Mädchen war ein Geschöpf von bedauernswerter Häßlichkeit, ihr Körper ungelenk und reizlos, ihr Gesicht verhärmt, mit herabgezogenen Mundwinkeln und stumpfen Augen. In den Jahren, die er schon hier war, hatte Johann kaum ein paar verständliche Worte von ihr gehört. Kein Wunder, daß sie einsam war. Anfangs hatte ihr Blick ihn manchmal verlegen gemacht. Es war auch vorgekommen, daß sie bei Tisch näher an ihn herantrat als nötig. An den Druck ihrer irritierend weichen Brüste auf seiner Schulter konnte er sich noch genau erinnern. Zu reagieren war er damals nicht imstande gewesen, obwohl zu seinem Erschrecken die Berührung Wohliges in ihm auslöste. Der Schweizer schien reaktionsfähiger zu sein.
Johann beugte sich nachdenklich über seine Suppe. Was sollte er tun? Eine Meldung machen? Dem Inspektor selbst oder dem Wöchner, der es weitergeben würde? Aber was hatte er denn schon gesehen? Das Küchenmädchen mit der Hand in der Schürze.
Nach der Mittagszeit ging jeder wieder seinen Pflichten nach. Alles, was an Arbeit in der Anstalt anfiel, wurde von den Zöglingen erledigt. An den Küchen- und Reinigungsdienst konnte sich keiner so recht gewöhnen. Beliebter war die Arbeit im Garten oder in der hauseigenen Schreinerwerkstatt. Der Aufsichtsdienst kontrollierte Stuben und Lehrräume, und der Wöchner hatte die Zöglinge zu wecken und diejenigen zu melden, die krank waren.
Für Johann war der Nachmittag voll belegt mit Unterricht. Missionswissenschaft, Gesang, englische Grammatik. So konnte er erst nach der Abendandacht wieder an seiner Predigt arbeiten. Doch die Konzentration war dahin. Immer wieder wanderten seine Gedanken in den Speisesaal zurück. Es war falsch gewesen, seine Beobachtung nicht zu melden. Dem Schweizer erwies er keinen Dienst, wenn er dessen Dummheiten tatenlos zusah.
Warum unternahm er nichts? Johann schloß die Augen, die Erinnerungen an eine tief in seinem Herzen vergrabene Schuld holten ihn ein. Er wußte, daß da der Schlüssel zu seinem Stillhalten lag. Er selbst hatte Schlimmeres getan als der Schweizer. Wie ein vertrauter Schmerz stiegen die Bilder jener Ereignisse in ihm auf, die ihn damals auf den tiefsten Grund der Sünde gezogen hatten. Langsam sank er auf die Knie und bat Gott um Vergebung, wie er es schon so oft getan hatte.
Bald darauf lag das Haus in der Missionsstraße still und friedlich im Mondlicht. Niemand, nicht einmal Johann Straub, der für gewöhnlich einen leichten Schlaf hatte, hörte die leisen Schritte auf dem Korridor, die den Weg über die Treppe hinab in den hinteren Trakt nahmen, wo das Personal schlief.
Kapitel 2
Wie jeden Mittwoch trafen sich die zwölf Mitglieder des Komitees im kleinen Versammlungsraum des Missionsgebäudes. Sie ließen sich an dem langen, mit grünem Filz bespannten Tisch nieder. Jeder von ihnen hatte seinen festen Platz. Am Ende des Tisches, das sich auf der Fensterseite befand, saß Pfarrer Laroche, der den Vorsitz führte. Zu seiner Linken zierten ein halbes Dutzend Porträtbilder die Wand. Mit ehrwürdigem Ernst schauten die ehemaligen Komiteemitglieder, die sich besondere Verdienste erworben hatten, auf die Versammlung herab. Ihnen gegenüber waren auf drei gleich großen Landkarten die Gebiete der gegenwärtigen Missionstätigkeit abgebildet, China, Indien und Westafrika. Fähnchen markierten die Standorte der Stationen.
Nachdem Laroche die Sitzung mit einem Gebet eröffnet hatte, erteilte er sogleich Inspektor Josenhans das Wort. Der Inspektor war unter den zwölfen – zur Hälfte Geistliche, zur Hälfte Laien – der einzige, der hauptamtlich der Mission diente. Wie üblich, erstattete er zunächst einen Bericht über die dringlichsten Angelegenheiten.
Heute ging es hauptsächlich um die Arbeit auf den Missionsstationen in Westafrika. Dort war es in den letzten beiden Jahren zu tiefgreifenden Veränderungen gekommen. Die Engländer, die sich in Afrika immer stärker engagierten, hatten den Dänen ihre gesamten Besitzungen abgekauft und weitgehend das Sagen übernommen. Darauf mußten sich auch die Baseler einrichten. In einem Brief von der Goldküste, den Pfarrer Josenhans zuerst vorlas, beklagte der Missionar Bernhard Zimmermann das rüde und teilweise überaus unvernünftige Vorgehen der englischen Soldaten.
»Aber wir kommen doch sonst recht gut zurecht mit den englischen Behörden«, bemerkte der Josenhans gegenübersitzende Ratsherr Socin-Heußler, in der Hand sein Monokel, das er in leicht affektierter Manier, aus nur ihm selbst bekannten Gründen, immer wieder an sein rechtes Auge führte und gleich wieder absetzte. »Was macht es denn so schwierig in Afrika?«
Der Inspektor, über dessen schmalen Lippen eine scharfkantige Nase saß, sah einen Moment stumm zu dem Ratsherrn hinüber. Dem war das nicht leicht zu erklären. Für einen Mann wie Socin-Heußler, der dem Kanton Basel als Finanzminister diente, waren nicht die Behörden schwierig, sondern die Menschen.
»Die Goldküste ist keine Kolonie im engeren Sinne wie zum Beispiel Indien. Es gibt keine Behörden, es gibt nur Militärstützpunkte.« Der Inspektor blickte zu Pfarrer Laroche hinüber, der ihm aufmunternd zunickte.
»Die Engländer und die Franzosen versuchen vorerst nur, ihre Einflußgebiete abzustecken, auch die Holländer und die Portugiesen mischen mit. Ich erinnere daran, daß trotz Verbot des Sklavenhandels gerade die Portugiesen dieses schändliche Geschäft im verborgenen weiterbetreiben, und das mit Unterstützung einiger verblendeter Eingeborenenfürsten. Die Ordnung durch die englische Schutzmacht ist daher wünschenswert.«
Pfarrer Josenhans legte die Hände nebeneinander flach auf den Filz.
»Aber«, fuhr er fort, »die englische Krone verfolgt ihre eigenen Interessen. Das sollten wir nicht außer acht lassen. Ihr geht es vorrangig um Gold, Elfenbein und um das Palmöl, das sie für ihre neuen Maschinenanlagen brauchen. Ob sie dabei mit Waffengewalt vorgehen müssen oder nicht, ist für sie unerheblich. Für uns aber macht es einen wesentlichen Unterschied, da wir die Herzen der Menschen erobern wollen.«
Der Inspektor versuchte, den Anwesenden etwas zu erklären, was auch er nur aus den Briefen der von ihnen ausgesandten Missionare wußte. Das war nicht leicht. Ihre Augen, das waren die Missionare vor Ort. Nur durch sie konnten sie erkennen, was geschah. Aber der Blick dieser Augen war nicht selten getrübt.
Auf einer Inspektionsreise, die ihn ein Jahr zuvor zu den Stationen in Südindien geführt hatte, war ihm die Einsicht gekommen, daß der Missionar vor Ort nach einer gewissen Zeit vollständig in die kleine Welt hineinwuchs, in der er wirkte. So lernte der Bruder an der Missionsfront zwar die Probleme kennen, die seine Arbeit unmittelbar betrafen, stand aber in Gefahr, den Blick für das Ganze zu verlieren. Dies führte immer wieder zu Konflikten zwischen den Missionaren und ihrer Zentrale. Dagegen sah Pfarrer Josenhans nur ein Kraut gewachsen: unbedingter Gehorsam. Ohne eine streng beachtete Hierarchie konnten Missionsleitung und Ausgesandte nicht fruchtbar zusammenwirken. Diese Erkenntnis bestärkte ihn in dem autoritären Geist, in dem er die Anstalt in Basel führte. Der Inspektor wußte, daß sich die Komiteemitglieder im Zweifelsfall immer auf sein Urteil verließen.
»Die Küstenregionen mit ihren Festungen, allen voran Christiansborg, wo Bruder Zimmermann wirkt, können als gesichertes Terrain gelten. Doch in den undurchdringlichen Wäldern des Hinterlandes gibt es Königreiche, wo das Heidentum ungebrochen wütet und grausame Feste feiert. Unsere Missionare berichten von Menschenopfern. Junge Mädchen, manchmal dreißig an einem Tag, sterben unter dem von der Hand gottloser Fetischmänner geführten Messer. Nachbardörfer werden überfallen und die Gefangenen als Sklaven verkauft.«
Pfarrer Josenhans nahm die um den Tisch Versammelten einzeln ins Gebet, sein Blick erfaßte ein Gesicht nach dem anderen. Er sah darin die Betroffenheit und den Schauder. Natürlich kannten sie diese Geschichten, natürlich hatten sie bereits von den blutrünstigen Ritualen des schwarzen Kontinents gehört. Doch es war seine Aufgabe, sie immer wieder daran zu erinnern, sie wachzurütteln, damit sie in ihrem Eifer nicht erlahmten, das Evangelium über die ganze Welt zu verbreiten.
Das aber war es nicht allein. Ohne daß es ausgesprochen werden mußte, war ihnen allen klar, daß sie auf die Spenden der Missionsvereine angewiesen waren, die diese in ihren Kollekten sammelten. Bis zum letzten Anhänger im kleinsten Dorf mußten alle stets aufs neue mobilisiert werden, um das Geld für die kostspieligen Aufgaben in den fernen Ländern aufzutreiben. Über jeden Groschen und jeden Kreuzer, der in der Kasse landete, hatte das Komitee Rechenschaft abzulegen. Wenn die Erfolge ausblieben, die Taufziffern sanken, so drohten Spendenfreudigkeit und Finanzquellen zu versiegen. Und vice versa. Ebbe in der Kasse machte alle hochfliegenden Pläne zunichte.
Pfarrer Josenhans, der daran Gefallen fand, im Rahmen dieser profanen Zusammenhänge das Beste herauszuholen, nahm aus dem Stapel, der vor ihm lag, einen Brief hervor. »Wir haben Nachricht von der Norddeutschen Mission über ihre Arbeit beim Ewe-Volk.«
Er verlas, was Inspektor Treviranus aus Bremen über die Station Peki berichtete. Danach erläuterte er: »Sie möchten bald weitere Kräfte entsenden und fragen an, ob unter den Zöglingen unserer Anstalt in absehbarer Zeit geeignete Kandidaten zur Verfügung stünden.«
Pfarrer Josenhans sah sich zu einer Erklärung genötigt.
»Peki ist einer dieser Orte im Hinterland. Dort, am Awudome, den Bergen des nördlichen Hochlandes, gibt es keine Soldaten und keine Festungen. Im übrigen darf ich daran erinnern, daß die Missionare Wilhelm Däuble und Heinrich Menge Zöglinge unserer Anstalt waren. Zusammen mit dem Ehepaar Quinius haben sie die Station wieder aufgebaut. Da Quinius und seine Frau aus Gesundheitsgründen Afrika verlassen wollen, wird Ersatz nötig sein. Wir sollten die Arbeit der Bremer in jeder Weise unterstützen. Ich werde in einer der nächsten Sitzungen meine Vorschläge unterbreiten.«
Laroche, dessen wasserblaue Augen mit dem Rot seiner Hängebacken kontrastierten, nickte ihm zu. Seiner Hilfe konnte der Inspektor immer gewiß sein. Die nächsten Tagesordnungspunkte betrafen die Finanzen und die Berichte der Unterstützergemeinden. Josenhans lehnte sich zurück und erlaubte seinen Gedanken, einen Moment abzuschweifen.
Er selbst hatte wesentlichen Anteil an den Fortschritten der Bremer Mission. Sie hatte bereits in den vierziger Jahren Missionare an die Goldküste in Westafrika geschickt. Von vieren war nur einer wiedergekehrt, und der starb, als das Schiff, das ihn in die Heimat brachte, in Hamburg anlegte. Als die Mission nach diesem Fehlschlag auch noch in Finanznot geriet, stand sie kurz vor der Auflösung. Damals war Josenhans nach Bremen gefahren und hatte die Neuorganisierung in die Hand genommen.
Seitdem bildete die Norddeutsche Mission keine eigenen Missionare mehr aus, sondern übernahm Schüler aus Basel, gegen eine angemessene Vergütung, natürlich. Auch dies eine Entwicklung, die der Inspektor maßgeblich mit vorangetrieben hatte. Selbst englischen Missionsgesellschaften stellten die Baseler bei ihnen ausgebildete Kräfte zur Verfügung. Zwar mußten diese Missionare sich strikt nach den Regeln der jeweiligen Missionsleitung richten, aber der Einfluß von Inspektor Josenhans und seiner »Baseler Schule« erhöhte sich durch diese Ausbildungspolitik erheblich.
Dergestalt wurden enge Kontakte zwischen allen geschaffen, die sich um die Heiden-Arbeit bemühten. Besonders Inspektor Treviranus, der dem Komitee der Bremer vorstand, war zu einem treuen Parteigänger von Josenhans geworden. Das erleichterte ihre Arbeit in Afrika, wo die Baseler und die Norddeutsche Missionsgesellschaft in unmittelbar benachbarten Gebieten wirkten.
Inspektor Josenhans blätterte in seinen Papieren. Als er den Brief, den er vor ein paar Tagen aus London erhalten hatte, in den Händen hielt, überlegte er kurz, ob er ihn in dieser Sitzung noch vorlesen sollte, entschied sich dann aber dagegen und legte ihn beiseite. Er hatte gerade das Zwölfuhrläuten gehört, ein Zeichen für ihn, die Sitzung des Komitees zu unterbrechen. Pfarrer Laroche schlug vor, daß sie die Beratung nach der Mittagszeit um Punkt zwei fortführen sollten.
Kapitel 3
Johann, der für den Ordnungsdienst eingeteilt war, hatte gerade die Kammern im zweiten Stock inspiziert und kam nun den mittlerweile leeren Flur im ersten Stock entlang, als er die offene Tür des Sitzungszimmers bemerkte. Auf dem Tisch lagen noch Blätter und Papierstapel. Also würde das Komitee später weitertagen. Da er nun mal gerade hier war, beschloß er, kurz nach dem Rechten zu sehen. Er öffnete das Fenster, um frische Luft hereinzulassen und rückte die Stühle zurecht.
In diesem Raum empfand er immer so etwas wie Ehrfurcht. Hier wurden die Entscheidungen getroffen, die den Lebensnerv aller Zöglinge berührten. Während er um den Tisch herumging, fiel ihm die Unterschiedlichkeit der Papiere auf, die auf den einzelnen Plätzen lagen. Auf einem Blatt waren Zahlenkolonnen und Listen zu erkennen, auf anderen kleine Zeichnungen und Kritzeleien. An der Stirnseite entdeckte er einige Briefe, der größte Stapel aber lag einen Sitz weiter. Das mußte der Platz des Inspektors sein. Er wollte gerade weitergehen, als ihn eine Formulierung stutzen ließ. Noch einmal beugte er sich über das Schriftstück, das zuoberst lag und las die erste Zeile: »Die geheime Stadt.«
Drei Worte, die ihn magnetisch anzogen. Nach einem Moment richtete er sich erschrocken auf. Diese Dinge waren nicht für seine Augen bestimmt. Zögernd verließ er den Raum. Der Flur war leer. Natürlich, alle waren um diese Zeit beim Mittagessen. Er sah zurück zum Tisch. Verlockend lag dort das Papier mit der seltsam faszinierenden Überschrift. Wenn man ihn dabei ertappte, wie er in den Unterlagen des Inspektors las, würde dies seinen sofortigen Ausschluß aus der Anstalt zur Folge haben.
Von ferne vernahm er das Klirren von Geschirr. Ein zweiter Blick konnte nicht schaden. Langsam ging er zurück in den Sitzungssaal. Hinter dem Stuhl des Inspektors blieb er stehen, um die Unterzeile zu lesen: »Nach dem Bericht des Missionars Thomas Birch Freeman.«
Dieser Name war ihnen allen bekannt. Der Methodistenpfarrer Freeman war als erster Missionar im Ashante-Land gewesen. Er hatte all das gesehen, wovon sie nur gehört hatten – Urwälder mit Bäumen, hoch wie Kathedralen, Könige in goldüberladenen Palästen, die enthaupteten Leiber der Geopferten. Auf seinen von den Methodisten veröffentlichten Tagebüchern basierten die Geschichten, die ihre Phantasie beflügelten.
Der Bericht war in Deutsch verfaßt. Johann schob die obersten Blätter beiseite und stieß auf den Originalbrief. Er trug die Adresse der Londoner Missionszentrale. Der Inspektor hatte ihn also bereits übersetzt. Er legte die Papiere wieder zurecht und begann zu lesen.
An den Inspektor der Baseler Mission, Pfarrer Joseph Josenhans.
Lieber Bruder, Du hast jüngst bei uns angefragt, ob wir Näheres über jene heidnischen Königreiche erfahren hätten, die im Westen des afrikanischen Kontinents, fernab der Küste, im Namen des Erbfeindes der Menschheit ihre finstere Herrschaft ausübten. Nun, Du wirst die Tagebücher unseres Bruders, des Reverends Thomas Freeman, kennen, in denen er seine Reisen nach Kumasi, Dahomey und Abeokuta beschreibt. Sein Bericht über den Aufenthalt in letztgenannter Stadt wies einige Merkwürdigkeiten auf, die wir nach eingehender Beratung der Veröffentlichung entzogen haben. Du weißt selbst, daß die Ausgesandten nicht nur mit dem Schwert des Glaubens, sondern auch mit dem Herzen der Liebe zu Werke gehen. So mag es manch einem geschehen, daß er sich den süßen Worten der Versuchung aus reinem Mitleid öffnet. Unsere Aufgabe muß es sein, das Erbauliche vom Zweifelhaften zu scheiden. Schließlich mag es dem Herrn gefallen haben, auch dort, wo wir nur Unwissenheit vermuten, eine verborgene Ahnung von Seiner alleinigen Allmacht und Seiner Größe belassen zu haben, auf daß wir, seine demütigen Diener, sie finden und zu neuem Leben erwecken. Außerdem möchten wir vermeiden, daß irgendwelche bösen Zungen unserem Bruder vorwerfen, er wäre dem Blute seines Vaters gefolgt, der, wie Du ja weißt, ein Neger war. So mögest Du selbst entscheiden, inwieweit dieser Bericht unserer großen Aufgabe dienen mag.
Ein erklärendes Wort wollen wir allerdings voran stellen, damit Du begreifst, was es mit jenen Emigranten aus Sierra Leone auf sich hat. Im Jahre 1836 lösten die Mitglieder unserer Station in Sierra Leone, wo auch Bruder Freeman zu dieser Zeit wirkte, eine Gruppe Sklaven aus der Gefangenschaft. Diese Männer sprachen einen fremden Dialekt und niemand wußte, woher sie stammten. Die Mission nahm sie auf und lehrte sie das Englische. Als sie der Sprache hinreichend mächtig waren, stellte sich heraus, daß sie vom Stamme der Yoruba waren. Sklavenjäger hatten sie gefangengenommen und in die Fremde verkauft. Diese ihrer Heimat Entrissenen zeigten sich ihren Rettern dankbar und nahmen die Worte des Herrn an. Als bekehrte Christen und freie Männer vor Gott hatten sie nur noch einen Wunsch: zurückzukehren in das Land ihrer Väter, um dort von dem zu künden, was ihnen widerfahren. So verließen sie mit dem Segen unserer Brüder die Mission in Sierra Leone.
Im Jahre des Herrn 1842 machte nun Bruder Freeman, der sich auf einer Reise nach Dahomey, im Landesinneren befand, in Badagry Station. In dem Hafenort, der durch den Sklavenhandel reich geworden war, erfuhr er von den ehemaligen Schützlingen aus Sierra Leone. Sie waren, so hieß es, in die Hauptstadt der Yoruba zurückgekehrt. Der Name dieser Stadt ist Abeokuta, das heißt » Unter den Steinen«. Unendlich viele Legenden ranken sich um diesen Ort, den kein Weißer bis dato je gesehen hatte. Bei den Europäern hieß er deshalb nur »die geheime Stadt«. Bruder Freeman sah den Weg, den der Herr ihm wies und änderte seine Reiseroute. Zwei Monate später sandte er uns seinen Reisebericht.
Johann zog den Stuhl zurück und ließ sich darauf nieder, um auch den Freeman-Bericht zu lesen.





























