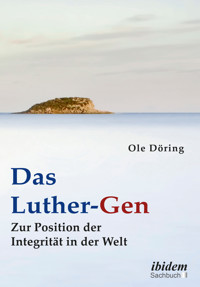
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ibidem
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wir tun das Richtige aus den richtigen Gründen, indem wir die Aufklärung zur Tugend machen, gegenüber den Menschen Verantwortung üben und die Spiele des Guten mit ganzem Herzen gestalten. Wie würde Martin Luther unsere Welt mit den Augen Willy Brandts sehen? Was dieser Luther uns als konfuzianisch geschulter Weltbürger wahrscheinlich zu sagen hätte, findet sich in Ole Dörings sprachgewaltigem politisch-philosophischen Essay. Das Buch ist nicht nur eine erschütternde Bestandsaufnahme des Geistes unserer politischen Verfassung; es werden auch Wege aufgezeigt, das Auseinanderfallen unserer Welt als Chance zu begreifen. Zehn faszinierende Kapitel hindurch nimmt uns Döring mit auf eine politisch-sprachlich-philosophische Tour de Force, in ironischer Selbstreflexion, voll scharfer Analysen und in brillanter Sprache. Er komponiert aus bescheidenen Taten radikalen Lernens den Mut, menschlich zu bleiben. Mal schmerzhaft, mal mit fröhlichem Urvertrauen – wir sehen in diesem Spiegel deutscher Befindlichkeit einen politischen Augenöffner! Mit seinem Integritätsplan stellt Döring zudem eine neue Theorie vor: Das Wagnis der Arbeit, die Welt ihrem inneren Sinn nach zu denken, verbindet jeden Einzelnen durch das nackte Menschsein und befreit uns zur Verantwortung für die Welt. Ein fesselndes Stück zeitgenössischen Denkens, ein Genuss für den kulturhungrigen Geist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 266
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
ibidem-Verlag, Stuttgart
Inhaltsverzeichnis
1 Auftakt
1.1 Stau der Geschichte
1.2 Hang des Menschen
1.3 Bis an die Sterne weit
1.4 Etikette
Zwischenspiel
2 Eingang
2.1 Mustern
2.2 Verstört
Zwischenspiel
3 Aufgang
3.1 Verdreht
3.2 Schütteln
3.3 Ausstrecken
3.4 Aufgerafft
Zwischenspiel
4 Bewegung im Durchgang
4.1 Ausgreifen
4.2 Zugang
4.3 Sammlung
4.4 Zutrauen
4.5 Mobilisieren
4.6 Sapere Aude!
4.7 Spirale abwärts
4.8 Durch die Mitte
Zwischenspiel
5 Gestalt der Kultivierung
5.1 Szenerie
5.2 Harmonik
5.3 Partitur
5.4 Libretto
5.5 Vorhang
5.6 Apotheose
Zwischenspiel
6 Raum der Integrität: Anerkennung oder Gehorsam
6.1 Gute Arbeit
6.2 Wertgehalt
6.3 Fehlsteuerung
6.4 Der Gott der kleinen Dinge
6.5 Zu guter Letzt
Zwischenspiel
7 Die Zeit der Integrität: Tradition
7.1 Unmündige Unrast
7.2 Wert-Basis
7.3 Wert-Fluss
7.4 Kredit-Würdigkeit
7.5 Welt-Sichten
7.6 Gutes Potential ist ein Auftrag
Zwischenspiel
8 Verantwortung
8.1 Kontakt-Aufnahme
8.2 Einblicke
8.3 Entwirrung
8.4 Abnabelung
8.5 Erb-Last
8.6 Selbst-Vergewisserung
8.7 Orientierung
8.7.1 Reihenfolge
8.7.2 Dienstverhältnis
8.8 Arbeit
8.9 Gesund denken
8.10 Spiel des Webens
8.11 Tanz des Lebens
8.12 Maßband
Zwischenspiel
9 Solidarität
9.1 Vorkehrungen
9.2 Anlage
9.2.1 Ökonomie sozialer Gesundheit
9.2.2 Gesunde Sozial-Ökonomie
9.2.3 Sozial gesunde Ökonomie
9.2.4 Berauschte Kannibalen
9.2.5 Billigbäcker
9.3 Wert-Geschöpf
9.4 Tilgungsplan
9.5 Wertstoff
Zwischenspiel: Arztblick
10 Gerechtes Ende
10.1 Recht geschehen
10.2 Nützliche Gerechtigkeit
10.3 Gerechte Kultur
10.4 Der Große Weg
Impressum
Wo wir stehen
1 Auftakt
Machen wir uns nichts vor: Wir leben noch immer im 19. Jahrhundert. Trotz Demokratie, Wissenschaft, Technologie und Globalisierung, trotz iPhone und Genmanipulation, Automobilität, Atomraketen und Internet. Vor allem: Trotz allen Wissens über die Geschichte und unsere Möglichkeiten das Richtige zu tun.
Der Horizont unseres Denkens spielt zwischen Kant und Darwin, Bismarck und Nietzsche. Unsere öffentliche Ordnung zementiert die Entfremdung zwischen Mensch, Gesellschaft und Staat. Unsere Rolle in der Welt ist die eines kolonialistischen Geschwürs geblieben. Halb verschämt konsumieren wir die Früchte verbotener Taten. Unsere Zwischenmenschlichkeit spricht die Sprache der Fremdbestimmung durch abgelebte Geschichten von Gender, Rassen, Ideologien, Klassen, Geist und Maschine, Schwarz und Weiß. Auch in der Bildung, im Recht und in der öffentlichen Sicherheit schotten sich überwunden geglaubte Grundmuster ab. Die Vertaktung und Zergliederung lebendiger Prozesse schreiben militärische Rationalität in unsere Zivilisation der Entfremdung ein. Die Erstarrung menschlicher Qualitäten zu Kenngrößen in Produktionsabläufen, der Wildwuchs orientierungsloser Kompetenzen, die Angst vor Entscheidung und Verantwortung sind Blüten einer giftigen Saat. Arbeit dient weiterhin dem Unterhalt der Unfreiheit: Unser Arbeitsleben ist radikal auf Produktion und Konsum ausgelegt. Selbst Kreativität ist ein Marktvorgang. Dessen innere Welt haben wir in unseren Schaubuden fast gänzlich von Bedeutung und Wert entkoppelt. Wenn ich überhaupt denken kann, Souverän oder doch Mit-Autor meines Lebens zu sein, dann nur um den Preis des Abschieds von dem Gedanken der Gesellschaft von dem, was sich nunmehr als Schwarm geriert.
So wie wir unsere Arbeit verstehen, organisieren wir eine Ökonomie des Toten. Das Grundmotiv der Liebe zum Leben wurde abgelöst durch das Aufbrechen jedes Zusammenhanges von Inhalt und Form, die Pervertierung der Grenzen: mit der schrankenlosen Ausweitung des Pornographischen, hinein in die aufgeschlagenen Leiber, in die Kraftzellen der Materie selbst, in die elementaren Eiweiße unserer Reproduktion. So kommen wir zu einer raffinierten Industrialisierung des Todes mit einer unerhört subtilen ›liberalen‹ Wirkmacht, für die man nach der Sprachlosigkeit des Holocausts weder Begriff noch Verständnis haben kann.
Erstmals in der Geschichte der Menschheit ist die Masse weniger als die Summe ihrer Teile. Unsere soziale Sicherung retardiert: Wir erlauben, dass aus ersten Schritten und Ansätzen für eine solidarische Gesellschaft ein kleinkarierter Marktplatz wird mit Regeln, die auf Misstrauen gründen; mit Tugenden, die wir nicht pflegen und Gesetzen, die Verzweiflung nach sich ziehen müssen. Unseren Kindern leben wir nicht nur Konsum, Selbstsucht und Verunsicherung vor, sondern auch die entsprechenden Kulturtechniken, die Verlogenheit und die Verdrängung. Wir sehen zu. Wir verstehen manches, sind besorgt – und handeln nicht.
Das ›Ende der Geschichte‹ war ein großes, vielsagendes Missverständnis. Zwar haben sich Faschismus und Sozialdarwinismus aus der raumgreifenden Anmaßung und staatlichen Verfassung ins Private zurückgezogen, sie sind aber nicht erledigt. Die Geschichte geht weiter. Für den Moment haben die neoliberalen Technokraten gewonnen, die Gesellschaft und Ökonomie sowie Denken und Handeln manipulieren. Dies gelingt ihnen nun durch die Macht der strukturellen Gewalt, die alle maßgeblichen Abläufe, Institutionen und auch die Sprache durchdringt. Der Unterschied zum ehemaligen planwirtschaftlichen Rahmen? Die kleinbürgerlich verzagte Zurückhaltung ist verschwunden mit der grotesken Anstrengung, die Welt der Wahrnehmung ideologisch zuzurichten. Die zynische Kraft aus Gier und Angst entfesselt das Potential menschlicher Makel, entfaltet ihre irre Wucht, gebündelt durch das eisige Prisma des Kommerz und kann so wirkmächtig wie nie die Welt verheeren. Die Wellen der Steine, die wir Europäer in die Wasser der Welt geworfen haben, wogen nun zurück und branden an unsere Küsten. Sie halten unserer Bigotterie Spiegel vor, verlangen nicht nach ›Demokratie‹, sondern Würde, zwingen unsere Überheblichkeit auf den Boden der Realwelt zurück. Für ihre Gesichter haben wir noch nicht einmal Namen: Flüchtlinge, Asylanten, Mitmenschen, Kontingentfälle? Sie branden nicht mehr nur mild tastend an die südlichen Gestade, sondern unversehens mit ungeheurer Macht: »Wir sind auch Menschen! Genau wie ihr!« Wir wissen es längst, lehren es auch eindringlich. Aber Papier ist geduldig. Was soll uns das?! Wir haben uns in dieser Provinzialität sicher eingerichtet. Unsere Provinz wähnt sich stark.
Unser Fortsatz Eurasiens wähnt sich stark, hat Gebirgswälle. Den Rest umgibt die Weite des Meeres.
Dieses Lied ist zu Ende.
Wir hatten doch Zeit uns aufzustellen, uns vorzubereiten, eine Friedensdividende? In der Tat. Aber jetzt müssen wir liefern. Sind wir vorbereitet?
Deutschland hat seinen Vorsprung und seine privilegierte Lage nach dem Zweiten Weltkrieg im zu erwartenden Rahmen genutzt und im relativen Vergleich mit unseren Nachbarn mäßig erfolgreich eingesetzt. 1989 bot die Geschichte Europas die Chance: sich zu zeigen, befreit von Schleiern ideologischer Lügen, von den Störsendern, die die Hymnen des Kalten Krieges spielen, von den Bremsklötzen der Selbstgestaltung. In der Antike war ehrliche Nacktheit schön. Wem würden wir begegnen auf unserer befreiten Agora? Kohl!
Alles, was unter der Decke dieser Morgenröte gezeugt wurde, in der Begeisterung materieller Verbindung und berauscht vom Staub zerrütteter Mauern, tritt nun zu Tage. Die Inkubationszeit dauert ein bis zwei Generationen. Und siehe da: Die Welt, ihre Bewohner, ihre Geschichten sind zerrissen. Die Lüge zwitschert von allen Masten. Wir befinden uns in einem Spiegelkabinett ohne Roadmap. Vergangenheit und Zukunft kollabieren in einem zersplitterten Jetzt. 2016 verzeichnet der Einzelhandel den höchsten Umsatz aller Zeiten. Wie schön. Wehr- und hilflos verjubeln wir unsere menschlichen Werte für Brot und Spiele.
Halten wir einen Moment inne: Ist das etwa alles? Finden wir so die Versprechen wieder, die eine humanistische Aufklärung ein Jahrhundert davor verkündet hatte? Jene Versprechen voll von sprühendem Enthusiasmus als Injektion der Leidenschaft antiker Weltumarmung, und gegen die Unmündigkeit, Verzweiflung und erschrockene Hybris einer klerikal-merkantilen Weltordnung?
1.1 Stau der Geschichte
Die Wirklichkeit schert sich nicht um die Anordnungen des Zeitstrahls. Ja, der letzte qualitative Systemsprung fand im 19. Jahrhundert statt: Die Individuen und Gemeinschaften mussten sich aufgrund des welterschütternden Wandels der Industrie, der Machtorganisation und der Überlebenszwänge ganz neu verstehen, unter- und einordnen. Die Formen, Infrastrukturen, Ideologien, Institutionen, Symbole und Geschichten wandelten sich – im Kleinen wie im Großen – nicht annähernd so stark wie es die äußere Dynamik nahelegen würde. Dazu ist die frostige Schockstarre der Weltkriege zu tief eingedrungen. Der Widerhall ihres Echos hat den aufkeimenden Lebensgarten des aufgeklärten Humanismus grundlegend und nachhaltig verödet. Er hat uns ausgebremst, verstört, gedemütigt, so dass wir uns bei allem Ringen um Befreiung immer wieder nur gelähmt und verstrickt in den verzagten Traumgeschichten des Biedermeiers wiederfinden. Im Geiste eine Stiege hoch getrabt, im Raum eine halbe Stufe genommen. Es wird Zeit, dass wir uns nicht nur der internen Kritik dieser Muster zuwenden, sondern auch aus ihnen herauswachsen. Dazu brauchen wir einen Integritätsplan, der uns bei der Gestaltung der Welt Orientierung schafft und uns bei der Bestimmung unterstützt, wer wir dabei sind und wer wir sein wollen. Die damit einhergehende Vielfalt und Widersprüchlichkeit verbinden wir zu einem kohärenten Bild vom Menschen, der ich in der Menschheit bin.
Wenden wir uns von den deprimierenden Aussichten des großen Ganzen und des Kleinkrams ab und sehen wir uns näher an, was uns übrigbleibt, wenn wir weder Fatalismus noch Hybris oder Ignoranz pflegen mögen. Da zeigt sich ein roter Faden. Den können wir aufnehmen, mit Zuversicht und Hoffnung; nicht aus Glauben oder Wunschdenken, sondern aus dem Versprechen der Arbeit und aus der Einsicht in die Grenzen eines jeden Urteils. Dazu gehört auch die bereits erwähnte Einordnung unseres Verhaltens. Denn wir können ja handeln: lernen und versuchen, es besser zu machen. Wir können uns redlich mühen, das Richtige aus den richtigen Gründen zu tun.
Mit den folgenden Überlegungen möchte ich eine Gedankenbewegung für einen Plan entwerfen. Der soll alle konstruktiven Faktoren des Menschlichen in eine Wegbeschreibung fassen. Die bescheidene Zuversicht, dass dies eine positive Resonanz erfährt, speist sich aus dem Fundus, der diesem Unternehmen zugrunde liegt: Eine über 30 Jahre laufende philosophisch-weltbürgerliche Arbeit des Zusammendenkens und der Kooperation zwischen Deutschland und China. In dieser Zeit habe ich – im Denken der Antike wurzelnd, im ausgehenden 20. Jahrhundert sozialisiert und im 21. Jahrhundert als Philosoph zwischen diesen Welten gereift – diese disziplinär, national und kulturell verfassten Erfahrungsräume durchmessen und erfahren, mich mit ihnen verwoben und ihrer eigenwilligen Weisheit anvertraut. Zum einen ist dieser Bestand so noch nie aufgearbeitet worden. Zum anderen trage ich hier das Wissen der beiden großen Traditionen weltbürgerlich aufklärender Kultur zusammen. Dies geschieht in einer Weise, die sie einander unterstützen, ergänzen, weiterspinnen lässt: sino-europäisches praktisches Wissen und Weltdenken als Rahmen für eine Zukunft Eurasiens, unserer Welt in der Welt.
Ein solcher übergreifender Ansatz ist nicht nur aus Gründen einer systematischen oder inhaltlichen Vollständigkeit wichtig und richtig, sondern auch weil wir mit dieser Aufstellung von Anfang an der Versuchung binnenkultureller Selbstbeschneidung widerstehen. Die Eigenart sprachlich ausgedrückten Wissens bringt uns dann strukturell zu einem Spiel, das zwar klare Regeln hat, aber doch unabgeschlossen und gestaltbar ist. Uns bleibt immer bewusst, dass wir unser Denken und Wissen zwischen allem Navigieren als Bewegung im Prozess inszenieren müssen, wenn wir gut handeln wollen.
Nicht Reinheit, Vollständigkeit oder Verweilen im Augenblicke sind die Ziele, um die es geht, sondern eine Kultur der achtsamen Kreativität, des Abwägens und des Ausgleichs durch fortgesetzt tätige Aufklärung und Arbeit. Das ist auch den Grenzen dieses Ansatzes geschuldet: Er muss sich im Modus des essayistischen Erzählens halten. Der Autor mäandert zwischen betroffener Befangenheit und auktorialer Erkundung.
1.2 Hang des Menschen
Dieser Essay heißt Das Luther-Gen. Die Metapher ist in keiner Weise wörtlich zu verstehen. Zwar lassen sich einige genealogische Zusammenhänge konstruieren, wenn man bereit ist, sich mit symbolischen und oberflächlichen – also nichtssagenden – Ansprüchen einer Wahlverwandtschaft zufrieden zu geben. Dem steht auf jeden Fall entgegen, dass nichts von dem hier Gesagten ohne eine tiefe und enge Auseinandersetzung mit der konfuzianischen Philosophie denkbar gewesen wäre. Auch der Kant, der hier mit am Werk ist, hat den Politiker und Gottesmann aus Wittenberg überschrieben. ›Luther‹ muss man sich hier als Weltbürger vorstellen, dessen hybrider Symbolcharakter etwas allgemein Menschliches bedeutet. Dieses ›Gen‹ hat jeder Mensch. Und wie bei jedem Gen bleibt es bedeutungslos, solange es nicht praktisch wird.
Es geht um den Standpunkt und die Haltung des Handelns, um die Wiedererinnerung an grundlegend Gewusstes, um die Rückbesinnung an die Arbeit der Selbstkultivierung und um die integrative Leistung der Vernunft. Es geht um die unprätentiöse Anmaßung, das Richtige aus den richtigen Gründen tun zu wollen. Die Mittel und Wege sind in ihrer Gebundenheit an diese zu verstehen; als Milieu der Wechselwirkungen, dort wo der Standpunkt nicht nur zum Weg wird, sondern sinnvolle Bewegung ist. Selbstverständlich geht es auch um eine proportionale Einordnung von Macht, von Disziplin und Eitelkeit, von Dummheit und Gier, vom Scheitern und dem Platz des Bösen.
Das Wort wird zur Tat. Die Tat steht zum Wort. Sie verstehen einander, richten sich aneinander aus.
Das ›Luther-Gen‹ ist die Anlage. Es verleiht dem Menschen seinen spezifischen Hang: Wir können nie neutral sein, nie objektiv, weder Neutrum noch Intellekt. Wir können das noch nicht einmal wollen. Was wir dagegen wollen können, ist: es richtig machen, das Gegebene anders machen. Denn hier haben wir einen Begriff der Bedeutung dessen, worum es geht: zu handeln, als ob wir nicht anders können.
Das hat auch etwas mit dem Tonfall zu tun. Es gibt da einen guten mittleren Weg zwischen der bieder ernsten Humorlosigkeit, für die ein bekanntes Zerrbild des Deutschen steht und mit dem wir gelernt haben zu kokettieren, und der Frivolität, in der wir es uns im Gerede von abwesenden Werten oder Alternativen bequem machen. Andere mögen da eher zynisch werden oder sentimental oder polemisch; das ist aber auch keine angemessene Weise, sich über sich selbst Gedanken zu machen. Besser passt da sicher der humorvolle Ernst, in dem uns ein von Bülow selbst die abgründigsten Tiefen des Menschseins mit heiterem Respekt und entlarvender Klugheit erträglich vermitteln konnte.
Warum aber ausgerechnet über Gesundheit, Bildung, Recht reden? Dieses dreifaltige innere Firmament umspannt das Feld, auf dem wir unser Erleben organisieren. Wir lassen uns auf nichts weiter reduzieren als auf das Gespinst dieser Grundtöne des Menschlichen: Leib, Geist und Gesellschaft reichen hier aus dem Ich heraus und wenden sich dem Du des Lebens zu. Wir erfahren uns als aktives Subjekt, als Ordnung stiftenden Zusammenhang, im Gewebe aus Innen und Außen. An diesem Brennpunkt kommt es aufs Ganze an: Ein korrupter Leib, ein stumpfer Geist, eine Tat ohne Widerhall stört mein inneres Gleichgewicht und stößt mich aus der Bahn. Diese roten Fäden des Lebens gleichmäßig zu einem Strang gesponnen: So beginnt die Verknüpfung zu einem Grundmuster, in dem ich schön bin.
Das ist die innere Seite der Positionierung zur Integrität. Die äußere, politische Seite dieser Medaille lässt uns auf das Gute sehen: Die thematische Triade entfaltet sich hier im Vollzug einer perspektivischen Drehung in die subjektiven Zwischenräume des Menschlichen. Mit ihrer Öffnung zur Gesellschaft erstarrt sie zugleich zum Objekt. Ihr entsteigt im Medium der Handlungswelt die Gestalt einer sozialen Topographie aus reflektierenden Flächen, aus Projektion, Schein und Widerschein, zu Facetten geronnenes, reflektiertes Lebensblut. Alles flackert, von Du und Wir und Es – wie soll man sich da auskennen? Was soll da gut sein können? Gut ist nicht schön. Wir können die Zwischenwelt nicht mit der Struktur der inneren Gestalt verwechseln oder nach deren Anordnung denken, sonst setzen wir die Kaskaden der Entfremdung in Gang, die den Einzelnen zersplittern, auflösen, vernichten. Es steht also vieles, alles auf dem Spiel, wenn wir unsere Welt nach Gesundheit, Bildung und Recht gestalten. Wir können die Arbeit hier nicht der kalten abstrakten Wahrheit von Prinzipien überlassen. Die starke Kraft des Menschenrechtes, der Menschenwürde, des Freiheitsgesetzes hat so noch niemanden wirklich gerettet.
Um etwas auszurichten, bleibt uns nur der Weg durch das Dickicht und die Niederungen der Menschlichkeit; die absurde Hoffnung auf unsere schwachen Kräfte. Sehen wir uns so die Anordnung des inneren Himmelszeltes als etwas Äußerliches an: Recht, Bildung und Gesundheit sind schwache und unklare normative Grundbegriffe. Sie sind unser ganzer Schatz. Sortieren wir sie einmal relativ nach ihrer politischen Bedeutung, so gewinnen wir ein Bild davon, womit wir es zu tun haben.
Am Ausgangspunkt steht die Bildung. Sie ist konzeptuell komplexer und politisch schwächer als Gesundheit und Recht. Sie zeigt eine ausgeprägte Spreizung zwischen dem höchsten Maß an differenzierender Achtsamkeit, das dem Individuum geschuldet ist, und der ideologisierten Standardisierung ihrer Organisation. Die konzeptuelle Komplexität entspricht dem Eigenrecht des Prozesscharakters von Bildung als Kultivierung. Die zur Unterstützung erforderliche Souveränität aufzugeben, behutsam zu hegen und zu pflegen, erlaubt nur äußerst schlanke Normierung und theoretische Fixierung. Je weiter der Raum, je offener die Welt, in der Bildung uns gestaltet, umso stärker die Anforderungen der Menschlichkeit, denen wir uns unterwerfen. Das Konzept der Bildung überlassen wir selbst seiner Kultivierung. Die Politik steht in der besonderen Bringschuld, alles zu ermöglichen und nichts vorzuschreiben. Der Erfolg politischer Zielsetzungen – besonders in einem Ausbildungssystem – hängt an dem Maß ihrer vorangehenden und begleitenden Wertschöpfung durch die Entfaltung undefinierter Bildung.
Gesundheit ist konzeptuell vergleichsweise klar. Weite Bereiche dieser Qualität können wir in ihrer Bedeutung zuverlässig verstehen, oft auch erklären. Zugleich aber ist sie politisch schwach. Die Verantwortlichkeiten sind nicht ausverhandelt zwischen Selbstverantwortung des Einzelnen, Ärzten, Verbänden und Entscheidern. Sie sind in ihrer institutionellen Form stark ökonomisch-interessengebunden organisiert und föderal administriert. Wie kein anderer Bereich hängt Gesundheit von einer entschlossenen politischen Agenda ab. Überlässt man sie einem kommerziellen Markt, programmiert man eine Gesellschaft, die sich vom Leben verabschiedet und in den Worten Erich Fromms »nekrophil« wird. Wir hängen hier besonders dramatisch an der Klippe des 19. Jahrhunderts als eine robuste politische Agenda die Umrisse des Möglichen erkennbar machte. Die politische Bringschuld besteht darin, alles stimmig salutogen anzuordnen und zu ermöglichen, was angeht.
Recht ist demgegenüber konzeptuell komplex, politisch gebunden und stark von seiner Pflege abhängig – nachgeordnet. Ersteres gilt nicht auf der Ebene der geistigen Grundlagen. Hier ist das Recht vollkommen klar und eindeutig: Im Äußeren das Richtige tun und erleiden dürfen, aus welchen Gründen und unter welchen Umständen auch immer. Sobald wir die Einheit von Recht und Ethik aber in Richtung der Gesellschaft aufheben, geht es nur noch um Gründe und Umstände. Die Gründe sind mit der Legitimität und Legitimation von Herrschaft verknüpft. Diese wiederum besteht nicht in einer isolierten Welt. Herrschaft stimmt nur insoweit, als dass sie Verantwortung und Partizipation in möglichst differenzierter Breite der Phänomenologie menschlicher Gesellschaft organisiert und abbildet. Die Politik muss das Rechtssystem unter völliger Absehung von Einzelinteressen hingebungsvoll pflegen und den gesamten Apparat intelligent einbeziehen. Und: Sie muss Anreize, Strukturen und Verfahren etablieren, in denen jeder Mitbürger sich als Mit-Gesetzgeber verstehen kann – die Antithese zur Attitüde des Obrigkeitsstaates. Jede Lüge, jede zynische Rabulistik, jede Inkonsequenz unterminiert das Vertrauen und die Vertrauenswürdigkeit des Ganzen. Nicht zuletzt kommt es hier darauf an, kontinuierlich zu prüfen, zu korrigieren und zu lernen, wie unser verfasstes normatives Selbstverständnis mit der Wirklichkeit auf einer Linie gehalten bzw. dorthin gebracht werden kann. Dieses Richtigstellen der Verhältnisse anhand verbürgter Selbstverpflichtungen, das Aufrichten der Begriffe, schafft ein gesellschaftliches Klima von Verbindlichkeit. Der Bedarf an Integritätsarbeit ist auf diesem Feld besonders groß, die Not durch diesen Mangel unerhört. Die konzeptuell-institutionelle Arbeit systemischen Lernens entspricht nur in Ansätzen der Würde und dem Anspruch unserer Verfassung. Hier wirkt sich die Unterordnung politischer Macht unter partikulare Interessen wirtschaftlicher oder organisatorischer Rationalität nicht weniger gravierend aus als andernorts das Primat religiöser oder ideologischer Prätention. Wir haben die Wahl, anhand unserer Leitbegriffe das System aufzurichten oder es weiter nach der Eigendynamik der Verhältnisse zu nivellieren.
Bildung, Gesundheit und Recht umschreiben die Sinneinheit des Menschlichen in gesellschaftlichen Zusammenhängen. Ihr Zusammenspiel bildet die materielle und kulturelle Grundlage jeder Wertschöpfung. Glück, Wohlstand und Sicherheit sind dem Sinn dieser Urzeugung des guten Lebens nachgeordnet. Im Folgenden werde ich deshalb immer wieder auf Themen und Beispiele aus diesem Feld eingehen, aus dem sich die Möglichkeit alles Anderem ergibt.
1.3 Bis an die Sterne weit
Was die Logik vom Inneren einer menschlichen sozialen Wertschöpfung weiß, gilt auch für die politische Ordnung. Wenn man sie als legitimierend verstehen soll, verlangt unser europäischer Demokratiebegriff, das Verhältnis des Einzelnen als Bürger zum Staat sowie der Gesellschaft zum Staat neu zu denken. Das ist keine revolutionäre Ansage. Es ist die Daueraufgabe einer lebendigen Demokratie, mit dem ein Legitimitätsanspruch selbstverständlich einhergeht. Bestehende Ansätze sind unter dem ebenso vornehmen wie zurückhaltenden Oberbegriff Verfassungspatriotismus zusammengefasst. Ihnen fehlt aber die konsequent integrative Perspektive, die den inneren Zusammenhang in seiner praktischen Vehemenz vorstellt. Auch wenn sie nicht im wünschenswerten Maße verbreitet ist, so ist diese Haltung doch einigermaßen wohlfeil. Es fehlt ihr der eng gewebte Resonanzrahmen der Übung, der Reibung und des Lernens des Politischen. Es fehlt an einem institutionellen Rahmen des Vertrauens und Forderns der menschlichen Qualität; die innere Haltung vermisst ihre wirklichen Ankerpunkte.
Erst in einer real erlebten Welt politischer Erfahrung, durch alltägliche Beteiligung an lebensweltlichen Entscheidungen gewinnt der Zusammenhalt der Gesellschaft politisch an Bedeutung. Damit verbunden entsteht die Chance, diskreditierte – aber sich immer noch im Umlauf befindende – Begriffe für das erlebt Gemeinsame in der abstrakten Gesellschaft zu nutzen: Volk, Volksgesundheit, Volkskörper können konstruktiv neu besetzt und kreativ von völkischer Aneignung befreit werden, anstatt sie mit verschämtem Fremdsprachschick zu verkleistern. Sie können ihre humanistisch dienende Konzeption geschärft und rehabilitiert zum Ausdruck bringen und uns darin an eben diesen Auftrag erinnern. (Interessanterweise haben wir mit Volkswirtschaft kein Problem.) Die integrative Perspektive wird erst erreicht, wenn in diesem Zuge auch der europäische bzw. ›westliche‹ Provinzialismus zunächst ganz verinnerlicht und dann überwunden und überformt werden kann. Nur weil wir unseren Kolonialismus mittlerweile kritisch sehen, kann er ja nicht weiter das Maß der Dinge bzw. der Welt sein. Ihn ehrlich als Lernende des Weltbürgertums anzunehmen, das wäre ein unverzichtbarer Zwischenschritt, um den wir uns über drei Generationen hinweg herumgemogelt haben. Das rächt sich nun durch explodierende Dringlichkeit.
Europas provinzielle Sprache und seine Weltordnung, die Art, in der wir die Proportionen und Relationen der Verhältnisse in der Welt vorsortieren und anordnen, unser geostrategisch, ökonomisch, ordnungspolitisch und ethisch gestricktes Provisorium steckt tief in den Imprimaturen unserer großen Geschichten von Orient und Okzident, die wir für die Welt selbst halten. Wir sollten sie nicht allzu wörtlich nehmen. Andere sind längst wieder dabei, sie kreativ und vital neu zu erzählen, sie zu überformen. Und der Osten und Süden Eurasiens bilden sich schnell zur Meisterschaft.
Was vor hundert Jahren als Drohung tönte, das stählerne Pathos des Stakkatos ›Fremd-Anders-Gefahr!‹, lösen wir aber nunmehr aus der Wolke der Angst vor unserer Courage heraus und gewinnen so ein Versprechen. Es ist möglich, wir können jetzt zusammen an der Zukunft arbeiten, in abgestimmter Ko-Autorschaft für die Geschichte einer menschlichen Welt. Das kann nur gelingen, wenn wir konsequent den roten Faden der Integrität weben, selbst integer und aufmerksam sind; in alle Richtungen und ohne Furcht. Ob es gelingen wird, kann uns dabei nicht interessieren. Ob es gelingen kann, hängt von uns ab. Unser Luther hatte dafür den klassisch besonnenen Melanchthon. Wir dürfen uns mit der Welt befreunden.
1.4 Etikette
Dabei dürften wir uns dem anvertrauen, was wir eigentlich sehr gut wissen. Einer unserer Heerführer verlangte vor einer Generation, es müsse ›ein Ruck‹ durch die Gesellschaft gehen, um Schritt zu halten und den Takt wiederzufinden, indem wir uns menschlich weiterentwickeln. Nun ist dies leider ganz missverstanden worden. Man erwartete offenbar einen großen starken Ruck, der dies bewerkstelligen würde. Die hierfür geeigneten Positionen waren jedoch dauerhaft von solidem Sitzfleisch eingenommen. Das Missverständnis liegt aber tiefer: Wert, Wucht und Richtung des ›Rucks‹ ergibt sich aus der Vielzahl der kleinen Schritte, die ihn bei Bodenkontakt auslösen. Es sind die kleinsten Entscheidungen, die jeder Mensch für sich selbst trifft, die den gemeinten Ruck ermöglichen; nicht das Spektakuläre der Schale der Macht. Es erscheint als bittere Ironie, dass es viel leichter ist, sich aus dem Schützengraben oder aus Trümmern eines zerstörten Hauses aufzuraffen, als wenn man übersatt unter dem Weihnachtsbaum sitzt. Für den Wohlstandsbürger muss die Verstörung geistig durchdrungen werden, damit Handeln entspringt. Nur hat er keinen Begriff von Ehre, Pflicht und Tat.
In dieser Bewegung der Gedanken verlassen wir nun für eine Weile die groben Züge der europäischen, deutschen Weltbeschreibung. Wir reichen einer Kultur die Hand, die auf das Subtile setzt, auf die Tätigkeit des Webens in kleineren Windungen, eine Arbeit im Gestus bescheidener Achtsamkeit. Man kann viel Schlechtes, aber eben auch viel Gutes von China lernen.
Zwischenspiel
Sortieren wir die Grundaufstellung. Geht es im Leben, Arbeiten, Lernen um die Perspektive, gut erfolgreich oder erfolgreich gut zu sein? Das ist der Fluchtpunkt unserer Leitlinie, auf der wir alles verstehen wollen: Wie kann man das Richtige aus den richtigen Gründen tun? Wir entscheiden uns, das Richtige als Nutzen, nicht Nutzen als das Richtige oder Erfolg zu behandeln und uns entsprechend zu bestimmen. Das Richtige meint hier, woran wir uns in der Wendung zum Guten hin ausrichten – bspw. an Gerechtigkeit und Menschlichkeit.
Es gibt dann richtigen oder falschen Nutzen, aber keine sinnvolle Aussage, was denn das ›nützliche Richtige‹ sein soll. Bestenfalls ist das tautologisch, denn das Richtige umschreibt nicht nur den Raum des Nützlichen, es verleiht zugleich jedem Nützlichen darin einen Mehrwert, nämlich den, auch im Richtigen zu sein. Der Zweck begrenzt sich selbst dadurch, dass er sich nur Mittel erlaubt, die ihm selbst entsprechen: Zu Unrecht Gutes gedeiht nicht! Diese Unterscheidung ist einerseits eine hierarchische und teleologische, denn sie legt die Entwicklung zum Besseren an. Für Akteure – ob Individuen oder Institutionen – drückt sich darin eine Zusammenführung zu einem Subjekt mit Verantwortung aus. Diese Aufstellung eröffnet die Hoffnung auf eine praktische Einheit, das Erleben, Erfahren und Wissen, dass ich durch mein nützliches Handeln etwas Gutes tun kann, weil ich stimmig auf das Richtige aus bin. Das bedeutet keine detaillierte Vorschrift, sondern mobilisiert und orientiert unsere Achtsamkeit, so dass wir aus eigenem Urteil zurechenbar handeln, nicht nur gemäß einer Standardnorm von Pflicht. Die Affinität gewinnt dann im Handelnden die Qualität innerer Einheit eines Wollens, das sich nicht nur instrumentell versteht.
Auf der pragmatischen Seite dieser Einstellung gewinnen wir Nachhaltigkeit und einen sukzessiven Zugewinn praktischer Klugheit, weil unser Handeln sich selbst in einem Lernprozess erfährt. Das Gelingen bedeutet in diesem Sinne: Gut erfolgreich zu sein im Beruf, in der Karriere oder der Wissenschaft, als Arzt oder Entscheidungsträger. Mein Beitrag zu diesem Gelingen soll eingebunden sein in die Entwicklung, erfolgreich gut zu werden.
Wie wir gehen
2 Eingang
Leben ist Bewegung. Innere Bewegung des Erlebens und seiner Wahrnehmung; äußeres Verknüpfen durch Zeit und Raum; geistige Ausdehnung von gebundenem Sinn und Existenz; materielle Umformung der Gestalt im Zusammenspiel ihrer Elemente; der Strom all dieser bewegten Lebensfacetten zum Leben selbst. Gegeben und Gemacht im Geben und Machen, an sich, für uns.
Meine konkrete Integrität ist der Lebensraum, den ich durch Bewegung beherrsche. Mein integrierter Lebensraum ist mein Leib, die Ausdehnung meiner geistigen Selbstwahrnehmung. Bin ich gesund und gebildet, kann ich denken, dass Gerechtigkeit in der Welt ist.
Leben ist Bewegung, die sich selbst organisiert. Der Integritätsplan nutzt die Bandbreite des Lebensraums, den ich schon und noch beherrsche, um mich darüber hinaus zu entwickeln und bei mir zu bleiben, zu wachsen. Er vergegenwärtigt im Noch das Schon und organisiert so das Werden der nächsten Etappe meines Weges. Das Neue ist stimmig veränderte Anordnung. Dass es, durch mich, gemacht und gemeint ist, zeugt Größe, Parthenogenese: der Moment des Triumphes der Freiheit, des Geistes als Erfinder der Qualität des Menschlichen. Aber erst durch die Demut, in der Verneigung vor dem Gegebenen, durch die rückhaltlose Liebe zur Mutter Materie bleiben wir eins und können weiter wachsen.
Diese Ausrichtung ist die Qualität der Integrität. Sie bestimmt den Sinn, die Wucht und die Richtung meines Weges.
Dieser Übergang ist der Arbeitsplatz der Integrität. Kein Labor, keine Fabrik und kein Schlachtfeld – ein Spielraum. Die Arbeit dieses Webens ist ein Spiel, das uns im Vollzug seine Regeln mitteilt. Wir finden sie vor, nehmen sie auf und mustern durch sie das Geschaffene. Alles wird anders: Kultur.
2.1 Mustern
Der Integritätsplan schlägt uns eine Methode zur Klärung und Verbesserung der Praxis dieses Spiels vor.
Welcher Praxis? Jedweder!
Praxis ist Handlung. Sie enthält im Kern das Innen, Außen und Dazwischen, mit dem wir umgehen, die ganze Welt. Praxis ist eingebettet, in das Netzwerk allen Handelns. Das unterscheidet sie vom Verhalten, das beschreibt, wie wir uns in den Absichten außen spiegeln. Praxis wirkt durch unsere Haltung beim Verfolgen unserer Ziele, nicht durch den Klang von deren Namen. Sie ist das Spiel des Lebens.
Ein Widerspruch? Die Einheit von Regel und Spiel ist uns nicht fremd. Im Spielraum sind wir frei. Die gebundene Freiheit ist unser Glück, das Seil, auf dem wir balancieren, zwischen trostloser Angst vor dem Nichtigen und dem irrlichternden Höhenflug eines Ikarus. Unser Plan hängt in der Luft.
Dies hat seinen eigenen Wert. Wir messen Qualität konventionell: Entweder von der Einstellung bzw. der Motivation oder von den Ergebnissen oder auch von den Konsequenzen her angesehen. Tugend wird gemessen an der Performanz, am Zwielicht von Schein oder Anschein der Einsinnigkeit von Gründen und Zweck. Das sind Momentaufnahmen. Das Leben gerinnt und zerfällt in Sequenzen, Facetten, Splitter. »Fehlt, leider! nur das geistige Band«.
Integrität als Qualität ergibt sich vom Prozess her als lebendiges, aus sich herauswachsendes, offenes Ganzes. Ihre Maximen verstehen sich als Arbeiten, als Werke: Sie werden. Zwischen Erleben und Erfahren und Nachdenken sind sie nie fertig. Die Maxime des Guten ist eben nicht Gut Sein, sondern: Ich will besser werden. Ihre lebendige Qualität strömt nicht mit ihrem Namen, denn nur der Gott der Genesis kann so etwas. Diese Geschichte erweckt in uns den Abglanz des Erkennens im anderen; das Du im Ich. Damit ich arbeiten, aufblicken und mich oder dich fragen kann: War das so gemeint?
Nüchterner klingt die Aufklärung, als Arbeit, im Osten, wo Namen durch Handeln richtig gestellt werden. Keine Ausrede, wir wissen alle, was es gilt! Handelt entsprechend. Immer weiter. (Grund- oder Vor-)Sätze, Urteile, auch Tugend, werden an der ›inneren Performanz‹ gemessen: An der Art und Weise, mich meiner Kompetenzen zu bedienen, meine Balance zu halten, meine Würde zu würdigen. Das ist der Witz des Spielraums als Keimzelle unseres Wachsens: Wir können ihn ebenso missachten wie missbrauchen. Wollen können wir das aber nicht: verzweifeln oder verbrennen.
2.2 Verstört
Dann kommen da diese anderen Leben, diese Geschichten; verdichtetes Erleben, Erfahrung, in Weltwebstücken, von hier und da – einst und jetzt. Eine Zumutung, eine Herausforderung, Chance, Aufgabe: Wie passt das, wie geht es zusammen? Gehen wir weiter, dann kommen die Leitfragen, die Horizonte verschmelzen: Welche Optionen finden wir, das Wozu und das Wie anzusprechen?
In welcher Sprache kann man so etwas überhaupt denken, sagen? Irgendwie sicher in jeder. Aber treffend und bestimmt? Im Deutschen wohl eher in philosophischer Dichtung, durch Räume der Konnotation, durch Interpretation guten Willens ausgefüllt. So bleibt die Bedeutung Aufgabe, erstarrt aber nicht in der Form.
Auch hier dürfen wir uns etwas entspannen: bestimmt(er) und treffend(er) – nicht weiter als für den Moment und so, über die Zeit, in beharrlicher Arbeit daran. Selbstverständlich ist das unbefriedigend. Ärgerliches Provisorium unserer Großspurigkeit. Und doch, Anlass neugierig zu sein, offen für Wege der Sprache, die über rituell eingefahrene und erschöpfte philosophische Prosa hinausgeht.
Es ist gerade die Disziplin unserer Sprache, durch die sie sich zur Bildung des Ausdrucks inspirieren lassen kann. Was macht das Englische anders, was das Chinesische? Ihr Charakter ist jeweils Ausdruck einer vorentscheidenden Orientierung, an Phrasierungen von Struktur, von Bewegung, von Qualität. Verbale, adjektivische, substantivische Akzente erzeugen in ungeschickter Anordnung Missklang. Wie stimmen sie aber zusammen, eröffnen neue Räume für Resonanz und Harmonie. Können wir sie erschließen? Ein Gespräch führen, in dem wir uns auf die gemeinsamen Themen einigen, einander zu verschmelzenden Horizonten verhelfen, neue, weitere Weltspiele daraus erschaffen? Kann ein solches Wachstum in genuiner Zusammenarbeit überhaupt gelingen? Wie könnte das Ergebnis aussehen – Erfolg von Verstehen, aus der jeweiligen Aufstellung oder Ausprägung einer neuen integrativen Kulturform?
Die Ausgangsbedingungen sind dabei nicht freundlich aufgeschlossen, sondern voreingenommen. Das betrifft zum Beispiel strukturelle Diskriminierung: Im Ad-jektiv klingt die Bedeutung des bloßen Anhaftens pejorativ mit, gerade das Gegenteil vom Kern des Qualitätsgedankens im Eigen-schaftswort. Im Englischen ist dies ähnlich ambivalent: property, zwischen eigen, angemessen und funktional-übergriffig. Hier mag sich eine der gemeinsamen lateinisch-griechischen Wurzel geschuldete Musterung unseres Begriffsvermögens ausdrücken, die das Chinesische, womöglich für uns ins Konstruktive rücken kann. Ergänzend mag der meta-strukturierende Konzeptapparat der lateinischen Sprachen dazu beitragen, das Selbstverständnis und die Ausdruckskraft des Chinesischen stärkend einzufärben.
Es besteht jedenfalls enormer Klärungsbedarf und Raum für gemeinsames Handeln, der – die Globalisierung begleitend – gerade erst auf der Tagesordnung sichtbar wird. Erheben wir die Blicke aus der Enge der Manufakturbetriebe. Sehen wir auf die neue Arbeit des Denkens, der Sprache, der Begriffe unserer unerhörten Welt.
Dieser Integritätsplan hat ein Mantra, eine Formel, die sich nach Belieben variieren, an jeden denkbaren Adressaten richten und fortgesetzt neu zum Ausdruck bringen lässt:
»Sagen, was ich tue – tun, was ich sage;
tun, was ich denke – denken, was ich tue;
um das Richtige aus den richtigen Gründen zu tun!«
Verstehen wir dies als Aufstellung und Ausrichtung der Arbeit, nicht als Beschreibung einer Verfassung oder eines Status. Der unendlich verwobene rote Faden ist das Lebensblut des Weges. Fließt es in seiner Bahn, wird es zur Quelle jeden Wertes.
Zwischenspiel
Warum denn die richtigen Gründe





























