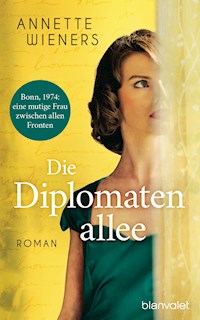7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Ein Roman über eine große Liebe und ein lebendiges Stück deutscher Zeitgeschichte
Köln, 1937. Die siebzehnjährige Maria Reimer bewirbt sich heimlich als Fotomodell. Sie ahnt nicht, welche Pläne der Chef des Foto-Ateliers mit ihr hat: Sie soll das neue Gesicht der Nazi-Propaganda werden. Der jüdische Fotograf Noah will Maria noch warnen, aber sie missversteht sein Verhalten – und verliebt sich in ihn.
Jahrzehnte später findet Marias Enkelin Sabine ein Vermögen im alten Haus der Familie. Es ist Geld und Gold, das der Großvater versteckt hat. Aber woher stammt der Reichtum? Was ist Ende der 1930er Jahre wirklich geschehen, als Maria unter dem Künstlernamen Mary Mer vor der Kamera stand?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 515
Ähnliche
Buch
Als Sabine Schubert nach dem Tod des Großvaters ihrer Großmutter Maria hilft, das Haus aufzuräumen, kommen unter dem großen, schweren Teppich im Wohnzimmer alte Geldscheine zum Vorschein. Im Keller finden die Frauen Gold und begreifen, dass der Großvater vor langer Zeit ein Vermögen versteckt haben muss. Nur warum? Maria beschleicht eine Ahnung, und sie gerät völlig außer sich. Sabine wird klar, dass in der Familiengeschichte erschreckende Lücken aufklaffen. Hat der Großvater in der angesehenen Kölner Metallgussfirma wirklich nur Spielzeug hergestellt? Auch die Großmutter scheint aus ihrer Zeit als berühmtes Fotomodell einiges zu verschweigen. Damals, Ende der 1930er-Jahre, hieß sie Mary Mer und lernte den jüdischen Fotografen Noah kennen, den sie bis zum heutigen Tag nicht vergessen hat …
Autorin
Annette Wieners wurde in Paderborn geboren und schreibt bereits Geschichten, seit sie einen Stift halten kann. Nach dem Studium der Publizistik, Germanistik und Ethnologie in Münster arbeitete sie als Journalistin bei Fernseh- und Radiosendern in München und Hannover. In den 1990ern zog sie nach Köln, wo sie auch heute lebt, schreibt und im Radio zu hören ist. »Das Mädchen aus der Severinstraße« ist ihr erster Roman bei Blanvalet.
Weitere Informationen unter: www.annette-wieners.de
Spannende Hintergründe zu »Das Mädchen aus der Severinstraße« im Podcast:www.annette-wieners.de/derpodcast/
Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlag und www.facebook.com/blanvalet
ANNETTE WIENERS
Das Mädchen aus der Severinstraße
ROMAN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Dieses Buch ist auch als E-Book erhältlich.
Copyright © 2019 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Angela Kuepper
Copyright der Fotos im Anhang: © Annette Wieners
Covergestaltung: © Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com (Gromovataya; Taras Atamaniv; Tupungato)
AF · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-23182-8V004
www.blanvalet.de
In Erinnerung an meine Großmutter Maria Reymer
»Beim Umschalten keine Gewalt anwenden. Die wesentliche Eigenschaft des Fahrzeugs ist seine unregelmäßige, nicht voraussehbare, selbständige Kurvensteuerung.«
Aus: Gebrauchsanweisung für Kölner Automodelle aus der Nachkriegszeit
Teil I Kontrapost
1
Sie war nicht zum ersten Mal heimlich unterwegs, den Mantelkragen hochgeschlagen, den Hut tief über die hellen Haare gezogen. Aber heute saß sie in der Reichsbahn und verließ sogar Köln. Gleich nach dem Frühstück, kaum dass der Vater die Armbanduhr aufgezogen und die Stufen zum Kontor betreten hatte, war sie zum Bahnhof gelaufen. Nicht ohne nachzudenken: Sie war mit den polierten Schuhen über jede Pfütze gesprungen und hatte das Billett fest in der Hand gehalten. Aber erst als sie im Abteil saß und der Schaffner sie ansprach, konnte sie hochsehen. Sie reichte ihm den Fahrschein, er war feucht und weich.
Bestimmt würde der Vater denken, sie sei spazieren gegangen, aber später würde er sich Sorgen machen. Maria Reimer, schlank und groß wie Sankt Petrus Canisius, zog die Aufmerksamkeit auf sich, wie er fand, und Aufmerksamkeit war heikel, war unwägbar und gefährlich, vor allem, seitdem die Wehrmacht in Köln eingerückt war.
»Rede nicht mit ihnen, auch wenn sie dich dazu auffordern«, sagte der Vater neuerdings, und wenn sie dann fragte: »Warum denn nicht? Wir haben nichts zu verbergen«, erwiderte er, der langweilige, der wohl Deutscheste unter den Deutschen: »Trotzdem.«
Als ob sie so dumm wäre. Und als ob sie überhaupt auf die Idee käme, mit Soldaten zu reden, die sich von der gesamten Stadt feiern ließen, ohne dass klar wurde, wofür.
Nein. Sie, Maria, siebzehn Jahre alt, wusste selbst, was gut für sie war.
Abends zum Beispiel, wenn der Vater zu seinem Debattierclub aufbrach, blieb sie nicht auf der Chaiselongue liegen, sondern schlich aus der Wohnung, die Gassen hinunter zum Rhein. Solange das Tageslicht ausreichte, konnte sie den Frauen, die am Ufer flanierten, ins Gesicht sehen. Das Rouge wurde seit Neuestem bis dicht unter die Augen gezogen, und die Brauen zupfte man sich vollständig aus, um sie mit einem Stift in einer feinen Linie nachzuzeichnen. Hohe, aufgemalte Bögen, darauf musste man erst einmal kommen!
Außerdem hatte sie viele Stunden damit zugebracht, das richtige Gehen zu lernen. Sie hatte an der Ecke gestanden und beobachtet. Die eine Frau wirkte elegant, wenn sie den Steg der Rheindampfer betrat, die andere schwankte wie ein Gaul. Wie kam das? Wie konnte Maria es selbst erreichen, besser zu gehen? Sie hatte einiges ausprobiert, und der Vater wusste gar nicht, wie bedeutend das war. Anstrengend auch und ernsthaft, und auf jeden Fall wichtig für die Zukunft, mit der Maria ihn noch überraschen würde, egal ob er versuchte, sie abzuschotten.
Im Grunde tat der Vater genau das, was er der Schuldirektorin vorgeworfen hatte. Er nutzte seine Macht aus, wollte über Maria bestimmen und am liebsten noch ihre Gedanken dirigieren. Dabei hatte er ihr persönlich beigebracht, sich solchen Versuchen zu widersetzen.
Die Schuldirektorin hatte neue Lehrpläne bekommen, von ganz oben, und dass die Mädchen plötzlich kochen und bügeln sollten, war schlicht idiotisch gewesen. Maria wuchs ohne Mutter auf, bei ihr zu Hause war die Haushaltsführung ein Beruf, den die kluge, freundliche Dorothea ausübte, weil sie nämlich Geld dafür bekam. Zum Glück hatte sich der Vater in diesem Punkt gegen die Schule und auf Marias Seite gestellt: »Du musst den Unterricht nicht länger besuchen als nötig.« Aber seither legte er die Hände in den Schoß. Er hatte keine Pläne mehr für Maria und erlaubte ihr auch nicht, selbst etwas zu planen. Seit Monaten, ja, seit dem Ende der Schulzeit, fand der Vater es ausreichend, wenn sie unbeschadet durch den Tag kam. Als ob das Nichtstun auf Dauer nicht ebenfalls Schaden anrichten könnte!
Der Eisenbahnwaggon ratterte über die Schienen, die Sitze vibrierten, die Türen klapperten erbärmlich. Der Herbst zog durch die Ritzen, das Fenster war nass. In Schleiern wehte Nieselregen über die Felder nördlich von Köln. Hecken und Bäume schwammen vorbei. Für einen Moment schien ein Bussard die Reichsbahn verfolgen zu wollen, er segelte mit, dann stürzte er herab.
Maria schob den Hut nach hinten und überprüfte den Scheitel. Er war noch glatt. Erst unterhalb der Ohren setzten die Wellen ein, wie gewünscht, und sie fielen ihr fast bis auf die Schultern.
Hoffentlich war es richtig gewesen, den halb langen Pageboy zu wählen. Bisher war die Frisur noch nicht allzu weit verbreitet, aber sie hatte darüber nachgedacht, welche Ansprüche das Atelier wohl stellen würde, gerade an eine junge Bewerberin. Man würde doch wahrscheinlich einen Hang zum Fortschritt verlangen? Eine Geste nach Übersee, auf die Leinwand vielleicht, warum nicht hin zu Ginger Rogers?
Andererseits würde es Geschmacksgrenzen geben, und vielleicht würde Maria unterstellt werden, es mit dem Pageboy zu übertreiben. Und dann würde man sie auslachen, anstatt ihre Fähigkeiten zu begutachten.
Vorsichtig stülpte sie den Hut wieder auf den Kopf. Mit einem Mal beklommen.
Schräg gegenüber saß ein dicker Mann mit Glatze. Er war eingeschlafen und drohte zur Seite zu kippen. Seine Frau knetete die hageren Finger und musterte die Mitreisenden aus dem Augenwinkel. Blasse Lippen, hochgezogene Schultern. Vielleicht war sie eine Jüdin? Ja, sie hatte wohl Angst, Maria kannte den Blick und hätte gern genickt oder gelächelt, um die Frau zu beruhigen, aber das stand ihr nicht zu.
Allerdings wollte Maria auch nicht falsch eingeschätzt werden. Es dachte doch hoffentlich niemand, dass sie auf dem Weg in die Große Reichsausstellung war? Schaffendes Volk? Sie würde zwar in Düsseldorf aussteigen, wie wohl die meisten, aber für die Leistungsschau hatte sie nichts übrig.
Die ängstliche Frau atmete durch den Mund. Ihr Kinn zitterte, vielleicht hatte sie Hunger, und Maria musste schon wieder an den Vater denken, der jeden Morgen ein Brot einpackte, angeblich für seine Frühstückspause, aber in Wahrheit war es für den kleinen Elias gedacht. Der Vater legte das Brot draußen im Hof auf die Fensterbank, damit der Junge es holen konnte, und Maria musste strikt so tun, als wüsste sie darüber nicht Bescheid.
Sie rutschte auf der Sitzbank ein winziges Stück nach vorn. Die Frau gegenüber hob sofort die Hände, als hätte sie sich erschrocken. Maria wurde rot. Wie verkehrt alles lief! Und dann war auch noch der Schaffner in der Nähe. Maria konnte sich der Frau nicht einmal erklären, dabei spielte für sie alles andere eine Rolle, nur nicht der rassische Gedanke!
Verlegen stand sie auf, wünschte »Eine angenehme Fahrt noch«, dann stellte sie sich in den Gang. Es war ohnehin besser zu stehen, damit das Kleid unter dem Mantel weniger knitterte.
Hinter dem Nieselregen lagen die Rheinwiesen mit den alten Weiden. Der Zug bog in eine Kurve, sie mussten auf der Höhe von Zons sein, jetzt war es nicht mehr weit. Leicht schwankend tastete Maria in der Handtasche nach dem Rouge und dem Nötigen für die Frisur. Sie wollte sich vor dem Termin noch einmal herrichten, aber am besten erst später, kurz bevor sie in der Weißen Villa, dem Fotoatelier, angekommen wäre.
Auch die Zeitungsanzeige, die sie neulich ausgeschnitten hatte, steckte in der Handtasche:
Sind Sie eine frische Frau mit Mut?
Haben Sie Interesse an deutscher Mode?
In winziger Schrift stand Atelier Bertrand unter den Zeilen. Sicher ein französischer Name, wie sollte es im Modefach anders sein, und allein ihn zu lesen ließ Marias Herz schneller schlagen: Das Atelier Bertrand fotografierte für Die Dame!
Sie straffte die Schultern, meinte dabei erneut, die Blicke der Frau hinter sich zu spüren, und zupfte am Hut. Vergeblich, natürlich, der blonde Pageboy ließ sich nicht gänzlich verstecken, aber – warum denn eigentlich auch? Warum schämte Maria sich, warum bedauerte sie die Umstände und machte sich dadurch mit allem gemein, anstatt sich einmal zu zeigen?
Kurz entschlossen nahm sie die Packung Salzletten, die sie als Verpflegung für den heutigen Tag eingesteckt hatte, und überreichte sie der Frau. »Für unterwegs!« Es durfte jeder sehen und hören.
Der dicke Mann wachte auf. Die Frau schüttelte entgeistert den Kopf, aber jetzt gab es keinen Weg zurück. Maria stand da, den Arm gestreckt wie aus Kruppstahl, und brachte unter den Blicken der Leute keine weitere Silbe hervor. Bis die Frau ihr endlich, ganz langsam, die Salzletten abnahm und »Danke« flüsterte. Maria erwiderte: »Bitte«, und floh in ein anderes Abteil.
War es denn ihre Schuld?
Sie nahm ein Taschentuch und rieb über die Schuhe, damit sie wieder so glänzten wie am Morgen. Dann bremste der Zug und fuhr in Düsseldorf ein. Endlich.
Der Bahnhof war voll, Maria musste drängeln, und kaum dass sie nach draußen trat, wehte ihr Regen ins Gesicht. Sie blieb im Schutz der Backsteinfassade stehen, um den Uhrenturm zu suchen. Düster und triefend ragte er auf, die Zeiger glänzten. Was? So spät war es schon?
Den Mantelkragen noch höher gestellt, sodass er an den Hut stieß, lief sie los, auf den Ballen, um die Absätze zu schonen. Der Wilhelmplatz stand unter Wasser, aber bis zur Königsallee war es zum Glück nicht weit, und immer wieder gab es auch trockene Passagen, wo Markisen oder Balkone über das Trottoir ragten.
Allerdings waren die Kreuzungen überfüllt, und Maria musste mehrmals warten. Längs und quer liefen die Menschen, manche sprachen Italienisch, Französisch oder Englisch, und auch viele Automobile, die vorbeiröhrten, schienen aus dem Ausland angereist zu sein. Schaffendes Volk. Überall hingen Plakate.
Kurz vor dem Schlageter Platz stritt sich ein Paar in einer unbekannten Sprache. Der Mann schimpfte und fuchtelte mit den Armen. Maria wich ihm aus, und ganz unerwartet wurde ihr dabei leicht zumute. Jeder suchte sich eine eigene Art, durchs Leben zu kommen, also war vielleicht alles gar nicht so schlimm? Erst recht konnte es nicht schlimm sein, wenn man wie sie selbst nur stille Pläne verfolgte und nicht schimpfte und nichts brauchte.
Maria brauchte lediglich Verstand und Begabung. Gutes Licht und etwas Chemie. Und sie brauchte jemanden, der im richtigen Moment auf den Auslöser drückte.
2
Sabine öffnete das Fenster. Der Laserdrucker hinter dem Schreibtisch roch intensiv, und es war beschämend, dass sich in der gesamten Stadtverwaltung kein Ansprechpartner dafür fand.
Sie hatte auf einem siebenseitigen Formular den Sachstand beschrieben. Papierstau, wiederholtes Heißlaufen. Nur leider hatte sie die Netzwerknummer nicht eingetragen, und der IT-Service hatte das Formular so ungeschickt zurückverwiesen, dass es bei ihrem Chef gelandet war und jetzt wieder in Sabines eigener Vorgangsmappe lag. Obenauf ein großes Fragezeichen.
LP 270309, Herrgott noch mal. Und warum war es im Büro schon wieder so dunkel?
Sie drückte den Schalter für die Jalousie. Die Herbstmorgensonne schien schräg auf die Dächer von Köln, und ein Sensor regelte den Schattenwurf der Lamellen. Dabei war es viel besser, nach draußen zu schauen. Die vergangene Nacht war vorbei, war tatsächlich vorübergegangen, trotz der grässlichen Durchhänger, und Sabine sollte sich klarmachen, dass die Welt immer noch dieselbe war.
Jeder Dachziegel lag an Ort und Stelle. Jeder Stein war auf dem anderen geblieben. Drüben an der Dillenburger Straße zog sich grauschwarze Teerpappe über die Industriebrache, in endlosen Bahnen. Pfützen glitzerten wie frische Versprechen. Gegen Mittag würden sie verdunstet sein.
Nur Sabine fühlte sich gefangen und ernsthaft krank. Verheult auf der Arbeit zu erscheinen war schlimm genug, aber dazu kam noch die Sorge, es würde womöglich nie wieder besser. Weil diesmal der Wendepunkt, ab dem ihr alles egal war, sehr lange auf sich warten ließ. Wie viel Mut und Geduld musste sie denn noch aufbringen? Die fünf Phasen der Trennung reduzierten sich bei ihr bekanntlich auf drei.
Es klopfte. Sie drehte die Lamellen wieder steiler und verschränkte die Arme. »Herein!«
Sofort flog die Tür auf, und das halbe Jugendamt drängte ins Büro. »Happy birthday!«
Woher wussten die davon? Kollegen, die Sabine noch nie gesehen hatte, sangen ihr ins Gesicht. Zwei, drei von ihnen kannte sie bloß von den Planungskonferenzen, trotzdem drückten sie ihr die Hand, als wäre es eine Freude, Geburtstag zu haben, und als wären sie alle ganz wild darauf, Sabine dabei zu erleben.
»Ihr seid ja verrückt«, sagte sie und dachte daran, wie sie aussah, rotäugig und aufgedunsen. Gleich kämen die ironischen Sprüche, und es würde ihr heute schwerfallen, witzig zu reagieren.
»Hätte ich gewusst, wie im Jugendamt gefeiert wird …!«, rief sie in den Lärm.
Die Sekretärin stellte einen Präsentkorb auf den Schreibtisch, lila Schleife und viel Zellophan. »Wir hoffen, du magst das. Cognacbohnen, Wurst und Sekt.«
Augenblicklich schwankte der Boden unter Sabines Füßen. Der Präsentkorb stammte aus dem Geschenkekiosk unten im Haus, und jeder wusste, wie man ihn nannte. Deep Throat, stopf dir den Hals. Auf der alten Arbeitsstelle im Bürgerbüro hatte Sabine ihn fünfmal reingewürgt bekommen, begleitet von Obszönitäten. Warum hatte sie erwartet, in der neuen Abteilung etwas anderes zu erleben?
»Sabine?«
Das Gelächter wurde leiser. Sie hielt sich an der Tischkante fest. Sie verstand nicht.
Die Sekretärin, Friederike, legte ihr eine Hand auf den Rücken. »Hey, du musst vor Begeisterung nicht gleich zusammenbrechen.«
War das Spott? Nein, es klang nicht so, es war vom Ton her eher stumpf und warm und trieb Sabine die Tränen in die Augen. Alles war noch schräger als gewohnt!
Sie löste das Zellophan. War verwirrt. Der Korb roch nach Salami, und noch immer machte niemand eine blöde Bemerkung, stattdessen blieb Friederikes Hand auf Sabines Rücken liegen. Sie riss sich zusammen. Ließ den Korken schlaff aus der Flasche gleiten, goss den Schampus mit umso mehr Schwung in die Gläser und stieß mit Friederike an. Dann stellte sie sich den zwei, drei eher unbekannten Kollegen noch einmal ausdrücklich vor und verfolgte besorgt, wie der Chef näher kam, Stefan Kramer.
»Gratulation, Frau Schubert, ganz besonders von mir. Wobei ich den Termin fast verpasst hätte, wenn ich nicht zufällig Ihre Akte gelesen hätte.«
»Danke, ich freue mich, dass alle so nett sind. Aber warum lag meine Akte auf Ihrem Tisch?«
»Keine Sorge. Ich habe mir bloß noch einmal Ihre Qualifikation angesehen.«
»Ist denn alles in Ordnung? Als ich die Stelle gewechselt habe, hieß es …«
Der Chef lächelte. »Es tut Ihnen gut, im Team zu arbeiten, das merke ich. Allerdings würde ich Ihnen auch gern einen eigenen Klienten anvertrauen. Zum Beispiel den Jungen, über den wir neulich in der großen Runde gesprochen haben. Pascal, neun Jahre.«
»Ja! Natürlich, sehr gerne.«
»Wir reden morgen darüber. Heute machen Sie früher Feierabend.«
Sabine konnte ihr Glück kaum fassen. »Ich könnte auch schon die Akte einsehen …«
»Nein.« Der Chef schüttelte ihr die Hand. »Bei uns ist es üblich, an Geburtstagen kürzerzutreten. An allen anderen Tagen werden Sie sich danach zurücksehnen.«
Fast eilig verschwand er durch die Tür, und als hätte er damit einen Stöpsel gezogen, leerte sich nach und nach das Büro. Nur Friederike blieb zurück und half, die Gläser in die Teeküche zu bringen.
Sabine schwitzte. Erst der Schlafmangel, dann das Wechselbad der Gefühle. Geburtstag, ein erster Klient. Und das Geräusch war weg, dieses Säbelrasseln. Ja, wirklich? Die Feindseligkeit, der Spott?
Als Friederike die Gläser in den Schrank räumte, fragte Sabine doch noch einmal nach dem Präsentkorb, nur vorsichtshalber: »Wer ist eigentlich auf die Idee gekommen, mich so heftig zu testen?«
»Inwiefern testen?«
»Deep Throat. Drüben im Bürgerbüro war ich auf den Korb abonniert.«
»Wie bitte?« Friederike ließ das Trockentuch sinken. »Deep Throat? Ich dachte, ich wüsste, was drüben mit dir abgegangen ist. Aber das toppt ja wohl alles!«
»Versteh mich nicht falsch …«
»So was musst du bekannt machen! Himmel noch mal, du Arme, und wir haben es nur gut gemeint.«
Es traf immer die Falschen, und was zu schnell wuchs, stürzte auch schnell wieder ein. Wie gern hätte Sabine ihre Frage nach dem Korb zurückgenommen.
Die Sonne leckte an der Fensterscheibe, irgendwo im Flur schlug die Tür zum Treppenhaus, nach draußen, ins Freie. Friederike aber nahm Sabines Hand und drückte sie tröstend, und das war das Unglaublichste von allem.
Sie aßen die Cognacbohnen aus dem Korb, »um dem Präsent den schlechten Ruf zu nehmen«, und lästerten über das Bürgerbüro. Erleichtert hörte Sabine, dass das Klima dort verschrien war, ganz unabhängig von ihr.
Als sie jedoch später wieder an ihrem Schreibtisch saß, setzten stechende Kopfschmerzen ein. Sie fand noch eine Tablette in ihrer Tasche.
Was bedeutete es eigentlich, dass man an seinem Geburtstag kürzertreten sollte? Ab wie viel Uhr galt die Regel – oder sollte sie die Zeit selbst bestimmen?
Sie sah im Computer nach, wie hoch die Zahl der ungelesenen E-Mails war. Dreiundfünfzig, das hielt sich im Rahmen. Ganz oben standen die Bitten um Rückruf beim Schulpsychologischen Dienst. Direkt dahinter eine interne Mitteilung: Der Chef hatte dem Team geschrieben, dass ab sofort sie, Sabine Schubert, für Pascal, neun Jahre, zuständig war. Und Sabine hatte sogar schon den Zugangscode für die Akte bekommen.
Sollte sie also? Jetzt?
So vieles könnte zurückkehren. All die guten Absichten, mit denen sie vor Jahren in den Beruf gestartet war. Die Vorsätze, Kindern und ganzen Familien zu helfen. Der Wechsel vom Erziehungsheim in den öffentlichen Dienst, weil sie Strukturen verändern und Grundlegendes verbessern wollte. Nichts müsste verloren sein, dachte Sabine, es war höchstens verschüttet.
Mit einem Klick rief sie Pascals Akte auf den Bildschirm. Der Junge spielte Fußball, sie sah Streichholzbeine in viel zu großen Shorts. Vor fünf Jahren, im Alter von vier, war das Kind von seinem Vater mit dem Bügeleisen malträtiert worden. Pascal hatte entsetzliche Narben auf dem Rücken. Der Vater hatte sich nach der Tat abgesetzt, der Junge war in Obhut genommen worden, durfte aber seit Neuestem wieder bei der Mutter wohnen, die mit dem Jugendamt kooperierte. Allerdings hatte die Mutter neulich erwähnt, dass sie ihren Sohn für einen Schwimmkurs anmelden wollte, und Sabine hatte daraufhin – zu ihrer eigenen Überraschung – in der Teambesprechung eingehakt, obwohl sie den Fall kaum kannte.
»Pascal in Badehose, einfach so?« Sie war aufgestanden, alle hatten sie angesehen. »Ist der Mutter denn klar, welche Sprüche ihr Sohn im Schwimmbad zu hören bekommt? Wenn die Haut auf dem Rücken so schlimm aussieht?«
Vielleicht war das der Punkt gewesen, an dem der Chef beschlossen hatte, Sabine den Fall zu überlassen. Wer sonst würde an Spott und Gemeinheiten gegen den Jungen denken, wenn nicht sie, die gemobbte Kollegin?
Ach, und wenn schon. Sabine verzog den Mund. Ihre Aufgabe war ab sofort, das Kind zu fördern, und sie hatte eine Idee. Vielleicht könnte die öffentliche Hand dem Jungen einen Schwimmanzug finanzieren, der seinen Oberkörper bedeckte. Wenn Pascal sich darin wohlfühlte? Oder war das Jugendamt für so etwas nicht zuständig?
Sie googelte nach Sportkleidung. Dann suchte sie ein Formular, mit dem sich ein Schwimmanzug beantragen ließe, bloß konnte der Computer leider keine Vordrucke laden, und als sie Friederike um Hilfe bitten wollte, war der Platz im Sekretariat leer. Die Telefone blinkten. Zwei, drei Anrufe, die Sabine als Neue kaum annehmen konnte.
Und wenn sie für heute tatsächlich kürzertrat? Und morgen dafür etwas länger blieb – wäre das üblich?
Auf der A3 war kaum etwas los. Sabine freute sich, die kurze Strecke von Köln nach Forsbach zu fahren und ihre Großmutter noch heute Mittag zu überraschen. Die Route führte durch den Königsforst, und wie immer an Sabines Geburtstag leuchtete der Wald in warmen Farben. Wacholder, Eichen, Buchen. Rotgoldene Kronen auf dunklen, schlanken Stämmen.
Sie dachte an die Mutter, mit der sie früher so gerne durch den Forst gefahren war. Mit der einen Hand hatte die Mutter das Auto gelenkt und mit der anderen Hand Sabines Bein gestreichelt. Die Seitenscheiben hatten offen stehen müssen, bei jedem Wetter, denn im Königsforst sollte man durchatmen.
Damals hatte Sabine noch andere Vorstellungen von einer Familie gehabt. Für sie war es normal gewesen, mal hier und mal dort zu schlafen. Ständig zu spät zu kommen. Tochter einer Anti-Atomkraft-Ikone zu sein, Enkelin eines Fotomodells. Sie hatte sich nur über die Nachbarn gewundert, die getuschelt hatten.
Permanent war Sabine zwischen Mutter und Großeltern gependelt, hatte vor allem die Fahrten nach Forsbach geliebt, denn die Kölner Mutter war mit Karacho durch den engen Dorfkern gekurvt, am Whisky Bill vorbei und den Julweg hoch, wo die Großmutter, Maria, damals meist schon vor dem Haus stand und wartete.
Der Großvater hatte oft hinten im Garten zu tun. Sobald er Sabine entdeckte, hob er sie hoch in den Himmel. Er hatte riesengroße Ohren, und manchmal ratschte sie sich an den Metallklipsen seiner Hosenträger. Er konnte zaubern und saß gern mit Sabine im Keller, während Maria und die Mutter oben in der Küche Makkaroni kochten.
Im Keller hatte der Opa eine Bar. Die Wände und die Decke waren aus Holz, und anstelle einer Tür gab es einen schweren Vorhang aus grünem Samt, damit die Wärme aus dem Heizlüfter in der Bar blieb und es gemütlich war. Sabine kletterte auf die klobige Eckbank und legte die kleinen Fäuste auf den Tisch. Der Opa lachte, dass die Ohren und die Koteletten hüpften. Dann holte er zwei Gläser, goss Eierlikör hinein und gab Himbeersauce dazu.
Vor drei Jahren erst war er gestorben, es war nicht einmal plötzlich gekommen, aber die Großmutter hatte trotzdem Zeit gebraucht, um sich daran zu gewöhnen. Und jetzt wollte sie Konsequenzen ziehen, zu Sabines Überraschung. Allen Ernstes wollte Maria das Haus am Julweg verkaufen, angeblich war es ihr zu groß. Dabei konnte sie noch sehr gut die Treppen steigen und sich selbst versorgen, das wusste Sabine, und es war auch kein Geheimnis, wie sehr Maria an ihrem Zuhause hing.
Der Garten suchte seinesgleichen, die Küche, die Balkendecke, die alten Möbel hatten Charakter. Wenn der Sommer schwül war, knarrten die Zedernholzschränke, und im Winter klopften die Heizkörper ihr Morsealphabet.
Nein, dachte Sabine, es gab noch eine Menge zu besprechen, bevor sie einen Makler in das Haus lassen konnten.
Sie bog in die Einfahrt ein und stieg aus dem Wagen. Ihr Kopf dröhnte, dabei war es am Julweg so still. In den meisten Häusern und Villen wohnten ältere Leute, die wahrscheinlich Mittagsschlaf hielten. Zwei Kurven weiter begannen die Hügel und Wiesen des Bergischen Landes. Ein Spaziergang wäre schön, später, vielleicht gemeinsam mit der Großmutter.
Mit einem Mal ging es ihr gegen den Strich, an der Haustür zu klingeln wie eine Fremde. Lieber öffnete sie das kleine Gartentor und betrat den Plattenweg, der um das Haus herumführte. An den Rosen hingen Hagebutten. Der Lavendel duftete, obwohl er längst verblüht war. Vor der Garage wuchsen Sonnenblumen im Spalier, jeder Stängel dick wie ein Kinderarm.
Das Küchenfenster an der Hausecke stand sperrangelweit offen, und Sabine hörte Geklapper. Sie lächelte. Die Großmutter war beschäftigt und würde hoffentlich nicht nach draußen blicken und sich vor ihr erschrecken.
Leise lief sie an den Sonnenblumen vorbei und gelangte in den hinteren Garten. Das Hochbeet war halb verrottet. Steine lagen im Gras. An den Apfelbäumen schrumpelten Früchte zu braunen Mumien, die sich an den Ästen festbissen. Nur die Grisbirnen waren noch genießbar.
Sie pflückte zwei Hände voll und machte sich auf der Terrasse bemerkbar. Sofort riss die Großmutter die Tür auf: »Mein Geburtstagskind!« Ihre berühmten grünen Augen strahlten. Sie trug die schöne Tunika und ein breites Band im Haar, von den Händen tropfte Wasser.
»Hast du Zeit?«, fragte Sabine, aber Maria packte sie fröhlich am Kinn.
»Wie siehst du denn aus? Hattest du eine anstrengende Party, oder hast du dich schon wieder von jemandem getrennt?«
»Letzteres«, Sabine trocknete ihr Kinn an der Schulter. »Du konntest den Mann sowieso nicht leiden, Oma.«
Sie versuchte, die Birnen festzuhalten, aber Maria schloss sie ungestüm in die Arme. Ihr weißer Scheitel duftete, Sabine gab ihr einen Kuss. Vor vielen Jahren waren sie noch gleich groß gewesen, mit ähnlichen schmalen Schultern und gleich langen Füßen.
»Wir backen Waffeln«, verkündete Maria. »Außerdem glaube ich, du könntest einen Kaffee vertragen.«
Ja, tatsächlich, Sabine spürte die Müdigkeit wieder, aber auf eine behagliche Art, so wie man nach einem Arbeitstag bequeme Klamotten anzieht.
Sie brachte die Birnen zur Spüle und stieg in den Keller hinab, um das Waffeleisen zu holen. Die alte Glühlampe sirrte, und vor der Bar hing der herrlich schwere Samtvorhang.
In den Regalen stand allerdings etwas Neues. Kartons voller Bücher, Schuhe und geblümter Tassen. Sabine wollte nicht stöbern, aber … Ob die Großmutter aufgeräumt hatte? Ob der Makler etwa doch schon hier gewesen war?
Zurück in der Küche, suchte sie nach einer Gelegenheit, die Kartons zu erwähnen, aber Maria war mit dem Handmixer beschäftigt, und dann, während sie Waffeln backten, war die Stimmung so gut, dass sie es nicht über sich brachte, kritische Fragen zu stellen. Schließlich nahmen sie das heiße Gebäck mit auf die Terrasse und setzten sich in die Hollywoodschaukel. Den Blick auf den Garten gerichtet, auf die hohen, sonnengefleckten Bäume, aßen sie und schwiegen.
Die Schaukel schwang träge vor und zurück. Eine Armlehne klapperte, aber das störte nicht. Gummihammer und Schraubendreher lagen seit Wochen bereit, ohne zum Einsatz zu kommen.
Früher hatte Sabine mit den Großeltern zwischen den Obstbäumen Krocket gespielt. Wenn es kälter geworden war, hatten sie Laub und Zweige für ein Lagerfeuer gesammelt und Kartoffeln geröstet. Der Qualm war hoch in das Kinderzimmer gezogen, ein herber Kontrast zu dem Apfelshampoo, dessen Geruch in dem Plüschkissen hing.
Maria bremste die Schaukel ab. »Wie ist dein Geburtstag bisher verlaufen?«, wollte sie wissen, und Sabine tauchte aus ihren Gedanken auf. Sie erzählte von den Kollegen, ihrem ersten eigenen Klienten und von Friederike.
»Nach den Cognacbohnen war uns schlecht.«
»Ich schlage drei Kreuze, dass du die Stelle gewechselt hast.«
»Allerdings. Aber es hat sich auch gelohnt zu warten, bis im Jugendamt etwas frei wurde.«
»Aus meiner Sicht hat es ewig gedauert.« Maria lehnte den Kopf an das Polster. »Ich hätte es nicht geschafft, so lange stillzuhalten.«
»Na ja, du bist schon immer entscheidungsfreudiger gewesen als ich.«
»Das stimmt nicht.« Maria lachte. »Denk an deine Männergeschichten. Da fackelst du nicht lange.«
Etwas verhalten stimmte Sabine in das Lachen ein. Sie war froh, der Großmutter nichts entgegnen zu müssen. Die Entscheidungen und das Alleinsein. Das ständige Abwägen fiel ihr manchmal schwer.
Für eine Weile schaukelten sie wieder, dann berührte Maria Sabines Arm.
»Hör mal, ich hoffe, es verdirbt dir nicht den Geburtstag, aber ich muss dich leider um etwas bitten. Kannst du mir beim Umräumen helfen? Der Makler bringt morgen jemanden mit.«
»Oma!«
»Du warst doch eben im Keller und … Manches muss zum Sperrmüll, oder wir könnten die Sachen spenden. Ich bin selbst überrascht, wie schnell es vorangeht.«
»Was heißt das – der Makler bringt jemanden mit?« Sabine stand auf, die Hollywoodschaukel ächzte. »Ich habe den Makler noch nicht einmal kennengelernt! Und außerdem kann ich mir für morgen nicht freinehmen.«
»Wirklich«, Maria hob bedauernd die Schultern. »Ich schaffe das auch allein.«
»Nein! Das lasse ich nicht zu.«
»Sabine, wir müssen uns dringend um das Haus kümmern.«
»Das tun wir doch!«
»Aber nicht richtig. Nicht für die Zukunft gedacht. Seitdem dein Großvater gestorben ist und wir beide allein sind, begreife ich, dass es nicht ausreicht, Sonnenblumen vor die Garage zu pflanzen, um zu vergessen, was dort …«
»Doch«, unterbrach Sabine sie. »Ich kann vergessen. Solange ich weiß, dass alles andere seine Ordnung hat.«
»Ordnung?« Maria griff nach dem Seitengestänge und zog sich hoch. »Ich bin steinalt und finde den Gedanken furchtbar, dich mit dem Haus zurücklassen zu müssen. Wie willst du das schaffen? Wie willst du zurechtkommen?«
»Ach, es liegt also an mir? Du denkst, ich kriege es nicht hin, wenn du … wenn ihr alle …?«
Empört nahm Sabine die Teller und lief in die Küche. Sie war nie die Stärkste in der Familie gewesen, jedenfalls hatten die anderen das von ihr gedacht. Aber sie hatte sich auch nie unfähig gefühlt, die Dinge zu meistern. Hatte immer alles ertragen, alles ausgehalten, und zwar von Kindesbeinen an. Selbst in der Garage, damals, als die Mutter am Seil gebaumelt hatte. Tot, den Kopf in der Schlinge. War es nicht sie, Sabine, gewesen, die den Großvater herbeigerufen hatte? Und die Großmutter auch? Und war es nicht Sabine gewesen, die letztlich ganz allein dagestanden und sich um ihre weißen Kniestrümpfe gekümmert hatte, anstatt wie die anderen nach oben zur Mutter zu starren, die keine Hilfe mehr gebraucht hatte?
Nein, nein, das alles gehörte nicht hierher. Nicht mehr in den heutigen Geburtstag.
Sabine räumte die Teller in die Spülmaschine und ging ins Wohnzimmer, um ein paar weitere Minuten allein sein zu können. Sie stupste die grünen Sessel an, die klobigen Bücherregale, das Sofa mit der hohen Lehne. Was sollte wohl mit den Möbeln geschehen? Ob der Makler auch darauf spekulierte?
»Sabine?« Maria kam durch den Flur, die Absätze klackerten auf dem Parkett. »Es tut mir so leid, und ich verstehe auch, wenn du möglichst viel für dich erhalten willst. Du könntest den großen Teppich haben. Für dein Schlafzimmer vielleicht?«
Aber so konnte doch keine Entscheidung fallen! Das Fleddern beginnen!
Sabine bückte sich. Der schöne Orientteppich war ein dickes, fransiges Ding. So oft hatte sie als Kind darauf gelegen, unter dem Schreibtisch, dem Großvater zu Füßen. Sie erinnerte sich an seine Pantoffeln, die wippten, während oben der Füller über das Papier kratzte, aber jetzt saß ihr die Erinnerung quer. Sie hasste den Teppich unvermittelt und wollte ihn doch keinen einzigen Tag mehr hier liegen lassen.
Sie schlug den Rand um und zog mit aller Kraft. Der schwere Teppich blieb am Fleck. Da wuchtete sie ein noch größeres Stück hoch, riss daran und wollte es in Schwüngen zusammenschlagen. Aber was war das? Etwas wirbelte vom Boden auf, ein Stück Papier flog durch den Staub. Braun und mit Zahlen. Ein Geldschein?
Die Großmutter stieß einen Schrei aus, Sabine fuhr herum. »Was ist das, Oma? Geld?« Ja, es war vollkommen unglaublich, auf dem Boden lag altes Geld! Und es war nicht wenig.
Maria fiel Sabine in den Arm, blass, wie vom Donner gerührt. Sabine brachte sie zum Sofa und schlug dann noch mehr von dem Teppich um, bloß behutsamer jetzt. Schein für Schein lag darunter, platt nebeneinander, Kante an Kante. Braune Tausender, D-Mark-Scheine, sauber und kaum benutzt.
»Das ist nicht wahr.« Die Großmutter klammerte sich im Sitzen an das Sofa, wie unter Schock.
»Oma, wo kommt das Geld her?«
»Das darf nicht sein! Das kann er nicht getan haben!«
»Was denn? Wen meinst du?«
Doch Maria wehrte ab. Sie krümmte sich, wimmerte, und als Sabine sie trösten wollte, ließ sie keine Berührung zu, sondern arbeitete sich wieder vom Sofa hoch. Ihr Gesicht zuckte, der Hals … es war ein furchtbarer Anblick.
Später saßen sie in der Küche. Sabine kochte Tee und brachte der Großmutter eine Strickjacke, die sie vehement ablehnte. Angeblich machte es ihr nichts aus, in der Bluse dazusitzen und zu frösteln. Dabei war das Zittern besorgniserregend, auch wenn Maria sich kerzengerade hielt.
Das Geld hatten sie im Wohnzimmer auf dem Boden liegen gelassen. Fünfzehntausend Deutsche Mark. Eine eiserne Reserve wahrscheinlich, die der Großvater vor Urzeiten versteckt haben musste.
»Was für eine Überraschung«, sagte Sabine möglichst ruhig. »Aber es ist keine so hohe Summe, dass wir Probleme kriegen. Ich gehe morgen ans Gustav-Heinemann-Ufer zur Bundesbank und tausche die Scheine in Euro um.«
»Nein.«
»Oma, selbst wenn es Schwarzgeld von früher sein sollte …«
»Das Geld bleibt, wo es ist.«
Unter dem Teppich?
Sabine rührte im Tee. Maria presste die Lippen aufeinander und zog sich das Haarband vom Kopf. Sie war ruppig, eisig und gleichzeitig außer sich. Was war bloß mit ihr los?
Um Zeit zu gewinnen, nahm Sabine eine Grisbirne, schnitt sie auf und schob der Großmutter ein Viertel zu.
»Hat Opa viel Geld verdient?«
»Er war Betriebsleiter.«
»Also ist es kein Wunder, dass er etwas auf die Seite schaffen konnte.«
»Niemand behauptet, dass es so gewesen ist.«
»Na ja, du hast eben selbst gesagt: Das kann er nicht getan haben. Hast du damit nicht Opa gemeint?«
Marias Wangen röteten sich. Sie schob die Birne beiseite und stemmte sich mit den Fäusten auf dem Tisch in die Höhe.
»Nimm du das Geld, Sabine. Nimm alles, was du noch finden kannst in diesem verdammten Haus.«
Damit schritt sie aus der Küche, die Wohnzimmertür schlug, und es wurde still.
Verblüfft blieb Sabine sitzen. Wusste die Großmutter noch, was sie sagte? Niemals würde Sabine das Geld nehmen, sondern sie würde die Scheine einsammeln und auf Marias Konto einzahlen. Erst recht, wenn morgen ein Kaufinteressent kam, um das Haus zu inspizieren.
Sie goss den Tee aus beiden Tassen in die Spüle und legte die Strickjacke zusammen, die von der Stuhllehne gerutscht war. Dann öffnete sie leise die Wohnzimmertür. Maria lag rücklings auf dem Sofa, einen Arm auf der Stirn. Ihr Atem ging flach und schnell, die Augen waren geschlossen. Als Sabine eine Hand an ihre Wange legte, merkte sie, dass Maria weinte.
»Oma, entschuldige.«
»Du musst suchen.« Maria war kaum zu verstehen. »Es könnte noch viel mehr versteckt sein, und ich will, dass du es findest.«
Sabine runzelte die Stirn. »Für heute passiert gar nichts mehr. Aber ich bleibe über Nacht bei dir.«
Sie breitete eine Decke über die Großmutter und streichelte ihr Haar. Dann stellte sie im Keller die Heizungsanlage an, es zischte und gluckerte in den Rohren. Als sie an der Bar vorbeikam, blickte sie hinter den Samtvorhang. Die Luft war feucht. Der Heizlüfter stand in der Ecke, ein klobiges Nachkriegsgerät. Auf dem Tisch schimmerte ein runder Fleck wie von der Eierlikörflasche des Großvaters früher.
Ob es stimmen konnte, was die Großmutter eben geflüstert hatte? Dass noch mehr Geld im Haus versteckt war als die fünfzehntausend Mark? Aber woher wollte sie das eigentlich wissen? War sie vorhin etwa nicht überrascht gewesen?
Sabine nahm einen Lappen und den Vierkantschlüssel aus der Werkstatt, um die Heizkörper zu entlüften. Im Dachgeschoss fing sie damit an, in ihrem alten Kinderzimmer.
Der Großvater, Heinrich Schubert, war bodenständig gewesen, vor allem, wenn es um die Finanzen ging. Das Geldversteck im Wohnzimmer würde er wohl sorgfältig ausgesucht haben. Der Teppich war so groß, dass man ihn selbst am Putztag nie vollständig beiseitezog. Man hob die Ränder an, die schwere Mitte blieb liegen. Einzigartig – oder nicht? Könnte es in diesem Haus etwa noch eine andere, ähnlich gute Möglichkeit zum Verstecken gegeben haben?
Prüfend sah Sabine sich um, fand aber nur schmale Läufer auf Parkett oder fest verklebte Linoleumböden. Trotzdem knibbelte sie an den Ecken, es war beinahe lächerlich, und dann, weil es unten im Haus immer noch ruhig blieb, schlich sie sogar an das Bett der Großeltern. Der dunkle Kasten hatte ihr immer Respekt eingeflößt. Jetzt tastete sie über die Leisten, griff unter die Matratzen und hinter das Kopfteil. Nichts. Da lag nur das feine Nachthemd der Großmutter, und plötzlich schämte sie sich.
Sie kehrte ins Wohnzimmer zurück, das Sofa war inzwischen leer. »Oma?« Die Tausendmarkscheine lagen noch an Ort und Stelle, aber Maria war fort.
»Oma?« Auch in der Küche war sie nicht, also dann vielleicht im Garten. »Bist du hier?«
Nichts. Stille, und Sabine konnte es nicht nachvollziehen. Maria hätte ihr doch Bescheid sagen müssen, wenn sie weggegangen wäre?
Im Garten war es mittlerweile kühler geworden. Von den Obstbäumen schoben sich Schatten über die Terrasse, der Rasen schien im Abendtau zu ertrinken. Die Hollywoodschaukel hing schlapp am Gestänge, und das Werkzeug fehlte, das am Nachmittag noch auf dem Boden gelegen hatte. Gummihammer und Schraubendreher.
»Oma?«
Konnte Maria das Werkzeug genommen haben? Von irgendwoher kam ein merkwürdiges Geräusch. Als ob etwas zersplitterte, etwas zerbrach. Doch nicht im Haus?
Nein, im Haus war die Großmutter nicht, und Sabine fand sich schon wieder albern, weil sie so aufgeregt wurde. Maria konnte nicht weit weg sein, oder war das Geräusch etwa von der Straßenseite gekommen?
Sie hastete über den Plattenweg. Ihr Blick fiel auf die Garage, den Sichtschutz aus Sonnenblumen, dick wie Kinderarme, und ihr Herz schlug immer härter.
»Oma!«
Da endlich sah sie Licht. Es kam von unten aus dem Haus, aus dem Kellerfenster. Sabine atmete aus. Maria musste in der Bar sein!
Sie rannte zurück zur Terrasse, über die Stufen nach unten und tauchte mit den Ellbogen voran durch den grünen Samtvorhang.
»Stopp!«
Die Großmutter stand krumm im Raum. Sie hielt tatsächlich den schweren Hammer und den Schraubendreher in den Händen, offenbar hatte sie sich verausgabt. Denn in der Vertäfelung an der Wand klaffte ein Loch. Die Paneele waren zerbrochen. Kleine Päckchen glänzten zwischen dem Holz.
»Was ist das?«, fragte Sabine.
Maria ließ das Werkzeug auf den Teppich fallen. »Das da, Sabine?« Ihre Stimme war voller Abscheu. »Das ist in Plastik eingeschweißtes Gold.«
3
Als Maria an der Weißen Villa ankam, troffen Mantel und Hut vom Regen. Die Schuhe waren nass, die Füße kalt, und die Strümpfe waren gesprenkelt von der Gischt der Straße. Doch das war egal, denn jetzt, wo sie so weit gekommen war, erfolgreich von zu Hause verschwunden und durch Düsseldorf geeilt, spürte Maria eine Kraft, mit der sie alles bewältigen würde.
Sie strich die Tropfen vom Mantel, und obwohl sie das Messingschild neben der Haustür zum ersten Mal sah, kam es ihr vertraut vor, als hätte es schon immer zu ihrem Leben gehört und als wäre alles, was bisher passiert war, eine Vorbereitung auf die persönliche Begegnung heute gewesen, auf Maria Reimer im Atelier Bertrand.
Sie betätigte den Türklopfer, und nachdem niemand öffnete, stieß sie die schwere Holztür auf und betrat eine imposante Eingangshalle. Ein Kristallleuchter hing von der Decke. Ringsum zog sich verschnörkelter Stuck. Am Boden glänzte Marmor in dem Schachbrettmuster, das Maria aus dem Kontor des Vaters kannte, aber anders als in den Räumen in Köln hätte man in der Halle des Ateliers einen Tanztee abhalten können. Oder eine Couture-Schau.
»Guten Tag!« Ihre Stimme verlor sich, es kam keine Antwort. Nur der Kristallleuchter knackte am Seil.
Zwei hohe, weiß lackierte Türen befanden sich hinten in der Wand. Es stand kein Schriftzug daran, kein Hinweisschild. Ob Maria auch dort anklopfen sollte? Vielleicht war es höflicher, noch einen Moment zu warten?
An der rechten Seite der Halle führte eine Treppe nach oben, ausgelegt mit rotem Teppich, und vor den Stufen stand ein zierlicher Sessel. Ein Sessel zum Warten wohl, denn daneben türmten sich Zeitungen auf einem Tisch. Völkischer Beobachter, Westdeutscher Beobachter, darunter lugte die Dame hervor, eine Ausgabe, die Maria noch nicht kannte. Behutsam zog sie die Zeitschrift aus dem Stapel.
Schon auf Seite drei war ein enormes Hutmodell abgebildet, schwarzer Samt, getragen von Marion Morehouse, einfach fantastisch. Mit Seitenlicht fotografiert, wie es auch in der Vogue üblich geworden war und wie man es hoffentlich im Atelier Bertrand nachahmen würde, um mit Paris und New York Schritt zu halten.
»Vorsicht!«, rief plötzlich jemand von oben. »Sie tropfen ja auf das Papier.« Auf dem Podest der Treppe stand eine Frau, sie lächelte mit einer langen Zigarettenspitze am Mund.
»Entschuldigung.« Eilig schlug Maria die Dame zu. Zum Glück sah sie keine nassen Flecken.
»Ah! Vous avez l’air nerveux, Sie Ärmste.« Die Frau kam Schritt für Schritt die Stufen herunter, blies den Zigarettenrauch durch die Nase und streichelte das Treppengeländer, als wäre es ein Tier.
Maria erkannte den Gang, eine in Paris geläufige Mischung aus Präzision und Lässigkeit, die viel Übung verlangte: Die Frau setzte die Füße gekreuzt voreinander, um sich weich in den Hüften zu wiegen, und lehnte den Rücken ein wenig nach hinten, um die Brust zu betonen. Und dann sprach sie auch noch Französisch, wie Maria es sich erhofft hatte – und wie sie es dem Vater nicht erzählen dürfte. Er machte seit Wochen ein Gewese um die Sprache, als besäße das Handelshaus Reimer keine stolze internationale Tradition.
»Bonjour, Madame. Ich bin Maria Reimer aus Köln.« Sie nahm den nassen Hut vom Kopf. »C’est un plaisir d’être ici.«
Die Frau musterte Marias Frisur. Wahrscheinlich klebte der Pageboy an den Schläfen.
»Öffnen Sie den Mantel, Fräulein Reimer, und zeigen Sie mir Ihr Kleid.«
»Ich würde mich gern erst einmal frisch machen.«
»Das deutsche Mädchen soll ungeschminkt sein. Wissen Sie das nicht?«
Vorsichtshalber nickte Maria. Die Frau trug selbst ein modernes Rouge und Lippenstift. Ihr enger blauer Rock musste teuer gewesen sein. Der Bolero saß perfekt auf den Schultern, und die Haare waren sorgfältig zu einer golden schimmernden Olympiarolle gedreht.
»Sind Sie eine Mitarbeiterin von Herrn Bertrand?«, fragte Maria und legte so viel Weltläufigkeit in die Aussprache des Namens, wie sie konnte.
Die Frau spitzte belustigt die Lippen. »Denken Sie, Herr Bertrand persönlich wird Sie fotografieren?«
»Bei ihm habe ich meinen Termin. Um zwölf Uhr.«
»Wissen Sie, wie viele Bewerberinnen wir heute schon hatten? Also hoffen Sie nicht auf den Chef. Ich vermute eher, dass Noah die Aufnahmen von Ihnen machen wird.«
»Gerne.«
»Oder haben Sie Bedenken gegen jemanden, der den Namen Noah trägt?«
Das war ja wohl keine ernst gemeinte Frage. Oder doch, denn die Frau hob die nachgezeichneten Augenbrauen und schien sich zu wundern, dass Maria keine Antwort gab.
»Fräulein Reimer, Sie kommen mir recht jung vor.«
»Ich bin bald achtzehn. Es ist der richtige Zeitpunkt, um in einen Beruf einzutreten.«
»Und Ihre Eltern sind damit einverstanden, dass Sie sich bei uns ablichten lassen?«
»Sonst wäre ich nicht hier.« Die Lüge klang etwas kratzig. »Außerdem kann ich mir gar keine andere Zukunft vorstellen als in der Modefotografie!«
In diesem Moment ertönte Applaus von oben. Schon wieder hatte sich jemand auf das Podest der Treppe geschlichen, ein Mann, ein Nazi in Reitstiefeln und schwarzer Uniform.
»Sei nicht so streng, Greta«, rief er fröhlich und kam nach unten gelaufen. »Freu dich, wenn die jungen Mädchen sich für unsere Sache engagieren. Und dann auch noch mit Eltern, die sie darin unterstützen!« Er übersprang die letzten Stufen und knallte vor Maria die Stiefel zusammen. »Sagten Sie Reimer?«
»Maria Reimer aus Köln.«
»Den Namen werde ich mir merken, für den Fall, dass Sie Karriere machen.«
Er salutierte und verschwand vergnügt durch die Haustür. Die Frau allerdings, Greta, wirkte verstimmt. Sie legte die Zigarette fort und lief dem Mann nach. Maria blieb allein in der Halle zurück.
Ob es schlimm gewesen war, dass sie mit dem Uniformierten gesprochen hatte? Und auch noch geschwindelt hatte?
Sie steckte den nassen Hut in die Tasche. Das lange Warten strapazierte die Nerven. Immer noch holte sie niemand aus der Halle ab. Weder Herr Bertrand noch der Fotograf Noah wollten sich um ihre Anwesenheit kümmern. Sie blätterte noch einmal in der Dame, aber inzwischen fehlte ihr die Muße zum Lesen.
Schließlich ließ sie den Mantel von den Schultern gleiten, korrigierte mithilfe des Taschenspiegels ihr Aussehen und näherte sich den beiden weiß lackierten Türen.
Hinter der linken fand sie bloß ein Badezimmer. Durch die rechte Tür aber gelangte sie in einen langen, dämmrigen Flur, der sie um mehrere Ecken in den hinteren Teil des Gebäudes führte. Am Ende des Flurs stand eine weitere Tür einen Spalt offen, und Licht drang heraus. Möglicherweise war hier das berühmte Studio, und sie könnte Herrn Bertrand treffen? Oder wurden gerade kunstvolle Fotos angefertigt, von Noah? Sie sollte unbedingt leise sein, um niemanden zu stören.
Auf Zehenspitzen, die Tasche an sich gedrückt, sah sie um die Ecke, nur leider entpuppte sich der Raum hinter der Tür als ganz normales Büro. Ein junger Mann stand über einen Schreibtisch gebeugt und blickte durch ein kleines silbernes Gerät. Dunkle Locken hingen ihm in die Stirn, und obwohl er sehr in seine Tätigkeit vertieft schien, fuhr er plötzlich hoch, als hätte er Maria atmen gehört. Das silberne Gerät ließ er in der Hosentasche verschwinden und schob mit der anderen Hand etwas auf dem Tisch durcheinander. Fast wie ertappt.
»Mademoiselle?« Er warf die Haare zurück.
Dunkle, wache Augen, hübsch und verwegen. Bloß seine Miene war abweisend.
»Ich habe einen Termin«, sagte Maria, »um mich für die Modeaufnahmen zu bewerben. Ich habe auch schon ziemlich lange in der Eingangshalle gewartet.«
»Wirklich?« Er knöpfte sein Jackett zu. »Wie heißen Sie bitte?«
»Maria Reimer. Ich bin extra aus Köln angereist.«
Sie sah, dass sich seine Lider zusammenzogen, es war ein merkwürdiger Reflex.
»Noah Ginzburg mein Name, freut mich.«
Er reichte ihr nicht die Hand und nickte auch nur sehr sparsam, ja, er schien sich jede Geste förmlich abringen zu müssen. Maria spürte, wie sich ihr Rücken versteifte. Gefiel sie ihm nicht? Ausgerechnet ihm nicht, dem Fotografen?
»Sie haben sicher schon auf mich gewartet«, sagte sie. »Sie müssen ja gedacht haben, ich käme zu spät.«
»Nein.« Er sah knapp an ihr vorbei. »Offen gestanden sind die Bewerbungen für heute abgeschlossen, Fräulein … Reimer, und die Damen, die wir eingeladen hatten, sind sämtlich im Studio erschienen. Uns fehlte niemand.«
»Das kann nicht sein …«
»Um fünf nach zwölf habe ich alle nach Hause geschickt.«
»Ich stand vorne in der Halle!«
»Der Eingang für die Bewerberinnen ist an der Seite des Hauses, im Hinterhof.«
»Oh, bitte nicht.« Sie stieß gegen die Schreibtischkante. »Ein Missverständnis, Herr Ginzburg! Aber Sie werden jetzt trotzdem noch mit mir ins Studio gehen?«
Ohne zu antworten, durchsuchte er die Mappen und Papiere, die auf dem Tisch lagen, und sie musste sich zwingen, ruhig zu bleiben. Er suchte doch hoffentlich nach ihrer Bewerbung? Er wollte ihr glauben? So fest sie konnte, verschränkte sie die Finger ineinander und wartete ab.
Er war ein Franzose, das verriet sein Akzent. Er sah auch durchaus künstlerisch aus, so, wie seine Locken nach vorn fielen. Bestimmt war es für jedes Fotomodell eine Ehre, mit ihm zu arbeiten, aber möglicherweise wusste er das auch und bildete sich viel darauf ein.
Jetzt ließ er einen Stapel Fotos über die Tischplatte rutschen. Aufnahmen von Kleidern und Frauen und Landschaften. Maria sah das Schlageter Denkmal, einen Militärwagen am Rhein und eine posierende Dame davor. War das nicht Greta mit der Olympiarolle?
Endlich hob Noah Ginzburg den Kopf. »Sie sind in unseren Unterlagen nicht verzeichnet, Maria.«
»Dann zeige ich Ihnen meine schriftliche Einladung zum Bewerbungstermin.«
Sie konnte den Brief kaum aus dem Umschlag klauben, so aufgeregt war sie inzwischen. Und dann las der Fotograf das Schreiben, und zu ihrem Schreck schien er dabei nur noch skeptischer zu werden.
»Warum haben Sie eine Postlageradresse benutzt?«, fragte er.
Was sollte sie antworten? Mit dem Postfach hatte sie verhindert, dass der Vater die Bewerbung entdeckte.
»Ich bin zweifellos Maria Reimer, und der Brief ist eindeutig an mich gerichtet.«
»Gut. Dann muss der Fehler wohl bei uns liegen. Leider lässt er sich jetzt nicht mehr beheben.«
Bitte?
Sie stopfte den Brief zurück in die Tasche, fieberhaft um Worte bemüht. Doch der Fotograf kam schon um den Tisch herum, Noah Ginzburg, und sie konnte sich hervorragend vorstellen, wie er eine Kamera in den schlanken Händen hielt. Aber stattdessen? Wies er zur Tür!
»Sie wollen mich nicht im Ernst hinauswerfen?«
»Es liegt nicht an Ihnen. Unser Atelier hat sich für eine andere Bewerberin entschieden. Entgegen der ursprünglichen Pläne wird nun doch kein junges, sondern ein erfahrenes Fotomodell bevorzugt.«
»Das glaube ich nicht!« Wo war nur die Zeitungsanzeige? Sind Sie eine frische Frau mit Mut? Frisch!, doch Herr Ginzburg wollte den Text nicht einmal anschauen, sondern schob Maria am Ellbogen Richtung Flur. Empört riss sie sich los.
»Ich verstehe!«, rief sie. »Es ist Greta, mit der Sie die Position besetzen wollen. Also bin ich von ihr mit Absicht in der Halle aufgehalten worden!«
»Es ist nicht gut, wenn Sie jetzt laut werden.«
»Sie wissen ja gar nicht, was es mir bedeutet hat hierherzukommen.«
Er wiegte den Kopf, und das Zimmer begann sich um Maria zu drehen. Wie überheblich er war! Wie ignorant! Ja, es war insgesamt ein sehr ignorantes Atelier. Verschickte Einladungen, ohne es ernst zu meinen. Ließ es zu, dass ein Mädchen wochenlang übte und an seinem Auftritt feilte, und sah sich das Ergebnis nicht einmal an.
Den Tränen nahe lief sie über den Flur, um die Ecken herum dem Schachbrettmuster entgegen, doch kaum hatte sie die Halle erreicht, trat ihr schon wieder Greta in den Weg.
»Was ist passiert?«
»Ich habe mich im Termin geirrt. Auf Wiedersehen.«
Greta versuchte, sie festzuhalten, und auch Noah Ginzburg schlitterte eilig heran, einen Mantel in der Hand: »Warten Sie, Maria, ich bringe Sie zum Bahnhof!«
»Ich gehe sehr gern allein. Und richten Sie Herrn Bertrand aus, dass er noch einmal Post von mir bekommen wird.«
»Noah!« Greta lachte. »Du hast Fräulein Reimer bei der Bewerbung durchfallen lassen?«
Energisch drängte der Fotograf Greta zur Seite, und Maria wurde klar, dass die beiden sich ziemlich gut kannten, und zwar bestimmt nicht nur von der Arbeit. Dabei war Greta mindestens zehn Jahre älter als er!
Ach, wie weit war es noch bis zur Haustür? Maria wollte vor den Augen der anderen nicht wieder rennen und setzte die Füße bewusst voreinander, während hinter ihr hörbar gerangelt wurde.
»Noah, ich fasse es nicht!«, rief Greta. »Du hast sie gar nicht fotografiert, oder? Kann das möglich sein? Halt, Fräulein Reimer! Bleiben Sie stehen!«
»Greta, lass sie, sie ist minderjährig.« Noahs Stimme bekam einen hässlichen Ton. »Sie konnte mir keine Erlaubnis ihrer Eltern vorlegen.«
Wie dreist von ihm! Maria wirbelte herum. »Sie haben mich gar nicht nach einer Erlaubnis gefragt, Herr Ginzburg! Stattdessen haben Sie mir mitgeteilt, dass Sie sich längst für eine andere Bewerberin entschieden haben.«
»Für wen?« Greta hob verwundert das Kinn. »Warum weiß ich davon nichts?«
»Weil Bewerberin wohl das falsche Wort ist«, schleuderte Maria ihr entgegen. »Wenn man sich kennt.«
»Ach, Sie reden von mir?« Greta griff sich ans Dekolleté. »Ich stehe doch gar nicht zur Verfügung!«
Das Blut rauschte in Marias Ohren. Noah kniff den Mund zusammen, und Greta ließ ihre Zigarettenspitze auf die Fliesen fallen.
»Jetzt mal im Ernst, Fräulein Reimer. Ich begleite das Auswahlverfahren, und ich habe Sie für eine unserer besten Kandidatinnen gehalten. Wir suchen exakt einen deutschen Typ wie Sie.«
»Ihr Fotograf sucht nicht.«
»Aber ja! Und er weiß auch um Ihre Qualitäten, da bin ich mir sicher.«
Nach Bestätigung heischend, wandte Greta sich an Noah. Er aber schwieg, und auf seinem Gesicht lag nicht etwa Betretenheit oder gar die Bitte um Verzeihung, sondern ein Anflug von Furcht. Na also, dachte Maria, er hatte wohl doch etwas zu verbergen, nämlich dass er sie abgekanzelt hatte. Und … ihr fiel das kleine silberne Gerät ein, das er so flink in die Hosentasche gesteckt hatte.
»Ich habe den Fotografen gestört«, sagte sie. »Er hatte wichtigere Dinge zu tun, als sich mit mir zu befassen.«
»Was meinen Sie damit?«, wollte Greta wissen, und jetzt wurde Noah schlagartig weiß wie die Wand. Aber wenn schon! Maria durfte wohl auch einmal unhöflich sein, gerade wenn es ihm peinlich war.
Und trotzdem zögerte sie weiterzusprechen. Der Fotograf ballte die Hände. Sein Augenausdruck wurde geradezu verzweifelt. Hatte er denn tatsächlich solche Angst, und wusste Maria wirklich über ein Geheimnis Bescheid?
Mühsam presste Noah ein paar Worte hervor: »Sie hat gesehen, dass ich im Büro die Bewerbungsfotos sortiert habe. Und ja, ich gebe es zu, ich habe sie etwas barsch behandelt. Aber Herr Bertrand war auch nicht mehr im Haus.«
»Ja und?«, fragte Maria, doch Greta unterbrach sie: »Noah! Der Chef hätte gewollt, dass du dieses Mädchen fotografierst. Sieh sie dir an! Und denk nach.«
»Das Studio war abgeschlossen, und selbst wenn ich den Schlüssel gefunden hätte«, er wurde lauter, »darf ich ohne Erlaubnis von Herrn Bertrand kein Filmmaterial mehr benutzen. Ich kann es mir nicht leisten, die Vorgaben für jüdische Mitarbeiter zu ignorieren.«
Marias Herz zog sich zusammen. Also ging es auch hier nur um das eine. Selbst in diesem Atelier wurde arisiert. So wie bei Photo Brenner in Köln oder im Stoffladen Schmitz, der früher Blumenberg hieß und wo die beiden Verkäufer entlassen worden waren. Entlassen und angezeigt, für nichts.
»Ich hätte Ihre Situation verstanden, Herr Ginzburg«, sagte sie mit heller Stimme.
»Sie wissen ja nicht, wovon Sie sprechen!«
»Sie auch nicht. So.«
Denn wann wurde sie einmal etwas gefragt? Wann erkundigte sich jemand nach ihrer persönlichen Meinung zu dem, was rundum geschah? Arisierung! Die Reimers machten da nicht mit.
Maria riss die Haustür auf, für heute gänzlich bedient. Der Wind zog um ihre Beine, die Strümpfe waren immer noch feucht vom Regen vorhin.
»Fräulein Reimer!« Greta hielt Maria am Ärmel fest. »Sie wünschen sich doch eine Karriere. Darum sind Sie ja zu uns gekommen.«
»Lassen Sie mich los.«
»Ich bitte Sie, nehmen Sie die Gelegenheit wahr. Ich hole gern die Erlaubnis ein, dass Herr Ginzburg das Filmmaterial für Sie verwenden darf.«
»Ich ziehe meine Bewerbung zurück.«
Doch Greta packte noch fester zu. Ihr Atem roch nach Zigaretten, und Maria fiel auf, dass sie sich an der rechten Augenbrauenlinie vermalt hatte.
»Der Obersturmbannführer wird nach Ihnen fragen, Maria. Nach dem blonden Mädchen aus Köln.«
»Ich kenne keinen Obersturmbannführer.«
»Ach nein? Sie haben sich vorhin mit ihm unterhalten, in unserer Eingangshalle. Er hat großen Gefallen an Ihnen gefunden, das hat er mir gesagt. Also was denken Sie: Wie wird der Obersturmbannführer der Waffen-SS reagieren, wenn er hört, dass der Jude Noah Ginzburg ausgerechnet Sie, das deutsche Mädchen, aus dem Atelier verscheucht hat?«
»Ich lasse mich nicht erpressen und erst recht nicht verscheuchen. Aber wenn es hilft, bezeuge ich gerne, freiwillig und aus eigenen Gründen gegangen zu sein.«
»Aha.« Gretas rot geschminkte Lippen wurden schmal. »Vorhin habe ich Sie gefragt, ob es Sie stört, sich von jemandem fotografieren zu lassen, der Noah heißt. Und jetzt?«
Entgeistert machte Maria sich los und lief über das Trottoir. Wie bösartig Greta war. Wie gemein ihre Unterstellung!
Noah rief ihr etwas nach: »Gehen Sie schneller! Laufen Sie, Maria!«
Wollte er sie verspotten? Sie bremste ab. »Herr Ginzburg, es hat nichts damit zu tun, dass Sie ein Jude …«
»Ich weiß es doch. Es ist alles gut, aber bitte gehen Sie.«
Von wegen! Nichts war gut. Sie trat auf der Stelle. Aber sie konnte ihm doch nicht helfen?
Schon wieder war Greta bei ihr. »Geben Sie sich einen Ruck, Fräulein Reimer«, drängte sie. »Kommen Sie noch einmal herein, uns allen zuliebe.«
Maria zuckte mit den Schultern – und nickte.
Im Studio saß sie zunächst vor einer Kommode, und Greta schaffte alles herbei, was nötig war: Spiegel und Bürste, Tiegel und Schwamm. Mit fachkundigem Blick legte sie Marias Pageboy in neue Wellen, tupfte auf ihrer Nase herum und wies sie an, ruhiger zu atmen.
Noah hantierte schweigend im Halbdunkel. Maria konnte ihn nur aus dem Augenwinkel beobachten. Er bewegte sich routiniert, wirkte aber auch widerwillig und auf keinen Fall dankbar. Wie würde er gleich mit der Kamera umgehen? Wie sollte sich bei einer solchen Laune bloß alles zum Guten wenden? So lange hatte Maria auf eine Gelegenheit als Modell gewartet, hatte geübt, und jetzt würden die Umstände ihr alles verderben.
Mit mürrischer Miene balancierte Noah die Scheinwerfer aus und zog einen Hintergrund aus grünem Papier hoch. Dann bat er Maria knapp, sich ins Licht zu stellen, und hob eine Leica ans Auge, einen handlichen Apparat. Sie schaffte es kaum zu lächeln. Denn wenn Noah nicht die große Atelierkamera verwendete, war es ihm auch nicht ernst.
Ob sie ihn umstimmen könnte? Wenn sie möglichst unbeirrt blieb? Sie wollte sich konzentrieren und wenigstens richtig stehen: Das Gewicht nach vorn verlagern, die Fersen durften vom Boden abheben, ja, so war es gut. Sie hielt sich nur auf den Ballen. Taumelte leicht, und nein, die Hände mussten in die Seiten gestützt sein, und sie musste sich noch mehr straffen. Freundlich gucken. Und weiter straffen! Und vielleicht drehen?
Nach einer Weile, in der Noah den Auslöser kein einziges Mal betätigt hatte, ließ er die Kamera sinken. »Greta, lass uns allein«, sagte er.
Es raschelte in der dunklen Ecke des Studios. Greta ging tatsächlich hinaus, und Maria biss die Zähne zusammen.
Vor ihr glänzte die Linse der Leica, Noah fingerte am Objektiv, dann brach er wieder ab.
»Was jetzt, Maria? Ich muss Sie fotografieren.«
Sie ließ die Arme hängen. »Nach all der Aufregung kann ich es nicht besser.«
»Ce n’est pas vrai«, erwiderte er. »Sie können sich durchaus präsentieren, bloß … Nein, es liegt nicht an Ihnen. Nicht so jedenfalls, wie Sie meinen.«
Lauernd – oder lässig? – ging er um sie herum, die Leica auf halber Höhe und plötzlich sehr nah.
»Ist das denn schon der richtige Fotoapparat?«, fragte sie, und er antwortete: »Ich würde es vorziehen, wenn wir nicht mehr reden.«
Direkt unter einem Scheinwerfer blieb er stehen. Das Licht fing sich in seinen Wimpern, die Wangenknochen warfen Schatten. Er starrte Maria an, ein wenig unheimlich, düster und verschlossen, bis er entschied, doch wieder etwas zu sagen.
»Wissen Sie eigentlich, was passiert, wenn ich ein schönes Bild von Ihnen mache, Maria? Herr Bertrand wird es nach Berlin schicken, an die höchste Stelle, wo man sich neuerdings für Mode interessiert. Für deutsche Mode, selbstverständlich. Und dann wird man überprüfen, wie völkisch Sie sind.«
»Sie werfen verschiedene Dinge in einen Topf, Herr Ginzburg.«
»Leider nicht.«
Oh, wie anstrengend. Die Haut auf Marias Wangen juckte unter dem Puder, und der frisch gelegte Pageboy drückte inzwischen wie ein Helm. Wofür bloß das Ganze?
»Also gut«, sagte sie. »Wenn Sie partout nicht abdrücken wollen, kann ich auch gehen.«
Sie bückte sich und stieg aus den Schuhen. Denn besser als Gehen würde in diesem Fall Laufen sein. Blitzschnell nach draußen an Greta vorbei.
Ihr Herz schlug heftig, enttäuscht, erbost.
»Maria?«
»Ja?«
Sie sah zurück über die Schulter, die Schuhe in der Hand. Noah Ginzburg stand breitbeinig da und hatte sich zu ihr gebeugt, was wollte er noch?
Die Leica schwebte, Maria … Aber da! Es klackte: Der Fotograf drückte ab.
4
Komisch, wie sich das Leben vom einen auf den anderen Tag verändern konnte. Neulich noch stand Sabine verheult am Bürofenster, und jetzt fühlte sie sich, als könnte sie Bäume ausreißen.
Entspannt wie nie hatte sie sich in der Früh vom Strom der städtischen Mitarbeiter ins Kalk-Karree tragen lassen, wo das Jugendamt saß. Sie hatte im Pulk die Drehtür benutzt und dem Pförtner, der mit hochrotem Kopf versuchte, den Überblick zu behalten, ein lautes »Guten Morgen!« zugerufen. Die Typen vom Zentralen Aktendepot hatten Sabine natürlich entdeckt und schon wieder dreckig mit den Zungen geschlackert, aber sie hatte einfach weggeschaut.
In ein paar Wochen, vor der Weihnachtsfeier, würde das Zentrale Aktendepot wie immer das Bürgerbüro stürmen, aber diesmal würde Sabine nicht verschreckt hinter dem Kopierer hocken, sondern gut gelaunt im Jugendamt feiern, umringt von den neuen Kollegen. Erlöst von den bescheuerten Wichtelgeschenken der vergangenen Jahre. Nie wieder Beate Uhse in der Hauspost.
Sie fuhr den Computer hoch, zog das Kabel aus dem defekten Drucker und räumte ihn zur Seite. Es lohnte sich nicht, auf den IT-Service zu warten. Außerdem hatte Friederike ihr angeboten, den Drucker im Sekretariat mitzubenutzen.
Schade, dass es auf der Büroetage noch still war. Die meisten Kollegen nutzten die Gleitzeit und kamen später. Der Kölner Verkehr staute sich höllisch, und auf der Dillenburger Straße hatte es schon wieder einen Unfall gegeben. Vom Fenster aus war die Kreuzung nicht einsehbar, aber über die Fassade des Kalk-Karrees huschte Blaulicht, und der Widerschein verfing sich in der trüben Luft.