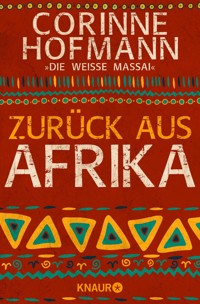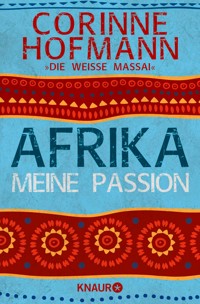9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Millionen von Leserinnen haben Corinne Hofmanns exotische Liebesgeschichte mit einem kenianischen Massaikrieger verschlungen. In "Das Mädchen mit dem Giraffenhals" erzählt sie von ihrer Jugend als Außenseiterin in der Schweizer Provinz und wie sie zu der unerschrockenen Frau wurde, die sich mit 27 Jahren nach Afrika aufmachte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 436
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Corinne Hofmann
Das Mädchen mit dem Giraffenhals
Knaur e-books
Über dieses Buch
Das neue Buch der »weißen Massai«: »Das Mädchen mit dem Giraffenhals« erzählt von Corinne Hofmanns Kindheit in der Schweizer Provinz und wie sie die wurde, die sie heute ist. Aus einfachen Verhältnissen stammend und als deutsches Kind in der Schweiz der sechziger und siebziger Jahre eine Außenseiterin, hat sie schon früh gelernt, aus widrigen Situationen das Beste zu machen. Eine Begabung, die das Fundament legte, vier abenteuerliche Jahre im kenianischen Busch zu überleben und, zurück in Europa, zahlreiche Neuanfänge zu meistern – und nicht zuletzt sie zu der starken, erfolgreichen und lebensfrohen Frau zu machen, der es immer wieder gelingt, ihre Leser zu überraschen und zu begeistern.
Inhaltsübersicht
Für meine Familie
Vorwort
Frau Hofmann, eine Frage hätte ich noch!«
»Ja bitte?«, antworte ich.
»Waren Sie schon immer so?«
»Was meinen Sie mit so?«, frage ich zurück.
»Nun, ich frage mich ganz einfach, ob Sie schon als junges Mädchen so selbstsicher, so klar und, wie mir scheint, so furchtlos und optimistisch durchs Leben gegangen sind oder ob das etwas mit Afrika zu tun hat. Mit Ihren Abenteuern und den Grenzerfahrungen – mein Gott, was Sie alles auf sich genommen haben, um diese Liebe leben zu können! Dass Sie das alles überhaupt überlebt haben! Ich hätte so etwas nie gekonnt! Und deshalb ist meine Frage ganz einfach: Waren Sie schon als Kind so?«
Die Journalistin, die mich neugierig aus strahlenden Augen betrachtet, wartet gespannt auf meine Reaktion. Doch zu meiner eigenen Überraschung kann ich mich nicht sofort zu einer befriedigenden Antwort durchringen. Denn früher – das ist schon sehr lange her. Ja, es kommt mir manchmal so vor, als befände ich mich schon in einem dritten Leben. Es gab eines vor Afrika. Eines in Afrika. Und eines im Jetzt, in Lugano, als weit über die Schweizer Landesgrenze hinweg bekannte Autorin. Wie sich das anhört! Irgendwie hochtrabend.
Immer wenn ich die Reaktionen der Menschen erlebe, wenn sie mich erkennen oder als »Die weiße Massai« entlarven und ich dann die Frage höre: »Waaaas, die bekannte Schriftstellerin sind Sie?«, fühle ich mich peinlich berührt und wiegle alles ein wenig ab, indem ich schnell antworte: »Na ja, ich bin Autorin, keine Schriftstellerin, aber dafür ist jeder Satz gelebt und selbst geschrieben.«
Für mich ist es auch nach siebzehn Jahren und vier Büchern noch etwas seltsam, als berühmt angesehen zu werden, auch wenn ich vor Hunderten, ja manchmal über Tausenden von Menschen referieren darf und Millionen von Leserinnen und Lesern meine Bücher kennen. Ich bin ich und irgendwie tief im Innersten immer das Mädchen vom Berg geblieben. Auch dann, wenn ich mich geschmackvoll oder bisweilen exzentrisch kleide. Auch wenn ich in den vielen Talkshows auftreten durfte, wie Boulevard Bio, 3 nach 9,Riverboat und wie sie alle heißen, reihe ich mich nicht in die Kategorie »Berühmtheiten« ein. Mir ist es egal, wer vor mir steht oder neben mir Platz nimmt. Wir sind alles Menschen, die etwas Besonderes zu erzählen oder zum richtigen Zeitpunkt das Richtige geleistet haben, und deshalb werden wir eingeladen.
Und nun soll ich in nur ein paar Minuten einer Journalistin erklären, ob ich schon immer so war …
»Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, das lässt sich nicht so schnell beantworten«, setze ich an. »Ich war sicher ein Kind, das die Freiheit liebte und ungewöhnlich aufwuchs, vielleicht aber für andere auch wieder auf sehr gewöhnliche Weise. Auf jeden Fall war ich in vielerlei Hinsicht anders als die anderen, und das wiederum störte mich als Kind enorm. Aber um diese Andersartigkeit definieren zu können, müsste ich tief in meiner Erinnerungskiste graben und eigentlich sehr viel Intimes preisgeben. Dafür reicht uns heute die Zeit nicht, aber ich werde darüber nachdenken«, antworte ich der erstaunten Fragestellerin.
Die Journalistin lässt sich damit nicht abwimmeln, sondern hakt nach: »Aber wer war Ihr Vorbild? Von was haben Sie sich als Kind leiten lassen? War es Ihr Glaube? Und waren Ihre Eltern auch schon so kämpferisch? Bitte, nur eine kurze Antwort!«
»Ja, weiß Gott – meine Eltern waren Kämpfer, wie viele in ihrer Generation. Aber sie waren für die damalige Zeit auch ungewöhnliche Abenteurer. Davon wurde mir offensichtlich viel in die Wiege gelegt. Und trotzdem habe ich schon als Kind auf mein Bauchgefühl gehört und mich bei meinen Vorhaben von der eigenen Begeisterung leiten lassen. Wenn ich überzeugt bin, dann gehe ich den mir vorgenommenen Weg, egal was andere Menschen – Vater, Mutter, Familie, Nachbarn, ja die ganze Welt um mich herum – davon halten. Das war schon immer so und hat mich unweigerlich in so manchen Konflikt mit meiner Umgebung geführt«, antworte ich der Journalistin und entschwinde kurz darauf auf die Bühne, um mit meinem Vortrag zu beginnen.
Heute, drei Jahre später, forsche ich nach und gehe diesen Fragen auf den Grund. Nicht nur, weil mich jene Journalistin zum Nachdenken gebracht hat, sondern weil ich eine große Leserschaft habe, die mir teilweise ähnliche Fragen stellt. Allem voran immer wieder Schüler, die Arbeiten über mich und meine Bücher schreiben wollen. Da ist aber auch die große Menge an Briefen und Mails, in denen mir Menschen von ihren persönlichen Nöten und Problemen berichten – Menschen, denen ich durch meine Bücher etwas Licht, Mut und Hoffnung geben kann.
Genau für solche Menschen, aber auch für mich, tauche ich tief in meine Kindheit zurück und suche nach dem Rezept für mein heutiges Ich. Dabei wird vieles Schöne und weniger Schönes bis Schmerzvolles wieder in mir hochsteigen. Doch ich bin überzeugt, dass dieses Buch auch einigen Menschen helfen kann, die manchmal im Begriff sind zu verzweifeln und nicht mehr an sich glauben.
Auch in meiner Jugend war nicht alles easy-going, und ich hatte viele Kämpfe auszutragen. Ich werde über einiges berichten, was selbst meine Eltern bis heute nicht wussten.
Liebe Mutter, lieber Vater, auch wenn schmerzliche Worte geschrieben werden sollten, verzeiht mir, denn ich schreibe aus der Erinnerung und vieles aus der Sicht des jungen Mädchens Corinne. Das betrifft speziell auch dich, Vater. Heute haben wir den Weg zueinander gefunden – nach schwierigen Jahren. Ich genieße unsere Treffen, denn jetzt sehe und erkenne ich deine Stärken sowie deine Lebensweisheiten an, auch wenn wir nicht immer gleicher Meinung sind. Und dein Erbe an mich ist die Liebe zur Natur. Das wiederum ist mein Schlüssel zum Glück und zur Zufriedenheit. Liebe Eltern, ich weiß, ihr habt euer Bestes gegeben, für mehr war keine Zeit und keine Energie!
Drehbuch des Lebens, auch dir gebührt Dank, denn bis jetzt war mein Leben spannend und eine große Herausforderung! Alles, was passierte – Positives wie Negatives –, hat mich letztlich zu dem Menschen geformt, der ich heute bin: eine freie, selbständige, erfüllte und bisweilen starke Frau.
Nicht zuletzt aber hoffe ich, dass dieses Buch bei vielen Menschen persönliche Erinnerungen sowie das eine oder andere Schmunzeln hervorrufen wird.
Lugano, im Mai 2015
Ungeahnte Parallelen
Als ich den Plan fasste, der Frage auf den Grund zu gehen, wie ich zu der geworden bin, die ich heute bin, bin ich sehr schnell bei einer ganz anderen Frage gelandet: Wessen Blut fließt eigentlich durch meine Adern? Und was für einen Einfluss hat die Geschichte meiner Eltern auf mich gehabt? Ich habe viel mit ihnen gesprochen in den letzten Monaten, und noch während sie erzählten, wuchs meine Neugier, und mir wurde klar, dass mir wohl schon eine große Portion Abenteuer in die Wiege gelegt worden war. Deshalb erlauben Sie mir bitte, liebe Leser, dass ich Sie zuerst mit auf diese Spurensuche nehme.
Mein Vater stammt aus Ostdeutschland, meine Mutter aus dem Elsass. In der Hoffnung, dort eine Arbeit zu finden, reisten beide unabhängig voneinander 1955/56 in die Schweiz. Sie, die damals erst Neunzehnjährige, fand einen Job als Direktionsangestellte bei der Neuenburger Versicherung. Er als Bäcker-Konditor in einem Café ebenfalls in Neuenburg in der westlichen Schweiz.
Vater hatte schon in jungen Jahren viel gearbeitet. Nach der Bäcker-Konditor-Ausbildung und einigen kürzeren Anstellungen hatte es ihn kurz vor der Währungsreform aus dem östlichen Deutschland ins Ruhrgebiet gezogen. Der relativ guten Bezahlung wegen hatte er im harten Kohlenbergbau gearbeitet. Das bessere Salär hatte es ihm ermöglicht, seinen sportlichen Hobbys nachzugehen. Er war im Fechtclub, im Deutschen Alpenverein, und erst recht war er ein begnadeter Skifahrer. Und er besaß ein altes Motorrad. Sportlich gekleidet, oder wie in der Mitte der fünfziger Jahre üblich, mit Hut und Trenchcoat, machte er immer eine gute Figur. Es fiel ihm offensichtlich leicht, mit seiner Abenteuerlust und seiner gesprächigen Art die Menschen zu beeindrucken.
Vier Jahre baute er tausend Meter unter der Erde Kohle ab, bis ein Unfall sein Leben veränderte. Eines Tages brach eine massive Gesteinsplatte vom Stollen herunter und verfehlte nur knapp seinen Kopf. Sie schlug neben ihm an einem Eisenstempel, der zur Stützung diente, auf. Trotzdem zog er sich Verletzungen zu. Dies war für ihn ein Zeichen, nach neuen Ufern zu streben.
Ein befreundeter Kollege verhalf ihm 1955 zu der besagten Arbeitsstelle in Neuenburg in seinem angestammten Beruf als Bäcker-Konditor.
Neuenburg lag an einem malerischen See, wo sich sonntags Jung und Alt an der Promenade trafen. Auch meine Eltern zog es dorthin. Mutter kam gerade aus Colmar zurück, wo sie eine Woche lang ihre kranke Großmutter gepflegt hatte. Im Wohnheim für junge Frauen, wo sie über ein Zimmer verfügte, erfuhr sie, dass sich die anderen Mädchen am See verabredet hatten. Neugierig schlenderte sie zur Promenade und erblickte ihre Kolleginnen beim Schäkern mit ihr unbekannten jungen Männern. Sie stellte sich dazu, musste aber feststellen, dass sie keine große Beachtung fand, da untereinander gekichert und gelacht wurde. So etwas war sie nicht gewohnt. Sie, die oft das »schönste Mädchen Colmars« genannt wurde, bekam normalerweise mehr Aufmerksamkeit. Als sie schließlich ihren Freundinnen vorschlug, Kaffee trinken zu gehen, antwortete ihr einer der jungen Männer, mein späterer Vater: »Geh doch alleine, Mädchen, wenn du schon gehen willst …«
Das war also definitiv keine Liebe auf den ersten Blick. Mutter fand diesen jungen Bäcker eingebildet und etwas arrogant.
Die Gruppe traf sich trotzdem immer öfter, und man verbrachte die Freizeit gemeinsam. Mal Schwimmen, mal Wandern oder gar Billardspielen waren angesagt.
Eines Tages schlug der junge Bäcker seinen Freunden vor, ein Abenteuer-Wochenende in der Natur zu verbringen. Der Plan stieß auf große Begeisterung, und kurz darauf wurde er in die Tat umgesetzt.
Die gemischte Gruppe marschierte stundenlang durch das schöne Juragebirge, und Mutter mit ihren langen Beinen eilte bald voraus, während der Rest der Mädchen langsam ermüdete. So imponierte sie dem Bäcker doch noch, und mit der Zeit hatte er nur noch Augen für sie. Beim anschließenden Campieren am offenen Lagerfeuer rückten sie näher zusammen, und plötzlich wurde aus Mutters Antipathie mehr als Sympathie.
Es bedurfte aber noch einiger Touren zu zweit, bis die beiden offiziell ein Paar wurden. Mutter gefiel, dass der sieben Jahre ältere, hübsche und sportliche Mann ihr, der neunzehnjährigen, unerfahrenen Frau, Abenteuer-Touren in der Natur bieten konnte.
Einige Monate später zogen die beiden bereits zusammen, denn damals durfte weder sie noch er Besuch auf dem Zimmer empfangen. Mutters Vater, also mein Großvater »Papapa«, wie ich ihn später nannte und den ich über alles liebte, war mit ihrer Wahl aber alles andere als einverstanden. Ausgerechnet einen Deutschen, gut zehn Jahre nach dem Krieg! Das war für ihn zuerst unvorstellbar. Zudem Vater auch noch »nur« ein Bäcker-Konditor war. Großvater stellte sich für seine einzige Tochter etwas Besseres vor und drohte der noch Minderjährigen, die Unterschrift fürs Wohnheim zu entziehen, damit sie nach Colmar zurückkommen musste.
Daraufhin »flüchteten« beide nach Genf und nisteten sich in einem heruntergekommenen ehemaligen Hotel ein. Beide fanden erneut Arbeit, sie bei der Genfer Versicherung, er erneut in einer Bäckerei.
Mein Vater schwärmte immer wieder von seinem Traum, mit einem Motorrad bis ans Schwarze Meer zu fahren. Eigentlich war es bereits ausgemachte Sache, diesen Traum mit seinem Kumpel und ehemaligen Arbeitskollegen Gerd in die Tat umzusetzen. Aber nun sollte auch meine Mutter mit. Nachdem sie nur zwei Monate in Genf gearbeitet hatten, wollten sie nun diese Reise zu dritt antreten. Meine Eltern kannten sich damals erst seit einem halben Jahr. Mutters Vater durfte von dem Plan nichts erfahren, er hätte die Reise bestimmt mit allen Mitteln verhindert.
Mit dem angesparten Geld der jungen Frau wurde eine gebrauchte Lambretta, eine Art Roller, gekauft. Sie war klein, und somit musste an Gepäck gespart werden. Ein klitzekleines Zweierzelt und ein wasserfester Seesack mit je ein paar Wechselkleidern und zwei Schlafsäcken waren alles, was die beiden mitnehmen konnten. Nach dem Kauf der Lambretta blieben meiner Mutter noch 400 Franken, und mein Vater hatte den letzten Monatslohn von 800 Franken als Reisegeld dabei. Damit wurde im Mai 1957 die lange Reise Richtung Schwarzes Meer angetreten. Mutters Vater, der ja nicht einmal wusste, dass seine Tochter zwischenzeitlich in Genf gelandet war, ahnte nichts davon.
Von Genf aus, wo sie alle Zelte abbrachen, fuhren meine Eltern zunächst nach Österreich, wo in Innsbruck Vaters Kollege Gerd dazukam. Dann ging es weiter Richtung Triest, durch das ganze kommunistische Jugoslawien und, da die Grenze in Albanien geschlossen war, durch das Gebirge über Griechenland bis in die Türkei. Im Sommer erreichten sie den Bosporus in Istanbul. Auf der Reise hatten sie schon viel erlebt – alleine nur die Visabeschaffungen an den jeweiligen Grenzen – und hatten viele neue, interessante Eindrücke gesammelt. Doch hier in der türkischen Großstadt war es für meine Mutter ein Schock, als sie bemerkte, dass weit und breit keine einzige Frau zu sehen war, weder mit noch ohne Schleier. Die drei wurden angestarrt, da es nicht dem Alltagsbild entsprach, dass eine europäische Frau zusammen mit zwei Männern unterwegs war, und das auch noch auf einem Motorroller. Von nun an verfolgten gierige Blicke sie, und ein Unwohlsein beschlich sie alle. Doch das Trio brauchte einen Platz, um die Zelte fürs Nachtlager aufzubauen. Noch während sie sich an einer Kreuzung beratschlagten, setzte die plötzliche Dunkelheit des Orients ein. Da tauchte wie aus dem Nichts eine Gestalt in einem langen, weißen Kaftan auf – eine Frau! Sie sprach französisch. Damals war Französisch in vielen Ländern die Sprache der Bessergestellten.
Als klarwurde, was die drei Reisenden benötigten, deutete »die Frau in Weiß« an, ihr zu folgen, denn es sei viel zu gefährlich, ohne Bewachung in der Öffentlichkeit in einem Zelt zu übernachten. Kurz darauf stellte sich heraus, dass die mysteriöse Frau beim Gouverneur angestellt war, um seine Kinder zu unterrichten. Sie führte nun das staunende und etwas verunsicherte Trio in die Felsenfestung Rumeli Hisarı, wo sie in der Dunkelheit unter dem Schutz der Wachen des Gouverneurs ihre Zelte aufstellen durften. Diese Bewachung stand ihnen ganze drei Wochen lang zur Verfügung! Die »Frau in Weiß« kam ihnen wie ein Schutzengel vor.
Die kleine Gruppe erkundete gemeinsam Istanbul. Die beiden Männer nahmen die junge Frau in ihre Mitte, um sie so ein wenig vor den Blicken zu schützen. Sie trug zwar ein Kopftuch, das ihr junge Mädchen geschenkt hatten, sowie ihren einzigen Rock und ein T-Shirt. Doch ihre Größe und die Andersartigkeit ließen sich nicht verstecken. Und immer wieder kam es vor, dass sie im Gedränge in den Hintern gekniffen wurde oder gar direkt in die Brust. Im Jahre 1957 war die Türkei vom Massen-Tourismus noch weit entfernt. Das Straßenbild prägten Eselskarren, Mopeds, nur wenige Autos und wie erwähnt keine Frauen, nur Männer und ab und an Kinder.
Als ein Teppichhändler das Trio in sein Geschäft einlud, wurden sie zum Teetrinken eingeladen und bestaunten die prächtigen Teppiche, welche über großen Querstangen im Geschäft hingen. Die junge Frau begutachtete den einen oder anderen wunderschön gewobenen farbigen Teppich, während die Männer weiter Tee schlürften. Und plötzlich ging alles ganz schnell. Sie wurde in ein Hinterzimmer gezerrt und konnte in letzter Sekunde dem Angreifer in die Hand beißen, um Luft zum Schreien zu bekommen. Nun stürmten die beiden Freunde ins Hinterzimmer, um meiner Mutter zu Hilfe zu eilen. Kurz darauf standen alle drei wieder auf der Straße, wo sie die Flucht ergriffen. Dies war wirklich der übelste Angriff auf der ganzen Reise, wie Mutter beteuert.
Ansonsten gab es auch viele schöne Momente, vor allem im Garten des Gouverneurs. Die »Frau in Weiß« servierte unbekannte orientalische Häppchen mit Gurken und Tomaten, und sie konnten sich ungestört unterhalten. Sie ließ ausrichten, dass der Gouverneur Interesse hätte, die junge französische Ausländerin als Französischlehrerin für seine Kinder zu engagieren. Mutter lehnte dankend ab, da sie ja nicht alleine unterwegs war.
Die »Frau in Weiß« brachte ihnen auch beim Lagerplatz immer wieder einmal Essen vorbei, da es nicht einfach war, mit einer jungen Frau irgendwo einzukehren. Zu diesem Zeitpunkt beschlich Mutter bereits allmorgendlich eine heftige Übelkeit bis hin zum Erbrechen. Kurz darauf stand fest, dass sie mit meinem älteren Bruder schwanger war.
Nach drei Wochen Istanbul entschlossen die zwei sich, die Rückreise anzutreten, und trennten sich von Gerd, der noch weiterreiste. Die lange Rückfahrt auf der Lambretta, und das noch im schwangeren Zustand, war für meine Mutter enorm anstrengend, zumal der Motorroller eines Tages auch noch streikte. Die Gangschaltung funktionierte nicht mehr und musste repariert werden. Mit Müh und Not fand sich ein anscheinend kundiger Mechaniker in einer Bretterbude, der den halben Motor auseinandernahm und wieder zusammensetzte. Schlussendlich blieben einige Schrauben übrig, und die Gangschaltung funktionierte wieder, aber ohne den ersten Gang, was das Anfahren zu zweit erschwerte.
Das Geld ging zur Neige, und die beiden ernährten sich hauptsächlich von Zwiebeln, Gurken und Salz. Nach knapp vier Monaten auf Reisen erreichten sie praktisch mittellos Deutschland – Bad Reichenhall. Es blieb ihnen nichts anderes übrig, als auf einem bescheidenen Campingplatz unterzukommen. Es war Herbst und kalt.
Nach ihrer Ankunft gingen sie zum nächstgelegenen Kiosk und kauften mit ihrem wenigen Geld eine Zeitung mit Schweizer Stellenangeboten. Während dieser kurzen Abwesenheit wurde ihr Zelt von Unbekannten aufgeschlitzt, und die wenigen Habseligkeiten wurden durchwühlt. Viel zu stehlen gab es nicht. Aber das Zelt war nun fast unbrauchbar und durchnässt. Die Kleider begannen nach einigen Tagen bereits zu schimmeln und zu stinken. Das junge Paar war am Ende, und niemand der anwesenden Camper half.
Da hatten sie doch in den durchreisten ärmlichen Ländern, etwa bei der Überquerung der kargen, trockenen Gebirgsketten, wesentlich mehr Gastfreundschaft und Hilfe erfahren dürfen. Als ihnen unterwegs einmal das Trinkwasser ausgegangen war, hatte ihnen eine kinderreiche Familie etwas von ihrem angeboten, das sie erst aus dem tiefen Schacht ihres bescheidenen Steinhauses heraufhieven mussten. Ein weiteres Mal, hoch oben in den Bergen, waren sie auf eine, wie ihnen schien, verlassene kleine Hütte gestoßen. Als sie eingetreten waren, hatten sie neben dem Feuerplatz eine kleine, ovale Strohwiege mit einem neugeborenen Baby darin erblickt. Weit und breit waren weder Menschen noch Tiere zu sehen. Überrascht hatte Mutter das Kleine auf den Arm genommen, als sich plötzlich die Tür öffnete und eine junge Frau im Raum stand. Ruhig schaute sie ihre ungewollten Gäste an und versuchte sich mit ihnen zu verständigen, was jedoch nicht recht gelingen wollte. Stattdessen bot sie lächelnd jedem der Unbekannten eine Schale Buttermilch an.
Von dieser unvorstellbaren Gastfreundschaft waren sie hier auf dem Campingplatz in Vaters Heimatland meilenweit entfernt. Sie erlebten die pure Verzweiflung.
Nach dem Durchforsten der Zeitungsinserate und mit letzter Kraft fuhren sie weiter in die Schweiz, wo der junge Mann bald darauf Arbeit in einer Bäckerei in Frauenfeld im Kanton Thurgau fand und sie eine Haushaltsstelle bei derselben Familie. Meine Mutter musste die fünf Kinder betreuen sowie im Haushalt mithelfen. Das Ganze ohne Lohn, aber gegen Kost und Logis. Das Zimmer war sehr klein und bescheiden für zwei Personen. Doch ohne Geld waren sie darauf angewiesen, dass sie überhaupt irgendwo zu zweit untergekommen waren. Die junge Frau, immer noch nicht volljährig, trug ja bereits ein Kind unter dem Herzen, obwohl die beiden noch nicht einmal verheiratet waren. Da brauchte es im Jahre 1957 sehr viel Glück.
Die Schwangerschaft schritt voran, und sie suchten verzweifelt eine größere Wohnung. Eine ältere Dame erbarmte sich ihrer und vermietete ihnen ohne Anzahlung eine Zweizimmerwohnung. Nur mit dem Wenigen, was sie besaßen, zogen sie ein. Um das Wohnzimmer behaglicher zu gestalten, wurde der leere Reisekoffer am Boden aufgeklappt und eine bunte Decke darübergelegt, damit überhaupt etwas im Zimmer stand. Daneben bastelte der bereits damals eisenbahnbegeisterte Vater aus alten Zeitungen Eisenbahnschienen und einen Papierbahnhof dazu. Auch dies wurde für mehr Behaglichkeit im Wohnzimmer aufgebaut. Die wenigen Kleider hingen am Fensterbrett, da kein Schrank vorhanden war. Die zwei schliefen auf dem Boden in ihren Schlafsäcken. Die werdende Mutter war jetzt bereits im achten Monat schwanger. Mit dem ersten neuverdienten Geld wurden ein Secondhand-Kinderbett sowie Matratzen für die werdenden Eltern gekauft.
Zwischenzeitlich hatten die beiden die standesamtliche Hochzeit beantragt, da ihr Kind nicht unehelich zur Welt kommen sollte. Sie befürchteten ansonsten, Probleme mit den Behörden zu bekommen. Beide waren in der Schweiz Ausländer und nur »Jahresaufenthalter«. Doch die Papiere aus Frankreich ließen auf sich warten. Immer wieder erkundigte sich die werdende Mutter bei der Standesbeamtin. Als der Geburtstermin näher rückte und nur noch ein Papier fehlte, drückte die mitfühlende Beamtin ein Auge zu, und es konnte geheiratet werden. Mutter rief Vater bei der Arbeit an, und er erschien mit einem Arbeitskollegen als Trauzeugen. Die zweite Trauzeugin wurde durch die Standesbeamtin direkt auf der Straße angesprochen. Die Hochzeit verlief unspektakulär, und nach der kurzen Zeremonie eilte Vater zurück zur Arbeit.
Vier Tage später erblickte mein Bruder Marc als Ältester das Licht der Welt, und nur zwei Jahre darauf, am 4. Juni 1960, wurde ich geboren.
Erst durch das Aufschreiben dieser Geschichte wird mir persönlich mehr und mehr bewusst, welche Parallelen das Leben meiner Eltern und mein eigenes haben. Wenn mir meine Mutter heute mit 77 Jahren diese Geschichte erzählt, erinnert sie mich unweigerlich an meine eigenen Erfahrungen und vor allem an meine Schwangerschaft.
Wie habe ich noch hart gearbeitet in meinem Shop in Barsaloi/Kenia, als ich schon meine Tochter Napirai unter dem Herzen trug! Wie viele Male musste ich mich übergeben, nicht vor Schwangerschaftsübelkeit, sondern durch die mehrmalige Malariaerkrankung. Hunger und Durst kannte ich zur Genüge. Ja, und nicht zuletzt schlief auch ich mit dickem Schwangerschaftsbauch auf dem Boden. Allerdings nicht im Schlafsack, sondern auf einem Kuhfell. Sogar einer meiner Trauzeugen musste ebenfalls von der Straße geholt werden, was allerdings in Maralal, wo wir heirateten, noch um einiges komplizierter war. Viele Afrikaner besaßen damals keine Ausweispapiere, trugen sie nicht bei sich oder konnten weder lesen noch schreiben. Und auch bei meiner Hochzeit war leider niemand von meiner Familie anwesend. Was für Parallelen, die mir erst durch dieses Aufschreiben dreißig Jahre später wirklich bewusst werden!
Mein Vater, dä Schwob
1963 war ich gerade drei Jahre alt, und ich kann mich natürlich heute an diese Zeit nicht mehr erinnern. Aber meine Mutter erzählt mir nun, fünfzig Jahre später: »Ach, du warst schon ein braves Kind. Hast mir eigentlich nie Kummer gemacht, als du klein warst, im Gegensatz zu später. Einmal, als du noch ein Baby warst und ich schnell mit deinem älteren Bruder zum Zahnarzt musste, habe ich dich bei offenem Zimmerfenster in deinem Bettchen gelassen. Als ich zurückkam, hast du dieses eine Mal laut geschrien. Da wusste ich sofort, es muss etwas Ungewöhnliches vorgefallen sein! Als ich ins Zimmer kam und nachschaute, sprang doch tatsächlich eine Maus aus deinem Bettchen. Sie muss dir übers Gesicht gelaufen sein – denn angeknabbert warst du nicht. Doch sonst … nein, geweint hast du nie. Nicht einmal, als ich dein Essen vergaß, weil ich deinen kleineren Bruder stillen musste.«
Ja, so ist das wohl, wenn man zwischen zwei Brüdern aufwachsen muss. Ich war das »Sandwich-Kind«.
Meine Mutter erinnert sich weiter: »Ich kann nicht sagen, dass du ein ausgesprochen fröhliches Kleinkind warst, aber genügsam und anspruchslos. Du konntest dich schon früh alleine beschäftigen. Zum Beispiel, wenn du samstags von der nahe gelegenen Kapelle die Kirchenglocken gehört hast, da wusstest du, jetzt findet wieder eine Hochzeit statt. Du hast deine Sandalen angezogen und bist im Röckchen die kleine, steile Straße hinuntergetippelt und hast gewartet, bis die Brautleute aus der Kirche kamen. Du wusstest, dass sie die bunten »Feuersteine« zu den Zuschauern werfen werden. Du hast sie dann eifrig aufgesammelt und bist mit strahlendem Gesicht und vollen Rocktäschchen wieder nach Hause getippelt. Danach konntest du dich stundenlang mit diesen dunkelblauen, feuerroten, gelben oder giftgrünen viereckigen Bonbons beschäftigen, bis dein großer Bruder kam und dir welche streitig machte. Du warst schon als ganz kleines Mädchen eine Sammlerin. Später ging das weiter mit Blümchen, Beeren, Hagebutten, Schnecken oder Muscheln – sogar Briefmarken kamen für kurze Zeit dazu.«
Meine Mutter blickt mich an und erzählt weiter: »Ich kann mich noch erinnern, als du ungefähr acht Jahre alt warst. Du hast wie immer große weiße Weinbergschnecken eingesammelt und ihre Häuser mit einem Filzstift mit Namen versehen, weil du sie am nächsten Tag wiedererkennen wolltest. Einmal hattest du etwa vier oder fünf solcher Schnecken in ein großes Glas gesteckt und mit einem Papier, in dem kleine Luftlöcher waren, abgedeckt. Du hattest sie über Nacht auf dein Bücherregal gestellt, und als ich dich morgens für die Schule wecken musste, krochen diese Viecher in einer Schleimspur an den Zimmerwänden entlang. Ja, du hattest manchmal schon ungewöhnliche Spielideen«, schmunzelt Mutter.
»Später, als du schreiben konntest«, fährt sie fort, »hast du mir die bereits vorfrankierten Postkarten abgestaubt, um sie an diverse Firmen zu senden, mit der Bitte, dir Firmenlogo-Abziehbilder zuzustellen. So kamen immer mal wieder Kuverts mit verschiedenen Motiven, die du dann in der Schule getauscht hast. Einmal war ein Pneuhändler dabei, ich glaube, Firestone. Die haben dir zwei riesige Klebebilder geschickt, die du sogleich in der Schule verkauft hast. Ja, ja, geschäftstüchtig warst du schon früh!«
Mein heute vierundachtzigjähriger Vater weiß zu berichten, dass 1963 in seinem Leben eine große Wende eintrat. Er war bei einer Sonderfahrt mit einer AE6-Lokomotive Richtung Bellinzona dabei. Mein Vater, der ein großer Eisenbahnfan ist und in seiner Freizeit schon etliche Male die gesamte Gotthardstrecke abgewandert war, weiß natürlich an diesem Tag bestens Bescheid. Nicht zuletzt auch wegen des Modelleisenbahnclubtreffens, dem er ab und an beiwohnen kann. Nun fährt er als Besucher die Gotthardstrecke mit, und sein präzises Wissen fällt sogleich einem Bahningenieur auf. Der wundert sich, dass ein Deutscher diese Strecke wie seine Hosentasche kennt und zudem noch die Details zur Schweizer Bahngeschichte. Er sagt anerkennend: »Solche Leute braucht die Schweizer Bundesbahn!«
Tatsächlich wird Vater zwei Wochen später zum Gespräch eingeladen, obwohl er Deutscher ist. Zu jener Zeit gibt es keine Festanstellungen für Ausländer bei der SBB. Und Vater hat noch nicht einmal die definitive Niederlassungserlaubnis für die Schweiz. Doch er überzeugt beim Vorstellungsgespräch in Zürich und wird danach zum Gesundheits-Check zum Schweizer Militärarzt in Winterthur geschickt. Schließlich geht es später um eine Pension aus der Schweizer Staatskasse! Nach weiteren Abklärungen, ob er die Arbeitsstelle als Ausländer wechseln könne, ohne seinen Aufenthaltsstatus in der Schweiz zu verlieren, sowie Mahnungen seitens der Behörde an die SBB, man solle sich dies gut überlegen, er sei schließlich ein Schwob (Deutscher), bekommt er die Stelle doch.
Vater wird zwar nicht Beamter, aber als erster Ausländer, wie man ihm mitteilt, bekommt er nach einer einjährigen Probezeit seine Festanstellung bei der Schweizerischen Bundesbahn – ein Traum geht für ihn in Erfüllung.
Wir ziehen von Frauenfeld nach Weesen im Kanton St. Gallen. Der neue Chef hat unserer zu dem Zeitpunkt schon fünfköpfigen Familie eine Wohnung in einem alten Haus einer Witwe beschaffen können. Wer bei der Bahn arbeitet, musste abrufbereit sein und deshalb in der Nähe des Arbeitsplatzes wohnen.
Der Anfang bei der neuen Arbeitsstelle ist schwer. Immer heißt es »dä Dütsch« oder »dä Schwob« und: »Was will der denn hier?!« Doch mein Vater geht beharrlich seiner Arbeit nach. Er ist nie krank und immer einsatzbereit, bei jeder Schicht und jedem Wetter. Zudem verdient er etwas mehr als bei seinem erlernten Beruf und braucht sieben Stunden die Woche weniger zu arbeiten, was ihm bald zugutekommt. Ehrgeizig, wie er ist, will er nämlich seinen Traum vom Eigenheim so schnell wie möglich verwirklichen. In seiner Freizeit berechnet und zeichnet er Pläne, und schon bald steht das Haus zumindest auf dem Papier. Weder Geld noch Land stehen ihm jedoch zur Verfügung. Nur der feste Wille und Glaube daran.
Neun Monate nach seinem ersten Arbeitstag bei der SBB, aber immer noch in der Probezeit, kauft mein Vater ein Grundstück. Wobei »Grundstück« die Sache fast nicht richtig trifft – eigentlich ist es ein unbrauchbarer Felsvorsprung, übersät mit kleinen Büschen und Dornen, abseits jeglicher Zufahrtsstraßen und ohne Wasser- und Stromanschluss. Es ist das Einzige, was mein Vater sich leisten kann. Dieser Felsen liegt auf einer Anhöhe zwischen zwei Bergbauernhöfen. Dort soll sein Haus entstehen. Seine Arbeitskollegen belächeln ihn und spotten: »Nur ein Schwob kann so etwas kaufen und meinen, er könne dort ein Haus bauen!«
Abenteuerlicher Hausbau
1965 bin ich fünf Jahre alt und darf endlich in den Kindergarten, der in einem Kloster angesiedelt ist.
Zu jener Zeit gehen in der Schweiz die Kinder mit fünf und sechs Jahren in den Kindergarten und mit sieben in die Schule. Für jüngere Kinder gibt es keine Betreuungsmöglichkeiten.
Oh, wie ich mich freue, denn zwischen meinen beiden Brüdern aufzuwachsen ist nicht immer nur schön, sondern auch echt anstrengend. Ich hoffe natürlich, im Kindergarten endlich eine Freundin zu finden. Die Klosterfrauen wirken auf mich etwas befremdlich in den langen schwarzen Schwesterntrachten und den eng anliegenden Kopfhauben. Sie gehören dem Kloster »Maria Zuflucht« an.
Ich merke schnell, die Regeln sind streng. Wir dürfen nur mit Rock und darüber gebundener Schürze erscheinen. Hosen für Mädchen sind tabu. Die Haare müssen zu Zöpfen geflochten oder zu einem Pferdeschwanz hochgebunden sein. Schuhe sind nur mit Kniestrümpfen zu tragen. Es wird gesungen, gebastelt und gebetet. An viel mehr kann ich mich nicht erinnern. Oh doch, an den Fotografen, der einmal im Jahr für das Erinnerungsfoto vorbeikommt. Da herrscht immer große Aufregung, und die Schwestern sind bedacht, uns ins beste Licht zu rücken. Jedes Kind wird einzeln an den für die Aufnahme vorgesehenen Tisch gesetzt. Wir Mädchen dürfen uns endlich für einen kurzen Moment der Schürze entledigen. Dann werden wir so auf einem Stuhl plaziert, dass der rechte Arm waagerecht auf der Tischplatte liegt, und in den linken bekommen wir endlich die riesige Puppe mit dem rosa Rüschenkleid gelegt. Sie ist fast so groß wie ein echtes Baby. Das ganze Jahr über sitzt sie auf einem Gestell weit über unseren Köpfen und schaut uns wohl zu. Doch spielen dürfen wir nicht mit ihr. Sie ist nur für die Fototermine bestimmt und muss nach getaner Arbeit wieder schön säuberlich zurück aufs Wandbrett, was uns Mädchen natürlich leidtut. Aber umso mehr freuen wir uns auf das folgende Jahr und den neuen Fototermin.
Schon nach einigen Tagen im Kindergarten habe ich eine Freundin. Bin ich glücklich, obwohl sie nicht unbedingt dem Mädchen entspricht, das ich mir freiwillig ausgesucht hätte! Aber wir haben denselben Heimweg, und so hat es sich halt ergeben. Mit ihrer sehr hellen Haut, den rötlichen Haaren und den vielen Sommersprossen sieht sie etwas anders als die meisten Mädchen aus. Doch Hauptsache, ich habe eine Freundin! Von nun an verbringen wir viel Zeit zusammen. Wir klettern auf Nussbäume oder spielen Verstecken. Auch an der großen, strömenden Linth halten wir uns öfter auf. Ich darf sogar auf ihrem Fahrrad so lange üben, bis ich alleine fahren kann. Meine weißen Strümpfe sind schon bald mit Kettenöl verschmiert. Doch ich bin stolz, dass ich es geschafft habe, ohne zusätzliche Hilfe zu fahren. Nur die weißen gehäkelten Kniestrümpfe sind nicht mehr zu retten, was meine Mutter nicht erfreut, denn ich besitze gerade mal zwei Paar davon.
Während meiner Kindergartenzeit beginnt bereits der Hausbau im sechs Kilometer entfernten Nachbarort, und unser Kinderleben verändert sich. Wenn meine Mutter auf die Baustelle geht, bin ich plötzlich für meinen vierjährigen Bruder verantwortlich. Bei schönem Wetter und wenn Vaters Schichtplan es zulässt und das Geld für Baumaterial reicht, wird der Hausbau von unseren Eltern eigenhändig in Angriff genommen. Zuerst roden sie den mit dornigen Büschen bewachsenen Felsvorsprung, und dann sprengen sie mit Hilfe des Nachbarn den Felsen ab, damit eine gerade Ebene entsteht. Der Bauer fährt gegen Entgelt mit seinem Aebitransporter, der dieses steile Gelände meistern kann, das Baumaterial vom Dorf unten auf den Bauplatz hoch. Eine richtige Straße gibt es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Auch das ganze Material muss von gutwilligen Bauunternehmern für uns besorgt werden, da es noch keine Baumärkte wie Obi gibt. Schwere Arbeiten lasten von nun an auf den Schultern unserer Eltern.
Bei schönem Wetter drückt mir nun meine Mutter den vierjährigen Bruder Eric an die Hand und schickt uns gemeinsam in den Kindergarten. Mein älterer Bruder Marc besucht bereits die Schule.
Wie ich es hasse, den kleinen, weinenden Bruder mitzuschleppen! Er will bei Mutter bleiben und nicht mitkommen. Ich hingegen werde von den Schwestern heftig gerügt, weil ich ihn trotz Verbot immer wieder anschleppe.
Einmal kommt die ältere Ordensschwester mit ihrem Gesicht sehr nahe zu mir, schaut mich durch ihre runden Brillengläser durchdringend an und schimpft erneut: »Corinne, wie oft muss ich es noch sagen? Du bringst jetzt deinen Bruder sofort wieder nach Hause, er ist viel zu jung und gehört nicht hierher!«
Und zu Hause höre ich von meiner Mutter: »Corinne, du nimmst deinen Bruder wieder mit! Ich muss auf die Baustelle und kann ihn da nicht brauchen. Im Kindergarten wird es wohl auf einen mehr oder weniger nicht ankommen.«
Diese ständigen Diskussionen erschweren mein Kinderleben und die Kindergartenzeit erheblich. Ich verstehe einfach nicht, warum immer ich die »Angebrüllte« sein muss, wenn es doch eigentlich um meinen Bruder geht.
Manchmal mag ich ihn gar nicht mehr so sehr und beneide hingegen meinen zwei Jahre älteren Bruder Marc, weil er schon die Schule besuchen kann.
Nach Kindergartenschluss marschieren wir Kinder meist zu zweit, manchmal auch zu dritt auf die Baustelle rauf. Ein sechs Kilometer langer Fußmarsch – alleine! Wir laufen von Weesen am Waldweg entlang, neben dem ein kleines Bächlein fließt. Je nach Jahreszeit, können wir die süßen Walderdbeeren in den Mund stecken, oder wir saugen den roten Kleeblüten den Nektar aus. Manchmal, wenn der Magen knurrt, beißen wir auf Sauerampferblättern herum, essen Buchenkerne oder Haselnüsschen.
Noch heute denke ich bei meinen vielen Wanderungen mit einem Schmunzeln an diese Erlebnisse zurück und bin überzeugt, dass damals der erste Grundstein für mein Naturbewusstsein gelegt worden ist.
Kurz vor dem Schießstand, den wir nicht betreten dürfen, müssen wir in den alten Römerwanderweg einbiegen und durch den Wald den »Römerberg« hochlaufen. Aus den Bäumen hervortretend erblicken wir schon den Rauch der Müllhalde. Mitten auf den saftigen grünen Wiesen liegen riesige Abfallberge. Auch da dürfen wir uns nicht aufhalten. Nun ist noch ein kleines Tobel, ein Waldtal, zu bewältigen, und schon kommt die Baustelle in Sicht, und unser Ziel ist erreicht.
Mutter mischt in einer Art Trommel Zement, und Vater gießt das Fundament. Wir Kinder können uns nicht vorstellen, dass hier einmal unser Zuhause stehen soll. Mitten im Wald, ohne Straße und nur durch einen Wanderweg erreichbar. Nachdem wir unsere Zuckerbrote verspeist haben, helfen wir mit, so gut es geht. Ich hole im nahe gelegenen Bach Wasser, und mein älterer Bruder Marc reicht dem Vater Steine, damit er die Mauer bauen kann. Wir lernen früh zu arbeiten oder uns selber zu beschäftigen.
Jedes Mal, wenn wir im Laufe der drei Jahre, die der Hausbau dauert, wieder auf die Baustelle kommen, sieht es dort anders aus. Das Haus gedeiht. Ein eigentliches Baugerüst gibt es nicht. Mutter steht auf Brettern zwei Meter über dem Boden und zementiert die Parasolsteine aneinander. Vater tut an einer anderen Ecke dasselbe. Ab und an helfen noch zwei, drei Bekannte mit.
Einmal sind auch Omi und Opa aus Ostdeutschland da und helfen. Wir Kinder kennen sie nicht so gut, da sie durch die Teilung Deutschlands erst ausreisen dürfen, nachdem Opa pensioniert wurde. 1963 sind wir aber einmal mit der ganzen Familie nach Dresden gereist, haben da Omi und Opa das erste Mal kennenlernen können und sind mit ihnen in den Zoo gegangen. Ich kann mich nur an den Zoobesuch erinnern – ich nehme an, weil ich schon als kleines Kind von Tieren fasziniert war. Ich war damals erst drei Jahre alt, Marc fünf und Eric gerade mal ein Jahr.
Wenn wir abends die Baustelle verlassen, marschieren wir Kinder mit Mutter wieder den Berg herunter und fahren nun mit dem Zug nach Weesen zurück, während Vater die Spätschicht bei der Bahn antritt.
Während der drei Jahre, die der Hausbau dauert, pendeln wir Kinder etwa anderthalb Jahre bei schönem Wetter hin und her. Unzählige Male laufen wir diese Strecke von Weesen über den Römerberg auf die Baustelle. Heute ist es kaum mehr vorstellbar, dass so junge Kinder alleine eine solche Strecke zurücklegen. In der heutigen Zeit fahren die meisten Eltern ihre Sprösslinge jeden Alters durch die Gegend. Wenn ich zu den Schulzeiten durch Lugano fahre oder wo auch immer, stehen ganze Autokolonnen vor den Schulgebäuden und laden Kinder auf oder ab. Ich kann das nicht verstehen, da doch gerade der Schulweg eine wichtige Erfahrung ist und die Kinder sich mit ihren Freunden austauschen können. Man lernt sich zu behaupten, auch wenn es nicht immer einfach ist. Wir haben auf dem Schulweg Schneeballschlachten veranstaltet oder auch mal handfeste Auseinandersetzungen gehabt. Dafür aber auch Freundschaften geschlossen und die großen und kleinen Geheimnisse ausgetauscht, bevor die Schule begann. Die Kinder übernehmen Eigenverantwortung und lernen Situationen einzuschätzen. Das Selbstbewusstsein wird gestärkt, auch wenn nicht immer alles rund läuft. Und die Mütter? Wäre es nicht schöner, wenn sie nicht ihr halbes Leben mit Fahrdiensten verbringen müssten? Wo bleibt denn ihr eigenes Leben?
Die Zeit vergeht, und das Haus ist praktisch fertig, als wir Mitte 1967 einziehen. Mit dem Aebitransporter findet der Umzug statt. Als der letzte Tag in Weesen gekommen ist, muss ich mich von meiner ersten Freundin trennen. Sie bittet mich noch um ein letztes Treffen hinter dem Haus an der nahe gelegenen Linth, da sie mir ein kleines Geschenk überreichen möchte. Natürlich versprechen wir uns, uns gegenseitig zu besuchen. Wir stehen an der Wassermessstation, als sie plötzlich ein Küchenmesser hinter ihrem Rücken hervorzieht und mich damit bedroht. Aufgeregt schreit sie: »Du wirst mich nicht verlassen, du Verräterin, Verräterin!« Erschrocken schaue ich in ihr sommersprossenübersätes Gesicht, verspüre beim Anblick der plötzlich tränenüberströmten Freundin Mitleid, aber auch Angst. Schlussendlich siegt die Angst, und ich eile ohne Abschied zum Haus zurück. Ich spreche mit niemandem darüber, da alle mit dem Umzug beschäftigt sind und ich keine Aufregung verbreiten möchte. Endlich fährt der Aebitransporter los. Der Abschied fällt mir nun leichter als gedacht.
Im Laufe meines bisherigen Lebens habe auch ich Freundinnen verloren. Aus unterschiedlichen, manchmal für mich auch unerklärlichen Gründen. Gerade, wenn für einen selbst der Grund nicht ersichtlich ist, tut es verdammt weh. Denn einander Freundin zu sein heißt auch, sich gegenseitig ins tiefste Innere schauen zu lassen und sich persönliche Geheimnisse und Wünsche anzuvertrauen. Plötzlich entfernt sich eine solch vertraute Person aus deinem Leben, und du weißt nicht, warum. Sie nimmt deine ganzen Offenbarungen mit, und du weißt nicht, was damit passiert. Ist es einfach plötzliches Desinteresse? Ist es Neid auf deinen Erfolg, die Unabhängigkeit oder was auch immer? Oder hast du in einer gewissen Situation falsch reagiert? Freundschaften sollten doch ein unbeabsichtigtes Missgeschick aushalten können – oder kann man sich so täuschen lassen? Solche Gedanken beschäftigen mich lange, doch ehrliche Antworten gibt es meistens keine mehr.
Wie musste wohl meine kleine Freundin in Weesen gelitten haben, wenn sie meinen Wegzug als Verrat empfand und schon als Siebenjährige ein Messer gegen mich richtete!
Leben am Berg
Als wir nun unser Grundstück mit dem Aebitransporter erreichen, ist dieses plötzlich von einem Stacheldraht umgeben. Davor steht die Bauersfrau, deren Mann der halbe Berg gehört, und somit auch das Grundstück, das von oben unmittelbar an das unsere angrenzt. In ihren schwarzen Gummistiefeln, breitbeinig dastehend und die Arme über der Blumenschürze aggressiv in die Hüfte gestemmt, brüllt sie uns Kinder an: »Merkt euch, dieser Zaun wird nicht übertreten, sonst passiert etwas!«, dann dreht sie sich um und stampft den Berg wieder hoch. Sie hat unseren Eltern schon während des Hausbaus verboten, an ihrem Bach Wasser zu holen, und deswegen schimpft Vater ihr an diesem Tag auch hinterher. In den kommenden Tagen ersetzt er den Stacheldraht durch einen normalen Zaun. Das ist ja ein Empfang! Ich weiß nicht, was schlimmer ist – meine Freundin, die zum Abschied ein paar Stunden vorher ein Küchenmesser auf mich richtete, oder diese wütende Alte und der Stacheldraht.
An das neue Leben am Berg muss ich mich erst gewöhnen. Wir haben nun keine unmittelbaren Spielkameraden mehr. Obwohl die andere Bauernfamilie reich an Kindern ist, sehen wir diese nicht allzu häufig. Ich bin froh, dass ich wenigstens mit meinem kleinen Bruder Eric etwas unternehmen kann. Marc, der Große, ist selten da, er hat schnell Anschluss bei den Pfadfindern gefunden, worum ich ihn beneide. Ich würde auch gerne mit anderen Kindern im Wald Abenteuer erleben. Aber eine »Mädchenpfadi« gibt es damals noch nicht. Trotzdem bin ich bei jedem Wind und Wetter draußen, klettere auf den Bäumen herum oder sammle Schnecken ein und beschrifte deren Häuschen. Auch zum »verbotenen« Bach schleichen Eric und ich ab und zu und stauen das Wasser so, dass wir darin spielen können. Meistens geht es gut, doch ab und an springt die »Alte von oben«, wie wir sie nennen, aus den Büschen und vertreibt uns mit lautem Geschrei und einem dicken Stock in der Hand. Erschrocken retten wir uns jeweils über den Zaun auf unser Grundstück und verstecken uns sogleich in unserem kleinen Kinderzimmer, welches wir Kinder uns zu dritt teilen müssen.
Abends ist es besonders schön, wenn man von unserem Berg auf das Dorf hinunterschauen kann. Die Lichter in den Häusern und auch die Straßenbeleuchtungen funkeln zu uns hoch. Beim ersten Sommergewitter, das wir auf dem Berg erleben, kauern wir Kinder uns erschrocken in Mutters Nähe auf dem Wohnzimmersofa zusammen und beobachten die langgezogenen Blitze auf der gegenüberliegenden Bergkette. Es ist unglaublich spannend, wann der nächste Blitz auftaucht, den Himmel erhellt und sich in einer züngelnden Bewegung spaltet wie eine Astgabel. Wir halten den Atem an und zählen die Sekunden, bevor der ohrenbetäubende Donner hinterhergrollt. Da wir am Hang wohnen und von Bergen umgeben sind, verstärkt sich der Knall ums Vielfache. Bei dem Getöse meine ich zu spüren, wie das ganze Haus leicht erzittert. Und dann schlägt der nächste ein: Der folgende riesige, langgezogene Blitz zuckt über die Bergkette, um dann plötzlich fast senkrecht in eine Baumgruppe zu fahren. Der Donnerhall erschüttert die ganze Gegend; wir ziehen automatisch die Köpfe ein und drücken uns ins Sofa. Als wir es wagen, wieder über den Sofarand zu äugen, steht ein riesiger Baum auf der gegenüberliegenden Talseite in Flammen.
Ängstlich schauen wir Vater an, und ich frage: »Papa, kann das Gewitter auch unser neues Haus zerstören?«
»Nein, außer, der Blitz schlägt auch hier in einen großen Baum ein, und der könnte dann aufs Dach fallen«, gibt er zur Antwort. Mein kleiner Bruder kauert sich nun in Mamas Schoß, während wir fasziniert, aber auch ängstlich das Gewitter verfolgen. Nach einer halben Stunde ist der Spuk vorbei, und nur die zuckenden Flammen und die Rauchschwaden vom brennenden Baum erinnern noch daran. Wir haben keinen Fernseher, aber wir empfinden das gerade Erlebte wie einen Krimi. Es soll nicht das letzte Gewitter bleiben, das wir am Berg erleben, und jedes Mal aufs Neue ist es faszinierend.
Noch schöner ist die Feier zum ersten August, unserem Nationalfeiertag. Als sie ein paar Wochen nach unserem Umzug stattfindet, kleben wir an unseren großen Wohnzimmerfenstern und warten gespannt, bis endlich das Feuerwerk im Dorf startet. Wir haben hier oben einen Logenplatz. Da es aber noch dauert, bis es endlich anfängt, schlägt Mutter vor: »Kommt, Kinder, lasst uns Karten spielen oder ein ›Mensch, ärgere Dich nicht‹, es dauert mindestens noch zwei Stunden.« Alle sitzen wir nun um den Esstisch und spielen das Brettspiel, auch Vater, obwohl er lieber Kartenspiele mag, aber dafür ist Eric noch zu klein. Mir gefällt es, wenn wir endlich mal alle zusammen sind und spielen. Durch den langen Hausbau war vorher keine Zeit dazu. Obwohl es dann doch meistens in Tränen für dasjenige Kind endet, das verliert. Doch an diesem Abend trocknen sie schnell, denn die ersten Raketen zischen unten im Dorf in die Höhe.
Sofort rennen wir auf unsere Terrasse hinaus, um alles noch besser zu sehen. Wir hören ein langgezogenes Zischen, dann einen Knall, und hernach explodieren über dem Dorf große bunte Farbkugeln, die ineinander verlaufen, um anschließend wie langgezogene Regentropfen langsam zurückzufallen und schlussendlich zu verglühen und am Himmel Platz zu schaffen für die nächste Ladung. Uns Kinder entfahren Ahhhhs und Ohhhhs, während wir das so noch nie gesehene Spektakel betrachten. Vergessen ist der lange Weg hoch auf den Berg. An diesem Tag bei dieser Aussicht wohnen wir am schönsten Platz.
Plötzlich ruft mein älterer Bruder: »Schaut da, ganz oben am Berg, da sind Feuer!« Ja, und nun sehen wir es auch. Gleich auf drei Berggipfeln können wir die legendären »Augustfeuer« erspähen. Als dann kurz vor Mitternacht plötzlich die schräg gegenüberliegende 400 Meter lange Felswand, das Mariawändli, zu brennen scheint, ist der Höhepunkt erreicht. Denn über die Wand wird die glühende Restkohle des riesigen Augustfeuers gekippt. Das sieht nun minutenlang wie ein Lavastrom aus – einfach gewaltig, und wir Kinder staunen glücklich.
Apropos Knall. Eines Tages kommt mein älterer Bruder Marc von den Pfadfindern nach Hause und zeigt mir eine Patronenhülse, die er in der Nähe des Schießstandes gefunden hat. Mit Ehrfurcht schaue ich auf das goldglänzende, konische Teil in seiner Hand, welches noch unverbraucht aussieht, was man am spitzen, kupfernen Köpfchen erkennen kann, wie mir mein Bruder stolz erklärt. Da es für uns aber verboten ist, diese Projektile aufzusammeln, bin ich echt beunruhigt und verpetze ihn deshalb kurz darauf bei unserer Mutter. Sie wiederum nimmt ihm die Patronenhülse unter lauter Schelte umgehend ab, und mein Bruder schimpft mich: »Du blöde Kuh, dir zeige ich nie mehr etwas!«
Als ich die Patronenhülse drei Tage später unter einem Stapel Handtücher erneut entdecke, gebe ich sie ihm verschwörerisch zurück, ohne dass Mutter davon erfährt. Zum Dank darf ich mitkommen, damit ich sehen kann, wie er die Patrone entschärft, schließlich ist er bereits elf Jahre alt. Dafür laufen wir zum nahe gelegenen Bachbett. Marc nimmt einen Stein und haut auf die Spitze der Hülse, die er auf einem weiteren, flachen Stein plaziert hat. Er möchte sie öffnen und das Schießpulver herausschütten. Aufgeregt, aber auch ängstlich stehe ich etwas abseits und beobachte, wie er immer und immer wieder mit einem Stein den goldglänzenden Gegenstand bearbeitet, während er davor kauert und überzeugt meint: »Ich muss sie entschärfen, dann kann nichts mehr passieren.« Mir ist bewusst, dass wir etwas Verbotenes tun, aber er ist mein großer Bruder und wird schon wissen, was er tut, denke ich.
Plötzlich höre ich einen fürchterlichen Knall, und mein Bruder fliegt rückwärts nach hinten, reißt seinen Mund zum Schreien auf, während er mit der einen Hand die andere umklammert und versucht, das hervorspritzende Blut zu stillen. In Panik renne ich nach Hause und schreie: »Maaaamaaaa! Marc ist vielleicht tot!« Mutter stürzt aus dem Haus und fragt erschrocken: »Was ist los? Was war das für ein Schuss?«, und da ich unter Schock nicht gleich antworten kann, rennt sie nach hinten zum Bach. Nach einigen Minuten kommen beide zurück, und Mutter hat ein riesiges Taschentuch um die verletzte Hand gebunden, damit das Blut einigermaßen gestoppt wird. Ich verstecke mich vor Schreck zitternd in dem Geräteschuppen neben unserem Haus, da ich den Anblick nicht ertragen kann und zudem Angst vor den Konsequenzen habe. Doch letztendlich ist es nicht ganz so dramatisch, wie es zunächst den Anschein machte. Mutter eilt mit Marc zum Arzt, wohlgemerkt zu Fuß, und es wird mit drei Stichen zwischen Daumen und Zeigefinger genäht. Wieder einmal ist ein Bubenstreich glimpflich verlaufen.
Ich hingegen spiele sowieso am liebsten draußen und klettere auf den Bäumen herum. Aber auch da lauern halt auf ein abenteuerlustiges Mädchen, das nicht unbedingt Prinzessin spielen möchte, große Gefahren. Wieder einmal hänge ich kopfüber nach unten an einem Baum, während ich den Ast in meinen Kniekehlen spüre. Dieser Kopfstandblick verändert die Welt, und während das Blut so langsam in meinen Kopf läuft, schaukle ich hin und her und beobachte die »verkehrte Welt«. Es ist einfach für mich, so rumzuturnen, da ich sportlich bin und zudem sehr dünn. Doch plötzlich knackt es, und der Ast bricht vom Baum weg, während ich Kopf voran Richtung Felsen fliege. Meine ausgestreckten Hände können den Aufprall zwar noch lindern, doch nicht ganz verhindern. Mit einem dumpfen Knall lande ich auf meinem Hinterkopf und verspüre augenblicklich einen stechenden Schmerz, während mir schlecht wird. Ich taste an meinen Hinterkopf und fühle ein feuchtes Loch. Als ich meine blutverschmierte Hand sehe, kann ich endlich losbrüllen. Mutter stürzt wieder einmal herbei und schaut sich das Drama an und bestimmt, dass ich sofort zum Arzt muss, da noch vereinzelte Steinchen im Kopf stecken und ich wohl eine Gehirnerschütterung habe, da ich mich weiter übergeben muss. Wie ich genau den Berg heruntergekommen bin, weiß ich heute nicht mehr. Ich kann mich nur erinnern, dass ich mich unten am Berg bei dem Holzschuppen, wo wir immer unsere Räder abstellen, hinten auf Mutters Fahrrad setze, mich an ihr festklammere und sie so mit mir zum Arzt fährt, während ich immer mal wieder mit einer Hand an den Kopf fasse, wo das Blut schon langsam zwischen den Haaren eingetrocknet ist. Die Wunde wird in der Arztpraxis gereinigt, einige Haare werden rasiert und mit der Pinzette die restlichen Steinchen entfernt. Ja, und dann müssen wir trotz Gehirnerschütterung erst mal wieder zurück auf den Berg marschieren, bevor ich mich dann ein paar Tage hinlegen muss und schulfrei bekomme. Noch heute habe ich einen flacheren Hinterkopf, wohl als Folge dieses Sturzes.
Neben den gelegentlichen Spielabenden mit den Eltern liebe ich auch den Samstagabend, wenn im einfachen Kamin ein Feuer lodert und wir gespannt dem Hörspiel im Radio lauschen dürfen, denn endlich besitzen wir ein ordentliches Gerät. Die verschiedenen Stimmen, mal laut, mal flüsternd, mal männlich, mal weiblich bis kindlich, ergreifen und zerren mich in Gedanken mitten ins Geschehen. Angespannt und Fingernägel kauend, hocke ich auf dem Sofa und brenne vor Neugierde, was als Nächstes passieren wird. Es ist mäuschenstill, während wir zuhören. Ärgerlich, wenn die Geschichte mittendrin aufhört und wir wieder eine Woche auf die Fortsetzung warten müssen. Aber zu Beginn entschädigen uns diese Abende für das plötzliche Abseitswohnen.
Als wir dann noch die frische Milch direkt vom Bauern unten am Berg beziehen, kann ich auch öfter bei ihm auf dem Hof mithelfen. Ich darf die Eier aus dem Hühnerstall holen, was allerdings nicht immer einfach ist. Die Hennen verteidigen ihre Brut manchmal ganz schön hartnäckig. Mit der Zeit erkennen sie mich wohl, und mein Händeklatschen beeindruckt sie recht wenig. Will ich mich anschleichen, legt die jeweilige Henne ihren Kopf leicht schräg und schaut mich aus roten, aggressiven Augen herausfordernd an. Sobald ich zu nahe komme, flattert sie mit den Flügeln, streckt ihren Kopf mit dem roten Kamm hervor und versucht, mit dem gelben Schnabel in meinen kleinen Handrücken zu picken. Manchmal braucht es wirklich Mut, um an die Eier zu gelangen. Doch von Hühnern lasse ich mich auch als Achtjährige nicht in die Flucht schlagen.