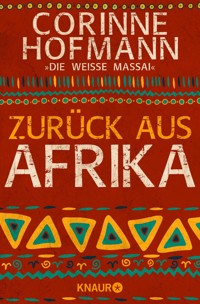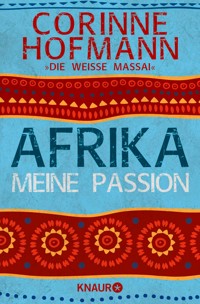9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Auf einer Urlaubsreise durch Kenia begegnet Corinne Hofmann dem Massai-Krieger Lketinga - und verliebt sich auf den ersten Blick in ihn. Sie verläßt ihren Lebensgefährten, zieht in den kenianischen Busch zu den Massai und heiratet Lketinga. Abenteuerliche Jahre folgen, Jahre der Liebe, aber auch des Verzichts und wachsender Probleme: Die Verständigung ist schwierig, die Ernährung ungewohnt, das Rollenverständnis völlig anders. Als ihre Tochter Napirai geboren wird, scheint sich doch noch alles zum Guten zu wenden...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 596
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Corinne Hofmann
Die weiße Massai
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Auf einer Urlaubsreise durch Kenia begegnet Corinne Hofmann dem Massai-Krieger Lketinga – und verliebt sich auf den ersten Blick in ihn. Sie verläßt ihren Lebensgefährten, zieht in den kenianischen Busch zu den Massai und heiratet Lketinga. Abenteuerliche Jahre folgen, Jahre der Liebe, aber auch des Verzichts und wachsender Probleme: Die Verständigung ist schwierig, die Ernährung ungewohnt, das Rollenverständnis völlig anders. Als ihre Tochter Napirai geboren wird, scheint sich doch noch alles zum Guten zu wenden …
Inhaltsübersicht
Widmung
Vorwort
Ankunft in Kenia
Auf der Suche
Ein langes halbes Jahr
Das Wiedersehen
Bürokratische Hürden
Abschied und Aufbruch
In der neuen Heimat
Meine Reise mit Priscilla
Begegnung mit Jutta
Glücklich in Maralal
Zurück in Mombasa
Krank im Kopf
You come to my home
Der Landrover
Gefahren im Busch
Zukunftspläne
Alltagsleben
Fremde Schweiz
Heimat Afrika
Behördenstreß
Malaria
Im Spital
Die Zeremonie
Pole, pole
Abschied und Willkommen
Standesamt und Hochzeitsreise
Unsere eigene Manyatta
Samburu-Hochzeit
Der Shop
Dschungelpfade
Die Frau des Lehrers
Angst um mein Kind
Am Todeshang
Der große Regen
Auszug aus der Manyatta
Flying doctor
Sophia
Napirai
Heimkehr zu dritt
Hunger
Quarantäne
Nairobi
Erholung in der Schweiz
Weiße Gesichter
Wird alles gut?
Mißtrauen
Zuspitzung
Verzweifelte Lage
Ohnmacht und Wut
Die gute Spucke
Neue Hoffnung
Bittere Enttäuschung
Ausweglosigkeit
Flucht
Dank
Bildteil
Anzeige
Für Napirai
Vorwort
Diese wahre Geschichte, die Sie jetzt gerade in Ihren Händen halten, habe ich vor 20 Jahren niedergeschrieben, und nie hätte ich geglaubt, dass sie so nachhaltig mein Leben verändern würde. Es ist eine außergewöhnliche Liebes- und Überlebensgeschichte, die mir vieles gab, aber auch alles abverlangte, was überhaupt in einem Menschen stecken kann. Noch heute muss ich beim Lesen oder Erzählen einiger Erlebnisse selber Tränen kullern lassen, wenn ich zum Beispiel daran denke, dass ich Malaria und Gelbsucht hatte, als ich schwanger war und diesen unendlichen Kampf um mein ungeborenes Baby kämpfte.
Heute kann ich es manchmal selber kaum mehr begreifen, wie viel ein Mensch aushalten kann, sei es physisch oder psychisch, und das freiwillig, denn was ich tat und erlebte und erlitt – es geschah aus LIEBE.
Dies alles hat Spuren hinterlassen, aber es hat mich zu einer starken Frau gemacht, die manchmal auch eine etwas andere Weltanschauung hat als vielleicht üblich. Ich genieße jeden Tag – und ich meine wirklich: jeden Tag – als etwas ganz Besonderes. Wer dem Tod einmal sehr nahe war, weiß, wie schnell alles vorbei sein kann, wie schnell das Leben nicht mehr das ist, was es war. Aber auch im positiven Sinne kann eine Sekunde dein Leben verändern – so wie es bei mir vor bald drei Jahrzehnten war, als ich meinen späteren Ehemann Lketinga zum ersten Mal sah. Himmel und Hölle waren in jenen Jahren sehr nahe beisammen.
Als Die weiße Massai1998 veröffentlicht wurde, hätte ich nie gedacht, dass meine Geschichte um die Welt gehen würde, und zwar noch zu Zeiten, als Internet, Facebook oder Instagram kaum eine oder keine Rolle spielten. Meine Geschichte wurde einfach von begeisterten LeserInnen weitererzählt, begleitet von vielen Fernsehauftritten, zu denen ich eingeladen wurde.
Noch heute bekomme ich schöne Mails, so wie diese:
Liebe Corinne,
ich wollte Ihnen nur einmal mitteilen, wie toll ich finde, was Sie im Leben erreicht haben. Ich lese gerade nach über zehn Jahren das Buch Die weiße Massai zum zweiten Mal. Ich finde, Sie sind eine unglaublich starke Frau. Das war speziell damals sicher nicht einfach. Ich weine noch immer an vielen Stellen bei dem Buch und kann es einfach nicht aus der Hand legen!
Ich wünsche Ihnen alles Gute & Gesundheit und vor allem Lebensfreude!
Sie sind ein Vorbild für viele Frauen!! VIELEN DANK!!!
Beste Grüße aus Thun, dem Berner Oberland:
Rebecca B.
Die weiße Massai scheint wirklich ein Buch zu sein, das viele LeserInnen – nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern weltweit – in verschiedenen Lebenslagen immer wieder zur Hand nehmen, um aus dem, was darin geschrieben steht, Kraft zu schöpfen. Ich kann es selbst kaum glauben, dass es auf der ganzen Welt Menschen gibt, die meine Bücher lesen – Die weiße Massai ist in über 30 Sprachen übersetzt worden. Das für mich Berührende daran ist, zu spüren, dass Menschen aller Nationen und Kulturen sich für außergewöhnliche Liebesgeschichten begeistern – vielleicht, weil jeder Mensch in diesen Erzählungen irgendwo seine Hoffnungen, Träume oder Wünsche wiedererkennt.
Auch auf meinen zahllosen Lesereisen durfte ich unglaublich viele schöne Momente erleben. Fast 20 Jahre habe ich immer wieder auf der Bühne gestanden und vor meist ausverkauften Sälen meine Erlebnisse schildern dürfen und so vielen Menschen Mut zur Veränderung gemacht – ja und nicht zuletzt auch Mut, sich anderen Kulturen zu öffnen oder zumindest mit Neugier zu begegnen. Nicht selten kam es vor, dass mir eine Zuhörerin beim Signieren leise zuflüsterte, dass sie heute, dank meiner Geschichte und meiner Erzählungen, Afrika und dessen Menschen anders gegenübersteht. Ich durfte manchmal eine Brückenbauerin zwischen Weiß und Schwarz sein.
Ich hielt auch auf Einladung großer Unternehmen Vorträge vor Managern. Das Verblüffende war, so mancher Mann änderte danach seine Vorbehalte mir und meiner Geschichte gegenüber, wie sich anschließend oft in manchmal sogar emotionalen Gesprächen herausstellte.
Und dann kommen Tage, da sitze ich da und denke: Mein Gott, das alles ist mir passiert. Dem Mädchen vom Berg, das früher in der Schule eher gehänselt wurde, beim Schreiben nicht die Bestnote erzielte und beim Vorlesen schon auch mal zu stottern begann (von diesem Teil meines Lebens erzähle ich in dem Buch Das Mädchen mit dem Giraffenhals). Damals hat wohl niemand mit mir auf der großen Bühne gerechnet, am wenigsten ich selbst. Aber: Es kommt meistens anders, als man denkt.
Afrika hat mich verändert – hat mir die Augen geöffnet für das Wesentliche im Leben. Für mich hat heute meine Gesundheit einen wichtigen Stellenwert, dazu gehören für mich die Natur und das Bergwandern. Aber das Allerwichtigste ist meine Tochter. Alleine dass es sie gibt, dafür hat sich jede Anstrengung, jede Unvernunft, jeder Schweißtropfen, jede Angst und jeder glückliche Moment gelohnt.
Sie ist auch das Bindeglied zwischen Afrika und der Schweiz. Sie erinnert mich immer wieder an meine Vergangenheit in Kenia, diese wird durch sie Gegenwart. Der Mutterinstinkt hat mich schlussendlich alles überleben lassen und später auch motiviert, nach vielen Jahren wieder zurückzukehren, um meinem Ex-Mann Lketinga, der ja ihr Vater ist, noch einmal gegenüberzustehen und um Verzeihung zu bitten. Denn vieles konnte er aus der Sicht seiner Kultur damals gar nicht verstehen. (Beschrieben in dem Buch Wiedersehen in Barsaloi.)
All die Jahre versuchte ich das Band zur Familie aufrechtzuerhalten, das war mir vor allem wegen meiner geliebten Schwiegermama ein echtes Bedürfnis. Sie war für mich in Kenia vier Jahre lang der Halt und der Fels in vielen schwierigen und verzweifelten Situationen. Sprachlich lagen wir weit auseinander, doch Liebe und Zuneigung brauchen im richtigen Moment nur Gesten und keine Worte. Ruhe in Frieden, geliebte Ngogo.
Durch meinen jahrelangen Kontakt mit meiner Familie in Afrika ist es mir schlussendlich gelungen, auch meine Tochter zu ihren Wurzeln im Samburuland zu führen und sie mit über 20 Jahren ihrem Vater und ihrer Großmutter näherzubringen. Die Begegnung war für alle Seiten sehr emotional, und ich bin noch heute dem lieben Gott dankbar, dass es so gekommen ist.
Afrika werde ich immer im Herzen tragen, weil es ein Kontinent ist, der fasziniert und dessen Bewohner mich berühren. Afrika ist Emotion pur – es lässt niemanden kalt, im positiven wie im negativen Sinn. Aber verändern tut es jeden! (Beschrieben in dem Buch Afrika, meine Passion.)
Heute noch wohne ich in afrikanischem Ambiente – meine Wohnung ist voller afrikanischer Bilder, Gegenstände und Erinnerungsstücke, die mir Geborgenheit schenken. Vor einer Weile habe ich meine Liebe zur Malerei entdeckt – und ich male in afrikanischen Farben und verwende afrikanische Motive, es sind Bilder, die tief aus meiner Seele kommen. Ich glaube, ich habe vieles von der afrikanischen Kultur mitnehmen können, dazu gehört auch, dass ich fast immer im Moment lebe – JETZT!
Dieses JETZT bedeutet für mich auch, dass trotz der Verbundenheit zu Afrika mein Zuhause nun hier in der Südschweiz ist und hier meine Wurzeln tiefer und tiefer wachsen, von Jahr zu Jahr.
Seit dem Tod meiner afrikanischen Schwiegermama Ngogo im Jahr 2015 verblasst der Wunsch, nach Barsaloi zurückzukehren, immer mehr. Ich glaube, 20 Jahre nach der Erstausgabe dieses Buches ist es an der Zeit, loszulassen. Die Nabelschnur ist durchtrennt, und ich mache meiner Tochter Platz, ihren Vater eigenständig zu besuchen. Mich braucht es dafür nicht mehr.
Ich arbeite daran, wieder an die Liebe zu glauben. Denn nach all dem, was Sie in diesem Buch lesen werden, hatte ich, bewusst oder unbewusst, den Glauben an die ewige Liebe für drei Jahrzehnte verloren.
Es ist Zeit, diese wiederzuentdecken. ☺
Corinne Hofmann, November 2017
Ankunft in Kenia
Herrliche Tropenluft empfängt uns bei der Ankunft auf dem Flughafen Mombasa, und bereits hier ahne und spüre ich: dies ist mein Land, hier werde ich mich wohl fühlen. Doch allem Anschein nach bin nur ich empfänglich für die wunderbare Aura, die uns umgibt, denn mein Freund Marco bemerkt trocken: »Hier stinkt’s!«
Nach der Zollabfertigung geht es mit dem Safaribus zu unserem Hotel. Auf dem Weg dorthin müssen wir mit der Fähre einen Fluß überqueren, der die Südküste von Mombasa trennt. Es ist heiß, wir sitzen im Bus und staunen. Zu diesem Zeitpunkt weiß ich noch nicht, daß diese Fähre drei Tage später mein ganzes Leben verändern, ja auf den Kopf stellen wird.
Auf der anderen Seite des Flusses fahren wir etwa eine Stunde über Landstraßen durch kleine Siedlungen. Die meisten Frauen vor den einfachen Hütten scheinen Moslems zu sein, denn sie sind in schwarze Tücher gehüllt. Endlich erreichen wir unser Hotel, das Africa-Sea-Lodge. Es ist eine moderne, aber noch im afrikanischen Stil erbaute Anlage, in der wir ein kleines Rundhäuschen, das hübsch und gemütlich eingerichtet ist, beziehen. Ein erster Besuch am Strand bestärkt das überwältigende Gefühl: Dies ist das schönste aller Länder, die ich je besucht habe, hier würde ich gerne bleiben.
Nach zwei Tagen haben wir uns gut eingelebt und wollen auf eigene Faust mit dem öffentlichen Bus nach Mombasa und mit der Likoni-Fähre hinüber zu einer Stadtbesichtigung. Unauffällig geht ein Rastaman an uns vorbei, und ich höre: »Haschisch, Marihuana.« Marco nickt: »Yes, yes, where we can make a deal?« Nach einem kurzen Gespräch sollen wir ihm folgen. »Laß das, Marco, es ist zu gefährlich!« sage ich, doch er achtet nicht auf meine Bedenken. Als wir in eine heruntergekommene, verlassene Gegend kommen, möchte ich das Unternehmen abbrechen, doch der Mann erklärt uns, wir sollen auf ihn warten, und verschwindet daraufhin. Mir ist unbehaglich zumute, und endlich sieht auch Marco ein, daß wir gehen sollten. Wir verziehen uns gerade noch rechtzeitig, bevor der Rastaman in Polizeibegleitung auftaucht. Ich bin wütend und frage aufgebracht: »Siehst du jetzt, was hätte passieren können!?«
Mittlerweile ist es später Nachmittag, wir sollten uns auf den Heimweg machen. Aber in welche Richtung? Ich weiß nicht mehr, wo diese Fähre ablegt, und auch Marco versagt kläglich. Schon haben wir den ersten handfesten Streit, und erst nach langer Suche sind wir am Ziel, die Fähre ist in Sicht. Hunderte von Menschen mit vollgepackten Kartons, Karren und Hühnern stehen zwischen den wartenden Autos. Jeder will auf die zweistöckige Fähre.
Endlich sind auch wir an Bord, und das Unfaßbare geschieht. Marco sagt: »Corinne, schau, da drüben, das ist ein Massai!« »Wo?« frage ich und schaue in die gezeigte Richtung. Es trifft mich wie ein Blitzschlag. Da sitzt ein langer, tiefbrauner, sehr schöner, exotischer Mann lässig auf dem Fährengeländer und schaut uns, die einzigen Weißen in diesem Gewühl, mit dunklen Augen an. Mein Gott, denke ich, ist der schön, so etwas habe ich noch nie gesehen.
Er ist nur mit einem kurzen, roten Hüfttuch bekleidet, dafür aber reich geschmückt. Seine Stirn ziert ein großer, an bunten Perlen befestigter Perlmuttknopf, der hell leuchtet. Die langen roten Haare sind zu feinen Zöpfchen geflochten, und sein Gesicht ist mit Zeichen bemalt, die bis auf die Brust hinabreichen. Über dieser hängen gekreuzt zwei lange Ketten aus farbigen Perlen, und an den Handgelenken trägt er mehrere Armbänder. Sein Gesicht ist so ebenmäßig schön, daß man fast meinen könnte, es sei das einer Frau. Aber die Haltung, der stolze Blick und der sehnige Muskelbau verraten, daß er ein Mann ist. Ich kann den Blick nicht mehr abwenden. So, wie er dasitzt in der untergehenden Sonne, sieht er wie ein junger Gott aus.
In fünf Minuten siehst du diesen Menschen nie wieder, denke ich bedrückt, denn dann legt die Fähre an, und alle rennen los, verteilen sich auf die Busse und verschwinden in alle Himmelsrichtungen. Mir wird das Herz schwer, und gleichzeitig bekomme ich kaum noch Luft. Neben mir beendet Marco gerade den Satz »… vor diesen Massai müssen wir uns in acht nehmen, die rauben die Touristen aus.« Das ist mir im Moment jedoch völlig egal, und ich überlege fieberhaft, wie ich mit diesem atemberaubend schönen Mann in Kontakt kommen kann. Englisch beherrsche ich nicht, und ihn einfach nur anzustarren bringt auch nichts.
Die Ladeklappe wird heruntergelassen, und alle drängen zwischen den abfahrenden Autos an Land. Von dem Massai sehe ich nur noch seinen glänzenden Rücken, als er geschmeidig zwischen den anderen, schwerfällig schleppenden Menschen verschwindet. Aus, vorbei, denke ich und könnte in Tränen ausbrechen. Weshalb mich das so mitnimmt, weiß ich nicht.
Wir haben wieder festen Boden unter den Füßen und drängen zu den Bussen. Mittlerweile ist es finster geworden, in Kenia bricht die Dunkelheit innerhalb einer halben Stunde herein. Die vielen Busse füllen sich in kurzer Zeit mit Menschen und Gepäck. Wir stehen ratlos da. Zwar wissen wir den Namen unseres Hotels, aber nicht, an welchem Strand es liegt. Ungeduldig stoße ich Marco an: »Frag doch mal jemanden!« Das sei meine Sache, meint er, dabei war ich noch nie in Kenia und spreche kein Englisch. Es war ja seine Idee, nach Mombasa zu fahren. Ich bin traurig und denke an den Massai, der sich bereits in meinem Kopf festgesetzt hat.
In völliger Dunkelheit stehen wir da und streiten. Alle Busse sind weg, als hinter uns eine dunkle Stimme »Hello!« sagt. Wir drehen uns gleichzeitig um, und mir bleibt fast das Herz stehen. »Mein« Massai! Einen Kopf größer als ich, obwohl ich bereits 1,80 m groß bin. Er schaut uns an und redet in einer Sprache auf uns ein, die wir beide nicht verstehen. Mein Herz scheint aus der Brust zu springen, meine Knie zittern. Ich bin völlig durcheinander. Marco versucht währenddessen zu erklären, wohin wir müssen.
»No problem«, erwidert der Massai, wir sollen warten. Etwa eine halbe Stunde vergeht, in der ich nur diesen schönen Menschen ansehe. Er beachtet mich kaum, Marco hingegen reagiert sehr irritiert. »Was ist eigentlich los mit dir?« will er wissen. »Du starrst diesen Mann geradezu penetrant an, ich muß mich schämen. Reiß dich zusammen, so kenne ich dich ja gar nicht!« Der Massai steht dicht neben uns und sagt kein Wort. Nur durch die Umrisse seines langen Körpers und seinen Geruch, der auf mich erotisch wirkt, spüre ich, daß er noch da ist.
Am Rande des Busbahnhofs gibt es kleine Geschäfte, die eher wie Baracken aussehen und alle dasselbe anbieten: Tee, Süßigkeiten, Gemüse, Früchte und Fleisch, das an Haken hängt. Vor den nur schwach mit Petroleumlampen beleuchteten Buden stehen Menschen in zerlumpten Kleidern. Als Weiße fallen wir hier sehr auf.
»Laß uns zurück nach Mombasa gehen und ein Taxi suchen. Der Massai versteht doch nicht, was wir wollen, und ich traue ihm nicht. Außerdem glaube ich, daß du von ihm richtig verhext bist«, sagt Marco. Mir allerdings erscheint es wie eine Fügung, daß ausgerechnet er unter all den Schwarzen auf uns zugekommen ist.
Als kurz darauf ein Bus hält, sagt der Massai »Come, come!«, schwingt sich hinein und reserviert uns zwei Plätze. Wird er wieder aussteigen oder mitfahren, frage ich mich. Zu meiner Beruhigung setzt er sich auf die andere Seite des Durchgangs direkt hinter Marco. Der Bus fährt auf einer Landstraße, die völlig im Dunkeln liegt. Ab und zu sieht man zwischen den Palmen und Sträuchern ein Feuer und ahnt die Anwesenheit von Menschen. Die Nacht verwandelt alles, wir haben völlig die Orientierung verloren. Marco erscheint die Strecke viel zu lang, so daß er mehrmals den Versuch macht auszusteigen. Nur durch mein gutes Zureden und nach ein paar Worten des Massai sieht er ein, daß wir dem Fremden vertrauen müssen. Ich habe keine Angst, im Gegenteil, ich möchte ewig so weiterfahren. Die Anwesenheit meines Freundes beginnt mich zu stören. Alles sieht er negativ und obendrein versperrt er mir die Sicht! Krampfhaft überlege ich: »Was ist, wenn wir am Hotel eintreffen?«
Nach gut einer Stunde ist der gefürchtete Moment gekommen. Der Bus hält, und Marco steigt erleichtert aus, nachdem er sich bedankt hat. Ich schaue noch einmal den Massai an, bringe kein Wort hervor und stürze aus dem Bus. Er fährt weiter, irgendwohin, vielleicht sogar nach Tansania.
Von diesem Moment an will sich bei mir keine Ferienstimmung mehr einstellen.
Ich denke viel über mich, Marco und mein Geschäft nach. Seit bald fünf Jahren betreibe ich in Biel eine exklusive Secondhand-Boutique mit einer Abteilung für Brautkleider. Nach anfänglichen Schwierigkeiten läuft das Geschäft bestens, und ich beschäftige mittlerweile drei Schneiderinnen. Mit siebenundzwanzig Jahren habe ich es geschafft, auf einen ansehnlichen Lebensstandard zu kommen. Marco lernte ich kennen, als es beim Einrichten meiner Boutique Schreinerarbeiten zu erledigen gab. Er war höflich und lustig, und da ich in Biel neu zugezogen war und niemanden kannte, nahm ich eines Tages seine Einladung zum Essen an. Langsam entwickelte sich unsere Freundschaft, und nach einem halben Jahr zogen wir zusammen. Wir gelten in Biel als »Traumpaar«, haben viele Freunde, und alle warten auf unseren Hochzeitstermin. Doch ich gehe völlig in der Aufgabe als Geschäftsfrau auf und bin auf der Suche nach einem zweiten Laden in Bern. Mir bleibt kaum Zeit für Gedanken an Hochzeit oder Kinder. Marco ist von meinen Plänen allerdings nicht sehr angetan, sicher auch, weil ich schon jetzt wesentlich mehr verdiene als er. Das macht ihm zu schaffen und hat in letzter Zeit zu Auseinandersetzungen geführt.
Und nun diese für mich völlig neue Erfahrung! Ich versuche immer noch zu begreifen, was da in mir vorgeht. Mit meinen Gefühlen bin ich weit weg von Marco und merke, daß ich ihn kaum wahrnehme. Dieser Massai hat sich in meinem Gehirn festgesetzt. Ich kann nichts essen. Im Hotel haben wir die besten Buffets, aber ich bringe nichts mehr hinunter. In meinem Bauch haben sich anscheinend die Gedärme verknotet. Den ganzen Tag spähe ich zum Strand oder spaziere an ihm entlang, in der Hoffnung, ihn zu erblicken. Ab und zu sehe ich einige Massai, aber alle sind kleiner und weit entfernt von seiner Schönheit. Marco läßt mich gewähren, es bleibt ihm ja nichts anderes übrig. Er freut sich auf die Heimreise, weil er fest davon überzeugt ist, daß sich dann alles normalisiert. Doch dieses Land hat mein Leben aus den Fugen gerissen, und es wird nichts mehr so sein wie bisher.
Marco beschließt, eine Safari ins Massai-Mara zu unternehmen. Mir behagt diese Idee nicht besonders, denn unter diesen Umständen habe ich keine Chance, den Massai wiederzufinden. Aber mit einer Zweitagesreise bin ich einverstanden.
Die Safari ist anstrengend, weil es mit den Bussen weit ins Landesinnere geht. Wir fahren bereits mehrere Stunden, und Marco geht alles zu langsam. »Wegen der paar Elefanten und Löwen hätten wir wirklich nicht diese Strapaze auf uns nehmen müssen, die können wir auch bei uns im Zoo sehen.« Mir aber gefällt die Fahrt. Bald erreichen wir die ersten Massai-Dörfer. Der Bus hält, und der Fahrer fragt, ob wir Lust hätten, die Hütten und deren Bewohner zu besichtigen. »Klar«, sage ich, und die anderen Safariteilnehmer schauen mich kritisch an. Der Fahrer handelt einen Preis aus. In weißen Turnschuhen stapfen wir durch lehmigen Morast, darauf bedacht, nicht auf die Kuhfladen zu treten, die überall herumliegen. Kaum sind wir bei den Hütten, den Manyattas, stürzen sich die Frauen mit ihrer Kinderschar auf uns, zerren an unseren Kleidern und wollen praktisch alles, was wir an uns tragen, gegen Speere, Stoffe oder Schmuck eintauschen.
Inzwischen sind die Männer in die Hütten gelockt worden. Ich kann mich nicht überwinden, in diesem Morast noch einen einzigen Schritt zu machen. So reiße ich mich von den rabiaten Frauen los und stürme zurück zum Safaribus, gefolgt von Hunderten von Fliegen. Auch die anderen Gäste eilen zum Bus und rufen: »Losfahren!« Der Chauffeur lächelt und meint: »Jetzt seid ihr hoffentlich gewarnt vor diesem Stamm, den letzten unzivilisierten Menschen in Kenia, mit denen auch die Regierung ihre Schwierigkeiten hat.«
Im Bus stinkt es fürchterlich, und die Fliegen sind eine Plage, während Marco lacht und meint: »So, jetzt weißt du wenigstens, woher dein Schönling kommt und wie es bei denen ausschaut.« An meinen Massai habe ich komischerweise in diesen Minuten überhaupt nicht gedacht. Schweigend fahren wir weiter, vorbei an großen Elefantenherden. Nachmittags erreichen wir ein Touristenhotel. Es ist fast unwirklich, in dieser Halbwüste in einem luxuriösen Hotel zu übernachten. Als erstes beziehen wir unsere Zimmer und gehen unter die Dusche. Das Gesicht, die Haare, alles klebt. Dann gibt es ein üppiges Abendessen, und selbst ich verspüre nach fast fünf Tagen Hungerns so etwas wie Appetit. Am nächsten Morgen stehen wir sehr früh zur Löwenbesichtigung auf und tatsächlich finden wir drei noch schlafende Tiere. Dann treten wir den langen Heimweg an. Je näher wir Mombasa kommen, desto mehr überkommt mich ein merkwürdiges Glücksgefühl. Für mich steht fest: Noch knapp eine Woche sind wir hier, und ich muß meinen Massai wiederfinden.
Abends findet im Hotel ein Massai-Tanz mit anschließendem Schmuckverkauf statt, und ich bin voller Hoffnung, ihn hier wiederzusehen. Wir sitzen in der ersten Reihe, als die Krieger hereinkommen. Es sind etwa zwanzig Männer, kleine, große, hübsche, häßliche, aber mein Massai ist nicht dabei. Ich bin enttäuscht. Trotzdem gefällt mir ihre Darbietung, und wieder rieche ich diese Ausdünstung, die sich von der anderer Afrikaner stark unterscheidet.
In der Nähe des Hotels soll es ein Freiluft-Dancing, die »Bush-Baby-Disco«, geben, wo auch Einheimische hingehen können. So sage ich: »Marco, komm, wir suchen dieses Tanzlokal.« Er will nicht so recht, da natürlich die Hotelleitung auf die Gefahren hingewiesen hat, aber ich setze mich durch. Nach kurzer Wanderung entlang der dunklen Straße erspähen wir Licht und hören die ersten Töne von Rockmusik. Wir gehen hinein, und mir gefällt es sofort. Endlich nicht mehr diese kahlen, klimatisierten Hotel-Discos, sondern eine Tanzfläche unter freiem Himmel mit einigen Bars zwischen Palmen. Überall hocken Touristen mit Einheimischen an den Theken. Hier geht es locker zu. Wir setzen uns an einen Tisch. Marco bestellt Bier und ich eine Cola. Dann tanze ich allein, da Marco nicht viel vom Tanzen hält.
Gegen Mitternacht betreten einige Massai die Disco. Ich sehe sie mir genau an, erkenne aber nur ein paar von denen, die im Hotel ihren Auftritt hatten. Enttäuscht kehre ich an den Tisch zurück. Ich fasse den Entschluß, die restlichen Abende in der Disco zu verbringen, denn es scheint mir die einzige Möglichkeit zu sein, meinen Massai wiederzufinden. Marco protestiert zwar, aber allein im Hotel bleiben will er auch nicht. So machen wir uns jeden Abend nach dem Essen auf den Weg zur Bush-Baby-Disco.
Nach dem zweiten Abend, es ist bereits der 21. Dezember, hat mein Freund genug von den Ausflügen. Ich verspreche ihm, es sei nur noch dieses eine Mal. Wie immer sitzen wir an dem inzwischen zu unserem Stammplatz gewordenen Tisch unter der Palme. Ich entschließe mich zu einem Solotanz inmitten der tanzenden Schwarzen und Weißen. Er muß doch einfach kommen!
Kurz nach elf Uhr, ich bin schon ganz schweißgebadet, öffnet sich die Tür. Mein Massai! Er legt seinen Schlagstock beim Kontrolleur nieder, geht langsam zu einem Tisch und setzt sich mit dem Rücken zu mir. Meine Knie zittern, ich kann kaum noch stehen. Jetzt schießt mir der Schweiß erst recht aus allen Poren. Ich muß mich an einer Säule am Rand der Tanzfläche festhalten, um nicht umzukippen. Fieberhaft überlege ich, was ich tun könnte.
Auf diesen Augenblick habe ich Tage gewartet. So ruhig wie möglich gehe ich an unseren Tisch zurück und sage zu Marco: »Schau, da ist der Massai, der uns geholfen hat. Hol ihn bitte an unseren Tisch und spendiere ihm ein Bier als Dankeschön!« Marco dreht sich um, und im selben Moment sieht uns der Massai. Er winkt, steht auf und kommt tatsächlich zu uns. »Hello, friends!« Schon streckt er uns lachend seine Hand entgegen. Sie fühlt sich kühl und geschmeidig an.
Er setzt sich neben Marco direkt mir gegenüber. Warum nur kann ich kein Englisch! Marco bemüht sich um ein Gespräch, wobei sich herausstellt, daß auch der Massai kaum Englisch spricht. Mit Gestik und Mimik versuchen wir uns zu verständigen. Er schaut zuerst Marco, dann mich an und fragt schließlich, auf mich zeigend: »Your wife?« Auf Marcos »Yes, yes« reagiere ich empört: »No, only boyfriend, no married!« Der Massai versteht nicht. Er fragt nach Kindern. Wieder sage ich: »No, no! No married!«
So nah war er mir noch nie. Nur der Tisch ist zwischen uns, und ich kann ihn nach Herzenslust anstarren. Er ist faszinierend schön, mit seinem Schmuck, den langen Haaren und dem stolzen Blick! Von mir aus könnte die Zeit stehenbleiben. Er fragt Marco: »Warum tanzt du nicht mit deiner Frau?« Als Marco, zum Massai gewandt, antwortet, er trinke lieber Bier, ergreife ich die Gelegenheit und mache dem Massai klar, daß ich mit ihm tanzen will. Er schaut Marco an, und als keine Reaktion kommt, stimmt er zu.
Wir tanzen, er mehr hüpfend wie beim Volkstanz, ich europäisch. Er bewegt keinen Muskel im Gesicht. Ich weiß nicht, ob ich ihm überhaupt gefalle. Dieser Mann, so fremd er mir ist, zieht mich wie ein Magnet an. Nach zwei Songs kommt langsame Musik, und ich würde ihn am liebsten an mich drücken. Statt dessen reiße ich mich zusammen und gehe von der Bühne, ich würde sonst völlig die Kontrolle verlieren.
Am Tisch reagiert Marco prompt: »Corinne, komm, wir gehen ins Hotel, ich bin müde.« Aber ich will nicht. Der Massai gestikuliert wieder mit Marco. Er will uns einladen, uns morgen seine Wohnstätte zeigen und eine Bekannte vorstellen. Ich stimme schnell zu, bevor Marco widersprechen kann. Wir verabreden uns vor dem Hotel.
In der Nacht liege ich schlaflos auf dem Bett, und gegen Morgen ist mir klar, daß meine Zeit mit Marco zu Ende ist. Fragend schaut er mich an, und plötzlich bricht es aus mir heraus: »Marco, ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht, was mir mit diesem völlig fremden Mann passiert ist. Ich weiß nur, dieses Empfinden ist stärker als jede Vernunft.« Marco tröstet mich und meint gutmütig, wenn wir wieder in der Schweiz seien, werde sich alles wieder einrenken. Kläglich erwidere ich: »Ich will nicht mehr zurück. Ich will hier bleiben in diesem schönen Land bei den liebenswerten Menschen und vor allem bei diesem faszinierenden Massai.« Marco versteht mich natürlich nicht.
Bei brütender Hitze stehen wir am nächsten Tag wie verabredet vor dem Hotel. Plötzlich taucht er auf der anderen Seite der Straße auf und kommt herüber. Nach kurzer Begrüßung sagt er: »Come, come!« und wir folgen ihm. Wir gehen ungefähr zwanzig Minuten durch Wald und Gestrüpp. Da und dort springen Affen, manche halb so groß wie wir, vor uns her. Wieder bewundere ich den Gang des Massai. Er scheint den Boden kaum zu berühren. Es ist fast wie ein Schweben, obwohl seine Füße in schweren Autoreifen-Sandalen stecken. Marco und ich wirken dagegen wie Trampeltiere.
Dann kommen fünf Rundhäuschen in Sicht, in einem Kreis zusammengestellt, ähnlich wie im Hotel, nur viel kleiner, und statt Beton sind hier Natursteine aufeinander gestapelt, mit rotem Lehm verputzt. Das Dach ist aus Stroh. Vor einem Häuschen steht eine stämmige Frau mit einem großen Busen. Der Massai stellt sie uns als seine Bekannte Priscilla vor, und erst jetzt erfahren wir den Namen des Massai: Lketinga.
Priscilla begrüßt uns freundlich, und zu unserer Verwunderung spricht sie gut Englisch. »You like tea?« fragt sie. Ich nehme dankend an. Marco meint, es sei viel zu heiß, er hätte lieber ein Bier. Das bleibt hier natürlich Wunschvorstellung. Priscilla holt einen kleinen Spirituskocher hervor, stellt ihn vor unsere Füße, und wir warten, bis das Wasser kocht. Wir erzählen von der Schweiz, von unserer Arbeit und fragen, wie lange sie hier schon wohnen. Priscilla lebt bereits seit zehn Jahren an der Küste. Lketinga hingegen sei neu hier, er sei erst vor einem Monat angekommen und spreche deshalb fast noch kein Wort Englisch.
Wir fotografieren, und jedesmal, wenn ich in Lketingas Nähe komme, zieht er mich körperlich spürbar an. Ich muß mich zusammenreißen, damit ich ihn nicht berühre. Wir trinken den Tee, der ausgezeichnet schmeckt, aber verdammt heiß ist. Wir verbrennen uns beinahe die Finger an den Emailletassen.
Es beginnt, rasch dunkel zu werden, und Marco sagt: »Komm jetzt, wir müssen langsam zurück.« Wir verabschieden uns von Priscilla und tauschen, mit dem Versprechen zu schreiben, unsere Adressen aus. Schweren Herzens trabe ich hinter Marco und Lketinga zurück. Vor dem Hotel fragt er: »Tomorrow Christmas, you come again to Bush-Baby?« Ich strahle Lketinga an, und bevor Marco antworten kann, sage ich »Yes!«
Morgen ist unser drittletzter Tag, und ich habe mir vorgenommen, meinem Massai mitzuteilen, daß ich Marco nach den Ferien verlassen werde. Neben dem, was ich für Lketinga empfinde, erscheint mir alles andere, was vorher war, lächerlich. Ich will ihm das morgen irgendwie klarmachen und ihm auch sagen, daß ich bald allein zurückkommen werde. Nur einmal denke ich kurz darüber nach, was er für mich empfindet, doch sofort gebe ich mir selbst die Antwort. Er muß einfach genauso empfinden wie ich!
Heute ist Weihnachten. Bei vierzig Grad im Schatten ist hier von weihnachtlicher Stimmung allerdings nichts zu spüren. Ich mache mich für den Abend so schön wie möglich und ziehe mein bestes Ferienkleid an. An unserem Tisch haben wir zum Fest Champagner bestellt, der teuer ist, dafür um so schlechter und viel zu warm serviert. Um zehn Uhr ist von Lketinga und seinen Freunden noch nichts zu sehen. Was ist, wenn er ausgerechnet heute nicht kommt? Wir sind nur noch morgen hier, und tags darauf geht es in aller Frühe zum Flughafen.
Erwartungsvoll starre ich zur Tür und hoffe inständig, daß er kommen wird. Da taucht ein Massai auf. Er schaut sich um und kommt zögernd auf uns zu. »Hello«, begrüßt er uns und fragt, ob wir die Weißen seien, die mit Lketinga verabredet sind. Ich habe einen Klumpen im Hals und bekomme einen Schweißausbruch, während wir nicken. Er berichtet uns, Lketinga sei am Nachmittag am Strand gewesen, was normalerweise für Einheimische verboten ist. Dort wurde er von anderen Schwarzen wegen seiner Haare und seiner Kleidung gehänselt. Als stolzer Krieger wehrte er sich seiner Haut und schlug mit seinem Rungu, dem Schlagstock, auf seine Gegner ein. Die Strandpolizei nahm ihn kurzerhand mit, weil sie seine Sprache nicht verstanden. Jetzt sei er irgendwo in einem Gefängnis zwischen der Süd und Nordküste. Er sei hier, um uns das mitzuteilen, und wünsche uns im Namen von Lketinga eine gute Heimreise. Marco übersetzt, und als ich begreife, was geschehen ist, stürzt für mich eine Welt zusammen. Nur mit größter Anstrengung kann ich die Tränen der Enttäuschung zurückhalten. Ich flehe Marco an: »Frag, was wir tun können, wir sind nur noch morgen hier!« Er antwortet kühl: »Das ist hier eben so, wir können nichts machen, und ich bin froh, wenn wir endlich zu Hause sind.«
Ich lasse nicht locker: »Edy«, so heißt der Massai, »können wir ihn suchen?« Ja, er sammle heute abend bei den anderen Massai Geld und morgen um zehn Uhr fahre er los und versuche, ihn zu finden. Es sei schwierig, weil man nicht wisse, in welches der fünf Gefängnisse er gebracht worden sei.
Ich bitte Marco darum, daß wir mitgehen, er habe uns ja schließlich auch geholfen. Nach längerem Hin und Her willigt er ein, und wir verabreden uns mit Edy um zehn Uhr vor dem Hotel. Die ganze Nacht kann ich nicht schlafen. Ich weiß immer noch nicht, was in mich gefahren ist. Ich weiß nur, daß ich Lketinga wiedersehen will, ja muß, bevor ich in die Schweiz zurückfliege.
Auf der Suche
Marco hat es sich anders überlegt und bleibt im Hotel. Er versucht noch, mir das Vorhaben auszureden, aber gegen diese Kraft, die mir sagt, ich muß gehen, kommen alle gutgemeinten Ratschläge nicht an. So lasse ich ihn zurück und verspreche, gegen zwei Uhr wieder da zu sein. Edy und ich fahren in Richtung Mombasa mit dem Matatu. Diese Art von Taxi benutze ich zum ersten Mal. Es ist ein kleiner Bus mit zirka acht Sitzplätzen. Als er hält, befinden sich bereits dreizehn Leute darin, dichtgedrängt zwischen ihrem Gepäck. Der Kontrolleur hängt draußen am Fahrzeug. Ich schaue ratlos in das Gewühl. »Go, go in!« sagt Edy, und ich klettere über Taschen und Beine und halte mich in gebückter Haltung fest, damit ich in den Kurven nicht auf die anderen falle.
Gott sei Dank steigen wir nach etwa fünfzehn Kilometern aus. Wir sind in Ukunda, dem ersten größeren Dorf, das ein Gefängnis hat. Gemeinsam gehen wir hinein. Noch bevor ich einen Fuß über die Schwelle gesetzt habe, hält uns ein bulliger Typ auf. Fragend sehe ich Edy an. Er verhandelt, und nach etlichen Minuten, nachdem ich angewiesen wurde, stehenzubleiben, öffnet der Typ eine Tür hinter sich. Da es im Inneren dunkel ist und ich draußen in der Sonne stehe, kann ich nicht viel erkennen. Dafür schlägt uns ein so schrecklicher Gestank entgegen, daß ich Brechreiz verspüre. Der Dicke schreit etwas in das dunkle Loch, und nach ein paar Sekunden erscheint ein Mensch, der völlig verwahrlost aussieht. Es ist anscheinend ein Massai, doch ohne Schmuck. Ich schüttle erschreckt den Kopf und frage Edy: »Ist nur dieser Massai hier?« Offensichtlich ist es so, und der Gefangene wird zurückgestoßen zu den anderen, die am Boden kauern. Wir gehen, und Edy sagt: »Komm, wir nehmen noch mal ein Matatu, die sind schneller als die großen Busse, und suchen in Mombasa weiter.«
Wieder geht es hinüber mit der Likoni-Fähre und weiter mit dem nächsten Bus an den Stadtrand zum dortigen Gefängnis. Es ist wesentlich größer als das letzte. Auch hier werde ich als Weiße grimmig angeschaut. Der Mann hinter der Barriere nimmt keine Notiz von uns. Er liest gelangweilt in seiner Zeitung, und wir stehen ratlos herum. Ich stupse Edy an: »Frag doch mal!« Nichts passiert, bis Edy mir erklärt, ich solle diesem Kerl unauffällig einige Kenia-Schillinge hinlegen. Aber wieviel? Ich habe in meinem Leben noch nie jemanden bestechen müssen. Also lege ich 100 Kenia-Schillinge hin, was etwa zehn Franken entspricht. Scheinbar achtlos streicht er das Geld ein und schaut uns endlich an. Nein, in letzter Zeit sei kein Massai namens Lketinga eingeliefert worden. Es seien zwei Massai hier, aber die seien viel kleiner als der Beschriebene. Ich will sie trotzdem sehen, denn vielleicht täuscht er sich ja, und das Geld hat er bereits genommen. Mit einem finsteren Blick auf mich erhebt er sich und sperrt eine Tür auf.
Was ich hier sehe, schockiert mich. In einem Raum ohne Fenster hocken zusammengepfercht mehrere Personen, die einen auf Pappkartons, die anderen auf Zeitungen oder direkt auf dem Betonboden. Durch den Lichtstrahl geblendet, halten sie sich die Hände vor die Augen. Nur ein kleiner Gang zwischen den kauernden Menschen ist frei. Im nächsten Augenblick sehe ich auch, warum, denn ein Angestellter kommt, um einen Kübel mit »Essen« hineinzuschütten, direkt auf den Betongang. Es ist unfaßbar, so füttert man bestenfalls Schweine! Bei dem Wort Massai kommen zwei Männer heraus, aber keiner von beiden ist Lketinga. Ich bin entmutigt. Was erwartet mich überhaupt, wenn ich ihn finde?
Wir fahren in die Innenstadt, nehmen ein anderes Matatu und rumpeln zirka eine Stunde zur Nordküste. Edy beruhigt mich und meint, hier müsse er sein. Doch wir kommen gar nicht erst bis zum Eingang. Ein bewaffneter Polizist fragt, was wir wollen. Edy erklärt unser Anliegen, doch der andere schüttelt den Kopf, seit zwei Tagen hätten sie keinen Neuen bekommen. Wir verlassen den Ort, und ich bin völlig ratlos.
Edy sagt, es sei bereits spät, wenn ich um zwei Uhr zurück sein wolle, müßten wir uns beeilen. Ich will aber nicht ins Hotel. Nur noch heute habe ich Zeit, Lketinga zu finden. Edy schlägt vor, wir sollten noch mal beim ersten Gefängnis nachfragen, weil die Insassen oft verlegt werden. Also fahren wir in der brütenden Hitze wieder zurück nach Mombasa.
Als sich unsere Fähre mit einer entgegenkommenden kreuzt, sehe ich, daß sich auf dem anderen Schiff fast keine Menschen, sondern nur Fahrzeuge befinden, wovon eines besonders hervorsticht. Es ist knallgrün und vergittert. Edy sagt, dies sei der Gefangenentransporter. Mir wird übel beim Gedanken an diese armen Geschöpfe, aber weiter denke ich nicht. Ich bin müde, durstig und total verschwitzt. Um 14.30 Uhr sind wir wieder in Ukunda.
Vor dem Gefängnis steht jetzt ein anderer Wächter, der wesentlich freundlicher wirkt. Edy erklärt nochmals, wen wir suchen, und es wird lebhaft diskutiert. Ich verstehe nichts.
»Edy, was ist los?« Er erklärt mir, Lketinga sei vor einer knappen Stunde an die Nordküste, von der wir gerade kommen, gebracht worden. Er sei in Kwale gewesen, dann kurz hier und jetzt auf dem Weg zu dem Gefängnis, in dem er bis zu seiner Verhandlung bleiben müsse.
Langsam beginne ich durchzudrehen. Wir waren den ganzen Morgen unterwegs, und vor einer halben Stunde fuhr er an uns vorbei, in der grünen Minna. Edy schaut mich ratlos an. Wir sollten besser ins Hotel gehen, er werde es morgen wieder versuchen, er wisse jetzt, wo Lketinga sei. Ich könne ihm ja das Geld geben, er werde ihn auslösen.
Ich muß nicht lange überlegen und bitte Edy, noch einmal mit mir zur Nordküste zu fahren. Er ist nicht begeistert, aber er kommt mit. Schweigend fahren wir den langen Weg zurück, und ständig frage ich mich, warum, Corinne, warum tust du das? Was will ich Lketinga überhaupt sagen? Ich weiß es nicht, ich werde einfach von dieser unheimlichen Kraft weitergetrieben.
Kurz vor sechs Uhr erreichen wir erneut das Gefängnis an der Nordküste. Es steht noch derselbe bewaffnete Mann dort. Er erkennt uns und berichtet, daß Lketinga vor etwa zweieinhalb Stunden angekommen sei. Jetzt bin ich völlig wach. Edy erklärt, wir wollten den Massai herausholen. Der Wächter schüttelt den Kopf und meint, vor Silvester gehe das nicht, da der Gefangene noch keine Verhandlung gehabt habe und der Chef des Gefängnisses bis dahin in Ferien sei.
Mit allem habe ich gerechnet, damit aber nicht. Selbst mit Geld ist Lketinga nicht freizubekommen. Mit Müh und Not bringe ich den Wächter soweit, mir zumindest zu erlauben, Lketinga für zehn Minuten zu sehen, da er verstanden hat, daß ich morgen abfliege. Und dann kommt er strahlend heraus auf das Gelände. Ich erschrecke zutiefst.
Er trägt keinen Schmuck mehr, hat die Haare in ein schmutziges Tuch gewickelt und stinkt fürchterlich. Dennoch scheint er sich zu freuen und wundert sich nur, warum ich ohne Marco hier bin. Ich könnte schreien, der merkt auch gar nichts! Ich sage ihm, daß wir morgen nach Hause fliegen, ich aber so schnell wie möglich wiederkommen werde. Ich schreibe ihm meine Adresse auf und bitte ihn um seine. Nur zögernd schreibt er mühsam seinen Namen und die P. O. Box auf. Ich kann ihm gerade noch das Geld zustecken, und schon nimmt ihn der Wärter wieder mit. Beim Weggehen schaut er zurück, bedankt sich und sagt, ich solle Marco grüßen.
Langsam gehen wir zurück und warten in der einfallenden Dunkelheit auf einen Bus. Erst jetzt merke ich, wie erschöpft ich bin, heule plötzlich los und kann nicht mehr aufhören. Im überfüllten Matatu starren alle die weinende Weiße mit dem Massai an. Mir ist es egal, ich will am liebsten sterben.
Es ist bereits nach 20 Uhr, als wir die Likoni-Fähre erreichen. Marco fällt mir wieder ein, und ich bekomme Schuldgefühle, weil ich seit mehr als sechs Stunden über die vereinbarte Zeit hinaus verschwunden bin.
Während wir auf die Fähre warten, sagt Edy: »No bus, no Matatu to Diani-Beach.« Ich glaube, mich verhört zu haben. »Ab 20 Uhr fahren keine öffentlichen Busse mehr bis zum Hotel.« Das kann nicht wahr sein! Wir stehen im Dunkeln bei der Fähre, und drüben geht es nicht weiter. Ich gehe die wartenden Autos ab, ob sich unter den Insassen Weiße befinden. Zwei heimkehrende Safari-Busse sind dabei. Ich klopfe an die Scheibe und frage, ob ich mitfahren kann. Der Fahrer verneint, er dürfe keine Fremden aufnehmen. Die Insassen sind Inder, die ohnehin schon alle Plätze belegt haben. Im letzten Moment fährt ein Auto auf die Rampe, und ich habe Glück. Zwei italienische Nonnen, denen ich mein Problem erklären kann, sitzen darin. Angesichts meiner Situation sind sie bereit, mich und Edy zum Hotel zu bringen.
Eine dreiviertel Stunde fahren wir durch die Dunkelheit, und ich bekomme Angst vor Marco. Wie wird er reagieren? Selbst wenn er mir eine Ohrfeige verpaßt, würde ich das verstehen, er wäre völlig im Recht. Ja, ich hoffe sogar, daß er soweit geht und ich dadurch vielleicht wieder zu mir komme. Immer noch begreife ich nicht, was in mich gefahren ist und warum ich die Kontrolle über jegliche Vernunft verloren habe. Ich merke nur, daß ich so müde bin wie nie in meinem Leben zuvor und das erste Mal große Angst empfinde, vor Marco und vor mir selbst.
Beim Hotel verabschiede ich mich von Edy und stehe kurz darauf vor Marco. Er schaut mich traurig an, kein Geschrei, keine langen Worte, nur dieser Blick. Ich falle ihm um den Hals und weine schon wieder. Marco führt mich in unser Häuschen und spricht beruhigend auf mich ein. Mit allem habe ich gerechnet, nur nicht mit einem so liebevollen Empfang. Er sagt nur: »Corinne, es ist alles gut. Ich bin so froh, daß du überhaupt noch lebst. Ich wollte gerade zur Polizei gehen und eine Vermißtenmeldung aufgeben. Ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben und gedacht, dich nicht mehr zu sehen. Soll ich dir etwas zu essen holen?« Ohne meine Antwort abzuwarten, geht er und kommt mit einem beladenen Teller zurück. Es sieht köstlich aus, und ihm zuliebe esse ich, soviel ich kann. Erst nach dem Essen fragt er: »Und, hast du ihn wenigstens gefunden?« »Ja«, antworte ich und berichte ihm alles. Er schaut mich an und meint: »Du bist eine verrückte, aber sehr starke Frau. Wenn du etwas willst, gibst du nicht auf, nur warum kann nicht ich den Platz dieses Massai einnehmen?« Eben das weiß ich nicht. Ich kann mir auch nicht erklären, welches magische Geheimnis diesen Mann umgibt. Hätte mir jemand vor zwei Wochen gesagt, ich würde mich in einen Massai-Krieger verlieben, ich hätte ihn ausgelacht. Nun stehe ich vor einem riesengroßen Chaos.
Während des Heimflugs fragt Marco: »Wie soll es nun weitergehen mit uns, Corinne? Es liegt an dir.« Es fällt mir schwer, Marco das Ausmaß meiner Verwirrung deutlich zu machen. »Ich suche mir so schnell wie möglich eine eigene Wohnung, auch wenn es nicht für sehr lange sein wird, denn ich will wieder nach Kenia, vielleicht für immer«, antworte ich. Marco schüttelt nur traurig den Kopf.
Ein langes halbes Jahr
Bis ich endlich eine neue Wohnung oberhalb von Biel finde, vergehen zwei Monate. Der Umzug ist einfach, da ich nur meine Kleider mitnehme und einige persönliche Sachen, den Rest überlasse ich Marco. Am schwersten fällt es mir, meine zwei Katzen zurückzulassen. Aber angesichts der Tatsache, daß ich sowieso weggehe, gibt es nur diese Lösung. Mein Geschäft betreibe ich weiterhin, aber mit weniger Engagement, weil ich ständig von Kenia träume. Ich besorge mir alles, was ich finden kann über dieses Land, auch dessen Musik. Von früh bis spät höre ich im Geschäft Suaheli-Songs. Meine Kunden merken natürlich, daß ich nicht mehr so aufmerksam bin, doch erzählen kann und mag ich nicht.
Täglich warte ich auf Post. Dann endlich, nach fast drei Monaten, bekomme ich Nachricht. Nicht von Lketinga, dafür von Priscilla. Sie schreibt viel Belangloses. Immerhin erfahre ich, daß Lketinga drei Tage, nachdem wir abgereist waren, freigelassen wurde. Noch am gleichen Tag schreibe ich an die Adresse, die ich von Lketinga bekommen habe, und berichte von meinem Vorhaben, im Juni oder Juli wieder nach Kenia zu fahren, diesmal jedoch allein.
Ein weiterer Monat verstreicht, und endlich erhalte ich einen Brief von Lketinga. Er bedankt sich für meine Hilfe und würde sich sehr freuen, wenn ich sein Land wieder besuchen würde. Am selben Tag stürme ich in das nächste Reisebüro und buche für drei Wochen im Juli im selben Hotel.
Nun heißt es warten. Die Zeit scheint stillzustehen, die Tage kriechen dahin. Von unseren gemeinsamen Freunden ist nur einer treu geblieben, der sich ab und zu meldet, um sich mit mir auf ein Glas Wein zu treffen. Er scheint mich wenigstens etwas zu verstehen. Der Abreisetag rückt näher, und ich werde unruhig, da meine Briefe nur von Priscilla erwidert werden. Und doch kann mich nichts erschüttern; nach wie vor bin ich überzeugt, daß mir nur dieser Mann fehlt, um glücklich zu werden.
Inzwischen kann ich mich einigermaßen auf Englisch ausdrücken, meine Freundin Jelly unterrichtet mich täglich. Drei Wochen vor der Abreise entschließen sich mein jüngerer Bruder Eric und die mit ihm liierte Jelly mitzukommen. Das längste halbe Jahr meines Lebens ist überstanden. Wir fliegen ab.
Das Wiedersehen
Nach gut neun Stunden landen wir im Juli 1987 in Mombasa. Uns umgibt dieselbe Hitze, dieselbe Aura. Nur ist mir diesmal alles vertraut, Mombasa, die Fähre und die lange Busfahrt bis zum Hotel.
Ich bin angespannt. Ist er da oder nicht? An der Rezeption ertönt hinter mir ein »Hello!«. Wir drehen uns um, und da steht er! Er lacht und kommt mir strahlend entgegen. Das halbe Jahr ist wie weggefegt.
Ich stupse ihn an und sage: »Jelly, Eric, schaut, das ist er, Lketinga.« Mein Bruder wühlt verlegen in einer Tasche, meine Freundin Jelly lächelt und begrüßt ihn. Ich stelle sie einander vor. Mehr als einen Händedruck wage ich im Moment nicht.
Im allgemeinen Durcheinander beziehen wir erst einmal unser Häuschen, und Lketinga wartet an der Bar. Endlich kann ich Jelly fragen: »Und, wie findest du ihn?« Sie antwortet, nach Worten suchend: »Schon etwas speziell, vielleicht muß ich mich erst an ihn gewöhnen, im Moment erscheint er mir etwas fremd und wild.« Mein Bruder meint gar nichts. Die Begeisterung liegt offensichtlich allein bei mir, denke ich doch etwas enttäuscht.
Ich ziehe mich um und gehe zur Bar. Lketinga sitzt dort mit Edy. Auch ihn begrüße ich freudig, und dann versuchen wir zu erzählen. Von Lketinga erfahre ich, daß er kurz nach seiner Freilassung zu seinem Stamm gegangen und erst vor einer Woche wieder in Mombasa eingetroffen ist. Er hat durch Priscilla die Nachricht von meiner Ankunft erhalten. Es sei eine Ausnahme, daß sie uns im Hotel begrüßen dürften, denn normalerweise gebe es keinen Zutritt für Schwarze, die nicht hier arbeiten.
Mir fällt auf, daß ich ohne Edys Hilfe Lketinga fast nichts erzählen kann. Mein Englisch ist noch in den Anfängen, und auch Lketinga spricht kaum mehr als zehn Wörter. So sitzen wir bisweilen schweigend am Strand und strahlen einander einfach an, während meine Freundin und Eric die meiste Zeit am Pool oder im Zimmer verbringen. Langsam wird es Abend, und ich überlege, wie es weitergehen soll. Im Hotel können wir nicht länger bleiben, und abgesehen von unserem ersten Händedruck ist nicht viel passiert. Es ist schwierig, wenn man ein halbes Jahr auf einen Mann gewartet hat. In Gedanken habe ich mich in dieser Zeit oft in die Arme dieses schönen Mannes geträumt, mir Küsse ausgemalt und die wildesten Nächte vorgestellt. Jetzt, wo er da ist, verspüre ich Angst davor, auch nur seinen braunen Arm zu berühren. So gebe ich mich völlig dem Glücksgefühl hin, ihn an meiner Seite zu haben.
Eric und Jelly gehen schlafen, sie sind erschöpft von der langen Reise und der schwülen Hitze. Lketinga und ich schlendern zur Bush-Baby-Disco. Ich fühle mich königlich neben meinem »Prinzen«. Wir setzen uns an einen Tisch und schauen den Tanzenden zu. Er lacht ständig. Und weil wir uns kaum unterhalten können, sitzen wir und lauschen der Musik. Durch seine Nähe und die Atmosphäre werde ich kribbelig, und gerne würde ich einmal sein Gesicht streicheln oder gar erfahren, wie es ist, ihn zu küssen. Als endlich langsame Musik ertönt, ergreife ich seine Hände und deute auf die Tanzfläche. Hilflos steht er herum und macht keine Anstalten.
Plötzlich aber liegen wir uns in den Armen und bewegen uns im Rhythmus der Musik. Die Anspannung in mir schwindet. Ich zittere am ganzen Körper, doch diesmal kann ich mich an ihm festhalten. Die Zeit scheint stillzustehen, und langsam erwacht mein Verlangen nach diesem Mann, das ein halbes Jahr geschlummert hatte. Ich wage nicht, meinen Kopf zu heben und ihn anzusehen. Was wird er von mir denken? Ich weiß so wenig von ihm! Erst als sich der Rhythmus der Musik ändert, gehen wir an unseren Platz zurück, und ich merke, daß wir als einzige getanzt haben. Ich glaube zu spüren, wie uns Dutzende von Augenpaaren folgen.
Wir sitzen noch eine Weile zusammen, dann gehen wir. Es ist weit nach Mitternacht, als er mich zum Hotel bringt. Am Eingang schauen wir einander in die Augen, und ich glaube, bei ihm einen veränderten Ausdruck wahrzunehmen. Etwas wie Verwunderung und Erregung erkenne ich in diesen wilden Augen. Endlich wage ich, mich seinem schönen Mund zu nähern, und drücke sanft meine Lippen auf seine. Da spüre ich, daß der ganze Mann erstarrt und mich fast entsetzt anschaut.
»What you do?« fragt er und tritt einen Schritt zurück. Ernüchtert stehe ich da, verstehe nichts, empfinde Scham, drehe mich um und renne aufgelöst ins Hotel. Im Bett überfällt mich ein Weinkrampf, die Welt scheint einzustürzen. Mir geht nur eines durch den Kopf: daß ich ihn bis zum Wahnsinn begehre und er sich anscheinend nichts aus mir macht. Irgendwann schlafe ich dennoch ein.
Ich erwache sehr spät, das Frühstück ist längst vorbei. Es ist mir gleichgültig, weil ich absolut keinen Hunger verspüre. So, wie ich momentan ausschaue, will ich nicht gesehen werden, setze mir eine Sonnenbrille auf und schleiche am Pool vorbei, wo sich mein Bruder wie ein verliebter Hahn mit Jelly tummelt.
Am Strand lege ich mich unter eine Palme und starre in den blauen Himmel. War das alles? frage ich mich. Habe ich mich dermaßen getäuscht in meiner Wahrnehmung? Nein, schreit es in mir, woher hätte ich sonst die Kraft genommen, mich von Marco zu trennen und ein halbes Jahr auf jeglichen sexuellen Kontakt zu verzichten, wenn nicht für diesen Mann.
Plötzlich nehme ich einen Schatten über mir wahr und verspüre eine sanfte Berührung am Arm. Ich öffne die Augen und blicke direkt in das schöne Gesicht dieses Mannes. Er strahlt mich an und sagt wieder nur: »Hello!« Ich bin froh, meine Sonnenbrille auf der Nase zu haben. Er schaut mich lange an und scheint mein Gesicht zu studieren. Nach geraumer Zeit fragt er nach Eric und Jelly und erklärt umständlich, daß wir heute nachmittag bei Priscilla zum Tee eingeladen sind. Auf dem Rücken liegend schaue ich in zwei mich sanft und hoffnungsvoll anblickende Augen. Als ich nicht sofort antworte, verändert sich sein Ausdruck, die Augen werden dunkler, ein stolzer Schimmer glänzt in ihnen. Ich kämpfe mit mir und frage dann doch, um welche Zeit wir kommen sollen.
Eric und Jelly sind einverstanden, und so warten wir zur verabredeten Zeit am Hoteleingang. Nach etwa zehn Minuten hält eines der überfüllten Matatus. Zwei lange Beine steigen aus, gefolgt vom langen Körper Lketingas. Er hat Edy mitgebracht. Ich kenne den Weg zu Priscilla noch vom ersten Besuch, mein Bruder allerdings schaut den Affen, die unweit des Weges spielen und essen, skeptisch zu.
Das Wiedersehen mit Priscilla ist sehr herzlich. Sie holt ihren Spirituskocher hervor und bereitet Tee. Während wir warten, diskutieren die drei miteinander, und wir schauen verständnislos zu. Immer wieder wird gelacht, und ich spüre, daß auch über mich gesprochen wird. Nach etwa zwei Stunden brechen wir auf, und Priscilla bietet mir an, jederzeit mit Lketinga hierherkommen zu können.
Obwohl ich für zwei weitere Wochen bezahlt habe, beschließe ich, aus dem Hotel auszuziehen und mich bei Priscilla einzuquartieren. Ich habe genug vom ewigen Disco-Besuch und den Abendessen ohne ihn. Die Hotelleitung warnt mich zwar, daß ich nachher wohl weder Geld noch Kleider besitzen werde. Auch mein Bruder ist mehr als skeptisch, doch hilft er mir, alles in den Busch zu schleppen. Lketinga trägt die große Reisetasche und scheint sich zu freuen.
Priscilla räumt ihre Hütte und zieht zu einer Freundin. Als es draußen finster wird und wir dem Moment des körperlichen Zusammentreffens nicht mehr aus dem Weg gehen können, setze ich mich auf die schmale Pritsche und warte mit klopfendem Herzen auf den lang ersehnten Augenblick. Lketinga setzt sich neben mich, und ich erkenne nur das Weiß in seinen Augen, den Perlmuttknopf auf der Stirn und die weißen Elfenbeinringe in den Ohren. Plötzlich geht alles sehr schnell. Lketinga drückt mich auf die Liege, und schon spüre ich seine erregte Männlichkeit. Noch bevor ich mir im klaren bin, ob mein Körper überhaupt bereit ist, spüre ich einen Schmerz, höre komische Laute, und alles ist vorbei. Ich könnte heulen vor Enttäuschung, ich hatte es mir völlig anders vorgestellt. Erst jetzt wird mir richtig bewußt, daß ich es mit einem Menschen aus einer mir fremden Kultur zu tun habe.
Weiter komme ich mit meinen Überlegungen nicht, denn schon wiederholt sich das Ganze. In dieser Nacht folgen noch weitere Anläufe, und nach dem dritten oder vierten »Beischlaf« gebe ich es auf, ihn mit Küssen oder anderen Berührungen etwas zu verlängern, denn das scheint Lketinga nicht zu mögen.
Endlich wird es hell, und ich warte darauf, daß Priscilla an die Tür klopft. Tatsächlich vernehme ich gegen sieben Uhr morgens Stimmen. Ich schaue hinaus und finde vor der Tür ein Becken voll Wasser. Ich hole es herein und wasche mich gründlich, weil ich überall am Körper rote Farbe von Lketingas Bemalung habe.
Er schläft immer noch, als ich mich bei Priscilla melde. Sie hat bereits Tee gekocht und bietet ihn an. Als sie mich fragt, wie ich meine erste Nacht in einer afrikanischen Behausung verbracht habe, sprudelt es aus mir heraus. Sichtlich verlegen hört sie zu und sagt: »Corinne, wir sind nicht wie die Weißen. Geh zurück zu Marco, mach Ferien in Kenia, aber suche keinen Mann fürs Leben.« Über die Weißen habe sie erfahren, daß sie gut zu den Frauen seien, auch in der Nacht. Massai-Männer seien da anders, so wie ich es gerade erlebt hätte, sei es normal. Massai küssen nicht. Der Mund sei zum Essen da, küssen, und dabei macht sie ein verächtliches Gesicht, sei schrecklich. Ein Mann fasse eine Frau unterhalb des Bauches niemals an, und eine Frau dürfe das Geschlechtsteil eines Mannes nicht berühren. Die Haare und das Gesicht eines Mannes seien ebenfalls tabu. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Ich begehre einen wunderschönen Mann und darf ihn nicht anfassen. Erst jetzt fällt mir die Szene mit dem mißglückten Kuß wieder ein und zwingt mich, das Gehörte zu glauben. Während des Gespräches hat Priscilla mich nicht angesehen, es muß ihr schwer gefallen sein, über dieses Thema zu sprechen. Mir geht vieles durch den Kopf, und ich bezweifle, ob ich alles richtig verstanden habe. Plötzlich steht Lketinga in der Morgensonne. Mit nacktem Oberkörper, seinem roten Hüfttuch und den langen roten Haaren sieht er traumhaft aus. Die Erlebnisse der letzten Nacht rücken in den hintersten Teil meines Gehirns, und ich weiß nur, daß ich diesen Mann will und keinen anderen. Ich liebe ihn, und außerdem ist alles erlernbar, beruhige ich mich.
Später fahren wir mit einem überfüllten Matatu nach Ukunda, das nächste größere Dorf. Dort treffen wir auf weitere Massai, die in einem einheimischen Teehaus sitzen. Es besteht aus ein paar Brettern, die notdürftig zusammengenagelt sind, einem Dach, einem langen Tisch, sowie ein paar Stühlen. Der Tee wird in einem großen Kübel über dem Feuer gekocht. Als wir uns setzen, werde ich teils neugierig, teils kritisch gemustert. Und wieder wird wild durcheinandergeredet. Es geht eindeutig um mich. Ich mustere alle und stelle fest, daß keiner so gut und so friedlich aussieht wie Lketinga.
Stundenlang sitzen wir da, und mir ist egal, daß ich nichts verstehe. Lketinga ist rührend besorgt um mich. Er bestellt ständig etwas zu trinken und später auch einen Teller Fleisch. Es sind zerkleinerte Teile einer Ziege, die ich kaum herunterkriege, weil sie noch blutig und sehr zäh sind. Nach drei Stücken würgt es mich, und ich gebe Lketinga zu verstehen, er solle es essen. Doch weder er noch die anderen Männer nehmen etwas von meinem Teller, obwohl deutlich zu sehen ist, daß sie hungrig sind.
Nach einer halben Stunde stehen sie auf, und Lketinga versucht, mir mit Händen und Füßen etwas zu erklären. Ich verstehe allerdings nur, daß alle essen gehen wollen, ich jedoch nicht mitgehen kann. Ich will aber unbedingt mitgehen. »No, big problem! You wait here«, höre ich. Dann sehe ich, wie sie hinter einer Wand verschwinden und kurz darauf auch Berge von Fleisch. Nach einiger Zeit kommt mein Massai zurück. Er scheint den Bauch voll zu haben. Ich begreife immer noch nicht, warum ich hierbleiben mußte, und er meint nur: »You wife, no lucky meat.« Ich werde am Abend Priscilla danach fragen.
Wir verlassen das Teehaus und fahren mit dem Matatu zum Strand zurück. Beim Africa-Sea-Lodge steigen wir aus und beschließen, Jelly und Eric zu besuchen. Am Eingang werden wir angehalten, doch als ich dem Wärter klarmache, daß wir nur meinen Bruder und seine Freundin besuchen, läßt er uns kommentarlos ein. An der Rezeption werde ich vom Manager lachend begrüßt: »So, you will now come back in the hotel?« Ich verneine und erwähne, daß es mir sehr gut gefällt im Busch. Er zuckt nur mit den Schultern und meint: »Mal sehen, wie lange noch!«
Wir finden die beiden am Pool. Aufgeregt kommt Eric zu mir: »Wird aber auch Zeit, daß du dich wieder einmal zeigst!« Ob ich gut geschlafen habe. Über diese Besorgnis muß ich lachen und erwidere: »Sicher habe ich schon komfortabler genächtigt, aber ich bin glücklich!« Lketinga steht da, lacht und fragt: »Eric, what’s the problem?« Einige badende Weiße starren uns an. Ein paar Frauen laufen auffällig langsam an meinem geschmückten und mit neuer Bemalung gefärbten, schönen Massai vorbei und bestaunen ihn unverhohlen. Er seinerseits verschenkt keinen Blick, da es ihn eher geniert, soviel Haut ansehen zu müssen.
Wir bleiben nicht lange, da ich einiges einkaufen möchte, Petroleum, WC-Papier und vor allem eine Taschenlampe. Letzte Nacht blieb es mir erspart, mitten in der Nacht das Busch-WC aufsuchen zu müssen, aber das wird nicht so bleiben. Das WC befindet sich außerhalb des Dorfes. Man erreicht es über eine halsbrecherische Hühnerleiter etwa zwei Meter über dem Boden. Dort befindet sich aus geflochtenen Palmenblättern eine Art Häuschen mit zwei Fußbodenbrettern und einem größeren Loch in der Mitte. Wir finden alles in einem kleinen Laden, wo anscheinend auch die Hotelangestellten ihre Ware beziehen. Jetzt erst merke ich, wie preiswert hier alles ist. Für meine Verhältnisse kostet, außer den Taschenlampen-Batterien, der Einkauf fast nichts.
Ein paar Meter weiter befindet sich eine weitere Bruchbude, wo mit roter Farbe »Meat« angeschrieben ist. Lketinga zieht es dorthin. An der Decke hängt ein riesiger Fleischerhaken und daran eine gehäutete Ziege. Lketinga schaut mich fragend an und meint: »Very fresh! You take one kilo for you and Priscilla.« Mich schüttelt es beim Gedanken, dieses Fleisch essen zu müssen. Trotzdem willige ich ein. Der Verkäufer nimmt eine Axt und schlägt dem Tier ein Hinterbein ab, um mit zwei, drei weiteren Schlägen unsere Portion abzutrennen. Der Rest wird wieder an den Haken gehängt. Alles wird in Zeitungspapier gewickelt, und wir ziehen in Richtung Dorf.