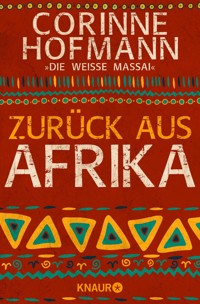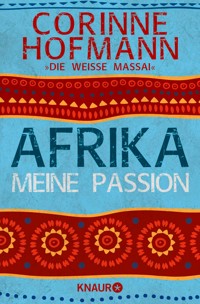
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Nach ihrer letzten Lesung will Corinne Hofmann die »weiße Massai« endgültig hinter sich lassen und sich eine Auszeit gönnen. Sie bereist ferne Länder und findet doch immer wieder vertraute Anklänge an Afrika. So bricht sie erneut auf in ihre zweite Heimat, wandert zunächst durch die Halbwüste Namibias, bevor sie zurückkehrt nach Kenia und dort eintaucht in die beengten Slums von Nairobi. Als ihre Tochter Napirai einige Monate später den Wunsch äußert, ihre afrikanische Familie kennenzulernen, machen sich Mutter und Tochter gemeinsam auf den Weg nach Barsaloi. Dort kommt es zu einer ersten behutsamen Annäherung zwischen Napirai und ihrem Vater Lketinga sowie ihrer Großmutter, Mama Masulani. Der letzte Teil der mitreißenden Biographie der weißen Massai.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 370
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Corinne Hofmann
Afrika, meine Passion
Über dieses Buch
Nach ihrer letzten Lesung will Corinne Hofmann die »weiße Massai« endgültig hinter sich lassen und sich eine Auszeit gönnen. Sie bereist ferne Länder und findet doch immer wieder vertraute Anklänge an Afrika. So bricht sie erneut auf in ihre zweite Heimat, wandert zunächst durch die Halbwüste Namibias, bevor sie zurückkehrt nach Kenia und dort eintaucht in die beengten Slums von Nairobi. Als ihre Tochter Napirai einige Monate später den Wunsch äußert, ihre afrikanische Familie kennenzulernen, machen sich Mutter und Tochter gemeinsam auf den Weg nach Barsaloi. Dort kommt es zu einer ersten behutsamen Annäherung zwischen Napirai und ihrem Vater Lketinga sowie ihrer Großmutter, Mama Masulani.
Der letzte Teil der mitreißenden Biographie der weißen Massai.
Inhaltsübersicht
Widmung
Abschied von der Weißen Massai – und doch wieder Afrika
Der harte Fußmarsch durch die Heimat der Himba
Allein mit zwei Männern und Kamelen
Neue Herausforderungen in Kenia
Das Grün aus dem Slum
Anne, die stille Kämpferin
Grünkohl statt Rattengift – Irenes Rettung
Doreens unbändiger Lebenswille
Jamii Bora
Joyce – von der Straßenmutter zur erfolgreichen Geschäftsfrau
Bernhard und John – die Bosse der Gang
Kaputiei Town – ein afrikanisches Wunder
Drei Fische – Grundstein für Claris’ Haus
Janes Weg aus der Prostitution
Mathare United – die Profikicker aus dem Slum
Ein aufregendes Spiel
Das Jubiläumsfest
Außergewöhnliche Fußballstars
Endlich mit Napirai in Barsaloi
Große Überraschung in Mombasa
Nachwort
Bildteil
Der »Förderverein Kenia WEISSE MASSAI«
Anzeige
Dieses Buch widme ich den starken und Mut machenden Menschen in Kenia.
Abschied von der Weißen Massai – und doch wieder Afrika
Zehn Jahre »Weiße Massai« sind genug – dachte ich. Meine letzte Lesung findet am 25. Oktober 2008 vor begeistertem Publikum in der kleinen Stadt Lauchhammer in Brandenburg statt. Mit einem weinenden und einem lachenden Auge verlasse ich unter lang anhaltendem Applaus die Bühne, um mich an einem kleinen Tisch für die letzte Signierstunde einzufinden. Viele der etwa 300 Zuhörer und Zuhörerinnen wollen mich ein letztes Mal sehen und sich mit Händedruck verabschieden. Immer wieder vernehme ich: »Frau Hofmann, bitte, Sie müssen weiterschreiben. Ihr Leben ist so spannend. Lassen Sie uns doch bitte wissen, wie es Ihrer afrikanischen Familie geht, und erzählen Sie uns, wenn Ihre Tochter ihren Vater besucht. Ach, einfach alles interessiert uns, Sie schreiben so wunderbar.« So oder ähnlich höre ich es die folgende Stunde, bevor ich die letzte Signatur in eines meiner Bücher setzen darf.
Ich habe die Veranstaltungen sehr geliebt, aber zu diesem Zeitpunkt denke ich, dass es noch ein Leben ohne Afrika und ohne »Weiße Massai« geben muss.
Bereits zwei Wochen nach diesem Auftritt begebe ich mich mit einer lieben und interessanten Freundin auf eine vierwöchige Reise durch Indien, denn schon lange wollte ich die Kultur dieses Landes kennenlernen. Natürlich sind vier Wochen nicht viel, aber immerhin ein Anfang, und wir beschließen, hauptsächlich den Norden zu erkunden.
Unsere erste Station ist Delhi, eine riesige Stadt, in der man permanent von gigantischen Menschenmassen umgeben ist. Wir haben uns ein Auto mit Fahrer gemietet, und so kutschiert er uns geschickt zwischen den Rikschas und den Dreiradtaxis zu den verschiedenen Sehenswürdigkeiten. Alles ist interessant, aber schon bald merke ich, dass mir bei dieser Art zu reisen der Kontakt zu den Einheimischen fehlt.
Als wir bei einem Markt vorbeikommen, bitte ich den Fahrer anzuhalten, damit ich die Umgebung zu Fuß erkunden kann. Ich muss riechen, fühlen und schmecken, sonst bin ich in einem Land nicht angekommen. Der Fahrer ist nicht begeistert und meint: »Hier bin nicht einmal ich als Inder zu Fuß unterwegs.« Dennoch steigen wir aus, und augenblicklich fühle ich mich wohler, obwohl wir sofort von Hunderten von Augenpaaren fixiert werden.
Ein Mann hat große Fische unter einem kleinen Tisch auf dem Boden ausgebreitet und hockt barfuß auf der Verkaufsfläche, auf der er weitere kleine Meerestiere zum Verkauf anbietet. Seine nackten Zehen befinden sich sozusagen in engster Nachbarschaft mit Krabben, Muscheln und Fischchen. Keinen halben Meter daneben läuft die Menschenmenge vorbei. Weiter hinten kocht ein beleibter, mit einem weißen Umhang bekleideter Mann in mehreren Töpfen irgendetwas Essbares. Vor ihm sitzen einige Männer auf der Straße, und es sieht so aus, als warteten sie auf die Mahlzeit. Immer wieder quetschen sich Menschen mit beladenen Handkarren an uns vorbei. Ab und an streckt uns eine Bettlerin ihre leere Hand entgegen. Es riecht nach allem Möglichen, einerseits würzig nach gekochtem Essen, gleichzeitig stinkt es fürchterlich nach Abwasser. Und über allem schwebt der Geruch nach Fisch. Wir beobachten einen Fleischverkäufer, der seine zerlegten Tiere auf mehrere Haufen verteilt hat. Vorne auf einer Plastikkiste liegen drei blutverschmierte Tierköpfe mit blau angemalten Hörnern. Daneben sind die abgetrennten Füße aufgereiht, und dahinter auf weiteren roten Plastikkisten, die als Verkaufsstand dienen, ist das eigentliche Fleisch aufgestapelt. Es riecht nach Blut. Der Verkäufer hackt mit einem Beil die restlichen Stücke entzwei, während ihm sein etwa neunjähriger Sohn dabei hilft. Wir steigen über Abfall jeglicher Art, der überall auf dem Boden verstreut ist.
Auch wenn bei uns diese Form von Hygiene kaum vorstellbar ist – hier herrscht pures Leben. Mein Herz macht einen Sprung und ich fühle mich an »mein« Afrika erinnert. In Nairobi ging es ähnlich zu.
Auf unserer weiteren Reise besichtigen wir wunderschöne Paläste, Museen und eine Reihe anderer Sehenswürdigkeiten. Einmal geraten wir sogar in eine Hochzeitsgesellschaft, bei der ich mir vorkomme, als wäre ich in einem Märchen aus Tausendundeiner Nacht gelandet. Vieles gefällt mir und manches finde ich interessant, aber ich betrachte das meiste mit dem distanzierten Blick einer durchreisenden Touristin.
Doch das ändert sich, als wir in Richtung Pushkar reisen. Diese kleine wunderschöne Stadt, in deren Mitte sich der heilige Pushkar-See befindet, liegt am Rande der Wüste Thar. Während der Fahrt merke ich, wie sich die Landschaft verändert. Sie wird trockener und einer Halbwüste ähnlicher. Ich sehe Frauen in ihren leuchtend roten oder rosa Gewändern durch die Steppe wandern, und sogleich erinnere ich mich an Barsaloi. Wenn es auch anders ist, so rufen die karge Gegend und die Farbtupfer doch unwillkürlich eine Sehnsucht in mir wach. Es ist unglaublich, wie schnell mich die Vergangenheit einholt! Mit jedem Kilometer wird dieses Gefühl intensiver und überall ziehe ich Vergleiche mit dem Samburu-Land. Wenn ich Frauen sehe, die Krüge oder Kanister mühsam mit einem Becher mit Wasser füllen, um sie anschließend auf dem Kopf durch die Halbwüste zu tragen, fühle ich mich schon fast zu Hause. Es ist verrückt. Ich wollte weg von Afrika und begegne in Indien doch wieder meiner zweiten Heimat. Meine Freundin ermahnt mich leicht genervt: »Corinne, wir sind in Indien und nicht in Afrika!« Ja, ich weiß es, aber erst jetzt berührt etwas meine Seele. Vorher habe ich zwar gestaunt, aber nichts Tieferes empfunden.
Wir werden Zeugen der Pushkar Mela, eines bedeutenden religiösen Festes. Die Inbrunst, mit der sich Massen von Menschen den rituellen Handlungen hingeben, ist für mich faszinierend, aber auch ein wenig fremd.
Das nächste Ziel, nur eine Flugstunde von Pushkar entfernt, ist Mumbai. Für mich ist es fast wie ein Kulturschock, als ich sehe, wie modern und freizügig sich die Mädchen und Frauen hier kleiden. Willkommen in der modernen Welt! Die Streifzüge durch diese überbordende Mega-City sind sehr aufregend, aber auch extrem anstrengend. Deshalb gönnen wir uns zum Abschluss unserer Reise eine viertägige Erholung an einem wunderschönen Strand im Süden Indiens.
Als wir unser dortiges Hotel aufsuchen, wundern wir uns über die vielen schwer bewaffneten Polizisten vor dem Gebäude. Jeder Wagen wird genauestens untersucht und unser Gepäck und wir selbst werden vor dem Hotel gescannt. Wir vermuten, dass sich wohl eine hohe Persönlichkeit im Hause befinden muss. Erst viel später am Abend erfahren wir durch das Fernsehen, dass sich in Mumbai, das wir ein paar Tage vorher verlassen haben, ein Terroranschlag ereignet hat. Es wurden Geiseln genommen und etliche Tote sind zu beklagen. Genau in dem Lokal, in dem wir eingekehrt sind, wurden ebenfalls einige Menschen getötet. Mit Entsetzen und klopfendem Herzen verfolgen wir die Meldungen und danken Gott, dass wir noch am Leben sind. Wieder einmal hatte ich einen Schutzengel!
Ende November kehre ich nach Lugano zurück. Indien hat mich fasziniert, aber nicht so tief berührt wie Afrika. Vielleicht müsste ich länger und langsamer reisen. Doch Afrika bleibt für mich einmalig. Man steigt aus dem Flieger, und die Luft vibriert. Man fährt durch die Gegend und spürt sofort die unglaublich pulsierende Energie. Man schaut die Menschen an und sieht in den Gesichtern Emotionen, die uns Europäer tief im Inneren berühren. Das habe ich in Indien in diesem Ausmaß nicht so empfinden können.
Der Dezember zieht kalt ins Land und alle sind mit Weihnachtsvorbereitungen beschäftigt. Ich selbst muss mich erst darauf einstellen, da Indien von jeglicher Weihnachtsstimmung weit entfernt war.
Wie wahrscheinlich viele Menschen auf dieser Welt lasse auch ich das Jahr mit besinnlichen Gedanken, was wohl kommen mag, ausklingen. In Indien ist es mir leider nicht gelungen, eine Idee zu entwickeln, wie meine Beschäftigung im nächsten Jahr aussehen könnte. Aber ich bin in der glücklichen Lage, mir Zeit lassen zu können.
Am 30. Dezember 2008 liege ich im Bett und blättere in einem Reisemagazin, das durch ein wunderschönes Indien-Cover mein Interesse geweckt hat. Plötzlich fällt mir eine Anzeige ins Auge, die mich sofort in den Bann zieht:
»Wo die Welt noch wild ist: Naturverbundener Abenteuer-Fotograf sucht zuverlässige Autorin/Reisepartnerin mit viel Mut und Humor für Expeditionen. Bin zu Fuß mit Kamelen unterwegs. Interessiert?«
Und ob ich interessiert bin! Meine Leidenschaft ist das Bergwandern. Die ganze Nacht hindurch überlege ich, was wohl hinter der Anzeige stecken mag. Was versteht der Inserent unter wild und abenteuerlich? Mit meinen extremen »Buscherfahrungen« bin ich in dieser Hinsicht nicht so leicht zu beeindrucken. Doch am nächsten Morgen steht fest: Corinne, schreibe dem Mann, und du wirst sicher eine interessante Reaktion erhalten. Auf diese Weise könnte das kommende Jahr durchaus spannend beginnen.
Noch am letzten Tag im alten Jahr gebe ich per E-Mail mein Interesse bekannt und bekomme bereits zwei Stunden später eine Antwort. Ich erfahre, dass es sich um ein sechswöchiges Wüstentrekking in Nordnamibia handelt. Also doch wieder Afrika! Mein Herz macht einen riesigen Hüpfer, und meine Neugier ist definitiv entfacht, noch bevor ich zur Silvesterparty nach Zürich aufbreche.
Namibia grenzt im Süden an Südafrika und im Norden an Angola. Zwischen Namibia und Angola fließt der Kunenefluss. Hier, im sogenannten Kaokoveld, sind die berühmten Himba beheimatet. Dieser ursprüngliche Volksstamm fasziniert mich schon lange. Wie auch die Samburu und die Massai gehören sie zu den letzten Halbnomaden Afrikas. In meiner Wohnung hängen schon seit langem zwei große Fotos von wunderschönen Himba-Frauen. Ihre auffallendsten Merkmale sind ihre rot eingefärbte Haut und die langen roten, in viele Zöpfe gedrehten Haare sowie ihre halbnackte Erscheinung.
Tatsächlich treffe ich den »Abenteurer« schon eine gute Woche später. Er macht einen recht angenehmen Eindruck auf mich, wenn er auch etwas dominant wirkt, doch seine Ausführungen zur Tour erscheinen mir kompetent. Wir werden das Kaokoveld durchlaufen, begleitet von einem jungen einheimischen Kameltreiber, der sich um die beiden Kamele kümmern wird, die unsere Ausrüstung tragen. Ich erfahre, dass man durch diese Art zu reisen ganz nahen Kontakt zu den Himba bekommen kann, vor allem durch die Kamele, da sie diese Tiere im Norden nicht kennen. Wir diskutieren hin und her, und mich reizt die Herausforderung sehr. Sechs Wochen wandern, kochen am Lagerfeuer, unter freiem Himmel schlafen, durch die Steppen ziehen und dabei die Wildtiere beobachten – das ist genau das Richtige. Dass dieses Unternehmen auch zwischenmenschliche Probleme mit sich bringen könnte, ist mir durchaus klar. Schließlich werde ich mich auf zwei mir fremde Männer in der absoluten Wildnis, ohne Handy-Empfang, verlassen müssen. Doch ängstlich war ich noch nie, und für den Notfall kann ich ein Satellitentelefon mitnehmen. So beruhige ich meine Lieben zu Hause und sage dem Abenteurer bereits zehn Tage später zu – allerdings nicht als Autorin, sondern als ganz normale Teilnehmerin, die das Trekking bezahlt.
Natürlich bekomme ich in meinem Verwandten- und Freundeskreis jede Menge Bedenken zu hören, dass ich mich viel zu übereilt entschlossen hätte. Aber so ist meine Natur: Wenn mich etwas packt, brauche ich nicht lange zu überlegen. Zudem habe ich seit Jahren das erste Mal keine Verpflichtungen mehr. Keine Auftritte, keine Verträge. Und meine Tochter bestreitet nach ihrer Visagistenausbildung nun auch noch die Coiffeurlehre, um anschließend in der Film-, Fernseh- oder Modewelt arbeiten zu können.
Ich stelle mir vor, wie sich durch das tägliche Wandern durch die Wüste, fernab jeglicher Zivilisation, begleitet von zwei liebenswerten, gemütlichen Kamelen, eine neue Perspektive für mich ergeben könnte. Langes Gehen soll ja eine meditative Denkweise hervorrufen.
Der harte Fußmarsch durch die Heimat der Himba
Am 15. Mai 2009 ist es so weit. Ich fliege nach Windhuk, allerdings nicht ohne Probleme. Drei Stunden vor Abflug wird die Swiss-Maschine annulliert und ich soll einen Tag später fliegen. Darauf kann ich mich jedoch nicht einlassen, da ich mich zusätzlich für ein zehntägiges Vorprogramm angemeldet habe, das bereits am nächsten Tag beginnt. In diesen zehn Tagen wollen wir den berühmten Etosha-Nationalpark besuchen und anschließend ein sechstägiges Trekking am Kunenefluss durchführen, das von weiteren vier Teilnehmern gebucht wurde. Mir erscheint es sinnvoll, daran teilzunehmen, um mich einlaufen und akklimatisieren zu können. Außerdem lerne ich meine beiden Begleiter besser kennen, bevor ich alleine mit ihnen unterwegs sein werde. Also muss ich unbedingt heute fliegen!
Nach langen Telefonaten hetze ich zum Flughafen und kann schließlich mit Lufthansa via Frankfurt abheben. Nach vielen Stunden überfliegen wir Kenia, und mein Herz zieht sich zusammen. Schon sechs Jahre habe ich meine Familie nicht mehr gesehen. Doch ich werde erst wieder hinreisen, wenn meine Tochter ihre afrikanischen Wurzeln entdecken möchte. Wie sollte ich ihrem Vater und ihrer lieben alten Großmutter auch erklären, warum ich wieder alleine gekommen bin? Noch weiß ich nicht, dass dies bereits ein gutes Jahr später der Fall sein wird, unter anderem beeinflusst durch meine jetzige Reise nach Namibia.
In Windhuk gelandet, warte ich vergebens auf mein Gepäck – es kommt nicht an. Das sind natürlich nicht gerade tolle Voraussetzungen, ein Trekking ohne Gepäck zu beginnen. Gott sei Dank trage ich meine Wanderschuhe an den Füßen, und meinen teuren Schlafsack habe ich im Handgepäck dabei. Dennoch ist die Situation sehr unangenehm, weil wir am nächsten Tag sehr früh weiterreisen und mehrere hundert Kilometer zurücklegen werden. Für die kommenden zwei Monate brauche ich auf jeden Fall mehr Ausrüstung als nur die Kleidung an meinem Körper. Trotz meiner misslichen Lage fahren wir kurz nach der Ankunft mit einem Minibus los.
Windhuk ist völlig anders als die mir bekannten Städte in Ostafrika. Viele Straßen, Bäckereien, Buchläden und andere Geschäfte tragen deutsche Namen. Nirgendwo sehe ich die mir vertrauten geballten afrikanischen Menschenströme, die sich durch die Straßen wälzen. Wir haben Windhuk noch gar nicht verlassen, als unser Minibus an den Straßenrand tuckert und nicht mehr fahrtüchtig ist. Das Gaspedal ist gebrochen. Und das an einem Sonntag! Langsam steigt in mir die Frage hoch, ob ich mit Gewalt an dieser Reise gehindert werden soll. Erst der Flug, dann kein Gepäck und nun schon das dritte Problem. Was wird noch alles passieren?
Der Tourguide telefoniert herum, und schließlich wird der Wagen in eine Garage gebracht, wo kurz darauf zwei dunkelhäutige Mechaniker in eleganten Sonntagsanzügen unters Auto kriechen und das gebrochene Pedal zusammenschweißen. Endlich kann es voll bepackt losgehen.
Auf einer schnurgeraden, gut ausgebauten, geteerten Straße fahren wir endlos in Richtung Norden. Links und rechts dieser »Autobahn« sehe ich Zäune, so weit das Auge reicht. Nach mehreren Kilometern wechseln Art und Farbe der Einfriedungen, was bedeutet, dass sich auf den kommenden Kilometern ein neuer Landbesitzer eingezäunt hat. Es handelt sich um Farmer, die meist neben der Rinderzucht gewöhnliche Safaris bis hin zu Wildabschuss-Safaris auf ihren riesigen Grundstücken anbieten.
Außer in ein paar vorbeifahrenden Autos sieht man kaum Menschen. Namibia ist sehr dünn besiedelt. Lediglich zirka zwei Millionen Menschen leben in diesem Land, das etwa doppelt so groß wie Deutschland ist. Erst nach vielen Stunden erblicke ich die ersten Personen, die zu Fuß unterwegs sind. Kurz darauf taucht eine Siedlung auf. Da es in den vergangenen Tagen heftig geregnet hat, steht vieles unter Wasser.
Wir erreichen den berühmten Etosha-Nationalpark. Hier werden wir uns zwei Tage lang aufhalten und die Nächte bereits in unseren Zelten verbringen. Die Etosha-Pfanne, die normalerweise als ehemaliger See trocken ist und durch den Salzgehalt weiß erscheint, sieht jetzt nach dem großen Regen wie ein Meer aus. Bis zum Horizont erstreckt sich das Wasser, das allerdings sehr flach sein soll. Vor dem glitzernden Nass, an dem wir entlangfahren, stolzieren viele Giraffen, und hin und wieder kreuzt ein aufgeplusterter Strauß unseren Weg. Darüber hinaus können wir etliche Impalas, Zebras, Wildschweine und allerlei Vögel bewundern. Es ist unglaublich schön, in dieses tiefblaue, manchmal silbern schimmernde Wasser zu schauen. Das hohe gelbe Steppengras, durchsetzt mit einzelnen grünen Büschen oder dunklen abgestorbenen Bäumen und Wurzeln, bildet einen wunderbaren Kontrast zum strahlenden Blau des Himmels. Ich kann mich kaum sattsehen an den eindrucksvollen Bildern.
Unweit unseres Nachtlagers befindet sich ein Wasserloch, wo man mit etwas Geduld die Tiere aus nächster Nähe beobachten kann. Wir haben Glück, denn eine große Herde von Zebras und Gnus ist gerade auf dem Weg zur Wasserstelle. Es sind so viele Tiere, dass sie sich gegenseitig stoßen oder beißen, um den besten Platz an der Tränke zu ergattern. Immer wieder schauen sich die Zebras um, ob sich auch kein Löwe anschleicht, während sie trinken. Aber es streunen nur einige Schakale am Wasserloch vorbei, die mit Ausnahme der aufgeregt flatternden Vögel niemanden beeindrucken. Nachts ist es besonders spannend, da die Wasserlöcher beleuchtet werden und wir deshalb beste Sicht haben. Eine Herde Elefanten trottet gemächlich heran. Obwohl sie so groß sind, machen sie fast kein Geräusch. Nur ein leichtes Plätschern ist zu hören, wenn sie mit dem Rüssel Wasser zum Mund führen. Bald gesellen sich zwei Nashörner dazu. Die Szenerie verströmt eine mystische Aura. Wir sitzen hinter einem sicheren Elektrozaun, während vor uns eine Live-Show stattfindet. Nachts liege ich im Zelt und lausche gespannt den Klängen der Natur. Ganz nahe an der dünnen Zeltwand schnüffelt ein Tier – welches, weiß ich nicht. Mitten in der Nacht wache ich auf, da vom Wasserloch lautes Löwengebrüll ertönt. Scheinbar wird gerade ein Tier gerissen. Wäre es nicht so dunkel und kühl, würde ich gerne zum Schauplatz laufen. So liege ich mit klopfendem Herzen, bis ich wieder einschlafe.
Am nächsten Tag fahren wir weiter durch den riesigen Nationalpark und bestaunen aufs Neue den vielfältigen Wildbestand. Doch so schön das alles ist, ich fiebere dem Trekking entgegen und der Wildnis ohne Zaun.
Nach über 1000 Kilometern Autofahrt nähern wir uns der Ortschaft Okangwati, wo unser sechstägiges Trekking beginnen soll. Mir gefällt diese Gegend sehr gut, sie ist trocken und steppenartig und erinnert mich an Maralal in Nordkenia. Und außerdem sind die Zäune verschwunden.
Bei zwei ausgewanderten Deutschen, die ein einfaches Hilfsprojekt betreiben, können wir unsere Zelte aufschlagen und werden anschließend von der Dame des Hauses verköstigt. In völliger Dunkelheit, abends um neun Uhr, hält plötzlich ein Auto bei unserem Camp. Ein Mann steigt aus und trägt in der rechten Hand meine große schwere Reisetasche. Ich kann es kaum glauben, dass nach etlichen Telefonaten und vielen Stoßgebeten mein Gepäck buchstäblich in allerletzter Minute doch noch aufgetaucht ist. Der Überbringer ist uns 1000 Kilometer nachgefahren und kehrt in derselben Nacht wieder nach Windhuk zurück. Ich bin überglücklich und kann zum ersten Mal seit Tagen meine Kleider wechseln.
Nach dem Frühstück begegne ich den ersten Himba. Zwei ältere Frauen überqueren das ausgetrocknete Flussbett, um in das Dorfzentrum zu gelangen, das aus drei einfachen Läden, einigen Bars und natürlich mehreren Kirchen besteht. Die Frauen sind von Kopf, inklusive Haartracht, bis Fuß mit rotem Butterfett eingestrichen. Wenn man vor den Himba steht, denkt man nicht an »schwarze« Afrikaner. Das rote Körperfett schützt die Haut vor Kälte, aber auch vor Sonne und Moskitos. Es ist sozusagen ein Bestandteil der Kleidung. Die zwei älteren Frauen tragen auf ihren Köpfen große Lasten, die in ebenfalls rot eingeriebene Tücher oder Ziegenlederbeutel verpackt sind. Ihre langen roten, kunstvoll eingedrehten Zöpfe lugen darunter hervor. Zwischen den nackten roten Brüsten baumelt eine weiße Schneckenmuschel und um den Hals tragen sie dezenten Schmuck. Am eindrucksvollsten finde ich den ledernen, ockerrot eingefärbten Lendenschurz. Vorne ist er sehr kurz, wie ein Minirock, und nach hinten wird er glockig und wadenlang. Die beiden sind barfuß unterwegs, tragen aber wie alle Himba einen etwa 15 Zentimeter hohen, schweren silbernen Knöchelschmuck. Trotz ihres Alters wirken ihre Bewegungen graziös, während sie durch das sandige trockene Flussbett gehen. Erst diese Begegnung löst in mir das Gefühl aus, dass ich wieder in »meinem« Afrika bin. Ihr Anblick ergreift mich kolossal und mir steigen Tränen in die Augen. Zu sehr erinnern mich die Bilder an Barsaloi und die Samburu-Frauen.
Da noch Zeit bleibt bis zu unserem Aufbruch, schaue ich mich ein wenig im Dorfkern um. Immer wieder begegne ich nun den »roten Menschen«. Mal sind es junge Mädchen mit knospenden Brüsten, die große Kürbisse auf ihrem Kopf zum Markt tragen, mal sind es Mütter mit ihren Kindern auf dem Arm, die vor einer Bar sitzen. Ich bin erstaunt, wie viel Alkohol in den Bars angeboten wird. Offensichtlich wird hier nicht nur Bier konsumiert, sondern auch Hochprozentiges. Aus einer Bar ertönt laute Disco-Musik. In der Mitte des Raumes befindet sich ein Billardtisch, an dem sich drei junge Himba-Männer die Zeit vertreiben. Sie bieten ein groteskes Bild. Vorne tragen sie einen kurzen blauen Stofflendenschurz und hinten ein langes Stofftuch. Die Füße stecken in Socken und groben schwarzen Lederschuhen. Ihre Oberkörper sind mit modernen T-Shirts bekleidet. Ihren Hals ziert ein dicker Silberschmuckring. Die Haare sind links und rechts rasiert, und in der Mitte prangt ein großer schwarzer Zopf, der von einer Art Tuch oder einem Hütchen eingefasst und versteckt wird. Schnell wird mir klar, dass hier die Frauen die Attraktiveren sind. Die Männer wirken fast unscheinbar neben den rot leuchtenden weiblichen Wesen. Auch sind die Frauen offen, neugierig und sehr fröhlich. Etwas unbeholfen bewegen sie ihre roten Körper zur modernen Musik. Während ich weiterschlendere, entdecke ich immer mehr Frauen, die in Gruppen zusammenstehen und lachen und plaudern. Die Männer schauen meistens etwas mürrisch.
Ich erreiche einen kleinen Markt, wo eine Herero-Frau duftende Kräuter verkauft. Es sind keine Kochkräuter, sondern ausschließlich Dufthölzchen-Blätter oder Samen, die die Mädchen benutzen, um sich zu parfümieren. Später erfahre ich sogar, dass einige Kräuter in die Glut gestreut werden und die Frauen sich kurz darüberhocken, um im Intimbereich betörend zu riechen. Neben den Gewürzsäcken stehen kleine geschnitzte Himba-Puppen und an einem einfachen Holzgestell hängen lederne rote Lendenschurze, bestickt mit kleinen Muscheln oder verziert mit Metallteilchen. Ich nehme einen Schurz in die Hand und bin überrascht, wie schwer dieses Kleidungsstück ist. Auch riecht es recht eigenartig nach einem Gemisch aus Leder, duftenden Kräutern und ranziger Butter. Nein, so etwas kann ich nicht in meine Wohnung hängen, geht es mir durch den Kopf.
Ich bin erstaunt, wie sehr sich die Herero in ihrem Äußeren von den Himba unterscheiden, obwohl sie mit ihnen verwandt sind, ähnlich wie die Massai mit den Samburu. Ein Erkennungsmerkmal bei den Frauen sind ihre großen Querhüte sowie die mehrschichtigen, bodenlangen Kleider. Dieses Kostüm tragen die Herero-Frauen heute mit Stolz, obwohl sie es erst durch die Missionierung kennengelernt haben. Sie sind das pure Gegenteil zu den wenig bekleideten Himba-Frauen. Am Ende des kleinen Marktes gelange ich zum kulinarischen Teil. Hier sitzen Frauen am Boden und kochen auf offenem Feuer in großen schwarzen Töpfen Fleisch, das sie nebenan beim Schlachter gekauft haben. Im Augenblick hängen zwei Ziegenhälften an Haken in einem Holzunterstand im Freien und warten auf einen Käufer.
In dieser archaischen Idylle wirken die wenigen Pick-ups, die neben einer einfachen viereckigen Lehmhütte oder vor einem Laden stehen, wie Fremdkörper. Alles geht gemächlich voran. Die Menschen scheinen keine Hektik zu kennen.
Auf dem Rückweg zu unserer Gruppe begegne ich einem älteren Himba-Mann, der mein Interesse weckt. Er ist offensichtlich auf dem Weg zur Bar. Groß und edel, ist er trotz seines Alters eine beeindruckende Erscheinung. Auch er ist komplett mit rotem Ocker eingerieben. Auf dem Kopf trägt er eine Art Wollmütze, darüber eine Fliegerbrille und in der linken Hand einen Klappstuhl. An seiner Hüfte hängt in einem Halfter ein Buschmesser und unter dem rechten Arm lugt ein langer Stock hervor. Sein Hals ist mit dem typischen silbernen Ring geschmückt. Der Mann schaut mich kurz an und grüßt mit »Moro, perivi«. Noch verstehe ich es nicht und lächle verlegen. Erst später weiß ich, dass es sich hierbei um die Begrüßung »Hallo, wie geht es dir?« handelt, die ich in den kommenden Wochen noch viele Male hören werde.
Endlich geht es los. Wir sitzen hinten im Pick-up und fahren zum Ausgangspunkt unserer gemeinsamen Tour. Zum ersten Mal übernachten wir draußen in der Wildnis. Jeder stellt sein Zelt selbständig auf und richtet sich ein. Plötzlich hören wir ein seltsames Brüllen, und als ich den Kopf drehe, sehe ich einen jungen Mann mit zwei Kamelen lachend auf uns zumarschieren. Der Kameltreiber, der auch die sechswöchige Tour begleiten wird, versucht auf angenehm sanfte Weise, die Kamele zum Hinsetzen zu bewegen. Ich bin erleichtert über das offensichtlich gutmütige Wesen des jungen Namibiers. Auch die Kamele gefallen mir sehr. Mit ihren dicken Lippen und den großen Kulleraugen, die mit einem dichten Wimpernkranz umgeben sind, muss man sich einfach in sie verlieben. Es handelt sich um zwei Männchen, die erstaunlich groß und kräftig sind. Das müssen sie wohl auch sein, denn schließlich sollen sie unser gesamtes Gepäck, alle Zelte sowie das Essen für sechs Tage und mehrere Wasserkanister tragen.
Bald bricht die Nacht herein und wir sitzen nach dem Essen am knisternden Lagerfeuer. Hinter uns in der Steppe faucht ein Tier und weiter entfernt heult ein Schakal. Jeder hängt seinen Gedanken nach und ist gespannt auf den morgigen Tagesmarsch.
Das Beladen der Kamele dauert zwei Stunden. Erst müssen Decken auf den Rücken gelegt werden. Darüber kommt ein Eisengestell, an dem das Gepäck und die Wasserkanister befestigt werden. Eines der Kamele scheint nicht begeistert zu sein und protestiert mit lautem Geschrei. Es hört sich ähnlich an wie das Gebrüll eines Löwen und wird in den folgenden Tagen noch so manchen Himba in Aufregung versetzen.
Als wir endlich aufbrechen, ist es bereits ziemlich heiß. Der Tourguide zieht mit den Tieren vorneweg, gefolgt von Lukas, dem Kameltreiber, und wir marschieren hinterher. Das Schritttempo ist sehr zügig. Lässt man sich mal beim Fotografieren etwas Zeit, hat man zu tun, den Anschluss nicht zu verpassen. Vier bis fünf Stunden Wandern stehen täglich auf dem Programm. Da ich viel in den Schweizer Bergen unterwegs bin, sollte ich eigentlich gut trainiert sein. Doch ich merke schon am zweiten Tag, dass mir die große Hitze und die hohe Luftfeuchtigkeit zu schaffen machen. Um die Mittagszeit ist es über 40 Grad heiß und meine Kleider kleben am ganzen Körper. Der Tagesrucksack am Rücken mit den Wasserflaschen und dem Lunch erhitzt zusätzlich.
Die wunderschöne Gegend entschädigt jedoch für das Leiden in der brütenden Hitze. Wir laufen größtenteils an einem Fluss entlang, der links und rechts mit Büschen, Bäumen und Palmen gesäumt ist. Am späteren Nachmittag wird jeweils das Nachtlager errichtet. Der Tourguide hat ausschließlich schöne Plätze ausgesucht, entweder unter großen Bäumen in trockenen Flussbetten oder direkt am Wasser. Es wird gekocht, und zum Essen setzen wir uns auf eine Plane ums Lagerfeuer. Jeder geht früh schlafen, da alle müde sind und es bereits ab halb sechs Uhr dunkel ist.
Ab und an begegnen wir Himba oder sie besuchen uns am Lagerplatz. Das ist immer besonders interessant, auch wenn wir keine Unterhaltung führen können. Mal kommen junge Männer auf Eseln angeritten und bestaunen uns, oder wir sie, mal läuft eine Himba-Frau allein durch die Steppe, wahrscheinlich auf dem Weg zu einem Familienbesuch.
Am dritten Tag müssen wir einen Fluss überqueren. Er führt kein hohes Wasser, ist aber ziemlich breit. Das sandige Ufer ist feucht und dunkel. Die schwer beladenen Kamele wagen sich nicht durch das Flussbett. Alles Locken, Rufen oder Zerren an den Zügeln nützt nichts. Sie haben Angst und stemmen sich mit Gewalt dagegen, hinübergeführt zu werden. Der Tourguide entschließt sich, die Kamele abzuladen, damit sie leichter sind und die Angst verlieren. Doch auch das führt nicht zum Ziel. Lukas stößt das Kamel von hinten, der Guide zerrt von vorne, das Tier jedoch stemmt sich mit gestreckten Beinen dagegen, bis es sich schließlich stur auf den Boden setzt. Sollten wir es nicht schaffen, die Tiere durch das Flussbett zu führen, würde es das Ende des Trekkings bedeuten. Plötzlich kommt ein Pick-up angefahren, was hier äußerst selten passiert, und der Fahrer bietet seine Hilfe an. So wird das Tier mit mehreren Pferdestärken durch den Fluss gezogen. Das anfängliche Sträuben lässt nach, als es merkt, dass der nasse Boden keine Gefahr bedeutet. Das zweite Kamel macht es uns einfacher, obwohl es mit lautem tiefem Gebrüll seinen Unmut kundtut. Nun müssen wir das ganze Gepäck durch den Fluss tragen und anschließend die Tiere wieder beladen, was uns fast zwei Stunden kostet.
Wir erreichen unseren heutigen Rastplatz in Ufernähe gegen 15 Uhr. Ich habe schon etliche Blasen an den Füßen, was mir normalerweise beim Bergsteigen nicht passiert. Doch die extreme Hitze am Nachmittag lässt die Füße anschwellen und aufweichen. Noch habe ich Blasenpflaster, die allerdings nicht lange halten, da sie sich an den feuchten Füßen schnell auflösen. Meistens marschieren wir auf sandigen Naturstraßen oder in trockenen Flussbetten, was besonders anstrengend ist. Die Landschaft verändert sich, ab und an wird es sogar etwas hügelig, und in der Ferne sieht man kleinere Bergketten.
Eines der prägenden Erlebnisse auf diesem sechstägigen Trekking ist für mich sicherlich das Erreichen des ersten Himba-Dorfes. Schon von weitem sehen wir den Kral und hören Hundegebell und Kinderstimmen. Wie die Massai bauen die Himba ihre runden Lehm- und Kuhdunghütten im Kreis auf. Geschützt werden die Behausungen auch hier mit einem Dornengestrüpp. In der Mitte des Krals trennt ein solcher Zaun das Areal ab, in dem sich die Kühe befinden. Im Dorf herrscht geschäftiges Treiben. Als wir uns nähern, kommen einige Bewohner auf uns zu und bleiben staunend vor den Kamelen stehen. Ein paar Kleinkinder weinen vor Schreck. Ziegen blöken und Hunde bellen. Auf einer flachen Lehmhütte sitzen zwei kleine Mädchen auf dem Dach und füllen trockene Maiskolben in einen Korb, der von einer alten Himba-Frau auf eine Plane geleert wird, wo weitere Kinder die Körner herauspulen. Hier erkenne ich deutlich den Unterschied von Mädchen im noch nicht heiratsfähigen Alter und den verheirateten Frauen. Die ganz jungen Mädchen sind nur leicht eingefettet, und zwei große, nicht gefärbte Zöpfe fallen über ihr Gesicht und verdecken die Augen. Das soll sie vor dem bösen Blick bewahren. Die verheirateten Frauen dagegen tragen ihre roten Haare in mehreren dicken gedrehten Zöpfen nach hinten und auf dem Kopf einen kleinen Lederschmuck, wie ein Krönchen.
Zwei alte Männer sitzen auf ihren Klappstühlen und starren auf die Kamele, wobei ihnen vor Staunen der Mund offen bleibt. Sie sind schon sehr alt und kennen wohl jeden Stein und jedes Tier in dieser Gegend, aber so etwas wie Kamele haben sie noch nie gesehen. Erstaunlicherweise wagen es immer nur Frauen, näher zu kommen und auch mal ein Kamel zu berühren. Männer halten Abstand. Diese Situation erlebe ich noch einige Male in den kommenden Wochen.
Ich würde gerne noch lange hier bleiben und die Menschen in ihrem einfachen Tagesablauf beobachten, doch wir müssen weiter. Obwohl vor allem die Frauen eigentlich gut genährt aussehen, frage ich mich dennoch, wie diese Menschen bei ihrer kargen Lebensweise genügend Nahrung bekommen. Bereits tagelang haben wir kein Geschäft mehr gesehen. Später erfahre ich, das Hauptnahrungsmittel sei geronnene Milch, die nach der Regenzeit besonders ergiebig ist.
Die Himba äußern immer wieder ihre Verwunderung, dass wir Weißen zu Fuß unterwegs sind. Bisher haben sie Touristen ausschließlich in Autos gesehen, allenfalls einige verwegene auf Motorrädern. So wird unser Kameltreiber, der die Himba-Sprache kennt, des Öfteren gefragt: »Wo ist das Auto dieser Weißen? Sind sie so arm, dass sie zu Fuß gehen müssen wie wir?« Oder sie zeigen auf die ihnen unbekannten Kamele und fragen: »Sind das eure Autos?« Solche Kommentare rufen bei uns immer Erheiterung hervor.
Langsam kommen wir unserem Ziel, den Epupa-Wasserfällen, näher. Wieder gehen wir in brütender Hitze auf einer Naturstraße. Dabei erhitzen sich nicht nur die Körper, sondern auch die Gemüter der Teilnehmer, und so mancher träumt von einem kalten Bier, einer Cola oder einem Schatten spendenden Baum zum Rasten. Und dann stehen wir völlig unerwartet vor einer Bar. Weit und breit ist kein anderes Gebäude zu sehen, nur diese Bar, die obendrein kalte Getränke anbietet. Der Strom für die Kühlung wird durch Solarzellen gewonnen. So sehr wir uns über das kühle Nass freuen, so traurig stimmt es uns, als wir erfahren, dass diese Solaranlagen von der Bierindustrie finanziert werden, damit der Bierkonsum bei den Himba zunimmt. Hinter dem Gebäude bemerke ich mit Entsetzen einen Glasscherbenhaufen, der sicherlich zwei Meter hoch ist. Alles zerbrochene Bierflaschen!
Je näher wir unserem Ziel kommen, desto häufiger treffen wir auf Himba, die ebenfalls in Richtung Epupa unterwegs sind. Wir sehen eine Familie, die sich mit einem Esel fortbewegt, das heißt, der Vater sitzt auf dem weißen Tier, vor und hinter ihm klammert sich jeweils ein Kind an ihn und links und rechts hängen Säcke mit Maismehl oder sonstigen Lebensmitteln. Die Frau läuft selbstverständlich hinterher. Ein anderes Mal überholen wir eine junge Himba-Mutter, die zügig mit schlenkernden Armen und schweren Lasten auf dem Kopf voranschreitet. Auf dem Rücken trägt sie ihren Säugling in einer Art Ziegenfellrucksack, der über ihrem wippenden Fellrock endet. Als ich die Schöne überhole, rieche ich eine ranzige strenge Ausdünstung, die bei dieser Hitze wohl durch das eingeriebene Butterfett verursacht wird.
Am sechsten Tag erreichen wir Epupa und die Wasserfälle. In einem Lodging wartet ein richtiges Bett auf mich, was durchaus wohltuend ist. Da es Tage zuvor heftig geregnet hat, tosen nun die Wasserfälle besonders imposant über die zerklüfteten Steinkrater mehrere Dutzend Meter hinunter. Das Rauschen ist gigantisch und man versteht sein eigenes Wort nicht mehr. Der Blick von einem Hügel auf das schäumende Wasser in der rötlichen Abendsonne ist grandios. Zwischen den Steinkratern und dem tosenden Wasser wachsen Bäume auf den kahlen Felsen, die wie Flaschen aussehen. Wie sie sich an die Felsen klammern und hier Nährboden finden, ist mir ein Rätsel. Vor den Wasserfällen fließt der Kunene noch ruhig und ist von Palmenhainen gesäumt. Im Hintergrund erhebt sich eine golden schimmernde, kahle Bergkette. Der Kunene ist der einzige Fluss, der das ganze Jahr Wasser führt und in dem auch viele Krokodile leben. Da Angola direkt am anderen Ufer des Flusses beginnt, ist es wohl schon vorgekommen, dass wagemutige oder betrunkene Touristen schnell hinüberschwimmen wollten, dann aber nie mehr gesehen wurden.
Der erste Teil des Abenteuers endet hier, und meine Mitreisenden kehren am nächsten Tag mit dem Minibus nach Windhuk zurück, während ich mit Lukas in drei Tagen 86 Kilometer nach Okangwati zurückmarschieren werde. Dort werden wir wieder auf den Tourguide treffen und dann das große Trekking beginnen. In diesen drei Tagen trage ich die Verantwortung. Das Laufen ist eine Katastrophe, weil wir auf einer sehr breiten, neueren Schotterstraße gehen müssen und ganz und gar der Hitze ausgesetzt sind. Autos preschen ab und an vorbei und hüllen uns in eine Staubwolke. Da es tagsüber fast unerträglich heiß ist, beschließe ich, ab sofort um vier Uhr früh aufzustehen, um die Kamele mit Lukas zu beladen, damit wir noch vor Sonnenaufgang losmarschieren können, was sich als sehr sinnvoll erweist. Das Schönste an diesen drei Tagen sind die Einsamkeit und die Tatsache, dass ich selbst verantwortlich bin. Mit dem jungen Lukas komme ich jetzt viel besser ins Gespräch. Er ist ein lustiger Kerl und bereitet mir in den kommenden Wochen noch viel Freude, vor allem, wenn es mit dem Tourguide Meinungsverschiedenheiten gibt.
Einmal frage ich ihn, ob er eine Freundin hat. Etwas verlegen nickt er. Da ich weiß, dass seine Familie nicht aus dieser Gegend ist, hake ich arglos nach, ob sie eine Himba sei. Erschrocken verneint er: »Nein, Corinne, so eine Frau kommt für mich nicht in Frage! Die waschen sich ja nie, und diese rote Farbe gefällt mir überhaupt nicht. Meine Freundin ist moderner.« – »Ja, wo ist deine Freundin jetzt?«, will ich amüsiert wissen. »Im Kindergarten«, lautet seine klare Antwort. Ich schaue verblüfft und lache erst einmal herzlich los, worauf auch er lachen muss. Er erklärt, dass seine Eltern das Mädchen ausgesucht haben, und sobald es das entsprechende Alter erreicht hat und er genug verdient, wird er sie heiraten. So ist es der Brauch.
Vollkommen erschöpft erreichen wir Okangwati, wo sich meine Füße unbedingt erholen müssen. Durch das Laufen auf der harten Straße haben sich die Blasen ausgeweitet und einige bereits mit Wasser gefüllt. Aber ich will auf keinen Fall die gebuchte Tour hier beenden, nur weil mich Blasen quälen. Außerdem habe ich den Spruch des Tourguides noch im Ohr: »Das kommende Trekking ist nichts für Weicheier, und auf ein paar Blasen kann ich keine Rücksicht nehmen.«
Wieder werde ich von den Deutschen verwöhnt, und nach Absprache mit dem Guide entscheide ich mich, meinen 49. Geburtstag hier zu feiern, auch wenn sich dadurch unser Aufbruch um zwei Tage verzögert. Den gewonnenen Tag verbringe ich mit kleinen Wanderungen durch das trockene Flussbett. Dabei beobachte ich Himba-Kinder, die an einer bestimmten Stelle nach Wasser graben, um mit einer Tasse ihren Plastikkanister mit dem braunen Wasser zu füllen. Damals in Barsaloi im Samburu-Land habe auch ich mein Wasser so besorgen müssen. Viele Male bin ich zum Fluss hinuntergelaufen, habe im Sand gegraben, bis sich das Loch mit sauberem Wasser füllte, wusch mich und schleppte danach das Trinkwasser nach Hause. Teilweise lebte ich nicht anders als diese Himba vor meinen Augen.
Die Kinder bemerken mich und kichern. Ich begrüße sie mit »Moro, perivi« und erhalte ein »Naua« zur Antwort, was »gut« bedeutet. Sie tuscheln und schauen auf meine blonden Haare. Ich setze mich zu ihnen in den Sand und beginne zu fotografieren, wobei ich ihnen anschließend die Fotos oder die Filmaufnahmen zeige. Nach anfänglichem Zögern sind nun alle ganz entzückt und wollen ständig, dass ich sie fotografiere. Ein junges Mädchen beginnt zu tanzen, ein anderes gräbt wie verrückt nach Wasser, nur um sich nachher in der Kamera zu sehen. Ich bin überzeugt, dass viele Himba noch nie ein Spiegelbild von sich gesehen haben. Ich kenne das aus meiner Zeit in Barsaloi, wo viele traditionelle Samburu-Frauen ständig vor meiner Hütte hockten, weil sie einen Blick in meinen Handspiegel werfen wollten.
Während ich das Spiel mit den Kindern genieße, staune ich, wie glücklich sie mit ihrem bescheidenen Leben sind. Es wird gelacht und ihre Augen funkeln und strahlen vor Freude. Nur der Kleinste, der kaum laufen kann, schaut mich ängstlich an. Nach einer Weile kommt eine Mutter, setzt sich wie selbstverständlich neben mich und diskutiert offensichtlich mit den Kleinen über mich. Meine Begrüßung nimmt sie lächelnd entgegen. Die hübsche Frau schnappt sich eines der Mädchen, die alle nur mit einem kleinen kurzen Hüfttuch bekleidet sind, und richtet ihr Tuch so, dass die Intimsphäre geschützt ist. Mir fällt auf, dass das Hüfttuch die Scham der Mädchen immer bedeckt, auch wenn sie noch so wild herumtoben. Die Mutter nimmt den ganz Kleinen und beginnt, ihn zu waschen, indem sie eine Tasse mit Wasser füllt, einen großen Schluck in den Mund nimmt und das Wasser mit einem gekonnten Strahl auf das Kleinkind spritzt. Die Stunden im Flussbett mit diesen unbekümmerten Kindern sind ein besonders schönes Erlebnis für mich.
Für meinen Geburtstag kaufe ich bei den Himba eine Ziege, die zur Feier geschlachtet und gegrillt wird. Auch die vom Hilfswerk betreuten Kinder freuen sich über etwas Fleisch. Wir feiern in kleinem Rahmen und genießen nochmals ein kühles Bier, bevor es am nächsten Tag losgeht.
Allein mit zwei Männern und Kamelen
Geplant ist, dass wir von Okangwati über den Van Zyl’s Pass durch das Marienflusstal Richtung Red Drum marschieren. Von dort geht es über Orupembe nach Purros zu den Wüstenelefanten und dann den Fluss Hoarusib entlang nach Opuwo, das unser Ziel ist. Also liegen etliche Kilometer vor uns. Täglich gehen wir zirka sechs Stunden, nur unterbrochen von zwei jeweils zwanzigminütigen Pausen. Da mein Vorschlag, immer um vier Uhr früh aufzustehen, damit bei Sonnenaufgang aufgebrochen werden kann, akzeptiert wird, erreichen wir unseren Lagerplatz meistens zwischen 12 und 13 Uhr. Das Marschtempo ist hoch, und ich bin froh, dass ich meine Wanderstöcke dabeihabe. Sie helfen mir sehr, vor allem in den trockenen Flussbetten, wo ich viel Kraft brauche, um vorwärtszukommen. Meine Bitte, manchmal etwas langsamer zu gehen, damit ich die schöne Gegend besser genießen kann, wird meist nur kurz erfüllt. Obwohl es mir mit der Zeit ganz gut gelingt, mich dem Tempo anzupassen, fehlt mir eine gewisse Lockerheit bei unserem Abenteuer. Klar, der Tourguide ist ein großer kräftiger Typ, der täglich eine Herausforderung braucht, und außerdem kennt er den größten Teil der Route schon. Und Lukas ist gerade mal 22 Jahre jung und dementsprechend fit. Für mich dagegen ist alles neu, und eigentlich möchte ich nicht nur durch- oder hinterherhetzen.
Auf unserer Wanderstrecke begegnen wir immer wieder Menschen, die meist mit Eseln unterwegs sind. Diese Tiere sind sozusagen eine Art Auto-Ersatz. Mal prescht eine Gruppe jüngerer Männer stolz auf ihren Eseln vorbei, als handle es sich um einen Sportwagen. Ein anderes Mal reiten zwei ältere Männer herbei. Sie bleiben stehen und fragen erstaunt, was wir hier zu Fuß wollen. Der eine scheint ein Chief zu sein. Sein stolzer Blick und die Art, wie er sich gibt, lässt mich das vermuten. Sein nackter Oberkörper ist mit Narben verziert, und eine Kette mit langen Tierzähnen schmückt seine Brust. Lukas unterhält sich mit ihnen. Trotz des Alters der beiden Männer erkennt man noch eine gewisse Wildheit in ihren Augen. Irgendetwas scheint sie zu stören an unserer Reiseart. Später erzählt mir Lukas: »Weißt du, sie haben mich gefragt, was die Tiere brauchen, weil sie fürchten, sie fressen den Kühen das Gras weg.«
Kurz vor dem Van Zyl’s Pass, am dritten Tag, nehme ich mir vor, mir jeweils am Abend vorher die Route anzuschauen und mit dem Tourguide zu besprechen, weil ich zukünftig jeden Morgen mindestens eine halbe Stunde vor den beiden Männern aufbrechen will, wenn nötig auch mit der Stirnlampe. Ich brauche einfach meinen Rhythmus, damit ich alles aufsaugen und ein Hochgefühl entwickeln kann, denn eines ist unbestritten: Die Route ist phantastisch. So beginne ich meinen Tag um vier Uhr und ziehe mich im noch warmen Zelt an, wobei ich mir viel Zeit für die Verarztung der Blasen nehmen muss. Jeden Tag verpflastere ich sie aufs Neue. Glücklicherweise habe ich zwei kleine Silikonbeutelchen dabei, die ich an meine Fersen klebe. Dann krieche ich aus dem Zelt, esse das obligate Birchermüsli mit Pulvermilch und Trockenfrüchten und trinke heißen Tee. Noch im Dunkeln breche ich das Zelt ab und verstaue alles in die Transportsäcke. Wenn es die Strecke zulässt, starte ich noch mit der Stirnlampe, bis sich die Sonne langsam über dem Horizont erhebt und der Tag beginnt. Für mich sind es die schönsten zwei Stunden des Tages, die ich durch meinen frühen Aufbruch erlebe. Viele Male schrecken vor mir kleinere Herden von Oryx-Antilopen oder sonstigen Tieren auf. Natürlich bin auch ich so manches Mal vor Schreck einem Herzstillstand nahe, aber umso intensiver sind diese Erlebnisse. Ohne meine Vorerfahrungen in Kenia und ohne meine Hochtouren in den Schweizer Bergen, die ich häufig ohne Begleitung unternehme, würde ich sicher nicht den Mut aufbringen, alleine durch die mir fremde Wildnis zu laufen.
Der Van Zyl’s Pass beeindruckt mich. Es ist ein abenteuerlicher Anstieg und für die schwer beladenen Kamele eine echte Herausforderung. Immer wieder verrutscht die Ladung und muss neu gerichtet werden, was viel Zeit in Anspruch nimmt. Immerhin hat der Pass Steigungen oder Gefälle bis zu 40 Prozent. In Reiseführern wird er nur den mutigsten Autofahrern empfohlen. Dementsprechend begegnen wir nur zwei Geländewagen, und beide Male sind die Fahrer mit den Nerven am Ende. Die 13 Kilometer lange Passstraße darf mit dem Auto nur von Ost nach West befahren werden. Dabei sind Vierradantrieb, beste Ausrüstung und hohes Können erforderlich.