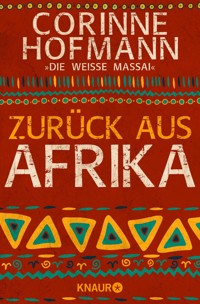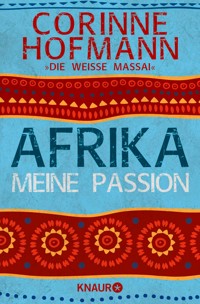9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Vierzehn Jahre nach der abenteuerlichen Flucht mit ihrer kleinen Tochter Napirai kehrt Corinne Hofmann erstmals wieder nach Kenia zurück – in das Land, das einmal ihre Heimat war. In Barsaloi, im kenianischen Hochland, kommt es schließlich zu einem bewegenden Wiedersehen mit dem Massaikrieger Lketinga, dem Vater ihrer Tochter. Zum ersten Mal nach all den Jahren trifft sie auch ihre Schwiegermutter und all die Menschen, die sie seit ihrer Flucht nicht mehr gesehen hat. In Mombasa und auf der Likoni-Fähre, wo einst das Abenteuer der »weißen Massai« begann, schließt sich der Kreis ihrer ereignisreichen Reise in die afrikanische Vergangenheit. Wiedersehen in Barsaloi ist der dritte Teil der ergreifenden Biographie der weißen Massai.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 285
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Corinne Hofmann
Wiedersehen in Barsaloi
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Vierzehn Jahre nach der abenteuerlichen Flucht mit ihrer kleinen Tochter Napirai kehrt Corinne Hofmann erstmals wieder nach Kenia zurück – in das Land, das einmal ihre Heimat war.
In Barsaloi, im kenianischen Hochland, kommt es schließlich zu einem bewegenden Wiedersehen mit dem Massaikrieger Lketinga, dem Vater ihrer Tochter. Zum ersten Mal nach all den Jahren trifft sie auch ihre Schwiegermutter und all die Menschen, die sie seit ihrer Flucht nicht mehr gesehen hat. In Mombasa und auf der Likoni-Fähre, wo einst das Abenteuer der »weißen Massai« begann, schließt sich der Kreis ihrer ereignisreichen Reise in die afrikanische Vergangenheit.
Wiedersehen in Barsaloi ist der dritte Teil der ergreifenden Biographie der weißen Massai.
Inhaltsübersicht
Widmung
Endlich
Vorgeschichte
Nairobi
Auf dem Weg ins Samburuland
Maralal
Wiedersehen mit James
Von Maralal nach Barsaloi
Lketinga
Mama
Eine große Familie
Unser Lager
Im Kral
In Mamas Manyatta
Am Fluss
Unser alter Shop
Unter Frauen
James’ neues Leben
Kleine Geschenke
Leben im Kral
Abend in der Mission
Lketingas neue Frau
Gespräche in der Manyatta
Saguna
Neue Essgewohnheiten
Reisepläne
Aufbruch zum Filmset
Am Set
Lemalian alias Lketinga
Das nachgebaute Barsaloi
Pater Giuliani
Die Mission in Sererit
Gottesdienst in den Ndoto-Bergen
Abschiedsfest
Nächtlicher Tanz
Schwerer Abschied
Der letzte Abend im Samburuland
Das Hospital in Wamba
Rückreise nach Nairobi
Flying Doctors
Im Kibera-Slum
Mzungu Massai
Mombasa
Die Likoni-Fähre
Bildteil
Danksagung
Spendenmöglichkeiten für Kenia
Anzeige
Für meine afrikanische Familie
Endlich
Es ist so weit. Fast vierzehn Jahre sind seit meiner Flucht aus Nairobi mit meiner damals eineinhalbjährigen Tochter Napirai vergangen, und jetzt sitze ich im Flugzeug, das mich erstmals wieder nach Kenia bringen wird. Meine Gefühle sind in Aufruhr: Mal zieht und kribbelt es vor freudiger Erregung im Bauch, mal lässt eine seltsame Beklemmung meine Hände feucht und klebrig werden. Vor Aufregung könnte ich weinen und im nächsten Moment loslachen.
Bange Fragen schwirren in meinem Kopf herum. Wie werde ich mein einstiges Zuhause vorfinden? Was ist geblieben? Was hat sich verändert? Ist etwa der Fortschritt und der damit zum Teil verbundene hektische Lebensrhythmus schon so weit nach Kenia vorgedrungen, dass ich die Menschen und das Dörfchen Barsaloi im Norden Kenias nicht wiedererkennen werde? Vor vierzehn Jahren gab es dort nur die Mission, etwa acht Holzhäuschen, unseren gemauerten Shop und einige Manyattas, die traditionellen runden und mit Kuhdung verputzten Behausungen der Samburu.
Neben mir im Flugzeug sitzen mein Verleger Albert Völkmann, der mich als »väterlicher Freund« bei dieser Reise begleitet, und Klaus Kamphausen, der unsere Erlebnisse fotografisch und filmisch dokumentieren wird. Ich bin erleichtert und dankbar, dass ich dieses Abenteuer nicht allein antreten muss.
Während des Fluges stelle ich mir immer wieder die Menschen vor, die ich so lange nicht mehr gesehen habe. Meine Schwiegermama, die ich bis heute sehr verehre, meinen damaligen Ehemann Lketinga, James, seinen jüngeren Bruder, Saguna und viele mehr. Auch Pater Giuliani, der mir mehr als einmal das Leben gerettet hat, wollen wir in seiner neuen Mission besuchen, sofern wir diese finden können. Ich hoffe, dass alles gut geht und ich nicht aus irgendwelchen Gründen schon am Flughafen in Nairobi festhängen werde.
Endlich döse ich ein. Als ich nach ein paar Stunden die Augen wieder öffne, sehe ich draußen einen orangeroten leuchtenden Streifen am Himmel. Genau dieses Bild einer Morgenröte sah ich nach dem äußerst anstrengenden Aufstieg auf den Kilimandscharo vor zwei Jahren. Nur war ich damals am Stella Point in einer Höhe von ungefähr 5750 Metern fast am Ende meiner Kräfte, und jetzt sitze ich lediglich etwas steif und unbequem in meinem Flugzeugsitz. Während mein Blick die in der Morgendämmerung liegenden kahlen Bergketten unter mir abtastet, döse ich erneut ein.
Eine Stunde vor der Landung wird mir für einen kurzen Moment fast schlecht, so sehr schnürt mir die Aufregung den Brustkorb zu, und ich schicke ein leises Gebet zum Himmel. Durch das kleine Fenster sehe ich schon die endlos weite Steppe Kenias. Ab und zu kann ich von oben einige runde Krals erkennen, Ansammlungen verschiedener Manyattas, die mit einem kreisförmigen Dornengestrüpp vor wilden Tieren geschützt werden.
Überfliegen wir vielleicht auch Barsaloi? Wie viele Male saß ich vor unserer Manyatta und schaute mit Mama zum Himmel. Wenn wir ein Flugzeug sahen, wollte sie wissen, wie diese Eisenvögel, wie sie sie nannte, wohl da oben ohne Straße und ohne Licht ihren Weg finden können. Schaut sie vielleicht auch jetzt wieder hoch, da sie weiß, dass ich komme?
Am liebsten würde ich gleich hinausspringen. Gedankenverloren beobachte ich ausgetrocknete Flussbette, die sich durch die staubige rote Erde schlängeln und deren Ufer trotz Trockenheit immer ein grüner Baumgürtel säumt. Kurz darauf beginnt das Flugzeug zu sinken, zieht eine letzte Schleife und setzt zur Landung in Nairobi an.
Vorgeschichte
Bis es so weit war, dass ich diese Reise antreten konnte, fand ein monatelanger innerer Kampf statt, in dem ich mich immer wieder fragte: Ist es richtig, was ich vorhabe? Gleichzeitig ereigneten und veränderten sich so viele Dinge in meinem Leben, dass es mir im Nachhinein wie eine Vorherbestimmung vorkommt.
In der Vergangenheit hatte ich wiederholt einen Anlauf unternommen und bei der kenianischen Botschaft in der Schweiz sowie bei der deutschen Botschaft in Nairobi telefonisch nachgefragt, was zu unternehmen sei, damit die in der Schweiz durchgeführte Scheidung von meinem Samburu-Ehemann auch in Kenia anerkannt wird. Die Antwort war jedes Mal die gleiche: dass ich einen kenianischen Anwalt beauftragen müsste und auf jeden Fall das Einverständnis meines Ehemannes nötig wäre. Doch Lketinga lebt nun wieder in Nordkenia, Hunderte von Kilometern von Nairobi entfernt, und ist seit Jahren mit einer jungen Frau seines Stammes verheiratet. Ihn in dieser Angelegenheit in Nairobi vorzuladen, ist ein Ding der Unmöglichkeit, zumal er sicherlich auch nicht einsehen kann, wofür dies gut sein soll. Sein Leben ist so weit in Ordnung und Scheidungen sind bei den Samburu unbekannt, weil die Männer ja mehrere Frauen heiraten können.
Da ich als Ehefrau beim Verlassen Kenias von Lketinga erneut eine Ausreisebewilligung hätte bekommen müssen, ließ ich alles, wie es war, mit dem Bewusstsein, dieses Land vorläufig nicht mehr betreten zu können, obwohl ich viel an meine Familie dachte, vor allem an meine Schwiegermama, die Großmutter meiner Tochter. Wir würden weitersehen, wenn Napirai nach ihrer Volljährigkeit in ein paar Jahren ihren Vater besuchen möchte, und würden dann schon eine Lösung finden, beruhigte ich mich selber und verstaute die europäischen Scheidungspapiere erneut in einer Schublade.
Im Jahr 2003 bin ich den ganzen Herbst mit meinem Buch »Zurück aus Afrika« auf Lesereise, was mir großen Spaß bereitet. Auch laufen nun die Arbeiten für die Verfilmung meines ersten Buches auf Hochtouren und es bleibt nicht aus, dass ich zu den Besprechungen des Drehbuches öfter nach München fahre. Es ist schön, dass ich meine Einwände, Wünsche oder Bedenken einbringen kann, und so entsteht eine enge Zusammenarbeit, die meine oft gemischten Gefühle, die sich zwischendurch einschleichen, etwas beruhigen.
Dennoch ist es nicht einfach, mein gelebtes Leben nun mit anderen Namen und teilweise in gekürzter oder etwas abgeänderter Version lesen und durchleben zu müssen. Bei manchen Drehbuchszenen treibt es mir Tränen in die Augen und ich spüre, wie mich vieles wieder einholt. Gleichzeitig bin ich auch neugierig und stolz darauf, dass ein wichtiger Teil meines Lebens bald in den Kinos gezeigt werden soll. Napirai ist natürlich noch sehr skeptisch, was ich gut verstehen kann, da sie sich nicht mehr an diese Zeit erinnert und dadurch Gefahr läuft, den Film mit der Wirklichkeit zu verwechseln. Ich bete immer wieder, dass alles gut gehen wird und wir uns nie zu schämen brauchen.
Durch die Zusammenarbeit mit den Filmleuten entstehen einige Kontakte in Kenia. So fasse ich im Dezember spontan den Entschluss, die Scheidungspapiere wieder aus der Schublade zu holen und an einen neuen Bekannten in Nairobi zu faxen, mit der Bitte, meinen Fall durch einen Anwalt vor Ort abklären zu lassen. Wenn es je eine unkomplizierte Möglichkeit für die Anerkennung meiner Scheidung in Kenia geben sollte, dann jetzt, wo wir sachkundige Leute vor Ort kennen. Verlieren kann ich nichts und so warte ich die Antwort einfach ab.
Die Lesetour nimmt mich auch zu Beginn des neuen Jahres noch sehr in Anspruch. Es ist eine schöne Aufgabe, vor Hunderten von erwartungsvollen Menschen über meine Erlebnisse zu erzählen, um dann in fröhliche und erstaunte Gesichter zu sehen. Es macht mich glücklich zu hören, wie vielen Menschen ich nicht nur Lesevergnügen bereite, sondern auch Kraft und Mut für ihr eigenes Leben vermitteln kann. Mittlerweile kommt es mir fast wie eine Berufung vor.
Weil ich davon so erfüllt bin, realisiere ich zu spät, dass sich zu Hause eine private Katastrophe ereignet hat. Mein Lebensgefährte hat sich ganz leise aus unserer Beziehung geschlichen. Als ich es endlich bemerke, ist es schon zu spät. Ich bin tief traurig und gleichzeitig wütend. Mehr kann, will und darf ich dazu nicht äußern. Wieder ist etwas zerbrochen, was ich so nicht erwartet hätte. Nun weiß ich aber auch, dass bei aller Liebe meine inzwischen weltweit bekannte Vergangenheit für einen Mann an meiner Seite nicht einfach zu ertragen ist. Nach dem Spielfilm wird dies wahrscheinlich noch problematischer.
Dennoch möchte ich meinen Weg nicht mehr verlassen. Ich liebe meinen Beruf, der mir die Möglichkeit bietet, sowohl hier als auch in Afrika zu helfen. Meine Bücher tragen bei vielen Menschen zu einem besseren Verständnis zwischen Weißen und Schwarzen bei, wie ich zahllosen Leserzuschriften entnehmen kann. Gibt es eine schönere Aufgabe, gerade weil ich selbst einem Mischlingskind das Leben schenken durfte? Für mich steht fest: Ich werde weiterhin alles in meiner Macht Stehende tun, um mit Energie, Kraft und meinem Bekanntheitsgrad zu helfen. Dieses Wissen hilft mir bei der Aufarbeitung meiner Trauer um die zerbrochene Beziehung zu meinem Lebenspartner.
Ich stürze mich noch mehr in die Arbeit, die Freizeit verbringe ich mit meiner Tochter oder bei langen Wanderungen in den von mir geliebten Bergen.
Einige Wochen später bekomme ich den Bescheid aus Nairobi, dass meine europäischen Scheidungspapiere auch in Kenia rechtsgültig seien und dass ich vor vierzehn Jahren meine Tochter nach kenianischem Recht nicht entführt habe, da ihr Vater damals die Einwilligung zur Ausreise gab, auch wenn dies natürlich aus seiner Sicht nicht für immer gedacht war. Bei dieser Neuigkeit spüre ich eine große Befreiung und Erleichterung.
Nachts dagegen verarbeite ich nach Wochen noch die zerbrochene Beziehung. Ich schlafe schlecht und träume viel. Einmal schrecke ich mitten in der Nacht hoch und sitze total verschwitzt und kerzengerade im Bett mit der Eingebung, dass ich nach Kenia reisen muss, wenn ich meine Schwiegermama noch einmal lebend sehen möchte. Verstört und verwirrt finde ich für den Rest der Nacht keinen Schlaf mehr.
Der Gedanke lässt mich nicht mehr los. In den kommenden Tagen überlege ich fieberhaft, ob ich wirklich nach Kenia reisen soll. Was wird Napirai dazu sagen? Was meine Mutter? Und vor allem, was wird meine ganze afrikanische Familie einschließlich Lketinga darüber denken?
Die Idee frisst mich langsam auf und meine Stimmung wechselt zwischen Euphorie und Aggression. Wäre ich noch mit meinem Partner zusammen, wäre ich nicht auf die Idee gekommen, jetzt nach Kenia zurückzukehren. Seltsam! Vielleicht ist das Leben schon vorprogrammiert und alles musste so kommen.
Erneut reise ich nach München und treffe die Regisseurin des Films »Die weiße Massai«, die in der Zwischenzeit in Kenia war und unter anderem auch meine Familie in Barsaloi besucht hat. Sie erzählt, dass sie nach anfänglichem Misstrauen freundlich aufgenommen wurde und sich nach einigem Zureden sogar meine Schwiegermutter blicken ließ. Mama sei immer noch eine stattliche, aber alte Frau. Beim Abschied gab sie ihr eine Botschaft für mich mit: »Corinne soll neunzig Jahre alt werden, so wie ich. Sie soll wissen, dass ich sie von ganzem Herzen liebe, dass ich ihr alles Gute wünsche, dass sie jederzeit willkommen ist und dass ich sie gerne noch einmal sehen möchte, bevor ich sterbe.«
Als ich diese Worte höre, schießen mir Tränen in die Augen. Ich spüre eine intensive Verbundenheit mit ihr und im gleichen Moment steht mein Entschluss fest: Ich muss meine Schwiegermama noch einmal sehen und in den Arm nehmen – ich gehe nach Afrika!
Im Verlag besprechen wir die neue Entwicklung. Albert, mein Verleger, der schon vor sechs Jahren meiner Familie das erste Buch »Die weiße Massai« bei einem Besuch überbrachte, erklärt sich bereit, mich zu begleiten. »Dann kann ich auch Little Albert kennen lernen«, meint er vergnügt. James, der Bruder meines Ex-Ehemannes, hat nämlich seinen ersten Sohn nach ihm benannt, um sich auf diese Weise für die langjährige Unterstützung des Verlages zu bedanken.
Nun teile ich unser Vorhaben in einem Brief an James mit. Er ist das Verbindungsglied zur Familie, weil nur er schreiben und lesen kann. Gespannt und neugierig warte ich auf eine Antwort. Im Mai erhalte ich endlich den ersehnten Brief, in dem er seine große Freude und die der ganzen Familie kundtut. Er schreibt auch, dass Mama immer gefühlt habe, dass sie mich noch einmal sehen wird, solange sie lebe. Sie freue sich sehr und auch Lketinga werde mir keine Probleme bereiten. Alle Menschen, denen er die Neuigkeit erzähle, glaubten es kaum und fragten zweifelnd: Really, Corinne will come once again to our place in Kenia?
Als ich meiner Tochter diesen schönen Brief vorlese, meint sie spontan: »Ja, Mama, ich glaube, du musst da wirklich nochmal hin.« Das sind die erlösenden Worte, die ich mir gewünscht und die ich gebraucht habe. Ich liebe meine Tochter sehr und hoffe, auch für sie mit vielen neuen Eindrücken, Geschichten und Fotos nach Hause zurückkehren zu können.
Vier Monate hatte ich innerlich mit mir gerungen, ob diese Rückkehr richtig sei. Ob wir alle dies gut überstehen würden? Doch nun bin ich sicher, dass alles, was seit Beginn des Jahres geschehen ist, nur der Weg war, um das Ziel – das Wiedersehen – zu erreichen.
Nairobi
Beim Verlassen des Flugzeuges schlägt mir keine feuchte Tropenluft wie damals in Mombasa entgegen, es ist eher trocken und warm. Wir reihen uns in die wartende Kolonne bei der Passkontrolle ein und ich werde mein mulmiges Gefühl einfach nicht los. Meine Gedanken kehren kurz zurück, wie ich vor vierzehn Jahren an dieser Kontrolle mit meiner Tochter beinahe gescheitert wäre. Damals schwitzte ich Blut und Wasser, als ich die vielen Fragen beantworten musste: Warum reisen Sie ohne den Vater Ihrer Tochter aus? Wo ist Ihr Ehemann? Wie lange bleiben Sie außer Landes? Warum hat Ihre Tochter einen deutschen Kinderausweis, wenn sie in Kenia geboren ist und der Vater ein Samburu ist? Ist das wirklich Ihre Tochter? Fragen über Fragen, die mich damals fast um den Verstand gebracht hätten. Nur mit viel Glück konnte ich schließlich ins Flugzeug steigen. Und nun reiche ich dem Beamten erneut meinen Pass. Obwohl er freundlich wirkt, klopft mein Herz heftig.
Diesmal ist allerdings meine Tochter nicht dabei. Es erschien mir zu gefährlich, sie mitzunehmen, da sie nicht volljährig ist. Nach kenianischem Recht gehört das Kind dem Vater und nach dem Stammesrecht meines Ex-Mannes gehört es sogar der Großmutter, also seiner Mutter. Aus Sicht der Samburu ist Napirai mit ihren fünfzehn Jahren gerade im besten heiratsfähigen Alter. Die Mädchen werden auch heute noch sehr jung verheiratet und durch die Genitalbeschneidung fürchterlich verstümmelt. Das Risiko, dass wir uns unter Umständen mit derartigen Ansprüchen auseinandersetzen müssten, möchte ich einfach nicht eingehen. Außerdem verspürt Napirai noch nicht den Wunsch, nach Kenia zu reisen. Natürlich erkundigt sie sich immer wieder nach ihrem Vater und unserer Geschichte, aber bislang ist der Respekt vor dem für sie Unbekannten zu groß.
Der Beamte nimmt meinen Pass und hält ihn vor ein Computerlesegerät. Offensichtlich hat auch hier der Fortschritt Einzug gehalten. Nach weiteren fünf Sekunden erhalte ich einen Stempel und kann erleichtert mit meinen beiden Begleitern einreisen.
Für die erste Nacht beziehen wir im Norfolk Hotel unsere Zimmer. Dieses Hotel kann bereits auf eine lange Geschichte zurückblicken. Es wurde 1904 im Landhausstil erbaut und war in der Kolonialzeit der Treffpunkt von reichen weißen Siedlern, Geschäftsleuten und Großwildjägern. Das Hotel muss in diesem wilden und unerschlossenen Land wie eine Insel gewesen sein. Überall hängen alte Bilder und Fotos von Berühmtheiten wie zum Beispiel Roosevelt oder Hemingway an den Wänden. Eine tropische Vegetation prägt das Bild der parkähnlichen Anlage, die mit alten Pferdekutschen dekoriert ist. Zum ersten Mal bin ich in Nairobi in solch einem noblen Hotel und darf nicht daran denken, was es kosten wird. Sicher ist eine Nacht so teuer wie so mancher Monatslohn eines Angestellten.
Wenn ich früher nach Nairobi musste, was mir jedes Mal ein Gräuel war, verkehrte ich immer in der River Road. Das war und ist bis heute natürlich nicht die beste Adresse, dafür bezahlte ich damals für eine Übernachtung in einem düsteren Lodging nur vier bis fünf Franken. Wenn man mit einem Samburu-Krieger verheiratet ist und gezwungenermaßen das Geld im Land verdienen muss, kommt es einem einfach nicht in den Sinn, das hart verdiente Geld so einfach für einen teuren Schlafplatz auszugeben.
Doch diesmal reise ich ja mit europäischen Begleitern und für meinen Verleger sollte die Reise auch einigermaßen angenehm werden. Schließlich gehört er nicht mehr zu den Zwanzigjährigen und hat sich auch nicht unsterblich in eine Massai-Frau verliebt.
Abends dinieren wir draußen auf der Terrasse. Hinter uns befindet sich die Bar, an die sich früher die Herren mit ihren Zigarren zurückzogen, während den Frauen der Zutritt verwehrt war. Für mich ist dies alles gefühlsmäßig noch nicht Afrika, obwohl sich heute mehr dunkelhäutige Geschäftsleute hier zum Essen treffen als wohl noch vor ein paar Jahren. Auch empfinde ich, nachdem meine erste Neugier gestillt ist, alles eine Spur zu elegant und es zieht mich so schnell wie möglich weiter. So bin ich nicht traurig, als wir am folgenden Tag dem Türsteher in seinem dunkelgrünen Smoking die in weiße Handschuhe gehüllte Hand drücken und uns lachend verabschieden.
Auf dem Weg ins Samburuland
Wir nehmen die zwei gemieteten Land Cruiser einschließlich der Fahrer in Empfang und endlich geht es los in Richtung »alte Heimat«. Unsere zwei Wagen kämpfen sich durch das Verkehrschaos in Nairobi. Links und rechts drängen sich Autos, Lastwagen, Kleinbusse, Matatus genannt, und stinkende, bunte Fernbusse vorbei. Die schwarzen Abgaswolken nehmen mir die Luft zum Atmen. Dafür fasziniert es mich aufs Neue, wie jeder und jede versucht, irgendwie ein paar Schillinge zu verdienen. Da gibt es die Zeitungsverkäufer, die am Straßenrand warten und, sobald die Autos in der Kolonne stehen, herbeieilen, um ihre Zeitungen feilzubieten. Ein anderer drängt sich zwischen den Autos hindurch und möchte seine Mützen, Taschenlampen und Uhren loswerden. Mir fällt eine rote Kopfbedeckung auf und so kurble ich das Fenster herunter, um den Preis auszuhandeln. Viel Zeit bleibt den Verkäufern nie. Wir einigen uns schnell, aber da er kein Wechselgeld hat und die Kolonne hinter uns ungeduldig drängt, fahren wir weiter. Doch so schnell lässt er sich von dem Geschäft nicht abbringen. Ich schaue in den Rückspiegel und sehe, wie der junge Mann in Riesenschritten unserem Wagen hinterherhechtet. Wir sind sicher schon 400 Meter gefahren, als sich nach einem Kreisverkehr die Möglichkeit ergibt, kurz anzuhalten. Kaum steht der Wagen, ist schon der Verkäufer mit einem strahlenden Lächeln neben uns. Staunend kaufe ich die Mütze und auch unser Fahrer erwirbt eine. Jetzt wird das Lächeln des Händlers noch breiter. Ich wünschte mir, viele Verkäufer in unserem noblen Land könnten diese Freude sehen. Bei uns steht wohl keiner zwischen stinkenden Abgasen und rennt der Kundschaft hinterher! Und um von einigen Verkäufern oder Verkäuferinnen ein freundliches Lächeln zu erhalten, muss man sich oft selbst etwas Originelles einfallen lassen.
Hinter kleinen Bretterbuden oder auf dem Boden sitzen Händler und versuchen, kleine Mengen von Tomaten, Zwiebeln, Karotten oder Bananen zu verkaufen. Das Leben ist bunt in Nairobi und trotz der vielen Menschen wirkt es auf mich nicht so hektisch wie in einer europäischen Stadt.
Langsam verlassen wir den Stadtkern und nun erkenne ich den so genannten Fortschritt deutlicher. Überall befinden sich neue Supermärkte und Firmen. Werbetafeln für Handys, TV-Geräte und Kinofilme prangen am Highway. Direkt am Straßenrand werden Betten und Schränke ausgestellt, zwischen denen einzelne Ziegen umherstapfen, die statt Gras Bananenschalen kauen oder im Müll schnuppern. Lachende Kinder in blauen Schuluniformen laufen in Gruppen durch die Gegend. Am Rande der Stadt erkennt man allerdings an den verschiedenen Wellblechdächern eines der großen Slumgebiete, wo die Ärmsten der Armen wohnen.
Unsere Fahrer müssen sehr konzentriert fahren, denn die Straßen sind selbst in Nairobi, der Hauptstadt Kenias, eine Katastrophe. Ein Schlagloch folgt dem anderen oder es fehlen auch ganze Teile der Asphaltdecke. Auf unserer Fahrbahnseite kommt uns immer wieder Gegenverkehr entgegen, so dass wir nie richtig schnell fahren können. So benötigen wir für die etwa 170 Kilometer bis Nyahururu fast fünf Stunden. Allerdings fahren wir die alte kurvenreiche Strecke über Naivasha, weil wir einen Blick in das grandiose Rift Valley werfen wollen.
Das Rift Valley, auch »Der große Graben« genannt, erstreckt sich als eine über 6000 Kilometer lange Spalte durch Afrika. Unvorstellbare unterirdische Kräfte rissen vor Millionen von Jahren die Erdkruste zwischen parallelen Verwerfungen auf, und das Land dazwischen sank ab. So sind beeindruckende Höhenunterschiede und tiefe Schluchten keine Seltenheit.
Nun stehe ich also auf einem nicht gerade Vertrauen erweckenden Brettervorbau, der für die zahlreichen Touristen errichtet wurde und einen beeindruckenden Blick auf die weite Ebene und die dahinter liegende Bergkette ermöglicht. Direkt unter meinen Füßen befindet sich noch dichter Laubwald, der sich in der Ferne langsam ausdünnt und in rotbraunen Erdboden und vereinzelte Akazienbäume übergeht. Dieser Anblick löst zum ersten Mal ein Heimatgefühl in mir aus. Endlich erkenne ich etwas von meinem vertrauten Kenia. Die Farbe der Erde, die Form der Bäume und diese überwältigende Weite erinnern mich an Barsaloi und mich überkommt ein spontanes Glücksgefühl. Es zieht mich weiter. Noch ist es ein weiter Weg bis zu meinem afrikanischen Zuhause.
Gegen Abend erreichen wir endlich Nyahururu, die mit 2463 Metern am höchsten gelegene Stadt Kenias. Am rechten Straßenrand erkenne ich sofort mein früheres Lodging, das Nyahururu Space Haven Hotel, dessen Fassade sich allerdings von Blau in Rosa verwandelt hat. Es liegt dem Busbahnhof direkt gegenüber und deshalb herrscht um diese Zeit hier viel Betrieb. Mehrere Fahrer von Kleinbussen versuchen, die Kundschaft durch Hupen auf sich aufmerksam zu machen. Von hier aus fahren sie in alle Richtungen. Wenn man von Maralal her anreist, beginnt hier sozusagen die große weite Welt Kenias. Die Übernachtung in Nyahururu bedeutete für mich, wenn ich von Nairobi kam, immer das Verlassen der Zivilisation und gleichzeitig freute ich mich, weil ich wusste, nach weiteren 25 Kilometern beginnt das Samburuland, die Heimat meiner afrikanischen Familie.
Diesen Busbahnhof muss ich einfach besichtigen und versuchen, mein damaliges Transportmittel ausfindig zu machen. Wir drei Weißen mit Foto- und Filmkamera fallen natürlich auf und sofort sind wir umzingelt. Jeder will etwas wissen oder verkaufen. Ich frage nach dem bunten Maralalbus und erhalte zu meiner Enttäuschung die Antwort, dass nur noch Matatus dorthin fahren. Schade, denke ich, denn ich hatte mir vorgenommen, am nächsten Morgen diesen Bus zu besteigen, um die vierstündige Fahrt bis Maralal wie in alten Zeiten zu erleben. Schon allein das Beladen des Busses faszinierte mich. Die unterschiedlichsten Habseligkeiten, Schachteln, Tische, Schränke, Matratzen, Wasserkanister usw. wurden auf abenteuerliche Weise im und auf dem Bus verstaut. Manchmal mischten sich die ersten bunt geschmückten Krieger mit ihren langen roten Haaren unter die Passagiere und dabei entstand eine aufregende Atmosphäre.
Ja, genau diese würde ich gerne noch einmal spüren und gemeinsam mit den Einheimischen und ihrer Fröhlichkeit in Maralal ankommen. Es war immer spannend und fraglich, ob man das Ziel überhaupt erreichte. Wie viele Male saß ich als einzige Weiße mit den Afrikanern im Straßengraben mitten in der Wildnis und wir konnten unsere Reise nicht fortsetzen, weil der Bus im Schlamm feststeckte. Wir schlugen von den Büschen Äste, um sie unter die Räder zu legen, bis es endlich weiterging.
Schade, diesen Bus, mit dem sich so viele Erinnerungen verbinden, gibt es nicht mehr, und so werde ich wohl oder übel bequem im Land Cruiser fahren. Mein Blick schweift ein letztes Mal über den Platz und wir machen uns auf den Weg zum Thomson’s Falls Lodging, in dem in dieser Gegend die Weißen normalerweise übernachten. Es ist ein einfaches, aber angenehmes Lodging. Schon bei der Einfahrt begrüßen uns verschiedene Frauen aus ihren Souvenirshops und wir hören: »Jambo customer, how are you? I’m Esther. Come to my shop!« Weitere Frauen eilen herbei und wollen uns ihre Namen einprägen, damit wir morgen sicher im richtigen Shop das Richtige kaufen können. Das Problem sei nur, dass morgen Sonntag sei und sie deshalb von neun Uhr morgens bis drei Uhr nachmittags in der Kirche seien. Wir sollten doch warten und sie nicht enttäuschen. Nun ja, natürlich können wir nicht warten, denn meine Familie in Barsaloi wartet schon vierzehn Jahre auf meine Rückkehr.
Kurz vor der Weiterfahrt besichtigen wir die Thomson’s Falls, den bekannten Wasserfall, der aus beachtlichen 72 Metern Höhe in die Tiefe fällt. Früher fuhr ich diese Strecke mehrere Male, doch für einen touristischen Halt hatte ich nie einen Sinn.
Nach der Besichtigung des Wasserfalls können wir das Camp ohne viel Aufsehen verlassen, da die Frauen ihre Souvenirläden tatsächlich noch geschlossen haben. Nun beginnt es für mich wirklich spannend zu werden, denn unser heutiges Reiseziel ist Maralal. Wenn alles wie vereinbart klappt, werden wir dort James treffen. In seinem letzten Brief hatte er vorgeschlagen, uns entgegenzukommen, um uns den neuen Weg nach Barsaloi zeigen zu können.
Ich freue mich sehr, ihn wiederzusehen, und bin neugierig, welche Neuigkeiten er zu berichten hat. Vor allem interessiert mich, wie Lketinga zu meinem Besuch steht. Freut er sich oder könnte es zu Schwierigkeiten kommen? Obwohl er selbst wieder mit einer einheimischen Frau verheiratet ist, bin ich überzeugt, dass er mich immer noch als seine Frau betrachtet. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie er sich verhalten wird. Ich hoffe sehr, dass wir James finden werden und dass er meine letzten Zweifel beseitigen kann!
Anfänglich fahren wir noch einige Kilometer auf einer Asphaltstraße weiter, bis diese beim Dörfchen Rumuruti abrupt endet und in eine Naturstraße übergeht. Ab jetzt befinden wir uns im Samburuland. Wie mit einem Lineal gezogen ändert sich die Vegetation. Fuhren wir bisher durch viel grünes Weide- und Kulturland, so sieht die Landschaft nun äußerst trocken aus und die Farbe der Erde beginnt, sich von Beige in Rot zu verwandeln. Die Temperaturen steigen ebenfalls an.
Ab hier gibt es keine einzige Teerstraße mehr, nur holprige Naturpisten. Unsere Fahrzeuge hinterlassen eine riesige Staubwolke und wir werden kräftig durchgerüttelt. Als meine Reisebegleiter einige Bemerkungen zum Zustand der Piste machen, kann ich ihnen nur lachend versichern, dass es vor vierzehn Jahren noch wesentlich schlimmer war. Mir gefällt das Geschüttel und meine Freude kann nichts mehr bremsen. Die Erinnerung an diese Straße und ihre Tücken ist so stark, dass ich unseren Fahrer bitte, mich ans Steuer zu lassen. Wenn es schon den großen Bus auf dieser Strecke nicht mehr gibt, möchte ich mich wenigstens an meinen klapprigen Landrover erinnern. Wir holpern über die Piste und ich muss mich beim Fahren sehr konzentrieren, um zumindest den größeren Löchern ausweichen zu können.
Aus den Augenwinkeln erkenne ich ab und zu die ersten Manyattas abseits der Straße. Hin und wieder tauchen ein paar Meter vor dem Wagen weiße Ziegen auf. Während sie die Straße langsam verlassen, blicken uns die sie hütenden Kinder hinterher. Die Jungen klemmen sich dabei meistens einen Stock hinter dem Rücken waagrecht zwischen die Armbeugen. Die jüngeren Mädchen hingegen lachen und winken uns Mzungus in den Autos hinterher. Nach etwa zwei Stunden erreichen wir ein kleineres Dörfchen, das sich lediglich an ein paar Shops rechts und links der Straße und natürlich den farbenfroh gekleideten Menschen, die davor stehen, ausmachen lässt. Nein, noch etwas kündigt im Gegensatz zu früher menschliche Behausungen an: Plastik! Es ist ein Trauerspiel zu sehen, wie sich der Einzug von Plastik in Kenia bemerkbar macht. Es beginnt etwa 500 Meter vor jedem Dorf. Anfangs hängen nur einige blaue, rosafarbene oder durchsichtige kleine Plastikbeutel an den niedrigen Büschen. Je näher man dem jeweiligen Dorfkern kommt, desto schlimmer wird es. An jedem Dorn der kleinen Büsche sind Plastikbeutel aufgespießt. Wenn man nur flüchtig hinsieht, könnte man meinen, es seien blühende Büsche, aber die traurige Wahrheit erschließt sich schnell bei genauerem Betrachten. Zu meiner Zeit in Kenia gab es hier noch fast kein Plastik. Hatte jemand einen Plastikbeutel von einem Touristen ergattert, wurde dieser wie ein Augapfel gehütet und immer wieder verwendet. Nun aber hängen sie zu Tausenden an den Büschen!
Maralal
Kurz bevor wir unser Tagesziel erreichen, übergebe ich das Steuer wieder unserem Fahrer, damit ich bei der Einfahrt in Maralal alles mit den Augen erfassen kann. Schnell bemerke ich, wie sehr dieser Ort inzwischen gewachsen ist. Es gibt neue Straßen, wenn auch Naturstraßen, sogar einen Kreisverkehr und direkt daneben, ich kann es nicht fassen, eine moderne BP-Tankstelle mit Laden, wie bei uns in der Schweiz. Wie ich bald feststelle, hat Maralal mittlerweile drei Tankstellen, Benzin ist immer erhältlich. Das war zu meiner Zeit noch ganz anders. Ich wusste nie, wann die einzige Tankstelle wieder Benzin bekommen würde. Manchmal mussten wir mehr als eine Woche ausharren, um anschließend mit einem vollen 200-Liter-Benzinfass über die gefährliche Buschstraße zu fahren. Zu Hause stellte sich dann die Frage, wo und wie wir das volle und gefährliche Fass verstauen konnten, da bei den Manyattas immer mit Feuer hantiert wird. Gott sei Dank half auch bei diesem Problem Pater Giuliani. Heute sind diese Tankstellen für alle Autobesitzer natürlich eine unglaubliche Erleichterung. Früher gab es allerdings nicht mehr als zehn Autos in dieser Gegend!
Mit unseren beiden Land Cruisern fahren wir langsam am Markt vorbei, der sich nicht wesentlich verändert hat. Mehrere Holzstände stehen nebeneinander und überall hängen die schönen bunten Massai-Decken und -Tücher im Wind. Dahinter befindet sich wie eh und je das Postamt. Später stelle ich erstaunt fest, dass dort vier Computer stehen, mit deren Hilfe sich die Missionare oder ehemalige Schüler über das Internet mit der Welt verbinden lassen können.
Wir fahren sehr langsam, um James nicht zu verpassen. Aufgeregt schlage ich vor, zuerst eine Runde durch Maralal zu fahren, da wir Weißen auffallen und James auf diese Weise sicher von unserer Ankunft hören wird.
Maralals Zentrum sieht aus wie früher, doch an den Rändern ist der Ort in alle Himmelsrichtungen gewachsen. Wir kommen an Sophias ehemaligem Häuschen vorbei und sofort tauchen die Erinnerungen an sie auf. Sie war mir in jener Zeit eine sehr gute Freundin. Wir hatten das Glück, zur gleichen Zeit schwanger zu sein und in derselben Woche unsere Töchter zur Welt zu bringen. Wir waren die ersten weißen Frauen, die in dieser Gegend Kinder geboren haben, und konnten uns deshalb ein Zimmer im Spital von Wamba teilen. Sophia und ihren italienischen Kochkünsten verdanke ich, dass ich im letzten Schwangerschaftsmonat die nötigen zehn Kilo zulegen konnte, um für die Geburt wenigstens ein Minimalgewicht von siebzig Kilo zu erreichen. Heute wiege ich bei einer Körpergröße von 1,80 m weit mehr und bin nicht im neunten Monat schwanger. Wie gerne würde ich sie und ihre Tochter wiedersehen!
Nachdem wir unsere Maralal-Rundfahrt beendet haben, parken wir die Wagen vor dem Lodging, in dem ich früher immer mit Lketinga übernachtet habe. Kaum ausgestiegen, sind wir von mindestens acht jungen Männern umringt, die uns etwas verkaufen möchten. Einer von ihnen erwähnt, dass hier vor ein paar Wochen, genau in diesem Lodging, der Film über »Die weiße Massai« gedreht wurde. Ob wir diese Geschichte auch kennen? Ein anderer nickt bestätigend mit dem Kopf und fragt dazwischen, ob wir vielleicht auch zu diesen Filmleuten gehören. Dabei schaut er mich prüfend an. Wir verneinen, während wir das Restaurant betreten.
Es ist anders eingerichtet, als ich es in Erinnerung habe. In der Mitte dominiert eine barähnliche Theke, die mit einem Maschendraht vergittert ist. Durch eine kleine Öffnung bekommen wir unsere Cola gereicht. Wir werden weiterhin von den Männern belagert, von denen einige nach Bier riechen. Ich werde nach meinem Namen gefragt und sage irgendeinen. Ich möchte mich nicht als die echte weiße Massai zu erkennen geben, zumal ich noch nicht weiß, wie das Filmteam hier in Maralal aufgenommen worden ist. Aber was ist, wenn James jeden Moment eintrifft?
Zur Ablenkung frage ich nach Samosas, den kleinen, mit Fleisch gefüllten Teigtaschen. Sofort läuft einer der Männer los, um nach nur wenigen Minuten zehn in altes Zeitungspapier gewickelte Samosas auf den Tisch zu legen. Erfreut esse ich drei davon. Meine Begleiter Albert und Klaus hingegen verspüren beim Anblick der fettigen Druckerschwärze keinerlei Appetit.
Wo bleibt nur James? Wir warten noch etwa eine halbe Stunde, doch er taucht nicht auf. Was ist, wenn er meinen letzten Brief nicht erhalten hat? Allerdings habe ich keinen genauen Treffpunkt ausgemacht, weil ich Maralal als sehr übersichtlich in Erinnerung hatte.
Inzwischen türmen sich die Touristensouvenirs, handgefertigter Massai-Schmuck, kleine Kopfstützen aus Holz sowie Rungus, die Schlagstöcke der Krieger, zwischen den Samosas auf dem Tisch und langsam wird es ungemütlich. Wir bezahlen einen für hiesige Verhältnisse enormen Betrag für die Teigtaschen und verteilen die restlichen an die übrigen Gäste. Draußen ist James immer noch nicht in Sicht und so beschließen wir, vorerst in die Safari Lodge hochzufahren, um in Ruhe unsere Zimmer zu beziehen.
Mit dieser Lodge verbinden mich ganz besondere Erinnerungen. Auf ihrer Terrasse saß ich, als ich zum ersten Mal nach Maralal kam, um meinen späteren Mann zu suchen. Ich beobachtete stundenlang die Zebras, Affen und Wildschweine um das Wasserloch und fragte mich, hinter welchem Hügel wohl dieser geheimnisvolle Krieger lebt und ob er ahnt, dass ich in seiner Nähe bin. Mit einer Handvoll Fotos bewaffnet lief ich täglich durch Maralal und fragte immer wieder die ankommenden traditionell gekleideten Männer nach Lketinga. Nach zehn Tagen wurden meine Bemühungen und Gebete belohnt. Ich konnte die größte Liebe meines Lebens in die Arme schließen und unser Schicksal nahm seinen Lauf.