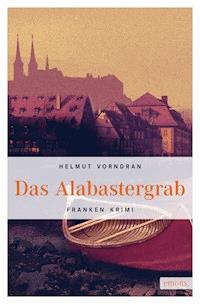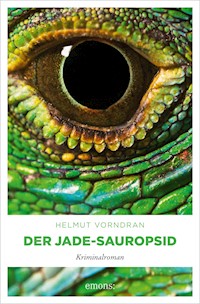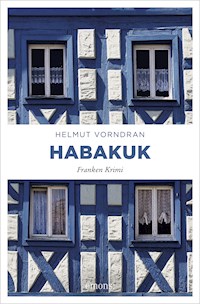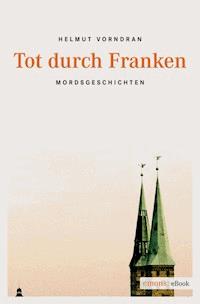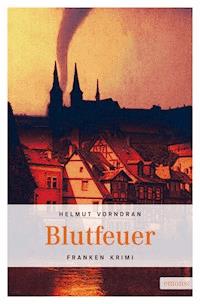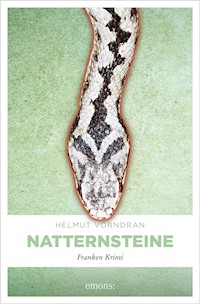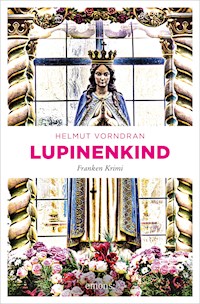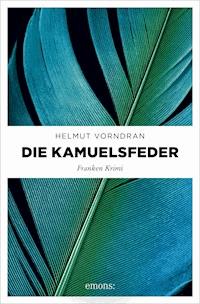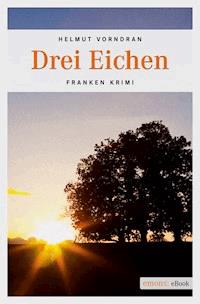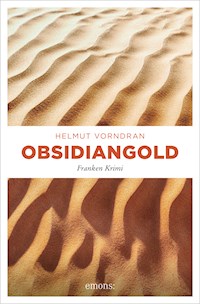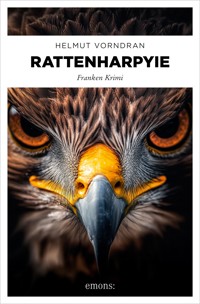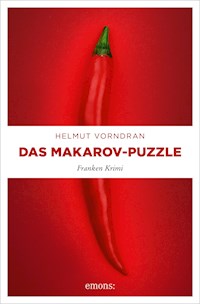
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Kommissar Haderlein
- Sprache: Deutsch
Neues vom Meister des Frankenkrimis! Hinterfotzig, skurril, sauspannend. In der Stadt ist er bekannt wie ein bunter Hund: Georg Schugg verbreitet wahnwitzige Thesen über die Klimaerwärmung, hinter der er ein Komplott einer globalen Industrie-Elite vermutet. Da er sich wegen einer Publikation in Lebensgefahr glaubt, bittet er die Bamberger Polizei um Schutz. Kurz darauf verschwindet Schugg tatsächlich – und Kommissarin Andrea Onello ebenfalls. Ihre Kollegen Haderlein und Co. begeben sich mit Verstärkung eines neuen, hochbegabten Ermittlerferkels auf eine rasante Jagd, die sie bis in die Fränkische Schweiz führt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 477
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Helmut Vorndran, geboren 1961 in Bad Neustadt/Saale, lebt mehrere Leben: als Kabarettist, Unternehmer und Buchautor. Als überzeugter Franke hat er seinen Lebensmittelpunkt im oberfränkischen Bamberger Land und arbeitet als freier Autor unter anderem für Antenne Bayern und das Bayerische Fernsehen.
www.helmutvorndran.de
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
Lust auf mehr? Laden Sie sich die »LChoice«-App runter, scannen Sie den QR-Code und bestellen Sie weitere Bücher direkt in Ihrer Buchhandlung.
© 2020 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: onemorenametoremember/photocase.de
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Marit Obsen
eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-686-9
Franken Krimi
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Und der Herr sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und gehe hin in das Land Morija und opfere ihn daselbst zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham des Morgens früh auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, davon ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von ferne und sprach zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen, und wenn wir gebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen.
Und als sie kamen an die Stätte, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham daselbst einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, dass er seinen Sohn schlachtete.
DAS ERSTE BUCH MOSE (GENESIS)
Der Rebell
Der Tag in der Bamberger Dienststelle begann relativ ruhig, das Arbeitsklima war fast friedlich zu nennen. Es war ein Dienstag, der erste Arbeitstag nach dem Osterwochenende. Endlich wieder Sommerzeit, es war abends wieder länger hell, und normalerweise läge ein Hauch von Frühling in der Luft. Der hatte in diesem Jahr aber schon wieder ausgehaucht beziehungsweise war von einem verfrühten Sommereinbruch überrollt worden und hatte sich beleidigt zurückgezogen. Mitte April und bereits einunddreißig Grad, das musste auch der toleranteste Lenz als übertrieben empfinden und somit aus fundamentalen Gründen vehement ablehnen. Bis zum nächsten, bitte schön kühleren Jahr.
Was soll man einem Frühling da sagen? Armer Irrer, schau mal in die Klimatabellen? Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt, also lassen wir der armen Jahreszeit doch einfach ihre Illusion.
Die sich immer deutlicher abzeichnende Klimaveränderung war für den gemeinen Bamberger jedoch Chance und Grund zugleich, sich immer zeitiger auf die Keller hinaufzubegeben, um sich bei derartig zum Warmen veränderter Außentemperatur bereits Anfang April dem Genuss von Bier und Schäuferla hinzugeben. Ein Unterfangen, das zu Zeiten der Ahnen frühestens im Mai praktiziert werden konnte.
Inzwischen musste man als biertrinkender Bamberger völlig umdenken, da nach den Erfahrungen der letzten Jahre im Juli und August bei glühendem Teer und flirrender Außenluft bereits der eine oder andere Engpass im Biernachschub in den Brauereien eingetreten war und zu haltlosen Zuständen an den fränkischen Biertischen geführt hatte. Da galt es vorzubeugen und frühzeitig den Hopfenlevel auf ein akzeptables Niveau zu heben.
Von derartigem Ansinnen unbeleckt, verrichtete Marina Hoffmann alias Honeypenny, die Sekretärin und Abteilungsmama in der Dienststelle der Bamberger Kriminalpolizei, ihre Arbeit. Sie war fast allein in ihrem Tun, lediglich das neueste Teammitglied, Andrea Onello, schob mit ihr zusammen Dienst. Die übrigen Beamten waren anderweitig beschäftigt.
Franz Haderlein war schon in aller Frühe mit seiner Lebensgefährtin aufgebrochen, um Riemenschneider und ihre Kleinen in ihrer neuen Bleibe in Ebensfeld zu besuchen. Die Ausnüchterungszelle im Untergeschoss, in der Riemenschneider ihre Nachkömmlinge zur Welt gebracht hatte, sah inzwischen wirklich aus wie ein Saustall und roch auch dementsprechend. Ihrer aller Chef Robert Suckfüll hatte Haderlein eine letzte Deadline von dreißig Tagen gesetzt, nach der das Dienststellenferkel und ihr Nachwuchs verräumt sein mussten, sonst werde er den nächstbesten Metzger anrufen, um die Schweinerei umgehend aus seiner Dienststelle entfernen zu lassen. Aber das Thema war seit den Osterfeiertagen vom Eis, ein Biobauer aus Ebensfeld hatte sich erbarmt und die ganze schweinische Gesellschaft bei sich aufgenommen.
César Huppendorfer war zu einer pädagogischen Fortbildung in Nürnberg und voraussichtlich erst ab dem späten Nachmittag wieder zurück. Der Kollege Bernd »Lagerfeld« Schmitt hatte diese Woche sogar komplett frei, um aus der ehemaligen Wohnstatt in Loffeld, seiner Mühle, die er mit seiner Nicht-mehr-Lebensgefährtin Ute von Heesen bewohnt hatte, auszuziehen. Die Trennung war weitestgehend friedlich verlaufen, das Haus bereits verkauft und er auf dem besten Weg, in seine neue alte Heimat Bamberg umzusiedeln. Ute hatte mitsamt der gemeinsamen Tochter eine Bleibe in Coburg gefunden, ganz in der Nähe der HUK, und war also auch nicht aus der Welt.
Robert Suckfüll war heute Morgen zu einem Termin nach Haßfurt gefahren, da die neue Regierung des Bundeslandes Franken etwas Persönliches mit ihm zu besprechen hatte. Dieses Treffen musste jedoch rund eine Stunde später beginnen, da Fidibus sich im Moloch Haßfurt gründlich verfahren hatte und ergo zu spät zum anberaumten Sitzungstermin erschienen war.
Blieben Andrea und Honeypenny, um die Stellung zu halten und Bamberg gegen die Verbrecher der Weltkulturerbestadt zu verteidigen. Die hatten zurzeit aber wohl Besseres zu tun, denn im Moment passierte kriminaltechnisch wenig bis nichts. Keine Morde, keine Entführungen, keine schweren Körperverletzungen, nicht einmal ein größerer Einbruch war zu vermelden. Die Bamberger Sommerstimmung schien sich auf alle Gesellschaftsschichten der Stadt übertragen zu haben, was aber auch wirklich niemanden störte, am allerwenigsten die derzeit ausschließlich weibliche Besetzung der Bamberger Kriminalpolizei.
So empfand Marina Hoffmann das Klopfen an der Bürotür mehr als persönlichen Eingriff in ihr beschauliches Leben denn als einen normalen Vorgang des kriminalen Arbeitsalltags. Widerstrebend erhob sie sich und bewegte ihren durchaus drallen Körper zu besagter Tür, um diese mit strengem Gesichtsausdruck zu öffnen.
Vor ihr stand ein großer, muskulöser, kräftiger Mann. Die Kleidung abgewetzt, löchrig bis ganz und gar verschlissen. Aus dem sonnengegerbten Gesicht blickten ihr zwei kleine, hektisch irrlichternde Äuglein entgegen, für die sich die Dienststellensekretärin weit weniger interessierte als für den struppigen, ungekämmten schwarzen Filz auf dem Kopf des Mannes und seinen ebenso verwilderten Vollbart. Auf gut Deutsch, eine ziemlich verhaute Persönlichkeit, die sich da in der Bamberger Dienststelle der Kriminalpolizei eingefunden hatte, allerdings eine stadtbekannte.
»Der Zimmergörch!«, entfuhr es Honeypenny, als ihr klar wurde, wen sie da vor sich hatte. Und damit war es vorbei mit der Beschaulichkeit des heutigen Tages, das war ihr sofort klar. Jetzt hieß es, die Schutzschilde hochzufahren und den verbalen Knüppel aus dem Sack zu holen.
Georg Schugg, der sogenannte Zimmergörch, war von seinem Auftrag durchdrungen. Das wusste beinahe jeder in Bamberg, entsprechend hatten sich die Menschen auf den kauzigen Typ eingestellt, der seine vogelwilden Thesen allüberall zum Besten gab, ob man sie hören wollte oder auch nicht. Das »oder auch nicht« überwog in fast einhundert Prozent der Fälle, weswegen Georg Schuggs dringliches Anliegen bei seinen meist unfreiwilligen Zuhörern auf unfruchtbaren Boden fiel, egal wie oft er den Samen auch auszusäen versuchte. Der Zimmergörch war ein lästiger, jedoch harmloser Spinner und somit für die meisten ein hinzunehmender Stolperstein auf dem Weg durch die Beschwernisse des Bamberger Alltags.
Der Grund für das ausgeuferte Sendungsbewusstsein des Zimmergörchs blieb seinem Auditorium indes verborgen, denn die vorgebrachten Argumente sprengten selbst mit sehr weit gefasster Toleranz die Grenzen des gesunden Menschenverstandes und mussten somit als kompletter Schmarrn klassifiziert und umgehend in den intellektuellen Mülleimer befördert werden.
Honeypenny war das im Moment einfach zu viel. Der Tag hatte so relaxt und friedlich angefangen, da konnte sie einen Spinner wie den Zimmergörch jetzt ganz bestimmt nicht gebrauchen. Sie war gerade dabei, in aller Ruhe die Dinge abzuarbeiten, die schon seit Längerem liegen geblieben waren, und wollte sich nicht in sinnlose Debatten über eine angeblich ferngesteuerte Klimaveränderung hineinziehen lassen.
Angriffslustig betrachtete sie den Mann, ohne recht zu wissen, was sie mit der Situation anfangen sollte. Wer hatte diesen Irren denn überhaupt hereingelassen? Irgendwer unten an der Personenschleuse wollte sich wohl einen üblen Scherz mit ihr erlauben. Honeypenny öffnete den Mund zu einer gepfefferten Eröffnungsrede, als ihr der zerlumpte Zimmergörch zuvorkam.
»Es will mich jemand umbringen«, tönte es heiser zwischen den rissigen Lippen hervor, während sein Blick hektisch über Marina Hoffmanns Schulter in die Dienststelle hinein- und wieder zurückhuschte.
Das war’s, mehr hatte Georg Schugg nicht zu sagen, er wartete nun auf eine Antwort.
Den imaginären Knüppel hatte er Honeypenny mit diesem einen Satz rigoros aus der Hand geschlagen, denn jetzt war es ein offizielles Anliegen an die Bamberger Polizei. Das musste aufgenommen werden, ob sie wollte oder nicht. Auch wenn sie zu einhundert Prozent davon ausging, dass das wieder so eine bodenlose Spinnerei des stadtbekannten Verrückten war, musste sich die Polizei dieser Angelegenheit zumindest der Form halber annehmen, ehe der Fall Georg Schugg nach dem Verschwinden dieser abstrusen Persönlichkeit aus der Dienststelle ganz schnell schubladisiert und damit ad acta gelegt werden konnte.
Honeypenny bat den Mann ins Büro und führte ihn umgehend zum Schreibtisch von Andrea Onello, die den verkommenen Mann ratlos betrachtete. Als jüngster Neuzugang der Bamberger Dienststelle war sie zwar keineswegs neu in der Stadt, aber dennoch die Einzige, die nicht wusste, mit wem sie es hier zu tun hatte. Es war ihr auch ziemlich egal, da ihre Gedanken gerade um das Problem kreisten, wie sie den leicht angerosteten Ring abbekommen sollte, den ihr der Leiter der Erlanger Rechtsmedizin bei ihrem völlig missratenen Candle-Light-Dinner auf den Finger gezwungen hatte.
Sie hatte es mit Erwärmung, Öl und Seifenlauge versucht und war sogar schon in einem Schmuckgeschäft gewesen, aber der Juwelier hatte ihr gesagt, das Teil sitze so fest, er müsse ihr den Ring wohl oder übel vom Finger flexen. Das könne eventuell etwas schmerzen, so seine Vorhersage. Diese Vorstellung ängstigte Andrea Onello dann doch, weshalb sie die operative Entfernung des aus der tödlichen Pfeilspitze einer achthundert Jahre alten Moorleiche gefertigten Schmuckstücks wieder und wieder vor sich herschob. Aber der Dienst rief, sie musste derlei Gedanken erst einmal verbannen.
»Das ist der Herr Schugg, Andrea«, meinte Honeypenny pseudofreundlich, ehe sie sich schleunigst wieder an ihren Schreibtisch verdrückte.
»Bitte setzen Sie sich doch.« Während Andrea mit der rechten Hand auf den Besucherstuhl vor ihrem Schreibtisch deutete, musterte sie unauffällig den verwahrlost wirkenden Mann, der bereitwillig auf dem angebotenen Sitzmöbel Platz nahm. Wieder hetzte sein Blick durch den Raum, als vermutete er hinter den Aktenschränken ungebetene Zuhörer, versteckte Kameras oder gar Attentäter.
Andrea Onellos Stimmung war der von Marina Hoffmann nicht unähnlich. Sie musste diesen Mann anhören, dazu war sie beruflich verpflichtet, allerdings hatte auch sie keine große Lust, sich von dem Landstreicher die Zeit stehlen zu lassen. Also kam sie gleich zum Punkt und schaute dabei demonstrativ auf ihre Uhr. »Na schön, Herr Schugg, was kann die Kriminalpolizei denn für Sie tun?«, fragte sie, so höflich es nur irgend ging.
»Ich werde schon seit Längerem verfolgt, Frau Kommissarin. Zwar habe ich keine Ahnung, wer die sind, aber ich bin mir inzwischen ziemlich sicher, dass man versuchen wird, mich umzubringen«, flüsterte der Mann, dessen fiebriger Blick sich in die Augen seines verständigen Gegenübers bohrte.
Bei Andrea Onello schrillten sogleich die Alarmglocken. Ach du liebe Güte, dachte sie ahnungsvoll, schon wieder einer mit Verfolgungswahn. Nur dass als Stalker diesmal kein Ex-Lebenspartner herhalten muss, sondern ihm völlig unbekannte Persönlichkeiten. Na toll. Hilfesuchend wanderte ihr Blick zu Honeypenny hinüber, die allerdings stoisch auf den Bildschirm ihres Computers schaute. Von dieser Seite war also keine Unterstützung zu erwarten. Da musste sie wohl oder übel allein durch.
»Aha, es will Ihnen also jemand etwas Böses, aber Sie wissen nicht genau, wer. Habe ich das richtig verstanden?« Sie musterte intensiv den seltsamen Mann, der immer unruhiger zu werden schien.
»Genau, genauso ist es«, bekräftigte er und schien darauf zu warten, dass sie sich das Gehörte aufschrieb. Die Kommissarin war aber nicht gewillt, seinen Verdacht einfach so zu protokollieren. Sie verschränkte die Arme, beugte sich nach vorne über den Tisch und schaute dem Mann mit festem Blick tief in die Augen.
»Aha«, meinte sie mit drohendem Unterton in der Stimme. »Und gibt es für diese gewaltige Anschuldigung vielleicht irgendwelche Beweise, und seien sie auch noch so klein? Ohne kann ich nämlich keinen Fall anlegen, verstehen Sie? Täte ich es, wäre das ebenfalls ein Verbrechen, und zwar der Allgemeinheit, dem Steuerzahler gegenüber, der mich und meine Arbeitsstunden hier bezahlen muss. Also, können Sie Ihre Behauptungen belegen oder nicht?«
»Ja, natürlich habe ich dafür Beweise, Frau Kommissarin, ich bin ja nicht blöd«, erwiderte der Zimmergörch fast ein wenig entrüstet. Er beugte sich vor und griff nach halb links unten, wo sich überraschenderweise eine Ledertasche befand. Da diese in einem genauso derangierten Zustand war wie ihr Besitzer, hatte Andrea Onello sie zuvor gar nicht bemerkt. Jetzt stellte sie fest, dass die Tasche sogar einen Inhalt beherbergte, und zwar ein etwa zwei Zentimeter dickes, DIN-A4-großes gebundenes Machwerk der schriftlichen Art, das Georg Schugg geräuschvoll vor sie auf den Tisch fallen ließ. Die kopierten und per Klebebindung selbst zusammengefügten Seiten hatten im Laufe ihres wer weiß wie langen Lebens schon einiges mitmachen müssen. Jedenfalls deuteten die ausgefransten und fleckigen Ränder darauf hin. »Das ist mein Beweis«, knurrte der Zimmergörch und legte seine rechte Hand auf den dicken Prügel von einem selbst gebastelten Buch.
Andrea Onello war etwas überrascht, dass dieser Mensch tatsächlich mit etwas halbwegs Greifbarem daherkam. Andererseits war das noch gar nichts, geschweige denn ein Beweis.
»Aha, und was soll das sein?«, fragte sie energisch nach.
Eine Frage, die sie noch lange bereuen sollte, denn auf das, was jetzt kam, war sie wirklich nicht gefasst. Dabei hätte ein schneller Blick zu ihrer Dienststellensekretärin sie vor Schlimmerem bewahren können, denn Marina Hoffmann hatte sehr wohl mitgehört und ihr mit einer hektischen, kurzen Handbewegung eine deutliche Warnung gesandt, was Andrea Onello aber nicht mitbekommen hatte. Nun war die Frage gestellt, und niemand beantwortete sie lieber als Georg Schugg. Seine Augen verengten sich, und er legte nun auch die zweite Hand auf den zerfledderten Einband des Eigenbaubuches.
»Das ist ein Manifest. Mein Manifest«, erklärte Schugg mit bedeutungsvollem, jedoch starrem Blick. Er hob die Arme zunächst anbetungswürdig zur Zimmerdecke und dann zu einer ausführlichen Erklärung an. »Die Fakten beweisen, es gibt keine Erderwärmung infolge von CO2-Emissionen. Die ganze öffentliche Debatte über die sogenannte Klimakatastrophe ist erstens falsch und zweitens gefährlich. Fremde Mächte wollen uns das einreden, um ihre Interessen durchzudrücken. Der weltweite Klimaschutz ist in Wahrheit nichts anderes als ein monströses Deindustrialisierungsprogramm, verbunden mit veritabler Arbeitsplatzvernichtung. Tatsächlich verursachen die periodischen Strahlungszyklen und Änderungen der Bahnparameter der Sonne nämlich zwangsläufig den Klimawandel, auch in der Zukunft. Die da oben verschwenden aufgrund vollkommen natürlicher Gegebenheiten Abermilliarden, um imaginierte Weltuntergänge abzuwenden. Die schüren nur Angst vor Dingen, die es gar nicht gibt, das ist ein Riesenkomplott!«
»Angst«, echote Andrea Onello, die von dem emotionalen Ausbruch ihres Gegenübers völlig überrumpelt wurde. Der erkannte sofort seine Chance und machte im gleichen Duktus weiter.
»Alle reden von globaler Erwärmung. Dabei waren die Winter 2009 und 2010 Rekordwinter in vielen Ländern. Es stimmt nicht, dass es immer wärmer wird. In Wahrheit sinken die Temperaturen. Die Eisflächen auf der Südhalbkugel wachsen sogar. Das soll Erderwärmung sein? Der Klimawandel ist ein natürlicher Prozess und nicht durch den Menschen verursacht. Der menschliche CO2-Ausstoß ist viel zu gering, um Einfluss auf das Klima zu nehmen, das müsste doch eigentlich jedem sonnenklar sein. Wir können ja nicht einmal genau vorhersagen, wie morgen das Wetter wird, wie sollen wir da das Klima in hundert Jahren voraussagen? Klimaschwankungen gab es schon immer. Im Mittelalter zum Beispiel war es viel wärmer als heute, und das, obwohl der CO2-Gehalt in der Luft weitaus geringer war. Die letzten zweitausend Jahre sind zwar nur ein Wimpernschlag in den vier Komma fünf Milliarden Jahren Erdgeschichte, aber selbst in dieser kurzen Zeit gab es Eiszeiten, Wärmeperioden, eine mindestens sechs Monate anhaltende Dürre in Mitteleuropa mit Hungersnot und ein eisfreies Grönland, das bewirtschaftet wurde. Und selbst wenn es den Klimawandel gäbe: Dann steigt die Temperatur weltweit eben um ein paar Grad. Wäre das wirklich so schlimm? Unser Planet ist doch schon mit vielen Veränderungen klargekommen. Es hätte ja sogar Vorteile. Positive Effekte für die Landwirtschaft zum Beispiel. Tiere und Pflanzen würden sich der Klimaerwärmung anpassen, der Boden würde in vielen Regionen der Welt fruchtbarer werden. Je wärmer, desto besser wachsen Pflanzen, ist doch logisch. Es würde aber sowieso keine dauerhafte Erwärmung geben, weil dann irgendwann der Golfstrom abreißt, etwa so wie in ›The Day After Tomorrow‹.«
Der Zimmergörch sprang auf, er hatte sich mehr und mehr in Rage geredet. »All die sogenannten Wissenschaftler, die das Märchen von der Klimakatastrophe verbreiten, lügen wissentlich. Zum Klimawandel gibt es nämlich gar keinen wissenschaftlichen Konsens. Die Prozesse sind viel zu komplex für irgendwelche Prognosen. Was die meisten für Klimaerwärmung halten, ist nach meinen Recherchen entweder auf Messfehler oder unsaubere Daten zurückzuführen. Und warum? Wegen wirtschaftlicher Interessen oder der Verfolgung einer politischen Agenda. Dem Klimawandel, sollte er doch irgendwann kommen, was ich nicht glaube, müssen wir mit technischen Maßnahmen begegnen. Für sauberen Strom sorgt dann die Atomkraft. Das ist das Einzige, was hilft. Aber wie gesagt, ich bin fest davon überzeugt, dass der Klimawandel in Wirklichkeit nur eine Lüge ist, eine Drohkulisse. Damit diese grünen Phantasten alles umbauen können und einen Haufen Kohle machen mit ihren sinnlosen Bauwerken und Anlagen. Und wer steht am Ende dafür gerade? Natürlich müssen wir das alles bezahlen, wir alle –«
»Stopp! Stopp! Stopp!«, rief Andrea Onello laut und hob abwehrend beide Arme. »Es reicht. Ich habe verstanden, was Sie mir sagen wollen.«
Georg Schuggs Gesicht war puterrot angelaufen, es fiel ihm sichtlich schwer, in seinem Vortrag innezuhalten. Aber die unerbittliche Miene der Kommissarin signalisierte einen sich alsbald anbahnenden Gefühlsausbruch, sollte er nicht sofort gehorchen. Verdutzt schaute er zuerst auf sie, dann auf seine gestikulierend erhobenen Hände.
»Setzen«, knurrte Andrea Onello, die sich gerade noch zusammenriss, und Georg Schugg ließ sich folgsam auf seinen Stuhl sinken. Ihr strenger Blick ließ diesen Verrückten dabei keine Sekunde lang aus den Augen.
Als ihr Gegenüber abwartend vor ihr saß, schweifte ihr Blick kurz hinaus in den einunddreißig Grad warmen Frühling, ehe er umgehend wieder zu Georg Schugg zurückkehrte.
»Okay, guter Mann«, sagte sie bemüht freundlich, um die Konversation wieder in ruhigere Bahnen zu lenken. »Völlig egal, ob ich Ihre Theorien jetzt glaube oder nicht. Wofür bitte schön soll das ein Beweis sein? Das müssten Sie mir noch genauer erklären, und zwar kurz und knapp, wenn’s geht.« Drohend hatte sie den Zeigefinger der rechten Hand gehoben und sandte einen mahnenden Blick hinterher.
Georg Schugg beugte sich über den Tisch. Seine Augen wurden groß und bekamen einen tiefen, beschwörenden Ausdruck. Die verschwitzte rechte Hand legte er wieder flach auf sein ramponiertes Manifest, bevor er mit heiserer Stimme zu flüstern begann: »Ich kann es beweisen, es steht alles da drin. Ich habe herausgefunden, wer dafür verantwortlich ist, und deswegen wollen die mich erledigen. Es wird nicht mehr lange dauern, dann haben sie mich gefunden, und dann bin ich fällig. Sie müssen mir helfen, Frau Kommissarin, sonst bin ich ein toter Mann.« Er nickte noch einmal bekräftigend und lehnte sich dann erschöpft an die Rückenlehne seines Stuhles, von wo er die Kommissarin, die ihn mit leerer Miene anschaute, abwartend fixierte.
Andrea Onello legte ihre Hände auf den Tisch, faltete sie und senkte kurz den Blick. Als sie ihn wieder hob, konnte Georg Schugg erkennen, dass sie sich wieder im Griff hatte. Nicht nur das, die Kommissarin wirkte regelrecht entspannt, was in ihm ein hoffnungsfrohes Gefühl auslöste. Endlich einmal jemand, der ihn nicht sofort für verrückt erklärte und ihm mit Anwalt, Polizei oder weit Schlimmerem drohte. Jetzt lächelte sie sogar, woraufhin er gelöst zurücklächelte.
Andrea Onellos Lächeln wurde noch etwas breiter, sah sie sich doch nach kurzer Irritation nun wieder in der erfreulichen Lage, die Gesamtsituation objektiv zu analysieren und finale Schlüsse zu ziehen. Dann teilte sie dem kräftigen, aber heruntergekommenen Mann ihre Einschätzung seines Anliegens mit.
»Also, Herr Schugg. Ich glaube wirklich, dass Sie sich da in etwas hineingesteigert haben. Am besten, Sie gehen jetzt erst einmal nach Hause und schlafen sich aus. Und sollten Sie in der nächsten Zeit etwas Verdächtiges bemerken, rufen Sie uns an. Dann werden wir gern eine Streife schicken, die sich das ansieht, okay?« Sie sagte das so konziliant, wie es ihr nur möglich war, was beim sendungsbewussten Zimmergörch allerdings auf wenig Verständnis stieß.
»Streife? Sie wollen eine Streife schicken?« Die Fassungslosigkeit in seinem Blick war nicht mehr zu überbieten. »Wenn die mich erst einmal im Visier haben, ist es zu spät, um eine Streife zu schicken, verstehen Sie das denn nicht? Bevor Ihre saubere Streife überhaupt losgefahren ist, bin ich schon tot! Erstochen, erschlagen, überfahren oder erschossen!«
Wieder war der Mann aufgesprungen, sein ausgestreckter rechter Zeigefinger deutete vorwurfsvoll in Andrea Onellos Richtung. Die blieb ruhig und agierte sehr konsequent.
»Ich verstehe vor allem eines, nämlich dass unser Termin hier beendet ist, Herr Schugg.« Andrea Onello stand auf und wies mit einer auffordernden Geste auf die Tür der Dienststelle. Auch Honeypenny hatte sich von ihrem Stuhl erhoben. Mit drohendem Blick und hochgekrempelten Ärmeln baute sie sich vor dem Zimmergörch auf. Sie musste zwar zu dem einen glatten Kopf größeren Mann hinaufschauen, der Einschüchterungsversuch schien aber dennoch zu wirken.
Der Zimmergörch gab auf. Er packte wortlos sein Manifest in die abgehalfterte Ledertasche, warf einen letzten verzweifelten Blick auf die mit verschränkten Armen dastehende Kommissarin, drehte sich um und eilte zur Bürotür, die er ohne weiteren Kommentar hinter sich schloss.
»Was war denn das?«, fragte Andrea Onello ihre Kollegin, die vor lauter Lachen fast ihren üppig gefüllten BH sprengte, konsterniert.
»Des war der Zimmergörch, und zwar in Höchstform. Des mit seim Klimagefasel hab ich ja schon gekannt, des kennt eichentlich jeder hier. Seit der vor a paar Monaten in Bamberch aufgedaucht is, schmarrt der so aan Schmarrn. Aber die Nummer mit den Killern, die deswegen hinter ihm her sind, war mir neu. Trotzdem sehr unterhaltsam, Reschbeggd, dass du des so lang mit dem auskalten hasd, Andrea.« Honeypenny nickte anerkennend.
Keine Klimaerwärmung, so ein Schwachsinn. Jeder, der so etwas behauptete, war nach Andrea Onellos Meinung vollkommen irre oder zu doof, die Klimatabellen der seriösen Wissenschaftler zu studieren. Zudem hatten sie doch gerade ein wirklich perfektes Argument direkt vor der Tür. Der wärmste April aller Zeiten osterte draußen fröhlich vor sich hin.
Aber Klimawandel hin oder her. Dass die kruden Theorien dieses Mannes der Grund für ein Mordkomplott sein sollten, war ja wohl das Dämlichste, was sie in ihrem ganzen Berufsleben bisher gehört hatte. Der arme Herr Schugg sollte besser einmal in seinem verkorksten Oberstübchen aufräumen – oder noch besser: aufräumen lassen. Wahrscheinlich würde es nur ein paar Stunden dauern, bis der arme Irre hier anrief, um die erste verdächtige Person zu melden. Sie täte gut daran, die gesamte Bamberger Polizei von diesen Wahnvorstellungen in Kenntnis zu setzen, damit die seine Anrufe besser nicht zu ernst nahmen.
Sie hatte sich gerade einen Stift mit Schreibblock zurechtgelegt, um eine handschriftliche Notiz für die Kollegen zu machen, als von draußen ein lautes Krachen zu hören war. Verdutzt schaute sie zu Honeypenny hinüber, dann rannten beide Frauen zum Fenster, um zu sehen, was da gerade unten auf der Straße geschehen war.
Frustriert und verärgert verließ Georg Schugg die Dienststelle der Bamberger Kriminalpolizei. Wieder einmal, wie so oft in den letzten Monaten, hatte ihm niemand zuhören wollen. Meist dauerte es nicht lange, bis sein Gesprächspartner, so er denn überhaupt einen fand, schleunigst das Weite suchte oder wie gerade eben das Gespräch rüde beendete. Man nahm ihn nicht ernst, egal wie engagiert er sein Anliegen auch vortrug.
Seit über einem halben Jahr war er nun schon in der Bamberger Innenstadt unterwegs, um seine Botschaft zu verkünden. Den ganzen Winter hatte er damit zugebracht, die Bamberger von seinem Manifest und der drohenden Gefahr, die am Horizont heraufdämmerte, zu überzeugen. Nicht einmal auf dem Bamberger Weihnachtsmarkt hatte er Unterstützer gefunden, dafür wurden ihm reihenweise Getränke jeglicher Art spendiert, denn schließlich wollte man so einen kauzigen Typen wie ihn ja gern unterstützen.
»Bassd scho, Alder, aber etzerd drink erscht amal was«, das hatte er dauernd zu hören bekommen. Und so endeten die Gespräche dann meistens auch. Inzwischen konnte er sich in der Bamberger Innenstadt nirgendwo mehr bewegen, ohne dass die Menschen bei seinem Anblick von einem spontanen Fluchtreflex ergriffen wurden.
In gewisser Weise hatte er sich daran gewöhnt, dass niemand seinen Erläuterungen folgen konnte oder wollte. Aber der Bamberger Polizei hätte er dann doch etwas mehr Sachverstand zugetraut. Vor allem jetzt, da es sich nicht mehr nur um eine globale Klimaverschwörung handelte, sondern sein Leben bedroht war. Das zumindest hätte diese Ignoranten doch alarmieren müssen.
Aber so war das eben, der kleine Mann war in diesem Staat vergessen und verloren. Wenn irgend so ein wichtiger Firmenboss mit einem ähnlichen Verdacht angetanzt wäre, hätte sich die Bamberger Dienststelle der Kriminalpolizei wahrscheinlich umgehend in einen hektischen Ameisenhaufen verwandelt. Aber nicht bei dem kleinen, verrückten Georg Schugg, dem Zimmergörch.
Die einzigen, die ihn halbwegs ernst nahmen, das waren die Leute von der AfD. Von denen fühlte er sich zumindest ansatzweise verstanden. Die teilten seine Meinung über diesen ganzen Klimawahnsinn und fanden sein Manifest im Grunde gut, auch wenn es von denen ebenfalls keiner lesen wollte. Aber das mochte eventuell daran liegen, dass die AfDler gar nicht alle lesen konnten, so sein leiser Verdacht.
Wie auch immer, für heute reichte es ihm. Fickt euch, Bamberger Polizei, so seine Stimmungslage. Sein Manifest unter den Arm geklemmt, eilte er mit zügigem Schritt über den Vorplatz. Würde er sich eben wieder in seine Baunacher Kellerwohnung zurückziehen und weiter an seinem Manifest feilen, ehe er erneut loszog. Das würde er genau so lange machen, bis ihm jemand Glauben schenkte.
Er schaute nach rechts und nach links, keine Fahrzeuge zu sehen, lediglich ein einzelnes Auto parkte gerade schräg gegenüber aus. Reichlich Zeit also, die Fahrbahnen zu überqueren und dann die nächste Bushaltestelle anzusteuern.
Er war gerade in der Mitte der Straße angelangt, als rechts von ihm ein Motor aufheulte und Reifen quietschten. Schugg fuhr herum und sah, wie der dunkelrote Wagen, der eben noch gemächlich ausgeparkt hatte, beschleunigte und auf ihn zuschoss. Für ein Ausweichen war es bereits zu spät, er schaffte es lediglich, aus dem Stand in die Höhe zu springen, sodass ihn der Wagen nicht mit der Stoßstange erwischte. Stattdessen prallte er auf die Windschutzscheibe. Das allerdings mit voller Wucht und so heftig, dass diese unter ihm zersplitterte. Er rollte über das Dach des Wagens und fiel, sein heiliges Manifest umklammernd, am hinteren Ende auf den Teer, wo er der Länge nach aufschlug und rücklings liegen blieb.
Mit weit aufgerissenem Mund schnappte er nach Luft, und das eine oder andere Sternchen tauchte vor seinen vernebelten Augen auf, während er hilflos beobachten musste, wie der dunkelrote Wagen, der ihn gerammt hatte, mit Vollgas über die nächste Kreuzung fuhr und verschwand. Dann legte er seinen Kopf auf den Asphalt und versuchte erst einmal zu begreifen, was da gerade eben passiert war.
Andrea Onello konnte gerade noch ein dunkelrotes Fahrzeug erkennen, das mit Höchstgeschwindigkeit davonfuhr, während sich ihr eben noch aufrecht gehender Gesprächspartner unten auf dem Teer wälzte. Dann rannte die Kommissarin auch schon aus dem Büro hinaus und die Treppe hinunter, um sich um den soeben Verunfallten zu kümmern.
Unten am Haupteingang standen ein paar neugierige Kollegen, die zwar mitbekommen hatten, dass draußen auf der Straße etwas passiert sein musste, aber nicht genau wussten, was. Andrea Onello schoss an ihnen vorbei, ohne den fragenden Blicken irgendwelche Aufmerksamkeit zu schenken, und eilte direkt zu dem immer noch auf der Straße liegenden Mann. Als sie bei Georg Schugg angekommen war, richtete der sich bereits stöhnend in eine sitzende Stellung auf und schaute ihr mit wütendem Blick entgegen.
»Ich habe doch gesagt, dass die mich umbringen wollen, verdammte Scheiße!«, rief er aufgebracht, während er sich mit der rechten Hand auf dem rauen Asphalt abzustützen versuchte. Das gelang nur leidlich, denn ihm schwirrte immer noch eine halbe Galaxie an Sternen im Kopf herum.
Andrea Onello ignorierte die wilde Behauptung und führte erst einmal eine gründliche Erstuntersuchung an dem Mann durch. Dessen ohnehin ziemlich abgerissenes Erscheinungsbild war nun endgültig den Bach runter. Die Jeans war an beiden Knien aufgerissen und blutig. Gleiches galt für seine linke Schulter. Auch dort war unter der auseinanderklaffenden braunen Cordjacke und dem zerfetzten karierten Hemd eine großflächige Hautabschürfung zu erkennen.
Gebrochen schien aber nichts zu sein, nur am Hinterkopf des armen Mannes wuchs eine veritable Beule in die Höhe. Wie es im Körperinneren aussah, konnte sie natürlich nicht sagen, dazu musste der Mann ins Krankenhaus.
Georg Schugg hatte entweder unverschämtes Glück gehabt, dass er nach einem solchen Zusammenprall jetzt nicht schwer verletzt vor ihr lag, oder er besaß eine unglaublich widerstandsfähige Physis. Wahrscheinlich wohl beides zusammen. »Bassd scho«, knurrte er und versuchte nun tatsächlich, sich unter heftigem Protest der Kommissarin auf die eigenen Beine zu stellen. Sekunden später stand er wacklig, aber dennoch aufrecht vor Andrea Onello. »Ich geh jetzt heim«, verkündete er mit selbstsicherer Stimme, während er die riesige Beule an seinem Hinterkopf befühlte.
Das war nun endgültig zu viel für die Bamberger Kommissarin, die sich für das ganze Desaster verantwortlich fühlte. Womöglich war sie doch ein wenig zu schroff mit dem Mann umgegangen. Nur so konnte sie sich erklären, warum er so unbedacht über die Straße gestürmt und dann von diesem Wagen erfasst worden war. Dass der Besitzer des Fahrzeugs eiskalt Fahrerflucht begangen hatte, stand auf einem anderen Blatt, darum sollte sich Marina kümmern. Sie musste jetzt erst einmal den abgeschürften Zimmergörch versorgen.
Andrea Onello hatte ihren Arm gerade stützend um die Hüften des muskulösen Schugg gelegt, als direkt neben ihnen ein Range Rover zum Stehen kam. Ihr dienstältester Kollege sprang heraus.
»Was ist denn hier passiert, um Himmels willen?«, fragte Franz Haderlein und blickte besorgt von Andrea zum blutenden Patienten und wieder zurück, aber seine Kollegin winkte ab.
»Franz, ich bring den Mann jetzt erst einmal zum Klinikum, dann sehen wir weiter. Wir haben es hier mit einem Fall von Fahrerflucht zu tun, Marina kann dir alles erklären.« Sie zeigte zum ersten Stock der Dienststelle hinauf, wo Honeypenny immer noch mit erschrockenem Gesicht am Fenster stand.
»Das war keine Fahrerflucht, das war ein Mordversuch, verdammte Scheiße!«, krächzte Georg Schugg, der sich nun doch an der Schulter der viel kleineren Kommissarin abstützte. Da erst erkannte Kriminalhauptkommissar Haderlein, welche Berühmtheit er hier vor sich hatte.
»Ach Gott, der Zimmergörch«, entfuhr es ihm überrascht. »Ja, dann bring den Mann mal zu einem Arzt, ich klär das oben mit Marina.« Auf gar keinen Fall wollte Haderlein in ein Gespräch mit diesem Irren verwickelt werden. Was auch immer gerade passiert war, es schien einigermaßen glimpflich ausgegangen zu sein.
Während Andrea sich mit dem humpelnden Schugg auf den Weg zu ihrem Suzuki machte, parkte Haderlein seinen Wagen und eilte nach oben ins Büro, um sich die Geschehnisse von Honeypenny erläutern zu lassen.
Die schaute ihm sowohl gespannt als auch besorgt entgegen. »Und, wie geht’s dem Zimmergörch?«, wollte sie wissen.
»Scheint nicht ganz so schlimm gewesen zu sein, Andrea fährt den armen Kerl aber trotzdem rasch ins Klinikum. Was ist denn eigentlich passiert, Marina? Ich habe gerade unten auf der Straße nur das blutige Ergebnis zu Gesicht bekommen.« Franz Haderleins fragender Blick legte sich auf Honeypenny, die sich sofort wasserfallartig äußerte.
»Also, das ist richtig dumm gelaufen. Eigentlich war heute überhaupt nichts los, richtig ruhig war’s, bis der Schugg hier aufgetaucht ist. Ich hab ihn zu Andrea geschickt, die hat den Seftl noch überhaupt nicht gekannt und sich die ganze Litanei von dem Irren angehört. Wobei er neben dem üblichen Schmarrn auch was von einem Mordkomplott gefaselt hat. Es will ihm angeblich jemand ans Leder wegen seinem komischen Manifest, das er schon den ganzen Winter durch die Stadt schleppt«
»Mordkomplott?« Haderleins Gesicht verzog sich zu einer gequälten Fratze. »Jesus Maria. Was fällt dem Verrückten denn noch alles ein? Du lieber Himmel. Lass mich raten, Marina. Irgendwann hat’s Andrea gereicht, und sie hat ihn in ihrer unnachahmlichen Freundlichkeit rausgeschmissen, richtig?« Das Lächeln war auf Haderleins Gesicht zurückgekehrt, und auch Honeypenny schaute nun wieder einigermaßen belustigt aus der Wäsche.
»Richtig«, entgegnete sie zufrieden. »Er hat’s auch sofort begriffen und ist wutentbrannt zur Tür raus. Unten ist er dann, anscheinend ohne zu schauen, über die Straße, und da hat’s ihn halt erwischt. Statt anzuhalten, ist der Autofahrer getürmt. Klassische Fahrerflucht, möchte ich einmal sagen. Das Kennzeichen konnte ich nicht erkennen, er war schon zu weit weg. Es würde mich aber nicht wundern, wenn sich herausstellt, dass da wieder ein Haßfurter unterwegs war.«
Haderlein nickte, dann griff er, ohne lange zu überlegen, zum Telefonhörer und wählte eine hausinterne Nummer. Wozu hatte die Bamberger Polizei haufenweise Kameras an diesem Gebäude installiert? Da müsste es doch mit dem Teufel zugehen, wenn nicht irgendeine davon das Nummernschild des Fahrerflüchtigen aufgezeichnet hätte.
Andrea Onello war zwar von mitfühlender und durchaus hilfsbereiter Natur, andererseits aber auch unglaublich penibel. In ihrem Leben hatte alles seinen Platz. Und Schmutz jeglicher Art bekam bei ihr kein Asyl. So hatte sie es immer gehalten, bei sich selbst und bei ihren inzwischen erwachsenen Kindern. Ordnung war das halbe Leben, Sauberkeit die andere Hälfte. Also hatte sie eine alte Decke aus dem Kofferraum geholt und über den Beifahrersitz ihres kleinen weißen Suzuki gelegt, nicht dass der aufgeschürfte Mann ihr womöglich den Sitzbezug versaute. Mit zusammengebissenen Zähnen und weitestgehend wortlos hatte sich Georg Schugg darauf niedergelassen und harrte nun der Dinge, die da kommen sollten. Das Adrenalin verließ ganz allmählich seinen Körper, und Schmerzen machten sich breit. Schmerzen, die seinen gesamten Körper durchzogen und sich minütlich intensivierten.
Andrea Onello bemerkte, dass ihr Patient entgegen seiner Gewohnheit still geworden war, während sich eine zunehmende Blässe auf seinem Gesicht ausbreitete. Besorgt knallte sie die Beifahrertür zu und warf sich auf den Fahrersitz. Hoffentlich hatte Georg Schugg sich nicht doch innere Verletzungen zugezogen, die von außen nicht zu erkennen waren. Sie war sich auf einmal nicht mehr sicher, ob dieser Zimmergörch, so robust er auch schien, wirklich so glimpflich davongekommen war. Vielmehr befürchtete sie, dass die Lebensuhr ihres erbleichenden Unfallopfers immer schneller tickte.
Georg Schugg krümmte sich während der Fahrt mehr und mehr auf dem Beifahrersitz zusammen. Die Schmerzen, vor allem in der linken Körperhälfte, wurden immer stärker. Entweder waren das ganz brutale Prellungen, die sich nun vehement bemerkbar machten, oder aber er hatte sich doch eine größere Verletzung zugezogen. Aber egal wie stark die Schmerzen auch sein mochten, niemals würde er es zulassen, dass ihm deswegen die Fassung verloren ging. Er war ein selbst ernannter harter Hund, ein richtiger Mann, den niemand jemals jammern sah. Bevor er solche Weichheiten in seinem Leben zuließe, wollte er lieber tot im Graben liegen.
Draußen vor dem Fenster rauschte die Bamberger Häuserwelt vorbei. So richtig nahm er sie aber gar nicht wahr, da er sich während der Fahrt mit seinem Leben der vergangenen sechs Monate beschäftigte und mit seinen erfolglosen Versuchen, die Menschheit von der Dringlichkeit seiner Anliegen zu überzeugen.
Warum tat er das alles eigentlich? Er hatte eine kleine, bescheidene Unterkunft in Baunach, die ihm ein wohlmeinender Gönner gewährte. Eine Aushilfsarbeit bei einer Grabungsfirma sicherte ihm seit dem Sommer des vergangenen Jahres ein bescheidenes, jedoch ausreichendes Einkommen. Er könnte zufrieden sein. Aber nein, irgendetwas in ihm folgte einem Programm, konnte nicht von diesem unwiderstehlichen Auftrag lassen, der Welt die Erkenntnisse und Schlüsse seines Manifestes mitzuteilen. Die ganze Klimadebatte war seines Erachtens nichts als ein ferngesteuertes Komplott bestimmter Mächte auf diesem Planeten. Und jetzt wusste er, dass er damit tatsächlich recht hatte, denn sie hatten gerade versucht, ihn umzubringen. Vielleicht glaubte ihm diese Kommissarin ja nun endlich.
Doch ehe er feststellen konnte, ob dem so war, verflogen diese Gedanken wieder, und Georg Schugg musste erneut ein Stöhnen unterdrücken. Ein endlos stechender Schmerz durchfuhr seine linke Körperhälfte.
Andrea Onello hatte Glück und ergatterte auf dem Besucherparkplatz einen der raren freien Parkplätze. Sie ging um das Auto herum und öffnete die Beifahrertür, hinter der sie ein zusammengekrümmtes Häufchen Elend vorfand.
Als sie Georg Schugg aus dem Wagen helfen wollte, schob dieser ihre Hand brüsk beiseite und quälte sich mit aufgerissenen Augen, jedoch ohne einen Muckser aus seinem Sitz. Den Blick starr und verbissen, das Gesicht weiß wie eine frisch gekalkte Wand, stand er gleich darauf vor ihr. Seine rechte Hand legte er auf die Schulter der Kommissarin, während die linke immer noch sein Allerheiligstes, das inzwischen blutverschmierte Manifest, umklammerte.
»Gehn wir«, presste er zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor und machte die ersten unbeholfenen Schritte, augenscheinlich unter massiven Schmerzen.
Andrea Onello sah sofort, dass sie auf diese Art und Weise niemals an ihrem Ziel ankommen würden, und legte erneut ihren Arm um die Hüfte des Mannes. So gestützt, schafften sie es, einen gemeinsamen Gang zu entwickeln, mit dem sie nach einer gefühlten Ewigkeit die Ambulanz im Untergeschoss des Bamberger Klinikums erreichten. Dort setzte sie Georg Schugg auf einen der letzten freien Stühle im Wartebereich. Neben ihm reihten sich verbundene Hände an blutende Nasenbeinbrüche, zwischen denen sich eine Frau mit schmerzverzerrtem Gesicht den Unterleib hielt, gefolgt von Platzwunden und fiebrigen Gesichtern kleiner Kinder. Die Variationsmöglichkeiten gingen dabei gegen unendlich.
Andrea Onello schaute sich die lange Schlange der Wartenden an, dann Georg Schugg, der sich zwar tapfer auf seinem Stuhl hielt, dessen Blick aber bereits anfing, leicht glasig zu werden. Das war eine absolut unbefriedigende Gesamtsituation, und Andrea Onello hasste selbige abgrundtief. Bei ihr musste es schnell gehen. Analysieren, Plan festlegen und dann zack, zack.
Ihre jetzige Analyse lautete Verkehrsunfall, Verdacht auf innere Blutungen, ergo potenzielle Lebensgefahr. Hier waren Eile, Konsequenz und Durchsetzungsvermögen gefragt. Sie warf einen letzten Blick auf den zusammengekrümmt dasitzenden Schugg, dann schritt sie zu der halbrunden Empfangstheke, hinter der zwei Schwestern geschäftig in ihren Unterlagen blätterten. Die größere der beiden, mit langen dunklen Haaren, die sie zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden hatte, sprach sie an.
»Hallo«, gab Andrea Onello laut und vernehmlich von sich, was die Schwester hinter der Theke – dem kleinen weißen Namensschild an ihrem Kittel zufolge war sie mit »Schwester Doreen Rensch« anzusprechen – erst einmal nicht zu registrieren schien. Sie schaute nicht von ihren wichtigen Unterlagen auf.
»Name?«, wollte die Schwester wissen, während sie weiter in ihrem Krankenbericht blätterte.
»Georg Schugg … also, soweit ich weiß«, antwortete die Kommissarin pflichtgemäß. »Hören Sie, dem Mann geht es wirklich schlecht. Er ist das Opfer eines Verkehrsunfalls, und womöglich hat er innere Blutungen. Vielleicht sollten wir die Formalitäten –« Weiter kam sie nicht.
»Ihre Versichertenkarte bitte«, warf die Brünette lakonisch dazwischen, und eine ausgestreckte Hand erschien vor Andrea Onellos Nase.
Die Kommissarin war dermaßen verblüfft, dass ihr einen Moment lang nichts einfiel – was in ihrem Leben bisher nur einmal vorgekommen war, nämlich als Professor Siebenstädter ihr in der Erlanger Rechtsmedizin den Heiratsantrag gemacht hatte. Aber der sprachliche Blackout währte nur wenige Sekunden, dann hatte sie sich wieder gefangen.
»Ähm, wir haben keine Versichertenkarte, gute Frau, ich habe den Mann von der Straße aufgelesen, weil er einen Autounfall hatte, ich kenne ihn im Grunde gar nicht. Und es ist jetzt wirklich keine Zeit mehr für so einen Quatsch, der Mann braucht dringend einen Arzt«, entgegnete sie in gemäßigter Lautstärke, aber durchaus strengem Tonfall.
Immer noch hob die Schwester nicht ihren Blick; lediglich ihr Arm bewegte sich zur Seite, und die flache Hand verwandelte sich in einen ausgestreckten Zeigefinger. »Dann setzen Sie sich bitte dort in den Wartebereich, Sie werden aufgerufen«, verkündete sie, und der Zeigefinger machte dazu unmissverständliche Bewegungen.
Andrea Onello war kurz davor, zu platzen, dann erinnerte sie sich ihrer beruflichen Herkunft sowie staatlich verliehenen Machtfülle und zückte ihren Ausweis. Den hielt sie über die Theke in Schwester Doreens Sichtfeld. »Kriminalpolizei Bamberg. Ich möchte jetzt sofort einen Arzt sprechen.«
Die Ansage wurde zwar gehört, zeigte aber nicht die gewünschte Wirkung. Immerhin hob die Schwester endlich den Kopf, und zwei dunkelbraune Augen schauten die Kommissarin durch eine schwarze Metallbrille hindurch streng an.
»Es ist mir völlig egal, wer Sie sind. Das hier ist die Ambulanz des Klinikums Bamberg und nicht der Ebracher Knast. Wenn Ihnen nicht passt, wie die Dinge hier laufen, wenn Sie partout nicht warten können, warum fahren Sie dann nicht nach Scheßlitz ins Krankenhaus? Dort können Sie gern mit Ihrem Ausweis herumfuchteln, um schneller an der Reihe zu sein. Die sind dort dankbar für jeden, der kommt«, fauchte sie bissig.
Womöglich wäre der Konflikt zwischen den beiden sehr unterschiedlichen Pferdeschwanzträgerinnen eskaliert, wenn nicht in diesem Moment ein kollektiver Aufschrei im Wartebereich laut geworden wäre. Als Andrea Onello sich umdrehte, sah sie zu ihrem größten Entsetzen, dass der Zimmergörch von seinem Stuhl gekippt war und nun, von vielen entsetzten Blicken beobachtet, bewusstlos auf dem Gang der Ambulanz lag.
Franz Haderlein betrachtete die Aufnahmen der Videokamera zum wiederholten Mal, das Ergebnis war jedoch immer dasselbe. Er konnte das Kennzeichen an dem dunkelroten Fahrzeug nicht wirklich gut ausmachen. Zwei der Kameras, die am Gebäude der Bamberger Polizei angebracht waren, hatten den Audi älteren Baujahres zwar erfasst, aber mit bloßem Auge kam er da nicht weiter.
Nicht viel besser sah es mit dem Fahrer aus. Da waren schemenhaft ein Gesicht und eine Sonnenbrille zwischen dem Kragen und einer weit heruntergezogenen Mütze zu erkennen. Aber selbst in der höchsten Auflösung war der undeutliche Matsch zu nichts zu gebrauchen, schon gar nicht zu einer ordentlichen Fahndung.
Es half alles nichts, er musste die Angelegenheit wieder an die Technikabteilung zurückverweisen. Vielleicht hatten die ja die entsprechenden Mittel, um einen bildtechnischen Erfolg zu produzieren. Sofern sich überhaupt noch etwas Lesbares aus dem verpixelten Material herauszaubern ließ.
Als er nach dem Telefonat den Hörer wieder auf den Apparat zurücklegte, ging die Tür auf, und der Kollege Huppendorfer erschien. Anscheinend war seine Fortbildung früher als geplant zu Ende gewesen, denn eigentlich hatte César erst am späten Nachmittag zurück sein sollen. Haderlein warf ihm einen fragenden Blick zu, den der dunkelhäutige Kollege zuerst mit einem schiefen Lächeln, dann mit einer Erklärung quittierte.
»Die Seminarleiterin ist nicht gekommen, ihr Zug ist auf freier Strecke liegen geblieben. Als klar war, dass die Frau nicht mehr auftauchen wird, sind wir halt alle wieder gefahren. Wirklich schade. Außer Spesen nichts gewesen. Muss ich die Exkursion in die Geheimnisse moderner Verhörtechniken eben ein anderes Mal verfolgen. Das geht allerdings erst wieder in einem halben Jahr, vorher hat Frau Semenova keine Zeit. Schade …« Er zuckte ehrlich enttäuscht mit den Schultern und begab sich auf seinen Platz.
Franz Haderlein und Honeypenny wechselten amüsiert einen wissenden Blick. Alles klar, daher wehte der Wind. Frau Semenova hatte keine Zeit. Darum ging’s also, nicht um das ach so wichtige Seminar. Schmunzelnd wandte sich Haderlein wieder seinen Aufgaben zu.
Kriminalkommissar César Huppendorfer für seinen Teil wusste jetzt gar nicht so richtig, was er tun sollte. Die Enttäuschung über die Nichtankunft der Seminarleiterin musste er erst einmal verdauen. Und arbeitstechnisch war er heute ja gar nicht eingeplant, aber einfach nach Hause gehen machte auch keinen korrekten Eindruck, schließlich war es noch früh und zudem immer noch Arbeitszeit, ausgefallenes Seminar hin oder her. Er würde sich daher erst einmal auf seinen Stuhl setzen, den ganzen Weiterbildungsreinfall eine Weile sacken lassen und überlegen, was mit dem restlichen Tag so alles anzufangen war.
Honeypenny war inzwischen auch wieder in ihrer eigenen Dienststellenwelt, sodass der anfangs friedliche Tag wieder in seine gemütliche Ausgangslage hätte zurückfinden können. Es blieb aber beim Konjunktiv, denn kaum dass César Huppendorfer seinen eleganten Sommermantel verräumt und sich auf seinem Stuhl niedergelassen hatte, öffnete sich die Tür des gläsernen Verschlages, in dem der Chef der Dienststelle residierte, und Robert Suckfüll betrat die Bühne.
Als er seinen ältesten Mitarbeiter erblickte, wollte er schon hocherfreut zu dessen Platz eilen, um zu erfahren, was für Neuigkeiten es hinsichtlich Riemenschneiders ländlichem Zuhause gab. Er war heilfroh, dass diese lästige Schweineplage in der Ausnüchterungszelle im unteren Stockwerk beseitigt war, und würde einen Teufel tun, seinen Mitarbeitern zu erlauben, das Dienststellenferkel und ihre Abkömmlinge erneut zurückzuholen, sollte es mit dem armen Landwirt, der die stinkende Bande aufgenommen hatte, Probleme geben. Fidibus machte drei eilige Schritte auf Franz Haderlein zu, bemerkte dann jedoch aus dem Augenwinkel seinen Untergebenen Huppendorfer, der sich auf seinem Bürostuhl rekelte.
Nanu? Was sollte das denn? War sein junger Mitarbeiter denn nicht auf dem Seminar, zu dem er unbedingt gewollt und um das er so lange mit ihm gerungen hatte? In Robert Suckfülls Gehirn kam es zu einer spontanen Kollision der anzunehmenden, jedoch fiktiven Realität, Weiterbildung genannt, mit dem tatsächlich existierenden Kosmos in seinem Büro. Ein dynamisches System tat sich auf und führte gemäß der allgemeinen Chaostheorie zu einem nicht vorhersagbaren Verhalten in Person von César Huppendorfer.
Hier passte etwas ganz und gar nicht zusammen. Hinzu kam, dass Robert Suckfüll nach dem gestrigen Abendessen mit seiner Gattin wirklich schlecht geschlafen hatte und nun völlig übermüdet war. Solch ungeplantes Unausgeschlafensein belastete den Dienststellenleiter der Bamberger Kriminalpolizei mehr als alles andere und brachte seine ohnehin instabile Psyche noch mehr ins Ungleichgewicht. Trotzdem musste er über seine körperlichen und geistigen Defizite hinwegsehen, sich zusammenreißen und für Ordnung und Disziplin in seiner Dienststelle sorgen. Wenn er etwas nicht dulden konnte und wollte, dann war das Chaos.
Mit dunklen Rändern unter den Augen, entschlossenem Auftreten und leichter Grimmigkeit im Blick baute er sich vor der Systemresonanz Huppendorfer auf und deutete mit einer seiner nicht angezündeten Zigarren auf den ungeplant anwesenden Mitarbeiter. »Ja, mein lieber César, was muss ich da sehen, Sie hier in unserer Dienststelle? Da bin ich jetzt aber verwirrt und erstaunt. Ich dachte, Sie werden gerade fortgebildet, noch dazu auf eigenen Wunsch?« Streng schaute er Huppendorfer an, dem die Enttäuschung immer noch in den Knochen steckte.
»Ja, ich weiß, Chef, aber die Fortbildung fiel aus, weil der Zug der Seminarleiterin auf freier Strecke zwischen München und Nürnberg liegen geblieben ist. Was soll man da machen. Das hol ich alles in einem halben Jahr nach, versprochen.«
Sein Chef hatte allerdings nur zur Hälfte hingehört, da seine Gedanken parallel dazu um die Schweinefrage kreisten. Und da er alles andere als multitaskingfähig war, gerieten seine Synapsen etwas aus dem Takt.
»Wie bitte, Sie sind mit einer Frau im Zug liegen geblieben? Na, Sie sind mir ja vielleicht so ein Einzelfall, mein lieber Huppendorfer. Ich dachte, das in Nürnberg sei eine fachliche Fortbildung und kein faulenzendes Kuschelevent. Ja, habe ich denn nur unverlässige Leute hier?« Missmutige Falten der waagrechten Art gruben sich in Robert Suckfülls Stirn, derweil die nicht angezündete Zigarre hektisch zwischen seinen Fingern zu rotieren begann. Ein untrügliches Zeichen, dass ihrer aller Chef etwas erregt war.
Huppendorfer rieb sich angestrengt die Augen, ehe er es noch einmal probierte. »Das Wort heißt ›unzuverlässig‹, Chef. Davon abgesehen, Chef, nein, da haben Sie sich verhört, ich war nicht in dem Zug. Ich war mit meinem Privat-Pkw in Nürnberg, saß pünktlich im Seminarraum und habe wie alle anderen auf die Seminarleitung gewartet. Als klar war, dass die Frau nicht kommt, sind wir alle wieder heimgefahren. Und ich bin ja jetzt hier, nicht wahr? Ich hätte mich auch daheim mit irgendeiner Frau in mein Bett legen und genüsslich vor mich hin träumen oder noch schönere Dinge mit ihr veranstalten können, da haben Sie recht«, giftete César Huppendorfer, dessen Geduldsfaden nach dem ausgefallenen Seminar merklich dünn geworden war. »Mach ich aber nicht, Chef. Ich halte mich an die eiserne Regel, keine Erotik während der Arbeitszeit. Daher bin ich brav an meinen Arbeitsplatz zurückgekehrt, zumal ich den wirklich sehnlichst vermisst habe. Geben Sie mir also bitte eine Aufgabe, und ich arbeite, gar kein Problem, Chef«, fauchte er und fixierte bockig seinen Dienststellenleiter.
Fidibus fixierte zurück, unsicher, wie er mit dieser verworrenen Situation weiter verfahren sollte. Da sein Geist sich bei Überlastung gern zu spontanen Wendungen hinreißen ließ, versuchte er, seinem jungen Mitarbeiter die Welt zu erklären. Seine Gesichtszüge entspannten sich, und sein Blick nahm fast väterliche Züge an. »Ach, mein lieber César, ich verstehe Sie ja, ich war ja auch einmal jung. Tut mir leid, es war nicht so gemeint. Da sitzen Sie jetzt wie eine gerupfte Kuh und sind frustriert. Aber lassen Sie den Kopf nicht hängen wie eine Fledermaus, das Leben geht weiter. Dann werden wir wohl eine Arbeit für den heutigen Tag für Sie finden müssen, das kann ja nicht so schwer sein«, sprach Fidibus und nickte Huppendorfer aufmunternd zu.
Franz Haderlein und Honeypenny saßen der Unterhaltung lauschend an ihren Tischen und mussten wirklich an sich halten, um bei dem zerstreuten Geschwafel ihres Chefs nicht in lautes Gelächter auszubrechen. César Huppendorfer schüttelte nur ratlos den Kopf, während Fidibus gedankenverloren seine Zigarre betrachtete.
Eine Sache wollte der dunkelhäutige Kriminalkommissar aber noch geklärt haben. »Fledermaus, wieso Fledermaus?«, fragte er nach und hoffte auf eine logische Antwort, obwohl er es eigentlich besser hätte wissen müssen.
»Na, Sie kennen doch wohl Fledermäuse, mein lieber César?« Fidibus hob erstaunt die Augenbrauen. »Das sind diese kleinen Saurier, die nachts durch die Gegend flattern«, faselte er, während er immer schneller an seiner Zigarre drehte.
»Saurier, aha«, echote Huppendorfer perplex und warf seinem Chef einen besorgten Blick zu. Aber der hatte keine Zweifel über nichts und versuchte, es seinem unwissenden Untergebenen zu erklären.
»Ja, natürlich. Die Saurier sind ja früher auch geflogen. Aber jetzt lassen wir das einmal, das war ja nur ein Beispiel, fast ein Vergleich. Und diese Fledermaussaurier stehen ja sowieso unter Denkmalschutz – also weg damit, das ist mir allmählich zu anstrengend.« Mit leicht geröteten, übermüdeten Augen lauschte er gedankenverloren seinen Worten hinterher, während César Huppendorfer, der seinen zerstreuten Chef nun auch schon ein paar Jahre kannte, langsam Zweifel an dessen psychischer Gesundheit bekam. Was redete der da bloß, zum Kuckuck?
»Chef, geht’s Ihnen gut?«, wollte Huppendorfer wissen, und auch an den Nebentischen warf man inzwischen zweifelnde Blicke in Richtung des Dienststellenleiters. Besonders Honeypenny, die ihren Chef so auch noch nicht erlebt hatte, wunderte sich. Er sah wirklich nicht gut aus und faselte noch verwirrter daher als üblich. Da stimmte was nicht.
»Chef, Sie sehen scheiße aus. Haben Sie Probleme irgendwelcher Art? Oder haben Sie nur schlecht geschlafen?«, erkundigte sich Honeypenny forsch. Sie war aufgestanden und kam mit besorgtem Blick auf Robert Suckfüll zu. Der wartete, bis seine langjährige Dienststellensekretärin direkt vor ihm stand und prüfend ihre Hand auf seine Stirn legte. Na gut, Fieber hatte ihr Chef anscheinend nicht, er sah nur einfach völlig fertig aus. »Vielleicht haben Sie etwas Falsches gegessen? Könnte doch sein«, riet Marina Hoffmann weiter. »Womöglich haben Sie eine Vergiftung, Salmonellen oder Ähnliches.«
Das schien das Stichwort gewesen zu sein, das ihren Chef aus seiner Lethargie herausholte. Seine Augen leuchteten auf, und er legte seine freie linke Hand auf die Schulter seiner Sekretärin. »Ja, in der Tat, ich glaube, da haben Sie recht, Frau Hoffmann, das wird’s gewesen sein, wenn ich so drüber nachdenke, das Essen, das Essen«, erregte sich Fidibus, während sich die ersten Schweißperlen auf seiner Stirn bildeten. »Meine Frau hat gestern seit langer Zeit wieder einmal gekocht. So einen Vielfüßler, einen Tintenfisch, so einen … Eukalyptus –«
»Oktopus«, verbesserte ihn Honeypenny und verdrehte bereits wieder leicht genervt die Augen.
»Ja genau, so einer. Aber der hat geschmeckt wie Pirelli, und man konnte ihn nicht kauen. Ich glaube, dieser Fisch war nicht mehr ganz frisch, etwas überzeitig. Ogu, verstehen Sie? Aber wenn die Frau schon einmal kocht, hat man Eisen wie Stahl, Frau Hoffmann, da gibt man nicht so einfach auf, das könnte Ärger geben. Also rein damit«, stieß Suckfüll hervor, und seine Finger krampften sich um ihre Schulter. »Na ja, und dann bin ich wie immer um die gleiche Zeit in unser Bettgemach, aber ich konnte nicht wirklich schlafen. Es rumorte gewaltig in der Verdauung, der Eukalyptus wollte mir anscheinend noch etwas sagen.«
»Ach, der erzählte noch was?«, stellte Honeypenny beiläufig fest, während sie mit Nachdruck die verschwitzte Hand ihres Chefs von ihrer Schulter entfernte.
»Ja, allerdings, die Mahlzeit blieb wohl weitestgehend unverdaut und schlich sich dann in meine Träume, um mich dort zu belästigen und zu verwirren …«
Hilfesuchend schweifte Honeypennys Blick durch das Büro, aber keiner der beiden männlichen Kollegen machte Anstalten, sich einzumischen. Sowohl Huppendorfer als auch Haderlein rangen tapfer um Fassung.
»Träume? Ja, was haben Sie denn geträumt?«, rutschte es Honeypenny heraus, eine Frage, die sie direkt wieder bereute, als sie in die gequälten Augen ihres Chefs blickte. Der platzierte seine verschwitzte Hand erneut auf ihrer Schulter, bevor er ihr vertrauensvoll antwortete.
»Frau Hoffmann, das wollen Sie nicht wirklich wissen, nicht wirklich«, erklärte er mit dumpfer Stimme und hob mahnend seine sich in Auflösung befindliche Trockenzigarre in die Höhe.
»Ja, nun erzählen Sie schon, Chef, was waren denn das für schreckliche Träume?«, rief Huppendorfer breit grinsend, was ihm einen vernichtenden Blick von Honeypenny eintrug. Aber es war zu spät. Die Büchse der Pandora war geöffnet.
»Nun, meine liebe Frau Hoffmann, ich träumte zuerst von kleinen gelben, würfelförmigen Chinesen, mit denen man billigen Einmalsex haben kann. Klein, schwarz-gelb und im Sechserpack, beim Aldi im Angebot in einer Ökoverpackung. Ich denke, Frau Hoffmann, Sie kennen diesen Einkaufsmarkt, meine Frau geht dort immer hin. Diese Würfelchinesen sahen aus wie quadratische Miniatur-Innenverteidiger von Borussia Dortmund. Sie wissen schon, diese Fußballmannschaft. Nur eben in Würfelform. Und sie taten das, was im Bett getan werden muss. Danach starben die Einmalsexchinesen sofort ab. Das alles für neunundvierzig Euro neunzig. Ein Scheiß-Kosten-Nutzen-Verhältnis, das kann ich Ihnen sagen, Frau Hoffmann.«
Honeypenny blickte ihren Chef fassungslos an. Der war ja vollkommen durchgedreht. Huppendorfer lag mit dem Oberkörper auf seinen Bürotisch, den Kopf in den Armen vergraben. Als Honeypenny genauer hinschaute, sah sie, dass der ganze Oberkörper zuckte.
Fidibus kam nun erst so richtig in Fahrt. Endlich konnte er sich ob seiner nächtlichen Abenteuer jemandem mitteilen. »Und dann kam der zweite Traum. Der war noch viel schlimmer. Ich wurde nämlich Zeuge eines einfach unglaublichen Verbrechens.«
»Ist es wahr?«, erwiderte Marina Hoffmann halb rhetorisch, nicht mehr so genau wissend, was sie mit ihrem Chef anfangen sollte. Das war ihr jetzt echt eine Nummer zu irre. Aber das durch Übermüdung generierte Adrenalin flutete Robert Suckfülls Körper, und er war nun durch nichts mehr zu stoppen. Es musste alles raus, die Psychohygiene verhalf sich brachial zu ihrem Recht.
»Ich war auf der Zuschauertribüne des neuen Berliner Flughafens –«, begann Fidibus seine Traumerzählung, wurde jedoch von Franz Haderlein unterbrochen.
»Aha, Science-Fiction. Sie haben einen Science-Fiction-Roman geträumt«, rief er prustend und konnte vor Lachen fast nicht mehr an sich halten. Robert Suckfüll warf ihm einen kurzen, vergeistigten Blick zu, fuhr aber dann umgehend mit seinen Träumereien fort.
»Ja, auf dem neuen Berliner Flughafen, Sie werden es nicht glauben, mein lieber Haderlein. Denn ER war im Anflug. Unsere Kanzlerin, Frau Angela Merkel, stand am Fuße des roten Teppichs und wartete auf seine Ankunft. Eine Premiere in jeder Hinsicht. Die Präsidentenmaschine würde das erste Flugzeug überhaupt sein, das seine Räder auf die Rollbahn dieses so lange errichteten Airports setzte. Die Arbeiten waren auf Anweisung des Bundeskanzleramtes dahingehend angepasst und hinausgezögert worden, dass die Eröffnung des Berliner Hauptstadtflughafens mit der Ankunft des amerikanischen Präsidenten zusammenfiel.«
Stolz hob Fidibus seine Zigarre. Stolz darauf, dass er sich erstens noch so genau erinnern konnte und zweitens der amerikanische Präsident höchstselbst in seinem Traum erschienen war.
»Donald Trump? Ein Alptraum. Sie hatten einen bösen Alptraum, Chef!«, rief Huppendorfer mit vor Lachen tränenüberströmtem Gesicht. Fidibus beachtete ihn nicht weiter, sondern fuhr unbeeindruckt mit seiner Geschichte fort.
»Der amerikanische Präsident Donald Trump würde jetzt, nach über zwei Jahren im Amt, tatsächlich nach Deutschland kommen. Bis dahin hatte er wirklich alles getan, um es sich mit der Kanzlerin zu verscherzen. Und trotzdem stand Frau Merkel in stoischer Ruhe da.«
Robert Suckfüll blickte vielsagend um sich, doch diesmal unterbrach ihn niemand. Sein kleines, aber feines Auditorium wollte nun wissen, wie die präsidiale Geschichte ausging, und Fidibus tat ihnen den Gefallen.
»Ich sah, wie die vielzähligen Reifen der Air Force One quietschend auf der Landebahn des nagelneuen Berliner Flughafens aufsetzten. Aber dann, nach nur wenigen Metern, geschah es. Man konnte ein Knirschen, Knacken und Kreischen hören, als sich Betonplatten nach unten in die Erde neigten und dann steil aufstellten. Die Präsidentenmaschine kippte vornüber in ein riesiges Loch und überschlug sich im freien Fall, ehe das gesamte Flugzeug am Boden des Kraters aufschlug und in einem riesigen Feuerball explodierte. Die Betondecke der Landebahn war einfach eingebrochen, sie hatte dem Gewicht der Maschine nachgeben müssen. Der amerikanische Präsident war mit einem großen Knall von uns gegangen. Ein glühender Show-Patriot sozusagen.« Mit diesen Worten beendete Fidibus die Schilderung seines Traumes, ehrlich ergriffen, das Bild von Donald Trumps Niedergang in so treffende und schöne Worte gefasst zu haben.
Spontaner Applaus war zu hören, auch César Huppendorfer hatte sich wieder gefangen und klatschte begeistert Beifall. »Bravo. Einfach phantastisch«, meinte er glucksend. »Aber, Chef. Das mit der eingebrochenen Landebahn, das ist doch nicht das Verbrechen, von dem Sie sprachen. Das war ein blöder Unfall, oder nicht?«
»Nein, mein lieber Huppendorfer, eben nicht. Das ist es ja, was mich so deprimiert. Die Betondecke der Landebahn ist nicht einfach so zusammengebrochen. Nein. Jetzt kommt’s. Das war ein abgekartetes Spiel. Es ist schon vorher klar gewesen, was passieren würde. Denn was da passiert ist, war Physik. Und damit kennt sich Angela Merkel ja aus. Unsere Kanzlerin, ein Sinnbild von Heimtücke und Mordlust. Tja, wer hätte das gedacht?« Robert Suckfülls beifallheischender Blick irrlichterte durch den Raum, ohne jedoch einen ihm beipflichtenden Kollegen zu finden.
Das war’s, Honeypenny riss der Geduldsfaden. Das war ja total irre. Ihr Chef musste schnellstens nach Hause ins Bett.
»Schluss jetzt!«, rief sie laut, während Robert Suckfülls Zigarre vollends den Geist aufgab und zerkrümelt auf den Dienststellenboden fiel. »Ich werde Ihre Frau anrufen, Chef, die soll Sie hier abholen. Sie sind ja kurz vor der Klapsmühle. Und keine Widerrede, im Moment ist ohnehin nichts los.«