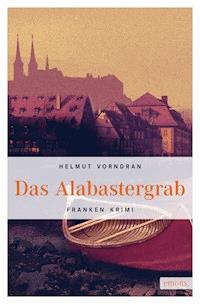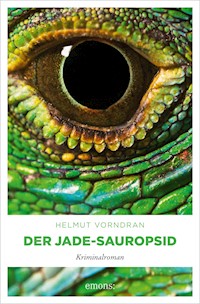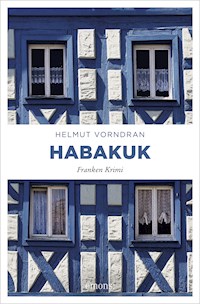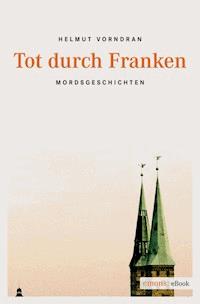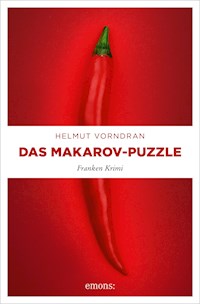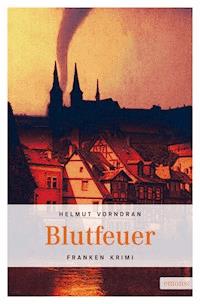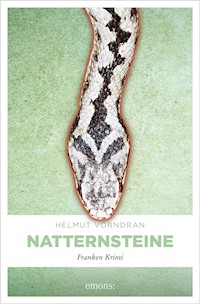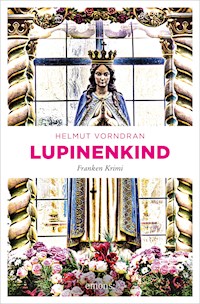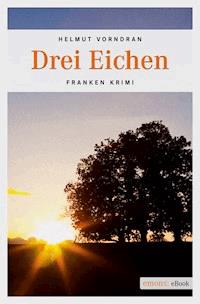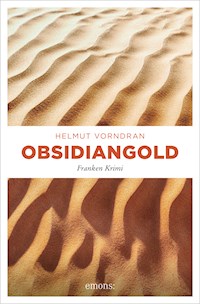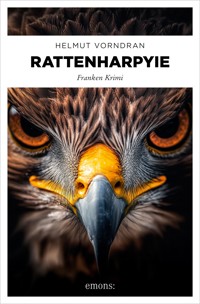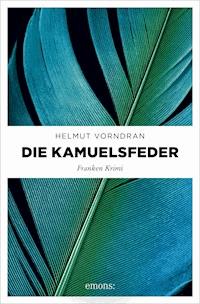
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Kommissar Haderlein
- Sprache: Deutsch
Im Rattenreich des Todes. Die Frau eines fränkischen Milliardärs ertrinkt im Mittelmeer. Ein Jahr später werden erst in einem idyllischen Fischerort in Italien, dann auch in Deutschland mehrere Menschen mit Messerstichen regelrecht hingerichtet. Für die Polizei in beiden Ländern beginnt eine fieberhafte Suche nach der Lösung dieses unheimlichen Rätsels. Mittendrin die Kommissare Haderlein, Lagerfeld und natürlich auch Ermittlerschweinchen Riemenschneider, die mit immer neuen Morden und schmerzlichen Prüfungen fertigwerden muss.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 548
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Helmut Vorndran, geboren 1961 in Bad Neustadt/Saale, lebt mehrere Leben: als Kabarettist, Unternehmer und Buchautor. Als überzeugter Franke hat er seinen Lebensmittelpunkt ins oberfränkische Bamberger Land verlegt und arbeitet als freier Autor unter anderem für Antenne Bayern und das Bayerische Fernsehen.www.helmutvorndran.de
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
Lust auf mehr? Laden Sie sich die »LChoice«-App runter, scannen Sie den QR-Code und bestellen Sie weitere Bücher direkt in Ihrer Buchhandlung.
©2018 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: shutterstock.com/1933bkk Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer Umsetzung: Tobias Doetsch Lektorat: Marit Obsen eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-96041-388-2 Franken Krimi Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de
Jegliches in dieser Welt
bedarf des Gleichgewichts.
Tue Gutes– und du wirst
Gutes empfangen.
Tue Böses– und du wirst
selbst Böses erfahren.
Also sprach Chamuel
und spreizte sein Gefieder.
Buch der Regina
Prolog
Ihre Augen wanderten über die spiegelglatte See, suchten nach irgendeinem Anhaltspunkt, einem Lebenszeichen.
Aber da war nichts zu sehen, absolut nichts. Das Wasser war ruhig wie selten zuvor in diesen Tagen. Ein Bild des Friedens, der absoluten Harmonie.
Das Experiment
Da stand er nun. Allein und völlig auf sich gestellt mit seiner hirnverbrannten Idee. Nur seine Freundin Sophia wartete draußen und drückte ihm die Daumen. Eigentlich war es ja ihre Idee gewesen, sich bei dieser Fernsehshow anzumelden. Aber jetzt lief sie nervös auf den Fingernägeln kauend vor dem Studio auf und ab, bis sie erfuhr, wie alles ausging. Für diese Präsentation war sie einfach nicht cool genug, das machten ihre zarten Nerven nicht mit. Allerdings, wenn er, Sigi Dinkel, an diesem Punkt seines Lebens geahnt hätte, wie alles einmal enden würde, er hätte bestimmt auf dem Absatz kehrtgemacht und diese Räumlichkeiten ebenfalls fluchtartig verlassen.
Aber so verharrte er, ausgestattet mit einer alten Keramikschüssel, die ihm seine Oma irgendwann einmal vererbt hatte. In dieser abgegriffenen Schüssel mit dem zersprungenen kobaltblauen Muster ruhten genau zehn der runden Konstrukte, die seinen weiteren Lebensweg für immer umkrempeln sollten. Doch das konnte Siegfried Dinkel zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht ahnen.
Begonnen hatte alles mit der Feier zu seinem fünfunddreißigsten Geburtstag im letzten Jahr in seiner Wohnung in Prächting. Sie war vollkommen ausgeufert. Jetzt, im Nachhinein, konnte er sich nicht einmal mehr erinnern, wer alles an dieser denkwürdigen Orgie teilgenommen hatte. Freunde waren gekommen, dann noch mehr Freunde und zum guten Schluss noch die Freunde der Freunde, sodass er irgendwann komplett den Überblick über sein Fest verloren hatte.
Das Ganze war eigentlich als Mitbringfete konzipiert gewesen, weil sich die Kosten für das epochale Event einigermaßen in Grenzen halten sollten. So der Plan. Das hatte aber nur zum Teil geklappt. Zwar war von seinen Gästen etliches an heimischen Spezialitäten angeschleppt worden. Was im Fortgang der Feierlichkeiten aber niemanden davon abhielt, sich an seinem heiß geliebten Whiskyvorrat gütlich zu tun. Und das war nicht gut. Vor allem nicht für den Gastgeber, der kurzerhand zusammen mit seinen Gästen die Geschmacksvielfalt schottischer Destillerien erkundet hatte.
Als Siegfried Dinkel am nächsten Tag aufgewacht war, hatte er feststellen müssen, dass seine Gäste ebenso verschwunden waren wie ein Großteil seiner sorgsam gehüteten Single-Malt-Sammlung. Sophia war gar nicht da gewesen, sie war mit ihrer Tanztruppe auf einem Mädelsausflug in Prag. Als er sich mühsam auf dem Sofa seiner kleinen Wohnung aufsetzte, stieß er mit dem rechten Fuß an etwas Gläsernes. Die leere Flasche eines dreißig Jahre alten Lagavulin (Destillers Edition) kullerte davon, bis sie schließlich müde und leer an der Wand seines Wohnzimmers liegen blieb. Über hundert Euro ausgesuchtesten Whiskys einfach so geleert, in einer Nacht. Wahnsinn. Aber dafür war es eine richtig geile Feier gewesen, und Opfer mussten schließlich gebracht werden, wie schon der alte Otto Lilienthal vollkommen zu Recht festgestellt hatte.
Na ja, wie auch immer, erst einmal war da dieser Hunger. Er hatte richtig Kohldampf, Essensreste en masse und reichlich Restalkohol in der Birne. Keine idealen Voraussetzungen für einen komplizierten Kochvorgang. Und genau dieser Umstand führte zu dem schicksalsträchtigen Moment, in dem er sich an die Herstellung des gemeinen Granatsplitters in Bäckereien und Konditoreien erinnerte. Ein Produkt der notgedrungenen Resteverwertung. Krümel zusammenkehren, Butter dazu, alles zusammenmanschen und zum guten Schluss die Masse mit einer Hülle aus Schokolade umgeben, um den gnädigen Mantel des Schweigens über den soeben hergestellten Mischmasch zu breiten. Ein grauenhaftes Zutatendurcheinander aus Kuchen, Torten und sonstigen Konditoreiresten, das aber, welch Wunder, affengeil schmeckte, wenn man beim Essen den desaströsen Herstellungsprozess auszublenden vermochte.
Ähnliches schwebte nun Sigi Dinkel vor, der aufgrund seines knurrenden Magens und der whiskytechnisch bedingten Trägheit seines Denkapparates einen möglichst kurzen Weg zum kulinarischen Ziel suchte. Also nahm er die nächstbeste Schüssel vom Tisch, in der sich noch Reste von Kartoffelchips befanden, und begann damit, selbige mit einer wohlsortierten Auswahl von weiteren Essensresten des gestrigen Abends zu befüllen. So fanden Rosmarinkartoffeln ebenso Eingang in das rezeptfreie Experiment wie Sardellenpaste und überbackener Ziegenkäse. Auch noch so einiges andere an unorthodoxen Zutaten landete in der Schüssel, bis diese etwa drei viertel voll war. Dann krempelte er die Ärmel hoch und begann ungeduldig damit, das Ganze zu einer Masse undefinierbarer Färbung zusammenzukneten.
Als nach wenigen Minuten die motorischen Fähigkeiten von Sigi Dinkel auszufasern drohten und sich zudem bereits wieder ein alkoholbedingter Schwindel einstellte, beschloss das hungrige Geburtstagskind, sich erst einmal in die Küche zu begeben und sich die Hände zu waschen. Bis zum Ellenbogen klebten die Zeichen des Herstellungsprozesses auf seiner Haut. Der Weg dorthin wurde von ihm in bester Absicht, jedoch mäßiger Geradlinigkeit begonnen. Zuerst tendierte sein Gang etwas zu sehr nach links, was er durch massive Gewichtsverlagerung nach rechts zu kompensieren suchte. Der richtungstechnische Korrekturversuch endete jedoch unvermittelt auf dem Küchenfußboden, direkt neben einer Bierbankgarnitur, die er dort als temporäres Büfett aufgebaut hatte. Mühsam zog und drückte er seinen verkaterten Körper an der Bierbank hoch, bis er sich schließlich zitternd mit seinen verschmierten oberen Extremitäten auf dem Biertisch abstützen konnte.
Schwer schnaufend und mit einem massiven Schwindelgefühl im Schädel versuchte er, die Kontrolle über seine gesamten Körperfunktionen zurückzuerlangen, als sein gequälter Blick auf die beiden einzigen Reste des gestrigen Essensangebotes fiel, die noch nicht vertilgt oder in der Schüssel vermengt worden waren. Ein braunes Etwas, das wie ein kleiner gebratener Hase aussah. Daneben ein schönes, knuspriges fränkisches Schäuferla, das ihm von einem hölzernen Servierbrett unschuldig entgegenlachte. Ein Traum von einem Stück Fleisch, allerdings mit dem Makel behaftet, gestern im Zuge der Feierlichkeiten irgendwann einmal vom Biertisch gefallen zu sein, woraufhin mindestens drei Personen in dem ganzen Getümmel auf dem Schäuferla ausgerutscht waren, ehe eine helfende Hand dieses Zeugnis überlegener fränkischer Kochkunst zurück auf den Biertisch befördert hatte.
Natürlich hatten alle im Raum die Odyssee des armen Krustenbratens unter großem Gelächter mitverfolgt, Sigi Dinkel inbegriffen. Jeder machte fortan seine Witze über das Missgeschick, die Bereitschaft jedoch, dieses gefallene Prachtexemplar zu verzehren, erwies sich als sehr begrenzt. Wer wollte schon ein Fleischstück essen, und mochte es noch so lecker aussehen, mit dem quasi der Wohnungsboden gewischt worden war. Also war das Schäuferla unbehelligt geblieben und hatte den Platz auf Sigi Dinkels Tisch zusammen mit dem Hasen nun exklusiv. Mit seiner braunen, knusprigen, jedoch ziemlich verschmierten Kruste bettelte es den Veranstalter des gestrigen Festes um Verzehr an. Der Pseudohase hatte höchstwahrscheinlich überlebt, weil irgendwer ihn ohne Kommentar und Beschriftung mitgebracht hatte und somit niemand den fremden Braten so richtig einzuordnen wusste. Es war ja auch genug anderes Zeugs zum Essen da gewesen, das nicht so undefinierbar daherkam.
Sigi Dinkels Synapsen arbeiteten langsam, aber konsequent. Ob aus seinem experimentellen Granatsplitter jemals etwas werden würde, stand in den Sternen, und die Wegstrecke zurück zum Sofa erschien ihm inzwischen unendlich lang. Also packte er kurz entschlossen das Holzbrett mit den vernachlässigten Leckereien und schob das malträtierte Schäuferla samt Hasen ohne zu zögern in die Mikrowelle. Die elektromagnetischen Vorgänge in dem Gerät würden eventuell vorhandenen bösen Keimen ja ganz sicher den Garaus machen, so seine von männlicher Logik geprägte Überlegung.
Wenige Minuten später verkündete ein helles »Ping« das Ende der Mikrowellenbearbeitung, und er konnte das dampfende Ergebnis entgegennehmen. Das Schäuferla und sein kleiner Kollege dufteten geradezu himmlisch, und er machte sich sofort mit einem leidlich sauberen Küchenmesser über das reanimierte Essen her. Dabei dachte er keine Sekunde lang über den hygienischen Aspekt seines Unterfangens nach. Er hatte Hunger, er hatte Koordinationsschwierigkeiten, alles war gut so, wie es war. Scheiß auf den Fußboden. Hastig und in großen Stücken verschlang er das warme Fleisch, bis kam, was kommen musste.
Sein Verdauungstrakt, an der Spitze sein whiskyverseuchter Magen, schwenkte panisch die weiße Flagge, weshalb Sigi Dinkel seinen Mittagstisch wenige Sekunden später auf der Gästetoilette beendete, wo er in ausufernder Gründlichkeit die soeben vertilgte Mahlzeit vor der Verdauung bewahrte. Als er danach kreidebleich aus der Toilette geschlurft kam, vermochte er es beim besten Willen nicht mehr, das restliche Fleisch zu essen. Zum Wegwerfen war es aber zu schade, schließlich war mehr als die Hälfte übrig. Also nahm er den letzten Rest seiner Konzentration zusammen, schnippelte alles vom Knochen, was ging, und trug dieses Häufchen Fleisch mit beiden Händen vor sich her, den ganzen langen Weg bis zu seinem Wohnzimmertisch. Dort warf er die nunmehr geschnetzelte fränkische Spezialität in die Schüssel zu seiner experimentellen Granatsplittermasse. Einmal mit der rechten Hand durchgemischt, fertig.
Apathisch betrachtete er seine vom Lebensmittelmischmasch nun wieder verschmierte rechte Hand, ehe er völlig erschöpft auf seinem Sofa einschlief.
Als Sigi Dinkel die Augen wieder öffnete, war es bereits dunkel geworden. Ein kurzer Kontrollblick auf die Uhr schmetterte ihm die unerbittliche Wahrheit ins Gesicht: gleich einundzwanzig Uhr. Seit er heute nach dem Ende der Feier zum ersten Mal auf dem Sofa eingepennt war, hatte er fast fünfzehn Stunden geschlafen. Immerhin war der Schwindel verflogen, und schlecht war ihm auch nicht mehr. Dafür meldete sich sein Magen mit einem lauten Knurren. Kein Wunder, hatte er ihn bei der letzten Fütterung mit aufgewärmtem Fußbodenfleisch doch total überfordert. Als Ergebnis hatte er nun einen komplett leer geräumten Magen und gewöhnungsbedürftige Aromen im Mund.
Um beides notdürftig zu befrieden, griff sich Sigi Dinkel das nächstbeste Glas, das einen halbwegs sauberen Eindruck machte, und öffnete eine Flasche irischen Tullamore Dew, die er als Notration oben auf dem Kühlschrank stehen hatte. Nicht die höchste Blüte der Whiskybrennerei, aber für seine Zwecke mehr als ausreichend. Es war sicherlich das Beste, Feuer mit Feuer zu bekämpfen.
Er beließ den Whisky einige Sekunden im Mundraum, ehe er ihn auf den Weg nach unten schickte. Und tatsächlich zeigte die ambulante Maßnahme den gewünschten Erfolg. Der ekelhafte Geschmack im Mund war verschwunden, das akute Hungergefühl wich einem beruhigenden Brennen in seinem Bauch. Dazu breitete sich eine angenehme Wärme in seinen gequälten Innereien aus. Mit einem hellen Klingen stellte er das Glas zurück auf den Küchentisch, dann öffnete er ruckartig den Kühlschrank, um sich jetzt endlich irgendetwas Essbares zusammenzuzimmern.
Der Anblick, der sich ihm bot, war mehr als ernüchternd. Der Kühlschrank war leer. Leer bis auf drei Tomaten und eine angeschnittene Gurke.
Sigi Dinkel hasste Gurken sogar noch mehr als Tomaten und machte den Kühlschrank schnell wieder zu. Dann durchwühlte er jeden Winkel seiner Küche. Jede Schublade, jeder mögliche Vorratsort wurde von ihm in Betracht gezogen. Aber es war alles weg. Aufgefressen von den Heuschrecken seiner Geburtstagsgesellschaft.
Was sollte er tun, essen gehen in Bad Staffelstein oder Lichtenfels? Lieber nicht. Wenn ihn die Polizei auch nur kurz zu Gesicht bekäme, hätte sich das mit seiner Fahrerlaubnis für längere Zeit erledigt. Verzweifelt scannte er die Wohnung, bis sein Blick aus aufgequollenen Augen auf Omas gemusterte Schüssel fiel. Ach ja, da drin war das ganze übrig gebliebene Essen.
Er überlegte nur kurz, dann fasste er einen folgenschweren Entschluss. Er würde dieses undefinierbare Gemisch jetzt in den Ofen schieben und das Ergebnis essen. Schlimmer als ein aufgewischtes Bodenschäuferla konnte es schlussendlich auch nicht mehr werden.
Er wühlte eine Weile in dem Fach unter seinem Backofen, bis er gefunden hatte, was er suchte. Das Backblech mit den Formen für die Muffins. Perfekt. Das würde schöne runde Fleischküchlein geben. Sigi Dinkel beabsichtigte, die ersten fränkischen Fleisch-und-Sonstiges-Granatsplittermuffins der Welt zu backen. Er stellte das Backblech mit den runden Aussparungen klappernd auf den Küchentisch, dann holte er Omas Keramikschüssel und platzierte sie direkt daneben. Schon wollte sich seine Hand auf den Weg machen, um die erste Portion aus der Schüssel zu holen, da hielt er plötzlich inne und überlegte. Er war zwar wirklich kein Hygienefanatiker, aber der Inhalt dieser Schüssel war jetzt viele Stunden lang der warmen Raumluft und den darin umherschwirrenden Mikroben ausgesetzt gewesen. Womöglich waren einige Bestandteile der breiigen Masse schon in Gärung begriffen. Auch könnte die gemeine fränkische Stubenfliege in der Zeit seiner geistigen Abwesenheit beschlossen haben, sich in seinem Granatsplitterteig vermehren zu wollen. Sogar für einen harten Hund wie Sigi Dinkel war dies eine abschreckende Vorstellung. Aber kein Grund, aufzugeben.
Als Erstes schüttete er den Rest des Tullamore Dew, immerhin noch über eine halbe Flasche, in die Schüssel, das sollte zur Desinfizierung eigentlich reichen. Dann gab er an Gewürzen hinzu, was er in der Küche finden konnte. Kardamom, Koriander, Chili und noch so einiges mehr. Ungute Geschmacksnoten sollten dadurch zumindest gedämpft werden. Noch einmal verrichteten seine Hände die mühselige Arbeit des Knetens, dann endlich klatschte die erste Portion des Mixtyriums in eine der Mulden seines Backbleches. Das reicht ja locker noch für drei weitere Backvorgänge, überlegte er stirnrunzelnd, als er kurz darauf den Backofen einschaltete. Na gut, was soll’s, heute habe ich eh nichts mehr vor. Er kehrte seinem Experiment für die Dauer des Garens den Rücken und ging ins Bad, um zu duschen. Es wurde Zeit, endlich den ganzen Dreck der vergangenen Nacht wegzuspülen.
Die Zeit in der Dusche zog sich hin, denn Siegfried Dinkel genoss die Wärme und wiederkehrende Reinheit zusehends. Im Moment des Waschvorganges erkennt der Mann den hohen Grad seiner Verschmutzung, aber erst dann. Sigis Säuberungsorgie endete allerdings jäh in genau dem Augenblick, als ein merkwürdiger Geruch sich in seiner Dusche auszubreiten begann. Ein hochfeines Aroma von Kokelschäuferla mit Anklängen von verbrannter Kartoffel und angesengtem Chiliziegenkäse sowie dem zarten Duft gekochten irischen Whiskys im Abgang drang als olfaktorische Botschaft in seine abgelenkte Nase.
Es dauerte einige Sekunden, bis er begriff, was dieser Duft ihm sagen wollte. Dann riss er den Duschvorhang zur Seite und stürzte, nass und nackig, wie er war, in die Küche. Der Backofen sonderte einen immer dunkler werdenden grauen Dampf ab, was nichts Gutes verhieß. Hektisch öffnete Sigi Dinkel die Tür des Backofens und ergriff, ohne nachzudenken, das Backblech. Mit einem wilden Schrei zog er es heraus, ließ es dann aber sofort wieder los. Das Blech landete polternd auf dem Küchenboden, während er sich fluchend die linke Hand hielt, die er sich sauber am Blech verbrannt hatte.
»Verdammte Scheiße!«, rief er voller Inbrunst, derweil die angekokelten Muffins über den Küchenboden rollten. Nicht schon wieder, mochten sich die Fleischanteile im Muffin gedacht haben, die ja im Gegensatz zu den restlichen Zutaten nicht zum ersten Mal die Ehre hatten, die Staubdichte des Küchenbodens zu testen.
Minuten später saß der moralisch zermürbte Wohnungsbesitzer mit verbundener Hand an seinem Küchentisch und betrachtete mit widerstrebenden Gefühlen den Haufen Kokelmuffins, der sich vor ihm auftürmte. Erstaunlicherweise rochen die verbrannten Dinger gar nicht mal so schlecht. Nicht wirklich verbrannt, eher so richtig trocken gegrillt. Schließlich entschloss er sich zu einer endgültig letzten Improvisation, um sein Abendessen doch noch zu retten. Er zerbröselte das soeben gebackene Produkt und gab die Krümel in eine weitere Schüssel. Diesmal eine, in der noch etwas Knoblauchsoße vom Vortag übrig geblieben war. Dass darauf noch die krümeligen Reste seines am Ende nicht mehr gerauchten Joints schwammen, registrierte er zwar beiläufig, es hinderte ihn aber nicht an seinem Tun. Immerhin gelang es ihm mit den neuen Zutaten, die verbrannte Färbung des Essensbreis etwas zu kaschieren. Er schüttete noch den Restinhalt einer Flasche Bionade, Geschmacksrichtung Zitrone/Bergamotte, hinzu, damit er das Zeug wieder kneten konnte. Das klappte ganz gut, sodass er kurz darauf den neuen, helleren Teig mit dem dunklen alten vermengte.
»Das ist jetzt aber endgültig das letzte Mal«, knurrte er in seinen nicht vorhandenen Bart, ehe er die Mulden des Backbleches erneut füllte. Den rohen Teig probierte er schon gar nicht mehr, dazu fehlte ihm inzwischen die Geduld. Und es war völlig egal, was bei diesem Backvorgang herauskam, er würde das Ergebnis essen, so viel stand für ihn fest. Mindestens einer dieser Muffins würde in seinem Verdauungstrakt landen, komme, was da wolle. Das war er seinem Magen, seinem Ofen, vor allem aber seinem Ego als Koch schuldig.
Damit nicht wieder etwas schiefging, harrte Siegfried Dinkel diesmal vor dem Backofen aus, bis sich ein durchaus angenehmes Aroma in der Küche zu verbreiten begann. Als sich dieses Aroma immer mehr verfestigte und seine Backlinge eine kräftige braune Farbe angenommen hatten, schaltete er den Ofen aus, streifte die Maurerhandschuhe über, die zu diesem Zweck auf dem Fensterbrett lagen, und nahm das Backblech heraus.
Riechen tut es schon mal ziemlich gut, sogar sehr gut, stellte er überrascht fest. Mit dem Blech in der behandschuhten linken Hand setzte er sich an den Küchentisch, pulte mit einem Löffel den ersten Muffin aus der Form und setzte ihn auf eine halbwegs saubere Stelle des Küchentisches, unbenutzte Teller hatte er ja keine mehr. Er gönnte dem Teil etwa eine Minute zum Abkühlen, dann hob er den Backling mit der unverbundenen rechten Hand vor sein Gesicht.
Einige Sekunden lang betrachtete er ihn von allen Seiten, dann biss Sigi Dinkel in das Ergebnis seines kulinarischen Experiments, den ersten Fleisch-und-Sonstiges-Granatsplittermuffin der Welt.
Eine Verkettung von alkohol- und nahrungsmittelmangelbedingen Umständen hatte dazu geführt, dass er nun hier war, in der Fernsehshow »Höhle der Löwen«, um in seiner maßlosen Unverfrorenheit den millionenschweren Unternehmern, die vor Tausenden Fernsehzuschauern über die Rentabilität neuartiger Geschäftsideen urteilten, ein Angebot zu machen, wie sie es bisher noch nicht gesehen hatten. Dabei hing zunächst einmal alles davon ab, wie ihnen seine Muffins schmecken würden. Die Dekorateure des Fernsehstudios hatten entgegen ihren sonstigen Gepflogenheiten keine üppigen Hintergründe aufgebaut. Nein, er hatte eine schlichte, einfache Präsentation gewollt. Eine Präsentation, die ausschließlich durch das Produkt selbst zu überzeugen wusste. Alles an seinem Auftritt sollte anders sein, als es in dieser Fernsehshow üblich war, denn auch sein Ansinnen war ein anderes als das, was die fünf Löwen gewohnt waren. Eine einfache, schlichte Säule aus Holz, auf der die alte Schüssel seiner Oma thronte. Darin zehn Exemplare seiner Muffins. Im Hintergrund in großen goldenen Lettern der Name, den er seinen Muffins gegeben hatte.
SIDIMUFF(Siegfrieddinkelmuffin)
Der erste Fleisch-und-Sonstiges-Granatsplittermuffin der Welt
Und dann, endlich, war er an der Reihe.
»Ich werde Ihnen zunächst nichts über meine Geschäftsidee, meine Forderungen oder mein Produkt erzählen«, trug Siegfried Dinkel den gespannten Löwen vor, die bereits neugierig die alte Schüssel auf dem Sockel betrachteten. »Ich werde Sie etwas kosten lassen, was die Welt bisher noch nicht gegessen hat.«
Sprach’s, schnappte sich seine Schüssel und reichte jedem der Löwen und Löwinnen einen »Sidimuff« zum Probieren. Dann stellte er die Schüssel zurück auf die hölzerne Säule und sich daneben, um die Reaktionen der Probanden abzuwarten. Die ließ nicht lange auf sich warten. Ein endloses Gejauchze und »Ah« und »Oh« waren von den begeisterten Unternehmern zu hören. Sie waren offensichtlich hin und weg von dem, was da ihre Geschmacksnerven streichelte. So etwas hatten ihre verwöhnten Gaumen noch nicht erlebt, nicht im teuersten Restaurant dieser Welt. Wenig später prasselten drängende Fragen zu seinem Sidimuff auf den Oberfranken ein, die Siegfried Dinkel größtenteils aber entweder nicht beantworten konnte oder wollte.
»Ja, es gibt eine geheime Rezeptur«, gab er schließlich zu. »Die ist zwar nicht patentiert, kann aber auch nicht von jemand anderem nachgebacken werden. Weder von einem Koch noch von einem Lebensmitteltechniker oder einem berühmten Lebensmittelinstitut. Diese Tests hat der Sidimuff nämlich schon hinter sich. Niemand hat es bisher geschafft, ihn so hinzubekommen wie ich«, verkündete er selbstsicher.
»Und warum glauben Sie, dass es nicht vielleicht doch irgendwann mal jemand schafft? So schwierig kann es doch nicht sein, die Bestandteile dieses Muffins herauszubekommen?«, wandte Carsten Maschmeyer skeptisch ein.
Sigi Dinkel antwortete ihm im Brustton der absoluten Überzeugung: »Weil man, Herr Maschmeyer, um das alles so zusammenzumixen, wie ich es getan habe, sehr, sehr besoffen sein muss.«
Das schien ein ziemlich überzeugendes Argument gewesen zu sein, denn es kam keine weitere Nachfrage mehr zum Herstellungsprozess seiner Muffins, alle im Raum brachen in lautes Gelächter aus und waren kurz darauf wieder mit ihren Sidimuffs beschäftigt.
Ralf Dümmel schluckte unter allgemeinem Gemurmel genüsslich den letzten Rest seines Muffins hinunter. Seine Gesichtszüge signalisierten absolute Begeisterung, eine uneingeschränkte Hingabe dieser ekstatischen Aromenvielfalt gegenüber. So etwas Außergewöhnliches, einen so speziellen und zugleich faszinierend einmaligen Geschmack, diese Art sensorischer Explosion in seinem Mund- und Rachenraum, hatte er in diesem Leben noch nicht erfahren dürfen. Er spürte dem ungeahnten Geschmackserlebnis noch einige Sekunden nach, dann klappte er seine berühmte Mappe auf, nahm einen Stift zur Hand und erklärte mit einem süffisanten, breiten Grinsen: »Herr Dinkel, egal wie das heute Abend hier für Sie ausgeht, eins steht für mich fest: Ihr Sidimuff wird Sie sehr, sehr reich machen. Das Ding hat meiner Meinung nach einen absoluten Suchtfaktor. Von mir bekommen Sie auf jeden Fall ein Angebot.«
Sogleich kamen von den anderen Löwen identisch lautende Ansagen. Es ging nun nicht mehr um die Offerierung von Angeboten, nein, die ganze Veranstaltung glich auf einmal einer Versteigerung, einem Wettlauf der anwesenden Investoren mit dem Ziel, als Sieger eine kulinarische Erfindung mit ausgesuchtester Perspektive finanzieren zu dürfen. Das war nicht nur nach den Maßstäben der Show einmalig und sensationell. Der Sidimuff hatte ein ähnliches Potenzial wie seinerzeit die Produktneuheit Coca-Cola.
Die Gebote der Löwen für den Sidimuff aus Oberfranken erhöhten sich im Minutentakt, und die Bieterorgie schien kein Ende zu nehmen. Bis schließlich ein Angebot von nie da gewesener Höhe im Raum stand. Noch niemals, für kein Produkt, das je in dieser Sendung vorgestellt wurde, war eine derart schwindelerregende Investitionssumme in Aussicht gestellt worden.
Blind
Seit langer Zeit hielt in Bamberg wieder einmal der Sommer Einzug in die Weltkulturerbestadt. Nach zwei verregneten Jahren hintereinander knallte in diesem Juli die Sonne gewohnt erbarmungslos vom Himmel. Bereits Anfang des Monats hatte das Thermometer einige Tage lang über vierzig Grad angezeigt. Inzwischen hatte sich die nachmittägliche Temperatur auf »nur« sechsunddreißig Grad eingepegelt, was für manchen Zeitgenossen aber nach wie vor zu viel des Guten war. Also tat man das, was man als anständiger Bamberger sowieso gern tat. Man verkrümelte sich hinauf auf die Keller, um seinen Flüssigkeitshaushalt mit dem Hinweis auf die temperaturbedingte Dehydration sozial und gesellschaftlich anerkannt mittels Bieren verschiedenster Geschmacksrichtungen und Herstellung wieder auszugleichen. Eine allseits beliebte und anerkannte Methode in Franken, die in Bamberg Jahr für Jahr zu ihrer höchsten Vollendung gebracht wurde.
Waren die Pilgerwanderungen zu den Kellern früher eine absolute Männerdomäne gewesen, so handelte es sich inzwischen um eine geschlechterübergreifende Übung, die in modernen Zeiten wie diesen auch von den Frauen absolut professionell beherrscht wurde. Heute stand den hauptsächlich männlichen Leistungstrinkern vergangenener Tage eine weibliche Schar an Bierfetischistinnen gleichrangig gegenüber. Allerdings wurde der Biergenuss weiblicherseits durchaus anders interpretiert, sozusagen umfassender, philosophischer. Entgegen dem Habitus des gemeinen Mannes, der sich mehr oder weniger sinnentleert in seinen Bierkonsum stürzte, ging die fränkische Frau mit einer wohlüberlegten Sinnhaftigkeit ans Werk. Quasi mit einem pädagogischen Unterbau, der es ihr ermöglichte, den promilleschweren Abend sich selbst und anderen weiblichen Teilnehmerinnen gegenüber zu legitimieren.
Während der biertrinkende Mann also ab einem gewissen Alkoholpegel einfach aufhörte zu denken, vermochte es die fränkische Bierfee, ihrem Besäufnis einen Sinn zu geben. Wobei es falsch wäre zu behaupten, dies sei der vernünftigere Weg. Ein betrunkener Bamberger schaffte es problemlos, an nichts zu denken. Es gab Menschen aus den Tiefen des Steigerwaldes, die es angeblich sogar fertigbrachten, monatelang nichts zu denken. Sie gönnten sich eine gedankliche Sommerruhe, eine Art alkoholisches Hitzefrei. Für Männer war dieser Zustand der absoluten inneren Leere das Höchstmaß an zu erreichendem Seelenfrieden, während eine abgefüllte Bambergerin ihre Alkoholkumulation gern als psychedelisches Experiment, wissenschaftliche Studie, Methode der Selbsterfahrung oder schlicht als fränkisches Heilsaufen bezeichnete. Eine Art Bieryoga, bei dem die Bewusstseinsstufen des Individuums um einige Karmavarianten erweitert wurden.
Entsprechend konnte man jetzt, im beginnenden Bamberger Sommer, etliche weibliche Yogagruppen beobachten, die sich auf ihrem Lieblingskeller in vorbildlicher gruppendynamischer Perfektion mittels Seidla-Bestellung plus Siebenhügeltropfen fröhlich die Kante gaben. Hübsch getrennt von den männlichen Nichtsdenkern, die meist einzeln, verstreut, an den Nebentischen saßen und, von jeglicher Gehirntätigkeit befreit, Löcher ins Universum stierten.
Eben diesen herzerfrischenden Tätigkeiten wollte ein Teil der Bamberger Kripo heute auch wieder einmal nachgehen. Schließlich war es heiß, Montagabend, und es gab allerhand zu besprechen. Nichts Kriminelles, denn der Bamberger Verbrecher zog sich bei derart hochsommerlichen Temperaturen gemeinhin ebenfalls an einen Biertisch zurück, um seinen nächsten Coup zu planen. Den würde er aber wegen temporärer gedanklicher Verlangsamung erst bei Erreichen weit niedrigerer Temperaturen umsetzen, so waren die ungeschriebenen Gesetze in Bamberg. Sollte es einer dieser Vögel dennoch wagen, unter so unchristlichen Bedingungen eine Straftat zu begehen, würde er die gesamte Macht des fränkischen Polizeiapparates zu spüren bekommen. Sowohl von der Polizei als auch von den Richtern und ganz sicher auch im fränkischen Knast blühte ihm was. Einen Banküberfall bei Biergartenwetter, so was machte man einfach nicht.
Mit diesem Wissen über die Lage der Dinge ausgestattet, hatten Kriminalhauptkommissar Franz Haderlein, sein jüngerer halb brasilianischer Kollege César Huppendorfer, ihr Chef Robert Suckfüll sowie die Dienststellensekretärin Marina »Honeypenny« Hoffmann an einem der Biertische im »Greifenklau« Platz genommen. Ihr Ermittlerferkel hatte sich darunter niedergelassen, froh, einen schattigen Platz gefunden zu haben.
Es dauerte gar nicht lange, dann hatte jeder ein Seidla vor sich stehen, und auch die Riemenschneiderin unter dem Tisch war mit einem Radler in einer Schale versorgt worden. Einem gedeihlichen Abend stand also nichts mehr im Wege. Die Lage der Welt, die bevorstehende fränkische Unabhängigkeitserklärung und natürlich die personellen Umwälzungen bei der Kriminalpolizei Bamberg wollten eruiert werden.
»Der arme Lagerfeld. Jetzt muss er doch tatsächlich Dienst schieben, um die neue Kollegin einzuarbeiten«, bemerkte César Huppendorfer betont mitfühlend, was sofort ein allgemeines Schmunzeln auslöste. Jeder am Tisch wusste, dass sich der Kollege Bernd Schmitt freiwillig gemeldet hatte. Und das war noch sehr zurückhaltend ausgedrückt. Selbst ein Blinder mit Krückstock und Kopfhörern hätte mitbekommen, dass sich der gute Lagerfeld mehr als gewöhnlich bemühte, die neue Mitarbeiterin an ihre neue Tätigkeit als Kriminalkommissarin heranzuführen. Da steckte mehr als nur berufliches Interesse dahinter. Wie sich das alles mit seiner häuslichen Situation als Familienvater vertrug, was also seine Freundin und die gemeinsame kleine Tochter davon hielten, konnte man nur vermuten. Auf jeden Fall bot die neue Situation den Kollegen Anlass, Lagerfelds Gegockel einerseits mit großem Vergnügen, andererseits mit gewisser Sorge zu betrachten. Im Hause Schmitt/von Heesen schien der Haussegen ganz gewaltig schief zu hängen.
Während die Männer der Dienststelle Schmitts Schürzenjägerei also als eine willkommene Abwechslung vom beruflichen Alltag ansahen, fand Marina Hoffmann alias Honeypenny die ganze Angelegenheit überhaupt nicht witzig. Viele, viele Jahre lang war sie die einzige Frau in der Dienststelle gewesen und hatte die Bamberger Kripo mit ihren Honigbroten sowie ihrer rustikal-mütterlichen Art an ihre durchaus umfangreich zu nennende Brust gedrückt. Und jetzt kam diese langbeinige Andrea vom unteren Stockwerk herauf und machte mit ihren blonden Haaren die Männer in der Dienststelle scheu. Obgleich es vier Monate gedauert hatte, bis Andrea Onello den Wechsel von ihrer alten Arbeitsstelle zur Bamberger Kripo vollzogen hatte und Honeypenny eigentlich genug Zeit geblieben war, um sich auf die weibliche Konkurrenz einzustellen, kam jetzt doch alles recht plötzlich für sie und ihre festgefahrenen Ansichten.
Nicht dass sie Andrea Onello eine unlautere Absicht unterstellte, das nicht. Aber wer so unverschämt gut aussehend daherkam, konnte einfach nicht gut für das Klima in der Dienststelle sein. Nicht nur die Männer, auch ihr geliebtes Ermittlerferkel war auf das blonde Gift hereingefallen. Dass Riemenschneider Andrea Onello gut fand, wog für Honeypenny fast noch schwerer. Schließlich hatte sie, Marina »Honeypenny« Hoffmann, das alleinige Sorgerecht für dieses Büro, und das wollte sie sich auf keinen Fall streitig machen lassen. Aber was sollte sie machen, Undank war der Welten Lohn. Seufzend schnitt sie mit ihrem Messer einen Schnitz von ihrem mitgebrachten Apfel ab und reichte diesen zur Riemenschneiderin hinunter, die ihn sofort genüsslich vertilgte.
»Vielleicht sollten Sie sich mit Ihrer Tierliebe etwas zurückhalten, Frau Hoffmann«, warf Robert Suckfüll ein, der Honeypennys Zuneigung zu diesem kleinen Ferkel nicht verstehen konnte. »Mir scheint, dass sich dieses Schwein gewichtstechnisch in die falsche Richtung entwickelt, sich also nicht im allerbesten Trainingszustand befindet.« Er blickte seine Sekretärin tadelnd an.
Honeypenny schaute böse zurück und meinte giftig: »Ja, klar hat Riemenschneider zugenommen. Aber nur, weil ein gewisser Herr Schmitt es für nötig befunden hat, diese Schnepfe, diese blonde Tussi zu engagieren. Dass die Riemenschneider andauernd Bananen gibt, kann ja nicht gut für die Figur sein. Außerdem bringt Bernd ihr neuerdings immer Pralinen mit. Der und die füttern ja wohl meine Riemenschneiderin zu einem Hängebauchschwein heran, ich doch nicht! So, das musste mal raus.«
Ihr verbales Geschoss zeigte nicht die gewünschte Wirkung. Statt gemeinschaftlicher Empörung wurde das Grinsen am Tisch nur noch breiter, César Huppendorfer konnte sich sogar ein leises Kichern nicht verkneifen. Allerdings waren das, was Honeypenny da absonderte, ziemlich konfuse, vor allem aber haltlose Anschuldigungen. Es wurde höchste Zeit, dass der Dienstälteste am Tisch mal etwas richtigstellte.
»Ich habe Andrea Onello zu unserem Ermittlerteam geholt, Marina, nicht Lagerfeld. Und ich habe diese Frau nicht engagiert, weil sie unbestritten sehr attraktiv ist, wie du vielleicht meinst, sondern weil sie fachlich wirklich was auf dem Kasten hat. Das und nichts anderes ist der Grund, warum sie bei uns ist. Also spar dir deine Eifersuchtsanfälle, Marina, und komm mal wieder runter. Andrea gehört jetzt zum Team. Du wirst dich mit ihr arrangieren müssen, ob dir das nun passt oder nicht.« Er hob demonstrativ seinen Bierkrug und stieß mit seinen Kollegen an. Laut klingend prallten die Krüge aneinander, und alle außer der Dienststellensekretärin genehmigten sich einen ordentlichen Schluck.
Marina Hoffmann sagte nichts mehr, aber ihre Gesichtsfarbe hatte sich weit in den scharlachroten Bereich verschoben, während sie störrisch und missmutig das nächste Apfelstückchen zur Riemenschneiderin hinunterreichte.
»Sehen Sie es doch einmal so«, versuchte sich Robert Suckfüll nun an einer Trostaktion. »Wir wollen doch alle jung alt werden, nicht wahr? Also sollten wir im Leben tunlichst jeglichen Ärger vermeiden, das sägt doch nur am Wohlbefinden, nicht wahr? Darum verkneifen Sie sich doch in Gottes Namen Ihre spitzen Bemerkungen Frau Onello gegenüber, meine Liebe. Sie müssen unserer neuen Mitarbeiterin nicht immer ein Gegenkontra geben, nur weil sie so schön blond ist.« Er holte tief Luft, während sich seine Untergebenen mühsam ein Lachen verbeißen mussten.
»Jung alt werden, hä? Gegenkontra?«, echote Honeypenny hilflos, was ihren Chef dazu animierte, noch tiefer greifende Begründungen zu artikulieren.
»Nun ja, wenn Sie in Ihrer ausufernden Weiblichkeit weiterhin eine so große Lippe riskieren, frisst Sie die Sucht des Eifers, der Ärger, noch von innen auf, meine liebe Frau Hoffmann. Dann können wir Sie irgendwann in der Pfanne rauchen, verstehen Sie? Womöglich legen Sie sich, wenn der Zug kommt, bei den nächsten Schienen… also ich meine, dort, wo man über die Gleise… oder von mir aus auch untendurch… na, Sie wissen schon, bei so einem Bahnuntergang, dass Sie sich dort wegen Ihrer sinnlosen, eifrigen Sucht das Leben…«
Allmählich kam Fidibus ins Schwitzen, der Sinn seiner Botschaft drohte in der komplizierten Satzstellung unterzugehen. Honeypenny schaute ihn immer verstörter an, während die Männer am Tisch immer mühsamer um Fassung rangen.
Verzweifelt bemühte sich Robert Suckfüll darum, wenigstens noch einen sinnstiftenden Schlusssatz hinzubekommen. »Na, Sie wissen schon, Frau Hoffmann, das kennen wir doch von den lebensmüden Kollegen dieser Welt, nicht wahr? Wenn man nicht mehr will, dann geht man einfach. Sie sind des Lebens nicht mehr froh und stürzen sich ins H2O. Aber das dürfen Sie nicht tun, Frau Hoffmann, ich brauche Sie noch im Büro.«
Das war’s. Aus Haderlein und Huppendorfer brach ein gewaltiges Lachen heraus, denn ihr Chef hatte wieder zugeschlagen. Das hatte die deutsche Sprache wirklich nicht verdient, von einem hochbegabten Juristen so vergewaltigt zu werden. Selbst Honeypenny stimmte schließlich in das befreiende Gelächter mit ein, während sich die Menschen an den Nebentischen reihenweise umdrehten, um zu sehen, was es denn hier so Lustiges zu begackern gab.
Nur Fidibus blickte erst verunsichert, dann ziemlich verärgert in die Runde, außerstande, den Grund für diese allgemeine, überbordende Heiterkeit zu erkennen. Schließlich gab er es auf. Alles Idioten, und er war ihr Chef. Was für ein Kreuz ihm das Schicksal da auferlegt hatte! Aber bitte, einer muss den Laden ja irgendwie zusammenhalten, dachte er kopfschüttelnd. Unter Einbeinigen ist der Blinde ja König oder so ähnlich.
Erschüttert von der Schlechtigkeit dieser Welt hob er seinen Krug ein weiteres Mal, um die unerquickliche Situation im Biere zu ertränken.
Es war ein Unfall gewesen, wie er im Kindesalter oft vorkam. Er hatte etwas von den Eltern ausdrücklich Verbotenes getan: Er war mit dem Fahrrad einen Weg entlanggefahren, den er eigentlich gar nicht hätte benutzen dürfen. Ein Rennen mit den Älteren. Mit seinem kleinen Rad schoss er den Pfad von der Giechburg hinunter, der hinüber zum Gügel, der alten Kapelle auf dem nächsten Berg, führte und für Radfahrer verboten war. Dazu ging es erst einmal steil abwärts, ehe der Weg wieder anstieg und sich zu der berühmten Kapelle hinaufschlängelte. Und genau am tiefsten Punkt der illegalen Rennstrecke war gekommen, was kommen musste. Eine Fußgängerin, ein wildes Ausweichmanöver, ein Stein, dann der Abflug, im hohen Bogen über den Lenker. Als Dieter Martin im Scheßlitzer Klinikum wieder aufgewacht war, konnte er nicht mehr sehen. Schädelbasisbruch, das Sehzentrum irreparabel geschädigt. Seine Sehfähigkeit hatten die Ärzte nicht mehr wiederherstellen können, aber zumindest das Leben des Achtjährigen retten.
Seine Blindheit bedeutete für den sportlichen Buben eine absolute Katastrophe, sein Leben hatte sich von einem Moment zum anderen geändert. Rad fahren, Fußball spielen, mit den Freunden um die Häuser ziehen, all das war von nun an Geschichte. Er musste sich in jungen Jahren umorientieren, seine Ziele neu definieren, einen Sinn in seinem Leben finden.
Und das hatte er auch getan. Schon während seiner Zeit in der Blindenschule hatte ihn der ihm innewohnende Ehrgeiz zu außerordentlichen Leistungen jenseits der verloren gegangenen Sehfähigkeit geführt. Die ihm verbliebenen Sinne schärften sich, und er förderte sie durch stetiges, verbissenes Training. Er machte seinen Realschulabschluss und absolvierte anschließend ohne Probleme das Fachabitur. So weit, so gut.
Die wirklichen Probleme waren erst danach gekommen. Denn niemand wollte wirklich einen Blinden einstellen, zumindest nicht in den Berufsfeldern, die sich Dieter Martin für seine berufliche Existenz vorgestellt hatte. Er wollte sich nicht in irgendeinen Keller stecken lassen, umgeben von allerlei technischen Apparaturen, die einem Blinden das Leben durchaus erleichtern konnten. Nein. Er wollte mit Menschen zu tun haben. Er wollte am Leben dort draußen teilhaben, den Umgang mit anderen pflegen, auf welche Art und Weise auch immer. So einige Versuche, sein Ziel zu erreichen, waren gescheitert, bis er schließlich Zugang zu einer beruflichen Tätigkeit gefunden hatte, auf die er zuerst wohl selbst nicht gekommen wäre: Barmixer.
Begonnen hatte alles mit einer Wette. An einem verregneten Novembertag hatte er für seine beste Freundin Anneliese ein paar Cocktails an seiner Hausbar gemixt. Und zwar in einer derartigen Geschwindigkeit, dass Anneliese vor Verblüffung der Mund offen gestanden hatte. Zuerst glaubte sie an einen Trick, an irgendeine seiner skurrilen Verarschungsaktionen, zu denen der liebe Dieter zugegebenermaßen neigte. Aber dann hatte er ihr ein Buch über Cocktails aus aller Welt in die Hand gedrückt und sie aufgefordert, ihm irgendeinen der Drinks aus dem Buch zu nennen, er würde es innerhalb von zwei Minuten schaffen, ihn herzustellen. Und zwar egal, welchen sie aussuchte.
Ihr Unglaube hatte sie eine kostenlose Autofahrt nach Salzburg und wieder zurück gekostet. Sie hatte die Wette nämlich mit Pauken und Trompeten verloren. Dieter Martin, seit seinem neunten Lebensjahr blind, hatte mit schlafwandlerischer Sicherheit zu den Flaschen gegriffen, Früchte geschnitten, Schirmchen gespannt und Cocktail um Cocktail in einer so absurden Geschwindigkeit zusammengemixt, dass sie nach der verlorenen Veranstaltung nur noch den Hut vor seinen Fähigkeiten ziehen konnte. Kurze Zeit später waren sie zusammen nach Salzburg gefahren, denn da wollte Dieter Martin schon immer mal hin.
Als sie zurückkamen, war Anneliese Schober tagelang in Bamberg unterwegs gewesen, um für einen blinden Barmann zu werben und Bambergs Barbesitzer davon zu überzeugen, dass Dieter doch zumindest mal zum Probearbeiten vorbeikommen könnte. Was letzten Endes dazu geführt hatte, dass Dieter Martin im »Aposto« in Bamberg eine Festanstellung hinter der Bar gefunden hatte. Das verglaste Restaurant direkt über dem Parkhaus zwischen den alten Regnitzarmen war für ihn wie gemacht– und umgekehrt traf dies genauso zu. Der blinde Barmixer und das Aposto hatten sich gesucht und gefunden.
Hinter, auf und unter der Theke war von ihm alles genauestens sortiert worden. Jedes Utensil stand genau dort, wo es stehen sollte. Und niemand im Aposto würde es wagen, eine der Flaschen anzurühren, zu verschieben oder gar ganz woandershin zu stellen. Das hier war Dieters Reich.
Im Aposto war Dieter Martin inzwischen eine feste Größe geworden. Durch seine Fachkompetenz, aber auch durch die irrsinnige Geschwindigkeit, mit der er seine Getränke herzustellen vermochte. Hinzu kamen diverse Kunststückchen, die er sich durch intensives Training angeeignet hatte. So konnte er zum Beispiel am Klingen eines Glases feststellen, ob es sauber war oder nicht. Er konnte am Einfüllgeräusch auf ein Zehntel genau erkennen, wie viel des benötigten Destillates sich schon im Glas befand. Die eine oder andere Wette mit seinen Gästen hatte er so schon für sich entschieden. Und kein Gast, dem es nicht gesagt worden war, hatte jemals bemerkt, dass dieser Barkeeper vollkommen blind war. Dieter Martin schaffte es, seinen Blick immer so fest auf die Schallquelle vor sich auszurichten, dass sein jeweiliger Gesprächspartner nicht im Geringsten daran zweifelte, einen sehtechnisch völlig gesunden Menschen vor sich zu haben.
Dieter Martin war im Aposto sehr glücklich geworden. Hier konnte er endlich das tun, was er immer wollte. Unter Menschen sein, Stimmen hören und sich austauschen. Und das als Gleichberechtigter. Sein Handicap spielte in seinem Leben von nun an keine Rolle mehr, er war frei. Hinzu kam noch die wunderbare Freundschaft mit Anneliese, die ihm half, wo sie nur konnte. Vor allem, wenn es darum ging, ihn irgendwohin zu bringen. In Bamberg selbst bewegte sich Dieter Martin traumwandlerisch sicher, dabei brauchte er keine Hilfe. Seine Einkäufe erledigte er meist allein, immer im selben Supermarkt, und in den kleinen Geschäften, beim Bäcker oder in der Metzgerei, gab es nette Verkäuferinnen, die er fragen konnte.
Wenn er Bamberg jedoch verlassen musste, etwa weil seine Einkäufe so speziell oder so umfangreich waren, dass er ein Auto brauchte, dann war Anneliese zur Stelle und gab den Chauffeur. Das machte sie sehr gern, denn sie hatte einen Narren an ihm gefressen. Wie groß und welcher Art dieser Narr war, konnte er nicht genau sagen. Aber ginge es nach ihm, wäre es ein sehr, sehr persönlicher Narr, denn er mochte Anneliese wirklich gern. Natürlich wusste er nicht, wie sie aussah, nur aus ihren Beschreibungen und nach dem zu urteilen, wie sie sich anfühlte. Aber das war ihm relativ egal. Er mochte ihre Art, ihre Stimme und insbesondere, wie sie mit ihm umging. Es war nur eine Freundschaft, doch mit Anneliese konnte sich der Siebenundzwanzigjährige durchaus eine sehr viel engere Beziehung vorstellen. Darüber würde er von sich aus aber niemals reden. Er hatte eine gewaltige Angst, dass die wunderschöne Freundschaft, die sie verband, dann den Bach runterginge, und das wollte er auf gar keinen Fall riskieren. Also akzeptierte er den Spatz in der Hand und verdrängte den Gedanken an die Taube auf dem Dach.
»Also was ist, großer Meister? Bist du dann so weit?«, erkundigte sich Anneliese. Es war mal wieder Montagabend. Er hatte frei, und es wurde Zeit fürs Tanzen.
Dieter Martin hatte zwei freie Abende in der Woche, die auch fest verplant waren. An einem gab er seine Darbietung als künstlerische Skulptur im Bamberger Hain, und der andere war reserviert fürs Tanzen mit Anneliese in Schwabthal.
»Ja, ich bin so weit, Anneliese«, meinte er lächelnd und erhob sich aus seinem Sessel. Er nahm den Beutel mit den Tanzschuhen und dem Wechselhemd und ging zur Wohnungstür, wo Anneliese schon mit einem warmen Lächeln auf ihn wartete. Sehen konnte er das natürlich nicht, aber fühlen, fühlen konnte er es sehr wohl.
Das Hotel Sonnenblick in Schwabthal, genauer gesagt die darin untergebrachte sogenannte Tanztenne, war ein ganz besonderer Ort. Der absonderliche Charme dieser speziellen Lokalität erschloss sich dem geneigten Besucher, wenn überhaupt, erst im ersten Stock des Hauses. Haben Sie Wahnvorstellungen? Erscheinen Ihnen die Geister Ihrer Ahnen? Vermuten Sie, illegale Drogen konsumiert zu haben? Nun, dann befinden Sie sich auf der Tanzfläche der Tenne in Schwabthal.
Wenn man es schaffte, aus den schlichten Hits der sechziger, siebziger, achtziger und immer häufiger auch neunziger Jahre musikalischen Honig zu saugen, wenn man sich auf seine Partnerin und die Bewegungen des zu vollführenden Tanzschrittes konzentrierte und, was im Grunde unabdingbar war, frühzeitig seine Augen schloss, konnte man sich mit ein bisschen gutem Willen dem sanften Schweben über die große Tanzfläche hingeben und für einige wenige Minuten in eine vergangene Welt, die der eigenen Jugend, eintauchen.
Aber dann kam irgendwann ganz verlässlich der Moment, in dem der oder die Alleinunterhalter auf der Bühne eine Pause einlegten und aufhörten, ihre Schlagerhymnen abzusondern. Entweder weil sie mussten oder weil sie einfach nicht mehr konnten. Denn die darbietenden Künstler in der Tenne in Schwabthal unterschieden sich in der Regel alterstechnisch nicht wesentlich von ihrem Publikum, was ein längeres Stehen hinter Keyboards oder goldornamentierten mahagonifarbenen Gitarren schlicht unmöglich machte. Auf gut Deutsch, unter Zuhilfenahme ihres Augenlichtes konnten die Besucher feststellen, dass sie sich zwar tanzend, aber dennoch mitten in einem Altersheim befanden.
Die für ihr hohes Alter zugegebenermaßen in Teilen noch recht fitte Belegschaft dieser Veranstaltung illustrierte auf anschauliche Weise den verzweifelten Versuch einer ganz bestimmten Altersschicht, vergangene Zeiten mit aller Gewalt aufrechterhalten zu wollen. Wie vergangen, dafür sprach die mitunter methuseale Lebensreife der anwesenden Gäste. So wurde der geschätzte Altersdurchschnitt an einem klassischen Samstagabend mit Gitti und Bert, Hans und Hannelore, Thomas und Traudl, oder wie die eingeladenen Musikanten auch immer hießen, von fünfundsiebzigjährigen Besuchern und Besucherinnen drastisch nach oben gezogen. Der eine oder andere tanzwütige Gast hatte sicher noch persönlichen Kontakt zu Goethe und Schiller gehabt oder war bei der letzten Kaiserkrönung dabei gewesen.
Dazu passte die schrille Innenausstattung der Räumlichkeiten, die an eine alpenländische Skidisco der frühen siebziger Jahre erinnerte. Wenn man seinen Blick von dem absurden Ambiente des riesigen Tanzsaales löste, sich auf einen Beobachtungsstatus zurückzog und den Besuch der Tanztenne als Milieustudie begriff, konnte es allerdings durchaus eine vergnügliche Zeit werden. Männer in den gereiftesten Jahren, die mit weit geöffnetem Hemd und goldenen Halsketten auf grauem Brusthaar durch die Gegend schlenderten, und Damen an der oberen Sterblichkeitsgrenze, die mit immensem kosmetischem Aufwand für einen Abend versuchten, Jugendlichkeit vorzutäuschen. Deutsche Gebrauchtwagenhändler, die an ihren Oldtimern Ähnliches probierten, kämen dank solcher Machenschaften ganz sicher in kürzester Zeit wegen Betruges in den Knast.
Nicht so die Gäste der Tanztenne in Schwabthal. Wer dort hinging, wollte betrogen werden. Wer dort das Tanzbein schwang und sich am fröhlichen Mumienschieben beteiligte, der wollte gar nicht wissen, was sich unter der teuren Perücke, dem vielschichtigen Make-up oder dem grauen, gekräuselten Goldkettenbrusthaar befindet. Der oder diejenige wollte nur noch einmal seinen respektive ihren Marktwert testen, den Gigolo, die Ballfee spielen. Noch einmal auf die Jagd gehen oder selbst gejagt werden. Was in der Regel auch gelang, da in diesem Alter die Beute keinen Baum mehr hinaufkam beziehungsweise plötzliche Fluchtambitionen in der nächstbesten Ambulanz endeten. Eine Win-win-Situation für einsame Greisenherzen.
Zwischen den ganzen rentenbezugsberechtigten Gigolos und Kurschattenjägerinnen gab es aber auch einige wenige Besucher jüngeren Alters, die es einfach nur wegen der raren Tanzmöglichkeiten nach Schwabthal verschlug. Einzelpersonen oder Paare, die sich dem sinnlichen Tanzerlebnis hingeben wollten und dabei geflissentlich in Kauf nahmen, ab und an einen altersschwachen Charmeur des anderen Geschlechts abweisen zu müssen, der oder die sich dank Schummerlicht oder grauem Star massiv in der Altersklasse vergriffen hatte. Kam man damit klar, hatte man in der Tenne im Hotel Sonnenblick seinen Spaß.
So auch Anneliese und Dieter. Beide tanzten für ihr Leben gern. Anneliese, weil sie hier aus der Gegend, nämlich aus Uetzing, stammte und damit praktisch mit dem Tanz in Schwabthal groß geworden war. Und Dieter Martin, weil ihn Anneliese eines Tages mit nach Schwabthal geschleift und ihm dort das Tanzen beigebracht hatte. So waren beide auf ihre Kosten gekommen. Anneliese hatte endlich einen festen Tanzpartner und Dieter eine wunderbar unverdächtige Gelegenheit, Anneliese im Arm halten zu dürfen. Das gewöhnungsbedürftige Ambiente in Schwabthal ging an Dieter Martin spurlos vorüber, denn er war ja blind. Im wahren Leben für die meisten eine massive Beeinträchtigung, für die Tenne in Schwabthal jedoch eine ideale Voraussetzung.
Bernd Schmitt versuchte seine neue Kollegin gerade in die ungeschriebenen Gesetze und maßgeblichen Unwägbarkeiten der Gemeinschaftskasse des Büros einzuweihen, als das Telefon an seinem Platz klingelte. Da sich die anderen inklusive Honeypenny auf die Bamberger Keller verzogen hatten, wurden alle Anrufe auf sein Telefon umgeleitet. Dass es also irgendwann auch mal klingeln würde, war zu erwarten gewesen, trotzdem fühlte er sich gestört, gab es für ihn doch gerade Wichtigeres zu tun, als sich um die kriminellen Problemchen der Außenwelt zu kümmern.
»Was gibt’s denn?«, bellte er mürrisch ins Telefon, in der vagen Hoffnung, eventuelle Banalitäten und Unwichtigkeiten auf diese Weise gleich wieder aus der Leitung hinausdrängen zu können.
Andrea Onello hörte nur mit halbem Ohr hin. Sie hatte fast ihren gesamten ersten offiziellen Arbeitstag damit verbracht, ihre Belustigung über Bernds Eifer zu unterdrücken. Der Versuch ihres Kollegen, ihr in möglichst körpernaher Art und Weise die Stellenbeschreibung der Kriminalbeamtin näherzubringen, war ziemlich durchsichtig und somit äußerst unterhaltsam gewesen. So ganz genau wusste sie nicht, was sie davon halten sollte. Aber da sie ja offensichtlich die erste Kollegin unter den Kriminalern in dieser Abteilung war, schob sie Lagerfelds Eifer auf sein bis dato vermutlich ungeordnetes Verhältnis weiblichen Neukommissarinnen gegenüber.
Jetzt zum Beispiel konnte sie beobachten, wie der seit dem Weggang der Kollegen ganz auf sie fixierte Bernd Schmitt sein Gesicht am Telefon zu einer leicht verstörten Grimasse verzog und verständnislos zu ihr herüberstarrte. Irgendetwas an diesem unliebsamen Telefonat schien ihn zu irritieren, denn urplötzlich winkte er ihr zu, hielt die rechte Hand zur akustischen Dämpfung auf den Hörer und flüsterte ihr zu: »Andrea, du kannst doch Italienisch, oder hab ich da was falsch verstanden?«
Diese Frage war ja wohl mehr als rhetorisch. Andrea Onello war fast zwanzig Jahre mit einem Italiener reinster Güte verheiratet gewesen, ein Umstand, der in der Dienststelle hinlänglich bekannt war. Selbstverständlich sprach sie Italienisch, und das sogar fast akzentfrei. Zusammen mit ihren Kindern war diese Sprachkenntnis so ziemlich das einzig Positive, was ihr die Beziehung gebracht hatte, wie sie sich schon sehr früh hatte eingestehen müssen.
Lagerfeld deutete mit einer dramatischen Geste auf das Telefon und formulierte mit den Lippen lautlos den Begriff »Italien«. Dann drückte er ihr ohne Umschweife den Telefonhörer in die Hand.
Verblüfft führte Andrea Onello ihn an ihr Ohr, allerdings mit dem dunklen Verdacht im Hinterkopf, dass der überschwängliche Kollege Schmitt womöglich eine Verarsche anlässlich ihres ersten Arbeitstages organisiert hatte. Schließlich hatte er ihr doch erst vor wenigen Minuten erklärt, dass er fast eine ganz andere berufliche Laufbahn eingeschlagen und Sprachen studiert hätte. Unter anderem könne er Englisch, Spanisch, Französisch und sogar Chinesisch, hatte er stolz verkündet und gleich ein paar durchaus authentisch klingende chinesische Sätze von sich gegeben. Und bei all dieser Sprachbegabung sollte der Gute ausgerechnet kein Italienisch können? Das kann er ja wohl bestenfalls seiner Katze erzählen, dachte sie misstrauisch, lag mit ihrer Vermutung allerdings knapp daneben. In diesem speziellen Fall war Lagerfeld ausnahmsweise einmal von jeglicher Schuld befreit. Er konnte tatsächlich kein Italienisch. Nicht, weil er es nicht zu lernen vermocht hätte, sondern weil er es ganz einfach nicht wollte.
In jungen Jahren, als er seinen Führerschein gerade frisch überreicht bekommen hatte, war er mit ein paar Kumpels voller Euphorie nach Italien gefahren, um an den sonnigen Meeresstränden der Adria auf Mädelsjagd zu gehen. Das Einzige jedoch, was gleich in der ersten Nacht erjagt worden war, war ihr Auto gewesen. Der klapprigeR4 verschwand über Nacht, genauso wie das darin befindliche Gepäck mit ihrem Geld, ihren Badesachen und den verschiedenfarbigen Kondomen. Somit hatten sie sich unverrichteter Dinge wieder auf den Heimweg machen müssen. Zwei fuhren mit dem Zug, zwei mussten mangels Geld trampen. Bernd Schmitt hatte sich also zwei Tage und Nächte lang über die Alpen geanhaltert und in diesen bitteren Stunden einen heiligen Eid geschworen. Erstens, das Land der Spaghetti nie mehr zu betreten, und zweitens, in diesem Leben, obwohl sprachbegabt, ganz gewiss nicht mehr deren Idiom zu erlernen. Vaffanculo, Italia! Aber das konnte Andrea Onello ja nicht wissen.
»Buongiorno«, flötete sie in die Muschel, in der Erwartung, sich eine völlig idiotische Geschichte in schlechtem Italienisch anhören zu müssen, die der Kollege Schmitt zu ihrer Erbauung in Auftrag gegeben hatte. Aber weit gefehlt. Ihr gänzlich unschuldiger und für den heutigen Tag anleitungsberechtigter Kollege konnte nun seinerseits feststellen, dass sich das Gesicht der hübschen neuen Kollegin langsam, aber konsequent zu verändern begann. Der spöttische Ausdruck in ihrem Antlitz wich ganz allmählich einem überraschten Interesse, das sich zu einer angespannten Ernsthaftigkeit wandelte. Dann begann Andrea Onello mit dem Anrufer zu reden.
Bass erstaunt bemerkte Lagerfeld, dass sich dieses Telefonat anhörte wie die intensive Verhandlung zweier südsizilianischer Fischhändler über den Preis einer exorbitanten Dorade. Die Frau sprach ein dermaßen authentisch klingendes Italienisch, dass Lagerfeld in seinem sturen Vorhaben, diese Sprache niemals zu lernen, gefährlich ins Wanken geriet.
Während sie sprach, griff sich Lagerfelds Kollegin einen Block sowie einen Kugelschreiber von Honeypennys Schreibtisch und begann, sich allerhand Notizen zu machen. Lagerfeld stellte sich neben sie, um zu sehen, was sie da so hektisch auf das Papier kritzelte, aber da Andrea Onello alles in der ihm so verhassten italienischen Sprache verfasste, verstand er kein Wort von ihrem Geschreibsel. Er würde das Ende des Telefonates abwarten müssen, um Näheres über den Inhalt dieses Auslandsgespräches zu erfahren.
Seine Geduld wurde nicht übermäßig strapaziert. Kurz nachdem er wieder auf seinem Stuhl Platz genommen hatte, beendete Andrea Onello das Gespräch und riss den Zettel mit ihren Notizen vom Block.
»Nicht schlecht«, sagte Lagerfeld anerkennend. Ein fremdsprachliches Kompliment, das bei seiner Neukollegin aber nur zu einem kurzen Aufblicken von ihrem Zettel führte. Dann folgte langes, konzentriertes Schweigen.
Als er die Warterei nicht länger aushielt, stellte Bernd Schmitt die drängende Frage. »Und?«, wollte er wissen.
Endlich reagierte der blonde Engel namens Andrea und setzte sich mit dem Zettel in der Hand zu Lagerfeld an dessen Schreibtisch. Sie schob ihm den Zettel mit den italienischen Notizen zu, lehnte sich in ihrem Bürostuhl zurück und verschränkte die Arme vor dem Bauch. »Sagt dir der Name Sophia Dinkel etwas?«, erkundigte sie sich mit nachdenklicher Miene.
Lagerfeld überlegte nur kurz, dann schaute er sie halb überrascht, halb fragend an. Natürlich sagte ihm dieser Name was. Jedem Franken sagte der Name etwas, wahrscheinlich sogar bundesweit. »Also, wenn du die Frau von unserem Muffinkönig oben in Kutzenberg meinst, dann ja. Die kenn ich natürlich. Die ist doch irgendwo im Mittelmeer beim Tauchen ertrunken oder so ähnlich. Stand letztes Jahr überall in den Zeitungen. Wieso fragst du?«
Andrea Onello antwortete mit einer Gegenfrage. »Hattet ihr da im Laufe der Ermittlungen Kontakt mit der italienischen Polizei? Mit der Kripo aus Porto Santo Stefano oder Orbetello?«
Lagerfeld überlegte, kam jedoch zu keinem wirklich befriedigenden Ergebnis. »Also ich meine, mich erinnern zu können, dass da welche angerufen hatten, aber nicht direkt aus Italien, sondern von Interpol. Meines Wissens hatte César damals mit denen zu tun. Richtige Ermittlungen waren das für uns aber nicht, die haben nur das heimatliche Umfeld der Vermissten abgecheckt. Die Frau war hochprominent, da machen die darum natürlich ein gewaltiges Buhei. Und ihr Mann, Siegfried Dinkel, hat letztes Jahr auch des Öfteren mit César gesprochen und sich nach dem Fortgang der Ermittlungen erkundigt, Genaueres weiß ich darüber allerdings nicht. Warum willst du das denn überhaupt wissen?« Neugierig geworden, schaute er Andrea Onello gespannt an. Da lag was Größeres in der Luft, das konnte er an ihrem Gesicht ablesen.
»Na ja, das eben war ein gewisser Federico Buffa von der Kriminalpolizei aus Porto Santo Stefano«, entgegnete sie. »Das ist die kleine Hafenstadt, von der aus Sophia Dinkel seinerzeit zu ihrem letzten Tauchgang aufgebrochen ist.«
»Ja, und weiter?« Lagerfeld wurde langsam richtig ungeduldig. Wenn es hier wirklich um die verschwundene Frau des reichsten Mannes in Franken ging, wurde es jetzt richtig interessant.
»Er hat mir erzählt, dass sie den Fall eigentlich in Kürze abschließen wollten, Sophia Dinkel wäre dann offiziell für tot erklärt worden. Vor ein paar Tagen rief ihn dann aber einer der Männer an, die damals mit ihr auf dem Boot waren.«
»Aha, und was wollte der?« Lagerfeld wurde immer gespannter, Andrea Onello für ihren Teil blieb ruhig und konzentriert.
»Das ist genau der Punkt. Das weiß keiner«, entgegnete sie mit einem intensiven Stirnrunzeln. »Dieser Luigi Sarone konnte nicht mehr mit Federico Buffa sprechen.«
Jetzt war es an Lagerfeld, nachdenklich zu werden, obwohl er schon ahnte, worauf Andreas Erläuterungen hinausliefen. »Weil?«, meinte er mit einer wissenden Dehnung seiner Frage.
»Weil Herr Sarone heute Nacht ebenfalls verschwunden ist. Als er am Morgen nicht nach Hause kam, hat erst die Polizei, dann die Küstenwache nach ihm gesucht und irgendwann seinen Kutter draußen auf dem Meer gefunden. Vom Besitzer keine Spur. Sarones Frau hat sich daraufhin bei Buffa gemeldet. Was genau passiert ist, konnte sie nicht sagen, aber sie war anscheinend davon überzeugt, dass ihrem Mann etwas sehr Unfreiwilliges zugestoßen ist, auch wenn sie dafür keine Beweise vorlegen konnte. Commissario Buffa will der Sache jedenfalls nachgehen, ehe er weitere Entscheidungen bezüglich der zu schließenden Akte trifft.«
»Aha«, rutschte es Lagerfeld etwas enttäuscht heraus. »Alles schön und gut, Andrea. Aber was hat das mit uns zu tun? Wieso hat Buffa uns angerufen? Ich meine, das Mittelmeer ist weit weg, und wir haben selbst genug Abgelebte, um die wir uns kümmern müssen.«
Lagerfeld kapierte Andreas Grübeln nicht so ganz. Das war eine Angelegenheit der Italiener, außerdem wollte er jetzt gern mit Andreas Unterweisung weitermachen. Nur war sein engagierter Schützling überhaupt nicht bereit, das Thema einfach so fallen zu lassen.
»Was das mit uns zu tun hat, Bernd? Na, zum Beispiel müssen wir jetzt zu Herrn Dinkel fahren und ihm mitteilen, dass seine Frau noch nicht für tot erklärt werden kann, weil sich im Zusammenhang mit ihrem Tauchunglück ein mögliches Verbrechen ereignet hat. Mag ja sein, dass sich in ein paar Tagen alles in Luft auflöst, aber erst einmal muss Siegfried Dinkel davon wissen. Das hat nämlich ziemliche Konsequenzen, Bernd. Eventuelle Lebensversicherungen werden nicht ausbezahlt, das Erbe kann womöglich nicht geregelt werden und so weiter. Außerdem hätte der Commissario nicht angerufen, wenn er nicht glauben würde, dass das Verschwinden dieses Bootsbesitzers eventuell etwas mit dem Vermisstenfall von Sophia Dinkel zu tun hat. Irgendwie hatte ich das Gefühl, Herr Buffa war ein wenig ratlos und könnte durchaus Hilfe gebrauchen.« Mit großer Entschlossenheit schaute sie ihm in die Augen.
Lagerfeld sah sie auch an, gleichzeitig aber nicht ein, dass Andrea recht haben könnte. Zwar rief die italienische Polizei nicht einfach so in Deutschland an, ohne begründete Verdachtsmomente zu haben. Schon klar. Aber musste man für einen eventuellen, vage nach Deutschland weisenden Mordfall in der Toskana hier die Pferde scheu machen? Sicher nicht. Da hatte Andrea unrecht. Bernd Schmitt hingegen hatte vor allem keine Lust auf Streit. Er hatte Lust auf etwas ganz anderes. Aber bitte, dann machte er es eben wie die Politiker. Er löste das Problem nicht, er vertagte es. »Okay, schön. Dann ist es wohl am besten, wir tragen das Ganze morgen früh dem Chef vor«, wich er aus. »Meiner Meinung nach muss Fidibus entscheiden, wie es in dieser Sache weitergehen soll. Oder was würdest du vorschlagen, wie wir zwei nun weiter verfahren?«
Ihm war die Unlust über diese italienische Angelegenheit deutlich anzusehen, genauso wie auch ein gewisses Maß an Ratlosigkeit. Internationale Verwicklungen waren nicht so wirklich sein Ding. Da verließ er sich lieber auf die juristische Fachkompetenz von Robert Suckfüll.
»Was wir beide jetzt machen sollen?«, meinte Andrea Onello lächelnd. »Ganz einfach, Bernd. Du zeigst mir die Frauentoilette in eurer bescheidenen Hütte, wenn’s recht ist. Nach diesem ganzen ausführlichen Einführungstermin müsste ich nämlich langsam mal wohin.«
Lagerfeld hob grinsend seinen Blick an die Decke. Na also, das Thema Italien war damit vorerst durch. Dann sah er wieder auf sein blondes Gegenüber und meinte mit einem schiefen Lächeln: »Na gut, aber auf eigene Gefahr, Andrea. Dieses Etablissement der körperlichen Erleichterung war bisher nämlich Honeypennys Privatgemach. Ich bin mir nicht sicher, wie sie es finden wird, diesen Bereich von nun an mit jemand anderem zu teilen.«
Andrea Onello lachte laut auf, dann erhob sie sich aus ihrem Stuhl und meinte mit theatralisch erhobenem Zeigefinger: »Und sollte sich die Hölle auftun, Bernd, und Marina Hoffmann als Untote aus dem Büroboden steigen, um mich an meinem hygienischen Vorhaben zu hindern, selbst dann werde ich mich nicht von meinem Toilettengang abbringen lassen, kapiert? Also, Eifersucht hin oder her– wo kann ich mich jetzt entleeren?«
Mit der Anmutung eines biblischen Racheengels stand sie da und schaute Lagerfeld an. Der kam aus dem Grinsen gar nicht mehr heraus. Na, das konnte ja was werden mit dieser Frau, langweilig war sie auf jeden Fall nicht. »Dort drüben, rechte Tür«, meinte er feixend und deutete mit dem Daumen in die angegebene Richtung.
»Danke«, bekam er knapp von seiner neuen Kollegin zu hören, dann war Andrea Onello in Richtung weibliches Örtchen verschwunden.
Federico Buffa war noch nicht lange bei der Polizei, genauer gesagt bei der Polizia di Stato in Orbetello. Streng genommen war seine Polizeieinheit für so kleine Nester wie Orbetello oder Porto Santo Stefano gar nicht zuständig. Aber weil diese durchgeknallte deutsche Superreiche beschlossen hatte, sich an der toskanischen Küste vom Leben zu verabschieden, hatte man ihn von Florenz hierhergeschickt, um die Sache polizeilich wasserdicht zu verabschieden. Ein klassischer Unfall, aber das konnte man wegen des großen öffentlichen Interesses nicht einfach den Carabinieri überlassen, da musste schon jemand von der Polizia di Stato her, um dem Ablauf die nötige Ernsthaftigkeit zu verleihen.
Eine lächerliche Woche noch, dann hätte er diese verdammte Akte schließen und nach Hause fahren können. Aber dann hatte Luigi Sarone angerufen und war kurz darauf verschwunden. Die Carabinieri fanden sein leeres Boot draußen auf dem offenen Meer. An genau derselben Stelle, an der Sophia Dinkel im vergangenen Sommer ertrunken war, hatte Luigi heute Nacht geankert. Und nun war auch er verschwunden. Seine Frau hatte etwas von einem gut bezahlten Nachttauchgang gefaselt, dann war sie in Tränen ausgebrochen, um ihm schließlich mit verheulten Augen ihren diffusen Verdacht aufzutischen.
Normalerweise hätte er ihre Behauptung mit dem Schock und dem Schmerz des plötzlichen Verlustes erklärt. Auf einmal war sie allein in dieser Welt, allein mit ihrem sechsjährigen Sohn. Aber Alice Sarone machte nicht den Eindruck, als würde sie besonders impulsiv handeln, ganz und gar nicht. Natürlich hatte die Dreißigjährige unter Schock gestanden, aber trotz ihrer Tränen wirkte sie recht gefasst. Das war keine emotionale Phantastin. Als sie ihm sagte, dass ihr Mann ganz sicher nicht aus freien Stücken verschwunden war, hatte sie ihm fest in die Augen geschaut. Noch einmal hatte sie ruhig ihre Behauptung wiederholt, dann war sie aufgestanden und einfach gegangen.
Seither dachte er unablässig über den Fall nach und fragte sich, wo genau die Verbindung liegen mochte. Es wäre bequemer für ihn, die neuen Vorkommnisse um Luigi Sarone zu ignorieren, den Fall Sophia Dinkel abzuschließen und endlich wieder in sein geliebtes Firenze zurückzukehren. Aber Federico Buffa war Polizist aus Leidenschaft. Wenn es ihm nicht gelang, diesen Fall sauber abzuarbeiten, würde er sich das nie verzeihen. Also hatte er sicherheitshalber schon mal die deutschen Behörden informiert, dass sich die Sache noch ein wenig hinziehen konnte. Ein erstaunlich gutes Italienisch hatte diese Deutsche am anderen Ende der Leitung gesprochen. Wahrscheinlich waren ihre Eltern ausgewanderte Italiener, davon sollte es bei den Kartoffelessern ja etliche geben.