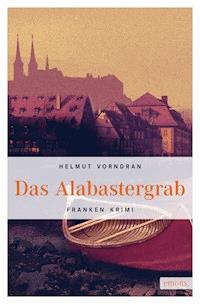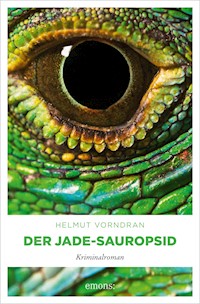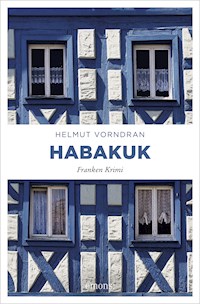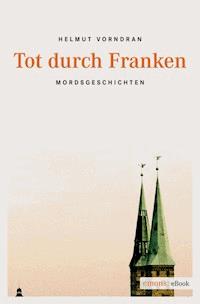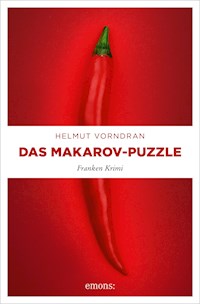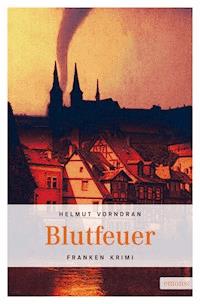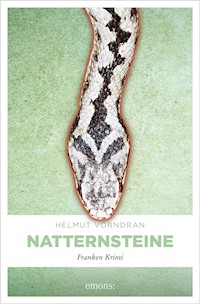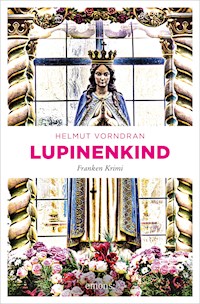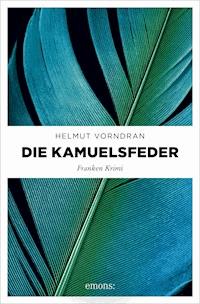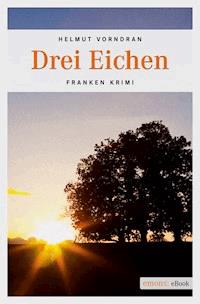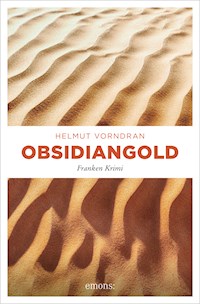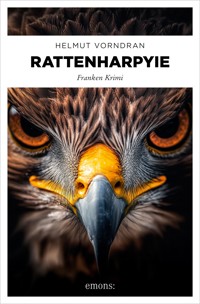Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Franken Krimi
- Sprache: Deutsch
Beststellerautor Helmut Vorndran in Höchstform. Zwischen Bamberg und Coburg verschwinden Menschen und tauchen plötzlich an den unterschiedlichsten Orten wieder auf. Zum Beispiel an fremden Stränden in der Südsee – allerdings nicht im Originalzustand. Dann gibt es die ersten Toten, und die Bamberger Polizei nimmt fieberhaft die Spuren auf. Unter der tätigen Mithilfe von Ermittlerferkel Presssack versuchen die Kommissare Haderlein, Lagerfeld und Neukommissarin Kira Sünkel einem wahnsinnigen Mörder Einhalt zu gebieten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 569
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Helmut Vorndran, geboren 1961 in Bad Neustadt/Saale, lebt mehrere Leben: als Kabarettist, Unternehmer und Buchautor. Als überzeugter Franke hat er seinen Lebensmittelpunkt im oberfränkischen Bamberger Land und arbeitet als freier Autor unter anderem für Antenne Bayern und das Bayerische Fernsehen. www.helmutvorndran.de
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2024 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: stock.adobe.com/Roberto Schettler
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Marit Obsen
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-98707-214-7
Franken Krimi
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß §44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Der Mensch hat eine Doppelnatur. Er ist zum Guten begabt, aber er kann auch wie kein anderer Teil der Schöpfung Fürchterliches anrichten.
Prolog
Da hingen sie. Kalt, nackt, am Ende ihres Daseins angelangt. Fast zärtlich strich er mit der Hand über die rasierten Körper, die jetzt einem höheren Zweck dienen würden. Am Boden der halb leere Eimer, mit dem er das Blut aufgefangen hatte, um seine Botschaft auf ihren Leibern zu verewigen. Sie waren seine Fahnen, die er in den Gegenwind dieses Landes hängen würde, um diese Schafe dort draußen endlich zu erwecken. Dafür brauchte er ein starkes Zeichen, eines, das keiner übersehen konnte.
Teil 1
Das Schweigen der Schafe
Homestory
Von der Plötzlichkeit seiner Beförderung einmal abgesehen, lief im Leben von Philipp Schultheiß alles bestens. Nachdem der bisherige Vorstandsvorsitzende der Firma Brosst Mechatronics vor einigen Monaten völlig unerwartet hingeschmissen hatte, war er als Vizechef des Coburger Unternehmens innerhalb weniger Tage zum neuen CEO auserkoren worden. Offiziell übte er das neue Amt zwar nur übergangsweise aus, aber es wäre ja nicht das erste Mal, dass ein Interimstrainer viel länger blieb, als es der ursprüngliche Plan des Vereinsvorstandes vorsah. Und er würde alles dafür tun, dass aus der Zwischenlösung ein »Solidus«, also eine dauerhafte Angelegenheit, bei Brosst wurde. Dazu hatte er in der Kürze seiner bisherigen Amtszeit schon einige zentrale Weichen in der Firma gestellt. Für weniger Filz in der Verwaltung beispielsweise und eine Rückbesinnung auf die Kernkompetenzen der Firma Brosst mit ihren rund zweiunddreißigtausend Mitarbeitern.
Andererseits war er auch ein großer Verfechter von neuen, modernen Wegen. Wer zu spät kam, den bestrafte das Leben. Dieser alte Spruch von Gorbatschow hatte für ihn absolute Gültigkeit, und zwar in jeder Lebenslage. Das hieß für die Firma Brosst: Innovation, Innovation und noch einmal Innovation. Seine Vorbilder waren Firmen wie Apple oder Tesla, die lieber hin und wieder ein paar Millionen in den Sand setzten, als sich von der Technologieführerschaft zu verabschieden. An diese eher progressive Unternehmensausrichtung würden sich jetzt einige gewöhnen müssen, auch die graue Eminenz des Unternehmens, Seine Heiligkeit Michael Brosst persönlich. Der hatte ihn ja letzten Endes auf den Sessel gehievt, auf dem er jetzt saß. Obgleich Michael Brosst, der ihn und seine nach vorne gewandten, manchmal fast radikal zu nennenden Einstellungen ja ziemlich genau kannte, seine progressiven Vorstellungen hinsichtlich der Unternehmensstrategie nicht immer teilte. So zumindest war das aus den diversen Vorgesprächen im Vorstand herauszuhören gewesen, an denen sich der dunkle Herrscher der Firma Brosst natürlich ebenfalls beteiligt hatte. Dunkler Herrscher deshalb, weil der größte und wichtigste Gesellschafter der Firma, die sich komplett im Privatbesitz der Familie Brosst befand, ebenjener Michael Brosst war. Allerdings war Philipp Schultheiß ein mindestens genauso großer Sturkopf wie der alte, mächtige Patriarch – was aus seiner Sicht über kurz oder lang zu einem Hahnenkampf an der Spitze des Unternehmens führen könnte, es wäre ja nun wirklich nicht das erste Mal.
Aber Philipp Schultheiß war nicht gewillt, das Schicksal seiner Amtsvorgänger einfach so zu teilen. Michael Brosst hatte ihn sicher nicht grundlos zum CEO von Brosst Mechatronics gemacht, auch wenn er seine aus Sicht des Patriarchen teils hochriskanten Pläne und Vorhaben nicht vollumfänglich goutierte. Irgendetwas würde er sich dabei schon gedacht haben.
Das war vor einem knappen Dreivierteljahr gewesen, die ersten Duftmarken hatte Philipp Schultheiß bereits gesetzt, jetzt wurde es Zeit, sich einmal um sein Image als CEO zu kümmern. Und zwar in Form einer Homestory über ihn und die Firma Brosst. Auch wenn viele Ältere seiner Zunft noch meinten, die Arbeit eines Managers solle für sich selbst sprechen und dass allein die Zahlen am Ende eines Geschäftsjahres geeignet waren, die eigene Karriere zu befördern, hielt er es eher mit den Vertretern seiner eigenen Generation, die die Unabdingbarkeit der modernen Medien für den beruflichen Erfolg kannten und auch nutzten. »Tu Gutes und rede darüber« war eine alte Binsenweisheit, die in der heutigen Zeit durchaus Bestand hatte und sich hauptsächlich in Fernsehen, YouTube und Social Media abspielte.
Darum saß er jetzt hier in seiner Wohnung in Coburg inmitten von Kameras samt dazugehöriger Technik. Ein kompletter Vormittag würde laut dem Produktionsleiter der Firma »New Media« für die Aufnahmen und Interviews draufgehen, darauf müsse er sich schon einmal einstellen, hatte man ihm gesagt. Immerhin sollte das ja kein einfacher YouTube-Clip werden, sondern eine professionelle Homestory, die auch höchsten medialen Ansprüchen genügte. Gerade bereitete das Filmteam die Aufnahmen in der Küche vor, nachdem schon sein Büro und der Wohnbereich ausführlich unter die Lupe genommen worden waren. Hier, im Allerheiligsten ihrer Beziehung, sollte gleich ein gemeinsames Interview der beiden Hausbewohner aufgenommen werden, was bei Jeanette, seiner Freundin, wenig Begeisterung auslöste. War die Küche für sie doch mindestens ein ebensolcher Intimbereich wie das Schlafzimmer. Aber da mussten sie jetzt durch, ob Jeanette das nun passte oder nicht.
Ergeben betrachtete Philipp Schultheiß die drei Kameras auf ihren Stativen sowie die Unmenge an sonstiger Technik, welche die Filmleute um ihn herum aufbauten. Das eigentliche Gespräch mit dem Aufnahmeleiter würde nur wenige Minuten dauern, das ganze technische Brimborium drum herum, vor allem bei einem Ortswechsel, verbrauchte ein Vielfaches davon. Seufzend schlug er die Beine übereinander, faltete seine Hände und harrte geduldig der Dinge, die da kommen sollten.
Der Balkon war endlich fertig, das hieß für sie im Umkehrschluss, es war Zeit für den ersten Topf auf dem Geländer. Sie stammte vom Land, aus einem kleinen Kaff in der thüringischen Pampa südlich von Heldburg. Dort war sie aufgewachsen. Idyllisch, abgeschieden, inmitten von Feld, Wald und Wiesen. Und wenn sie etwas an der ländlichen Umgebung geliebt hatte, dann den Duft von Blumen und Kräutern, den die Wiesen verströmten, wenn man im Sommer aus dem Haus ging. Das war auch so ziemlich alles, was sie sich aus ihrer Jugend in Lindenau hierherwünschte und nun Wirklichkeit werden lassen wollte.
Sie stellte den ersten großen Topf, in dem eine Mischung aus Klatschmohn und Kornblumen um einen Platz an der Sonne konkurrierte, direkt vor sich auf das Geländer. Das allein machte noch kein komplettes Landleben, aber immerhin würde es schon bald danach riechen. Sie hatte jetzt schließlich Zeit und konnte es sich leisten, ihr neues Balkongeländer in eine thüringische Wiese zu verwandeln. Unverhofft kam oft, in ihrem Falle in einem extrem positiven Sinne.
Lächelnd zupfte und zog sie an den Kornblumen herum, bis ihr das Stillleben einigermaßen gefiel. Hinter den Bamberger Hügeln war gerade die Sonne untergegangen, aber aus der Wohnung drang noch genug Schummerlicht nach draußen, sodass sie alles gut erkennen konnte.
Sie trat einen Schritt zurück, um den ersten Topfbaustein ihrer Balkonwiese zu betrachten, als sich ein kräftiger Männerarm um ihren Hals legte. Lena Glemm war nicht in der Lage, sich auch nur im Geringsten zu wehren, so schnell passierte das. Jemand musste sich von hinten an sie herangeschlichen haben, ohne dass sie etwas gehört hatte, zerrte sie nach hinten und holte sie fast von den Beinen. Erschrocken versuchte sie mit beiden Händen, den eisenharten Griff von ihrem Hals zu lösen, jedoch vergeblich. Sie wollte schreien, aber der Arm drückte auf ihre Luftröhre, sodass nur ein Gurgeln ertönte. Rücklings wurde sie durch die offene Balkontür in das diffuse Halbdunkel ihrer Dachgeschosswohnung gezogen. Dann presste ihr Angreifer einen Lappen auf ihr Gesicht, der penetrant nach einer süßlichen Chemikalie roch. Ihre Atemluft wurde langsam knapp, und für einen kurzen Moment löste sich der Druck um ihren Hals, sodass sie nicht anders konnte, als das übel riechende Zeug in dem Lappen einzuatmen. Hilflos zappelte sie noch ein wenig herum, verzweifelt bemüht, Arm und Lappen von ihrem Hals und dem Gesicht zu entfernen. Die verbrauchte Luft in ihren Lungen brannte wie Feuer, und sie gierte nach Sauerstoff. Ihr Kopf schien schier zu zerspringen, und schwarze Flecken tauchten vor ihren Augen auf. Noch einmal schnappte sie mit weit aufgerissenen Augen nach Luft, dann verlor sie endgültig das Bewusstsein.
Man hatte es nicht leicht heutzutage, wenn die Herausforderung darin bestand, im goldenen Handwerk den Nachwuchs auszubilden. Die größte aller Aufgaben bestand nämlich zuallererst einmal darin, überhaupt einen Lehrling zu finden, der das Dachdeckerhandwerk erlernen wollte. Die Traumberufe der heutigen jungen Generation waren ja eher »Youtuber« oder »Gewinner irgendeiner Castingshow«. Ein Freiluftberuf mit körperlicher Anstrengung, das war bei den meisten Schulabgängern so ziemlich out. Und wenn es dann doch mal einer wagte, sich diesem Berufsziel zu widmen, konnte man als Ausbilder nicht zwingend davon ausgehen, dass der neue Schützling beispielsweise die Grundrechenarten beherrschte.
»Ey, chill erst mal, Alter«, so die typische genervte Antwort etwa auf die Frage, was denn das Ergebnis der Multiplikationsaufgabe sieben mal zwölf sei. So ähnlich war es auch heute gewesen, als Dachdeckermeister Emil Kotschenreuther seinem jüngsten Untergebenen in grenzenloser Naivität eine scheinbar einfache Aufgabe übertragen hatte. Weshalb er nun auf dem halb fertigen Dachstuhl seiner Baustelle saß, den Kopf in den Händen vergraben, und intensiv damit beschäftigt war, sein Nervenkostüm mit letzter Kraft im grünen Bereich zu halten. Ihm gegenüber, ebenfalls auf einem freigelegten Balken der Kirche sitzend, sein Auszubildender im ersten Lehrjahr Max Fabian.
Kotschenreuther hatte keine Ahnung, was so schwer daran war, eine Dachlatte auf die benötigte Länge, in diesem Fall 2,79 Meter, zu kürzen. Für seinen Stift Max war dies anscheinend eine intellektuelle Herkulesaufgabe, denn von den drei Dachlatten, die er mitgebracht hatte, wies keine die geforderte Länge auf, nicht einmal annähernd. Max’ Begründung dieses Sachverhalts: Ohne Handy könne er das nicht, da sei eine Taschenrechner-App drauf, und die bräuchte er, um die Länge der Latte auszurechnen.
Dachdeckermeister Kotschenreuther fasste es nicht. Das Ende war nah, dieses Land stand am Abgrund, endgültig. Wie sollte die Republik noch gerettet werden, wenn sich in der sogenannten »Generation Z« solche Abgründe auftaten? Aber vielleicht war er auch einfach nur zu streng, womöglich vertrug Max die hohen Temperaturen auf dem Dach nicht, oder Kotschenreuther durfte nicht einfach eins zu eins die Maßstäbe anlegen, die er aus seiner eigenen Ausbildungszeit kannte, so zumindest die Argumentation seiner Frau zu diesem Thema. Wahrscheinlich war die Fähigkeit, eine einfache Dreisatzrechnung zu lösen, heutzutage nicht mehr als Standard vorauszusetzen. Den Dreisatz brauchte man ja auch nicht, um ein Handy einzuschalten und sich auf TikTok auszutoben.
Emil Kotschenreuther knetete zur Beruhigung mit Daumen und Zeigefinger seine Nasenwurzel und beschloss, es einmal mit möglichst viel Verständnis und Einfühlungsvermögen zu probieren, ganz so, wie seine Frau es ihm nahegelegt hatte. Aber das war hier auf dem Dach unmöglich, dafür hatte er jetzt wirklich nicht die Nerven, dazu brauchte es einen sicheren Standort und eine entspannte Atmosphäre. Zumal die tägliche Sonneneinstrahlung inzwischen ein unerträgliches Maß angenommen hatte, was auch bei ihm das Denken erschwerte. Immerhin war es gerade mal Anfang Juni, Pfingsten, und die Höchsttemperaturen lagen bereits bei fünfunddreißig Grad im Schatten. Wenn das so weiterginge, würde im Bundesland Franken der Wasserverbrauch reguliert werden müssen, so zumindest die ersten Warnungen der Regierung.
»Max, mir machen etzerd erschd amal Brodzeid«, eröffnete der erfahrene Dachdecker seinem hocherfreuten Lehrling, was beide umgehend dazu veranlasste, ihren luftigen Arbeitsplatz zu verlassen und sich nach unten zum Kleinlaster der Dachdeckerfirma zu begeben. Dass sie gerade mal eine knappe Stunde gearbeitet hatten, schien den neuen Auszubildenden nicht im Geringsten zu verwundern oder gar zu stören. Der wurde zwar bald achtzehn, konnte aber definitiv besser essen als kopfrechnen. Immerhin war Max Fabian absolut schwindelfrei, und Konditionsschwächen schien er auch nicht zu kennen. Den konnte man den ganzen Tag aufs Dach und wieder runterscheuchen, ohne dass es ihm etwas ausmachte. Nur war der berufliche Mehrwert dieser körperlichen Leistungsfähigkeit natürlich extrem beschränkt, wenn der Junge nicht verstand, was er an seinem jeweiligen Ankunftsort eigentlich machen sollte. Dass Kotschenreuthers Auszubildender aufgrund seines durch schulische Ehrenrunden bedingten Alters bereits im Besitz eines Führerscheins auf Probe war, der ihn zum Fahren des Betriebsfahrzeuges ermächtigte – zumindest, wenn sein Chef danebensaß –, machte die Sache auch nicht besser.
In der Kabine des Lasters angekommen, packte erst einmal jeder seine mitgebrachten Delikatessen aus, und kurz darauf waren nur noch die üblichen Geräusche zu hören, die Männer eben so machten, wenn sie Leberkäsebrötchen mit Mezzo Mix ihrer Verdauung zuführten. Als die erste Charge des Brotzeitklassikers aus der nahe gelegenen Metzgerei vertilgt war, ging der Dachdeckermeister mit Bedacht, aber zielstrebig zum Angriff über. Er hatte sich jetzt ein Brötchen lang überlegt, wie er dem Dreisatzproblem seines Lehrlings beikommen konnte, und sich einen Plan zurechtgelegt. Wenn es mit Dachlatten nicht funktionierte, dann vielleicht mit etwas anderem. Etwas, womit Max mehr anfangen konnte.
»Also, Max, was habt ihr denn zuletzt in der Berufsschul in Bamberch für Fächer kabt? Rechnen, Holzkunde oder Werkstatt?«, erkundigte sich Kotschenreuther freundlich. Leider lag er mit seiner Fächeraufzählung schon einmal daneben.
»Na, Sozialkunde und Religion«, entgegnete sein Lehrling kauend, was Kotschenreuther vor eine schier unlösbare Aufgabe stellte. Religion? Wie sollte er denn vom Fach Religion die Kurve hin zur Dreisatzrechnung kriegen?
»Sozialkunde und Religion, aha, und um was ging’s dann da?«, fragte er ein wenig hilflos nach.
»Hexen«, antwortete Max Fabian knapp, während er sich gierig den letzten Rest seines zweiten Leberkäsbrötchens in den Mund schob, um dann mit Limonade nachzuspülen.
»Hexen«, repetierte Emil Kotschenreuther und starrte auf sein eigenes Leberkäsbrötchen, das immer noch geduldig der morgendlichen Verspeisung harrte.
»Ja, Hexen. Nirchendwo sonst sin so viel Hexen verbrannt worn wie in Bamberch, da warn mir Bambercher richtich gud. Inderessand war vor allem, dass die mid dem Verbrenna aach deswechen aufkört ham, weil des Brennholz, mit dem die da gschürt ham, irchendwann zu deuer worn is. Des hat den Bischof nachherd doch irchendwie gereuth. So is übrichens ach der Name vo dem Bambercher Stadtteil entstanden. Gereuth.« Breit grinste Max Fabian seinen Lehrherrn an. Das Thema schien ihm in der Schule tatsächlich gefallen zu haben. Dann schickte er sich an, auch noch ein drittes Leberkäsbrötchen aus seiner Alufolienverpackung zu befreien.
Es dauerte einen Moment, bis bei Kotschenreuther der Groschen gefallen war. Der Geist seines Auszubildenden war eindeutig von eher schlichter Machart, trotzdem wohnte ihm eine Art Bauernschläue inne. Den Kerl brauchte man nicht anzugiften, den musste man einfach nur in die richtige Richtung schubsen.
»Also gud, Max, wenn du dich mit Hexen so gud auskenna dusd, dann rechnen mir halt mit Hexen weider, vielleicht dusd du dir nacherd leichder«, erklärte Kotschenreuther mit einem aufmunternden Lächeln und holte vom Rücksitz des Kleinlasters den DIN-A4-Block, auf dem er immer seine Bauskizzen anzufertigen pflegte. »Folgende Aufgabe. Um eine Hexe zu verbrennen, braucht es, sagen wir mal, drei Ster Holz. Du hast etzerd vom Bambercher Bischof den Auftrach gegrichd, so viel Hexen zu verbrenna wie möglich. Dafür gibd dir der Bischof sechs Ster Holz. Wie viel Hexen zum Verbrenna gibt des?« Erwartungsvoll schaute er seinen Lehrling an, der tatsächlich wie aus der Pistole geschossen antwortete.
»Zwaa«, antwortete Fabian, ehe er in sein letztes Brötchen biss.
Kotschenreuther war versucht, lauthals zu jubeln, verkniff sich aber vorsichtshalber jegliche Begeisterung, schließlich wollte er Max’ neu entdeckte Leidenschaft für das Kopfrechnen nicht stören. Das war tatsächlich richtig, er war auf dem richtigen Weg. Der Dachdeckermeister beschloss, die mathematischen Daumenschrauben gleich mal ein wenig anzuziehen.
»Gud, sehr gud, Max. Am nächsten Dooch sollst du des Gleiche wieder machen, nur had der Bischof dir diesmal sehr viel mehr Holz besorchd, nämlich achtzehn Ster. Wie viel Hexen kannsd du also mit achtzehn Ster Holz verbrenna, Max?« Gespannt wie eine Klavierseite beobachtete er seinen kauenden Auszubildenden, der diesmal etwas länger für den Lösungsweg benötigte, schlussendlich aber trotzdem durchs Ziel gelaufen kam.
»Sechs Hexen?«, fragte er zweifelnd.
»Jawoll, Max, super, des is richtich!«, rief Emil Kotschenreuther begeistert und schlug seinem Lehrbuben so fest auf die Schulter, dass dem fast das Brötchen aus dem Mund gefallen wäre. Vorwurfsvoll schaute er seinen Meister an, der sich aber bereits wieder im Dreisatzmodus befand und neue Aufgaben ersann, um die Grenzen seines Schützlings auszutesten. Es war jetzt genug der Hexerei, er musste Max rechentechnisch in die reale Welt hinüberlocken, um irgendwann, irgendwie bei den harten Fakten, sprich: den Dachlatten zu landen. Im Zuge dieser Überlegungen fiel Emil Kotschenreuthers Blick auf ein Wahlplakat, das nur wenige Meter entfernt an einem Laternenpfahl hing. Die Landtagswahl in Franken war zwar bald ein Jahr her, aber der Kandidat der blauen Partei aus dem Wahlkreis Haßberge hatte es immer noch nicht geschafft, seine Plakate abzuhängen. War wahrscheinlich auch ein bisschen zu viel verlangt, wenn man fast im Knast gelandet wäre. Na, jedenfalls bot sich so eine wunderbare Möglichkeit, den Bogen vom Mittelalter in die Gegenwart zu schlagen. »Siehst du den da, Max?«, fragte er fast beiläufig und deutete auf das HfD-Wahlplakat.
Sein Stift nickte. »Glar, des is der Daniel Lumumba von der HfD, der Hoffnung für Deutschland, der ausm fränkischen Landdach … warum?«
»Na ja, jetzt vergiss mal des mit die Hexen, des is ja alles scho viel zu lang her. In der heutigen Zeit kann mer ja auch lustigere Sachen verbrennen. Mir ersetzen jetzt einfach die Hexen durch HfDler, des is ja auch viel wirklichkeitsnäher. Also, Max, wie viel Ster Holz brauchst du, um sechs HfDler zu verbrennen?«
Max Fabian glotzte seinen Meister an wie ein Häschen, wenn’s blitzt, aber dann fand er doch relativ zügig den Weg vom Mittelalter in die Gegenwart.
»Na … widder achtzehn. Des is ja wohl wurschd, ob ich a Hexe oder an HfDler verbrenn, oder?«, entgegnete er im Brustton der Überzeugung.
Der Dachdeckermeister lächelte seinen Lehrbuben stolz an. »Des stimmt, Max, des is im Prinzip egal. Nur dass die Hexen damals unschuldig warn«, schob er süffisant nach. »Aber egal, so weit, so gut. Im nächsten Schritt muss mer nur noch die Ster Holz durch die Dachfläche und die Lumumbas durch Dachlatten ersetzen, dann hammer’s. Aber heut nimmer, des mache mer morchen, Max. So, und etzerd geht’s widder aufs Dach, die Ladden schneid ich dir heut noch amal.«
Sprach’s und warf seinem Auszubildenden einen auffordernden Blick zu, woraufhin dieser sich mit sanfter Gewalt seinen restlichen Leberkäsweck in den Mund stopfte und dem Meister nach draußen folgte.
Die Aufnahmen in der Küche waren beendet, was Jeanette Kasiske umgehend dazu nutzte, sich von dem Trubel in ihrer Küche zu entfernen und ins Schlafzimmer im ersten Stock zu flüchten. Sie stand nicht gern im Mittelpunkt des Interesses. Dass sie dieses Schicksal nun auch noch mit ihrer heiß geliebten Küche teilte, machte die Sache nicht besser. Sie war gespannt, was Philipp sich einfallen lassen würde, um sie für den ganzen Stress, der ja nur aufgrund seiner Karriereabsichten entstanden war, irgendwie zu entschädigen. Ein gemeiner Blumenstrauß reichte da jedenfalls nicht, so viel stand fest.
»Alles in Ordnung, Schatz?«, hörte sie ihn da auf einmal fragen. Als Jeanette sich umdrehte, stand ihr Freund im Türrahmen und schaute sie besorgt an. Sie kannten sich ja erst ein paar Monate, da war noch nicht jedes Detail in ihrer Beziehung erforscht und ausgelotet. Er hatte diese Homestory unbedingt gewollt, wusste aber nicht, ob Jeanette ihm das Ganze nicht doch nachhaltig krummnehmen würde. Die war im Moment allerdings einfach nur erleichtert, dass ihr Part in der Geschichte vorbei war.
»Ja, alles in Ordnung«, antwortete sie knapp, was ihren Freund dazu veranlasste, sicherheitshalber das Ende der Filmarbeiten im Haus anzukündigen.
»Ich gehe davon aus, dass die Hauptarbeit jetzt getan ist, Schatz. Wir machen noch ein letztes Interview vor dem Haus, dann ist der ganze Spuk vorbei, versprochen.«
»Verschwinde einfach«, meinte Jeanette Kasiske lachend und warf ein Kopfkissen nach ihrem Supermanager. »Aber wenn du mit deinem Chef fertig bist, erwarte ich dich hier in diesem Zimmer zur Wiedergutmachung, verstanden?«, ergänzte sie mit einem Funkeln in den Augen und ergriff drohend das nächste Kissen.
»Verstanden!«, bestätigte Philipp Schultheiß mit gespielter Furcht, dann schaute er sie mit einem seltsamen Ausdruck in den Augen an. »Du weißt, die Arbeit ist mir heilig, Jeanette. Aber was immer auch passiert, du musst wissen, dass ich dich wirklich liebe. Zweifle niemals daran.« Ein schmales Lächeln huschte über sein Gesicht. Dann wandte er sich um und eilte die Treppe hinunter, um sich um die Filmcrew und deren finale Aufnahme zu kümmern. Jeanette grübelte noch kurz über seine Worte nach, dann sammelte sie das geworfene Kissen wieder ein.
Noch ungefähr eine halbe Stunde lang konnte Jeanette Kasiske Stimmen draußen vor dem Haus und im Erdgeschoss der Wohnung vernehmen, dann fiel die Haustür ins Schloss, und es herrschte Stille, endlich. Seit unzähligen Stunden war endlich wieder Ruhe in ihrem Heim hoch oben am Festungsberg in Coburg. Eine Ruhe, die die Hausherrin jetzt ausgiebig genießen würde.
In der Dienststelle der Bamberger Kriminalpolizei herrschte geschäftiges Treiben, was nicht nur dem gewöhnlichen Arbeitsaufkommen geschuldet war. Oder vielleicht doch, denn nur in dieser Dienststelle pflegte man sich bei Dienstantritt mit frisch geschmierten Honigbroten zu verlustieren, welche die propere blonde Dienststellensekretärin Marina Hoffmann alias »Honeypenny« herzustellen pflegte.
Einer der hier beschäftigten Honigbrotesser, Kriminalkommissar Bernd Schmitt alias »Lagerfeld«, tat für seinen Teil das, was alle anderen Kollegen auch taten – auf seinem Honigbrot herumkauen, welches er schluckweise mit Marinas Kaffee abrundete. Außerdem beteiligte er sich am momentanen Dienststellen- und Stadtgespräch, nämlich der Auszählung der Stimmen nach der Abstimmung in Franken zum Wasserverbrauch. Sämtliche Bürger des noch jungen Bundeslandes waren dazu aufgerufen gewesen, darüber zu entscheiden, wie das knappe Wasser in Stadt und Land künftig verteilt werden sollte. Genauer gesagt, wo demnächst als Erstes das Wasser abgestellt werden musste, wenn es mit dieser außergewöhnlichen Hitze und dazugehörigen Trockenheitsphase so weiterging.
Abgesehen von der Wasserknappheit waren die steigenden Temperaturen mit beständigen dreißig Grad im Büro der Beamten größte Sorge. Das wurde irgendwann jedem zu viel. Im Urlaub gerne, aber nicht bei der Verbrechensbekämpfung in der kriminalpolizeilichen Dienststelle. Dreißig Grad am Meer und dreißig Grad am Schreibtisch waren nämlich zwei völlig unterschiedliche Dinge.
So diskutierten die Bamberger Kriminologen, Lagerfeld eingeschlossen, ebenso engagiert darüber wie ganz Franken. Die Diskussion war aber nur das sehr vordergründige Tun, sein eigentliches Augenmerk lag neuerdings ganz woanders, nämlich auf der neuen Kollegin Kira Sünkel beziehungsweise dem Ansinnen, sein sehr spezielles Interesse an besagter Dame möglichst nicht offenbar werden zu lassen. Er praktizierte diese kollegiale Verdunkelungsmethode der ziemlich privaten Art jetzt schon seit fast einem halben Jahr, und bis jetzt hatte das mit der Heimlichtuerei auch ganz gut geklappt. Niemand hier in der Dienststelle war der Auffassung oder hatte auch nur den Anflug einer Idee, der Kollege Schmitt und die nagelneue Kollegin im Team könnten amourös aneinanderhaften.
Ihre Beziehung vor den anderen zu verheimlichen war auch nicht ganz so schwer, wie es sich vielleicht anhörte, denn so richtig wusste Kriminalkommissar Bernd Schmitt ja selbst nicht, ob Kira und er jetzt offiziell ein Paar waren oder nicht. Das war eine Frage des Standpunktes, der Perspektive oder der Einstellung, je nachdem, welchen Maßstab der geneigte Betrachter an das Zusammensein von Mann und Frau legte. In ihrem Fall waren die Grenzen durchaus fließend – auf gut Neudeutsch: Es war kompliziert, so zumindest hätte man die Beziehung auf Facebook in den persönlichen Einstellungen zur Person markiert.
Bei der Arbeit an ihrem letzten großen Fall hatte er Kira kennengelernt. Wenn man das überhaupt so bezeichnen konnte. Sie war gerade wieder in ihre Heimatstadt Bamberg zurückgezogen, hatte aber übergangsweise weiterhin für die BFU gearbeitet, die Bundesanstalt für Flugunfalluntersuchung. Es war bestenfalls eine Sache von Stunden gewesen, da hatte er sich auch schon in die Frau verknallt. Seiner letzten Beziehung hatte er zuvor jahrelang hinterhergetrauert, doch das war von jetzt auf gleich vorbei, und er wurde von Amors Pfeil getroffen. Nein, eigentlich hatte Amor ihn in diesem Fall mit einer Art großem Wurfspeer erledigt, zumindest fühlte es sich so an. Wie es sich für Kira anfühlte, konnte er bedauerlicherweise nicht sagen, denn die Ex-Bundeswehrkommandantin mit Hochschulabschluss war ihrem Verhalten nach ein Buch mit sieben Siegeln, wenn nicht sogar einer ganzen Reihe Siegel mehr. Mal fiel sie regelrecht über ihn her, dann wieder erweckte sie den Eindruck, ein frisch gefangener toter Hering zu sein, der in einer großen Kiste voller Eiswürfel lag.
Den offiziellen Grund für ihr wankelmütiges Verhalten hatte sie ihm an ihrem denkwürdigen ersten Date im Greifenklau in Bamberg mitgeteilt. Bei Kira war bereits im Kindesalter das sogenannte Asperger-Syndrom diagnostiziert worden. Asperger war nach ihrer Schilderung eine Art milder Autismus, der für Außenstehende kaum oder gar nicht erkennbar war. Da Menschen mit Asperger über ein gutes Sprachverständnis und eine normale, oft sogar überdurchschnittlich hohe Intelligenz verfügten, waren ihre Schwierigkeiten im sozialen Bereich leicht zu übersehen. Hauptsächlich fehlte es ihnen an Empathie und sonstigen sozialen Fähigkeiten, was es für die Betroffenen oft sehr schwer machte, soziale Bindungen aufzubauen. Insbesondere Asperger-Menschen mit hohen intellektuellen Fähigkeiten lernten daher früh, ihre Schwierigkeiten so zu kompensieren, dass der Autismus selbst für Fachleute schwer zu erkennen war. Dennoch litten viele an ihrem Anderssein. Sie sehnten sich danach, so wie alle zu sein, fühlten sich aber gezwungen, eine Rolle zu spielen.
Es gab Menschen mit Asperger-Syndrom mit hohen Begabungen im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich, andere wiederum hatten massive Lernschwierigkeiten. Kira war eindeutig der ersten Gruppe zuzuordnen. Außerdem führte der Umstand, dass Menschen mit Asperger-Syndrom häufig bestimmte Situationen nicht einordnen konnten, dazu, dass viele von Grund auf ehrliche Menschen waren und ungeachtet möglicher sozialer Nachteile ihre Meinung einfach kundtaten, ohne jegliche Hemmung. Das konnte durchaus zu Problemen führen, sowohl allgemein als auch in intimen Beziehungen, war aber ja eigentlich eine positive Eigenschaft. Das war zumindest Bernd Schmitts Meinung, auch wenn die schonungslose Offenheit, die Kira gerne an den Tag legte, den einen oder die andere hin und wieder vor den Kopf stieß.
Dieser Umstand war auch dem dienstältesten Kommissar der Bamberger Kripo, Franz Haderlein, bewusst. Die Kollegen hier in der Dienststelle schienen sich so langsam an Kiras gnadenlose Art zu gewöhnen, trotzdem hatte er seine Vorstellungsrunde mit der neuen Kollegin bei den Kontaktpersonen außerhalb der Dienststelle bisher hinausgeschoben, denn er war sich nicht so ganz sicher gewesen, ob er ihre spezielle Art jedem sogleich zumuten konnte. Aber heute würde es endlich so weit sein. Kira sollte die Menschen kennenlernen, mit denen sie im Laufe der Zeit noch des Öfteren zu tun haben würde. Die ersten sechs Monate hatte sie ja vorwiegend im Innendienst verbracht, nur sporadisch war sie zu Tatorten oder Befragungen mitgenommen worden. Aber das hat jetzt ein Ende, dachte Haderlein zufrieden. Die Frau war wirklich schlau, hatte keine Angst vor Herausforderungen, und durchsetzungsfähig war sie ohne Zweifel ebenfalls. Es gab keinen Grund, ihr nicht mehr Freiraum zu gewähren. Haderlein war sich inzwischen sicher, dass Kira ein absoluter Gewinn für die Bamberger Dienststelle war.
»Und, was maanst, is scho a Feecher, unner Kira, odder?«, raunte ihm just in diesem Moment der Kollege Schmitt ins Ohr.
Haderlein beschloss, den anzüglichen Unterton in Lagerfelds Stimme einfach zu überhören, eine Methode, die er in der Zusammenarbeit mit seinem jüngeren Kollegen schon sehr früh hatte erlernen müssen. »Wenn du damit ausdrücken willst, dass Kira eine Kollegin mit außerordentlichem Potenzial ist, dann magst du wohl recht haben, Bernd. Ansonsten müsstest du mir das mit dem Feecher noch einmal näher erklären«, entgegnete er förmlich, was Lagerfeld aber nur ein müdes Grinsen abnötigte.
Das war er von Franz Haderlein gewohnt. Der eingewanderte Oberbayer aus dem Chiemgau hatte sich trotz der vielen Jahre in Bamberg immer noch nicht vollständig »frankiert«. Außerdem war er nun mal ein paar Jahre älter und hin und wieder so dermaßen steif und konservativ, dass ihm der gebürtige Bamberger Lagerfeld gern das eine oder andere Mal aufs Pferd geholfen hätte. Aber so war er halt, da konnte der gute Franz nicht aus seiner Haut.
»Ich werde Kira heute einpacken und mit ihr zu Siebenstädter in die Rechtsmedizin fahren«, äußerte Franz Haderlein beiläufig, woraufhin Lagerfeld fast die Kaffeetasse aus der verkrampften Hand gefallen wäre. Entsetzt blickte er seinen erfahrenen Kollegen von der Seite an.
»Äh, Franz, is des net a weng früh? Du weißt scho, wie des damals mit der Andrea und Seiner Eminenz Herrn Professor Siebenstädter geendet hat, des brauch ich fei net noch amal«, stellte er fest, während er unter Aufbietung sämtlicher motorischer Fähigkeiten versuchte, den verschütteten Kaffee aus der Untertasse zu schlürfen.
Franz Haderlein nahm die aufgeregte Reaktion seines jüngeren Kollegen amüsiert zur Kenntnis und ebenso zum Anlass, die schwierige Aufgabe mit der Erlanger Rechtsmedizin vielleicht besser an Bernd zu delegieren. Immerhin schien er sich mit Kira ziemlich gut zu verstehen, auch wenn er das stets zu verbergen versuchte, so zumindest Haderleins Eindruck. Während Honeypenny und der eloquente César Huppendorfer in Bezug auf Kira immer noch ein wenig fremdelten, war es bei ihrem Chef und Lagerfeld genau andersherum gewesen. Die beiden waren von ihrer Persönlichkeit her ja eher so gestrickt, dass sie ab und an schlichte, klare Ansagen brauchten, um ihren Beruf und das Leben im Allgemeinen zu bewältigen. Und da waren sie bei der neuen Kollegin Kira Sünkel an der richtigen Adresse.
Zwar dürfte das Aufeinandertreffen von Kira und Siebenstädter ziemlich interessant werden, trotzdem hatte Haderlein nur wenig Lust auf den Spontanbesuch in der Erlanger Rechtsmedizin. Wer wusste denn schon, mit welchen Widerwärtigkeiten der Professor diesmal aufwarten würde? Möglich, dass er in typisch ätzender Weise über die Bamberger Neukommissarin herfiel. Andererseits war Kira durchaus verteidigungsfähig, das hatten die letzten sechs Monate bereits gezeigt. Und sie hätte einen gewissen jüngeren Kollegen an ihrer Seite, sofern der die undankbare Aufgabe übernahm.
Bei dieser Gelegenheit ließ sich auch gleich einmal feststellen, überlegte sich Haderlein mit einem säuerlichen Grinsen, ob er sich das mit Lagerfelds kläglich verhohlenem Interesse an der neuen Kollegin nur einbildete oder ob er richtiglag. Wenn er Bernd nämlich jetzt fragte, ob er nicht anstelle seiner Wenigkeit mit Kira in die Erlanger Höhle des Löwen fahren wolle, könnte er die Antwort auf diese Frage an dessen Reaktion ablesen. Ein Bernd Schmitt in Normalform würde sich vehement wehren und winden, damit dieser Kelch an ihm vorüberging. Sollte Haderlein aber richtigliegen mit seiner Vermutung, fiele Lagerfelds Gegenwehr garantiert ziemlich bescheiden aus. Vielleicht druckste er der Form halber noch ein bisschen herum, jedoch nur kurz, dann würde er sich dazu bereit erklären, da war sich Haderlein ziemlich sicher. Also winkte er den sich betont unauffällig in der Dienststelle umschauenden Lagerfeld noch einmal zu sich.
»Was gibt’s, Franz, kann ich dir helfen?«, säuselte Bernd Schmitt übertrieben lässig, während er die Sonnenbrille auf seiner Nase zurechtrückte.
Haderlein musste sich eine harsche Bemerkung verkneifen, dann brachte er sein Anliegen aber doch noch adäquat an den Mann. »Ja, kannst du in der Tat, Bernd. Ich wollte ja eigentlich heute mit Kira nach Erlangen fahren, aber ich hab so viel zu –«
»Klar, mach ich«, kam es wie aus der Pistole geschossen vom Kollegen Schmitt. »Ich bin zwar heut mit dem Roller da, aber ich hab für die Kira einen Helm, der passt genau. Bis später, Franz.« Lagerfeld tätschelte noch kurz und aufmunternd die Backe seines dienstältesten Kollegen, dann drehte er sich um und eilte zur Kollegin Sünkel.
»Ääh …«, machte Franz Haderlein verblüfft, ehe er den Mund wieder schloss und wortlos zusah, wie Lagerfeld die völlig überraschte Kira am Arm aus der Dienststelle zerrte.
Der Mann stand über der regungslosen Frau und betrachtete sie einige Sekunden lang still und unbewegt. Dann erwachte er urplötzlich zum Leben und begann, die Wohnung abzusuchen. Regale, Schubladen, Schrankfächer und so weiter. Er sammelte all das ein, was einen Hinweis auf ihn geben konnte, Handy, Laptop, Speicherplatten, und machte sich mit großer Sorgfalt daran, seine Spuren zu verwischen.
Streng genommen war dies kein Einbruch, da es ihm nicht ums Geld ging, sondern um das große Ganze. Was die Polizei dahinter vermuten würde, das zu steuern lag nicht in seiner Macht. Aber die Kurve zu dem wirklichen Grund ihres Verschwindens würden sie sowieso niemals kriegen. Irgendwann würden sie die Frau wieder präsentiert bekommen, allerdings anders, als sie sich das vielleicht vorstellten. Sie war jetzt jedenfalls mal weg, und er hatte alles, was er brauchte.
Aus den Tiefen seiner Manteltasche zog er einen schwarzen Sack hervor. Es war eines jener Behältnisse, in denen Bestatter ihre Leichen abzuholen pflegten. In diesen Sack legte er die bewusstlose Frau, die immer noch ihre Handschuhe und die Gärtnerschürze trug. Einige Sekunden lang ruhte sein kalter Blick auf ihr. Es hatte begonnen, die Dinge nahmen nun ihren unwiderruflichen Verlauf. Dann zog er entschlossen den Reißverschluss zu und warf sich den schwarzen Sack ohne große Mühe über die Schulter.
Im Hinausgehen warf er noch einen letzten kontrollierenden Blick über die Schulter, dann verließ er die Wohnung, ohne auch nur einen einzigen weiteren Gedanken daran zu verschwenden.
Michael Brosst saß an seinem Tisch im »La Villa« in Bamberg, dem französischen Restaurant, das er selbst mit nicht wenigen eigenen finanziellen Mitteln aufgebaut hatte, und wartete auf seinen neuen CEO, Philipp Schultheiß, um ein ernstes Wörtchen mit ihm zu reden.
Ja, natürlich, es war am Ende des Tages seine Entscheidung gewesen, den jungen Manager übergangsweise an die Spitze von Brosst Mechatronics zu stellen. Aber er hatte Schultheiß wohl doch ein wenig falsch eingeschätzt. Nicht dass er plötzlich an dessen Fähigkeiten zweifelte, davon konnte keine Rede sein. Jedoch hatte Philipp in der Firma innerhalb kürzester Zeit ein paar höchst diskutable und für seinen Geschmack allzu radikale Entscheidungen getroffen, um es vorsichtig auszudrücken. Es wurde langsam Zeit, den jungen Mann etwas einzufangen, sonst war dessen Zeit als Geschäftsführer bald genauso plötzlich vorbei, wie sie begonnen hatte. Dass er nicht alle seine Entscheidungen schätzte, hatte er ihm bei ihrem letzten Gespräch zwar schon mitgeteilt, aber im Kreise der versammelten Vorstandsmitglieder war er wohl nicht deutlich genug gewesen. Wenn Philipp horrende Summen zum Fenster hinauswerfen wollte, dann sollte er das in einer anderen Firma tun, aber nicht bei Brosst Mechatronics.
Sein neuer CEO schien sich allerdings massiv zu verspäten. Er war jetzt schon seit bald dreißig Minuten überfällig, was normalerweise überhaupt nicht seine Art war. Zumindest hätte er sich kurz gemeldet, dass er nicht pünktlich sein konnte, aus welchen Gründen auch immer. Also tat Michael Brosst etwas, das er ansonsten hasste wie die Pest, nämlich jemandem hinterherzutelefonieren.
Am anderen Ende der Leitung klingelte es lang und ausdauernd, aber es ging niemand ran. Also probierte Michael Brosst es in Schultheiß’ Büro bei dessen Sekretärin, aber auch die konnte ihm nicht sagen, wo sein CEO war, wähnte sie ihn doch beim Geschäftsessen mit ihm, Michael Brosst, im »La Villa« in Bamberg. Sie beteuerte, dass ihr Chef eigentlich jeden Moment eintreffen müsse, aber sie werde sicherheitshalber einmal bei ihm zu Hause anrufen, vielleicht wisse ja seine Freundin Jeanette etwas Näheres.
Die graue Eminenz legte auf und steckte das Mobiltelefon in die Jackentasche zurück. Wie auch immer, er würde jetzt erst einmal die vorzügliche Bouillabaisse essen, die das »La Villa« auf der Speisekarte hatte, danach sah die Welt bestimmt ganz anders aus.
Jeanette Kasiske legte den Hörer des Telefons zurück und machte sich jetzt doch allmählich Sorgen. Unpünktlichkeit war überhaupt nicht Philipps Art, ganz im Gegenteil. Wenn es um seine Karriere ging, war er akkurat wie ein preußischer Offizier, da konnte man ihm nichts nachsagen. Und nun ließ er ausgerechnet Michael Brosst eine halbe Stunde warten? Sie probierte, ihn auf dem Mobiltelefon zu erreichen, aber es ging niemand ran. Nervös geworden, eilte sie zur Tür und ging nach draußen, um sich kurz umzuschauen. Vielleicht hatte sich Philipp ja einfach mit den Fernsehleuten verquatscht. Das war zwar unwahrscheinlich, aber es gab für alles ein erstes Mal.
Draußen prallte sie gegen die Wand aus stehender Hitze, die sich jetzt bereits seit vielen Wochen in Deutschland breitmachte. Umgehend traten ihr feine Schweißperlen auf die Stirn. Die Fernsehleute waren inzwischen aber zweifellos weg, die beiden schwarzen Busse, in denen sie ihr Equipment verstaut hatten, verschwunden, und auch Philipp war nirgendwo zu sehen. Das war schon mal gut, denn er hätte wie gesagt längst in Bamberg sein sollen. Aber wo steckte er dann?
Sicherheitshalber ging sie zu den Garagen und drückte den roten Knopf, woraufhin sich das Rolltor mit einem leisen Brummen nach oben in Bewegung setzte. Jeanette Kasiske erstarrte, als sie sah, was dahinter zum Vorschein kam. Der BMW ihres Freundes stand frisch gewaschen in der Garage, genau so, wie er ihn gestern Abend hineingestellt hatte. An sich ein beruhigender, fast beschaulicher Anblick. Nur dürfte der Wagen eigentlich gar nicht mehr hier sein. Statt in Bamberg vor dem Restaurant stand er unangetastet hier in der Garage. Philipp aber war fort und von niemandem mehr zu erreichen.
Es dauerte einige Sekunden, bis sich Jeanette aus ihrer Starre löste und mit einer unheilvollen Vorahnung zurück ins Haus rannte.
Die südfranzösische Fischsuppe war mal wieder ganz ausgezeichnet gewesen, das war überhaupt nicht das Problem. Ursächlich für Michael Brossts sich verschlechternde Laune war die Abwesenheit seines CEOs. Zum wiederholten Male versuchte er, ihn telefonisch zu erreichen, aber inzwischen bekam er nicht einmal mehr ein Freizeichen, sondern die sonderbare Auskunft, die angerufene Person sei vorübergehend nicht erreichbar. Bei allem Ärger mogelte sich unter diesen Umständen auch der eine oder andere sorgenvolle Gedanke in Michael Brossts Überlegungen. Schultheiß würde doch wohl nichts passiert sein, ein Autounfall oder etwas in der Art? Das Ganze wurde langsam unkontrollierbar, eine Situation, die Brosst nicht ausstehen konnte. In der Regel war er derjenige, der alles und jeden steuerte. Noch dazu wusste er nicht einmal genau, was da gerade schieflief und warum.
Wenn sich nicht bald etwas tat, würde er die staatlichen Organe einschalten müssen, um den Verbleib von Philipp Schultheiß zu eruieren. Aber das war nur die Ultima Ratio, vorher wollte er noch alle Hebel in Bewegung setzen, die helfen konnten, seinen Geschäftsführer aufzuspüren. Vielleicht gab es ja letztendlich eine ganz einfache Erklärung. Zuallererst würde er höchstpersönlich die Kliniken zwischen Bamberg und Coburg abklappern, vielleicht war Schultheiß ja inzwischen in einer davon eingeliefert worden.
Mit einer entschlossenen Bewegung schob Michael Brosst seinen Stuhl nach hinten, schnappte sich sein schwarzes Jackett und stürmte nach einer knappen Verabschiedung aus dem »La Villa«. Draußen holte er ob der ihm entgegenschlagenden Hitze einmal tief Luft und eilte zur Tiefgarage Geyerswörth, wo er seinen Lancia Stratos geparkt hatte. Allerlei Varianten und Variablen den Verbleib von Schultheiß betreffend gingen ihm durch den Kopf, die ihm jedoch allesamt missfielen. Entsprechend unaufgeräumt erreichte Michael Brosst seinen Lancia, wo er sich auf der Stelle hinter das Steuer schwang und den Gurt anlegte.
Obwohl es sich bei dem Wagen um ein sündhaft teures Einzelstück handelte, vollgestopft mit neuester Technik, musste man das edle Teil tatsächlich noch mit einem gewöhnlichen Zündschlüssel starten. Den Schlüssel ins Schloss stecken, rumdrehen, fertig. Ganz ordinäre Technik aus den siebziger Jahren, da stand Michael Brosst drauf. Der Schlüssel steckte bereits im Schloss, er wollte nur noch gedreht werden, da bemerkte der ungeduldige Autobesitzer, dass eine kleine Schachtel unter dem rechten Scheibenwischer klemmte. Überrascht starrte Brosst das rechteckige Teil an, als wäre es eine Hunderterpackung XL-Kondome, dann, nach einigen Sekunden der inneren Sortierung, nahm er den Zündschlüssel wieder aus dem Schloss, öffnete die Fahrertür und stieg aus dem Wagen. Er ging um die Motorhaube des Stratos herum und zog den Gegenstand vorsichtig unter dem Scheibenwischer hervor. Das war keine Schachtel, sondern eine kleine, fest zusammengefaltete dunkelgrüne Plastiktüte ohne Aufdruck, deren Inhalt er jetzt mit spitzen Fingern aus der Tüte fummelte.
Bei dem, was er sodann in Händen hielt, handelte es sich mitnichten um Verhütungsmittel aus dünnem Latex. Der formgebende Inhalt war ein Mobiltelefon der Firma Apple. Auf dem dunklen Display klebte ein gelber Notizzettel mit einer getippten Botschaft.
Entsperren: 11121947
Diese Zahlen kannte Michael Brosst natürlich, das war sein Geburtstagsdatum, verdammt. Eine kalte Wut kroch in ihm hoch. Wer zum Teufel spielte dieses seltsame Spiel mit ihm? So unauffällig wie möglich sah er sich in der Tiefgarage um, es war aber nirgends jemand zu entdecken. Da klingelte auf einmal das Mobiltelefon. Wobei Klingeln nicht gerade der passende Begriff war, das Handy schmetterte laut und inbrünstig die Arie eines Opernsängers an die Betonmauern der Tiefgarage. Dieser sang sich einige Sekunden lang wacker die Seele aus dem Leib, bis Michael Brosst schließlich beschloss, mit einem Tippen seines linken Zeigefingers das Gespräch anzunehmen.
»Brosst«, meldete er sich mit energischer Stimme und lauschte auf eine Antwort.
Die Arbeiten auf dem Kirchendach wurden allmählich zur Zumutung. Bei solchen Temperaturen war es auch für den abgebrühtesten Dachdecker unmöglich, sich auf dem Dach zu bewegen, ohne sich einen Sonnenstich einzufangen. So langsam musste sich die Firma Kotschenreuther wohl mit dem Gedanken anfreunden, wie die Kollegen in den südlichen Ländern Europas über Mittag eine mehrstündige Siesta einzulegen und dafür abends länger zu arbeiten. Wahrscheinlich war das mit der Klimaerwärmung doch nicht so an den Haaren herbeigezogen, wie der Dachdeckermeister bislang dachte. Dieses Jahr war das wärmste, das er in seinen bald sechzig Jahren je erlebt hatte. So wie jetzt ging es jedenfalls nicht weiter.
Seinem Auszubildenden, auch wenn er nicht die hellste Kerze auf der Torte war, schien die Sonne indes gar nicht so viel auszumachen. Er trank zwar hektoliterweise Limonade, damit schienen seine Grundbedürfnisse aber auch schon befriedigt zu sein. Kein Klagen, kein Gejammer über die brutale Hitze. Max Fabian arbeitete mit dem Gleichmut einer Planierraupe vor sich hin, während sein Chef bereits das elfte Hemd durchgeschwitzt hatte. Darum trat Kotschenreuther, von der Sonneneinstrahlung zermürbt, um kurz vor zwölf Uhr auch endgültig auf die Bremse.
»Max, Schluss, mir machen Middach, des häld ja kaa Sau aus bei dera Hitz, ich muss raus aus der Sunna!«, keuchte er und blickte zum wiederholten Male nach oben in die flirrende Hitze am blauen Himmel.
Sein Auszubildender wischte sich zwar auch mit dem Handrücken den Schweiß von der Stirn, machte aber nicht den Eindruck, als würde er gleich zusammenbrechen. Von den mathematischen Unzulänglichkeiten einmal abgesehen, war Max Fabian ein biologisches Wunder. Ein Berg von einem Kerl mit knapp einem Meter neunzig und ausgestattet mit der körperlichen Konstitution eines fränkischen Zuchtochsen. So ungefähr hatten sich die alten Griechen sicher den Titanen Atlas vorgestellt, der das Himmelsgewölbe der Welt auf seinen Schultern zu tragen hatte. Nur dass Max Fabian den Himmel wahrscheinlich immer noch stützen würde, wenn Atlas schon längst mit Bandscheibenvorfällen kämpfte.
Wie auch immer, der Latten waren genug genagelt, es war an der Zeit, ein schattiges Plätzchen zu finden, das in ihrem Fall die Kabine des Betriebslasters war. Kotschenreuther hatte in weiser Voraussicht eine zweite Batterie in das Fahrzeug einbauen lassen, sodass die Klimaanlage in der Fahrzeugkabine auch ohne laufenden Motor betrieben werden konnte, ein absoluter Segen bei Temperaturen wie diesen.
Der Ventilator der Lüftung begann, leise surrend zu laufen, und bereits nach wenigen Minuten hatte sich die drückende Luft auf ein erträgliches Maß abgekühlt, sodass Emil Kotschenreuther wieder einigermaßen klar denken konnte. Das war heute definitiv der letzte Tag mit klassischen Arbeitszeiten, stellte er resigniert fest. Ab einer bestimmten Tageszeit war es für Normalsterbliche einfach unmöglich, unter diesen Bedingungen dem Beruf eines Dachdeckers nachzugehen. Es musste eine andere Lösung her, jedenfalls bis die aktuelle Hitzeperiode in Franken vorüber war.
Apropos Franken. Kotschenreuther schaute auf seine Armbanduhr. Gleich kamen ja die Nachrichten im Radio, da würde das Abstimmungsergebnis der Volksbefragung im Bundesland Franken darüber, wie das Wasser im Extremfall rationiert werden sollte, bekannt gegeben werden. Und der Extremfall schien nun schon bald einzutreten, denn die Talsperren und Stauseen im Bundesland waren bereits jetzt, Anfang Juni, zu drei Vierteln geleert. Also war das Abstimmungsergebnis womöglich eine direkte Vorlage für die Entscheidung, die von der fränkischen Landesregierung in Kürze verkündet werden musste. Mit einem leichten Druck auf das entsprechende Icon auf dem Touchscreen des Transporters aktivierte er das Radio, und die Stimme einer Reporterin von Franken 3 war zu hören. Kotschenreuther hatte gerade rechtzeitig eingeschaltet, denn die Dame, eine gewisse Dagmar Luchs, machte sich soeben daran, die Details der Abstimmung zu verkünden. Gespannt lauschte er ihren Schilderungen, während sein Azubi Max bereits wieder geflissentlich mit Brotzeitauswickeln beschäftigt war.
»Hier also das offizielle Endergebnis der frankenweiten Dürreabstimmung. Wie Sie, liebe Zuhörer, ja sicher alle wissen, sollten die jeweiligen Maßnahmen ihrer Dringlichkeit entsprechend drei aufeinanderfolgenden Phasen zugeordnet werden. Nach dem Willen der fränkischen Bevölkerung soll es in der ersten Phase nicht mehr erlaubt sein, den heimischen Garten zu bewässern, Fahrzeuge zu waschen, Poolanlagen und Sportanlagen zu betreiben sowie Rasenflächen in öffentlichen Parks zu sprengen. Sollte sich der Wassernotstand fortsetzen, tritt ab einem Zeitpunkt, der von den Landkreisen und kreisfreien Städten weitestgehend selbst bestimmt werden kann, Phase 2 in Kraft. Dem Abstimmungsergebnis nach sollen dann alle öffentlichen Schwimmbäder geschlossen werden, auch die landwirtschaftliche Bewässerung wird eingestellt, und in der Gastronomie werden alle Speisen verboten, die große Mengen Wasser enthalten wie beispielsweise italienische Suppen, holländische Tomaten und thüringische Klöße. Weiterhin erlaubt bleiben fränkische Spezialitäten wie Schäuferla und die Rostbratwurst, während das Verzehren von veganen Gerichten als Straftatbestand zu bewerten ist. Es ist außerdem strengstens verboten, Flüssigkeiten jeglicher Art zu verschwenden. Das heißt, es ist nicht mehr erlaubt, den Scheibenwischer am Auto zu benutzen, öffentlich auszuspucken sowie Wäsche zu waschen, und es herrscht in ganz Franken von sechs Uhr morgens bis einundzwanzig Uhr abends ein strenges Toilettenverbot beziehungsweise ein Verbot des Spülens derselben. Im Extremfall tritt schließlich flächendeckend im ganzen Bundesland Franken Phase 3 der Wassernotverordnung in Kraft. Sie sieht vor, die Ernährung der fränkischen Bevölkerung gänzlich auf ein einziges Lebensmittel zu reduzieren, nämlich das regional gebraute Bier, da Bier als einziges Grundnahrungsmittel sämtliche lebenswichtigen Stoffe sowie genug Wasser enthält, um die Bevölkerung satt und bei guter Gesundheit zu halten. Brauereien wie Patrizier, Mönchshof oder Leikheim werden in Phase 3 verstaatlicht, damit auch diese Biere endlich den geschmacklichen Mindestanforderungen genügen. Die Regelungen aus allen drei Phasen bleiben so lange in Kraft, bis die jeweiligen Wasserwirtschaftsämter für die Grundwasserspiegel beziehungsweise die Tiefbrunnen in Franken wieder grünes Licht geben. So viel hierzu von mir, live aus dem fränkischen Landtag.« Dagmar Luchs verabschiedete sich und übergab an ihren Kollegen Charly Holpert im Studio Franken in Nürnberg.
»Ach du Scheiße, Kloverbot. Weißt du was, Max, des dauert nimmer lang, dann treffen mir uns alle wie früher bei den alten Germanen im Wald und graben Löcher für die tägliche Notdurft. Is übrigens auch a schöner Dreisatz zum Üben: Wie viele Löcher braucht mer, um einmal so richtig …« Kotschenreuther verstummte, als er den Gesichtsausdruck seines Auszubildenden bemerkte.
Max Fabian, den eigentlich nichts aus der Ruhe brachte, hatte das Kauen eingestellt und schaute seinen Meister leicht verstört an.
»Vergiss es«, meinte der daraufhin ernüchtert und startete den Motor. »Hoff mer derweil einfach, dass es net zum Äußersten kommt. Und jetzt fahrn wir erst einmal heim, wir brauchen neue Dachlatten.« Ohne einen weiteren Kommentar lenkte er den Kleinlaster rückwärts aus der Ausfahrt der Baustelle.
Kurz herrschte am anderen Ende der Leitung Stille, dann meldete sich eine klare, kräftige Stimme.
»Falls Sie Ihren Geschäftsführer vermissen, wir haben ihn. Es macht wenig Sinn, nach ihm zu suchen, Sie werden ihn nicht finden. Versuchen Sie es also besser gar nicht. Wir werden uns in den nächsten Tagen wieder melden, warten Sie auf Nachricht per WhatsApp auf diesem Handy. Ich wünsche noch einen schönen Tag.«
Das war’s, der Anrufer hatte aufgelegt. Michael Brosst starrte sekundenlang unschlüssig auf das Mobiltelefon, bis schließlich in sein Hirn einsickerte, dass der CEO von Brosst Mechatronics entführt worden war. Etwas, das unter anderem auch ihm selbst hätte widerfahren können, zumindest war ihm von fachkundigen Menschen bereits mehrfach eingeschärft worden, wachsam zu sein und keine Risiken einzugehen, sich vielleicht sogar einen Personenschützer zuzulegen. Eigentlich hielt sich der altersweise Manager ja für ziemlich cool und abgebrüht, aber die Tatsache, dass jemand aus seinem direkten geschäftlichen Umfeld entführt worden war, focht auch einen Michael Brosst an. Natürlich verfiel er deswegen nicht gleich in Hysterie oder gar Panik, dennoch verspürte er ein Gefühl des Ausgeliefertseins, das er so noch nicht kannte. Sicher, er hatte damit rechnen müssen, dass irgendwann einmal jemand versuchte, ihn oder ein Mitglied seiner Familie zu entführen, sie besaßen einfach zu viel Geld, um keine Neider auf den Plan zu rufen. Aber jetzt hatte es jemand auf seinen Interimsgeschäftsführer abgesehen, was irgendwie befremdlich war, da von dem Mann ja weit weniger Geld zu erpressen war als von Mitgliedern der Familie. Es sei denn, die Entführer nahmen an, dass die Firma Brosst beziehungsweise Seine graue Eminenz Michael Brosst himself für Philipp Schultheiß’ Unkosten, sprich: das Lösegeld aufkommen würde.
Nun, das war ein Kopf, den er sich nicht jetzt zerbrechen würde, immerhin war ja noch gar kein Lösegeld gefordert worden. Nicht einmal vor der Hinzuziehung der Polizei war gewarnt worden. Was auch immer dahinterstecken mochte, die Entführer machten ob dieser scheinbaren Gleichgültigkeit gegenüber der polizeilichen Einmischung einen ziemlich abgebrühten Eindruck. Ohnehin wollte sich Michael Brosst diesen letzten Schritt einstweilen noch vorbehalten, er gab das Heft des Handelns ungern aus der Hand. Darum würde er sich jetzt zuerst einmal im kleinen Kreis mit der Familie und der Firmenleitung beraten, um zu entscheiden, wie mit der Situation weiter verfahren werden sollte. Noch einmal blickte er zornig auf das nun wieder stumme Fremdhandy, dann schwang er sich auf den Fahrersitz seines Sportwagens. Das Mobiltelefon schmiss er mit einer verächtlichen Geste auf den Beifahrersitz, startete den Motor und raste wenig später mit nicht mehr erlaubter Geschwindigkeit in seinem Lancia Stratos auf der Autobahn in Richtung Coburg davon.
Das war ja mal ein wirklich guter Tag gewesen. Die Stimmung bei den Kollegen wurde immer angespannter, und das schlug sich allmählich auch in den Umgangsformen nieder. Aber das focht Erich Seubert nicht an, denn er war heute, trotz der schwierigen Einsätze in der letzten Zeit, völlig unerwartet befördert worden. Es lohnte sich also doch noch, wenn man etwas leistete. Die Beförderung brachte ihm mehr Gehalt, was gut war, vor allem aber Anerkennung. Das war ihm persönlich viel wichtiger. Trotzdem saß er nun bei einem doppelten Whisky an seinem Küchentisch und betrachtete äußerst wohlwollend den virtuellen Haufen Geld, den er, kaum dass er zur Tür hereingekommen war, vor seinem geistigen Auge auf dem Tisch platziert hatte. Anschließend war er zum Schrank mit den Spirituosen geeilt, um den teuren Single Malt zu holen. Ein Glas Whisky zur Feier des Tages war heute mehr als angemessen.
Eigentlich hätte Erich Seubert heute noch so einiges im Haushalt erledigen sollen, bevor seine Freundin von der Nachtschicht nach Hause kam, aber ihre zu erwartende Missbilligung seiner unterlassenen Pflichten würde mit Sicherheit wie Eis in der Sonne dahinschmelzen, wenn er ihr von dem unerwarteten Einkommenszuwachs erzählte. Da würde sie aber Augen machen. Der standardmäßige Anschiss bezüglich seiner Arbeitsmoral im gemeinschaftlichen Zusammenleben wäre vergessen, und sie würde sich selbst auch ein alkoholhaltiges Getränk genehmigen. Vielleicht keinen Whisky, aber stattdessen vielleicht einen Batida oder Baileys oder irgendetwas mit Aperol.
So langsam sollte sie aber auch erscheinen, sonst riskierte sie, dass Erich Seubert seinerseits angepisst reagierte und eine Erklärung verlangte, wo sie denn die ganze Zeit gesteckt hatte.
Der hämische Gedanke war noch nicht ganz zu Ende gedacht, da vernahm er das quietschende Geräusch der Schranktür aus dem Schlafzimmer. War Kriemhild doch schon nach Hause gekommen und hatte ihn einfach ignoriert? Das konnte er zwar nicht glauben, aber bei Frauen wusste man ja nie; besser, er schaute mal nach. Nicht dass sie ihn nachher noch beschuldigte, er habe sie nicht begrüßt oder sich nicht um ihre Gefühle geschert oder irgendwas in der Art.
»Kriemhild, bist du da?«, rief Erich Seubert laut, bevor er sich in Richtung Schlafzimmer in Bewegung setzte.
Die Tür war seltsamerweise geschlossen, was sie eigentlich niemals war, es sei denn, einer von beiden hatte Schlaf nachzuholen und machte sie deswegen zu. Als Erich Seubert die Klinke hinunterdrückte und eintrat, blieb er ob des Anblickes, der sich ihm bot, abrupt stehen. Kriemhild lag rücklings auf dem Bett, den Kopf in einer absolut unnatürlichen Haltung abgewinkelt. Die weit aufgerissenen Augen starrten leblos an die Zimmerdecke. Eine große Blutlache hatte sich unter ihr ausgebreitet und war in die Bettdecke und die Matratze eingesickert. Als er genauer hinsah, konnte er das kleine Einschussloch erkennen, das sich am Ansatz des Dekolletés zwischen ihren Brüsten befand.
»Kriemhild?«, entfuhr es ihm leise, und er trat entsetzt einen Schritt näher, als sich ein kräftiger Arm um seinen Hals und ein dicker Lappen auf sein Gesicht legte.
Erich Seubert war wahrlich kein unsportlicher Mensch, ganz im Gegenteil, beruflich bedingt hatte er vor Jahren sogar eine Nahkampfausbildung erhalten, aber gegen diese Bärenkräfte hatte er nicht den Hauch einer Chance. Er konnte ziehen, drücken, hebeln oder auch kratzen und strampeln, so viel er wollte, er war im eisenharten Griff des Mannes gefangen wie in einem Schraubstock. Es dauerte nicht lange, dann erstarben seine Bewegungen, und sein Körper erschlaffte.
Der Mann behielt seinen Klammergriff noch eine Weile bei, bis er sicher sein konnte, dass Seubert bewusstlos war. Dann legte er ihn neben die tote Kriemhild aufs Bett. Sie war heute ausnahmsweise vor Seubert nach Hause gekommen. Das allein besiegelte ihr Schicksal, denn sie hatte gar nicht auf seiner Liste gestanden. Aber bitte, es war jetzt nicht mehr zu ändern und womöglich auch besser so. Bedachte man, was ihrem Freund bevorstand, sollte sie ihm eigentlich dankbar sein, dass es schnell gegangen war.
Ohne sich weiter um die beiden zu kümmern, ging er zurück ins Wohnzimmer. Dort verfuhr er genauso wie in der vorherigen Wohnung. Handy, Laptop und so weiter nahm er mit, die Wohnung an sich wurde in einen Zustand versetzt, der keinen Rückschluss auf ihn zuließ. Eine Person mehr war nicht eingeplant gewesen, weswegen er die Frau hier liegen lassen musste. Für sein eigentliches Ziel hatte er einen schwarzen Sack mitgebracht. Mit einem leisen Surren öffnete er den ersten Reißverschluss und machte sich ans Werk.
Eigentlich hätte Lagerfeld es vorgezogen, mit seinem dreirädrigen MP3 nach Erlangen zu fahren, was bei dem durch den Roller eruierten Fahrtwind in der brütenden Hitze durchaus hätte angenehm sein können. Kira hatte aber auf die Fahrt mit ihrem elektrischen Fiat 500 bestanden, da sie bei ihrem Antrittsbesuch in einem wichtigen Institut Wert auf eine einigermaßen stabile Frisur legte. Was sollte denn sonst der Professor von ihr denken? Auch wenn ihr strenger Bürstenhaarschnitt relativ pflegeleicht war, ein Rollerhelm hatte im Sommer, bei so einer Hitze, durchaus das Potenzial, auch die stabilste Frisur regelrecht hinzurichten. Also fuhren sie nun in Kiras Wagen auf dem Frankenschnellweg der Erlanger Rechtsmedizin entgegen – natürlich nicht, ohne erneut über missverständliche Details ihrer immer noch nicht näher ausgehandelten Beziehungsvereinbarung zu diskutieren. Während Lagerfeld das äußere Erscheinungsbild ihres Zusammenseins – vielmehr dessen Nichtvorhandensein – schwer im Magen lag, beschäftigten Kira ein paar eher grundsätzliche Fragen. Besonders im sexuellen Bereich hatte sie einige Unzulänglichkeiten ausgemacht, die sie gerne behoben sehen wollte. Der Weg zur Perfektion in allen Lebenslagen war, wie sie wusste, ein durchaus steiniger, vor allem wenn man mit einem so ausgeprägten fränkischen Wurschtigkeitsgefühl dahinvegetierte wie dieser Kommissar.
»Du, Bernd, sagt dir eigentlich das Kamasutra was, ist dir das bekannt?«, wollte sie von ihrem Bamberger Kollegen wissen.
Eine Frage, die Lagerfeld wie schon einige zuvor in die Kategorie der eher lästigen Erkundigungen verwies. Das Kamasutra, landläufig als Buch der tausend Sexstellungen bekannt, war ihm bisher tatsächlich noch nicht über den Weg gelaufen. Er hatte den Begriff zwar schon einmal gehört, er wusste auch, dass es irgendwie mit Erotik zu tun hatte, aber was war das jetzt wieder genau? Überhaupt, wenn er gerade über irgendwas nicht reden wollte, dann war es Sex. Das machte man einfach, fertig. Da musste man doch wirklich keine Wissenschaft draus machen. Außerdem kam er sich immer, wenn sie mit ihren Fachbegriffen daherkam, und das meistens gehäuft, ziemlich blöd vor. Er hatte inzwischen begriffen, dass diese Frau so eine Art wandelndes Intelligenzsilo war, aber das musste sie doch wirklich nicht andauernd heraushängen lassen. Einfach so zugeben, dass er keine wirkliche Ahnung hatte, wollte er allerdings auch nicht, also versuchte er es mit einer Zwischenlösung, einer Art Halbeingeständnis.
»Kamasutra … ja, hab ich schon einmal irgendwo gehört. Is was Indisches, glaub ich. A Tee vielleicht?«
Kira Sünkel zuckte mit keiner Wimper, war sie die fundamentalen Wissenslücken ihres Sexualpartners doch inzwischen gewohnt. Immerhin zeigte Bernd eine unglaubliche Bereitschaft und auch Fähigkeit, schnell dazuzulernen, was einige seiner prinzipiellen Schwachstellen in Bezug auf das Allgemeinwissen ausglich. So honorierte sie prinzipiell sein Engagement, blieb aber weiterhin irritiert von dem teilweise extrem unlogischen Verhalten dieses Mannes. Hinzu kam, dass ein Mann für Kira in erster Linie ein Sexualpartner war, kein Mensch, mit dem man unbedingt andauernd reden musste. Aber Bernd wollte genau das, vor allem wollte er ständig über für sie so befremdliche Dinge wie Gefühle und Befindlichkeiten reden. Das verwirrte und stresste sie, daher brauchte sie einfach in regelmäßigen Abständen eine Pause von ihm, das ganze Gerede und Getue war sie schlicht nicht gewohnt. Außerdem gestaltete sich etwas so Kompliziertes wie das Empfinden von Empathie mit Asperger eher schwierig. Das verstand er offenbar nicht, immerhin schien er es aber zu akzeptieren. Das mochte sie auch an ihm.
Ansonsten war es vor allem das Thema Lustzufügung, das sie an ihm interessierte und das mit diesem Mann ganz hervorragend funktionierte. Weshalb genau, konnte sie nicht sagen. Bernd war weder exorbitant gut aussehend, noch hatte er einen besonders männlichen Körper. Noch dazu rauchte er wie ein Schlot. Aber er machte einfach immer das Richtige mit ihr, in dieser Hinsicht war er schon etwas Besonderes. Nichtsdestotrotz war auch der Sex ein Bereich, in dem man sich weiterbilden konnte, statt mit der Lagerfeld’schen »Bassd scho«-Mentalität wieder und wieder das gleiche Prozedere abzuspulen. Es war an der Zeit für eine umfassende Unterweisung.
»Nein, das Kamasutra ist kein Tee, Bernd. Die indische Lehre über die Sexualität wurde vor rund zweitausend Jahren von Vatsyayana Mallanaga verfasst, über dessen Leben nur wenig bekannt ist. Viele denken, es wäre einfach nur eine Auflistung verschiedener Stellungen beim Sex, aber es ist tatsächlich eng verbunden mit der Liebeskunst Tantra, die die Transformation von Sexualität meint. Kamasutra bedeutet übersetzt so viel wie ›Verse des Verlangens‹. Neben den Liebesstellungen finden sich darin nämlich auch Abhandlungen über eine ethische Erotik und Lebensweise.«
»Aha«, warf Lagerfeld frustriert ein, der schon geahnt hatte, dass ihm jetzt wieder ein längerer Vortrag von Kira blühte.
»Der Verfasser des Kamasutras wurde auch Muni, der Schweigsame, genannt. Im Altertum gaben Inder bedeutenden Personen, für die sie Respekt empfanden und die sie verehrten, diesen Beinamen. Über sich selbst sagte Vatsyayana Mallanaga, er habe das Kamasutra in strenger Enthaltsamkeit und höchster meditativer Konzentration geschrieben, und zwar für den Fortbestand der Welt und nicht für die blinde Leidenschaft.«
Das war nun eine These, der Kommissar Bernd Schmitt rein gar nichts abgewinnen konnte. Ein Buch über Sex schreiben und dann die ganze Zeit enthaltsam bleiben, das war ja wohl lächerlich. Man musste doch eine Ahnung von dem haben, was man predigte, das konnte einem jeder katholische Dorfpfarrer bestätigen.
»Ja klar, Kira, des kann er seinem Tee erzählen. Wenn nicht für die Leidenschaft, wofür denn nachert dann, frag ich dich? Oder soll des heißen, mir müssen alle tausend Stellungen in deinem Kambodscha durchexerzieren, um damit nachert die Welt zu retten? Wieso überhaupt mir zwei, kann das nicht jemand anders machen? Außerdem, der Schweigsame, aha. Die Inder ham des also auch schon gewusst, dass mer net so viel reden soll beim Sex. Bloß du fängst andauernd damit an.« Lagerfeld tat sich so schon schwer, offen über dieses Thema zu reden, und jetzt sollte er auch noch in einem Buch lesen. Ja, war er denn hier im Schulunterricht, oder was, am besten noch mit Abschlussprüfung? Er war eher ein Verfechter der spontanen Ausübung und ganz bestimmt kein Anhänger generalstabsmäßiger Vorbereitung. Wollte Kira jetzt allen Ernstes jedes Mal eine dieser indischen Turnübungen abarbeiten? Das widersprach vehement seinem fränkischen Selbst- und Kulturverständnis. »Du, horch amal, Kira. Ich bin fei kein Inder, ich bin Franke. Mei Hauptnahrung sin Bratwörscht, Schäuferla und Bier. Also so indisch, ab und zu, als Abwechslung, des könnt ich mir noch eingehen lassen. Aber doch net jeden Tag, na.« Verbissen skalierte er den vorausfahrenden Verkehr.
Kira hatte sich seine Ausführungen schweigend angehört und dabei mit den Augen gerollt. Sie hätte noch einiges anzumerken, jedoch fand die Diskussion ein jähes Ende, als der Fiat kraft seiner Ankunft am gewählten Ziel auf einen freien Parkplatz am Eingang der Erlanger Rechtsmedizin rollte. Wenig später betraten die beiden Kommissare die dunklen Katakomben des Institutes auf ihrem Weg zum Herrn der hiesigen Unterwelt Professor Thomas Siebenstädter.