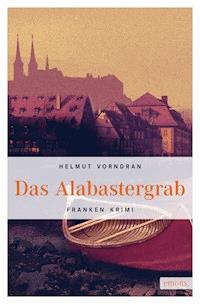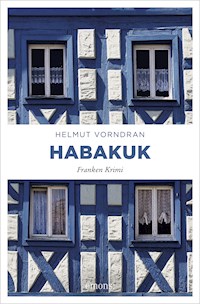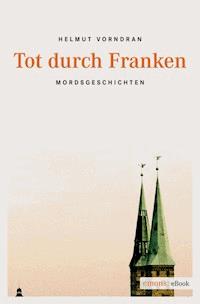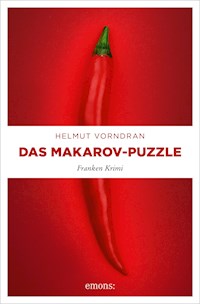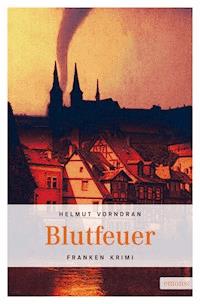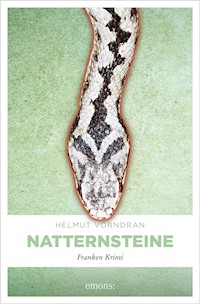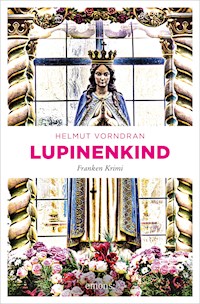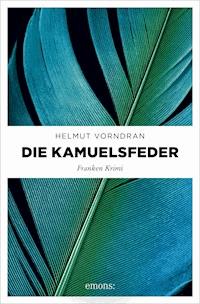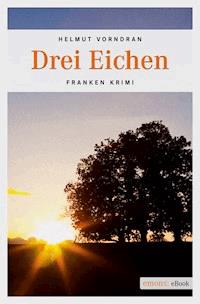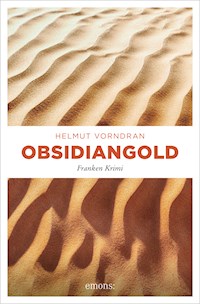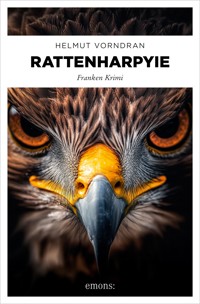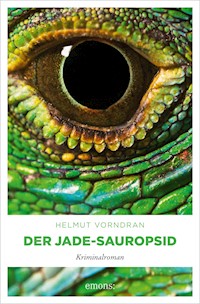
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Kommissar Haderlein
- Sprache: Deutsch
Zynisch und humorvoll: der siebte Fall des Bamberger Ermittlerteams. Künstler haben es schwer, vor allem wenn sie nächtens ermordet in Hotelzimmern aufgefunden werden. Ein eigentlich alltäglicher Fall für Haderlein und seine Kollegen – wenn man von dem grausam zugerichteten Leichnam und der blutigen Botschaft an der Zimmerwand einmal absieht. Was zuerst wie ein barbarischer, aber einmaliger Mord daherkommt, entpuppt sich wenig später als Anfangstat eines Serienkillers. Ein blutiger Wettlauf gegen die Zeit beginnt . . .
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 462
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Helmut Vorndran, geboren 1961 in Bad Neustadt/Saale, lebt mehrere Leben: als Kabarettist, Unternehmer und Buchautor. Als überzeugter Franke hat er seinen Lebensmittelpunkt ins oberfränkische Bamberger Land verlegt und arbeitet als freier Autor unter anderem für Antenne Bayern und das Bayerische Fernsehen.
www.helmutvorndran.de
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2017 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: mauritius images/Science Faction/Seth Resnick
Umschlaggestaltung: Franziska Emons, Tobias Doetsch
Lektorat: Marit Obsen
eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-259-5
Franken Krimi
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de
Für dich,Anam Cara.
Tá grá agam duit.
Something in me, dark and stickyAll the time it’s getting strongNo way of dealing with this feelingCan’t go on like this too long
Digging in the dirtStay with me, I need supportI’m digging in the dirtTo find the places I got hurtOpen up the places I got hurt
Aus: Peter Gabriel, »Digging in the Dirt«
Prolog
Er legte die Augen beziehungsweise das, was von ihnen noch übrig war, in den runden gläsernen Zylinder. Dann hob er den großen Kanister vom Boden, schraubte den Deckel ab und fing an, die durchsichtige Flüssigkeit in das Glas zu schütten. Sofort begann es, in der kleinen Stube nach Medizin und Krankenhaus zu riechen. Es zogen Bilder von sterilen Werkzeugen vor seinem inneren Auge vorbei, von grün gewandeten Ärzten, die mit Mundschutz und Handschuhen vor ihren betäubten Patienten standen, bereit für die anstehende Operation. Und so verkehrt war diese Assoziation auch überhaupt nicht. Was er hier tat, war im Grunde nichts anderes. Eine Operation am befallenen Körper der Menschheit.
Jedem Ende wohnt ein Zauberer inne
Die Vorstellung war vorbei, endlich. Hätte es besser laufen können? Das war die eindeutig falsche Frage. Denn nach oben hin hatte die Qualität seiner Darbietung noch sehr viel Luft gehabt. So viel, wie man sich nur irgend vorstellen konnte. Dafür war der Raum nach unten sehr begrenzt gewesen, fast nicht mehr wahrnehmbar. Seine künstlerische Fallhöhe tendierte nunmehr gegen null. Auf gut Deutsch: Er, der hochbegabte Freizeitzauberer Markus Wild alias »der Große Spiratelli« war am absoluten Tiefpunkt seiner Bühnenlaufbahn angelangt.
Schon die letzten Vorstellungen in Kronach, Bad Rodach und Bayreuth waren nicht besonders gut gelaufen. Was heißt »nicht gut gelaufen«, sie waren absolute Katastrophen gewesen. In Kronach war nach der Pause nur noch ein Drittel der Zuschauer im Saal verblieben, weil er in einen Fünfhundert-Mann-Saal hatte ausweichen müssen, obwohl nur siebenunddreißig Karten für seine Vorstellung verkauft worden waren. Da konnte ja keine richtige Stimmung aufkommen.
In Bad Rodach hatte eigentlich alles gepasst. Ein wunderschöner Saal in einem alten Jagdschloss, über achtzig Leute, fast ausverkauft. Natürlich war er da nervös gewesen, vor so vielen Leuten hatte er noch nie gestanden. Und es lief auch eigentlich ganz gut. Bis zu dem Zeitpunkt, als draußen im Moment der größten Spannung der ortseigene Nachtwächter mit seiner bescheuerten Führung vorbeigekommen war und angefangen hatte, mit seinem Horn lautstark durch die Gegend zu tröten. Vor Schreck hatte er die Utensilien seiner kompliziertesten Trickanordnung, der verschwundenen Geldbörse, einfach fallen lassen. Lautes Gelächter und höhnische Kommentare waren die Folge gewesen. Er hatte das Fenster aufgerissen und sich aus dem ersten Stock ein wütendes Wortgefecht mit diesem Idioten von einem Nachtwächter geliefert, was den Mann aber nicht weiter beeindruckt hatte. Als er das Fenster wieder geschlossen und sich zu seinem Auditorium umgedreht hatte, war er mit einem Schreckensszenario erster Güte konfrontiert worden. Mehrere Kinder hatten sich seiner Zauberutensilien bemächtigt und spielten Fangen damit, während der Großteil des Publikums bereits im Gehen begriffen war. Er hatte die Vorstellung daraufhin eilends abgebrochen, um Schlimmeres zu verhindern.
Tja, und Bayreuth? In Bayreuth war er von einem Buchladen engagiert worden, der allerdings fälschlicherweise Karten für eine Kafka-Lesung verkauft hatte. Zwar machten der Große Spiratelli und sein Publikum gute Miene zum bösen Spiel, im Versuch, den Abend noch irgendwie zu retten. Aber der gemeine Kafka-Leser hat nicht wirklich einen Sinn für die Niederungen des Darbietungsalltags irgendwelcher Hinterhofzauberer. So musste er während der Vorstellung mehrfach Fragen zur Problemstellung seiner Zauberei beantworten und die Tiefgründigkeit seiner künstlerischen Tätigkeit erläutern. Der Gipfel der Absurdität war dann die Feststellung einer Oberstudienrätin, dass er, der Große Spiratelli, ja gar nicht richtig zaubern könne. Das, was er hier tue, habe mit Mystik, mit der Transformation des Hier und Jetzt unseres Daseins gar nichts zu tun. Das seien ja nur Tricks, alberne Taschenspielereien eines Laiendarstellers.
Als er dann völlig frustriert und unter den mitleidigen Blicken der Buchhändlerinnen zu seinem Auto in die Tiefgarage des Rotmain-Centers geeilt war, hatte er auch noch feststellen müssen, dass dieses Parkhaus nur bis neunzehn Uhr geöffnet war, man hatte ihn ausgesperrt. Somit war die sauer verdiente Gage sofort wieder für ein überteuertes Hotelzimmer in Bayreuth draufgegangen.
Wie war ein solches Desaster nun noch zu toppen? Ganz einfach. Er hatte beschlossen, sich sein Publikum das nächste Mal einfach nicht anzuschauen. Sich vorgenommen, heute einfach da rauszugehen, sich auf die Bühne zu stellen und sein Publikum mit seiner Zauberei so gut zu unterhalten, wie er es eben vermochte. Zumal der Veranstaltungsort durchaus vielversprechend war: Jugendzentrum Coburg. Ein alteingesessenes Haus zur Jugendlichenbespaßung in einem alten Ziegelbau, großer Parkplatz gleich gegenüber. Hier würde es erstens einigermaßen voll werden, und zweitens roch das richtig nach Familien im Zuschauerraum. Familien mit vielen Kindern, die mit großen Augen und erstaunten Gesichtern seinen kunstfertigen Übungen beiwohnen würden. Endlich einmal eine befriedigende Vorstellung, eine runde Sache. So seine Annahme, so der Plan.
Als er auf die Bühne des Jugendzentrums getreten war, hatten da aber keineswegs Kinder mit ihren erwartungsfrohen Eltern gesessen, sondern die Teilnehmer der gerade eben zu Ende gegangenen Demonstration der Coburger Pegida-Gruppe »Cogida«. Es war Montagabend, der Alkohol floss in Strömen, und keiner der anwesenden AfD-Sympathisanten interessierte sich auch nur einen Deut für seine Zauberkunststückchen. Im Gegenteil, im Parkett unterhielt man sich immer lauter, der Künstler wurde fleißig ignoriert.
Zuerst hatte er ebenfalls lauter gesprochen, um den Lärm zu übertönen, bis er seine Performance schließlich schreiend vorgetragen hatte. Entnervt und wütend war er erst geworden, als irgendwann gar keiner mehr auf ihn geachtet hatte. Aufgebracht war er zum Gegenangriff übergegangen, hatte die Cogidaristen zunächst mit Kraftausdrücken belegt und schlussendlich mit Titulierungen wie »braune Idioten« und »Nazipack« beschimpft. Was natürlich nicht zu einer Beruhigung der Gesamtsituation geführt hatte. Im Gegenteil. Man hatte begonnen, mit Flaschen, Gläsern und sonstigen Dingen nach ihm zu werfen, in etwa mit allem, was halt so auf den Tischen herumstand. Woraufhin er fluchtartig die Bühne verlassen und die Tür zur Garderobe hinter sich geschlossen hatte. Noch immer konnte er draußen die wütenden Gesänge der alkoholisierten Af Dler vernehmen.
»Wir sind das Volk!«, drang es lautstark und fortlaufend seit über einer halben Stunde zu ihm herein, an eine Fortführung seiner Darbietung war nicht mehr zu denken. So saß er nun auf einem alten zerschlissenen Sofa in der Garderobe des Coburger Jugendzentrums und entschied, verzweifelt, wie er war, so lange ein Bier nach dem anderen zu trinken, bis der Krach dort draußen aufhörte.
Eine Stunde und fünf Bierdosen später war das Geschrei im Saal nicht wirklich leiser geworden. Ein völlig überforderter Student der Sozialpädagogik hatte ihm zwischenzeitlich seine von ausgelaufenem Bier triefenden Utensilien gebracht und ihm seine Gage in die Hand gedrückt. Seither war er zusammen mit den Leiterinnen dieses Irrenhauses hier vollauf damit beschäftigt, einen ungebetenen Cogidaristen nach dem anderen aus dem Jugendzentrum hinauszubefördern. Markus Wild beschloss, sich ein Taxi kommen zu lassen und von hier zu verschwinden. Er wollte nur noch weg.
»Na, wo soll’s denn hingehen?«, fragte ihn der Fahrer fröhlich, als er sich leicht wankend auf den Beifahrersitz quälte.
»Schönleinsplatz Bamberg, Hotel Bamberger Hof. Und zwar so schnell wie möglich«, entgegnete er frustriert und steckte die Schnalle seines Sicherheitsgurtes in den dafür vorgesehenen Schlitz. Mit einem metallischen Klicken rastete der Verschluss ein, was dem erschöpften Zauberer beinahe ein beruhigendes Gefühl vermittelte.
»Kommen Sie aus Jugendzentrum?«, erkundigte sich der fremdländische Taxifahrer, während er ausparkte und sich auf den Weg in Richtung Bamberg machte.
»Ja, allerdings.« Markus Wild verzog den Mund zu einem schiefen Lächeln, in der Hoffnung auf ein mitfühlendes Gespräch. Er schaute zu seinem Chauffeur hinüber, der aber nur mit halbem Ohr bei der Sache war, schließlich musste er sich auf der Stadtumgehung durch den Verkehr schlängeln. Trotzdem versuchte er sein Bestes, um den Fahrgast zu unterhalten.
»Kann ich verstehen, dass du wollen weg. Bist nicht der Einzige, der heute gefahren mit mir, weil wollen weg aus Jugendzentrum«, tönte der Mann, während er sich geschickt mal links, mal rechts in den Verkehr einfädelte.
»Ach«, bemerkte Wild beiläufig, der sich jetzt eigentlich nur noch seinem Selbstmitleid hingeben wollte. Er hoffte auf irgendetwas Aufmunterndes.
»Ja, hatte ich vorhin Fahrgast von Cogida, der war auch in Jugendzentrum. War wie du total mies drauf«, meinte der Taxifahrer.
»Weil sie ihn rausgeworfen haben?«, erkundigte sich Markus Wild neugierig. Vielleicht hellte es seine Stimmung ja etwas auf, wenn er von Menschen erfuhr, denen es noch schlechter ging als ihm selbst. Vor allem, wenn es sich um so ein braunes Cogida-Arschloch handelte.
»Nein, nein«, entgegnete der Taxifahrer sofort. »Mann war mies drauf, weil eine Zauberer zugeschaut, der wohl war unheimlich schlecht und langweilig. Eigentlich Schlechtestes, was er jemals gesehen auf Bühne irgendwo. Dann hat er noch geschimpft über Ausländer und Flüchtlinge und so, darum ich ihn rausgeschmissen an Schlossplatz. Hat aber trotzdem bezahlt, der Mann.« Der Taxifahrer blickte grinsend zu Markus Wild, aber der saß mit eingefrorenen Gesichtszügen auf dem Beifahrersitz, schaute nach draußen in die winterliche Kälte und sagte gar nichts mehr. Der Große Spiratelli wollte nur noch nach Hause in sein kleines, behütetes Bamberger Hotelzimmer.
Carolin Metz packte ihre umfangreiche Fotoausrüstung zusammen und kam wie meistens schon nach kurzer Zeit ins Grübeln. Sie musste mehrmals überlegen, was sie denn nun mitnehmen oder besser hierlassen sollte. Ihre Tagesaufgabe war nicht ohne. Ein Shooting der Königsberger Rosenmesse. Das hieß, auf alles vorbereitet sein, von morgens früh bis Sonnenuntergang. Linsen und Brennweiten für alle Eventualitäten sowie Fotoausrüstung und Hilfsmittel, die beim Fotografieren unentbehrlich waren. Kameras und Objektive hatte sie genug, die waren nicht das Problem. Das Problem war wie jedes Mal das Gesamtgewicht. Bei kompletter Ausrüstung kamen schnell mal über zehn Kilo zusammen, und die wollte sie nicht den ganzen Tag über den Platz schleppen. Carolin Metz war zwar leidlich sportlich, aber doch eher schlank, fast zierlich gebaut. Und was nützte einem die beste und teuerste Vollformatausrüstung, wenn man sie irgendwann nicht mehr heben konnte? Das war ihr schon einmal passiert, das brauchte sie nicht wieder, es war mehr als peinlich. Ihre Wahl fiel auf eine Pentax-Vollformatkamera mit zwei Zooms, um damit die Weitwinkelaufnahmen und die großformatigen Bilder zu schießen. Für Porträts nahm sie ihre Fuji-Systemkamera und zwei Festbrennweiten mit. Die machte auch wunderschöne Bilder, war aber sehr viel leichter und vor allem nicht so auffällig wie das Vollformatmonster. Dazu ein Stativ, Ersatzakkus und Speicherkarten, und fertig war die Ausrüstung. Das müsste hinhauen. Zufrieden verstaute sie ihre Auswahl in den Fototaschen und hob diese probeweise auf ihre Schulter. Schwer, aber nicht zu schwer. Das würde schon gehen, befand sie entschlossen.
Als sie ihre Haustür abschloss und ganz in Gedanken auf die Straße hinaustrat, wäre sie fast mit einem Mann zusammengestoßen. Hastig entschuldigte sie sich und machte sich auf den Weg zu ihrem Auto. Das stand ein ganzes Stück weit weg. Das Parken in der Bamberger Innenstadt wurde von Jahr zu Jahr anstrengender. Gerade hier in der Hornthalstraße, zwischen Stadtzentrum und Konzerthalle, musste man inzwischen lange suchen, um einen Parkplatz in der Nähe zu ergattern. Die verdammten Touristen, dachte sie immer häufiger verärgert und wünschte sich wehmütig in ihre Studentenzeit zurück, als es in Bamberg noch weit beschaulicher zugegangen war. Vor fünfzehn Jahren hatte es zwar auch Amerikaner und Japaner gegeben, die in Bamberg vorbeischauten. Nach dem Motto »Ganz Europa in sieben Tagen« waren sie allerdings schon nach wenigen Stunden wieder verschwunden. Schließlich mussten sie schleunigst weiter nach Würzburg oder Rothenburg ob der Tauber. Aber jetzt war ja bald die halbe Erdbevölkerung in der Weltkulturerbe-Stadt zu Gast. Die Zeit bleibt nun mal leider nicht stehen, dachte sie mit einem leisen Seufzen.
In wenigen Monaten wurde sie vierzig, ein schreckliches Ereignis. Aber dafür war sie ja auch keine Studentin der Betriebswirtschaft mehr, sondern eine außerordentlich erfolgreiche und gesuchte Fotografin. Also weg mit diesen düsteren Gedanken ans Altern, Falten und Orangenhaut. Ein äußerst lukrativer und ebenso anspruchsvoller Job auf einem großen Gartenmarkt wartete auf sie, da konnte sie sich keine Sentimentalitäten leisten.
Endlich stand sie neben ihrem BMW Mini, öffnete die Heckklappe und versenkte ihre Ausrüstung in den Tiefen des Kofferraums. Als sie ausparkte, war sie mit ihren Gedanken schon wieder ganz woanders. Auf der Rosenmesse erwarteten sie Schaustellerbuden, Rosen und viele gut gelaunte Menschen. Und was am wichtigsten war, das Wetter würde ihr keinen Strich durch die Rechnung machen. Es sollte heute den ganzen Tag über eine nur lockere Bewölkung geben; das Licht der Junisonne würde ihr somit zu einer grandiosen Stimmung auf ihren Bildern verhelfen. Mit einem Lächeln im Gesicht startete sie den Motor.
Erleichtert ließ sich Markus Wild in die Kissen seines Hotelbettes sinken. Endlich Ruhe. Zu guter Letzt war dieser Höllenauftritt, dieser grausame Tag vorbei. Und wieder einmal fragte er sich verzweifelt, was ihn eigentlich dazu trieb, sein Hobby zum Beruf machen zu wollen. Seine Familie verstand es schon lange nicht mehr, er selbst im Grunde auch nicht. Warum wollte er den Leuten dort draußen unbedingt nahebringen, was sie offensichtlich gar nicht sehen wollten, zumindest nicht von ihm? Er wusste es nicht mehr, und vielleicht hatte er es nie gewusst. Morgen hatte er noch eine Veranstaltung mit anderen Hobbykünstlern im Bamberger E-Werk. Diesen letzten Auftritt würde er wie geplant absolvieren und danach erst einmal eine Pause einlegen. Er würde Zylinder, Kartenspiel und Zauberkisten in den Keller stellen und die Zauberei für eine Weile vergessen. Nur noch eine weitere Nacht, die er hier im zweiten Stock seines Hotels mit Blick auf den Bamberger Schönleinsplatz verbringen würde, und dann nichts wie nach Hause. Vielleicht musste er einfach einsehen, dass sein Talent nicht …
Tock, tock, tock. Leise, fast zaghaft klopfte es an der Tür. Markus Wild hob mit ungläubigem Blick den Kopf. Wer in Gottes Namen wollte denn jetzt noch etwas von ihm? So spät am Abend konnte das eigentlich nur jemand vom Hotel sein.
»Hallo, wer ist denn da?«, rief er in Richtung Tür. Bevor er sich von dieser wunderbar weichen Matratze quälte, musste gewährleistet sein, dass sich eine Erhebung von derselben auch wirklich lohnte.
»Ein Fan«, hörte er jemanden durch die Tür hindurch sagen. »Ein Fan des Großen Spiratelli«, fügte derjenige noch gedämpft hinzu.
Markus Wild konnte es nicht glauben. Ein Fan? Es gab Menschen, die seine Zauberei tatsächlich dermaßen bewunderten, dass sie ein Autogramm von ihm haben wollten? Hektisch sprang er vom Bett und richtete seine Kleidung, so gut es ging. »Moment!«, rief er und strich sich die Haare nach hinten. Sein allererstes Groupie, da wollte er doch einen wirklich guten Eindruck machen.
Er setzte das freundlichste Lächeln auf, zu dem er fähig war, und öffnete die Tür.
Carolin Metz parkte ihren Mini auf dem Parkplatz für Schausteller, der sich direkt neben dem großen steinernen Eingang zur Burg Königsberg befand. Dann holte sie ihre Ausrüstung aus dem Kofferraum und hängte sich die Fototasche und den kleinen Rucksack um. Von unterwegs hatte sie mit der Veranstalterin telefoniert, man ließ ihr heute völlig freie Hand. Da dies nicht ihr erster Job auf dem Rosenmarkt war, kannte sie sich aus, und ihre Auftraggeberin hatte offensichtlich größtes Vertrauen in ihre Fähigkeiten.
Obwohl sie schon zum dritten Mal hierherkam, war sie doch immer wieder beeindruckt von der herben Schönheit der Burganlage, die, etwas außerhalb, hoch oben über dem romantischen Ort Königsberg in Bayern thronte. Das Städtchen war so romantisch, dass es schon fast kitschig wirkte. Ein Ort, der vor allem dafür bekannt war, dass dort im Spätmittelalter ein gewisser Hans Müller gelebt hatte, besser bekannt als Regiomontanus, genialer Mathematiker, Astronom und der berühmteste Sohn der Stadt. Seit dessen Ableben war in Königsberg allerdings nicht mehr viel passiert. Vergessen von der Welt lag die Stadt am Rande der Haßberge, verschont von Aufregung, Krieg und der Zerstörung der Welt.
Nur die Burg Königsberg machte einmal im Jahr von sich reden, indem sie eine große Rosenmesse ausrichtete, im Grunde eine Gartenausstellung für Besserverdienende und ein Einkaufsparadies für FDP-Wählerinnen.
Die Motivation für das Hiersein der Besucher war Carolin Metz aber reichlich egal. Ihre Aufgabe war es, die Stimmung einzufangen und auf Bilder zu bannen. Da auch auf der Rosenmesse genug Eitelkeit durch die Welt spazierte, war es normalerweise sehr einfach, willige Objekte und Objektinnen zu finden, die bereit waren, sich von ihr ablichten zu lassen.
Sie beschloss, sich diesmal zuerst in den Burggraben hinunterzubegeben; dort war es zwar eng, aber es gab perfekte Motive für ihre Kamera. Und so früh am Tag waren noch nicht allzu viele Besucher im Burggraben, die ihr den Blick verstellen konnten. Guter Dinge betätigte sie die automatische Türverriegelung des Minis und schritt auf den Eingang zu.
Als Markus Wild aus seiner Ohnmacht erwachte, fiel ihm zuallererst auf, dass sein Kinn wehtat, und zwar gewaltig. Als er sich an die schmerzende Stelle fassen wollte, bemerkte er, dass seine Hände irgendwo festgebunden und dass sein Mund mit einem Klebeband verschlossen war. Er lag der Länge nach auf seinem Hotelbett, wie es schien. Als er sich aufzurichten versuchte, um das Klebeband irgendwie zu entfernen, stellte er zu seiner großen Verblüffung fest, dass auch seine Füße gefesselt waren. Er konnte sich nicht wirklich gut bewegen. Ein Schwall panischer Gefühle überschwemmte ihn. Was zum Teufel war hier los? Verzweifelt versuchte er, sich zu erinnern. Dann fiel es ihm wieder ein: die Tür, der Fan, das Autogramm. Schemenhaft erinnerte er sich auch an den Faustschlag. Er war so plötzlich, so unvermittelt aus dem Nichts gekommen, dass er überhaupt nicht gewusst hatte, wie ihm geschah. Danach war es sofort dunkel um ihn geworden. Wer ihn niedergestreckt hatte und vor allem warum, lag außerhalb seines Erinnerungsvermögens. Er hatte überhaupt keinen Schimmer, wer ihn da an der Tür bewusstlos geschlagen hatte. Unstrittig hingegen war, dass er nun an allen Gliedern gefesselt auf dem Bett seines Hotelzimmers lag.
Wild hatte keine Zeit, weiter über sein Schicksal zu grübeln, denn er hörte klappernde Geräusche, die aus der geöffneten Badezimmertür zu ihm herüberdrangen. Als er mühsam den Kopf drehte, sah er, dass neben seinem Bett eine mittelgroße Lampe stand, die zuvor nicht dort gewesen war. Ihr metallener Schirm, der aussah, als wäre er aus einem nagelneuen Kreißsaal entwendet worden, hing direkt über ihm, die Leuchte war aber nicht eingeschaltet. Sie hatte einen Fuß aus Edelstahl und sah sehr teuer aus, fast wie ein Designerobjekt.
Hinter der Lampe konnte er jetzt eine weiß gekleidete Gestalt erkennen, die mit leicht schlurfenden Schritten aus dem Bad heraustrat und sich ans Fußende des Bettes stellte. Er hatte keine Ahnung, wer da vor ihm stand, denn die Person war in ein weißes Ganzkörperkondom gehüllt und trug zudem noch eine Art Taucherbrille über dem Gesicht. Hinter dem ovalen Glas waren zwei kühle Augen zu erkennen, die ihn emotionslos musterten.
Schweigend und ohne sich zu rühren, betrachtete ihn die Gestalt, während Markus Wild allmählich der Schweiß aus allen Poren drang. Etwas kam ihm an dem Kerl bekannt vor, er konnte es nur nicht richtig greifen. Aber vielleicht nahm der Spinner ja irgendwann seine Maske ab, dann würde er es schon erfahren. Eines war jedenfalls klar: Der da am Fußende des Bettes war ganz sicher kein Fan seiner Zauberei. Eher schon jemand, der seine Vorstellung in den falschen Hals gekriegt hatte. Spätestens jetzt schwor Markus Wild tausend Eide, in diesem Leben nie mehr eine Bühne zu betreten, um Kunststücke, und zwar egal welcher Couleur, aufzuführen.
Unvermittelt gab die Person im weißen Kondom ihre meditative Haltung auf und trat ans Kopfende des Bettes. Mit einem metallischen Klicken flammte die grelle Birne der Designerlampe auf, und Markus Wild musste erst einmal geblendet die Augen schließen. Er hörte ein Klappern, als ob jemand in einem Werkzeugkasten wühlte. Blinzelnd konnte er gleich darauf weiß behandschuhte Finger über seinem Gesicht ausmachen. Sie schoben ihm mit festem Griff das linke Augenlid nach oben. Nur schemenhaft konnte er die metallisch aussehende Klammer erkennen, die von der anderen Hand über sein Auge geführt wurde und sein Augenlid in der gewählten Position fixierte. Hektisch keuchend stellte er fest, dass es ihm nun nicht mehr möglich war, mit diesem Auge zu blinzeln. Er versuchte, seinen Kopf zu bewegen, was ihm aber nicht gelang, denn die weiß behandschuhten Hände hielten ihn wie in einem Schraubstock fest.
Mit geübten Bewegungen wurde von dem Unbekannten auch sein rechtes Augenlid auf die gleiche Art und Weise fixiert. Panisch bewegte er die lidlosen Augäpfel hin und her, sein Körper wand sich unter dumpfem Stöhnen. Aber er war so bombensicher ans Bett gefesselt, dass er die Chancenlosigkeit seines Unterfangens schon nach kurzer Zeit einsehen musste und mit schweißnassem Körper seine hektischen Bewegungen einstellte. In kurzen Intervallen hob und senkte sich das Klebeband über seinem Mund, pfeifend fuhr die Luft durch seine Nase.
Seine wilden Befreiungsversuche schienen dem geheimnisvollen Fremden dennoch zu missfallen, denn er gab es auf, ihn festhalten zu wollen, und wühlte stattdessen wieder in seinem Werkzeugkasten. Kurz darauf spürte Markus Wild einen Stich in seinem linken Unterarm. Er drehte den Kopf zur Seite, konnte aber nicht sehen, sondern nur erahnen, was dort passierte. Anscheinend wurde ihm etwas in seine Vene injiziert. Sekunden später begann eine lähmende Kälte langsam durch seine Glieder zu kriechen. Er verlor jegliches Gefühl für seinen Körper, schließlich spürte er gar nichts mehr. Er konnte noch atmen und die Augen bewegen, mehr jedoch nicht. Still und reglos lag er da, hilflos und unfähig, sich zu rühren.
Die fremde Person, das unbekannte mysteriöse Kondom, das geduldig wartend neben ihm auf dem Bett gesessen hatte, beugte sich nun zu dem zweiten Bett hinüber, griff sich von dort einen kleinen Alukoffer, öffnete ihn und legte den Inhalt sorgsam neben Wild auf die Matratze. Um was es sich handelte, konnte Markus Wild nicht erkennen. Erst als die weiß behandschuhte Hand erneut über seinem Kopf auftauchte, sah er das Skalpell, das sich entsetzlich langsam näherte und schließlich direkt neben seinem linken Auge in die Haut eintauchte.
Er verspürte keinen Schmerz, er bemerkte nur, dass das halbe Zimmer auf einmal in Dunkelheit getaucht wurde, weil er nur noch auf seinem rechten Auge sehen konnte. Seine Brust krampfte sich vor lauter Panik zusammen, allerdings im übertragenen Sinn, denn er war immer noch so bewegungsunfähig wie ein Stück Holz. Mit seinem unnatürlich aufgerissenen rechten Auge sah er, wie sich die Gestalt über ihm aufrichtete und die Augen hinter der Taucherbrille etwas Blutiges, Rundes in der erhobenen Hand interessiert betrachteten. Der Unbekannte legte das blutverschmierte Etwas in einen durchsichtigen Plastikbehälter, dann beugte er sich wieder zu ihm herunter, und die Hand mit dem Skalpell näherte sich seinem rechten Auge.
Markus Wild versuchte in seiner unendlichen Verzweiflung erneut, sich loszureißen, um sich zu schlagen, den Kopf wegzudrehen oder wenigstens laut zu schreien, was ihm natürlich alles nicht gelang. Das Letzte, was er in seinem Leben sah, waren die weiß behandschuhten Finger seines Peinigers. Dann erlosch auch das Licht in seinem rechten Auge, und Markus Wild war allein in einer absolut empfindungslosen Dunkelheit. Diesen grausamen Zustand musste er eine gefühlte Ewigkeit ertragen, bis ihm die Droge in seinen Adern einen letzten Dienst erwies und sein Herz von einer Sekunde zur anderen aufhörte zu schlagen.
Der Betriebsausflug der Bamberger Kripo war an seinem Ziel angelangt, dem Wildpark im Tambacher Schloss nahe Coburg. Da Honeypenny in diesem Jahr vorschlagsberechtigt gewesen war, hatte sie sich, auch im Hinblick darauf, Riemenschneider etwas Gutes tun zu wollen, kurzerhand für den Wildpark ausgesprochen. Schließlich gab es hier nicht nur Menschen, denen das kleine Schwein sowieso rund um die Uhr ausgesetzt war, sondern auch haufenweise andere Tiere und sogar ein Wildschweingehege. Das Ermittlerferkel wäre dann sozusagen endlich einmal unter seinesgleichen.
Es war ein wunderschöner Februarmorgen und früh, weshalb die Ausflugsgesellschaft spontan beschlossen hatte, sich zunächst einmal im Biergarten des Wildparks gleich neben dem Eingang der angebotenen Kulinarik hinzugeben. Im Gras glitzerten in der Morgensonne immer noch die letzten Eiskristalle einer frostigen Nacht, was der Grund dafür war, dass Robert Suckfüll, der Leiter der Dienststelle, seinen Mitarbeitern den Besuch des Stehimbisses dringend ans Herz gelegt hatte. Erstens waren Tiere in halbfreier Wildbahn sowieso nicht sein Ding, und zweitens, ein Punkt von noch größerer Bedeutung, hatte er Angst um den guten Zustand seiner teuren schwarzen Lederschuhe. Sie waren neu, sie waren sauber, und das sollte bitte schön auch so bleiben. In einem Gelände voller Tiere, Schmutz und Dreck, noch dazu um diese Jahreszeit, war die Gefahr groß, dass seine edle Fußbekleidung in Mitleidenschaft gezogen wurde. Das jedoch durfte unter gar keinen Umständen geschehen.
Am liebsten hätte er sich schon bei Aufkommen der Idee strikt geweigert, in diesen Wildpark zu gehen. Schließlich war er der Chef, und außerdem musste er kraft seines Amtes den ganzen Ausflug auch noch bezahlen. Aber da er von lauter willensstarken Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen umringt war, die bei derlei Entscheidungsfindungen keine Gnade kannten, hatte er schon bald einsehen müssen, dass er mit seinem Ansinnen, das Ausflugsziel zu korrigieren, auf Granit biss.
»Könnten wir nicht einfach in ein Museum gehen?«, hatte er seine Belegschaft angebettelt. »Oder zum Nürnberger Flughafen vielleicht?«
»Nein, wir gehen in den Wildpark, wie Marina es vorgeschlagen hat«, stellten seine Mitarbeiter beharrlich fest. Der Ton, in dem sie das sagten, hatte jeden Einwand zunichtegemacht. Es würde ihm außerdem guttun, sich einmal draußen an der Sonne und der frischen Luft zu bewegen, anstatt dauernd in seinem gläsernen Büro Akten zu wälzen, hatten sie gemeint.
Nachdem er also keine Unterstützung für seine Gegenvorschläge gefunden hatte, war der Ausflug so beschlossen worden, mit einer – seiner – Gegenstimme.
Nun gut, jetzt galt es, das Beste daraus zu machen. Sie saßen hier so schön in der wärmenden Sonne, vielleicht konnte er den Lauf der Dinge ja so geschickt lenken, dass sich die Zeit im Biergarten immer mehr verlängerte und der Gang durch die unwegsame Flur sich entsprechend verkürzte, vielleicht sogar komplett ausfiel. Dann wäre der Ausflug für ihn persönlich wenigstens halbwegs gerettet.
»Also, es ist wirklich schön hier, das muss ich schon sagen«, meinte er beflissen und streckte sich etwas theatralisch. »So lässt es sich aushalten. ›Da bin ich hier, Mensch darf ich sein‹, wie der alte Schiller zu sagen pflegte.« Er gab einen zufriedenen Seufzer von sich.
Aber seine Absichten der faulen Art wurden leider sofort durchschaut. Zu durchsichtig sein Begehren, zu aufgesetzt seine Begeisterung. Robert Suckfüll war nie begeistert, schon gar nicht überschwänglich.
»Erstens stammt das von Goethe und heißt doch auch ganz anders«, wandte Marina Hoffmann alias »Honeypenny« ein, während sie die Riemenschneiderin zwischen den Ohren kraulte.
»Und zweitens ist das doch nur ein billiges Ablenkungsmanöver, damit du nicht mit deinen heiligen Schuhen durch den Park laufen musst«, ergänzte Eleonore, seine Frau, mit einem bissigen Unterton in der Stimme. »Andere Menschen haben verschiedene Schuhe für verschiedene Zwecke zu Hause stehen. Nur du hast sieben Mal das gleiche Paar, egal ob Sommer oder Winter. Selbst schuld, kann ich da nur sagen. Aber bei so vielen Schuhen ist es andererseits überhaupt nicht schlimm, wenn ein Paar davon dreckig wird, selbst wenn es aus Italien stammt und fast vierhundert Euro gekostet hat.« Mühsam beherrscht schaute sie zuerst auf ihren Göttergatten, dann auf dessen schwarz glänzendes Schuhwerk.
Robert Suckfüll ärgerte sich zwar mehr über sich selbst und sein klägliches Scheitern als über seine Frau, aber er war nicht bereit, kampflos aufzugeben. Er hing sehr an seinen italienischen Schuhen, mindestens so sehr wie an seinen Zigarren. Gerade hing er an ihnen sogar mehr als an seiner Frau.
»Also wirklich, Eleonore, das ist überhaupt nicht wahr«, entgegnete er aufgebracht. »Ich habe gar nichts dagegen, ein bisschen zu laufen. Es muss aber doch nicht unbedingt zwischen so vielen schmutzigen Tieren sein. Außerdem finde ich es richtig schön an diesem kleinen Ausschank. Hier gibt es warmen Tee, Glühwein oder was auch immer. Ich glaube, du hegst heute ganz einfach irgendeine, äh, Antisympathie gegen mich. Das Laufen durch all den Mist und Dreck mag dir ja vielleicht gefallen, mir aber nicht, Eleonore.« Fidibus holte tief Luft. »Du musst das auch einmal von der negativen Seite sehen, also von meiner«, setzte er nach, ohne jedoch wirklich an einen Erfolg seiner Argumentation zu glauben.
Der Blick seiner Frau verdüsterte sich langsam, aber konsequent, woraufhin er sich hilfesuchend den anderen Anwesenden zuwandte. Irgendjemand musste ihn doch verstehen, musste seine Gemütslage nachempfinden können. Verzweifelt sah er von einem zum anderen. Lagerfeld versuchte mühsam, seine Mimik im Griff zu behalten, während Haderlein sein legendäres Pokerface für die ganz schwierigen Fälle aufsetzte. Die beiden waren heute frauenlos unterwegs, da hatten sie offenbar keine Lust, sich in den Kampf der Geschlechter einzumischen. Ergo konnte Fidibus bei keinem seiner untergebenen Kommissare irgendeine Art von Zuspruch ernten. Sollten sich mal schön die anderen fetzen. Als ihm in letzter Instanz auch vonseiten seiner Dienststellensekretärin nur ein strafender Blick zuteilwurde, langte es ihm aber wirklich.
»Frau Hoffmann, was erlauben Sie sich? Jetzt schauen Sie mich bitte nicht in diesem Ton an, ja!«, krakeelte er ungehalten. »Zumindest von Ihnen hätte ich ein bisschen mehr Beistand und Mitgefühl erwartet. Sie wissen ja, halbes Leid ist gemeinsam geteilt oder so ähnlich«, lamentierte er in der Hoffnung, Honeypenny möge sich nun endlich seiner Notlage annehmen.
Ihre Reaktion war jedoch eine andere, als Fidibus im Sinn gehabt hatte. Honeypenny sprang ihm mitnichten zur Seite, nein, sie solidarisierte sich sogleich und zu einhundert Prozent mit dem weiblichen Teil der anwesenden Ausflugsschar.
»Wir hatten ausgemacht, dass wir heute Riemenschneider zuliebe durch den Tierpark laufen. Und das heißt, dass wir heute durch den Tierpark laufen werden. Es ist fast März, die Sonne scheint, es gibt keinen Grund, es nicht zu tun. Nicht wahr, mein kleiner Liebling?« Honeypenny kraulte das kleine Schweinchen, das zwischen ihr und Eleonore auf dem Boden saß und schon seit Längerem ein ferkeliges Grinsen aufgesetzt hatte.
Den Chef beeindruckte allerdings weder die Argumentationsreihe seiner Bürokraft noch das freundliche Wesen Riemenschneiders. »Ja, aber diese unpassenden Wege sind –«, hob er zur Gegenrede an, konnte den Satz jedoch nicht beenden, denn er wurde sofort und energisch von seiner Frau gemaßregelt.
»Es gibt keine unpassenden Wege, nur unpassende Schuhe. Und jetzt sei bitte endlich still, Robert, du versaust uns sonst noch den ganzen Ausflug. Wenn du dich weigerst, angemessenes Schuhwerk für gröberes Gelände zu kaufen, ist dir nun mal nicht zu helfen. Dann musst du eben mit deinen Designerschuhen durch den Dreck laufen, basta!«, rief seine bessere Hälfte erregt, woraufhin ihr Mann sie nur noch erschrocken anglotzte.
Betretenes Schweigen breitete sich aus, denn es lag ein handfester Ehekrach in der Luft. Und das war ja wohl das Letzte, was man sich auf einem Betriebsausflug wünschte. Zäh verstrichen die Sekunden, ohne dass sich irgendjemand dazu aufraffen konnte, die angespannte Situation aufzulockern. Schließlich erhob sich mit einem leisen Grunzen das kleine Ferkel, schüttelte sich und machte sich gemächlichen Schrittes auf den Weg. Es mochte der plötzliche Stimmungsabfall gewesen sein oder dass sie sich durch den Terminus »versaut« angesprochen fühlte, wie auch immer. Jedenfalls begab sich die Riemenschneiderin zu dem mit verschränkten Armen und bockig verdunkelter Miene dasitzenden Dienststellenleiter und fing, dort angekommen, an, ihren Kopf an dessen rechtem Hosenbein zu reiben. Dabei schaute sie immer wieder mit treuherzigem Blick zu Fidibus hinauf. Es war ihr Spezialblick. Ein Gesichtsausdruck, der eine so fröhliche Unschuld emittierte, wie sie sonst nur Neugeborene zuwege brachten, wenn sie ihre Mutter in der Hoffnung auf reichliche Zuwendung anstrahlten.
War es wirkliches Mitgefühl oder nur eiskalte Berechnung des kleinen Schweins, das endlich zu seinen wilden Artgenossen wollte? Egal, es half. Suckfülls Bitternis schmolz dahin wie Vanilleeis in der Sommersonne und ebenso der Ärger seiner Frau. Als Riemenschneider zu guter Letzt auch noch einen Fussel von Suckfülls Beinkleid in die Nase bekam und erst einmal herzhaft niesen musste, war der Bann gebrochen, und die ganze Runde brach in ein schallendes Gelächter aus.
»Da hast du wieder mal Schwein gehabt«, beschied Eleonore Suckfüll ihren Mann mit versöhnlicher Miene.
Auch der Schuhträger beschloss, erst einmal alles auf sich beruhen zu lassen und sich in sein Schicksal zu fügen. Er gab sich sogar einen Ruck und verkündete lautstark an die Bedienung gerichtet, dass er bitte zahlen wolle, da sie ja noch einen langen Weg durch den Wildpark vor sich hätten. Wenig später machte sich der Betriebsausflug der Bamberger Kriminalpolizei auf den Weg durch den Irrgarten des Tambacher Schlossparkgeländes.
Irgendwann fiel ihr der Mann auf. Sie hatte eine geraume Zeit im Burggraben fotografiert und auch durchaus sehenswerte Motive erknipst. Das Licht war wirklich wunderbar und zeigte sowohl die Buden mit ihren ausgestellten Sachen wie auch die dazugehörigen Besitzer und die immer zahlreicher werdenden Besucher von ihrer besten Seite. Als die Sonne jedoch nach oben geklettert war und ihr Licht immer steiler fiel, hatte sie beschlossen, erst einmal eine Pause einzulegen. Über Mittag war das Licht nur noch hell und hart, die romantische Stimmung war vergangen und hatte der grellen Wirklichkeit Platz gemacht. Auch unter diesen veränderten Umständen konnte man gute Fotos machen. Aber dazu musste sie zuerst den Standort und vor allem die Kamera wechseln.
Sie war einmal um die Burganlage herum und dann wieder nach oben gegangen, um sich einen schattigen Platz zu suchen. Ihr Equipment hatte sie erst einmal zur Seite gestellt und damit begonnen, sich ihre fotografische Ausbeute auf dem klappbaren Display ihrer Kamera anzusehen und offensichtlich missratene Aufnahmen zu löschen. Bild für Bild zog der Vormittag erneut an ihr vorbei, bis sie auf einmal stutzte und wieder zurückblätterte.
Tatsächlich, sie hatte sich nicht getäuscht. Da stand ein Mann, der geradezu provozierend in die Kamera lächelte. Das war an und für sich nichts Besonderes, das taten die Menschen des Öfteren, wenn sie merkten, dass sie fotografiert wurden. Aber der Typ war nicht nur einmal zu sehen, auch nicht zweimal. Nein, er war zum Schluss auf beinahe jeder Aufnahme drauf. Immer grinste der Idiot von irgendwoher in die Kamera.
Das war nicht nur lästig, das war richtig scheiße. Dopplungen auf den Bildern konnte sie überhaupt nicht brauchen, die konnte sie wegschmeißen. Sie brauchte verschiedene Menschen, nicht nur einen. So ein Mist. Wer war der Kerl, und was sollte das? Wollte er sie anmachen? Auf den Fotos hatte er zwar gut ausgesehen, aber sie war nicht zum Flirten hier, sondern zum Arbeiten. Verärgert schaute sie sich um und versuchte, das Gesicht des Unbekannten irgendwo zu entdecken, aber er war verschwunden.
Resigniert schnaufte sie einmal laut und beschloss, sich dadurch den Tag nicht verdrießen zu lassen. Es waren wirklich schöne Fotos dabei. Und bei den anderen konnte sie diesen Affen ja vielleicht irgendwie retuschieren oder gleich ganz rausschneiden. Wozu gab es denn Computer, nicht wahr?
Sie stopfte die Fuji in den Rucksack und holte die Pentax mit dem Porträtobjektiv heraus. Hundertfünfunddreißig Millimeter. Bei der Brennweite waren jetzt erst einmal viele schöne Gesichter in Großaufnahme angesagt. Keine Chance für männliche Komiker, sich irgendwie ins Bild zu mogeln.
Mit einem grimmigen, entschlossenen Gesichtsausdruck mischte sie sich auf der oberen Etage des Schlossgeländes unter die Leute, auf der Jagd nach geeigneten Motiven.
Das war jetzt das letzte Zimmer gewesen, beinahe jedenfalls. Denn da war immer noch die Nummer 217. Das Zimmer, an dessen Tür unverändert das Schild »Bitte nicht stören« hing. Aber inzwischen war es elf Uhr dreißig, und selbst bei der allergrößten Toleranz den Hotelgästen gegenüber war es nun langsam an der Zeit, dass die Gäste da drin ihr Zimmer endlich räumten, damit sie ihre Arbeit als Putzfrau auf diesem Stockwerk beenden konnte. Wie lange sollte sie noch warten? Unschlüssig stand sie vor der Tür und horchte, aber aus dem Zimmer drangen keinerlei Geräusche, keine Anzeichen, dass die Bewohner vielleicht im Aufbruch befindlich waren, da rührte sich überhaupt nichts.
Jetzt hatte sie genau zwei Möglichkeiten. Entweder sie ging runter und fragte an der Rezeption nach, was sie tun sollte, oder sie stellte sich blöd und gab vor, das Schild draußen an der Tür nicht gesehen zu haben. Sie musste nur einen vollkommen überraschten Gesichtsausdruck aufsetzen, wenn die verpennten Gäste erschrocken aus den Laken hüpften, sobald sie mit Staubsauger und Wägelchen ins Zimmer kam.
Ein heikles Unterfangen, denn ebendas war erst letzte Woche gehörig schiefgegangen, als dieser prominente Komiker hier übernachtet hatte. Marius Bard oder so ähnlich hatte der geheißen. Angeblich war er total bekannt, aber ihr hatte der Name überhaupt nichts gesagt. Jedenfalls hatte sie den Kerl etwa um die gleiche Zeit aus dem Bett geschmissen, zusammen mit seinen geschätzt siebenundzwanzig Gespielinnen, mit denen er gerade zugange war. Logisch, dass da Zeit draufging, wenn die alle zu ihrem Recht kommen wollten.
Jedenfalls hatte es hernach ein Riesentheater gegeben, dieser Herr Bard hatte sich massiv bei der Geschäftsführung über sie beschwert. Was bei den Oberen im Haus anscheinend mächtig Eindruck gemacht hat. Denn sie war angewiesen worden, bei weiteren Fällen der prominenten Art besser unten bei der Leitung nachzufragen, mindestens jedoch dreimal zu klopfen, bevor sie unangemeldet ein Zimmer betrat, an dessen Tür ein »Bitte nicht stören«-Schild hing. Das Zimmer hieß seit diesem unerquicklichen Vorfall bei ihr und ihren Kolleginnen wie auch bei der Geschäftsleitung bloß noch »Künstlerzimmer«. Und jetzt hatten sie bestimmt wieder so einen Durchgeknallten im Künstlerzimmer einquartiert, der seinen Tag etwas anders einteilte als der normal arbeitende Mitteleuropäer.
Sie hob die Hand und klopfte vorsichtig an die Tür. Aufmerksam lauschte sie und erwartete irgendeine Reaktion, die aber nicht kam. Also klopfte sie wieder, diesmal mit etwas mehr Vehemenz, aber auch jetzt ließ ihr Klopfen jegliche Reaktion vermissen. Vielleicht waren die Gäste ja auch einfach schon ganz früh gegangen und hatten nur vergessen, das Schild zu entfernen? Das kam vor. Aber in diesem Fall hätte ihr die Geschäftsleitung Bescheid gegeben. Wieder klopfte sie, diesmal so laut sie konnte, und wieder war aus dem Zimmer absolut nichts zu vernehmen. Na gut, also bitte, sie wollen es ja nicht anders, dachte sie verärgert, schob ihren Generalschlüssel ins Schloss und drehte ihn nach rechts. Egal wen oder was sie da drin noch vorfinden würde, jetzt wurde geputzt.
Sie hatte die Tür kaum geöffnet, da überkam sie so ein komisches Gefühl. Irgendetwas stimmte hier nicht, das sagte ihr die langjährige Erfahrung als Reinigungskraft, ihre innerste Putzfrauenempfindung. Die merkwürdige Beklemmung wurde noch stärker, als sie, im Türrahmen stehend, auf einem der Betten am anderen Ende des Zimmers die beiden nackten Füße erblickte. Das, was noch zu den Füßen gehören mochte, war für sie aufgrund der L-Form des Raumes erst einmal nicht zu sehen. Aber etwas war oberfaul, denn obwohl sie sich einigermaßen geräuschvoll verhalten hatte, rührten sich die Füße nicht, und auch sonst blieb alles merkwürdig still.
»Hallo!«, rief sie hoffnungsfroh ins Zimmer hinein, doch es geschah nichts, absolut nichts. Ihre Zuversicht sank. Sehr viele Möglichkeiten gab es nicht, wenn jemand auf dem Bett lag und sich trotz lautem Rufen nicht bewegte. Entweder derjenige wollte nicht, oder er konnte nicht. Die letztere der beiden Alternativen mochte sie sich lieber nicht vorstellen. Aber irgendetwas musste sie tun, hier herumzustehen brachte sie nicht weiter. Sie fasste sich also ein Herz und ihren Wischmopp und ging vorsichtig in das Zimmer hinein.
Die Füße immer im Auge behaltend, umkurvte sie die Nasszelle, bis sich ihr Sichtfeld weitete. Halb bewusst registrierte sie, dass die Füße des Mannes am Fußende des Bettes festgebunden waren, dann nahm sie der Anblick des Ganzen gefangen.
Sie stellte sich erst gar nicht die Frage, ob der Mann tot war, denn das war offensichtlich. Sie stellte sich eigentlich gar keine Frage. Das Bild, welches sich ihr bot, war einfach zu entsetzlich, als dass sie noch irgendeinen klaren Gedanken fassen konnte.
Interessanterweise wurde ihr Blick nicht zuallererst von dem Getöteten und dem ganzen Blut, sondern von dem Schriftzug angezogen, der breit und rot an der Wand über dem Bett prangte. Erst danach konnte sie sich dem Toten auf dem Bett zuwenden. Überall war Blut. Der Mann, das Bett, die Wand, der ganze Fußboden, alles war voll davon. Aber am schlimmsten war der Anblick des Gesichtes. Ein menschliches Gesicht, dem der Blick fehlte. Irgendjemand hatte die Augen des Mannes entfernt, sodass der Tote sie aus leeren blutigen Höhlen zu betrachten schien. Was sonst noch mit diesem Menschen angestellt worden war, wollte sie gar nicht wissen. Sekundenlang stand sie wie angewurzelt da, unfähig, sich zu rühren, dann begann ihr Körper zu reagieren.
Flucht war der dringende Befehl, den das Stammhirn mittels Hormonausschüttung befahl. Susanne Schmittlutz, dienstälteste Reinigungsfachkraft im Hotel »Bamberger Hof«, gehorchte auf der Stelle und ohne jeden Widerstand. Sie ließ ihren Wischmopp und den Schlüsselbund dort, wo sie sich gerade befand, auf den Boden fallen, und rannte hysterisch schreiend aus dem Zimmer.
Die ersten fünfzig Meter des Rundweges im Tambacher Wildpark waren völlig dreckfrei und somit ganz in Suckfülls Sinn verlaufen. Ein trockener, geschotterter Weg ohne jeglichen Schmutzansatz. Allerdings wurde Fidibus das Gefühl nicht los, dass er sich auf diese trügerische Sicherheit besser nicht verlassen sollte. Es war wohl eher so, dass er sich in der gleichen Lage wie der berühmte Mann befand, der gerade von einem Hochhaus stürzt. Nach fünfzig Metern freien Falls am ersten Stockwerk angekommen, denkt er zufrieden: Na ja, bis jetzt ist ja noch alles gut gegangen.
Auf welcher Etage sich Fidibus gerade befand, zeigte sich in dem Moment, als Honeypenny, die mit Riemenschneider an der Leine an der Spitze des kriminalen Konvois ging, laut ausrief: »So, jetzt müssen wir nach links!« Denn dieses »links« bedeutete, einen ausgetretenen, ungeschotterten, vor allem aber feuchtlehmigen, frisch aufgetauten und versifften Waldweg entlanggehen zu müssen. Der Sturz vom Hochhaus war zu Ende, der Aufschlag hart und schmerzhaft.
Eleonore sagte nichts, sondern schaute ihn nur mit einem dunklen, warnenden Blick an, dann ging sie mit ihren knöchelhohen Wanderschuhen Honeypenny hinterher. Auch Haderlein und Lagerfeld stapften schon fröhlich durch den Dreck, während Robert Suckfüll immer noch missmutig auf das Schild starrte, das die Parkleitung am Zaun angebracht hatte. »Wildschweingehege«, stand groß und deutlich darauf zu lesen.
Noch einmal betrachtete der Leiter der Dienststelle der Bamberger Kriminalpolizei seine Schuhe im Urzustand, dann schlich er, staksig wie ein Storch im Salat, dem Rest der Gesellschaft hinterher.
Honeypenny und Eleonore hatten zwischenzeitlich das Heft des Handelns in die Hand genommen und liefen nun voraus, den zunehmend schmaler werdenden Weg entlang, der sich wenig einladend den leicht ansteigenden Hang hinaufwand. Eleonore hatte Riemenschneiders Leine übernommen und sich mit dem Hausschwein an die Spitze des Grüppchens gesetzt, gefolgt von Marina Hoffmann. Franz Haderlein und Lagerfeld marschierten quasi im Windschatten hinterher, ihrerseits intensiv in Männergespräche vertieft.
»Macht Ute jetzt eigentlich Ernst mit eurer veganen Ernährungsumstellung?«, fragte Haderlein seinen jüngeren Kollegen, was bei Bernd Schmitt sofort ein merkliches Zusammenzucken des ganzen Körpers auslöste. Haderlein nahm dies schmunzelnd zur Kenntnis, verkniff sich aber jedweden Kommentar. Der liebe Lagerfeld würde schon mit der Sprache rausrücken, wenn er Redebedarf hatte.
Den hatte er, und das nicht zu knapp.
»Ja, macht sie. Sie zieht die vegane Nummer gnadenlos durch«, presste Lagerfeld mit gesenktem Blick zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. »Und das ist noch längst nicht alles. Das Essen ist inzwischen nicht mehr ihre einzige Spielwiese, was ihren Planungswahn anbelangt. Sie macht jetzt auch Zeitpläne, wann und wie unsere Tochter bewegt werden soll. Darin steht nicht nur, zu welchem Zeitpunkt, sondern auch, wo und wie weit. Papa Bernd kann sich also nicht einfach den Kinderwagen inklusive Tochter schnappen und das Teil mal hierhin oder dorthin schieben, nein.« Lagerfeld kickte mit seinem Wanderschuh einen mittelgroßen Stein in hohem Bogen ins Gebüsch. »Es ist vielmehr so, dass ich jetzt jeden Montagmorgen einen genau ausgetüftelten Wochenplan bezüglich meiner väterlichen Arbeitspflichten vorfinde. Die Zukunft unserer Tochter wurde von ihrer Mutter im Prinzip schon für Jahrhunderte im Voraus durchstrukturiert – und meine gleich mit.«
Wieder flog ein unschuldiger Stein krachend ins Gebüsch, während der erst kurz vor Weihnachten zum ersten Mal Vater gewordene Kollege weiter seiner gequälten Seele Ausdruck verlieh.
»Und natürlich legt Ute, um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, mein lieber Franz, trotz dieses zusätzlichen Aufwands auch weiterhin eine einhunderttausendprozentige Konsequenz an den Tag, was die gesunde Ernährung der Familie Schmitt/von Heesen anbelangt.«
»Doch so schlimm?«, stellte Haderlein mehr fest, als dass er fragte. Da schien ja gerade so richtig was am Dampfen zu sein in der Loffelder Mühle. Aber anscheinend war es gut, dass er gefragt hatte, denn Lagerfelds Gemüt glich einem gewaltigen Frustpickel, in den Haderlein gerade hineingestochen hatte. Der Inhalt desselben quoll jetzt ungehindert heraus. Die Seelennot war so groß, dass Lagerfeld sprachlich nicht mehr an sich halten konnte und spontan ins Fränkische verfiel.
»Dofu, die ganze Woche nur so a Sojascheiße. Ich frage dich, Franz. Wozu macht mer a Wurscht aus Soja, wenn die nacherd gar net nach Wurscht schmeckt? Gräuterbradlinge, Sellerieschnidzel, Lauchcordonblö. Und als glanzvoller Höhepunkd letzta Wochen: a Sojaschäuferla. Stell dir das amal vor, Franz. A Schäuferla aus Soja, mit am Gnochen aus gepressdem Bioholz!« Erst jetzt hob Lagerfeld den Kopf und drehte ihn in Haderleins Richtung. Sein Blick irrlichterte regelrecht vor veganer Verzweiflung. Ein schlabbriges Tofu-Schäuferla tanzte in jeder von Lagerfelds Pupillen einen feurigen Tanz.
Dass es so schlimm um ihn stand, hatte sich Franz Haderlein bisher nicht vorstellen können. Andeutungsweise hatte er zwar schon ein paar Bemerkungen von Honeypenny mitgekriegt, aber das hier neben ihm, das war doch gar nicht mehr sein schnoddriger, lebenslustiger Kollege Bernd Schmitt, das war eine tickende Zeitbombe.
Den Tofu- und Beziehungsterror, dem Lagerfeld allem Anschein nach ausgesetzt war, konnte sich Franz Haderlein allerdings sehr gut vorstellen. Natürlich war kein Lebenspartner auch nur ansatzweise neutral, wenn er über seine bessere Hälfte lamentierte. Aber der Kommissar kannte Bernds Lebensgefährtin inzwischen ziemlich gut und wusste, wie verbissen sie manchmal war. Alles planend, mit der ihr eigenen Akribie. Kein Wunder bei ihrem Beruf. Wenn man Leiterin der Revision in einem großen Unternehmen wie der HUK Coburg war, musste das ja irgendwie aufs Privatleben abfärben. Und auch wenn sein junger Kollege bekanntermaßen einen eher lässigen Lebensstil pflegte, weshalb ihm ein bisschen mehr Ordnung durchaus guttat, so schien es die liebe Ute, wenn auch nur die Hälfte von Bernds Schilderungen der Wahrheit entsprach, mit der mütterlichen Brutpflege doch gewaltig zu übertreiben.
Aber was sollte er sagen? Franz Haderlein war zwar keinesfalls ahnungs-, jedoch kinderlos. Da war mangels Eigenerfahrung bei eventuellen pädagogischen Ratschlägen Vorsicht geboten. Aber sein vom Beziehungsleben gebeutelter Kollege wirkte dermaßen verzweifelt, dass Haderlein ihm motivierend unter die Arme greifen wollte.
»Also, ich kann ja nicht wirklich mitreden, Bernd, an mir ging der Kelch der Elternschaft, wie du weißt, vorüber. Aber eines hat mich das Leben als Mann auf dieser Welt inzwischen gelehrt: Versuche um Himmels willen nicht, Utes Verhalten als Mutter zu verstehen. Sie ist nun mal eine sehr eigenwillige Frau, die Planungssicherheit braucht. Außerdem ist es ihr erstes Kind, genauso wie für dich, Bernd. Da spielen die weiblichen Hormone schon mal verrückt. Ich will damit nicht sagen, dass man alles entschuldigen muss, aber ein bisschen Nachsicht ist vielleicht angeraten.«
Wenn Haderlein jetzt gehofft hatte, Lagerfeld mit seinen Worten ein wenig aufmuntern zu können, so täuschte er sich gewaltig. Nichts dergleichen geschah, im Gegenteil, der junge Vater redete sich erst richtig in Rage.
»Was soll ich ihr nachsehen? Die weiblichen Hormone? Das is ja wohl ein Witz, oder? Immer wenn Frauen nicht erklären können oder wollen, warum sie gerade sind, wie sie sind, müssen irgendwelche Hormone herhalten. Ich habe es langsam satt, mir diesen Mist anzuhören, Franz. Sind Mütter demnach keine selbstständig denkenden Wesen mehr, oder was? Vom eigenen Körper ferngesteuert? Nur noch armselige Sklaven ihrer Säfte?« Rot traten die Halsschlagadern des echauffierten Papas hervor, der sich immer mehr aufregte und wieder in seinen heimatlichen Dialekt verfiel. »Ich hab ka Lust mehr auf den ganzen Scheiß, Franz, ich will widder mei ganz normales Leben ham, die Leichtigkeit des Seins zurück, verstehsde?« Wieder flog ein Stein ins Gebüsch. Diesmal von solcher Größe, dass Haderlein sich Sorgen um Bernds Zehen machte.
Franz Haderlein verstand Lagerfeld sehr gut, war von dessen spontanem Gefühlsausbruch aber derart baff, dass er erst einmal nicht wusste, was er sagen sollte. So hatte er Bernd ja noch nie erlebt. Ehe er sich neu sortieren und eine passende Antwort formulieren konnte, drehte sich allerdings die vor ihnen laufende Marina »Honeypenny« Hoffmann ruckartig um und funkelte Lagerfeld angriffslustig an.
»Ich habe alles gehört, Bernd. Frauen sind also Sklaven ihrer Säfte, aha, sag mal, weißt du eigentlich, was Frauen durchmachen müssen während einer Schwangerschaft? Hast du eine Ahnung, was der Körper einer Frau alles aushalten muss bei einer Geburt? Und da kommst du erbärmliches Männchen daher und jammerst über deine kleinen Problemchen? Von seinem Lebenspartner erwartet man als Frau ein bisschen mehr Verständnis, mein lieber Papa. Frauen sind nun mal anders als Männer. Wir lösen unsere Probleme auf anderem Weg. Das sieht auf den ersten Blick nicht immer logisch aus, weil wir viel häufiger nach Gefühl handeln als ihr, nach Intuition.«
Mit hoch erhobenem Zeigefinger stand Honeypenny vor ihnen und schaute Lagerfeld drohend an. Der vernichtende Blick, den ihr der aufgebrachte Papa zuwarf, ließ jedoch einen fürchterlichen Verdacht in ihr aufkommen. Einen Verdacht, der ihr noch mehr als sowieso schon die Zornesröte ins Gesicht trieb.
»Oder willst du vielleicht andeuten, Bernd, wir Frauen wüssten nicht, was wir tun? Hältst uns wohl für doof, für unzurechnungsfähig, oder was?«
Franz Haderlein hielt sicherheitshalber die Luft an. Er kannte Honeypenny. Wenn sich Bernd jetzt nicht unverzüglich mäßigte und etwas Deeskalierendes absonderte, würde ein Unglück geschehen. Ein falsches Wort, und Honeypenny verwandelte sich in eine hell lodernde Furie, in die Jeanne d’Arc des heutigen Betriebsausfluges.
Lagerfeld schien zu Haderleins Erleichterung auch tatsächlich einen Moment innezuhalten und zu überlegen. Dann entgegnete er jedoch kurz und trocken: »Alle Menschen sind klug, Honeypenny, nur Ausnahmen haben die Regel.«
Haderlein hatte keine Ahnung, wo Bernd diesen Spruch herhatte, aber er war ganz sicher nicht dazu geeignet, die Lage auch nur ansatzweise zu befrieden. Es drohte der Super-GAU. Zum Glück war Jeanne d’Arc ob dieser männlichen Unverschämtheit einen Moment lang derart perplex, dass er sich zwischen die beiden Kampfhähne schieben konnte, im Bestreben, Schlimmeres zu verhindern. Das war auch zwingend nötig, denn Honeypenny und Lagerfeld standen sich wie zwei Boxer gegenüber, die sich gleich aufeinanderstürzen wollten. Allerdings bewegte sich Marina Hoffmann in einer weit höheren Gewichtsklasse als Lagerfeld, sodass der Kampf mit ziemlich ungleichen Mitteln geführt werden würde. Doch ehe Haderlein die beiden erhitzten Gemüter trennen konnte, war von etwas weiter oben den Berg hinauf die Stimme von Eleonore Suckfüll zu vernehmen. Sie stand am Wegesrand und deutete aufgeregt über ein hölzernes Gatter, während Riemenschneider bereits neugierig an der straff gespannten Leine zog.
»Wir sind da, wir sind da!«, rief sie aufgeregt und winkte zu ihnen hinunter. Im nächsten Moment bemerkte sie die angespannte Situation und hörte sicherheitshalber mit dem Winken auf. Was war da los? Noch etwas weiter zurück konnte sie ihren Mann erkennen, der im Zickzackkurs den Weg heraufgelaufen kam. Was sollte das denn werden, wollte der Kerl etwa jedem Lehmbröckelchen ausweichen? Egal, direkt vor ihr lag das Wildschweingehege, und sie war mehr als gespannt, wie sich Riemenschneider mit ihrer wilden Verwandtschaft vertragen würde. Die wie auch immer geartete Situation unterhalb ihres Standpunktes schien sich bereits wieder aufzulösen, und wann ihr Göttergatte zu ihr stoßen würde, stand sowieso in den Sternen, auf den brauchten sie nicht zu warten.
Unterdessen rührte sich aber etwas in dem Wildschweingehege. Riemenschneider hatte die Leine zum Zerreißen gespannt und lauschte und schnupperte mit hoch aufgestellten Ohren in die Welt hinter dem Bretterzaun. Die Gerüche, die das Schwein von dort aufnahm, waren zwar fremd, aber auch irgendwie vertraut. Auf jeden Fall roch alles fürchterlich aufregend, und sie konnte kaum erwarten zu sehen, was da gerade auf sie zukam. Denn jenseits des Zaunes war Bewegung zu erkennen.
Irgendetwas großes Schwarzes kam aus dem Dunkel der Bäume direkt in Richtung des kleinen Ferkels gelaufen. Zuerst konnte Riemenschneider nur diffuse Schatten erkennen, dann schälten sich die Silhouetten verschieden großer Schweine aus dem Dunkel zwischen den Bäumen heraus. Allerdings sahen diese Schweine völlig anders aus als Riemenschneider – und damit auch völlig anders, als Riemenschneider sich ihre Artgenossen vorgestellt hatte. Je näher diese sogenannten Schweine kamen, umso befremdeter war sie von dem, was ihre Augen da geboten bekamen. Das Erscheinungsbild der Rotte, die auf sie zugelaufen kam, war für sie regelrecht erschreckend, sozusagen unter aller Sau.
Lange dunkle Borsten, dreckig, voller Schlamm. Hatten diese Schweine kein Bad, niemanden, der sich um ihr Äußeres kümmerte? Die sahen ja alle völlig heruntergekommen aus! Und vornweg trottete anscheinend der missmutige Chef der ganzen Truppe. Ein griesgrämig dreinschauendes Männerschwein, das sie anschaute, als hätte sie ihm gerade das Mittagessen geklaut.
Riemenschneider war konsterniert und überlegte kurzzeitig, ob sie von dem geplanten Kennenlernevent mit dieser wüsten Truppe vielleicht doch besser Abstand nehmen sollte. Und sie wäre wohl schon im angeekelten Rückzug begriffen, wäre da nicht dieser absolut faszinierende, wilde, animalische Duft, der von den schwarzen Gesellen ausging und wie ein olfaktorischer Tsunami auf sie einströmte. Also blieb sie stehen, und ehe sie sich versah, drückte sich auch schon der Rüssel des mächtigen Keilers durch einen Spalt im Zaun und auf ihr zierliches kleines rosa Pendant. Dampfende Wolken aus Atemluft ausstoßend, sog der Keiler die Gerüche ein, die von ihr ausgingen, um hernach zu entscheiden, wie das alles hier einzuordnen war.
Die menschliche Zuschauerschar hatte zwischenzeitlich, von Fidibus einmal abgesehen, das hölzerne Gatter erreicht und harrte gebannt der Ereignisse im zwischenschweinischen Bereich, die nun erfolgen mochten. Den ersten Kontakt mit dem großen Keiler, dem Familienoberhaupt der Schweinesippe, hatte Riemenschneider gut überstanden. Nachdem er sie genug beschnuppert, als ungefährlich und annähernd rassengleich eingestuft hatte, trollte er sich zur Seite und begann betont lässig, mit seinem Rüssel im Waldboden zu wühlen. Das war nun das Signal für die restlichen Familienmitglieder, den rosa Zaungast auch einmal etwas näher zu betrachten. Riemenschneider für ihren Teil hatte ihre anfängliche Zurückhaltung aufgegeben, sie steckte ihren kleinen Kopf durch das Gatter und begann lebhaft zu grunzen. Die Botschaft schien anzukommen, denn in null Komma nichts war Riemenschneiders Kopf nicht mehr zu sehen, da sie von der wilden Verwandtschaft regelrecht zugedeckt wurde.
Eines der Wildschweine schien besonderen Gefallen an Riemenschneider zu finden. Als die anfängliche Neugier der Sippe befriedigt war und ein Mitglied nach dem anderen wieder seinen üblichen Geschäften nachging, blieb dieses eine, immerhin mehr als doppelt so große Wildschwein auch weiterhin bei Riemenschneider und herzte seine Artgenossin nach allen Regeln der Kunst.
»Ist das nicht süß?«, riefen Eleonore und Honeypenny unisono, als sie die Zuneigungsbekundungen auf beiden Seiten des Zaunes wahrnahmen. Die beiden Schweinchen waren derart intensiv miteinander beschäftigt, dass sie allmählich von einer warmen Dunstwolke eingehüllt wurden, die ihre warmen, erregten Körper abzusondern schienen.
»Kann es sein, dass sich unsere Riemenschneiderin einen Liebhaber geangelt hat?«, fragte Eleonore Suckfüll lachend.
Marina Hoffmann schaute erst etwas genauer hin. Dann ging auch ihr ein Licht auf. Na klar, ihr kleiner Schützling war in den Jahren ihrer gluckenhaften Fürsorge natürlich nie mit irgendwelchen gegengeschlechtlichen Artgenossen zusammengekommen. Aber Riemenschneider war schon lange erwachsen, auch wenn man das ob ihres kleinen Wuchses nicht sofort vermutete. Jetzt hatte sie offensichtlich das heiligste aller Gefühle in sich entdeckt, wie schön.
»Und ob. Einen kernigen Naturburschen, der vor Männlichkeit nur so strotzt«, meinte Marina Hoffmann begeistert. »Na, so etwas würde mir für ein erstes Date auch gefallen.«
Kichernd und glucksend betrachteten die beiden gereiften Frauen das zärtliche Liebesspiel zwischen den Brettern – bis Lagerfelds nüchterner, höchst ungelegen kommender Kommentar sie auf den Boden der Tatsachen zurückholte.
»Also ich sag’s ja nur ungern, Mädels. Aber das da auf der anderen Seite ist kein kleiner, wilder Eber, der vor Männlichkeit strotzt, das ist überhaupt kein männliches Schwein. Dazu fehlen ihm zentrale Gerätschaften zwischen den Hinterbeinen.« Er setzte ein genüssliches Grinsen auf. »Wollte ich nur mal so anmerken.«